Leseprobe
Minderheiten in Indien
Definition Minderheit
Der Begriff der Minderheit wird mehrdeutig verwandt: als allgemeine zahlenmäßig geringere Gruppe, als Gegenbegriff zur Mehrheit (im Hinblick auf repräsentative Körperschaften, Verbände, Parteien); für die Dritte Welt bedeutsam ist jedoch v. a. das Verständnis von Minderheiten als eine beständige Gruppe von Menschen, die sich rassisch, kulturell /- sprachlich/ und/oder religiös-konfessionell von der Mehrheit der Population oder anderen Bevölkerungsteilen eines Landes unterscheiden. Ebenso werden benachteiligte oder sich benachteiligt fühlende gesellschaftliche Gruppen als Minderheit bezeichnet, die rein zahlenmäßig durchaus in der Mehrheit sein können.
Mit den Wäldern sterben die Adivasi Minderheiten im Allgemeinen
Eigentlich müßten in der indischen Gesellschaft, die sich säkular und demokratisch nennt, die Brahmanen und die oberen Kasten eine bedrohte Spezies sein: Sie stellen lediglich etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung. In Wahrheit sorgt aber das Kastensystem, gepaart mit den hartnäckigen Überbleibseln eines Feudalsystems, das auch die anderen Länder des Subkontinents noch weitgehend prägt, zuverlässig dafür, daß die Mehrheitsverhältnisse in ihr Gegenteil verkehrt werden. Es ist die Minderheit der oberen Kasten, die die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit dominiert und die ihre Vorherrschaft erst in letzter Zeit ernsthaft gefährdet sehen muß. (Im indischen Sprachgebrauch verwendet man das Wort ,,Minderheit" durchgehend für die religiösen Minderheiten wie die Muslime oder die Sikh; hier wird der Begriff in einem weiteren Sinne gebraucht.) Die Mehrheit wurde jedoch zur Minderheit gemacht, indem sie in verschiedene Gruppen aufgeteilt wurde: in die unteren Kasten, die Dalit (die ehemaligen ,,Unberührbaren"), die Adivasi (die Nachkommen der indischen Urbevölkerung), ferner in die religiöse Minderheit der Muslime. Man könnte auch Frauen zu den Minderheiten zählen, nicht nur wegen ihrer untergeordneten gesellschaftlichen Stellung, sondern sogar im Wortsinn, weil sie von der Männergesellschaft aus ihrer biologisch zu erwartenden Mehrheitsposition in die zahlenmäßige Minderheit gedrängt wurden. All diese Gruppen bilden zusammen die große Mehrheit, die aber vor allem im Norden des Landes erst jetzt beginnt, ihre numerische Überlegenheit politisch und gesellschaftlich auszuspielen. Das Kastensystem (siehe Seite 151) liefert die ideologische Rechtfertigung für die Vorherrschaft einer privilegierten Minderheit über die benachteiligten Minderheiten, die eigentlich zusammen die Mehrheit bilden.
Frauen und Unberührbare
An zwei gesellschaftliche Gruppen in Indien läßt sich musterhaft die Gleichzeitigkeit von Tradition und Wandel in den sozialen Strukturen aufzeigen: Frauen und Unberührbare. Traditionellerweise wurden beide Gruppen unterhalb der drei ,,reinen" Kasten eingestuft. Für sie gab es keinen direkten Zugang zu Gott.
Aber trotz ihrer ,,Unreinheit" traute man ihnen die Fähigkeit zu, sich im gefährlichen Niemandsland zwischen bekannten, definierten Zuständen zu bewegen etwa dem zwischen Leben und Tod: Angehörige der unteren Kasten werden nach einem Todesfall engagiert, um die Seele des Verstorbenen zu bannen, die möglicherweise auf dem Weg in das Reich der Vorfahren Schaden anrichten könnte. Aus einem ähnlichen Grund vertraut man immer Frauen die Aufgabe an, die jungen Reispflanzen umzusetzen, die sich in einem Zwischenstadium nicht mehr Keim und noch nicht ausgebildete Pflanze befinden. Aber der gesellschaftliche Wandel verändert auch hier das Leben. Er führte beispielsweise auch zur Entstehung der Ad dharmi Bewegung (,,Wahre Religion"), in der viele Menschen eine Lobby gefunden haben, oder der Mahila Mandals, der feministischen Fraktionen innerhalb der politischen Parteien, die sich längst nicht mehr auf warnende Aufrufe an die Männer beschränken. Sie halten der Gesellschaft, in der manchmal heute noch neugeborene Mädchen erstickt werden und Mädchen sich verbrennen, weil sie ungesetzliche Mitgiftforderungen nicht erfüllen können, den Spiegel ihrer Brutalität vor Augen
Die Adivasi
In ihrer Existenz bedroht sind in diesem System vor alle die Adivasi, die letzten Nachfahren der indischen Urbevölkerung, die den Subkontinent vor der Einwanderung der Arier bewohnten. Die Adivasi, die im indischen Sprachgebrauch auch ,,tribals", Angehörige von Stammesvölkern, genannt werden, machen immerhin rund 7,5 Prozent der Bevölkerung aus, also etwa 60 bis 70 Millionen. Sie laufen aber zunehmend Gefahr ihre kulturelle Identität zu verlieren. Die offizielle Statistik zählt zum Beispiel diese Völker, die ihre eigenen Religionen haben oder bis vor kurzem noch hatten, ganz einfach als Hindu.
Die Adivasi befinden sich in jeder Hinsicht auf dem Rückzug, seit um 1500 vor unserer Zeitrechnung die ersten Arier von den fruchtbaren Ebenen des Indus und der Ganga Besitz ergriffen, besonders aber, seit das moderne, unglaublich dynamische, aber auch zerstörerische Indien auch die letzten Winkel des Landes mit Beschlag belegt. Zwar zählte der ,,Anthropological Survey of India" 1994 noch 461 Stammesvölker. Aber die Lebensgrundlagen der Adivasi schwinden mit beängstigender Schnelligkeit. Es lag in der Logik der arischen Einwanderung, daß die technisch überlegenen Neuankömmlinge die unterlegenen Ureinwohner aus den fruchtbarsten Gegenden wie zum Beispiel der Gangesebene verdrängten. So lebten die Adivasi in immer abgelegeneren Hügelgebieten; nur hier konnten sie noch von ihrer eigentlichen Lebensgrundlage existieren, nämlich vom Wald und von der unberührten Natur. Heute vollenden der Bevölkerungsdruck und die moderne Wirtschaftsentwicklung das Werk der arischen Einwanderer. In den letzten Siedlungsgebieten der Adivasi werden Naturschätze ausgebeutet. Die letzten Wälder werden abgehackt. Adivasi müssen in großem Umfang Stauseen zur Produktion von Elektrizität und zur Bewässerung für die moderne Landwirtschaft weichen. Eine wachsende Schar von Landlosen und Kleinstbauern dringt auf der Suche nach Land in die Gebiete der Adivasi vor. Die Adivasi spüren als erste die Folgen der raschen Schrumpfung der natürlichen Lebensgrundlagen, wie sie in ganz Indien festzustellen ist. Ihr Schicksal, das eng mit dem Schicksal der Natur verknüpft sind, müßte eigentlich als deutliches Warnsignal für den Rest der Bevölkerung dienen. Wie es den Adivasi ergeht, wird es auch den Bauern und später selbst den Städtern ergehen, wenn Indien auf der begreiflichen Suche nach mehr Wohlstand nicht aufhört, Luft, Böden und Wasser in lebensbedrohender Weise zu vergeuden. Die Art und Weise, wie sich die indische Gesellschaft über das Existenzrecht der Adivasi hinwegsetzt, zeigt auch, wie sie mit der Natur umgeht und dieser Umgang mit der Natur wird nicht ohne Folgen bleiben
Die Adivasi wissen: Wenn ich leben soll, muß auch die Natur leben. Deshalb hat sich über Jahrhunderte eine Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit von Natur und Mensch entwickelt, die sich auch in der Religion zeigt. Die Beziehung zur Natur wird symbolisch ausgedrückt durch religiöse Verehrung für Bäume. Oder ein Berg wird verehrt als Beschützer der Ernte und der wilden Tiere für die Jagd, er wird von einer toten Sache . zu einem lebendigen Wesen. Indem sie diese Dinge mit Leben versehen, haben die Adivasi ihr eigenes Leben auf die Natur: ausgedehnt. Das erklärt die Abhängigkeit der Stammeskultur von der Umwelt.
Kultur und Religion
Mit der Natur verschwanden auch die alten Götter. Der Wald ist der Ort, wo die Gottheiten wohnen, und ohne Wald kann die althergebrachte Religion ebensowenig überleben wie die traditionelle Heilkunst, nachdem die Heilkräuter verschwunden sind. Fragt man Kacharu heute nach seiner Religion, sagt er: ,,Wir sind Hindu." Etwa die Hälfte der Adivasi in der Gegend von Mada bekennt sich inzwischen zum Hinduismus, zur Religion der dominierenden Gesellschaftsschicht, die sie vor 30 Jahren von einem Hindu-Wandermönch übernahm. Der Verlust der eigenen Religion und vor allem die Übernahme der Religion des Unterdrückers unterstreicht erst recht den Verlust der eigenen Identität. Er ist ein Zeichen für die innere Kolonisierung der Adivasi durch die Hindu-Mehrheit, die keinerlei Zweifel an der Überlegenheit ihres Glaubens und ihrer Kultur hegt.
Soweit sich die Vertreter der Mehrheit im Land überhaupt für das Schicksal der Adivasi interessieren, halten sie es fraglos für richtig, die ,,rückständigen" Stammesvölker auf das eigene Niveau ,,anzuheben" und mit der eigenen Kultur zu beglücken. Die Adivasi werden ,,sanskritisiert", was man, weil Sanskrit nicht nur die Sprache meint, sondern Kultur überhaupt, mit ,,zivilisiert" übersetzen muß. Selbst dort, wo solcher Paternalismus gutgemeint ist, geschieht die gesellschaftliche Integration nicht zum Vorteil der Adivasi: Ihnen wird ein Platz ganz zuunterst in der Kastenhierarchie zugewiesen, auf der Stufe der kastenlosen Dalit.
Das Megaprojekt Narmada (Staudammbau) wird viele Adivasi heimatlos machen. Der Flußlauf der Narmada ist eines der letzten zusammenhängenden Rückzugsgebiete der Natur.
Immerhin sprechen die Bhil von Südrajasthan noch ihre eigene Sprache, die mit Hindi nichts gemeinsam hat. Und die Leute haben sich ihr Zusammengehörigkeitsgefühl bewahrt. ,,Wenn ein Adivasi-Dorf in Schwierigkeiten gerät, werden ihm tausend Dörfer zu Hilfe kommen", sagt Kacharu. In der weitgehend egalitären Adivasi-Gesellschaft hilft man sich gegenseitig; zu den Kosten einer Hochzeit oder einer Beerdigung trägt das ganze Dorf bei, und das Dorf schlichtet auch Schwierigkeiten zwischen und in den Familien. Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl heraus sind im Süden von Rajasthan zahlreiche Gruppen von Adivasi entstanden, die aus eigener Initiative einen Ausweg aus der verzweifelten Situation suchen. Frauen wie Männer bilden zum Beispiel Sparklubs, die mit ganz kleinen Beiträgen ein Kapital aufbauen, aus dem die Mitglieder in Notfällen ein Darlehen beziehen können. Das vermeidet die traditionelle Abhängigkeit vom Geldverleiher, der zehn Prozent Zinsen im Monat nimmt, und demonstriert den Leuten, daß es durchaus in ihrer Macht liegt, etwas gegen die sozialen Mißstände zu unternehmen. Sie beginnen, sich für ihre Rechte, aber auch für die Rechte der Natur einzusetzen.
Beispiel
Ein Beispiel für die ökologische und soziale Gefährdung der Adivasi, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt, ist. das Schicksal einer Adivasi-Gruppe vom Volk der Bhil, die in der Nähe des Ortes Mada im Süden von Rajasthan siedelt; Diese Leute erlebten innerhalb einer einzigen Generation den Kollaps ihrer Lebensgrundlagen und die sozialen Folgen davon. ,,Noch vor 25 Jahren war hier alles Wald", sagt Kacharu, ein lokaler Führer der älteren Generation. ,,So dicht war der Wald, daß man kaum darin herumlaufen konnte. Auf den Talböden hatten wir zwei Ernten, ohne daß wir bewässern mußten. Der Wald verhinderte, daß die Sonnenstrahlen direkt auf den Boden fielen, Blätter und Gras hielten die Feuchtigkeit zurück. Heute trocknet der Boden sofort nach den Monsunregen aus, das Land gibt immer weniger her. "Man glaubt es kaum, daß der Süden von Rajasthan noch vor einer Generation zum größten Teil bewaldet gewesen sein soll, Heute sieht es hier aus wie im afrikanischen Sahel. Die Hügel sind baumlos und kahl, so weit das Auge reicht. Die Humusschicht ist vielerorts völlig abgetragen, auf anderen Hügeln wächst noch etwas Gras, das aber nur nach der Regenzeit trügerisch grün wird, bevor Ziegen, Schafe und anderes Vieh es abfressen. Die Natur im Siedlungsgebiet der Adivasi in Südrajasthan ist weiträumig zerstört, und mit der Natur gingen auch die Lebensgrundlagen der Menschen verloren. ,,Früher gab es hier mehr als genug zu essen", berichten die Leute. ,,Nach guten Regenjahren lebten wir von unseren Äckern, in schlechten Jahren gingen wir einfach in den Wald, wo es Früchte gab und Wurzeln wie die wilde Kassava. Aber heute reicht nur noch für drei Monate, was wir auf unseren Äckern produzieren. Überall herrscht Mangel." Um überleben zu können, müssen die jungen Leute im Jahr für sechs bis acht Monate nach Gujarat oder Maharashtra ziehen und als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft oder auf dem Bau arbeiten, für eine Mark oder etwas mehr am Tag. Aus den Adivasi Südrajasthans, deren letzte Generation sich noch selbst mit dem Lebensnotwendigen versorgen konnte, sind abhängige, verelendete Wanderarbeiter geworden.
Die dramatische Entwicklung im Süden von Rajasthan zeigt auf eindrückliche Weise, wie das moderne Indien, angetrieben von einem unbändigen Fortschrittswillen und von einem ebenso unbändigen Bevölkerungswachstum, nach den letzten Rückzugsgebieten der Stammesbevölkerung greift. Eigentlich hatte die verhängnisvolle Entwicklung in der Gegend von Mada damit begonnen, daß der Wald, der traditionelle Besitz der Adivasi, zum Staatsbesitz erklärt wurde. Die Adivasi, die den Wald maßvoll und nachhaltig nutzten und sozusagen als seine integralen Bestandteile agierten, verloren das Interesse an einem Wald, an dem sie keine Nutzungsrechte mehr hatten. Als die Regierung auswärtigen Holzfirmen Lizenzen zum Schlagen der besten Bäume gab, begannen auch die Adivasi, Bäume zu fällen, Holzkohle herzustellen und in den Städten zu verkaufen. ,,Damals gab es auch eine mehrjährige Dürre", entschuldigt Kacharu das Verhalten seiner Leute, ,,der Verkauf von Holzkohle und Brennholz war das einzige Mittel zum ,,Überleben." Danach ging alles sehr schnell: Als das empfindliche Ökosystem Wald einmal angeschlagen war, folgte der ökologische Zusammenbruch auf dem Fuß.
,,Früher brauchte man praktisch kein Geld zum Leben, nur alle paar Monate einmal ging man in die Stadt", sagt Kacharu.
,,Aber heute hängt alles vom Geld ab." Die Ablösung der althergebrachten Subsistenzwirtschaft durch die moderne Geldwirtschaft ist zweifellos der eigentliche Grund für den ökologischen Kollaps in Südrajasthan. Die Bedürfnisse der Menschen wurden unter dem Einfluß des ,,fortschrittlichen", städtischen Indien zunehmend monetarisiert, und der Wald war das einzige, was die Adivasi in Form von Holzkohle verkaufen konnten. Dazu kam der Holzbedarf der rasch wachsenden Bevölkerung außerhalb des Adivasi-Gebiets und der sich entwickelnden Industrie. Unmengen von Holz frißt das Brennen von Backsteinen für den Bau moderner Häuser. All das führte schließlich in rasantem Tempo zur Zerstörung der Lebensgrundlage Wald.
Die Katastrophe ist statistisch belegbar.1947, als Indien unabhängig wurde, war die Gegend von Mada noch zu 60 Prozent mit Wald bedeckt, heute nur noch zu vier Prozent. Die Folge war eine Klimaveränderung: Regnete es um 1947 an durchschnittlich 120 Tagen im Jahr 1200 Millimeter, so sind es heute nur noch 600 Millimeter an 40 Tagen. Ein Drittel des Landes besteht nur noch aus Felsen und Steinen, der Humus ist für alle Zeiten weggeschwemmt, hinunter auf die Felder der reicheren Bauern in der Ebene. Doch nicht nur die Umwelt geht verloren, sondern auch die eigene Volkskultur. Die Abwesenheit der jungen Leute während mehr als der Hälfte des Jahres unterhöhlt das Gemeinschaftsleben, das für die Adivasi so wichtig ist. Kacharu beklagt sogar den Verlust der Tugend der Töchter von Mada: Auch sie. müssen in die Stadt, und die Männer dort versuchen sich den: Umstand zunutze zu machen, daß der Umgang zwischen den Geschlechtern bei den Adivasi weniger prüde ist als bei der Hindu-Mehrheit.
Nomaden allgemein
Komal Kothari, ein anerkannter Spezialist für die Völker Rajasthans, unterscheidet drei Arten von Nomaden: die Banjara oder Händler, deren Aufgabe von alters her der Transport war, die Jogi, die wie früher bei uns die ,,Zigeuner" oder Roma als Scherenschleifer oder Kesselflicker der seßhaften Bevölkerung spezifische Dienstleistungen anbieten, und schließlich die Hirtenvölker, die mit Ziegen, Schafen, Rindern und Kamelen in der Halbwüste herumziehen. Sie alle haben dasselbe Problem: Ihnen fällt es schwer, in dem sich rasch verändernden Indien, das auf die Bedürfnisse seiner Stammesvölker am allerwenigsten Rücksicht nimmt, eine neue Existenzgrundlage zu finden.
Die Jogi
Die Jogi waren ursprünglich Jäger und Sammler, Adivasi eben, aber sie wurden schon vor Generationen Opfer. des von den Menschen verursachten Waldsterbens in Nordindien. Später wurden sie Spezialisten für die Herstellung von Bestandteilen der Handwebstühle, doch auch diese Tätigkeit wird immer mehr überflüssig. Heute fertigen die Kabelia, die von den Briten wie die Banjara zu den kriminellen Stämmen gezählt wurden, Körbe und Getreidemühlen aus Stein, Sie müssen sich mit Tagelöhnerarbeiten über Wasser halten, und oft bleibt nur das Betteln.
Die Hirtenvölker
Am meisten haben aber die Hirtenvölker unter den veränderten Bedingungen und der übernutzten Natur zu leiden. ,,Früher hättest du die Hügel da hinten gar nicht sehen können, so viel Wald gab es damals", erzählt Bhuraram vom Volk der Devasi, den wir zu seinen Leuten in Bera,160 Kilometer südöstlich von Jodhpur, begleiten. Der Wald diente als Weide für die Ziegen und Schafe der Menschen, Wild und Früchte ergänzten die Ernährung. ,,Früher war der Wald einfach eine Selbstverständlichkeit", sagt Bhuraram. ,,Überall gab es Wald, und jetzt gibt es nur noch kahle Hügel."
Die Hauptschuld am Waldsterben, so meint auch Bhuraram, trifft nicht die lokale Bevölkerung, sondern die Holzfirmen aus der Stadt, die, mit Lizenzen der Regierung ausgestattet, den Wald ausbeuteten und abholzten. Darauf wurde das neugewonnene Land, das früher Allgemeingut gewesen war, privatisiert; auswärtige Bauern ließen sich nieder, wo einmal Wald und Weide gewesen waren. Früher gab es eine sinnvolle Symbiose zwischen Bauern und Nomaden. Das Vieh der Nomaden weidete auf den abgeernteten Feldern, und während es die langen Stengel des Jowar (eine Hirseart) fraß, düngte es gleichzeitig den Boden. Aber mit der Modernisierung der Landwirtschaft, mit der künstlichen Düngung und insbesondere mit der. Bewässerung, die eine zweite Ernte zuläßt, ergab sich aus der gegenseitigen Ergänzung eine Konkurrenzsituation.
Die Kondh leben in einer engen Symbiose mit den Pano, die Adivasi als Herren, die Dalit als Diener. Bis vor kurzem nahm sich ein Kondh immer seinen Pano mit, wenn er zum Beispiel mit den Behörden in Phulbani zu tun hatte. Die Pano sprachen Oriya, die Verwaltungssprache, sie waren die Vermittler zur Außenwelt. In ökonomischer Hinsicht waren die Dalit aber vollständig abhängig von ihren Herren.
Noch heute wohnen die Dalit außerhalb der Kondh-Dörfer. Obwohl die Adivasi traditionell nichts mit dem hinduistischen Kastensystem zu tun haben und selber in der sozialen Hierarchie ganz unten stehen, praktizieren sie den Pano gegenüber bis heute die Unberührbarkeit. Sie essen nicht zusammen, und die Pano müssen getrennt von ihnen wohnen.
Kein Platz mehr für die Nomaden
Auch von den vielen farbenfrohen Nomadenvölkern, die, ebenfalls in Rajasthan, in und am Rand der Wüste Thar leben, zählen die meisten zu den ,,tribals", den Stammesvölkern. Sie haben je eine eigene Kultur, Wirtschaftsform und soziale Organisation, die an die harten Lebensbedingungen in der Wüste und Halbwüste angepaßt sind. Doch die Ausbreitung der seßhaften, bewässerten Landwirtschaft, die Privatisierung des Bodens, das Verschwinden traditioneller Handwerksberufe und vor allem die rapide Abnahme der natürlichen Lebensgrundlagen unterhöhlen auch ihre althergebrachte Lebensweise. Ganze Völker suchen nach einer neuen Nische zum Überleben, viele sind verarmt und werden nur noch durch die starken Bande der Gemeinschaft und ihrer Kultur zusammengehalten.
Die Banjara
Zu den stolzesten Völkern der Wüste gehören zweifellos die Banjara, die - sprachliche Ähnlichkeiten weisen darauf hin - als Vorfahren unserer ,,Zigeuner" oder Roma gelten. Sie sind in ganz Indien zu finden und zählen mehrere Millionen Menschen. Sie zeichnen sich aus durch eine besondere Tracht und vor allem durch den reichen Silber und Elfenbeinschmuck der Frauen, der heute allerdings langsam durch Aluminium und Plastik ersetzt wird. Zum Teil sprechen die Banjara bis heute ihre eigene Sprache; sie haben spezielle Bräuche und religiöse Sitten.
,,Früher waren wir ein großartiges Volk", rühmt sich eine alte Banjara-Frau vom Clan der Baldiabhatt. ,,Wir hatten große Karawanen mit Ochsenkarren, mit denen wir Salz und andere Güter transportierten. So großartig waren wir, daß wir einen Trommler vorausschickten, um in den Dörfern unsere Ankunft. anzukündigen." Als junges Mädchen habe sie das noch miterlebt, sie erinnere sich genau. Aber in den letzten zwei, drei Generationen sind die Banjara brotlos geworden. Ihr Beruf - der Transport und Verkauf von Waren an die seßhafte Bevölkerung -- wurde von Lastwagen übernommen; das moderne Transportsystem brachte die Banjara um ihre Lebensgrundlage. Die Familie der Frau, die so beredt von den guten alten Zeiten schwärmt, hat sich freilich gut an die neuen Verhältnisse angepaßt: Sie ist seßhaft geworden und lebt von der Landwirtschaft. Der Besitz eines Traktors zeugt von einem gewissen Wohlstand. Andere Banjara machen von ihren Kenntnissen der nomadischen Lebensweise Gebrauch und verdienen als Viehhändler ihr Auskommen. Sie bringen beispielsweise männliche Wasserbüffel aus Weizenanbaugebieten, wo sie keine Verwendung finden, in Reisanbaugebiete, wo der männliche Büffel in den überschwemmten Feldern zum Pflügen eingesetzt wird. Doch viele Banjara sind verarmt. Sie leben zum Beispiel als Tagelöhner auf dem Bau, und viele sind in Schuldknechtschaft geraten.
In dem Dorf Ajitpura im Distrikt Alwar begegnen wir einer großen Gruppe Banjara, die seßhaft geworden sind und etwas Landwirtschaft betreiben. Die Arbeit in den nahen Steinbrüchen bringt ein wenig Bargeld; ein zehnjähriger Junge zum Beispiel verdient dort etwa 30 Pfennige am Tag. Ein paar ältere Männer sind immer noch im Salzhandel tätig, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß als früher. Sie holen das Salz am Salzsee von Sambhar bei Jaipur und bringen es zu den Bauern, die dieses Salz für das Vieh dem Meersalz vorziehen. Das geht so: Die Banjara-Händler kaufen das Salz und tauschen es gegen Weizen oder Bajra, Perlhirse. Für drei Kilo Salz gibt es ein Kilo Getreide, das sie zum Teil selber konsumieren und zum Teil weiterverkaufen. Die Leute rechnen vor, daß sie am Tausch von Salz gegen Getreide etwa eine Mark pro 100 Kilo Salz verdienen.
Die Banjara von Ajitpura erweisen sich als überaus offen und gastfreundlich. Unaufgefordert bringen sie den alten Schmuck, den bei festlichen Gelegenheiten auch die Männer tragen, und eine ganze Sammlung von Waffen, zerbeulte Schilde, Streitäxte, Wurfkeulen und Lathi, mit Silberdraht umwickelte Stöcke. ,,Wir können sehr gewalttätig sein", sagen sie. ,,Von der Polizei halten wir nichts. Wir regeln Streitigkeiten unter uns." Mit Stolz führen sie uns ein Kamel vor, das von brandschwarzer Farbe ist und das sie festlich mit Bändern und Glitzerzeug geschmückt haben.
Der Silberschmuck der Frauen kann bei den Banjara mehrere Kilo wiegen. Für die Nomaden hat Schmuck die Funktion eines Bankkontos, auf dem man für Notzeiten seine Ersparnisse deponiert, nur daß der Schmuck gegen die Ungewißheiten der Inflation besser schützt. Aber zu meiner Frau sagen die Banjara-Frauen: ,,Du mußt nicht glauben, daß wir reich sind und ein schönes Leben führen, bloß weil wir so viel Schmuck haben. Wir arbeiten genauso hart in den Steinbrüchen wie die Männern nur bekommen wir dafür weniger bezahlt."
Maurnath ist der Chef der Kalbelia Jogi, ein überaus hilfreicher Mann, der uns bereitwillig zu einigen Gruppen seiner Leute führt.
Die Jogi
Die Jogi waren ursprünglich Jäger und Sammler, Adivasi eben, aber sie wurden schon vor Generationen Opfer. des von den Menschen verursachten Waldsterbens in Nordindien. Später wurden sie Spezialisten für die Herstellung von Bestandteilen der Handwebstühle, doch auch diese Tätigkeit wird immer mehr überflüssig. Heute fertigen die Kabelia, die von den Briten wie die Banjara zu den kriminellen Stämmen gezählt wurden, Körbe und Getreidemühlen aus Stein, Sie müssen sich mit Tagelöhnerarbeiten über Wasser halten, und oft bleibt nur das Betteln.
Wir treffen eine Gruppe von Maurnaths Leuten, die ein paar. Esel für gelegentliche
Kleintransporte ihr eigen nennt. In der Nähe von Jodhpur haben sie im Freien ein provisorisches Lager errichtet. Ihre ganze Habe hat auf einem Charpai Platz (traditionelles indisches Bett aus einem Holzrahmen und geflochtenen Schnüren). Hunde bewachen den ansonsten frei herumstehenden Hausrat. Die Jogi sind Spezialisten für Hunde, und obwohl es nichts mehr zu jagen gibt, gehört der Hund immer noch zur Mitgift. ,,Sonst würde es heißen, ihr habt uns nicht einmal einen Hund gegeben", sagen die Leute. Die Jogi sind hervorragende Kenner der traditionellen Medizin, doch auch das ist nicht mehr so gefragt, und die Heilkräuter findet man mit dem Verschwinden der Natur immer weniger. Auch mit Schlangen kennen sich die Jogi aus, und das gibt der Bettelei, von der sie teilweise leben, eine ganz andere Bedeutung. ,,Eigentlich kann man das nicht betteln nennen", sagt Komal Kothari. ,,Die Jogi sind so etwas wie Priester der Schlangengöttin. Wenn sie mit ihren Schlangen von Dorf zu Dorf ziehen, ist das wie eine religiöse Dienstleistung, für die sie von den Leuten mit Nahrungsmitteln entschädigt werden." Trotz ihrer Armut und trotz der schlechten neuen Zeiten halten die Kabeliaim Unterschied zu den Banjara ein ganz kleines Volk mit nur etwa 20 000 bis 25 000 Angehörigen eng zusammen. Sie tragen immer noch ihre Kostüme fürs Singen und Tanzen mit sich. ,,Wir respektieren unsere Kultur", sagt Maurnath, ,,niemand von uns will dieses moderne westliche Zeug, das im Fernsehen angepriesen wird. Wir bleiben zusammen, und mit dem Rest der Leute haben wir wenig zu tun. Wir kennen eigentlich nur unseren Stamm." Kaum ein Jogi ist je zur Schule gegangen, und von seinen zwei Jungen sagt Maurnath:
,,Wenn ich sie in die Schule schicken will, hauen sie ab und verstecken sich, und sogar wenn ich sie schlage, sagen sie nur: Warum denn ausgerechnet ich!"
Maurnath ist sich sehr bewußt, daß die Schwierigkeiten seiner Leute zuallererst mit den schwindenden natürlichen Lebensgrundlagen zu tun haben: ,,Obwohl wir am Rand der Wüste wohnen, spüren wir die verheerenden Auswirkungen der Abholzung. "
Die Hirtenvölker
Am meisten haben aber die Hirtenvölker unter den veränderten Bedingungen und der übernutzten Natur zu leiden. ,,Früher hättest du die Hügel da hinten gar nicht sehen können, so viel Wald gab es damals", erzählt Bhuraram vom Volk der Devasi, den wir zu seinen Leuten in Bera,160 Kilometer südöstlich von Jodhpur, begleiten. Der Wald diente als Weide für die Ziegen und Schafe der Menschen, Wild und Früchte ergänzten die Ernährung. ,,Früher war der Wald einfach eine Selbstverständlichkeit", sagt Bhuraram. ,,Überall gab es Wald, und jetzt gibt es nur noch kahle Hügel."
Die Hauptschuld am Waldsterben, so meint auch Bhuraram, trifft nicht die lokale Bevölkerung, sondern die Holzfirmen aus der Stadt, die, mit Lizenzen der Regierung ausgestattet, den Wald ausbeuteten und abholzten. Darauf wurde das neugewonnene Land, das früher Allgemeingut gewesen war, privatisiert; auswärtige Bauern ließen sich nieder, wo einmal Wald und Weide gewesen waren. Früher gab es eine sinnvolle Symbiose zwischen Bauern und Nomaden. Das Vieh der Nomaden weidete auf den abgeernteten Feldern, und während es die langen Stengel des Jowar (eine Hirseart) fraß, düngte es gleichzeitig den Boden. Aber mit der Modernisierung der Landwirtschaft, mit der künstlichen Düngung und insbesondere mit der. Bewässerung, die eine zweite Ernte zuläßt, ergab sich aus der gegenseitigen Ergänzung eine Konkurrenzsituation. Die Devasi gehören wohl zu den schönsten Menschen, denen man begegnen kann. Nicht nur die Frauen sind reich geschmückt. Auch die Männer tragen kostbare Halsbänder und Halsketten. Die jungen Männer haben einen phantastisch großen, roten Turban aus einer langen, gerollten Stoffbahn um den Kopf geschlungen, ,,aber wenn die Haare grau werden, wird der rote Turban weiß", erklärten uns die Leute. Ein weißes Hemd, darüber ein weißes Jäckchen und ein schwungvoll um die Hüfte gebundenes Tuch vervollständigen die Tracht. Die Devasi sind jederzeit als solche zu erkennen. Ihre einmalige Kleidung und vor allem der gewaltige Turban sind Symbole für eine eigene Kultur und für einen starken Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Die wirtschaftlichen und ökologischen Grundlagen ihres Volkes sind weitgehend geschwunden; geblieben ist die traditionelle Sozialstruktur und insbesondere der starke Wille, zusammenzubleiben. Ob das auf Dauer zum Überleben ausreicht? ,,Wenn die Regierung uns helfen würde, die Hügel wieder zu begrünen, würden wir sorgfältiger mit dem Wald umgehen", meint Bhuraram. Aber die Regierung ist anderweitig beschäftigt. Zuallerletzt denkt sie daran, sich für die in Not geratenene ,,tribals" zu engagieren, die in den Augen des modernen Indien ohnehin überflüssig sind, zum Aussterben verurteilt, höchstens den Fortschritt behindernd.
Narmada: Die Vertreibung der Urbevölkerung
Das Megaprojekt Narmada (Staudammbau) wird viele Adivasi heimatlos machen. Der Flußlauf der Narmada ist eines der letzten zusammenhängenden Rückzugsgebiete der Natur.
Das Dorf Vadgam an der Narmada, einem von Indiens Flüssen, existiert nicht mehr. Als erstes versank es im Monsun des Jahres 1993 in den Fluten des riesigen Staudamms, den Indien ungeachtet einer nationalen und internationalen Protestwelle hochziehen will.
Wir hatten Vadgam als friedliches, fast idyllisches Dorf kennengelernt, als der Mammutbau noch in der Anfangsphase steckte. Die mit selbstgemachten Ziegeln gedeckten Häuser der Adivasi, die auch dem Kleinvieh Platz boten, waren geräumig, fast stattlich. Der blitzsaubere Boden war sorgfältig mit einem Gemisch aus Stroh und Kuhmist verputzt, das sich fast wie ein Teppich anfühlte. Üppig rankende Kürbisgewächse spendeten Schatten und Kühle, als wir mit den Leuten auf den traditionellen Charpais saßen, Tee tranken und über die Zuerde des Dorfes sprachen. Vadgam mag ein armes Dorf gewesen sein, aber elend war es nicht. Die Leute hatten zu leben, und das Dorf war irgendwie schön, es hatte Lebensqualität. Die Leute von Vadgam hatten immerhin für ihr Land Entschädigung erhalten.1400 Mark hatte ihnen die Regierung pro Hektar auf ein Bankkonto eingezahlt. Man hatte ihnen sogar in der Nähe von Baroda, weiter nördlich, Land gezeigt, das sie hätten kaufen können - nur wäre es siebenmal teurer gewesen als die Regierungsentschädigung. So oder so wollten sich die Leute auch für Geld nicht vertreiben lassen. Sie wußten, daß sich ihre dörfliche Gemeinschaft nicht einfach würde verpflanzen lassen. ,,Wir werden uns trennen müssen", sagten sie.
Seither ist das Wasser im riesigen Stausee ständig höher gestiegen, und immer mehr Dörfer sind in ihrer Existenz bedroht. Das Mega-Projekt Narmada - der ganze 1400 Kilometer lange Flußlauf soll mit rund 3000 Dämmen gezähmt und für den Menschen nutzbar gemacht werden - beraubt im großen Stil die Adivasi-Bevölkerung am Fluß ihrer Existenzgrundlage. Je nach Rechnung - genaue Angaben sind auch heute noch nicht erhältlich - sollen bis zu einer Viertelmillion Menschen vertrieben werden. Die meisten von ihnen sind Adivasi, denn der Lauf der Narmada ist auch eines der letzten zusammenhängenden Rückzugsgebiete der Natur, die Indien geblieben sind, und damit einer der letzten großen Lebensräume für Indiens Ureinwohner. Kritiker zögern deshalb nicht, angesichts der Größe des Projekts und seiner sozialen Folgen von ,,Völkermord" an den Adivasi zu sprechen. Sollte das gesamte Projekt zur Ausführung kommen - woran auch Fortschrittsoptimisten immer mehr zweifeln -, so werden an der Narmada 144000 Hektar Land überschwemmt; das ist fast die dreifache Fläche des Bodensees. Mehr als 50000 Hektar davon sind fruchtbares Kulturland, ebensoviel ist Wald, der in Indien immer rarer wird. Doch allein schon der im Bau befindliche Sardar-Sarovar-Damm, das erste Teilprojekt mit einer 150 Meter hohen Staumauer, wird 37000 Hektar Land überschwemmen. 500 Dörfer sollen ganz einfach verschwinden.
Die Regierung wird nicht müde, die Vorteile des Projekts anzupreisen. Mit den Dämmen an der Narmada soll das Flußwasser, das sich bisher ,,nutzlos" in das Arabische Meer ergoß, für die Landwirtschaft genutzt werden. Mit einem 450 Kilometer langen Hauptkanal soll der Fluß, der in seiner Größe mit dem Rhein vergleichbar ist, nach Gujarat und bis nach Rajasthan umgeleitet werden. 30 Millionen Menschen soll die umgeleitete Narmada sauberes Trinkwasser bringen. Und Tausend von Bauern im Gliedstaat Gujarat soll sie die Felder bewässern. 20 Millionen Menschen, so eine futuristisch anmutende Schätzung, sollten dadurch zusätzlich ernährt werden können. Sardar Sarovar sollen dazu noch 1500 Megawatt Elektrizität installiert werden.
Diese Vorteile sind mehr als eine hinreichende Rechtfertigung für die Zerstörung von etwas Natur und die Vertreibung von ein paar Zehntausend Menschen, meint das moderne technokratische Indien in seinem immer noch ungebrochen Machbarkeitswahn. Doch gegen das Dammprojekt erhob sich auch breiter Widerstand in der indischen Öffentlichkeit. Die herausragenden Figuren dieses Widerstands sind Baba Amte und Medha Patkar: er der große alte Mann unter Indiens Sozialarbeitern, sie eine um eine Generation jüngere, wortgewaltige und bis zur Selbstaufgabe überzeugte Symbolfigur des Protests gegen die Narmada-Pläne. Beide stehen für das Engagement und auch den Einfluß nichtstaatlicher Institutionen und Bewegungen, die sich in Indien immer wieder sozialer und auch ökologischer Probleme annehmen.
Baba Amte sieht seinen Kampf für die Narmada als symbolisches Beispiel für eine ,,Entwicklung mit menschlichem Gesicht". Für ihn ist dieser Kampf der Zusammenstoß zweier gänzlich gegensätzlicher Entwicklungskonzepte: hier die Entwicklung der Menschen in Eintracht mit der Umwelt, dort technokratische Modernisierung mit all ihren Zerstörungen. Es ist der Kampf zwischen Bedürfnis und Gier, der nackte Hunger nach Größe, der Überfluß für wenige statt ein Auskommen für alle. Und Baba Amte erinnert an Mahatma Gandhi, der sagte, daß genug da sei für die Bedürfnisse von allen (everybody's need), aber nicht genug für die Gier von allen (everybody's greed). Zuvor waren wir Baba Amte und Medha Patkar, den Führern der Bewegung ,,Rettet die Narmada" (Narmada Bachao Andolan Das Mega-Projekt an der Narmada steht für einen allgemeinen Trend. Indiens Entwicklung läuft darauf hinaus, einer Minderheit der Bevölkerung, höchstens einem Drittel, Zugang zu dem mit dem Westen vergleichbaren Konsumniveau zu verschaffen. Der Preis dafür ist, daß eine Mehrheit der Bevölkerung aus dem Modernisierungsprozeß als überzählig herausfällt. Der Fortschritt hat keinen Platz für die ärmeren Bevölkerungsschichten, deren Existenz zunehmend nur noch als Ärgernis empfunden wird. Es läßt sich statistisch nachweisen, daß das Narmada-Wasser aus ärmeren Distrikten in reichere Distrikte umgeleitet wird.
Die armen Adivasi entlang dem Flußlauf müssen ihre Lebensgrundlage aufgeben zugunsten von wohlhabenderen Bauern, die zwar eine immer noch rasch wachsende Bevölkerung ernähren, die aber im Begriff sind, mit ihren modernen Produktionsmethoden die natürlichen Grundlagen, auf denen die Nahrungsmittelproduktion basiert, zu zerstören. Gujarat hat in der Tat ein lebensbedrohendes Problem: Der Grundwasserspiegel ist gerade in den landwirtschaftlich intensiv bewirtschafteten Gegenden bedenklich abgesunken, weil ohne Rücksicht auf das Wiederauffüllen der Wasserreserven bewässert wurde. In Meeresnähe droht das Grundwasser gar zu versalzen, weil der abgesenkte Grundwasserspiegel sich mit Salzwasser auffüllt.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß Gujarat das Wasser der Narmada deshalb so dringend braucht, weil es seine eigenen Wasserreserven in kürzester Zeit derart gründlich übernutzt hat, daß daraus irreparable Schäden entstanden sind. Um bereits begangene Umweltsünden auszubügeln, wird an der Narmada eine noch größere Umweltsünde begangen. Dabei ist abzusehen, daß der Nutzen des Staudamms überschätzt wird. Die Erfahrungen mit großen Dämmen sind - nicht nur in Indien - mittelfristig keineswegs günstig. Die Böden versalzen und die Schädlinge, die nach dem Bau solcher Staudämme das ganze Jahr über beste Bedingungen vorfinden, nehmen überhand. Nirgends in Indien werden die projektierten Ertragssteigerungen auch nur annähernd erreicht.
Im Grunde ist es aber eine philosophische Frage, ob es sinnvoll und verantwortbar ist, einen Fluß von der Größe und Bedeutung des Rheins zu stauen und sein Wasser bis zu 450 Kilometer weit umzuleiten, um dort neue landwirtschaftliche Flächen zu erschließen oder bestehende zu rehabilitieren. Und dabei die Existenz von einer Viertelmillion Menschen sowie eines der letzten einigermaßen ursprünglichen Ökosysteme zerstören. Die Antwort läge eigentlich schon in der Religion. Den Hindu ist die Narmada, der einzige größere Fluß übrigens, der von Osten nach Westen fließt, heilig wie Ganga und Yamuna.
,,Flüsse sind überall und stets die Mütter der Völker gewesen", sagt Baba Amte. Die Narmada hat das Recht zu fließen. ,,Wer dieses Recht mißachtet, bringt die ganze Erde in Gefahr."
Das ungewisse Schicksal der Wäscherkaste
Kastenlose allgemein
,,Achhut" bedeutet auf Hindi ,,unberührbar". Der Begriff bezeichnet die rituelle Unreinheit von Menschen, die sich mit religiösen Verrichtungen nicht verträgt. Achhut, ,,unberührbar" sind Menschen, die mit Totem zu tun haben, mit Fäkalien, mit Schmutz. Zum Beispiel Chamar (Lederarbeiter, Gerber), val tki (Putzer, Toilettenreiniger) oder Dhobi (Wäscher). In der indischen Kastenordnung sind diese Berufe identisch mit Kasten (jati): Man wird in die Kaste der Chamar hineingeboren, und das bedeutet, daß man auch den Beruf der Chamar, das Gerben und Verarbeiten von Tierhäuten, übernimmt. Angehörige dieser Kasten und Berufe - etwa 15 Prozent der Bevölkerung - sind so unrein, daß sie außerhalb, genauer: unterhalb der sozialen Ordnung stehen; daher nennt man sie ,,Kastenlose", ,,Outcast". Sie selber bezeichnen sich heute als Dalit (die ,,Zertrampelten"). Kontakt mit Kastenlosen ist zu vermeiden. Deshalb essen Angehörige der höheren Kasten nicht zusammen mit ,,Unberührbaren". Kastenlose dürfen nicht den Brunnen benutzen, aus dem andere ihr Wasser schöpfen. Die ,,Unberührbaren" wohnen außerhalb der Dörfer. In Südindien gab es früher nicht nur ,,Unberührbarkeit" sondern sogar ,,Unsichtbarkeit": Kastenlose mußten sich so verhalten, daß sie von den Brahmanen nicht gesehen werden konnten. Es war genau vorgeschrieben, wer wie viele Schritte Distanz zu einem Brahmanen halten mußte, und keinesfalls durfte der Schatten eines Dalit auf einen Brahmanen fallen. Solche Regeln sind heute überholt. Sie sind auch in der modernen Gesellschaft nicht mehr durchzuhalten: In einem vollen Bus in der Hauptstadt Delhi oder in den notorisch überfüllten Vorortzügen von Bombay ist niemand mehr ,,unberührbar". Aber in den 500000 Dörfern Indiens wird Unberührbarkeit immer noch in dem Sinn praktiziert, daß Höherstehende mit Kastenlosen nicht essen, kein Wasser von ihnen nehmen und es nach wie vor für selbstverständlich halten, daß die Dalit außerhalb des Dorfes wohnen.
Mahatma Gandhi hat den ,,Unberührbaren" etwas verharmlosend den Namen Harijan,,,Leute Gottes", gegeben; er nahm damit dem untolerierbaren Konzept der Unberührbarkeit etwas die Spitze. Viele Dalit weisen heute den Ausdruck ,,Harijan" zurück. Der Begriff ,,Dalit" sprengt die Kategorien der Kastenordnung und bezeichnet alle, die ganz unten auf der sozialen Stufenleiter stehen.
Die Dalit haben wohl denselben Ursprung wie die Adivasi. Nur wurden sie von den arischen Einwanderern nicht abgedrängt, sondern deren Ordnung unterworfen. Sie wurden in der indischen Gesellschaftsordnung unterhalb der vier mitgebrachten Kasten angesiedelt, und ihnen waren all jene Arbeiten zuzumuten, die den Kasten-Hindu als unrein galten. Die Eroberer schufen sich damit eine Unterklasse, die fast Sklavenstatus hatte und in der Kastenhierarchie ideologisch-religiös verbrämt wurde. Auf den Ursprung der Dalit in der Urbevölkerung Indiens weist auch hin, daß die Dalit auffällig dunkler sind als die Angehörigen der oberen Kasten.
Vor diesem Hintergrund der Unterklasse der Dalit ergibt sich, daß die große Mehrheit der körperlich Arbeitenden, der Tagelöhner und der besitzlosen Landarbeiter Dalit sind. Überlegungen zu dem geringen Stellenwert, den in der indischen Gesellschaft die (körperliche) Arbeit hat, befassen sich deshalb weitgehend mit den Dalit. Hier soll nur am Beispiel der Dhobi, der Wäscherkaste, gezeigt werden, wie sich im heutigen Indien das Konzept der ,,unberührbaren" Kasten - aus ganz verschiedenen Gründen - verändert, wie eine Kaste den angestammten Beruf verliert, was bedrohlich sein kann, aber auch soziale Mobilität schafft.
Millionen Inder und Inderinnen gehören der Kaste der Dhobi an, deren althergebrachter Beruf es ist, die Kleider Indiens zu waschen. Die Dhobi mögen auf der sozialen Leiter ganz unten stehen, doch ihre Arbeit war bisher aus dem Alltagsleben nicht wegzudenken. Heute erhalten die Dhobi aber Konkurrenz: Immer mehr Haushalte des städtischen Mittelstandes, aus dem sich die Kundschaft der Wäscher zusammensetzt, leisten sich - nach dem Fernseher und dem Kühlschrank - eine Waschmaschine. Auch die Umweltverschmutzung wird den Dhobi zum Verhängnis: Das Wasser der großen Flüsse, an denen die Arbeitsplätze der Dhobi liegen, ist oft so dreckig, daß dort niemand mehr gute Kleider waschen lassen will.
,,Alle Menschen sind Dhobi", sagt B. S. Arya, der Generalsekretär der Vereinigung der indischen Wäscher (All India Dhobi Sabha). ,,Alle Menschen waschen, sie waschen sich die Hände, sie waschen sich das Gesicht." Arya will damit vergessen machen, daß das Waschen anderer Leute Kleider in der indischen Kastengesellschaft einen überaus niedrigen Status hat.
Nur die Putzer und die Gerber, diejenigen, die mit Fäkalien oder mit toten Lebewesen zu tun haben, stehen noch etwas tiefer.
Immerhin hat Indien seine Dhobi bisher schlecht und recht ernährt, hat ihnen ein Auskommen gegeben. Der Dhobi gehörte zum Haushalt. Er kam in regelmäßigen Abständen ins Haus, holte die schmutzige Wäsche ab, brachte nach ein paar Tagen die saubere, sorgfältig gebügelte Wäsche wieder, und nie hat er einen Sari oder ein kurta pajama (Hemd und Hose aus weißem Baumwollstoff) verwechselt.
Doch das ist jetzt in Frage gestellt. Die Fernsehwerbung macht täglich vor, daß Waschen keine herabwürdigende Tätigkeit sein muß. Im Gegenteil, smart, elegant und fröhlich ist die Hausfrau, wenn sie das Waschmittel Marke Schneewittchen in die Maschine gibt. Die Dhobi jedoch müssen angesichts dieses Fortschritts um die Existenzgrundlage ihrer ganzen Kaste fürchten. ,,Das Geschäft ist um die Hälfte zurückgegangen", sagt B. S. Arya.
Bei der alten Yamuna-Brücke liegt Delhis ältester Dhobi ghat (das in jeder Stadt für die Wäscher reservierte Stück Flußufer), gleich unter dem Lal Quila, dem von Kaiser Shah Jahan erbauten Roten Fort. ,,Hier haben wir eine Generation nach der anderen die Wäsche von Delhi gewaschen", sagen die Leute nicht ohne Stolz. Aber was von dieser jahrhundertealten Tradition übriggeblieben ist, bietet ein Bild des Jammers. Unverändert geblieben ist die Technik des Waschens: Die Dhobi stehen im Wasser und schlagen die nasse Wäsche auf flache Steine am Flußufer, um den Schmutz herauszuprügeln. Das Bild ist so typisch, daß sich Mark Twain vor hundert Jahren zur Bemerkung veranlaßt sah, Indien sei das Land, in dem die Leute mit ihren Kleidern Steine entzweischlagen würden.
Aber Kleider werden am Dhobi ghat bei der alten Yamuna-Brücke kaum mehr gewaschen. Am Ufer liegen nur noch ausgediente Stofftücher und Lumpen zum Trocknen, die danach noch als Putzlappen Verwendung finden. Gebrauchte Säcke werden hier gewaschen, keine farbenfrohen Saris. Gänse, Ziegen und Hunde laufen über die am Boden ausgebreiteten Lumpen. ,,Wir tun das nur, damit unsere Kinder abends etwas in Magen bekommen", sagt ein Wäscher. Der Berufsstolz, den sehr ausgeprägt auch die Dhobi haben, ist der Verzweiflung gewichen.
Die Probleme sind vielfältig. ,,Die Leute wissen halt, daß wir in der Yamuna waschen, und hier ist das Wasser eben dreckig", sagt ein junger Mann, während inmitten einer Insel aus Wasserhyazinthen ein totes Schwein flußabwärts treibt. Die Yamuna ist derart verschmutzt, daß man darin nicht einmal mehr waschen kann. ,,Früher wuschen wir gute Kleider hier", sagt eine alte Frau. ,,Aber seit etwa zehn Jahren müssen wir mit Lumpen unser Geld verdienen."
Die Leute beklagen sich bitter über die Zuwanderer aus Bihar und Bangladesh, die sich hier, noch ärmer als die ansässige Bevölkerung, ihre Slumhütten hingebaut haben. ,,Die stehlen und versauen den ganzen Dhobi ghat ", sagt Shanti. ,,Jetzt müssen wir in dem Dreck drin arbeiten."
Für die Dhobi, die nicht am Yamuna-Ufer, sondern in der Stadt wohnen, wird es eng an ihrem angestammten Arbeitsplatz. Aber dem Überschwappen der Bevölkerung aus den Elendsgebieten des Subkontinents, das die Leute mit der Gewalt einer Flutwelle nach Delhi schwemmt, haben sie nichts entgegenzusetzen. Sie reagieren mit Fremdenhaß.
Dazu kommt die Konkurrenz der Waschmaschine, die Arbeit wegnimmt und die Preise drückt. ,,Früher nahmen wir nur ein Anna (den sechzehnten Teil einer Rupie) pro Kleidungsstück, aber das hat uns gereicht", sagt Shanti. ,,Heute würde es nicht mehr reichen, selbst wenn wir eine Rupie bekämen." Die Leute haben Mühe, anzugeben, wieviel sie verdienen. Ein Muslim mit dem Namen Allawallah - auch die Muslime und die Sikhs haben bezeichnenderweise ihre Wäscherkaste - erklärt, daß die Dhobi eben immer alles auf Kredit kaufen müssen. Sobald etwas Geld hereinkommt, geht es an den Ladenbesitzer, damit es wieder neuen Kredit für das Lebensnotwendigste gibt. Auf diese Weise wissen die Leute am Ende des Monat nur, daß nichts übriggeblieben ist. B.S. Arya hat ausgerechnet daß einer Dobhi-Familie nach Abzug ihrer Kosten monatlich etwa 25 Mark bleiben. Es ginge auch anders. Om Prakash zum Beispiel, unser eigener Dhobi, der fünf Jahre lang zweimal in der Woche in unser Haus kam, wohnt in einer Dhobi-Kolonie im Zentrum von Delhi, im Schatten des Fünf Sterne-Hotels ,,Taj Mahal". Die Siedlung wurde von einer Kongreß-Regierung gebaut. Hier gibt es saubere und zweckmäßige Arbeitsplätze zum Waschen. Die Leute haben sich propere Häuschen gebaut, in denen es blitzsauber ist und geradezu gemütlich.
Mit ein bißchen Hilfe von der Regierung wäre es also durchaus möglich, Bedingungen zu schaffen, die sowohl für die Dhobi attraktiv sind als auch für die Kundschaft, die weiß, daß ihre Kleider auf hygienisch einwandfreie Weise gewaschen werden. Aber B. S. Arya beklagt sich, daß die Regierung nichts für seine Kaste tut, sogar die Valmiki, die Putzer bekämen mehr ,,Der Gemeinschaft der Dhobi geht es schlecht, schlecht, schlecht, auch im Vergleich mit anderen Dalit", sagt er. Dabei sei man äußerst zahlreich, 300000 Wäscherfamilien gebe es allein in Delhi, seine Organisation habe in der Hauptstadt 400000 zahlende Mitglieder.
Arya ist nebenbei auch noch Kongreß-Politiker, man sieht es an seinem gestärkten Gandhi- Käppchen. Seine Zahlen müssen stark übertrieben sein und entsprechen etwa dem Anteil aller Dalit an der Bevölkerung der Hauptstadt. Immerhin geht es hier landesweit um das Schicksal von vielen Millionen Menschen, wenn auch nicht gerade 120 Millionen, wie Arya behauptet. ,,Wir sind ungebildete Analphabeten", sagt er, ,,und wenn wir unsere angestammte Arbeit verlieren, sind wir doppelt arbeitslos." Arya meint damit, daß es für die Dhobi schwierig ist, andere Arbeit zu finden. Dhobi-Sein ist eben mehr als ein Beruf. Dhobi wird man nicht durch eigene Wahl, als Dhobi wird man geboren. Dhobi-Sein ist Schicksal, bestimmt durch das karma, die Summe aller Taten eines früheren Lebens. Dhobi-Sein ist eine Lebensweise mit einer eigenen Gesellschaftsstruktur, mit einer eigenen Kultur, mit eigenen Spielregeln fürs Leben, Heiraten und Sterben. Die Dhobi mögen fast zuunterst stehen auf der sozialen Leiter. Aber die Zugehörigkeit zur Kaste der Dhobi gibt auch soziale Geborgenheit, sie ist im Guten wie im Bösen Bestimmung, dharma. Die Leute von der alten Yamuna-Brücke glauben auch heute noch nicht, daß ihre Kinder eine Chance haben, dem Dhobi-Dasein zu entfliehen. ,,Nur zehn Prozent der Dhobi-Kinder gehen zur Schule", sagt Arya. ,,Und wenn sie die Schule hinter sich haben, vergessen sie allzu leicht ihre Herkunft." Doch sogar die Schule hilft nicht immer weiter. Die alte Shanti zum Beispiel hat einen Enkel, der zwölf Jahre zur Schule ging. ,,Aber wie einen Job finden? Um einen Job zu bekommen, muß man Bestechungsgelder zahlen. Woher sollen wir das Geld nehmen?" sagt sie. Jetzt hängt der Junge herum, hilft hier ein bißchen und dort ein bißchen. ,,Auch meine Kinder werden ihr Leben als Dhobi verdienen müssen", sagt ein junger Mann, ,,obwohl das immer schwieriger wird."
Om Prakash, unser Dhobi, sieht das etwas anders. ,,Die junge Generation will nicht mehr als Wäscher arbeiten", sagt er. Er habe eine Kundin gehabt, die ihm 800 Rupien im Monat zahlte; jetzt habe sie eine Waschmaschine angeschafft und gebe ihm nur noch 300 Rupien fürs Bügeln. Dafür ist sich die mittelständische Hausfrau zu gut, da besteht noch eine Nische für die Dhobi, soweit nicht einfach das normale Hauspersonal herangezogen wird. Aber der Verdienst ist entsprechend geringer.
Das Beispiel der Dhobi, die um ihre Existenz fürchten müssen, ist typisch für das moderne Indien. Auf der einen Seite steht hier eine althergebrachte Ordnung, die von Grund auf ungerecht sein mag, die aber jedem Menschen einen Platz zuweist und jedem eine Rolle, ein Auskommen gibt. Auf der anderen Seite stehen Modernisierung, Mechanisierung, Industrialisierung, die Sehnsucht, ja geradezu Gier nach Konsumgütern, die Übernahme von immer mehr Elementen einer einebnenden Weltzivilisation, die mit der überlieferten Ordnung zusammenprallen. vikas, Fortschritt, ist das Schlüsselwort, Die moderne Welt mag neue Möglichkeiten schaffen, neue Aufstiegsmöglichkeiten für diejenigen ganz unten. Sie läßt aber gleichzeitig Millionen zurück, die nicht dafür ausgestattet sind, in einer sich rasch wandelnden Umgebung einen neuen Platz, eine neue Nische zu erobern. ,,Die ganze Gemeinschaft der Dhobi wird überflüssig", sagt ein nachdenklicher Arya.
Alle Dhobi sind natürlich überzeugt, daß sie ihre Arbeit besser machen als die Maschine. ,,Wir verlängern das Leben der Kleider", sagt einer, eine Behauptung, die angesichts der uralten Methode, den Schmutz buchstäblich aus den Stoffen herauszuprügeln, etwas gewagt erscheint. Sie würden besser auf die Erhaltung der Farben achten, sagen die Dhobi. Sie wüßten die verschiedenen Stoffe, Baumwolle, Wolle, Seide, besser den Anforderungen des Materials entsprechend zu behandeln als die Maschine, meint Om Prakash. ,,Dhobi ka hath se" (Von der Hand des Dhobi) sei eben immer noch das Beste.
Dalit gegen Adivasi - Ein Fall aus Orissa
Im Sommer des Jahres 1994 machte eine kuriose Geschichte die Runde durch die indischen Zeitungen. Irgendwo im Hinterland des rückständigen Gliedstaats Orissa, der südlich an das bekanntere Westbengalen mit der Hauptstadt Kalkutta anschließt, waren eine Gemeinschaft von Dalit und eine Gemeinschaft von Adivasi aneinandergeraten. Die Adivasi hatten die Dalit vertrieben, es gab mindestens 20 Tote und Tausende von Flüchtlingen. Irgendwie hatten es die großen Zeitungen der Hauptstadt nicht geschafft, ihre Reporter bis in diesen fernen Winkel des Subkontinents zu entsenden, und so blieb die Geschichte reichlich vage, ein Kuriosum eben. Es wurde nicht ersichtlich, was die Adivasi gegen die Dalit aufgebracht hatte; die Hintergründe des Zusammenstoßes blieben schleierhaft.
Als wir ein paar Monate später in die Gegend kamen und der Sache nachgingen, stießen wir auf eine höchst merkwürdige Geschichte, die zur Hälfte in der fernen Vergangenheit spielte und Einblicke in verschiedene, auch grausame Aspekte der ererbten Adivasi-Kultur brachte. Zur anderen Hälfte jedoch war es durchaus eine heutige Geschichte, welche von sozialem Wandel, wechselnden Rollen und neuen Konflikten, aber auch vom ökologischen Niedergang handelt. Während die Adivasi vom Stamm der Kondh in der gewohnten Lebensweise verharrten, so gut es ging, machten sich die Dalit von der Gemeinschaft der Pano, die von den Kondh mehr oder weniger als Diener gehalten wurden, auf den Weg nach oben. Daraus ergab sich ein Konflikt, wie er sich in Indien, wenn auch nicht im so spektakulär, hundert- und tausendfach abspielt, wenn Völker, Gemeinschaften, Kasten, religiöse Gruppen aus dem gewohnten gesellschaftlichen Gefüge mit all seinen Vor- und Nachteilen ausbrechen und sich auf den Weg in eine - hoffentlich - bessere Zukunft machen. Eine exemplarische Geschichte.
Jedes Jahr zu Dassehra, dem Fest von Durga, der Gemahlin von Shiva in ihrer schrecklichen Form, werden in Balaskum blutige Tieropfer dargebracht. Balaskumpa in der Nähe des Distrikthauptorts Phulbani ist der traditionelle Opferplatz einer Untergruppe der Kondh von Orissa. Zwölf verwitterte Opferpfähle stehen unter einem großen, weit ausholenden Baum. Der traditionelle Stein, der die Mutter Erde symbolisiert - sie ist es, die nach den Opfern verlangt - ist in einen hinduistischen Durga-Tempel integriert, wie überhaupt die alten Kondh-Riten vom Hinduismus weitgehend assimiliert wurden. Nur der Name - Ma Barali - ist von der Adivasi-Gottheit geblieben.
Zum letzten Dassehra-Fest wurden hier neun Wasserbüffel und 25 Ziegen geschlachtet und Ma Barali dargebracht. Die Tiere werden jeweils mit Hilfe eines Fadens mit dem Stein verbunden, der die Göttin symbolisiert, damit die Kraft des Tieres direkt in die Erde geht. ,,Die Opfer gewährleisten den Frieden des Geistes", sagt der Opferpriester, der die Zeremonien leitet:,,Die Leute opfern Tiere, um Frieden, Regen oder Kindersegen zu erbitten. Die Opfer helfen, die Wünsche der Menschen zu erfüllen."
Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein waren es nicht Büffel und Ziegen, sondern Menschen, die geopfert wurden, wenn Ma Barali, Mutter Erde, nach Blut schrie, das ihre Fruchtbarkeit erhalten sollte. Die Briten führten damals eine. militärische Kampagne gegen die grausamen Menschenopfer - kaum aus Menschenliebe, sondern weil ihnen die blutigen Rituale der Kondh einen Grund zum Eingreifen gaben in einer Gegend, in die die Herrschaft der Kolonialmacht nicht reichte. Es waren die Briten, die den Ersatz der Menschenopfer durch Tieropfer erzwangen, doch wird bis in die Gegenwart im Zusammenhang mit dem hinduistischen Durga-Kult von Menschenopfern gesprochen, und bis heute haben die Kondh eine erstaunlich präzise Erinnerung an die einstigen Menschenopfer.
In dem schönen, noch nicht von Beton und Backsteinen verschandelten Kondh-Dorf Dutipada ließen wir uns im Detail erzählen, wie solche Menschenopfer vonstatten gingen, wie das Opfer zuerst vier bis sechs Monate reichlich gefüttert, dann an einem glückbringenden Tag mit Tamarinde eingerieben und tüchtig mit Schnaps abgefüllt wurde, bevor es an den Opferpfahl gebunden und vom Dorfpriester mit einem Schlag enthauptet wurde. Der Priester schnitt den Körper in Stücke, die er an die Dorfbewohner verteilte. Der Kopf wurde Mutter Erde dargebracht und in den Reisfeldern vergraben. Der Rest habe getrocknet als Medizin gedient, oder man habe die Menschenfleischstücke als Talisman um den Hals getragen.
In anderen Dörfern soll es noch grausamer zugegangen sein. Da schnitten die Kondh dem unglücklichen Opfer bei lebendigem Leibe die besten Stücke ab, und stets sei gestritten worden, wer zuerst drankam. Die Beschaffung der Opfer war Aufgabe der Pano, einer Volksgruppe, die zu den Dalit, den ,,Unberührbaren", zählt und die sich die Kondh vor etwa 150 Jahren ins Land holten. Die Kondh leben in einer engen Symbiose mit den Pano, die Adivasi als Herren, die Dalit als Diener. Bis vor kurzem nahm sich ein Kondh immer seinen Pano mit, wenn er zum Beispiel mit den Behörden in Phulbani zu tun hatte. Die Pano sprachen Oriya, die Verwaltungssprache, sie waren die Vermittler zur Außenwelt. In ökonomischer Hinsicht waren die Dalit aber vollständig abhängig von ihren Herren.
Noch heute wohnen die Dalit außerhalb der Kondh-Dörfer. Obwohl die Adivasi traditionell nichts mit dem hinduistischen Kastensystem zu tun haben und selber in der sozialen Hierarchie ganz unten stehen, praktizieren sie den Pano gegenüber bis heute die Unberührbarkeit. Sie essen nicht zusammen, und die Pano müssen getrennt von ihnen wohnen.
Auch Bisi Kesan Kanhar, ein Pano, den wir außerhalb von Dutipada in seiner Hütte antreffen, erinnert sich noch an die Rolle seiner Leute bei den Menschenopfern. ,,Wir kauften die Opfer von ihren Eltern", sagt er und fügt schnell hinzu: ,,Aber das ist lange her, wir haben nur davon gehört."
Noch vor einem Jahr arbeitete Bisi Kesan Kanhar als Landarbeiter für die Kondh; sein Tageslohn betrug zwölf Rupien (60 Pfennig) oder fünf Kilo ungeschälten Reis. Dazu überließen ihm die Kondh ein kleines Stück Land, wo er seine Hütte bauen und seine Frau einen kleinen Küchengarten anlegen konnte.
Doch inzwischen ist es zum Bruch gekommen zwischen dem Herrenvolk der Kondh und dem Dienervolk, den ,,unberührbaren" Pano. Im Distrikt Phulbani mit einem Anteil von 50 Prozent Adivasi und 20 Prozent Dalit, davon die meisten Pano, brachen Unruhen aus. Es gab Tote auf beiden Seiten, Hunderte von Hütten wurden niedergebrannt. Auch Bisi
Kesan bekam es mit der Angst zu tun und floh mit den anderen Pano von Dutipada nach dem Distrikthauptort Phulbani, der zeitweise 20 000 Flüchtlinge zählte. Als sich die Situation wieder einigermaßen normalisierte, kehrte er in seine Hütte zurück. Aber es ist nicht mehr wie früher: Die Kondh wollen mit den Pano nichts mehr zu tun haben, sie lassen sie nicht mehr für sich arbeiten, und der bescheidene Lohn fällt weg.
Fragt man die Kondh nach den Ursachen dieses Zwists, kommt zunächst Triviales zum Vorschein. Die Pano hätten eine Ziege gestohlen und sich gegenüber den Frauen des Dorfes ungebührlich aufgeführt, meint Chanchala Kanhar, die Mutter des Sarpanch (Dorfchef) von Dutipada. Zudem seien einige Dalit in den Shiva Tempel gegangen und hätten dort Opfer dargebracht. Zwar braucht es die Adivasi nicht zu kümmern, wenn die Pano das Tabu brechen, das den Dalit den Zutritt zum Tempel verbietet, denn sie benutzen den Tempel selber nicht. Und doch solidarisierten sie sich in diesem Fall mit den Brahmanen und den oberen Kasten, denn sie empfinden sich gegenüber den Pano als obere Kaste, und deshalb war das aufmüpfige Verhalten der Pano auch für die Kondh eine unerträgliche Anmaßung.
Doch hinter solchen Reibereien steckt mehr. Während die Kondh zufrieden in ihrer althergebrachten Kultur und in ihrer traditionellen Herrenrolle verharrten, nutzten die untergeordneten Pano die Aufstiegsmöglichkeiten, die ihnen das moderne Indien bot. Viele traten zum Christentum über, und ihre Kinder besuchten Missionsschulen, andere erhielten dank der Quoten für die Dalit (siehe Seite 168) Zugang zu den Regierungsschulen. Mit der besseren Ausbildung fanden sie besser bezahlte Arbeit und waren den Kondh nicht mehr fraglos zu Diensten. Insbesondere belegten die Pano sämtliche lokalen Regierungsjobs.
Die neue Rolle verschaffte den Pano auch Zugang zur Geldwirtschaft. Während die Kondh in ihrer traditionellen Selbstversorgungswirtschaft verhaftet blieben, wurden sie in Geldsachen nun plötzlich von den Pano abhängig. Wenn die Kondh Geld brauchten, um Schnaps und Schaf- oder Ziegenfleisch für Hochzeiten und andere Feste zu kaufen, gingen sie zu den Pano, welche die Rolle der Geldverleiher übernahmen und wie diese zehn Prozent Zins im Monat nehmen konnten. In Geldsachen unerfahren, verpfändeten die Kondh ihr Land für lächerliche Summen. Mit Hilfe der Pano-Beamten gelang es den Dalit auch, dieses Land amtlich zu registrieren. ,,Die Dalit nutzten die Situation aus und übernahmen die Hälfte des Landes der Kondh, erklärt Suresh Chandra Mahapatra, der junge und effiziente Distriktchef von Phulbani.
Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen begannen die Pano auch, den Wald kommerziell zu nutzen, Holz für den Verkauf zu schlagen und Holzkohle herzustellen. ,,Die Adivasi schonen dagegen den Wald, weil sie ohne den Wald nicht überleben können", sagt Mahapatra, ,,das mußte natürlich zu Konflikten führen." So kam es denn zum offenen Krach. Die Kondh brachten gezielt einige Pano um, die sich bei der Ausbeutung der Adivasi besonders hervorgetan hatten; die Dalit schlugen zurück. Die Regierung mußte eingreifen und die größten Hitzköpfe aus dem Verkehr ziehen. Sie erreichte auch, daß die Kondh ihr angestammtes Land zurückerhielten. Nicht zur Freude aller: ,,Das Land haben wir zurückgegeben", kommentiert Bisi Kesan, ,,aber das Geld haben wir nicht zurückerhalten."
Der soziale Wandel, der auch die Landbevölkerung bis in die hintersten Ecken Indiens hinein erfaßt, hat das Rollengefüge der Kondh-Gesellschaft auf den Kopf gestellt. ,,Die Tradition ist aufgebrochen", sagt Mahapatra. Die Pano, die Aufsteiger in dieser Gesellschaft, halten sich nicht mehr an die alten Regeln. Es macht ihnen auch nichts aus, Ziegen und Ochsen der Kondh zu stehlen und zu schlachten (im Unterschied zu den Kondh essen die ,,unberührbaren" Pano auch Rindfleisch). Zum Pflügen brauchen die Kondh aber immer ein Paar Ochsen, deshalb fällt der Verlust eines Ochsen besonders schwer ins Gewicht. Wie überall gibt es in diesem Veränderungsprozeß Verlierer. Dazu gehören nicht nur die meisten Kondh, sondern auch der Pano Bisi Kesan Kanhar. An ihm ist die Emanzipation der Dalit vorübergegangen. Er ist arm, landlos und ungebildet geblieben, und er ist von den Kondh immer noch ebenso abhängig wie die Kondh vom Wald. Ihn hat der Konflikt zwischen den beiden Gemeinschaften um seine Existenz als Landarbeiter gebracht.
In Orissa mit seinem hügeligen Hinterland werden offiziell 62 Stammesvölker gezählt. Zu den unberührtesten - zu den ,,rückständigsten" in der offiziellen Terminologie - gehören die Kutia Kondh, eine Untergruppe der Kondh. Sie siedeln noch einmal vier Fahrstunden entfernt auf zuletzt ungeteerten Straßen westlich von Phulbani auf Hügeln und in Wäldern. In ihrem Hauptort Belgher gibt es noch nicht einmal Elektrizität, und in der einzigen Dhaba (Garküche) am Ort ißt man bei flackernden Petrollampen auf dem nackten Erdboden aus Tellern, die aus Teak-Blättern gefertigt sind, während die einheimischen Männer gemächlich lokal hergestelltes Opium rauchen.
In den Dörfern treffen wir alte Männer, die sich, das ergraute Haar zu einer Art Chignon oder Knoten hochgesteckt, noch mit dem traditionellen Lendenschurz als Bekleidung begnügen. Die Frauen sind tätowiert, und man kann unschwer erkennen, daß sie ihre Blöße erst seit kurzem mit einem nachlässig um den Körper geschlungenen Tuch bedecken.
Beispiel für ein Dorf:
Burlu Baru zum Beispiel, ein schönes altes Dorf aus einem Indien, das es anderswo längst nicht mehr gibt, besteht aus zwei schnurgeraden Häuserzeilen, wobei sich mehrere Häuser dasselbe Dach teilen. Die beiden Häuserreihen sind genau von Osten nach Westen ausgerichtet. In der nördlichen Häuserzeile wohnt das Geschlecht der Jani, aus dem der Dorfpriester, also die geistliche Herrschaft, stammt. In der gegenüberliegenden südlichen Zeile wohnen die Majhi, die den Dorfchef, also die weltliche Herrschaft, stellen. Zwischen den beiden Geschlechtern, es sind in allen Dörfern dieselben, gibt es kein hierarchisches Gefälle, und die beiden Clans heiraten untereinander. Die Pano, die auch den Kutia Kondh zu Diensten sind, wohnen, wie es sich gehört, außerhalb des Zauns, der das Dorf umgibt.
Zwischen den beiden Häuserzeilen der Jani und der Majhi liegt langgestreckt der Dorfplatz. Die Häuser seien so angeordnet, weil das praktisch sei für die vielen Feste, die die Kutia feiern, wird uns erklärt: Hochzeiten zum Beispiel oder dreimal jährlich die Tieropfer, die auch hier die alten Menschenopfer abgelöst haben und die mit mehrtägigem Tanzen, Trommeln und Trinken begangen werden. In der Mitte des Dorfplatzes steht der uralte, sorgfältig geschnitzte Opferpfahl, Koromunda geheißen, davor ein weißlicher Stein, Dharan Penu, der die Mutter Erde symbolisiert.
Die Kutia leben noch heute weitgehend von den Produkten des Waldes. In den Wäldern finden sie eßbare Wurzeln und Früchte, die sich auch verkaufen lassen wie Mango oder Tamarinde. Sie sammeln die Samen des Sal-Baums, aus denen man Speiseöl gewinnen kann. Ein toter Affe, der angebunden in der Umzäunung hängt, belegt, daß die Jagd mit Pfeil und Bogen ebenfalls etwas hergibt. Und nicht zuletzt findet sich im Wald der Mahua-Baum, aus dessen proteinreichen Blüten der beliebte Mahua-Schnaps gebrannt wird - anders als die Kasten-Hindu schätzen die Adivasi den Alkohol.
Große nackte Flächen im Wald zeigen aber, daß die Leute in den letzten Jahren vermehrt zum Wanderackerbau übergegangen sind, den sie chaspas nennen: Der Wald wird gerodet und verbrannt, drei Jahre lang werden die so gewonnenen Felder für den Anbau von Reis und Senfsaat genutzt und dann wieder der Natur überlassen.
Die junge Frau, die wir in Burlu Baru antrafen, hat damit kein Problem. In ihrer Vorstellung ist Wald etwas, das nur wachsen kann, der Inbegriff von Fruchtbarkeit und Üppigkeit, der stets neuen Wohlstand gebiert und die geschlagenen Lücken immer wieder von selber schließt.
Doch die Männer, die mehr von der Welt gesehen und es vielleicht schon mal in den Distrikthauptort Phulbani geschafft haben - der Begriff ,,Indien" hingegen sagt ihnen nichts -, wissen, daß der Wald heute übernutzt wird. Aber was können sie tun? Wenn sie kein eigenes Land besitzen, müssen sie chaspas machen. Dabei wissen sie selber, daß der Ertrag aus der Landwirtschaft die Menschen nur etwa drei, vier Monate im Jahr ernährt; die restlichen Bedürfnisse müssen durch den Wald gedeckt werden, der wiederum durch chaspas gefährdet ist.
Der Grund für die Übernutzung des Waldes liegt aber nicht nur im Bedürfnis nach genügend Nahrungsmitteln, nicht nur in. der Zunahme der Bevölkerung. Hauptgrund sind die neuen Bedürfnisse, die, wie man auf dem Wochenmarkt von Belgher sehen kann, ihren Weg auch zu den Kutia finden. Um diese Bedürfnisse zu decken, braucht es Bargeld. Es ist die Geldwirtschaft, die die Lebensgrundlage der Kutia gefährdet,
Die Muslime als Sündenböcke
Während die indische Gesellschaft die Minderheiten der Adivasi und der Dalit problemlos verkrafte, indem sie ihnen ,,ihren Platz zeigte" - nämlich einen Platz ganz zuunterst in der Kastenhierarchie -, will ihr eben das mit einer anderen gewichtigen Minderheit nicht gelingen: mit den Muslimen. Die Muslime waren wie die Arier als Eroberer in den Subkontinent gekommen, freilich viel später:
Geschichte
Vom 11. Jahrhundert an drangen muslimische Heere von Afghanistan her in die fruchtbaren Täler des Indus und der Ganga vor und unterwarfen die bestehenden Hindu-Königreiche. In Delhi errichteten sie im 12. Jahrhundert aus Resten zerstörter Tempel den gewaltigen, 72 Meter hohen Qutab Minar, den ,,Turm des Sieges". Im 16. bis 18. Jahrhundert erlebte Indien unter den Moghul-Kaisern, vom toleranten Akbar bis zum Hindu-Fresser Aurangzeb, eine Blütezeit, deren Architektur bis heute zum Besten zählt, was die Welt zu bieten hat.
Etwa zwölf Prozent der Inder, also gegen 120 Millionen Menschen, sind Muslime; Indien ist damit nach Indonesien, aber noch vor Pakistan und Bangladesh, das zweitgrößte islamische Land der Welt. Anders als die Adivasi und die Dalit haben Indiens Muslime aber denselben ethnischen Ursprung wie die Hindu; die beiden Volksgruppen unterscheiden sich in nichts als der Religionszugehörigkeit. Zwar ließen sich auch die Eroberer mit ihren Heerscharen auf dem Subkontinent nieder, die große Mehrheit der indischen Muslime wurde aber muslimisch durch Bekehrung. Das geschah manchmal unter Zwang, doch trug auch das Kastensystem zu den Konversionen bei: Im Islam bot sich den Angehörigen der unteren Kasten die Möglichkeit, in eine egalitärere Gesellschaft überzutreten (obwohl mit der Zeit Elemente der Kastenhierarchie auch im indischen Islam Eingang fanden). Das mag mit erklären, daß die große Mehrheit der Muslime bis heute zum ärmeren Drittel der indischen Gesellschaft gehört und nur wenige den Aufstieg in die heute dominierende Mittelschicht schafften.
Die Erinnerung an die Jahrhunderte der muslimischen Fremdherrschaft - abgelöst erst von der noch verhaßteren britischen Fremdherrschaft - ist das eine, was die kollektive Psyche der Hindu-Gesellschaft belastet. Das andere ist das Trauma der Teilung des britisch-indischen Empires in einen mehrheitlich islamischen Teil - Pakistan - und einen mehrheitlich hinduistischen Teil - eben Indien. Die unglückliche ,,Zwei-Nationen- Theorie", wonach die mehrheitlich islamischen Teile Indiens eine eigene Nation darstellten, wurde erst relativ spät von muslimischen Intellektuellen (die man heute durchwegs zum liberalen Flügel des Islam zählen würde) in die Welt gesetzt; erst 1940 wurde die Forderung nach einem eigenen islamischen Staat offiziell zum Programm der indischen Muslimliga unter dem Präsidium von Mohammed Ali Jinnah, dem ,,Vater" Pakistans. Das Motiv der dünnen muslimischen Elite wird wohl die. Einsicht gewesen sein, daß sie in einem mehrheitlich hinduistischen Indien immer zur zweiten Garnitur gehört hätte.
Es war eine verrückte Übung, in wenigen Monaten vor der Unabhängigkeit im August 1947 den Subkontinent auseinanderzudividieren, die niemanden zufriedenstellen konnte. Die beiden Gemeinschaften hatten räumlich stets Seite an Seite gelebt. Eine Grenzziehung nach religiösen Kriterien mußte deshalb in jedem Fall künstlich sein. Es wurde nur jeweils die bisherige Minderheit zur Mehrheit und die bisherige Mehrheit zur Minderheit gemacht; das Zusammenleben der beiden religiösen Gemeinschaften wurde dadurch nicht erleichtert. Pakistan wurde in einem wahren Blutbad geboren. Hüben wie drüben der neuen, künstlichen Grenze wurden Zehntausende von Flüchtlingen niedergemacht, ein Gemetzel, das bei den Menschen beider Länder tiefe Spuren hinterließ.
Seither haben Indien und Pakistan drei Kriege gegeneinander geführt. Durch diese tief eingesessene Feindschaft ist der Subkontinent zu einem der gefährlichsten Krisenherde der Welt. Und noch ist die territoriale Teilung nicht ausgestanden: Beide Länder beanspruchen das ehemalige Jammu und Kashmir für sich; beide halten Teile davon besetzt. Im Kashmir-Tal tobt ein blutiger Aufstand der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, der von Pakistan nach Kräften geschürt, von Indien mit allen Mitteln der Staatsmacht unterdrückt wird. Beide Länder zerfleischen sich in gegenseitigem Haß, den sie sich Milliarden an Militärausgaben kosten lassen, statt sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer eigenen Bevölkerung zu konzentrieren. Pakistan rechtfertigt seinen Anspruch auf Jammu und Kashmir mit dem Begriff der ,,islamischen Nation": Weil das ehemalige Maharaja-Reich mehrheitlich islamisch ist - allerdings mit bedeutenden hinduistischen und buddhistischen Minderheiten in Jammu und Ladakh - gehört es zu Pakistan, das sich als islamischer Staat definiert. Genau umgekehrt argumentiert Indien: Jammu und Kashmir können sehr wohl zu Indien gehören, denn Indien definiert sich nicht als Hindu-Staat, sondern als weltlicher, säkularer Staat, in dem, anders als in Pakistan, alle Menschen unbesehen ihres Glaubens (oder ihres Geschlechts, ihrer Kaste, ihrer Ethnie) gleich viel wert sein sollen. Diesem hehren Anspruch müßte Indien allerdings im Zusammenleben mit seiner islamischen Minderheit Wirklichkeit verschaffen, und damit hat die hinduistische Gesellschaft ihre Probleme, wie die Ereignisse der letzten Jahre, auf die wir uns hier konzentrieren möchten, gezeigt haben.
Ein Besuch in der muslimischen Universität Aligarh,130 Kilometer südöstlich von Delhi, offenbarte wenige Tage nach der Zerstörung der Moschee den Grad der Verletztheit unter den Muslimen. Die Muslim-Universität von Aligarh rühmt sich, die bedeutendste islamische Lehrstätte nach der Ashar-Univetsität in Kairo zu sein. Sie ist das geistige Zentrum der modernen Muslime Indiens, genau wie die Jama Masjid, die Freitagsmoschee in Delhi, mit ihrem konservativen Imam das Zentrum des traditionellen Islam ist. ,,Sind wir wirklich noch sicher in diesem Land?" fragte ein Professor stellvertretend für viele. ,,Gilt die Verfassung noch?"
Die muslimischen Intellektuellen stimmten darin überein, daß die Tragödie von Ayodhya nicht einfach auf einer ,,falschen Lagebeurteilung" beruhte, wie das die Regierung glaubhaft machen wollte. Sie waren überzeugt, daß die Zerstörer der Moschee mit der schweigenden
Duldung, ja mit der heimlichen Zustimmung von Premierminister Narasimha Rao rechnen konnten. Und sie zogen aus dieser Sicht der Dinge den einzig möglichen Schluß: Die Regierung in Delhi, geführt von der ehemals säkularen und liberalen Kongreß-Partei eines Jawaharlal Nehru, hat es aufgegeben, Recht und Verfassung gegenüber einer Kraft zu verteidigen, die ganz klar als faschistisch erkannt wird.
,,Das ist nicht eine Auseinandersetzung zwischen Hindu und Muslimen, sondern zwischen dem Faschismus und dem säkularen Staat, und diesen säkularen Staat hat die Regierung kampflos aufgegeben", sagten die Intellektuellen, die ja gerade deshalb in Indien geblieben und nicht nach Pakistan ausgewandert sind, weil sie oder ihre Eltern der säkularen Staatsidee vertrauten. ,,Wir glaubten, wir seien in Indien gleichberechtigte Partner", meinte ein Studentenführer. ,,Jetzt realisieren wir, daß wir 1947 betrogen wurden. In Wirklichkeit wurden wir im Namen von Demokratie und Säkularismus unterjocht." In Aligarh sah man das Debakel von Ayodhya auch als soziales Problem. ,,Die indische Gesellschaft ist nicht in Hindu und Muslime gespalten", sagte M. N. Faruqui, der damalige Rektor der Universität, ,,sondern in die oberen Kasten und in die rückständigen Klassen, zu denen auch die Muslime gehören. Hier geht es um ein wirtschaftliches Problem. Es ist der soziale Aufstieg der Muslime, der zu Zusammenstößen führt. Es kommt überall dort zu Unruhen, wo es wohlhabende Muslime gibt. Die Mehrheit will die Muslime in Unterdrückung halten." Nach Faruqui hat der Konflikt zwischen Indiens wichtigsten Religionen auch mit dem zunehmenden Bevölkerungsdruck zu tun. Immer mehr neue Leute drängen in Berufe und Tätigkeiten hinein, die bisher das angestammte Reservat einer bestimmten Gemeinschaft waren.
Die Vertreter der muslimischen Intelligenzija zeichneten von der eigenen Gemeinschaft das Bild einer rückständigen, marginalisierten Gemeinschaft, der ein gerechter Anteil am Kuchen der indischen Wirtschaft vorenthalten wird. Tatsächlich ist der Bildungsstand der Muslime in Indien unterdurchschnittlich; nur vier Prozent haben einen Schulabschluß. Nur 4,5 Prozent der in Indien so begehrten Regierungsjobs sind von Muslimen besetzt, und nur fünf Prozent der Bankkredite gehen an Muslime. Die Muslime fühlen sich von der indischen Gesellschaft ähnlich behandelt wie die Adivasi und die Dalit. Besonders erbittert gab sich die jüngere Generation. ,,Wir haben den Glauben an die indischen Institutionen verloren", sagte der Studentenführer Peerzada A. Saleem. ,,In Indiens politischem Körper steckt ein Virus. Der säkulare Grundgedanke ist keine politische Kraft mehr." Saleem hielt es für möglich, daß jetzt Indiens Muslime ihrerseits vermehrt Zuflucht im religiösen Fundamentalismus suchen, der weltweit im Vormarsch ist. ,,Aber es ist auch nicht auszuschließen, daß junge Leute jetzt zu den Waffen greifen, um gegen den aufkommenden Faschismus zu kämpfen. Enttäuschung führt zur Militanz." Wie in Kashmir.
Die Hindu-Mehrheit scheint umgekehrt zu denken, daß es die Muslime sind, die eine privilegierte Stellung einnehmen. ,,Die Muslime sind die am meisten gehätschelte Gemeinschaft", sagte mir in einem Interview kein anderer als Ashok Singhal, der Generalsekretär des Vishwa Hindu Parishad, des fundamentalistischen Welt-Hindu-Rats. ,,Sie haben mehr Rechte in der Verfassung als die Hindu. Nirgends in der Welt findet man eine Minderheit, die mehr Rechte hat als die Mehrheit. Es sind die Hindu, die diskriminiert und zu Bürgern zweiter Klasse gemacht werden."
Ashok Singhal machte die Ideologie der Hindu-Extremisten mit schonungsloser Offenheit klar: ,,Während der Muslim-Herrschaft wurden in Indien 30000 Tempel zerstört; die Hindu dagegen haben nie eine Moschee zerstört. Man kann zwei Geisteshaltungen unterscheiden in diesem Land. Die islamische Geisteshaltung zerstörte 30000 Tempel. Sie ist eine Philosophie, die es anderen Philosophien nicht erlauben will, sich auszubreiten. Wir wollen nicht 30000 Tempel zurück. Aber wir wollen die drei Plätze Ayodhya, Mathura (der Geburtsort von Krishna) und Kashi (der Vishwanath Tempel in Varanasi), die den Hindu so heilig sind wie Mekka den Muslimen oder der Vatikan den Katholiken. Die Hindu muß man nicht lehren, tolerant zu sein. Was in diesem Land vor sich geht, ist nicht religiöser Fundamentalismus, sondern Nationalismus, Suche nach der eigenen Identität, das Wiedererstehen einer Nation. Hinduismus ist keine Religion, so wenig wie Deutsch oder. Französisch eine Religion ist. Hinduismus ist eine Nation. In den letzten 800 Jahren wurde dieses Land von den Muslimen und von den Briten beherrscht, die nationalen Werte wurden unterdrückt: Was jetzt in diesem Land geschieht, ist das Erstehen eines Nationalismus." Liberale Analytiker machen gerade die Verunsicherung der Hindu in der modernen Gesellschaft dafür verantwortlich, daß eine an sich tolerante Religion - unter Verwendung des Feindbilds der Muslime - einen neuen Dogmatismus entwickelt. Und sie warnen vor dem faschistischen Kern, den diese Entwicklung in sich trägt. Swami Agnivesh, der radikale hinduistische Reformer, erklärt die geistigen Grundlagen des neuen Bekenntniseifers so: ,,Hinduismus ist genaugenommen keine Religion. Hinduismus ist eine Lebensweise, die die Mehrheit in diesem Land über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Mit dem Islam oder dem Christentum im Sinne eines konfessionellen Bekenntnisses ist der Hinduismus nicht vergleichbar. Hinduismus hat keine feste Gestalt, und das ist sowohl seine Stärke als auch seine Schwäche. Weil es keine vorgegebenen Dogmen gibt und weil keine Militanz dahintersteht, hat der Hinduismus Platz für jedermann. Hindu können glauben, was ihnen beliebt - oder auch gar nichts. Doch nun gibt es politische Wortführer, die vorgeben, daß der Hinduismus ohne Dogma und ohne hierarchische Strukturen dem Untergang geweiht sei. Sie glauben, daß auch wir ein Mekka haben sollten. Und so haben sie aus Ayodhya ein Mekka gemacht und aus Ram den Propheten."
Für den bekannten Soziologen Ashis Nandy - einen der wenigen Christen, der sich an der öffentlichen Diskussion über den Konflikt zwischen Hindu und Muslimen beteiligt - ist Ram nicht so sehr eine religiöse Figur, sondern ein Symbol für den Nationalismus der neuen städtischen Mittelklasse: ,,Hindutva (der Vorrang der Hindu-Kultur und -Religion) ist der Versuch, im Namen der Religion die Kontrolle über den modernen Nationalstaat und den technologischen Fortschritt zu gewinnen. Der Hindu-Dogmatismus ist gerade für jene verwestlichte Mittelschicht attraktiv, die ihre traditionellen Bindungen verloren hat und die daran ist, sich in die universelle Massenkultur zu integrieren, und die dadurch heimatlos zu werden droht." Deshalb kommt Ashis Nandy zum Schluß: ,,Hindutva (der Hindu- Dogmatismus) ist das Produkt des Verlustes der Hindu-Kultur. Hindutva wäre das Ende des Hindu-Glaubens." Wie im Islam ist der renitente ,,Fundamentalismus" in Wirklichkeit keine Rückkehr zur traditionellen Kultur, sondern ein modernistisches Konzept, dessen sich die neuen Führungsschichten, die Aufsteiger in der Bürokratie, der Wirtschaft, den freien Berufen bedienen. Die renommierte Historikerin Romila Thapar erklärt das so: ,,Die indische Mittelklasse hat einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Aber jetzt wird es schwierig, den neuen Status aufrechtzuerhalten. Der Wettbewerb wird immer intensiver, der Bevölkerungsdruck größer, und die Ressourcen sind begrenzt. Daraus resultiert eine tiefe Verunsicherung, und aus diesem Gefühl der Unsicherheit heraus wendet man sich wieder der Religion zu. Dazu kommt, daß die Leute im Prozeß der Modernisierung, der gleichbedeutend ist mit Verwestlichung, eine ganze Menge traditioneller Werte aufgegeben haben. Daraus ergibt sich ein Gefühl der Schuld. Und aus diesem Schuldgefühl heraus werden die Leute religiös - an der Oberfläche." Indiens innerer Friede ist durch die aggressive Hindu-Ideologie gefährdet wie noch nie seit der Teilung von 1947. In Frage gestellt wird das eigentliche Grundprinzip des indischen Staates, der im Namen des Säkularismus alle Religionen gleich behandeln will und damit bis jetzt das Zusammenleben der verschiedenen religiösen Gemeinschaften einigermaßen gesichert hat. Romila Thapar erklärt: ,,Alle Religionen, auch der Islam oder die Sikhs, haben aus den gleichen Gründen ähnliche Tendenzen. Aber hier handelt es sich um die Mehrheitsgemeinschaft, und das ist um so gefährlicher. Angestrebt wird die Herrschaft der Mehrheitsgemeinschaft statt die Herrschaft der Mehrheit. Das ideologische Resultat kann nur die Unterordnung der Nicht-Hindu sein. Was einen an diesem Konzept erschreckt, ist, daß es exakt die Elemente enthält, die den Faschismus ausmachen."
,,Die Mehrheit entwickelt die Komplexe einer Minderheit", faßt Ashis Nandy zusammen. Verunsichert sind nicht nur die Muslime, sondern auch die Hindu. ,,Der Muslim" als Angehöriger der Minderheit bietet sich hier an als der Sündenbock für alles, als ,,der Jude". ,,Der Muslim" wird zur Haßfigur, zum Blitzableiter, und das wurde in den erregten Wochen nach Ayodhya in unzähligen Gesprächen deutlich, wie sie trivialer nicht hätten sein können. ,,Warum sollen wir nicht unseren Hindu-Staat haben dürfen? Pakistan hat ja auch seinen islamischen Staat", hörte man zum Beispiel beim Abendessen, unter den
Angehörigen des indischen Mittelstands wohlgemerkt, gut gebildet, aufgeklärt, fortschrittlich. Und ob ich denn wisse, daß von den indischen Staatspräsidenten die Muslime zwei gestellt hatten und die Hindu nur fünf! Und wie viele der neun Premierminister, die im Unterschied zum Staatspräsidenten etwas zu sagen haben, waren Muslime? Keiner natürlich. Ein Geflecht aus Lügen und Vorurteilen, das immer gleich falsche Lied von der Bevorzugung der Muslime ist nicht auszurotten. Mit Vernunft ist dem nicht beizukommen, denn es handelt sich um unkontrollierte Reflexe, nicht des Kopfes, sondern der Eingeweide. An der Oberfläche ist es seit Ayodhya wieder ruhiger geworden. Sogar die mörderische Bombenserie mit 300 Todesopfern vom März 1993 in Bombay, die auf die anti-muslimischen Pogrome vom Dezember und Januar folgte und die auf den muslimischen Untergrund in Bombay zurückgeführt werden konnte, zog keine weiteren Unruhen nach sich. Es war, wie wenn nach einem heftigen Ausbruch kollektiven Wahnsinns wieder Vernunft eingekehrt wäre, zumal die Bombenattentate zeigten, wie groß das Zerstörungspotential eines muslimischen Rachefeldzuges wäre. Die Muslime zogen sich ohnehin ins eigene Schneckenhaus zurück; das erneute Trauma von Ayodhya hat bei ihnen höchstens die Tendenz gefördert, sich abzuschotten und sich in den eigenen Fundamentalismus zu flüchten.
Aber unter der Oberfläche bleibt das Problem bestehen; nichts wurde getan, um das Vertrauen der Muslime in den indischen Staat zurückzugewinnen. Dabei bedroht die mangelnde Integration der Muslime die indische Gesellschaft weit mehr als das Schicksal der anderen Minderheiten. Die Adivasi haben keine Lobby, sie kann man ungestraft weiter abdrängen und ihre Reste schließlich ,,sanskritisieren", in der Gesamtgesellschaft aufgehen lassen. Die Dalit sind ein inner-hinduistisches Problem; zudem bietet das demokratische System den Dalit und den unteren Kasten ein Ventil für ihre Ambitionen. Die Problematik der Muslime hingegen wird nicht einfach vorbeigehen, solange Indien nicht die politische und gesellschaftliche Großzügigkeit hat, seiner größten religiösen Minderheit entgegenzukommen und ihr einen sicheren und. hinreichend komfortablen Platz in der Gesellschaft zu sichern. An der Minderheit der Muslime muß sich die indische Staatsidee, die allen Gruppen und Gemeinschaften, auch den untersten, den Adivasi, den Dalit und den Muslimen, eine gleichberechtigte und faire Behandlung verspricht, bewähren - sie hat es bisher nicht genügend getan.
- Arbeit zitieren
- Gesa Hildebrandt (Autor:in), 1998, Minderheiten in Indien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99353
Kostenlos Autor werden




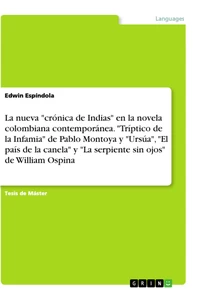

















Kommentare
Unglaublich, wieviel Wissen in dieser Arbeit steckt, die Sie in der Schule geschrieben haben. Sehr beeindruckend.
zu unübersichtlich.
etwas zu unübersichtlich
ein roman.
dieses referat braucht man sich nicht durchzulesen. es ist so lang dass man darauf bestimmt keine 1 bekommt.....hoechstens schriftlich
ein bissel viel, oda?.
sicher, dass das nur ein Referat sein sollte und nicht etwa eine Belegarbeit?
aber was ich so gelesen habe gefiehl mir ganz gut
referenzen?.
hi,
eigentlich ziemlich umfassende und gute arbeit, aber die quellenangaben fehlen - daher total unbrauchbar! waer klasse, wenn du den aufsatz noch so erweitern koenntest, dass er nachpruefbar wird. werde mich daher darauf beschraenken, deinen namen als quelle anzugeben - ob das meine profs ueberzeugt, wage ich mal zu bezweifeln... aber egal.
gruesse,
rena