Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
A / Ein theoretischer Bezugsrahmen
1. Zähneknirschen
1.1. Phänomenologie
1.2. Definition
1.3. Epidemiologie
1.4. Ätiologie
a) lokale / mechanische Ansätze
b) neurophysiologisch / systemische Ansätze
c) psychologische Ansätze
d) Zusammenfassung
2. Psychosomatik
2.1. Konzeptuelle Schwierigkeiten
2.2. Der Situationskreis
a) Prämissen
b) das Modell
c) praktische Implikationen
d) empirische Evidenz
2.3. Diskussion
B / Das interdisziplinäre Bruxismusprojekt
3. Behandlungskonzept
3.1. Diagnose
a) allgemeines Vorgehen
b) zentrale Befunde
3.2. Therapie
a) zahnmedizinische Komponente
b) physiotherapeutische Komponente
c) psychologische Komponente
d) informative Komponente
3.3. Zusammenfassung
4. Versuchsplanung
4.1. Fragestellung
a) Kriterien einer Therapieevaluation
b) weitere interessierende Zusammenhänge
c) Zusammenfassung
4.2. Messinstrumente
a) objektive Parameter
b) subjektive Parameter
4.3. Methodik
a) Hypothesen
b) konkreter Versuchsablauf
c) kritische Bemerkungen
C / Statistische Datenanalyse
5. Stichprobe
6. Bruxismus
6.1. Deskription
a) Interraterreliabilität
b) Schlafqualität
c) Bruxismusaktivität
d) Kennwerte
e) Resultate
6.2. Entscheidungsstatistik
a) allgemeine Betrachtungen
b) Hypothesenprüfung
7. Fragebogen
7.1. Deskription
a) Gütekriterien
b) Itemanalyse
c) Verlauf
d) Bemerkungen
7.2. Entscheidungsstatistik
a) Verlauf
b) Verknüpfung der Evaluationskriterien
8. Tagebuch
8.1. Deskription
8.2. Exploration
a) a posteriori Hypothesen
b) Folgerungen
9. Diskussion
9.1. Zusammenfassung der Resultate
9.2. Abschliessende Bemerkungen
a) objektiver Nutzen
b) subjektiver Nutzen
10. Literaturverzeichnis
D / Anhang
11. Signierungsanleitung
12. Fragebogenitems
12.1. Fragebogen 1
12.2. Fragebogen 2 / 3
13. Tagebuch
14. Rohdaten
14.1. Bruxismus
14.2. Fragebogen
14.3. Tagebuch
Zusammenfassung:
In der vorliegenden Arbeit wurde ein interdisziplinäres Behandlungskonzept für Bruxismus (Meili, Meyer & Tritscheler, 1997) empirisch evaluiert. Die Gruppentherapie setzt, mit einer zahnärztlichen, einer physiotherapeutischen und einer psychologischen Komponenten, einerseits b ei den bekannten ätiologischen Faktoren des Bruxismus an. Andererseits wird das Konzept mittels einer kognitiven, informativen Komponente auch den Anforderungen gerecht, die aus der aktuellen psychosomatischen Forschung abgeleitet werden können.
Als objektive Evaluationskriterien dienten Aufzeichnungen von 14 starken Knirschern der Masseter- und Temporalismuskulatur während des Nachtschlafes. Nach der erfolgten Behandlung liess sich eine durchschnittliche Reduktion des nächtlichen Bruxismus um rund 18% feststellen, die jedoch keine statistische Signifikanz erreichte.
Als subjektive Erhebungsinstrumente dienten Fragebogen und Tagebücher. Vor dem Behandlungsbeginn wurde die Erwartungshaltung der Teilnehmenden erfragt, in der Mitte der Behandlung und zu deren Schluss der tatsächlich wahrgenommene Nutzen. Während das Ausmass der Erwartungshaltung mit der ersten Nutzeneinschätzung tendenziell zusammenhing, bestand kein Zusammenhang zur zweiten Nutzenbeurteilung mehr. Der Einfluss der Erwartungshaltung reduzierte sich mit der Zeit, während die Nutzeneinschätzung selbst stabil blieb. Der Zusammenhang zwischen den subjektiven und objektiven Evaluationskriterien fiel positiv aus, die Enge des Zusammenhanges entsprach den in der Literatur üblicherweise berichteten Zahlen.
Anhand der Tagebuch-Aufzeichnungen konnte auf eine hohe Compliance geschlossen werden. Die Teilnehmenden zeigten zudem eine differenzierte Wahrnehmung der mit dem Bruxismus korrelierenden Faktoren. Trotzdem konnte der Bruxismus per se nicht valide wahrgenommen werden. Diesbezügliche Angaben standen vielmehr mit dem Vorhandensein von Schmerzen, Verspannungen sowie mit einer schlechten Schlafqualität im Zusammenhang.
Einleitung:
Aufgrund ihrer professionellen Tätigkeit wurden die Herren Urs Meili (Zahnarzt), Thomas Meyer (Psychiater) und Thomas Tritscheler (Physiotherapeut) auf einen nicht gedeckten Therapiebedarf für Zähneknirscher aufmerksam. Im interdisziplinären Austausch entstand, dank einem überdurchschnittlichen Engagement, ein entsprechendes multimodales Therapieprogramm. Das Konzept wurde in einer ersten Therapiephase schon mit der Realität konfrontiert. Dabei konnten erfreuliche Resultate, wie die Abnahme spannungsbedingter Schmerzen, eine Verbesserung der Gesamtbefindlichkeit, usw. erzielt werden. Die persönlichen Rückmeldungen, sowie die Compliance der Teilnehmer waren zudem äusserst positiv (vgl. Meili , Meyer & Tritscheler, 1997).
In einem zweiten Durchlauf, das heisst im vorliegenden Projekt, soll die Effektivität des Behandlungsmodells nun mit statistischen Methoden geprüft werden. Dank der Existenz der Projektgruppe Bruxismus an der Abteilung klinische Psychologie der Universität Zürich haben Ursula Zanardi und ich das Glück, dieses neuartige Therapiekonzept im Schlaflabor begleiten zu dürfen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Effektivität des Behandlungsprogrammes zu untersuchen.
“ ..., denn wenn man knirscht kann man nicht weinen. ” (Goethe, 1767, Brief an Behrisch)
“ Wenn Matrosen gepeitscht werden sollen, so nehmen sie zuweilen ein Stück Blei in den Mund, um es mit äusserster Kraft zu beissen und so den Schmerz zu ertragen. ”
(Darwin, 1872)
A / Ein theoretischer Bezugsrahmen
1. Zähneknirschen
1.1.Phänomenologie
In der wissenschaftlichen Literatur wird das Phänomen des Zähneknirschens erstmals 1872 von Charles Darwin in seiner Untersuchung der Affektexpressionen erwähnt. Darwin geht bezüglich des Ausdruckes der Emotionen von folgender Prämisse aus:
“Any nerve tension, which in an inscrutable way produces in us the state we call feeling, must expend itself in some directive - must generate an equivalent manifestation of force somewhere. (... It) will manifestly take the most habitual routes; (...) consequently the facial (...) muscles, which are the most used, will be apt to be brought first into action. ” (Spencer, zit. nach Darwin, 1872/1987, S.54)[1]. Um möglichst unverfälschte Expressionen analysieren zu können, hielt sich Darwin in seinen Beobachtungen vor allem an Kinder, Behinderte und Tiere. Bei allen drei Gruppen fand er dann auch das Zähneknirschen vor, welches er vor allem mit Schmerzzuständen oder Angst in Verbindung brachte.
Anfangs dieses Jahrhunderts stiessen Marie & Pietkiewicz (1907), zwei französische Neurologen, auf dasselbe Phänomen, jedoch in einem anderen Kontext. Sie beobachteten Zähneknirschen im Zusammenhang mit kortikalen Gehirnläsionen und anderen zerebralen Syndromen, wie z.B. Chorea, multiple Sklerose und Paralysen. Für ihre Beobachtungen prägten sie den Ausdruck ‚Bruxomania‘[2].
Mit diesen zwei Pionierarbeiten zu der Thematik des Zähneknirschens öffnete sich, für Psychologen und Mediziner gleichermassen, ein weites Forschungsfeld. Diese Tatsache äussert sich auch in den verschiedensten Bezeichnungen, die in der Literatur für dieses facettenreiche Phänomen existieren. Im folgenden werden wir für das Zähneknirschen den heute wohl gebräuchlichsten Terminus des ‘Bruxismus‘ verwenden.
Bruxismus gilt als die häufigste und schädlichste Parafunktion des menschlichen Kauorgans, das sich aus den Zähnen, dem Stützgewebe, den Kiefern und Gelenken, der Muskulatur und der zugehörigen Innervation zusammensetzt. Diese bilden zusammen eine funktionale Einheit, die in der medizinischen Literatur als das stomathognathe[3] System bezeichnet wird. Die häufigsten Tätigkeiten dieses Systems sind der Kauakt, der Schluckakt, sowie Kaubewegungen bei leerem Mund (Pressen oder Reiben). Ebenso ist das stomathognathe System wesentlich am sprachlichen Ausdruck, der Atmung, sowie an psychomotorischen Affektexpressionen beteiligt. Der weit verbreitete Ausdruck der (oralen) Parafunktion ist als Überbegriff für alle (qualitativen und quantitativen) Fehlfunktionen des stomathognathen Systems zu verstehen, so z.B. auch für Kaugummikauen, Daumenlutschen, Lippenbeissen, etc. (vgl. Koeck, 1982).
Bruxismus bezeichnet also das Reiben oder Pressen der Zähne zu nichtfunktionalen Zwecken. Der Musculus masseter, sowie der Musculus temporalis[4] sind dabei für die hauptsächlichen Kieferbewegungen verantwortlich (siehe Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die in dieser Arbeit namentlich erwähnte Muskulatur. Gezeichnet nach den Angaben von Rohen & Yokochi (1988).
Während beim normalen Kauen Kräfte von 2-5 Kilopond auftreten, bzw. beim Kauen von weichem Brot 0,2 kp erforderlich ist, werden bei bruxistischen Aktivitäten zwischen 20 und 30 kp wirksam. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Kieferschlussge- schwindigkeit beim Bruxieren (180 mm/sec.) ungedämpft bis zum Kieferschluss wirkt. Beim normalen Kauzyklus ist diese Geschwindigkeit einerseits anfänglich schon erheblich kleiner (100 mm/sec.), andererseits wird sie vor dem Zahnkontakt noch stark abgebremst. Ebenso übersteigt die Dauer der Zahnkontakte beim Zähneknirschen diejenige bei normalem Kauen um ein Vielfaches (Körber, 1995, S. 49, 60). Es manifestieren sich durch diese massive, neuronal nicht gehemmte Hyperaktivität eine Reihe klinischer Symptome, die im folgenden nach den Bestandteilen des stomathognathen Systems gegliedert sind (vgl. Ruppenthal, 1989,S.6 ff.):
- Zähne: Abrasionsfacetten, Hypersensibilität, Kronenfrakturen, Abbröckeln des Schmelzes.
- Stützgewebe: Entzündungen (Parodontitis); erhöhte Zahnbeweglichkeit.
- Kiefergelenke: Gelenkgeräusche; Berührungsschmerzen (Palpationsdolenz); strukturelle Deformierungen; muskulär bedingte Beschwerden (funktionelle Myoarthropathien), z.B. Bewegungseinschränkungen. Diese Symptome werden zusammen als ‘Myofasciales‘, oder ‘Temporomandibuläres Schmerzsyndrom‘ bezeichnet.
- Muskulatur: Spasmen; Mitbeteiligung benachbarter Muskelgruppen, die zu Nacken-, Schulter- und Kopfschmerzen führt; Zunahme des Zellvolumens (Hypertrophie).
- Sonstiges: Kopfschmerzen, Migräne; Schlafverflachung.
Betrachtet man die Symptomliste und das Ausmass der wirksamen Kräfte, so wird verständlich, warum Bruxismus zuweilen als ‘selbstdestruktiv‘ bewertet wird. Chronisches Zähneknirschen kann einen erheblichen Leidensdruck verursachen.
1.2. Definition
Im ICSD (Schramm & Riemann, 1995, S.95/96) findet sich folgende Definition des Krankheitsbildes: “Bruxismus ist eine stereotype Bewegungsstörung, die durch Zähneknirschen oder Zusammenbeissen der Zähne gekennzeichnet ist. ” Folgende drei Merkmale gehören zu den Minimalkriterien: “1.Abnormale Abnützung der Zähne; 2.Geräusche im Rahmen des Bruxismus; 3.Beschwerden mit der Kiefermuskulatur. ” Bruxismus fällt hier unter die Kategorie der Parasomnien, genauer unter diejenige der Aufwach-, oder Arousal-Störungen. Die experimentellen Befunde, die zu einer solchen Taxonomie führt, werden im Kapitel 1.4. (S.11 f.) dargelegt werden.
Es wurden verschiedene Versuche unternommen, innerhalb dieses Krankheitsbildes weitere Unterscheidungen zu treffen. Aus zahnmedizinischer Perspektive (Ruppenthal, 1989) wurden die Kategorien des ‘zentrischen‘ und ‘exzentrischen‘ Bruxismus eingeführt, womit zwischen den verschiedenen Lokalisationen der Schlifffacetten differenziert werden soll. Eine solche Einteilung bringt jedoch keine praktischen Implikationen mit sich und erweist sich somit als irrelevant.
In der Literatur häufiger anzutreffen ist eine Differenzierung, die zwischen dem Zähneknirschen tagsüber (‘diurnal‘) und dem nächtlichen Zähneknirschen (‘nocturnal‘) unterscheidet, zu deren Kennzeichnung dann auch die Termini ‘Bruxomanie‘, bzw. ‘Bruxismus‘ eingesetzt wurden. Reding, Zepelin & Monroe (1968) sprechen, mit dem Argument, dass wir hier mit verschiedenen Bewusstseinszuständen konfrontiert seien, von verschiedenen Krankheitsentitäten. Des weiteren führen sie aus, dass das nächtliche Knirschen mit typischen Geräuschen verbunden sei, die man tagsüber nicht beobachten könne. Sie sehen ihre Annahme schliesslich darin bestätigt, dass ihre untersuchten nächtlichen Knirscher in Interviews nicht von Zähneknirschen tagsüber berichteten. Dieser Schluss scheint mir jedoch keineswegs zwingend. So konnte in einer Studie mit tragbaren EMG-Geräten nachgewiesen werden, dass das Zähneknirschen tagsüber selten die Bewusstseinsschwelle überschreitet (Rugh & Solberg, 1976, S.17f.)[5]. Zudem berichteten die, auf die Wahrnehmung von Bruxismus sensibilisierten Teilnehmenden des vorliegenden Projektes zum Teil sehr wohl von einer Knirschaktivität tagsüber. Olkinoura (1969) vertritt, in Opposition zu Reding et al. (1968) die Meinung, dass Überschneidungen von Knirschen tagsüber und Knirschen in der Nacht nicht mit Sicherheit auszuschliessen seien. Des weiteren sei eine solche Differenzierung mit unnötigen Komplikationen in der Konzeption des Bruxismus verknüpft, zu deren Erklärung noch keine Vorschläge gemacht wurden. Diesen Mangel versucht er zu beheben, indem er die Begriffe des ‘strain[6] ‘ (für das Knirschen tagsüber) und des ‘non- strain bruxist‘ (für die nächtlichen Knirscher) einführt, die er in psychologischen Kriterien zu verankern versucht. Demnach sollen Menschen, die unter Tags knirschen erhöhte Aggressionswerte, vermehrt emotionale Störungen und einen höheren Bewusstheitsgrad der Störung bzw. der auslösenden Faktoren aufweisen. Diese Annahmen konnten empirisch jedoch nicht bestätigt werden.
Im ICSD werden weitere Einteilungen nach Schweregrad und Dauer der Störung vorgeschlagen. Da sich die Bruxismussypmtome über längere Zeiträume hinweg ausbilden (und regenerieren), ist die Manifestationsdauer jedoch mit Sicherheit nicht, oder lediglich unzuverlässig bestimmbar. Auch die eigentlich sinnvolle Unterteilung nach dem Schweregrad der Störung dürfte sich im klinischen Alltag, wegen der zu abstrakten Definitionskriterien der Kategorien, kaum durchsetzen. Eine genaue Beschreibung der vorhandenen Symptomatik wird unumgänglich bleiben.
Im folgenden wird die Bezeichnung des Bruxismus für sämtliche Knirschaktivitäten verwendet, die nicht auf andere, primäre Störungen (z.B. Epilepsie) zurückzuführen sind.
1.3. Epidemiologie
Angesichts der erörterten differentialdiagnostischen Probleme erstaunt es nicht, dass die Häufigkeitsangaben für Bruxismus zwischen 5% und 80% schwanken. Dazu kommt, dass die Störung bloss im Schlaflabor valide festgestellt werden kann. Bei grossangelegten Studien sind die Untersucher gezwungen aus der umfangreichen Symptomliste eine Auswahl zu treffen, was die Häufigkeitsangaben stark verzerren kann. Bruxismus führt oft erst nach Jahren zu akuten Beschwerden an den Kiefergelenken; auch Zahnabrasionen erlauben keinen Rückschluss auf akuten Bruxismus. In der Regel liefern Befunde zur Kaumuskulatur die zuverlässigsten Daten.
Andere Ursachen dieser starken Schwankungen sind die unterschiedlichen Stichproben und die damit verbundene Varianz der multikausalen Faktoren des Bruxismus, sowie die Anwendung verschiedenster Untersuchungsmethoden. Der Vergleich der Daten wird durch die unterschiedlichen Forschungsdesigns und Krankheitskriterien erheblich erschwert. Im folgenden versuchen wir, anhand einiger ausgewählter Studien, uns einen Überblick über die epidemiologische Forschung zum Bruxismus zu verschaffen.
Hicks & Conti (1989) erhoben bei 1‘150 Studenten mittels Fragebogen die Schlafgewohnheiten, wie auch allfällige Hinweise für ein nächtliches Zähneknirschen. Anhand der Antworten vermuteten sie, dass 20,5% der befragten Stichprobe Bruxisten sind. Sie verglichen diese Zahlen mit früheren Fragebogenerhebungen anderer Forscher und stellten eine statistisch signifikante Zunahme fest. 1966 ergaben sich bloss bei 5.1% der 2'290 untersuchten Studenten Hinweise auf Bruxismus, während es 1981 dann schon 13.4% von immerhin 1'050 Studenten waren. Hicks & Conti vermuten, dass dieser eindrückliche Trend auf andersartige Lebensstile, sowie insbesondere auf ein Mehr an Stress zurückzuführen sei.
Es sind bei dieser Art von Studien jedoch verschiedene Kritikpunkte anzubringen. Die erfragten Items sind beispielsweise nicht aufgeführt; wurden in diesen drei Untersuchungen überhaupt dieselben Fragen gestellt? Alternativerklärungen, wie ein erhöhtes Bewusstsein gegenüber dieser Störung, sind nicht auszuschliessen. Die Studenten könnten beispielsweise vermehrt entsprechende Hinweise von ihren Zahnärzten erhalten haben, was bei der ständig wachsenden Zahl von Publikationen zu diesem Thema nicht erstaunen würde. Die Methode der Fragebogenerhebung scheint mir zudem für diesen Zweck prinzipiell nicht geeignet, da das erfragte Verhalten, auch bei entsprechender Sensibilisierung der Wahrnehmung, vorwiegend unbewusst ist (siehe auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit). Trotzdem sind die Befunde interessant und regen zum Weiterdenken an. Ist etwa die Zahl der Menschen, die wegen Kiefergelenkbeschwerden Arztpraxen aufsuchen, ebenfalls angestiegen?
Solche Inzidenzstudien sind in der Literatur nicht zu finden; es existieren jedoch Angaben zur Prävalenz von Bruxismus in Populationen von Zahnarztpraxen. Den Querschnittstudien zufolge konnte durchschnittlich bei 50% der jeweils über 1'000 untersuchten Patienten eine Myoarthropathie festgestellt werden. Als tatsächlich behandlungsbedürftig wurden 25-30% der untersuchten Stichproben erachtet (vgl. Motsch, 1985). Eine solche administrative Prävalenz ist für die Gesamtbevölkerung aber nicht repräsentativ. Wigdorowicz, Czeslaw, Panek, Maslanka, Plonka & Palacha (1979) untersuchten eine Stichprobe von 2'000 Soldaten, wobei sie Abrasionsfacetten und Symptome der Kaumuskulatur als Krankheitskriterien nahmen. Es zeigten sich bei 57% der (wiederum nicht zufälligen) Stichprobe funktionelle Störungen, was den in Arztpraxen festgestellten Zahlen erstaunlich gut entspricht.
Oft findet man die Behauptung, dass Bruxismus eine typische westliche Zivilisations- krankheit sei, die mit unserer Umwelt, die voll von potentiellen Stressoren ist, zu tun habe. Dass diese Behauptung nicht aufrecht erhalten werden kann, zeigen Studien an Populationen, die fernab von unserem Kulturkreis liegen (vgl. Motsch, 1985). So litten von 320 untersuchten Lappländern 66% an Berührungsschmerzen der Kaumuskulatur, 48% an Palpationsschmerzen bei den Kiefergelenken. In einer Stichprobe von 215 Beduinen, die ethnisch gänzlich isoliert leben, wiesen gar 84% Berührungsschmerzen der Kaumuskulatur auf, während bei 30% eine Palpationsdolenz der Kiefergelenke festgestellt wurde.
Gibt es einen Geschlechtsunterschied beim Zähneknirschen? Zieht man die Zahlen zu Rate, die in Arztpraxen und Kliniken gesammelt wurden, erhält man ein Verhältnis von durchschnittlich drei Frauen auf einen Mann (Schulte, Lukas & Sauer, 1981). In Querschnittstudien an nichtselektierten Populationen zeigen sich jedoch keine Geschlechtsunterschiede (Motsch, 1985). Frauen suchen bei gesundheitlichen Beschwerden eher professionelle Hilfe auf, ein Phänomen, das auch im Zusammenhang mit anderen Störungsbildern beobachtet werden kann.
Welche Altersgruppen sind betroffen? In den Zahlen der Praxen und Kliniken zeigt sich ein Gipfel bei den 20-40 jährigen (Schulte et al., 1981), der bei nichtselektierten Populationen nicht mehr zu beobachten ist. In allen untersuchten Altersgruppen (7-70 Jahre) zeigen sich gleich häufig Symptome einer Dysfunktion (Motsch, 1985). Bei Kindern nimmt man an, dass hinter diesen Symptomen vorwiegend altersspezifische Bedingungsfaktoren liegen, wie etwa das allgemeine Wachstum, der Verlust der ersten Zähne, oder aber auch das Fehlen von Sprach- und Handlungskompetenzen. Bei Kleinkindern ist das Pressen und Reiben der Kiefer sogar förderlich für das Zahnen (vgl. Nadler, 1957)[7].
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bruxismus ein universales Verhaltensmuster ist. Symptome, die auf Bruxismus hinweisen, lassen sich bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung beobachten, wobei diese bei rund 20% der Bevölkerung ein pathologisches, behandlungsbedürftiges Ausmass annehmen (Greene & Marbach 1982; Motsch, 1985). Damit kommt die Frage auf, welche Faktoren dieses weit verbreitete Verhaltensmuster pathologisch werden lassen.
1.4. Ätiologie
Bruxismus hat eine komplexe, multikausale Pathogenese. Im Zentrum der Erklärungshypothesen stehen ein muskulärer Hypertonus und eine muskuläre Hyperaktivität, aufgrund welcher die Gewebe unphysiologisch belastet werden. Nach einem Vorschlag von Glaros & Rao (1977) werden die zahlreichen Theorien zur Entstehung des Bruxismus üblicherweise in mechanische/lokale, neurophysiologische/systemische und psychologische Ansätze unterteilt. In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Modelle und Forschungsergebnisse dieser Erklärungsansätze diskutiert werden.
a) mechanische / lokale Ansätze
Eine in der Zahnmedizin weit verbreitete Lehrmeinung sieht in okklusalen[8] Disharmonien die entscheidende Ursache für den Bruxismus. Darunter sind vorzeitige Kontakte und Gleithindernisse zu verstehen, die z.B. bei zu hohen Füllungen und Zähnen, Aufrauhungen des Zahnschmelzes durch Zahnstein und Säuren, sowie bei asymmetrischen Zahnstellungen gegeben sind.
Da die Dichte der Rezeptoren in der Mundhöhle beinahe gleich hoch ist wie an unseren sensiblen Händen, löst schon die geringste okklusale Störung Reaktionen aus. Die vergleichsweise niedrige Reizschwelle und die langsame Reizadaptation der Mechanozeptoren in der Mundhöhle verstärken deren Reaktionsbereitschaft zusätzlich (vgl. Mohl, Zarb, Carlsso & Rugh, 1990).
Grundsätzlich funktioniert das stomathognathe System autonom, nach dem Prinzip eines Regelkreises. Dabei reagiert der Organismus auf Okklusionsstörungen mit einer primären muskulären Hypertonizität und -aktivität, was durchaus als funktional zu beurteilen ist. Ihr Zweck ist es nämlich, entweder durch Abreiben störende Zahnflächen zu eliminieren, oder durch Pressen günstigere Positionierungen der Zähne zu bewirken. Dieser Mechanismus ist peripher gesteuert und soll, nach dem Prinzip des Eigenreflexes, eine optimale individuelle Okklusion gewährleisten (Mohl et al., 1990). Sind die Disharmonien eliminiert, stellt sich auch die Hyperaktivität und -tonizität wieder ein.
Dieser Ansatz ist insofern attraktiv, als dass er einfach und mit einer klaren Therapieindikation verbunden ist. Tatsächlich zeigen vielen Patienten nach einer zahnärztlichen Optimierung der Okklusion Besserungen, v.a. der muskulären Symptome (vgl. Ramfjord, 1961). Der Einsatz von Zahnschienen ist ebenfalls üblich, sie helfen weitere Zahnschäden zu vermeiden, und eliminieren die auslösenden Okklusionshindernisse wenigstens während der Nacht.
In Experimenten konnte der postulierte ‘Zahnschleifreflex‘ tatsächlich nachgewiesen werden, z.B. an dezerebrierten Katzen (Yemm, 1976, S.34). Doch beweisen solche Experimente lediglich die Existenz einer peripheren Verknüpfung und sagen nichts über die normale Funktionsweise des Organismus aus. Eine Übertragung auf den Menschen ist zudem fragwürdig, hier liegen auch kontroverse Befunde vor. So konnte z.B. bei Experimenten mit künstlich eingesetzten Okklusionshindernissen nicht von allen Forschergruppen eine Zunahme des Muskeltonus registriert werden (vgl. Birner, Wankmüller, Dhingra-Rother & Kraiker, 1994). Ebenso weisen nicht alle Bruxisten okklusale Disharmonien auf. Die Annahme einer rein reflektorischen, peripheren Reaktion ist nicht gesichert, vielmehr scheinen auch höhere, kortikale Zentren mitbeteiligt zu sein. Dieser Ansatz liefert also eine wertvolle, mögliche Ausgangsbasis, ist aber zur Erklärung von Bruxismus weder notwendig noch hinreichend.
b) neurophysiologische / systemische Ansätze
Diese Teiltheorien knüpfen an den Beobachtungen der Neurologen Marie & Pietkiewicz (1907) an und untersuchen zentrale Dysfunktionen und Mechanismen, die für den Bruxismus verantwortlich gemacht werden können. Dabei scheint das limbische System, als “integrales Regelkreissystem, das alle Adaptationsleistungen des Organismus auf exogene sowie auch endogene Umweltveränderungen auslöst”, massgeblich beteiligt zu sein (Graber, 1995, S.55). In diesem Zentrum, das den Hypothalamus (vegetative Organe und somatisches NS) und die Hypophyse (Hormonhaushalt) ansteuert, werden insbesondere emotionale und psychosomatische Phänomene, z.B. Stressreaktionen, Aggressivität, Angst, usw. gesteuert. Solche psychoemotionalen Spannungszustände senken unter anderem auch die Reizschwelle der (Zahnschleif-) Reflexe (Graber, 1972, S.28).
Das spezielle Postulat dieser Theorien beinhaltet einen chronischen, zentral erhöhten Muskeltonus, der entweder die Reflextätigkeit überlagert und perpetuiert, oder aber auch per se zu Bruxismus führen kann. Das allgemeine Adaptationssyndrom nach Selye ist dabei von zentraler konzeptueller Bedeutung, wonach der Körper auf unterschiedlichste Stressoren mit einem unspezifischen Muster reagiert (vgl. Schandry, 1988, s.74 ff.). Der Organismus erhöht angesichts realer oder imaginärer Bedrohungen sein energetisches Niveau, um auf allfällig notwendige Handlungen vorbereitet zu sein. Der ökonomische Normalbetrieb wird aufgehoben, alle Energie, die der Körper aufbringen kann, wird freigestellt. Nach einer allgemeinen sympathischen Erregung (Alarmreaktion) folgt eine hypophysär gesteuerte, erhöhte Katecholaminausschüttung[9], eine Erhöhung des Stoffwechsels, usw. Diese Widerstandsphase kann über längere Zeit aufrecht erhalten werden; dem Körper werden keine, oder lediglich kurze Erholungsphasen gewährt. Die unspezifische Aktivitätssteigerung des Adaptationssyndroms kann somit auch die Grundlage für eine chronische Hyperaktivität und -tonizität der Kaumuskulatur, bzw. für den Bruxismus bilden.
Das Phänomen der erhöhten Muskelspannung unter mentalem und physischem Stress wurde oft repliziert. Schon das Lösen einer Intelligenzaufgabe genügt, um die Spannung der Kieferschliessmuskulatur gegenüber dem Entspannungszustand durchschnittlich um 34% zu steigern. Bei Serien von solchen Leistungsaufgaben, zeigte die gesunde Kontrollgruppe eine progressive Entspannung über die Aufgabenserie hinweg, wohingegen der Tonus bei der Gruppe mit oralen Dysfunktionen konstant erhöht blieb. Weiter fanden Mercuri, Olson & Laskin (1979) bei den Probanden mit myofascialem Schmerzsyndrom schon vor dem Experiment einen höheren Baselinetonus der Kiefermuskulatur, sowie eine, im Vergleich mit der Kontrollgruppe, unverhältnismässig hohe Stressreaktion der Kiefermuskulatur. Sie nehmen aufgrund ihrer Resultate eine orale Reaktionsspezifität bei Patienten mit myofascialer Symptomatik an.
Weitere Evidenz für eine zentral erhöhte Aktivation bei Knirschern kommt vor allem aus Schlaflaborstudien. Evaskus & Laskin (1972) konnten bei Patienten mit myofascialem Schmerzsyndrom im Urin eine Katecholaminkonzentration beobachten, die gegenüber der gesunden Kontrollgruppe um 118% erhöht war. Clark, Rugh & Handelmann (1980) korrelierten die nächtliche EMG-Aktivität von Bruxisten mit der Adrenalinkonzentration im Morgenurin, wobei sie einen erstaunlich hohen Koeffizienten von 0.72 feststellen konnten. In anderen Schlaflaborstudien konnte eine immer mit bruxistischen Episoden auftretende Herzfrequenzerhöhung beobachtet werden, sowie häufig auch Vasokonstriktionen am Finger, Unregelmässigkeiten in der Respiration, sowie eine allgemeine motorische Aktivitätssteigerung (Birner et al., 1994, S. 148). Eine experimentelle Erhöhung des Aktivierungszustandes durch die Gabe von Medikamenten, wie z.B. Amphetaminen, hat ebenfalls ein verstärktes Auftreten bruxistischer Episoden zur Folge. Analog dazu senkt eine Verabreichung von Sedativa vor dem Schlafengehen die bruxistische Aktivität, oder lässt sie kurzfristig ganz verschwinden (Birner et al., 1994, S. 149). Bruxismus wirkt sich auch auf die Schlafarchitektur aus, Knirschepisoden sind häufig von einem, den Schlaf verflachenden Stadienwechsel begleitet. Es zeigt sich zudem, eine mittlere Korrelation zwischen der Anzahl der Knirschepisoden und der Schläfrigkeit beim Aufstehen (vgl. Maetzler, 1997). Aufgrund der eben referierten Beobachtungen wird Bruxismus als Arousalstörung bezeichnet.
Ebenfalls zu dieser Gruppe von Erklärungsansätzen werden die Untersuchungen gezählt, die eine erbliche Komponente als Erklärung des Bruxismus favorisieren. Neben vielen retrospektiven Befragungen von Betroffenen, die zahlreichen Fehlerquellen ausgesetzt sind, gibt es zu diesem Erklärungsansatz eine methodisch saubere Studie von Lindqvist (1974). Sie untersuchte 117 ein- und zweieiige Zwillingspaare und fand bei 54% Abrasionsfacetten, wobei der Anteil an vorgefundenen Schlifffacetten in beiden Gruppen gleich hoch war. Bei den eineiigen Zwillingen wiesen, mit Ausnahme eines Paares, immer beide Kinder gleichzeitig oder keine Symptome von Bruxismus auf. Bei zweieiigen Zwillingen war das Vorhandensein dieses Symptomes hochsignifikant weniger spezifisch für ein Zwillingspaar. Weiter zeigte sich, dass bei den eineiigen Zwillingen, im Gegensatz zu den zweieiigen, deutlich mehr Paare dieselben Abrasionsmuster aufwiesen. Diese Beobachtungen weisen auf einen genetischen Faktor bei Bruxismus, bzw. bei den Kieferbewegungsmustern hin. In Bezug auf die weiter untersuchten Merkmale der Palpationsdolenz und der okklusalen Hindernisse konnten keine Hinweise auf eine erbliche Beteiligung gefunden werden.
Die Evidenz für die neurophysiologisch/systemischen Theorien sieht überzeugend aus. Die indizierte Therapie wäre gemäss diesem Ansatz jede Form von Entspannung. Die Methoden, die am häufigsten angewendet werden sind das autogene Training (AT), die progressive Muskelrelaxation (PMR), sowie das Biofeedback (BF). Empirische Untersuchungen zu diesen Ansätzen zeigen stark widersprüchliche Ergebnisse auf (vgl. Koller, 1995; Wojnilower & Gross, 1981); die Methoden des AT und BF scheinen jedoch die wirksameren zu sein (Bazzana, 1994). Gemäss subjektiven Einschätzungen bringen alle drei Verfahren eine körperliche Entspannung mit sich, beim AT wird zudem eine geistige Relaxation wahrgenommen (Bazzana, 1994).
Gewisse Resultate, wie z.B. die orale Reaktionsspezifität, oder die subjektive Komponente der Stresswahrnehmung lassen auch psychologische Komponenten interessant werden, insbesondere weil sich körperliche (Spannungs-) Zustände und psychische Strukturen gegenseitig beeinflussen können (vgl. Rosenberg, Rand & Asay, 1993).
c) psychologische Ansätze
Unter psychoanalytischer Perspektive wird Bruxismus als Konversionsreaktion eines seelischen Spannungszustandes verstanden. In der Tat weisen Bruxisten ein höheres körperliches Spannungsniveau auf, das von Psychoanalytikern auf internalisierte Konflikte zurückgeführt wird. Bezüglich des Konfliktinhaltes differieren die gegebenen Interpretationen jedoch so stark (vgl. Rugh & Solberg, 1976), dass sie als beinahe beliebig erscheinen. Das hohe Abstraktionsniveau der klinischen Theorie der Psychoanalyse verbietet leider jegliche Verifizierung.
Allgemeine psychodynamische Untersuchungen mit projektiven Verfahren versuchen eine syndromale Erfassung der Bruxismuspersönlichkeit. Gruber (1980) untersuchte mittels dem TAT, dem Rorschachtest und der biographischen Anamnese 20 Versuchspersonen, die alle eine auf Bruxismus lautende zahnärztliche Diagnose hatten. Dabei stellte er folgende 4 Syndrome fest, die sich meiner Meinung nach teilweise stark überlappen:
- Frustriertes Bedürfnis nach Achtung und diesbezügliche Kompensationen ;
- Ungenügende Realitätskontrolle, egozentrisch-narzistische Abkapselung;
- Mangelnd integrierte Affektivität, Willensstärke, Intellektualismus, Ehrgeiz;
- Handlungsunfähigkeit, Totstellreflex, Angst vor Fremdaggression.
Es liegen hierzu jedoch keine weiteren Studien vor. Untersuchungen mit anderen projektiven Verfahren, z.B. dem Rosenzweig - Picture - Frustration - Test ergaben keine eindeutig replizierbaren Befunde (vgl. Wojnilower & Gross, 1981). Eine Untersuchung des Zusammenhangs von Zähneknirschen und Trauminhalt, welche weitere Aufschlüsse zur bruxistischen Psychodynamik geben könnte, fehlt auf einer symbolischen Ebene. Bernegger & Welke (1997) fanden, dass die physiologischen Indikatoren dse Bruxismus nicht in den Traum integriert wurden.
Hier anknüpfend erforscht die differentielle Psychologie spezifische Persönlichkeitsmerkmale von Bruxisten mittels Fragebogen, deren bekannteste der MMPI, der FPI und der EPI sein dürften. Häufig zeigten sich auffällige Werte in den Skalen der Depression, der Ängstlichkeit, der Angepasstheit und im Dominanzstreben. Diese Befunde bleiben jedoch über verschiedene Studien hinweg kontrovers (vgl. Rugh & Solberg, 1976; Willi, 1996), es konnte weder ein spezifisches Persönlichkeitsmerkmal, noch ein eindeutiges Persönlichkeitsmuster gefunden werden. Der Vergleich von Resultaten, die mit verschiedenen Fragebogen generiert wurden, ist zudem eine schwierige Angelegenheit. Weder die Persönlichkeitskonstrukte, noch die gebrauchte Terminologie werden einheitlich definiert und gebraucht. Ebenso konnten andere Konstrukte, wie das Typ-A-Verhalten, nicht durchgängig nachgewiesen werden. Das Mass an belastenden Lebensereignissen, bzw. die tägliche Summe an Stressbelastungen (Daily Hassles Scale), ist im Vergleich mit Kontrollgruppen bloss tendenziell erhöht. Unterschiede bezüglich der gewohnten Bewältigungsstrategien konnten nicht festgestellt werden (vgl. Birner et al., 1994; Willi, 1996).
Betrachten wir noch die Früchte eines anderen Forschungszweiges der Psychologie, der sich stark auf Darwin beruft. Laut der Verhaltensforschung dienten die Zähne ursprünglich als Waffen und Werkzeuge; das Schärfen der Zähne, durch Mahlbewegungen, war von lebenswichtiger Bedeutung. Obwohl diese Funktion der Zähne im Laufe der Phylogenese verloren ging, sind noch Muskeln vorhanden, die aufgrund ihrer Faserverläufe eher für das Schleifen der Zähne, als für Kaubewegungen geeignet sind (vgl. Birner et. al., 1994).
An diesem Punkt knüpft die Emotionspsychologie an, die postuliert, dass Kaumuskelkontraktionen Bestandteile emotionaler Verhaltensmuster sind. Ihre expressive Komponente (beispielsweise Zähnefletschen als Drohgebärde) haben sie in unserem kulturellen Umfeld zwar weitgehend eingebüsst. Versteht man sie jedoch im Sinne der Emotionstheorie von James & Lange, so können sie, über interozeptive Prozesse, wesentlich zum Erleben von Emotionen beitragen. Zähneknirschen kann so als Spannungsreaktion verstanden werden, die dem Bruxisten möglicherweise ein Gefühl von Stärke, Mut und Selbstvertrauen vermittelt.
Auch die Lerntheoretiker konstatierten, dass emotionales Ausdrucksverhalten meist sozialer Kontrolle unterliegt. Situativ hervorgerufene physiologische Reaktionsmuster werden, aufgrund operanter Konditionierung, in sozialen Situationen selten offen ausgedrückt. Ein erhöhter Muskeltonus kann sich aber, durch externe und interne Kontingenzen, beispielsweise als Angst reduzierend und Sicherheit spendend erwiesen haben. Die dabei in Frage kommenden Lernmechanismen sind einerseits die negative Verstärkung (z.B. wenn der Tonus zu einer vermeintlichen Verminderung der unangenehmen Empfindungen beiträgt), wie auch die positive Verstärkung (z.B. wenn der Tonus in Leistungssituationen eine optimale Funktionsgrundlage bildet). Andererseits kann auch das Beobachtungslernen nach Bandura als plausible Erklärung herangezogen werden (vgl. Reinecker, 1986, S. 90 ff.). Wer erinnert sich nicht an John Waynes Anschwellen der Kiefer, wenn dieser sich in emotional geladenen Situationen befindet.
An unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten mangelt es nicht, ihre empirische Evidenz ist jedoch entweder nicht vorhanden, oder aber eher ernüchternd. Trotzdem scheinen mir die verschiedenen Theorien mit ihrem je eigenen Vokabular um einige gemeinsame Punkte zu kreisen. Die bruxistische Aktivität stellt in jeder Theorie einen Versuch dar, einen - internen oder externen - Konflikt zu lösen. Das gemeinsame Merkmal dieser Konflikte ist, dass sie subjektiv eine ernsthafte Bedrohung für den Betroffenen darstellen. Die Problemlösestrategie Bruxismus ist jedoch nicht funktional, sie bewirkt keine realen Veränderungen der bedrohenden Situation. Trotzdem stellt sie für die Betroffenen den einfachsten, unbewussten Weg dar, das Spannungsgefälle der konfligierenden Parteien zu mindern, abzuführen. Diese Annahmen sind jedoch so rudimentär, dass sie sich auf die meisten psychischen Störungen anwenden lassen. Das Auftreten von Zähneknirschen kann zwar von psychologischer Perspektive aus plausibel gemacht werden; spezifische, generalisierbare Präzisierungen oder weiterführende Erklärungen überschreiten jedoch vorerst noch die Grenzen des Möglichen.
Indiziert wäre hiernach jegliche Art von Psychotherapie, die auf eine Erweiterung der Coping-Strategien, d.h. eine bessere, bewusstere Konfliktbewältigung, abzielen. Die empirische Evidenz zu den psychotherapeutischen Behandlungen bei Bruxismus ist kontrovers (Wojnilower & Gross, 1981).
d) Zusammenfassung
Es wurden verschiedenste theoretische Ansätze zur Aetiologie des Bruxismus diskutiert. Wie sind diese einzelnen Teiltheorien nun aber im konkreten Fall zu gewichten? Jäger, Borner & Graber (1987) untersuchten 197 Myoarthropathie-Patienten der Universitätsklinik Basel auf einen primären ätiologischen Faktor hin. Nach ihrer multidisziplinären Diagnostik bildeten sie folgende vier Gruppen[10]:
- 54.8%: Okklusaler Primärfaktor in Verbindung mit Stress.
- 34.0%: Psychischer Primärfaktor in Verbindung mit chronischer Stressoreinwirkung.
- 7.1%: Echte psychische Erkrankung, z.B. Depression.
- 4.1%: Primäre Gelenkerkrankung, z.B. Polyarthrose, die periphere Reflexe auslöst.
Diese Zahlen sind insofern interessant, als sie zeigen, dass in der Mehrheit der Fälle tatsächlich eine multifaktorielle Ätiologie vorhanden ist. Für die Praxis lassen sich folgende Konsequenzen aus dieser Multikausalität ableiten:
1. Die Diagnose soll so breit wie möglich sein, um alle beteiligten Faktoren zu erfassen.
2. Die Therapie soll an möglichst vielen verschiedenen Faktoren ansetzen, um so eine Heilung wahrscheinlicher und dauerhafter zu machen.
Wenn jedoch der Begriff der Mehrdimensionalität über eine blosse Addition von Eigenschaften hinausgehen soll, müssen auch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen berücksichtigt werden. Leider geben die erwähnten Zahlen zu solchen Zusammenhängen und deren Konzeptualisierung keinen Aufschluss. Anhand von Abbildung 2 sollen die oben angesprochenen, möglichen Wechselwirkungen der ätiologischen Komponenten veranschaulicht werden.
Der Zweck dieser (etwas komplizierten) Abbildung ist die Darstellung und Betonung der gegenseitigen Bedingtheit und Abhängigkeit, der eigentlichen Einheit der referierten ätiologischen Faktoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Dieätiologischen Faktoren des Bruxismus und ihre Wechselwirkungen.
Wie verhält es sich nun konkret mit den vielfältigen, komplexen Wechselwirkungen? Die Denkansätze der bisher besprochenen Teiltheorien sind zu eng, um diese erfassen und konzeptualisieren zu können. Der geäusserte Wunsch nach Integration dieser sektorenhaften Betrachtungsweise zwingt uns, nach einem geräumigeren Theoriegebäude Ausschau zu halten. Was hat uns die Psychosomatik diesbezüglich zu bieten?
“Die Trennung des Körpers von der Welt ist wie die der Seele vom Körper. ”
(Novalis, Aphorismen)
“Der Mensch ist der Imagination unterworfen, und die Imagination - wiewohl auch unsichtig, ungreiflich - , so wirkt sie doch ‘corporaliter‘ auf eine Substanz und durch die Substanz, als sei sie die Substanz. ”
(Paracelsus)
“Es lehrt mich ferner die Natur durch eine Empfindung des Schmerzes, Hungers, Durstens usw., dass ich nicht nur in der Weise meinem Körper gegenwärtig bin, wie der Schiffer seinem Fahrzeug, sondern dass ich aufs engste mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, so dass ich mit ihm eine gewisse Einheit bilde. ”
(Descartes, 6. Meditation)
2. Psychosomatik
2.1. Konzeptuelle Schwierigkeiten
Die Theoretiker der Psychosomatik stossen bei der Modellbildung auf viele Schwierigkeiten, von denen das von Descartes formulierte Leib-Seele Problem wohl von höchster Prominenz ist. Descartes (1596-1650) ging von einer ontologischen Verschiedenheit der mentalen und physischen Phänomenbereiche aus. Trotzdem versuchte Descartes in seiner Wechselwirkungshypothese eine Erklärung für eine intuitiv plausible, gegenseitige Einflussnahme zu formulieren, die jedoch schon von seinen Zeitgenossen der Aufklärung heftig kritisiert wurde (Hübli & Lübcke, 1995, S.130).
Ein Dualist kann in seiner Theoriebildung vorerst von der offensichtlichen Verschiedenheit mentaler und physischer Phänomene ausgehen. Bei der Konzeption einer gegenseitigen Einflussnahme muss er sich jedoch erheblichen Schwierigkeiten stellen. Denn dabei wird die kausale Geschlossenheit der physikalischen Welt, ein grundlegendes Prinzip der empirischen Forschung, unweigerlich in Frage gestellt. Die Probleme, vor die uns der Dualismus stellt, können nicht gelöst werden; sie müssen in einer ontologischen Neutralität aufgelöst werden (Bieri, 1993, S.10).
So wird heute in der Psychosomatik grundsätzlich das metatheoretische Modell des Monismus favorisiert. Hier sehen wir uns mit ähnlich schwerwiegenden Problemen konfrontiert, wollen wir nicht einem Reduktionismus verfallen und damit entweder die Medizin oder die Psychotherapie zur blossen Symptombekämpfung degradieren. Beispielsweise dürfen bei monistischen Konzepten die Kategorien von Ursache und Wirkung nicht in Anspruch genommen werden, denn diese sind bloss auf gegeneinander abgeschlossene Seinsbereiche anwendbar. “Das allgemeine Modell der psychosomatischen Theorie sieht so aus, dass Leib und Seele eine untrennbare und in Ursache und Wirkung nicht zerlegbare Einheit bilden (...)” (Schaefer, 1990, S.45).
Der philosophische Widerspruch zwischen empirisch-methodischer Verschiedenheit und logischer Aequivalenz, der das Leib-Seele Problem konstituiert, ist damit noch keineswegs gelöst. Immerhin haben wir damit vorerst eine pragmatische Hypothese gewonnen, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht.
Wie soll nun der Komplexität des gesamten menschlichen Organismus konkret Rechnung getragen werden? Das Spannungsfeld der Metatheorie Psychosomatik erstreckt sich über weite Gebiete der Wissenschaft. So praktiziert die Psychosomatik noch vorwiegend auf dem Gebiet der naturwissenschaftlichen Medizin, forscht mit den Methoden der empirischen Sozialforschung und fügt das Ganze unter einem geisteswissenschaftlichen Theoriegebäude zusammen, das seine Wurzeln in der Psychoanalyse hat (vgl. Rudolf, 1990). Die Interaktion dieser verschiedenen Theorieebenen lässt sich jedoch (noch) nicht zuverlässig und detailliert modellieren, sie ist lediglich sehr allgemein beschreibbar.
Dennoch ist aus einer Synthese der verschiedenen einzelnen, pragmatisch ausgerichteten Teilperspektiven ein weiterführender Erkenntnisgewinn zu erwarten[11]. Deshalb wollen wir uns im folgenden mit einem aktuellen, breit rezipierten psychosomatischen Modell, dem Situationskreiskonzept von Thure von Uexküll & Wolfgang Wesiack (1988), näher und stark komprimiert befassen.
2.2. Der Situationskreis
a) Prämissen
Das Krankheitsbild der klassischen Medizin basiert auf dem Ursache-Wirkungsmodell der Mechanik Newtons, wonach äquivalente Ursachen äquivalente Wirkungen erzeugen; analog dazu ist auch die Beziehung Mensch-Umwelt konzipiert. Diese Vorstellung wird, wegen ihrer lückenlosen Determination, zuweilen auch als Maschinenmodell bezeichnet. Der grosse Vorteil dieses Paradigmas ist eine enorme Klarheit der Deutungs- und Handlungsmuster.
Das physikalische Modell der mechanischen Kausalität ist jedoch mittlerweile veraltet[12], und greift auch beim menschlichen Organismus zu kurz. Der duale Ursache-Wirkungs- Determinismus wird daher im Situationskreiskonzept auf eine dreigliedrige, probabilistische Beziehung erweitert. Nach dem neuen Paradigma, das der Semiotik entliehen ist, sind Einwirkungen auf den Organismus lediglich als Vehikel für Nachrichten aufzufassen. Die Wirkung, bzw. der wahrgenommene Informationsgehalt[13] einer Nachricht liegt aber niemals per se vor, er unterliegt vielmehr immer einer ‘Bedeutung‘. Subjekt, Objekt und Erlebnis werden damit zu einer nicht mehr trennbaren, da sich gegenseitig bedingenden Einheit. Diese umfasst:
1. ein Zeichen (Signifikant), das zwei Aspekte beinhaltet: den energetischen Zeichenträger (z.B. Schallwellen und ihr neuronales Korrelat), sowie eine informative Qualität, die weder auf Energie noch auf Materie reduziert werden kann;
2. das bezeichnete, materielle Objekt (Signifikat); und
3. den Interpreten, der die Zeichen selektiv wahrnimmt und ihnen eine subjektive, d.h. von seinem Status abhängige, Bedeutung verleiht.
V. Uexküll & Wesiack (1988) postulieren nun, dass alle Vorgänge des Organismus, die sich innerhalb desselben Subsystems (dem sozialen, psychischen, biologischen oder dem physikalisch-chemischen) abspielen, nach diesem Konzept, das in der Semiotik Zeichenprozess, bzw. Semiose genannt wird, funktionieren. Diese Kommunikationssysteme haben ihre je eigenen Kodes und an den Systemgrenzen finden jeweils ‘Bedeutungssprünge‘, bzw. Kodewechsel statt. Die Interaktionen zwischen den Subsystemen sind einerseits angeboren, andererseits auch individuell erlernt. Solche Bedeutungskoppelungen stellen sich v.Uexküll & Wesiack nach Pawlows Modell der unbedingten, bzw. der bedingten Reaktionen vor (siehe dazu Reinecker, 1986, S.44). Die Kodes der verschiedenen Systeme befinden sich also in einer, durch Information modellierbaren, wechselseitigen Beziehung.
Um die allgemeine Funktions- und Organisationsweise der postulierten Subsysteme zu erfassen, berufen sich v.Uexküll & Wesiack auf die Systemtheorie, deren Gegenstand die Analyse zirkulärer Relationen ist[14]. Sie postulieren einen offenen, sich selbst organisierenden Regelkreismechanismus, der Integrationsebenen verschiedener Komplexität umfasst, verknüpft und so zwischen ihnen eine gemeinsame Realität schafft. Das Phänomen der Bedeutungssprünge wird in diesem theoretischen Rahmen mit dem Auftreten von Emergenzen erklärt. Der kybernetische Begriff der Emergenz bezeichnet nämlich das Entstehen qualitativ völlig neuartiger Eigenschaften, wenn zwei zuvor unabhängig funktionierende Systeme zusammengeschlossen werden[15]. Diese emergenten Eigenschaften zwingen uns, wollen wir Kategorienfehler vermeiden, jedesmal eine neue wissenschaftliche Disziplin zu Rate zu ziehen, deren Terminologie auf die neu auftretenden Phänomene zugeschnitten ist.
In einer solchen hierarchischen Organisationsform sind sowohl relativ eindimensionale, somato-psychische ‘Aufwärtseffekte‘, als auch um einiges komplexere, psycho-somatische ‘Abwärtseffekte‘ denkbar. Der Begriff der Hierarchie darf dabei nicht missverstanden und auf eine ‘reduktionistische Diktatur‘ eingeengt werden. In selbstorganisierenden Systemen kann es zwischen strukturierenden und strukturierten Teilen gar keine eigentliche Trennung geben.
Als Konsequenz der semiotischen Fundierung resultiert für die “Soziopsychosomatik” (Schaefer, 1990) eine starke Betonung des deutenden Subjekts und damit seiner individuellen (Lern-) Geschichte. “Nicht der Reiz, sondern der Organismus ist für sein Verhalten verantwortlich. ” (v.Foerster, zit. nach v.Uexküll, 1996, S.26) Mit dieser historischen, sozialen Dimensionen erhält das Modell einen wichtigen dynamischen Aspekt.
Die systemtheoretische Metatheorie hat zur Folge, dass zwischen Leib und Seele eigentlich nicht mehr unterschieden werden kann. Vielmehr kann innerhalb desselben Systems zwischen unterschiedlich komplexen Integrationsebenen differenziert werden, die ihre spezifischen Substrukturen und (endo-) semiotischen Kodes haben.
b) das Modell
V.Uexküll & Wesiack (1988) fokussieren nun den vielschichtigen semiotischen Aspekt im speziellen. Die erörterten grundlegenden Annahmen kulminieren in einem dialogischen Beziehungsmodell, das v.Uexküll & Wesiack den ‘Situationskreis‘ nennen (Abbildung 3, S.26). Der rückgekoppelte Regelkreis beansprucht prinzipielle Gültigkeit für jede Systemebene: Beziehung erweist sich als der Begriff “für den fundamental wichtigen Sachverhalt, dass Leben sich zwar auf jeder Integrationsebene in verschiedenartiger Erscheinung, im Prinzip aber in der gleichen Weise darstellt. ” (v. Uexküll, 1996, S.44.)[16]
Sehen wir als erstes die rezeptorische Sphäre der Abbildung 3 an, so finden wir die oben ausgeführte Prämisse der Semiose (Zeichenprozess) wieder: einem selektiv wahrgenommenen Sachverhalt (Problemsituation, soziale Realität, Umgebung) wird mittels einer Nachricht (Merken) von einem Organismus eine situationsspezifische, subjektive Bedeutung (individuelles Deutungsmuster) zugewiesen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Der Situationskreis. (Nach v.Uexküll & Wesiack, 1988, S.274; leicht abgeändert.)
Das Situationskreismodell fokussiert insbesondere die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt, bzw. zwischen interagierenden Systemen. Die Zyklizität der dialogischen Beziehungssituation bedingt eine Optimierung der Realitätskonstruktion, die beim Menschen auch hypothetisch erfolgen kann. Die intentionale Handlung ist dabei mit der kognitiven Aktivität untrennbar verknüpft. Dieses Modell beansprucht auch intraindividuelle Gültigkeit, d.h. auf der Ebene von Subsystemen.
Ziehen wir nun die effektorische Sphäre mit in Betracht, sehen wir, dass die kognitive Informationsübertragung auch als Befehl, auf die Umgebung[17] (auf die ‘Wirk-lichkeit‘) mit einem bestimmten Verhalten einzuwirken, aufgefasst werden kann. Der semantische Gehalt des ablaufenden Prozesses hat sowohl eine kognitive, wie auch eine intentionale, motivationale Dimension, die untrennbar miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen.
Der Organismus befindet sich also in einem ständigen Informationsaustausch mit der Umwelt. Dieser Feedback-Mechanismus arbeitet auf eine Optimierung der Funktionsfähigkeit, bzw. der Interaktion der verschiedenen beteiligten (Sub-) Systeme hin. Dabei existiert der einzelne menschliche Organismus als individuelles System nicht per se, er ist auf komplementäre Beziehungen angewiesen, die ihn konstituieren, definieren und ergänzen. V.Uexküll & Wesiack (1988) sprechen daher von einem ‘Beziehungsnetz‘, in das die einzelnen Organismen eingebunden sind.
Diese Betonung der Interdependenz aller interagierenden Systeme hat für das Krankheitsverständnis weitreichende Konsequenzen[18]. Störungen betreffen immer das gesamte Beziehungsnetz, auf allen Ebenen der Subsysteme. Sie zeigen sich sowohl im Organismus selbst, in seiner wahrgenommenen Umgebung, wie auch in den stattfindenden Interaktionen. Diese drei sich gegenseitig bedingenden, prinzipiell gleichwertigen Komponenten bilden dann auch die Punkte, an denen mit einer Intervention angesetzt werden kann. Da das System jedoch nur als ganzes adäquat erfasst werden kann, soll der Fokus so breit wie möglich sein.
c) praktische Implikationen
Was impliziert diese Theorie nun für die therapeutische Praxis, bzw. für die konkrete Interaktion von Ärzten und ‘psychosomatischen‘ Patienten[19] ? “Therapie heisst Antworten geben, die dem Patienten zeigen, dass die Zeichen, die er auf einer körperlichen, psychischen oder sozialen Ebene sendet, verstanden werden. ” (v.Uexküll, 1996, S.47)
Der diagnostisch-therapeutische Prozess setzt dort ein (*, Abbildung 4), wo der Patient auf seine Krankheit aufmerksam wird und mit einer subjektiven Krankheitstheorie den Arzt aufsucht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Der diagnostisch-therapeutische Zirkel (nach v.Uexküll & Wesiack, 1988, S.563).
Die Krankheit tritt in der Patient-Arzt-Interaktion explizit in verschiedene Bedeutungsgefüge ein, die es, in einem Prozess, untereinander abzustimmen gilt. Die Dimension der Bedeutungserteilung wird als Diagnose bezeichnet, die Dimension der Bedeutungsverwertung als Therapie.
Anhand einer vorläufigen Entscheidung zugunsten eines Interpretationsmodells versucht der Arzt sich in der vorgefundenen Situation zu orientieren. Eine solche Diagnose beruht auf den Krankheitszeichen, den Symptomen, die in ihrer Bedeutung für den Patienten einerseits, andererseits aber auch im Kontext des spezifischen Fachwissens erfasst werden sollen. Der Arzt ist in diesem Sinne ein Meta-Interpret, d.h. er muss die Interpretationsmuster und -kodes des Patienten im Kontext seines spezifischen Fachwissens interpretieren. Damit wird ‘die Krankheit‘, die vormals mit dem Patienten verknüpft war, zu einem dritten, expliziten Objekt im Beziehungsraum.
Wiederum ist mit diesem kognitiven Prozess auch eine Handlungsanweisung verknüpft, die als Therapie bezeichnet wird. Hier geht es vor allem um eine Modifizierung der gestörten ‘Beziehungsfäden‘ auf verschiedensten Systemebenen; es gilt über Rückkoppelungsschleifen die Realitäts-, bzw. Bedeutungsfindung beider Seiten in einem Prozess zu optimieren. “Der Arzt muss Problemlösungen für die Patienten entwickeln, und die Patienten müssen den Arzt durch Rückmeldung über die Effektivität seiner Lösungsvorschläge informieren. ” (v.Uexküll, 1996, S.19) Die subjektiven Ansichten des Patienten fungieren somit als ein wesentliches Regulativ der Expertenmeinung.
Auch der diagnostisch-therapeutische Zirkel beansprucht für alle Subsysteme Gültigkeit. Was sind demnach die Gemeinsamkeiten von operativen, medikamentösen, Entspannungs-, Psycho- und Familientherapien?
Alle denkbaren Therapiemethoden erreichen Rezeptoren bestimmter Systeme, auf die sie eine Veränderung ausüben. Diesen Veränderungen erteilt der Patient im besten Fall die Bedeutung einer nützlichen Information, die ihm hilft Umweltsituationen adäquat wahrzunehmen und zu integrieren. Der Zuwachs an Information soll der adaptiven Ordnung der Umgebungsinformationen dienen. Diesen Informationen sind System-, bzw. Kodegrenzen gesetzt, die zwar prinzipiell überwindbar sind; ein multimodales therapeutisches Vorgehen ist unter diesem Gesichtspunkt dennoch empfehlenswert. “Damit wird Information zum gemeinsamen Nenner aller therapeutischen Bemühungen.” (v.Uexküll, 1996, S.349).
Eine explizite, informative Kommunikation zwischen Arzt und Patient, welche die Hintergründe und Vorgehensweisen einer Therapie erklärt, versteh- und akzeptierbar macht, wird damit zum wesentlichen Moment jeglicher Therapieformen[20]. Erst solche Erklärungen werden dem Patienten in seiner Rolle als aktiver Bedeutungserteiler gerecht und ermöglichen ihm das ‘Mittel‘ zur Genesung (z.B. Operation, Medikament) als nutzbringend wahrzunehmen und somit die dem Mittel innewohnende Information optimal umzusetzen.
c) empirische Evidenz
“Das Subjekt ist der Gestalter seiner Krankheit, ” (Schaefer, 1990, S.88) wie auch seiner Gesundheit. Der Fokus auf eine persönliche Patient-Arzt-Beziehung stellt in der Zeit von Spezialisten, Diagnosetechnologien, usw. eine echte Herausforderung für die Medizin dar. Ist die starke Betonung des deutenden Subjekts und der ausführenden Information, die wohl konsequenzenreichsten Postulate des Situationskreiskonzepts, bloss theoretische Spekulation oder lassen sich diesbezügliche empirische Belege finden? Die Forschung um subjektive, bzw. Laientheorien, die in den letzten Jahren von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen intensiv betrieben wurde, vermag uns darauf am ehesten Antworten zu geben.
Man ist sich einig, dass subjektive Theorien, als Deutungsmuster, vor allem regulative Funktionen haben, ihre klinische Relevanz liegt in ihrer potentiellen Veränderbarkeit. Die Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien lässt sich, analog zu den Funktionen wissenschaftlicher Theorien, wie folgt beschreiben:
1. Subjektive Theorien bestimmen die Situationswahrnehmung, die Realitäts- konstruktion. (Situationskreis: Merken)
2. Sie erklären aktuelle Ereignisse und machen Vorhersagen über künftige Ereignisse. (Situationskreis: Bedeutungserteilung)
3. Sie eignen sich zur Generierung von Handlungsableitungen. (Situationskreis: Wirken) Zu Punkt 1: Um die Wichtigkeit subjektiver Wahrnehmungen im bezug auf die Konstitution von Realität (hier von Gesundheit oder Krankheit) zu veranschaulichen, wenden wir uns kurz dem gut dokumentierten Phänomen des Placebo-Effektes zu. Je nach Krankheitsbild sind rund 30-70% aller Erfolge von chirurgischen, pharmako-, physio- und psychotherapeutischen Massnahmen auf Placebo-Effekte zurückzuführen (vgl. Fricke, 1983). Die Wirkung von Placebos bezieht sich also nicht bloss auf psychologische Effekte, sie schliesst physiologische Mechanismen, bis hin zu organischen Gewebeveränderungen mit ein (Frank, 1981, S.200) [21].
Wie sind diese Effekte zu verstehen? Es konnte gezeigt werden, dass der Preis, der Name, die Beschaffenheit und die Neuheit einer Kur, die Verabreichungsform, die Anwesenheit und eingeschätzte Kompetenz von Krankenhauspersonal, usw. die Wirksamkeit einer Kur zu steigern vermögen. Die wesentlichste Determinante ist dabei die Patient-Arzt-Beziehung (Straus & Cavanaugh, 1996, S.319). Es steht fest, dass vielfältige Aspekte der unmittelbaren Situation, bzw. die mehrere Systemebenen umfassende ‘Aura curae‘ (Langer, 1989, S.339) auf die Reaktionsbereitschaft für Placebos einen grösseren Einfluss haben, als dauerhafte Persönlichkeitsmerkmale (Frank, 1981, S.211). Obwohl diese situativen Effekte nicht zuverlässig vorhersagbar sind, wird die Beschaffenheit der konkreten Therapiesituation zu einer wichtigen Variablen.
Die Sozialpsychologen sprechen in diesem Zusammenhang von der Macht der situationalen Hinweisreize. Wenn die eigene kognitive Beurteilungskompetenz in einer bestimmten Situation nicht hinreichend ist (beispielsweise verfügt der Arzt über ein uns nicht zugängliches Fachwissen), verlassen wir uns auf kulturell tradierte Heuristiken (Zimbardo & Leippe, 1991, S.166). Diese Laientheorien beruhen jedoch nicht auf der zentral vermittelten Information (z.B. dem chemischen Wirkstoff des verordneten Medikamentes), sie stützen sich hauptsächlich auf marginale, situationale Faktoren, also die ‘Aura curae‘. Heilungseffekte beruhen stark auf der selektiven Wahrnehmung von positiv konnotierten, sozial definierten bzw. gelernten Symbolen des Heilens.
Der Aufmerksamkeitsfokus wird dabei im wesentlichen von Erwartungen gesteuert. Diese Bewirken eine aktive Suche nach einstellungsrelevanten und -konsonanten Informationen. Negative Erwartungen gegenüber einer Behandlung führen dementsprechend zu sogenannten Nocebo-Effekten[22] (vgl. Straus & Cavanaugh, 1996).
Damit sind wir bei der zweiten Funktion von subjektiven Theorien angelangt, der sinnstiftenden Verknüpfung der wahrgenommenen Ereignisse. Diese subjektive Strukturierung hat primär Orientierungsfunktion. Sie dient der Erklärung der aktuellen Situation, sowie der Abschätzung von zukünftigen Ereignissen, was sich dann in Form von Erwartungen äussert.
Die meisten Studien zur Erwartungshaltung der Patienten (als trait) konnten eine direkte, lineare Beziehung zum subjektiv eingeschätzten Behandlungserfolg, der jedoch stark von der sozialen Erwünschtheit abhängt, nachweisen. Zu objektiven Erfolgskriterien liegen kontroverse Befunde vor, ebenso zeigt die experimentelle Beeinflussung der Erwartungshaltung (als state) der Patienten keine eindeutigen Resultate (vgl. Klingler, 1989). Viele dieser Studien weisen jedoch gravierende methodische Mängel auf (vgl. Wilkins, 1973) und messen unter verschiedensten Bedingungen die unterschiedlichsten Variablen. Trotzdem kommt Klingler (1989, S.323) nach einer Durchsicht einschlägiger Studien zum Schluss, dass “Erwartungen (...) massive Einflüsse auf die Effekte therapeutischer Interventionen haben und (...) daher in der Therapieforschung berücksichtigt werden (müssen). ”
Theoretisch ist das Einstellungskonstrukt in vielen der sozialpsychologischen Erwartungs-Wert-Modellen des Verhaltens verankert. Darin tragen Einstellungen vor allem motivationale Bedeutung. Als Konsequenz von Erwartungen wird eine selektive Suche nach konsonanter Information angegeben, sowie eine ausgeprägte Compliance (vgl. Zimbardo & Leippe, 1991, S.352 ff.).
Das führt uns zur Generierung von Handlungsableitungen, der dritten Funktion subjektiver Theorien. Professionelle Ratschläge werden oftmals gar nicht, oder lediglich teilweise befolgt. Je nach Defintion und Messmethode schwanken die Zahlen zur Non- Compliance zwischen 4 und 92%, um einen Median von 42% (Lakin Phillips, 1988, S.60). Welche Faktoren können die Compliance verbessern?
Nach einer Literatursichtung von über 100 Studien gibt Lakin Phillips (1988, S.83) folgende hauptsächlichen[23] unabhängigen Variablen an:
1. Merkmale der Patient-Arzt-Interaktion,
2. mit Expertenmeinungen konkordante subjektive Krankheitstheorien, und
3. bisherige Compliance, wie z.B. das Einhalten der Arzttermine.
In Uebereinstimmung mit diesen Ergebnissen (und mit den Postulaten des Situationskreis) gibt Cramer (1991, S.6) folgende Strategien zur Verbesserung der Compliance an:
1. Kommunikation zwischen Arzt und Patient, z.B. Diskussionen über die Diagnose, die Notwendigkeit einer Behandlung, etc. anregen. Als zentral erachten sie dabei die Zeit und die Aufmerksamkeit, die dem Patienten gegenüber erbracht werden.
2. Allgemeine Informationen bezüglich dem Krankheitsbild, der Art der Therapie, usw. geben. Dies ermöglicht dem Patienten persönliche Einsichten sowie eigenverantwortliche Einstellungen auszubilden.
3. Das Ausarbeiten einer gegenseitig akzeptierbaren Form und Frequenz der Behandlung. Die an den Patienten gestellten Ansprüche sollten mühelos in seine täglichen Gewohnheiten integrierbar sein.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Interdependenz von Subjekt, Wahrnehmung und Objekt (bzw. von Deutungsmustern, Wahrnehmungen und Handlungen), wie auch die Wichtigkeit einer informativen Kommunikation, die im Situationskreis und im diagnostisch-therapeutischen Zirkel postuliert werden, anhand der referierten Befunde bestätigt werden können. In der Therapie sowie in der Krankheitsgenese zeigen sich tatsächlich probabilistische, semiotische Wirkungen, die sich gleichzeitig auf verschiedensten Systemebenen entfalten können. “Jeder Kranke bietet Erscheinungen, die nie da waren und nie wiederkommen werden in Bedingtheit und Gestalt. ” (v.Krehl, zit. nach Schaefer, 1990, S.71)
2.3. Diskussion
Auf der Suche nach einer integrativen Metatheorie, sind wir auf die traditionsreiche Disziplin der Psychosomatik gestossen. Als sogenannte ‘Grenzwissenschaft‘ war und ist die Psychosomatik für Anregungen und Strömungen aus zahlreichen anderen Wissenschaften offen, was zu einer Vielzahl unterschiedlichster psychosomatischer Modellvorstellungen führte. Ideengeschichtlich lässt sich die Psychosomatik als Gegenreformation verstehen: In der Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich, durch die Entdeckungen der Bakteriologie und der Pathophysiologie, das traditions- und erfolgreiche Paradigma der Mechanik in der Medizin breit. Die Seele, der vormals durchgängig eine Funktion zugewiesen war (z.B. in Galens Temperamentslehre), wurde zeitweilig vollständig aus dem medizinischen Gegenstandsbereich verbannt (vgl. v.Uexküll, 1991).
Die Geschichte ihrer Wiederentdeckung lässt sich mit Wesiack (1994, S.25) grob in drei Phasen einteilen. Die Grundlage für eine neue psychosomatische Theorie legte Freud mit seinem somato-psychischen Triebbegriff und seinem psycho-somatischen Konversionsmodell. In letzter Konsequenz verfällt dieses Modell jedoch einem idealistischen Reduktionismus. Deshalb orientierte sich die nächste Generation, die in Alexander und Mitscherlich die wohl bekanntesten Exponenten hatten, wieder an dualistischen Vorstellungen von Seele und Leib, als getrennt diagnostizier- und therapierbaren Entitäten. Es wurde nach eindeutigen Ursache - Wirkungs - Zusammenhängen gesucht. Die meisten heute verfügbaren Erkenntnisse der Psychosomatik stammen aus Arbeiten dieser Periode der Theoriebildung. Momentan befinden wir uns in einer dritten Phase, in der versucht wird, den empirisch - methodisch bedingten Dualismus zu überwinden. Einerseits geschieht dies mit neuen philosophischen Konzepten, wie Handlung, Sprache oder Leib (vgl. Bieri, 1993; Christian, 1989). Andererseits kommen auch bei Naturwissenschaftlern integrative Konzepte auf, von denen wir im Situationskreis ein prominentes Beispiel angeschaut haben. Da das Problem der Integration und Interaktion der Subsysteme praktisch noch weitgehend ungelöst ist, spricht man hier zuweilen auch von pluralistischen Modellen. Aber neues Denken bedeutet ja nicht schon fertige Konzepte zu haben, vielmehr ist es ein Prozess, der mit neuartigen Fragen beginnt.
Die Prämissen, die dem Situationskreis zugrunde liegen, finden wir auch in anderen bedeutenden Theoriebildungen wieder. Wiener entwickelte in den 40‘er Jahren den Regelkreis und gilt damit als Begründer der Kybernetik. Doch schon in den 30‘er Jahren wurden Kreismodelle mit Rückkoppelungen konstruiert, so z.B. von Piaget mit seiner sensomotorischen Zirkulärreaktion, oder von Weizsäcker mit seinem psychosomatischen Gestaltkreis. Die Überschreitung der Grenzen des linearen Ursache-Wirkungs-Modells hin zu komplex interagierenden Systemen ist also keine Neuigkeit, auch nicht in der Psychosomatik.
Ebenso ist die Semiotik für die medizinische Disziplin nichts Neues, sie hat im Gegenteil jahrhundertelang eine führende Rolle gespielt. Freilich stand dabei der semantische (Bedeutung und Interpretation von Zeichen) und der pragmatische (in Zeichen implizierte Handlungsanweisungen) Aspekt im Vordergrund. Die Syntaktik (das Zeichen an sich und die kombinatorischen Regeln) blieb weitgehend unbearbeitet, und auch v.Uexküll & Wesiack können nicht mehr als auf diesbezüglich offene Arbeitsfelder hinweisen. Ein Begriffssystem, das mentale mit neurophysiologischen Termini semantisch und logisch verknüpfen kann, steht noch in weiter Ferne.
Das Situationskreiskonzept lag somit gewissermassen in der Luft. Trotzdem setzt das Modell neuartige Akzente und erscheint mir, wegen seiner breiten Rezeption, als besonders wertvoll. V.Uexküll & Wesiack (1988) haben eine Theorie der Psychosomatik entworfen, die mit der heutigen klassischen Medizin über weite Strecken unvereinbar ist, bzw. bei zentralen Begriffen einschneidende Bedeutungsveränderungen vornimmt und auf Mängel in der medizinischen Ausbildung (z.B. Kommunikationsschulung) hinweist. V.Uexküll & Wesiack legen eine umfassende, integrierende Standortbestimmung der heutigen Psychosomatik vor, sozusagen als Ausgangsbasis für ein grosses, noch zu leistendes Stück Arbeit. Dabei legen sie eine solide theoretische Grundlage mit einem Modell, das 1. die sozialen Beziehung von Organismus und Umwelt, sowie 2. die innerorganismischen Beziehungen von chemisch-physikalischen, biologischen und psychischen Vorgängen untereinander konzipiert. Dabei bleibt das Modell skizzenhaft: es wird einerseits keine eigentliche Verbesserung der wissenschaftlichen Präzision erreicht, andererseits entwickeln die Autoren auch keine fachbereichspezifische Forschungsmethodik. Ein neues Paradigma, als Alternative zur naturwissenschaftlichen Medizin, liegt in diesem Sinn nicht vor. Vielmehr erweitern die Autoren den wissenschaftlichen Horizont der Medizin und bringen wertvolle Konzepte zahlreicher anderer Disziplinen mit ein. Die Psychosomatik wird zu einer eigentlichen Anthropologie.
Anhand der erfolgten Ausführungen zum Situationskreiskonzept lassen sich, für eine Therapie des Bruxismus, weiterführende Konsequenzen ableiten. Bei sämtlichen psychosomatischen Behandlungen muss, neben den bekannten ätiologischen Faktoren, ein zusätzlicher kognitiver Ansatzpunkt mitberücksichtigt werden. Eine gründliche Informierung der Patienten über die ätiologischen Konzepte und therapeutischen Komponenten vermag die Wahrscheinlickeit einer Heilung erheblich zu steigern.
Wie kann eine psychosomatische Behandlung von Bruxismus nun konkret gestaltet werden?
“Die Heilung eines Teiles sollte nicht ohne Behandlung des Ganzen versucht werden. ” (Plato)
“Voraussetzung einer jeden Behandlung ist die Information über das Geschehen selbst und insbesondere seiner Ursachen. ”
(Brokmeier, Manuelle Therapie)
B / Das interdisziplinäre Bruxismusprojekt
3. Behandlungskonzept
3.1. Diagnose
a) allgemeines Vorgehen
Im vorliegenden Projekt bildete eine interdisziplinäre Diagnostik die Grundlage für das therapeutische Vorgehen (vgl. Meili et al., 1997). Während der Abklärungsphase durchliefen die insgesamt 15 Teilnehmenden folgende drei Stationen:
Der Zahnarzt führte bei allen Patienten vollständige zahnärztliche Untersuchungen durch. Die Diagnose von akutem Bruxismus stützte sich dabei allgemein auf ebenmässige und im speziellen auf glänzend erscheinende Facetten. Um auch das pressende Bruxieren zu erfassen, wurde ebenso auf eine erhöhte Zahnbeweglichkeit, sowie auf berichtete Schmerzsymptome geachtet.
Die darauf folgenden, speziellen Untersuchungsschritte beinhalteten als erstes die Anfertigung von Orthopantomogrammen[24]. Solche Aufnahmen bewähren sich vor allem zur Überwachung der Gebissentwicklung.
Weiter wurden, mit Hilfe von Abdrücken, Kiefermodelle angefertigt, die, anhand von Indizes, der genauen Analyse des Okklusionstyp[25] dienten. Andererseits konnte mittels dieser Modelle auch die Kontaktbeziehung zwischen den Kiefern bei Bewegungen simuliert werden, was ebenfalls einen wichtigen Aufschluss über die physiologische Funktionalität der Okklusion gab[26]. Und nicht zuletzt dienten sie auch der exakten Anfertigung der Aufbissschienen. Schliesslich wurden noch Photographien angefertigt, die speziell zur Analyse der KieferGesichts-Beziehungen herangezogen werden können[27].
Der Physiotherapeut klärte die Probanden mit der Methode der manuellen Medizin (Brokmeier, 1995) ab. Die manuelle Medizin befasst sich speziell mit der Analyse von reversiblen Funktionsstörungen am Haltungs- und Bewegungsapparat, beispielsweise einer Bewegungseinschränkung aufgrund von muskulären Verspannungen oder Gelenkstörungen. Hier wurde nun der Kaumuskulatur, den Kopf- und Kiefergelenken sowie der Beweglichkeit der Halswirbelsäule spezielle Beachtung geschenkt. Des weiteren wurde nach spezifischen Schmerzpunkten, allgemeinen Kopfschmerzen oder Migräne gefragt.
Das konkrete Vorgehen der manualmedizinischen Diagnostik besteht aus einer ersten Orientierung an der Körperoberfläche, z.B. an spezifischen Wirbeln. Von solchen Bezugspunkten ausgehend werden dann die Tiefenstrukturen (Muskeln, Bänder, Gelenkstrukturen, etc.) ertastet. Dabei wird eine Hand für die Palpation benutzt, während die zweite Hand den Patienten dreidimensional im Raum bewegt. Diese feinfühlige Untersuchungsart erlaubt genaue Aussagen über den Zustand und die Beschaffenheit der interessierenden somatischen Gewebe und Strukturen.
Schliesslich führte der Psychiater mit den Probanden ein 50-minütiges Einzelgespräch. Die erste Phase des Gesprächs war jeweils wenig strukturiert. Sie zielte auf die Er- fassung des gegenwärtigen Befindens einerseits, auf das Aufdecken von psychosozialen Belastungsfaktoren andererseits ab. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf den Erzählstil, sowie auf die Art der Beziehungsaufnahme gerichtet. “In der zweiten Gesprächsphase erfolgte eine klassische psychiatrische Exploration mit Erhebung der Familienanamnese und der persönlichen Vorgeschichte. ” (Meili et al. 1997, S.3)
Im letzten, dritten Gesprächsabschnitt wurde bei Bedarf noch eine Charakterzuordnung nach dem Körperpsychotherapeuten Rosenberg (1993, S.251) vorgenommen. Rosenberg unterscheidet vier defensive Typen anhand von Kriterien der Selbstgrenzen, Körperstruktur, Übertragungsmechanismen, etc.
b) zentrale Befunde
Bei den zahnärztlichen Untersuchungen zeigte sich bei allen 15 Teilnehmenden eine ausgeprägte Symptomatik, die auf Bruxismus hinwies. Ob sich die Partizipierenden tatsächlich in einer akuten Bruxismus-Phase befinden, würde sich mit letzter Sicherheit jedoch erst im Schlaflabor zeigen. Immerhin waren sich 7 Personen ihres Knirschens, sei es tagsüber oder in der Nacht, bewusst. Jemand berichtete zusätzlich über Schlafstörungen.
Aus der Bissanalyse zeigte sich bei 5 Personen die Notwendigkeit einer Einschleiftherapie. Bei einer Person erwies sich das Anfertigen einer Zahnschiene als sinnvoll.
Die physiotherapeutischen Abklärungen brachten bei 12 Teilnehmern eine Unbeweglichkeit der oberen Halswirbelsäule hervor. Diese konnte auf eine Verkürzung der entsprechenden Muskulatur zurückgeführt werden.
Bei den M. masseter, pterygoideus und sternocleidomastoideus[28] zeigten sich viele Schmerzpunkte. An den Kiefergelenken konnte jedoch selten Knacken oder Schmerzen festgestellt werden. 5 Personen berichteten über regelmässig auftretende Kopfschmerzen, weitere 3 über häufige Migräne.
Die psychopathologische Abklärung brachte bei allen 15 Teilnehmern starke psychosoziale Belastungen zutage. 6 Personen zeigten deutliche Persönlichkeitsstörungen. Bei 3 Teilnehmern wurde ein Somatisierungssymdrom diagnostiziert. In der vorliegenden Stichprobe zeichnet sich deutlich eine mulitfaktorielle Ätiologie ab. Bei 40% der Stichprobe war eine okklusale Disharmonie vorhanden. Alle Teilnehmenden liessen deutliche psychosoziale Stressoren erkennen, während 20% spezifisch körperliche Konfliktverarbeitungsmuster aufweisen. Bei weiteren 40% war eine Persönlichkeitsstörung mitbeteiligt. Die Frage nach den jeweiligen Primärfaktoren kann hier nicht beantwortet werden.
3.2. Therapie
Die eigentliche Behandlung begann 3 Wochen nach der Abklärung. Die 6 zweistündigen Sitzungen fanden im Abstand von je 2 Wochen statt, wobei zwischen der 3. und der 4. Sitzung eine 6-wöchige Weihnachtspause lag. Die gesamte Kursdauer erstreckte sich somit über rund 4 Monate.
Die Sitzungen wurden im Gruppenrahmen durchgeführt[29]. Einerseits liegen die Vorteile der Gruppentherapien offensichtlich in ihrer Ökonomie. Andererseits “ist das gruppentherapeutische Setting, unter dem Gesichtspunkt therapeutischer Potenz, dem einzeltherapeutischen Setting zumindest gleichzustellen, auch wenn es nicht um zwischenmenschliche Probleme geht. (...) Dies spricht dafür, dass das Gruppensetting Unterstützungsfaktoren enthält, die über die Einzeltherapie hinausgehen.” (Grawe, Donati, Bernauer, 1994, S.704) Auf solche gruppenspezifischen Therapiefaktoren werden wir weiter unten noch einmal zu sprechen kommen. Im folgenden werden die Bestandteile des Behandlungsprogramms kurz einzeln erläutert.
a) zahnmedizinische Komponente
Die Teilnehmer erhielten während des ganzen Projektes eine individuelle zahnmedizinische Betreuung. Dabei kam der Schienentherapie, die bei 13 von den 15 Teilnehmern durchgeführt wurde, eine wichtige Bedeutung zu[30]. Die Teilnehmer wurden aufgefordert die Schiene nur bei Bedarf, also bei starkem Knirschen zu tragen. Dies sollte die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung des Bruxismus schulen. In einer ersten Phase wurden 2 mm dünne, relativ bequeme Schienen angewandt, die im Unterkiefer plaziert werden (Tiefziehschiene nach Drum, siehe Freesmeyer, 1995, S.221). Für die Langzeittherapie wurde anstelle der üblichen Michiganschiene (Freesmeyer, 1995, S.221) eine neuartige, zweischichtige Kunststoffschiene verwendet. Die eine, weiche Seite liegt dabei der Zahnreihe und dem Zahnfleisch des Unterkiefers an und gewährleistet somit einen optimalen Tragkomfort. Eine harte Oberschicht, die gezielt eingeschliffen werden kann, trifft auf den Oberkiefer. Es zeigte sich im ersten Kursdurchlauf, dass diese neuartige, kombinierte Schiene von den Teilnehmern wesentlich besser als die harte Michiganschiene akzeptiert wurde (vgl. Meili et al., 1997)[31]. Es wurden gezielte “Motivationsgespräche geführt und das Feedback der Patienten registriert. ” (Meili et al., 1997, S.6)
“Der Angriffsort einer Okklusionsschiene ist immer die Aufhebung der bestehenden Kontaktbeziehung der Zähne; das Ziel ist die Änderung der Muskel- und Gelenkfunktion und damit eine Neueinstellung und Harmonisierung der vertikalen und horizontalen Kieferrelation. Diese Umstellung der Kieferrelation hat auch das Ziel, neuromuskulär positiv auf Haltungs- und Verhaltensstörungen einzuwirken. ” (Freesmeyer, 1995, S.217)
Durch eine solche Strukturveränderung der Muskulatur, sowie der Kiefergelenke stellt sich oftmals eine neue Unterkieferposition ein. Um die angestrebte definitive, stabile physiologische Okklusion gewährleisten zu können, werden dadurch weitere Massnahmen zur Optimierung der Kontaktbeziehung zwischen den Zahnreihen notwendig. Hier ist die Einschleiftherapie die Methode der Wahl (vgl. Engelhardt, 1995). Ausgehend von der Modellanalyse wurde bei 5 Teilnehmern eine Rekonturierung der okklusalen Bereiche vorgenommen, mit dem Ziel unharmonische Abläufe des stomathognathen Systems funktionsadäquat zu gestalten.
b) physiotherapeutische Komponente
“Im Vordergrund der physiotherapeutischen Behandlung standen die Verbesserung der körperlichen Wahrnehmung und das Erlernen eines Heimprogramms zur Selbstbehandlung muskulärer Dysfunktionen. ” (Meili et al., 1997, S.5) Eine gezieltere Wahrnehmung wurde anhand von Informationen über die Lokalisation und Beschaffenheit der interessierenden Muskeln und Gelenke, sowie durch angeleitete Übungen vermittelt.
Das Programm zur Eigenbehandlung bestand aus zwei unterschiedlichen Elementen. Das erste Teil umfasste aktive Massnahmen zur Detonisierung der verspannten Muskulatur. Für die verkürzte Schulter-Nacken-Muskulatur wurden spezifische, passive Dehntechniken gelehrt (vgl. Schneider, Dvorák, Dvorák & Tritscheler, 1989, S.144). Die Detonisierung der Kiefermuskulatur wurde durch eine Technik des Wechsels von Anspannung und Entspannung vermittelt. Nach dem 1. Sherrington-Gesetz korreliert nämlich die maximale Anspannung eines Muskels mit seiner maximalen Entspannung (Brokmeier, 1995, S.243)[32].
Der zweite Teil des Heimprogramms beinhaltete Techniken zur spezifischen Schmerz- behandlung. Die Selbstbehandlung von Triggerpunkten[33] der Kaumuskulatur, sowie des
M. sternocleidomastoideus wurde mittels der Technik der punktförmigen Quermassage gelehrt. Sie dient vor allem der direkten Dehnung der Fasern in den Muskelspindeln, sowie einer, über periphere Sensoren laufenden, zentralmotorischen Inhibition der betreffenden Muskulatur (Brokmeier, 1995, S.246).
Zur Behandlung der diffusen Schmerzregionen wurde den Teilnehmern die Anwendung einer Eisbehandlung beigebracht. Die hauptsächlichen Wirkungen eines längerfristigen Kältereizes sind sowohl eine Hemmung der Entladung der Schmerzrezeptoren, wie auch eine Detonisierung der Muskelfasern (Brokmeier, 1995, S.231).
Um auch Anstösse zur Prävention von Spasmen und Schmerzen geben zu können, wurden Themen der Ergonomie, z.B. die korrekte Sitzhaltung, ebenfalls diskutiert[34]. Denn die Kau- und Schlundmuskulatur ist nicht nur in die Funktionen der Halswirbelsäule, des Schultergürtels mit der oberen Brustwirbelsäule integriert, sondern über Reflexe insbesondere auch in die statisch-dynamische Steuerung des aufrechten Ganges und Standes involviert (Brokmeier, 1995, S.224).
Das Autogene Training (AT) war ein weiterer, wichtiger Bestandteil der Behandlung. Die Effekte, die mit diesem Verfahren erzielt werden sind weniger spezifisch, vielmehr zielen sie auf eine allgemein Entspannung des gesamten Organismus hin.
Die Methode geht in die 30‘er Jahre auf den deutschen Psychiater J.H. Schultz (1932/1991) zurück. Mit der Absicht eine Alternative zur Hypnose zu schaffen, entwickelte er das AT, das für den Praktizierenden den Vorteil der Unabhängigkeit vom Arzt bringt. Die Techniken mit denen Schultz arbeitet, sind Vorstellung (Autosuggestion) und Konzentration. Konzentration soll in diesem Zusammenhang jedoch nicht als ein angestrengter Willensakt, sondern vielmehr als eine gezielte Steuerung des Bewusstseins verstanden werden.
Das AT beinhaltet 6 verschiedene Übungen, oder Vorstellungsinhalte:
1. “Der Körper ist schwer und entspannt.”
2. “Die Extremitäten sind angenehm warm.”
3. “Die Atmung ist ganz ruhig und kommt und geht.”
4. “Das Herz schlägt ruhig und kräftig.”
5. “Der Bauch (Plexus solaris) ist strömend warm.”
6. “Die Stirn ist angenehm kühl.”[35]
Die nachweisbaren Effekte, die mit dieser Methode erzielt werden, können auf verschiedenen Integrationsstufen beschrieben werden. Die Wirkung von Vorstellungen lässt sich z.B. direkt auf der physikalisch-chemischen Ebene beobachten. Hält man sich eine geballte Faust vor Augen, so kann man in der entsprechenden Muskulatur zuverlässig elektrische Aktivität beobachten. “Das heisst, die Vorstellung von einer Bewegung beinhaltet im Ansatz deren Durchführung. ” (Binder & Binder, 1993, S.17) Dementsprechend haben die Schwere- und Wärmeübung eine Entspannung der quergestreiften Skelettmuskulatur, bzw. der glatten Muskulatur der inneren Hohlorgane zur Folge.
Auf der biologischen Ebene lässt sich eine zeitweilige Umstellung im vegetativen Nervensystem vom ergotropen zum trophotropen Zustand beobachten. Bei regelmässigem Üben findet ein langfristiger Funktionsausgleich von Sympathikus und Parasympathikus statt, hin zu einer homöostatischen Eutonie (Binder & Binder, 1993, S.21 ff.). Spezifischen (und erfolgreichen) Einsatz findet das AT vor allem bei der Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, z.B. bei Hypertonie, paroxysmaler Tachykardie, usw. (Wolf, 1994, S.12f.). Die Wärmeübung fördert dabei die allgemeine Durchblutung, während bei der Herzübung eine positive Beziehung zu diesem zentralen Organ aufgebaut wird.
Auf der Ebene der Psychologie finden sich Effekte der Beruhigung, des Angst- und Aggressionsabbaus, der Resonanzdämpfung von Affekten, sowie ein verbessertes Stresscoping (Wolf 1994, S.17ff.). Wir haben es hier also mit einer ganzheitlichen Methode zu tun, die vor allem die Selbstheilungstendenzen des Organismus aktiviert[36].
Natürlich hätte das AT auch unter den psychologischen Behandlungskomponenten genannt werden können. Da die physiologischen Wirkungen des AT sich jedoch als erste einstellen (psychische Strukturen werden erst nach längerem Praktizieren einer Veränderung unterworfen), wird diese vielschichtige Methode unter der physiotherapeutischen Komponente subsumiert.
c) psychologische Komponente
Hierunter sind vor allem die Gruppendiskussionen zu nennen, innerhalb derer sich dann auch die gruppenspezifischen Wirkfaktoren entfalten können.
Obwohl das gruppenpsychotherapeutische Setting noch nicht lange im Fokus der Aufmerksamkeit liegt, ist diesbezüglich schon einige Forschung vorhanden. Allein für den Ansatz der Kurzgruppenpsychotherapien existieren schon eine verwirrende Vielzahl von theoretisch und praktisch unterschiedlichen Konzeptionen und Schulen[37].
Yalom (1970/1996) identifizierte 12 gruppenspezifische Therapiefaktoren, die, unabhängig von Schulrichtung und angewandter Technik, für jede Art von Gruppentherapie Gültigkeit beanspruchen. Zu ihrer Erfassung entwickelte er einen Fragebogen, mit dem bisher beinahe alle diesbezüglichen Studien im angloamerikanischen Raum durchgeführt wurden. Dabei zeigte sich keine absolute Rangordnung der Bedeutsamkeit dieser Faktoren. Vielmehr wird vermutet, dass das Muster der kurativen Faktoren sich je nach Entwicklungsstand der Gruppe anders präsentiert (Tschuschke, 1989, S.65).
Einer entsprechenden Literatursichtung von Pritz (1989) zufolge, kommt, innerhalb von Kurzgruppentherapien (und somit auch im Setting dieses Projektes), folgenden drei Yalomschen Faktoren die grösste Wirksamkeit zu:
1.Gruppenkohäsion. Dies bedeutet, dass die Gruppenmitglieder ein Gefühl der Zusammengehörigkeit haben und sich gegenseitig akzeptieren. Die Wirkung der Gruppenkohäsion wird darin gesehen, dass sich durch Prozesse sozialer Integration, eine entspannte therapeutische Atmosphäre entwickeln kann, in der Veränderungen überhaupt erst möglich werden (Yalom, 1996, S.67).
2.Interpersonales Lernen. Hiermit ist gemeint, dass durch Äusserungen und Reaktionen anderer Teilnehmer in ähnlicher Situation tiefgreifende Veränderungen, wie eine allgemeine Verständnisentwicklung oder das Erkennen neuer Bewältigungsstrategien, ausgelöst werden können. Diese Umstrukturierung kann sowohl in Form eines korrigierenden emotionalen Erlebnisses (Alexander) geschehen, oder aber auch nach dem Prinzip des Modelllernens erfolgen (Yalom, 1996, S.37).
3.Katharsis. Einerseits bietet die Mitteilung von persönlichen, belastenden Gefühlen oder Ansichten die Möglichkeit, in einem sozialen Mikrokosmos neue Erfahrungen mit diesen Gefühlen zu sammeln, sich emotional zu entlasten. Gleichzeitig werden hier auch kommunikative Fertigkeiten erworben. Andererseits kann durch die Erzählung allein, wie auch durch eine anschliessende Diskussion eine diesbezüglich verbindliche Neustrukturierung stattfinden. Dabei ist die alltagsnahe Situation mit verschiedensten gleichberechtigten Anwesenden zentral (Yalom, 1996, S.100).
Als spezifische Aufgabe wurde das Erstellen eines persönlichen Stressinventars sowie eines Kataloges persönlicher Bewältigungsmöglichkeiten gegeben. Diese Art der Selbstbeobachtung führt einerseits zu grösserem Bewusstsein. Andererseits kann die Verhaltensbeobachtung verstärkende oder bestrafende Auswirkungen haben, womit problematische Verhaltensketten besser durchbrochen werden können (Reinecker, 1986, S.168).
Zusätzlich wurden die Teilnehmer während der Behandlungsphase gebeten, ein ‘Knirsch-Tagebuch‘ zu führen (s. Anhang, S.131 ). Das Tagebuch dient grundsätzlich der Selbstkontrolle, d.h. der Bewusstwerdung bezüglich des Bruxismus, sowie auch bezüglich dem Einsatz der vermittelten Strategien zur Verhaltensmodifizierung. Es soll die Teilnehmer einerseits zu eigenem Beobachten und Erforschen von Zusammenhängen anregen und somit auch die Motivation positiv beeinflussen (siehe auch die entsprechende Forderung für zukünftige Arbeiten bei Keller 1994, S.78).
Aus ‘psychotherapeutischer‘ Perspektive sind die Veränderung allgemeiner Verhaltensmuster, sowie die Verbesserung der Wahrnehmung der psychischen Befindlichkeit und des eigenen Charakterstils die angestrebten Ziele (vgl. Meili et al., 1997).
d) informative Komponente
Um therapeutische Information (auch auf körperlicher Ebene) überhaupt als nutzbringend wahrnehmen zu können, ist es wichtig, dass eine entsprechende kognitive Repräsentation oder Struktur vorhanden und aktiviert ist. In der Terminologie des Situationskreis würde es sich dabei um semiotisch bedingte, psychosomatische Abwärtseffekte handeln. Der Zweck dieses Behandlungsbausteines ist eine zusätzliche Anregung der Initiative und der Verantwortung der Teilnehmer, was durch die Vermittlung von therapierelevanter Information erreicht wird.
Die Disziplin der kognitiven Lerntheorie, die spezifisch den Einfluss von mentaler Information auf das Verhalten untersucht, erklärt diese Wirkung über das Einstellungskonstrukt. Dabei wird normalerweise zwischen zwei handlungsrelevanten Erwartungshaltungen unterschieden, die im folgenden Schema verdeutlicht werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Kognitive Verhaltensdeterminanten (nach Reinecker, 1986, S.48).
Die Haltung der Selbst-Effizienz (Bandura) wird angesichts einer Problemlage situationsspezifisch gebildet, und beinhaltet die Erwartung, ob und inwiefern man in der Lage sein wird, mit dem vorliegenden Problem umzugehen. Durch das vermittelte Arsenal an Coping-Strategien der schon genannten Behandlungsbausteine, dürfte es um diese kognitive Komponente seitens der Teilnehmenden gut stehen.
Die zweite Determinante besteht aus der Einschätzung der Verhaltenseffektivität, also aus der Erwartung zu welchen positiven Effekten das gezeigte Verhalten führen wird. Dieser Evaluationsprozess entscheidet dann darüber, welche der zur Verfügung stehenden Problemlösestrategien zum Einsatz kommen. Und genau hier setzt die informative Komponente an, die über die Vermittlung von der Behandlung zugrundeliegenden Annahmen, die kognitiven Konzepte und schliesslich bedingt auch die Werthaltungen der Teilnehmer zu modifizieren versucht. Die Themen die dabei zur Sprache kommen, werden im folgenden kurz angeschnitten.
Um die Effektivität der zahnärztlichen Betreuung zu steigern, wird die dentalmedizinische Theorie der Parafunktionen dargelegt.
Aus physiotherapeutischer Warte wird das Thema der Schmerzphysiologie diskutiert. Nach dem heutigen Schmerzverständnis wird zwischen gleichberechtigten emotionalen und sensorischen Komponenten unterschieden. Das Phänomen Schmerz stellt dabei stets eine subjektive Empfindung dar, wofür Gewebeschädigungen weder hinreichende noch notwendige Bedingungen sind. Der Schmerz wird damit zu einem guten Paradigma für psychosomatische Zusammenhänge[38]. Einblicke in die psychologische Perspektive werden anhand von mehreren Referaten gewährt. Anhand von Ausführungen über die psychodynamische Entwicklungspsychologie, sowie über grundlegende Themen von Beziehungen (Nähe, Distanz, Helferverhalten, Abgrenzung, usw.), geschieht eine allgemeine Einführung in das psychologische Denken. An die Beziehungsthematik anknüpfend, wird die Charakterlehre nach Rosenberg (1993, S.251 ff.) vermittelt. Hier wird anhand des Energiemodells ein Bezug von problematischen Beziehungsmustern, entsprechenden körperlichen Verankerungen und damit einhergehenden psychischen Strukturen hergestellt. Die Teilnehmer werden angeregt die eigenen Mechanismen der Beziehungsgestaltung zu erforschen.
Schliesslich wird das Angebot mit der Erklärung einiger kognitiv-behavioralen Konzepte vervollständigt. Von Erläuterungen zum allgemeinen Konzept der Bewältigungsmechanismen (Coping) ausgehend, kommen diesbezüglich spezifische Techniken des Selbstmanagement und der Selbstregulation zur Sprache[39]. Allgemeine Erwägungen und Konzepte bezüglich der Veränderung von Verhaltensmustern runden diesen Block ab.
3.3. Zusammenfassung
Wir sehen, dass die Ansatzpunkte dieses multimodalen Behandlungskonzeptes genau den drei ätiologischen Faktoren, die dem Bruxismus zugrunde liegen können, entsprechen. Wie wir in unserer theoretischen Auseinandersetzung mit der Psychosomatik gesehen haben, ist als weiterer wesentlicher Therapiefaktor eine explizite, informative Kommunikation betreffend des Störungsbildes und der laufenden Therapie zu nennen, welcher durch den Baustein der Impulsreferate hier ebenso vertreten ist. Die im Verlaufe dieser Arbeit aufgestellten Anforderungen an eine psychosomatische Therapie im allgemeinen, sowie an eine Therapie des Bruxismus im speziellen, werden vollumfänglich erfüllt.
Die einzelnen Gruppenveranstaltungen waren wie folgt strukturiert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Kursprogramm, nach Meili et al. (1997).
“Klug zu fragen ist schwieriger als klug zu antworten. ”
(Persisches Sprichwort)
“Die Wissenschaft der Planung besteht darin, den Schwierigkeiten der Ausführung zuvorzukommen. ” (Vauvenargues)
“Die Wirksamkeiten, auf die wir achten müssen, wenn wir wahrhaft gefördert sein wollen, sind:
Vorbereitende, Begleitende, Mitwirkende, Nachhelfende, Fördernde, Verstärkende, Hindernde, Nachwirkende. ” (Goethe, Maximen und Reflexionen)
B / Das interdisziplinäre Bruxismusprojekt
4. Versuchsplanung
4.1. Fragestellung
a) Kriterien einer Therapieevaluation
Natürlich gehen wir davon aus, dass das vorliegende Therapiekonzept konkreten Nutzen im Sinne einer Symptomreduzierung bringen wird. Betrachten wir noch einmal die Auflistung der für Bruxismus typischen Anzeichen, sehen wir uns vor allem mit einer Symptomatik konfrontiert, die sich über längere Zeiträume hinweg ausbildet, bzw. regeneriert. Als unmittelbar feststellbares, objektives Erfolgskriterium drängt sich daher die direkte Prüfung der Knirschaktivität selbst auf. Die zu untersuchende Frage wäre also, ob die Teilnehmer nach der erfolgten Behandlung weniger mit den Zähnen knirschen als zuvor.
Dieses objektive Kriterium liefert einen wichtigen, aber ziemlich undifferenzierten Erfolgsmassstab. Nach den Ausführungen zum Situationskreis und der Formulierung des Therapieziels als Nutzenoptimierung für die Teilnehmer, liegt es nahe den subjektiv wahrgenommenen Nutzen auch zu erfragen. Eine solche subjektive Bewertung “kann als ein (...) eigenständiges Erfolgskriterium betrachtet werden. ” (Priebe, 1992, S.21) Es zeigte sich dass Patienten durchaus reliable und valide Einschätzungen der Behandlungsqualität abgeben können (Davies & Ware, 1988, S.33).
Untersuchungen zu subjektiven Therapiebewertungen deuten darauf hin, dass diese vor allem von Faktoren abhängen, die nicht für eine spezielle Therapieschule oder Behandlungtechnik charakteristisch sind (vgl. Davies & Ware, 1988). Damit erlaubt die Berücksichtigung der subjektiven Therapieevaluation auch “den Einfluss von für das Therapieergebnis relevanten unspezifischen Faktoren abzubilden, obwohl diese Faktoren selbst nicht erfasst werden können und obwohl es sogar unklar bleibt, um welche Faktoren es sich im einzelnen handelt. ” (Priebe, 1992, S.147)
Als Kritikpunkt einer subjektiven Erfolgseinschätzung ist oft zu lesen, dass das abgegebene Urteil mehr mit dem Patienten selbst, als mit der Qualität und dem Nutzen der Therapie zu tun habe. Die wesentlichen soziodemographischen Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, etc. nehmen jedoch einen vernachlässigbar geringen Einfluss auf die erfolgte Beurteilung (Priebe, 1992, S.122). Die globale Zufriedenheit mit einer Therapie scheint tendenziell mit der Bewertung der Beziehung zum Therapeuten zusammenzuhängen (vgl. Davies & Ware, 1988; Priebe, 1992, S.138). Diese Ergebnisse spiegeln den therapeutischen Stellenwert der persönlichen Beziehung wider und stehen somit in Übereinstimmung mit den Ausführungen zum diagnostisch-therapeutischen Zirkel. Dass die Beziehungsqualität als wichtiges, empirisch bestätigtes, therapeutisches Agens mit in die subjektive Beurteilung einfliesst, spricht eher für, als gegen dieses Evaluationskriterium. Wir können also davon ausgehen, dass Patienten durchaus in der Lage sind den subjektiven Nutzen der erfolgten Behandlung akkurat wahrzunehmen.
Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit die subjektiven und objektiven Kriterien der Therapieevaluation sich aufeinander beziehen. Es erscheint folgerichtig von einem positiven Zusammenhang auszugehen.
b) weitere interessierende Zusammenhänge
Um den Aspekt der persönlichen Attribution des Therapieerfolgs abzurunden, wollen wir ein weiteres subjektives Kriterium, die Erwartungshaltung der Teilnehmer vor der Behandlung miteinbeziehen. Wir haben gesehen, dass Studien zum Zusammenhang zwischen der Erwartungshaltung von Patienten und dem tatsächlichen Behandlungserfolg kontroverse Befunde liefern. Neben einer methodischen Kritik dieser Studien (Wilkins, 1973) kann jedoch auch konzeptuelle Kritik angebracht werden.
Das Erwartungskonstrukt misst nämlich lediglich ein anfängliches Veränderungspotential, oder die Bereitschaft sich offen auf eine bevorstehende Therapie einzulassen. Diese Erwartungen sind jedoch in dem Sinne naiv, als dass sie mit der Realität, also mit der tatsächlich erfolgten Behandlung, nichts zu tun haben. Über das tatsächlich wahrgenommene Ausmass an Hilfe, sowie über eine allfällige Symptomreduzierung lassen sich aus Erwartungshaltungen keine direkten Aussagen ableiten. Die intervenierende Variable der stattgefundenen Behandlung ist in ihrem diesbezüglichen Effekt der Erwartungshaltung sicherlich überlegen. Dennoch dürfte eine positive Erwartungshaltung zumindest dem initialen Behandlungserfolg zuträglich sein.
Von diesen Überlegungen ausgehend interessiert uns der Zusammenhang zwischen der Erwartungshaltung und dem tatsächlichen, subjektiv wahrgenommenen Nutzen. Die Annahme eines positiven Zusammenhangs, im Sinne einer self-fulfilling-prophecy, erscheint dabei berechtigt und plausibel. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Effekt der initialen Erwartungshaltung allmählich von den realen Begebenheiten überlagert, und somit mit der Zeit abnehmen wird. Um diese Annahme zu prüfen, wird neben der Erwartungshaltung vor der Behandlung, das Ausmass der wahrgenommenen Hilfe zweimal erhoben werden: in der Mitte der Behandlung, sowie beim Abschluss der Therapie.
c) Zusammenfassung
Folgende Punkte sollen innerhalb dieser Studie untersucht werden:
1. Die Veränderung der Bruxismusaktiviät nach der Therapie zu der vorher gemessenen Baseline.
2. Der Zusammenhang zwischen der Erwartungshaltung gegenüber der Therapie und dem Ausmass des tatsächlich wahrgenommenen Nutzens.
3. Der Zusammenhang zwischen dem subjektiv wahrgenommenen Nutzen und der objektiv gemesssenen Veränderung in der Bruxismusaktivität.
4. Versuchsplanung
4.2. Messinstrumente
a) objektive Parameter
Objektive Kennwerte zur Knirschaktivität werden vor und nach der Intervention erhoben. Dazu laden wir die Teilnehmer je zwei aufeinanderfolgende Nächte in das Schlaflabor ein; eine Adaptationsnacht soll der Minimierung der Schlaflabor-Artefakte dienen.
Um die Knirschaktivität zu bestimmen, wird die Aktivität der Masseter und Temporalis Muskulatur während der ganzen Nacht registriert. Die Ableitung und Aufzeichnung erfolgt nach den in der Schlafforschung üblichen Standards (vgl. Rechtschaffen & Kales, 1968).
Die Identifizierung und Signierung der einzelnen Bruxismusepisoden erfolgt nach den bei Koller (1995) angegebenen Richtlinien (siehe Anhang, S.117). Die Dimensionen, die dabei berücksichtigt werden sind: 1. der Typ der Episode (phasisch, tonisch oder gemischt), 2. die Anzahl der Episoden, sowie 3. deren Dauer.
b) subjektive Parameter
Der subjektive Erlebensbereich ist nicht direkt beobacht- und messbar. Es lassen sich lediglich Verhaltensweisen erfassen, die als Ausdruck dieses Erlebens und der Einstellungen der Teilnehmer verstanden werden können. Die Erhebung der subjektiven Erwartungen, bzw. des subjektiv wahrgenommenen Nutzens geschieht deshalb mittels Fragebogen (s. Anhang, S.119). Die Entwicklung geschah gemäss den allgemeinen, bei Lewin (1986) angegebenen Richtlinien. Als Antwortformat wurden 10 cm lange visuelle Analogskalen verwendet. Die hauptsächlichen Vorteile dieser Messmethode sind folgende: einfache Verständlichkeit, die Reduktion des Einflusses systematischer Antworttendenzen, die Eignung für die Erfassung von zeitlichen Verläufen, die statistische Auswertbarkeit auf Intervallniveau, sowie hohe Werte der Reliabilität und Validität (vgl. Fähndrich & Linden, 1982). Des weiteren sind die einzelnen Items unmittelbar inhaltlich interpretierbar. Das Antwortspektrum liegt dabei zwischen einem negativen und einem positiven Pol. Um den Einfluss systematischer Antworttendenzen zu reduzieren, wurden die Pole der aufeinanderfolgenden Items jeweils vertauscht dargeboten.
Inhaltlich wurden die Items ziemlich breit aufgefächert, sie erlauben sowohl allgemeine, wie auch spezifische Beurteilungen. Es finden sich vier hauptsächliche Faktoren vor, die den therapeutischen Komponenten entsprechen. Pro Faktor wurden dabei 5 Fragen formuliert, die auch eine gewisse Systematik aufweisen. Ein Item erfasst dabei jeweils ein, die Therapiekomponente betreffendes, globales Urteil. Ein weiteres, in allen Kategorien vorkommendes Item fragt nach der entsprechend entwickelten Eigenaktivität, die neben den Therapiesitzungen stattfindet. Die restlichen 3 Fragen je Kategorie kamen durch theoretische Ueberlegungen zustande. Berücksichtigt wurden dabei die ätiologischen Theorien, das Behandlungskonzept, sowie Resultate aus der aktuellen Therapieprozessforschung. Die folgende Abbildung 7 gibt einen strukturellen Überblick zur inhaltlichen Gestaltung der einzelnen Items.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Struktureller Ueberblick zur inhaltlichen Gestaltung der Fragebogenitems.
Zur Erfassung der Erwartungen und dem tatsächlich wahrgenommenen Nutzen wird prinzipiell dieselbe Formulierung der Items verwendet. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Formen besteht im verwendeten Tempus. Die Erwartungshaltung ist dabei, ihrem Wesen entsprechend, im Futur formuliert (z.B. ich denke / erwarte, dass mir ... helfen wird), während die Beurteilung der Effektivität im Präsens erfragt wird (z.B hilft mir).
Die Daten des ‘Knirsch-Tagebuchs‘ sind weitere, zur Verfügung stehende subjektive Parameter. Diese fliessen jedoch nicht in die eigentliche Analyse der Fragestellung ein, sie sollen vielmehr für eine detaillierte Deskription eingesetzt werden.
4.3. Methodik
a) Hypothesen
Im folgenden werden die, aus der Fragestellung abgeleiteten Alternativhypothesen aufgeführt.
Die erste Hypothese betrifft die objektive Effektivität der Therapie:
- H1: Die durchschnittliche Bruxismusaktivität ist nach der Intervention geringer als vorher.
Die zweite Hypothese ist zweiteilig und betrifft den Zusammenhang zwischen der Erwartungshaltung vor der Behandlung und der tatsächlich wahrgenommenen Hilfe.
- H2: Das Ausmass der Erwartungshaltung steht mit dem Ausmass der tatsächlich wahrgenommenen Hilfe in einem positiven Zusammenhang. Die Enge dieses Zusammenhangs nimmt über die Zeit hinweg ab.
Die dritte Hypothese formuliert den erwarteten Zusammenhang zwischen subjektiven und objektiven Erfolgskriterien:
- H3: Das Ausmass des subjektiv wahrgenommenen Nutzens steht mit dem Ausmass des objektiven Therapieerfolgs in einem positiven Zusammenhang.
b) konkreter Versuchsablauf
Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte in der Praxis des behandelnden Zahnarztes in Schaffhausen, wo Patienten mit deutlich erkennbarer Symptomatik direkt auf das bevorstehende Behandlungsprogramm angesprochen wurden.
Ein unverbindlicher Informationsabend brachte dann den Interessenten einen übersichtsartigen Einblick in das Projekt. Die Projektleiter gaben zuerst allgemeine Erklärungen zum Bruxismussyndrom ab und erläuterten in kurzen Worten den Inhalt ihrer therapeutischen Massnahmen, sowie die dahinterstehenden Absichten. Ursula Zanardi und ich klärten die Anwesenden dann über unser Vorhaben, die allgemeine Forschungstätigkeit an der klinischen Abteilung, sowie das bevorstehende Vorgehen im Schlaflabor auf.
Nach dem Anmeldeschluss nahmen Ursula Zanardi und ich dann erneut Kontakt mit den Teilnehmern auf, um den Zeitpunkt für die ersten zwei konsekutiven Nächte zu vereinbaren. Die Termine der 15 Teilnehmer wurden, mit einem beiliegendem Plan und allgemeinen Informationen, postalisch bestätigt. Die Fragebogen zur Ermittlung der Erwartungshaltung wurden in der ersten Nacht im Schlaflabor ausgefüllt. Diese erste Erhebungsphase erstreckte sich über 4 Wochen.
Die Phase der Behandlung begann 3 Wochen später, mit den diagnostischen Abklärungen. Weitere 3 Wochen später startete dann der erste Behandlungsteil à 3 Sitzungen, die jeweils im Abstand von 2 Wochen stattfanden. Nach der dritten Sitzung wurde der erste Fragebogen zur Ermittlung des subjektiv wahrgenommenen Nutzens den Teilnehmern per Post zugestellt. Im Anschluss an eine 6-wöchige Pause über die Festtage, startete sodann die zweite Sitzungsrunde mit drei weiteren Treffen. Die gesamte Kursdauer erstreckte sich somit über ca. 4 Monate.
In direktem Anschluss daran wurde der Nachtschlaf der Teilnehmer ein zweites Mal auf Bruxismusepisoden hin untersucht. Die zweite Messung des subjektiv wahrgenommenen Nutzens geschah ebenfalls in der ersten dieser zwei aufeinanderfolgenden Nächte.
Ein Auswertungsgespräch der Therapeuten mit den Teilnehmenden, sowie ein kurzer Ergebnisbericht unsererseits rundeten dieses facettenreiche und spannende Projekt ab.
Der methodisch wesentliche Ablauf lässt sich folgendermassen darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Zeitlicher Ablauf der Datenerhebungen.
c) kritische Bemerkungen
Das vorliegende Versuchsdesign weist einige, leider unumgängliche Schwachstellen auf, die ich hier vorwegnehmen und stichwortartig ansprechen möchte:
- Derselbe Fragebogen kommt mehrmals zur Anwendung, was zu Erinnerungseffekten führen könnte. Da die Zeitabstände zwischen den einzelnen Fragebogenmessungen jedoch recht gross sind (ca.10 Wochen), scheint mir dieses Vorgehen gut vertretbar.
- Gerne hätte ich noch weitere, möglicherweise relevante Variablen, wie z.B. der Leidensdruck vor dem Beginn der Intervention, usw. mitberücksichtigt. Eine Stichprobengrösse von 15 Personen lässt dies jedoch nicht zu. Bei einem Mehr an Prädiktorvariablen würden diese hauptsächlich mit sich selbst korrelieren und somit nichts zu einer gewünschten Differenzierung beitragen.
- Die behandelte und untersuchte Stichprobe ist für die Population nicht repräsentativ, was jedoch ein allgemeiner, fast unmöglich zu behebender Mangel von Untersuchungen dieser Art ist.
- Der Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die keiner Behandlung unterzogen wird, fehlt. Der Einbezug einer Kontrollgruppe hätte jedoch den, im Rahmen einer Lizentiatsarbeit geforderten Aufwand bei weitem gesprengt. Ausserdem wären ethische Bedenken zu berücksichtigen gewesen, die Probanden der Kontrollgruppe hätten nicht auf eine spätere Behandlung verwiesen werden können. Die Aussagekraft des Versuchs bezüglich der tatsächlichen Therapieeffektivität ist somit erheblich eingeschränkt.
Eine gewisse Kontrolle liegt trotzdem im Bereich des möglichen. Falls therapiespezifische Effekte vorhanden sind, müsste die Varianz zwischen den zwei Messzeitpunkten grösser sein, als diejenige zwischen den jeweiligen aufeinanderfolgenden Nächten.
“Mit Hilfe der Statistik kann man versuchen, die soziale Realität in der genauesten menschlichen Sprachform abzubilden; diese besteht in der Sprache der Zahlen. ”
(Wellhöfer, 1984, S.29)
“ Nicht in der Erkenntnis liegt das Glück, sondern im Erwerb der Erkenntnis. ”
(Edgar Allan Poe)
“ Von dem, was vorgeht, ist nicht immer das Wichtigste, was dabei zustande kommt. ”
(L.v.Ranke)
C / Statistische Datenanalyse
5. Stichprobe
Die als starke Knirscher identifizierten Versuchspersonen wurden in der Stadt Schaffhausen, aus dem Klientel des Zahnarztes rekrutiert. Das Alter der 15 Teilnehmenden lag zwischen 24 und 62 Jahren, ebenso war der Bildungsstand weit gestreut. Von den ursprünglich 15 Probanden ist lediglich eine Versuchsperson, mangels Motivation, abgesprungen. Es stehen uns also 14 vollständige Datensätze zur Verfügung, welche die Grundlage der nachfolgenden Berechnungen bilden[40].
Mit einer Gruppenzusammensetzung von 5 Frauen (36%) und 9 Männern (64%) ist das männliche Geschlecht, im Vergleich zu den gewöhnlich berichteten Behandlungszahlen (3 Frauen auf 1 Mann) übervertreten. Auch unter Mitberücksichtigung der bisherigen Therapieerfahrungen (Tabelle 1) relativiert sich dieses Bild nicht wesentlich. Unsere Stichprobe ist betreffend dem geschlechtsspezifischen Krankheitsverhalten also nicht repräsentativ. Aus diesem Grund wurde für jede Variable des Knirschverhaltens, Fragebogens und Tagebuches der Einfluss des Faktors Geschlecht geprüft. Es kann hier vorweggenommen werden, dass der Faktor Geschlecht auf keinen Variablenwert oder - verlauf einen signifikanten Einfluss nimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Gechlechtsspezifische Aufschlüsselung der bisherigen Therapieerfahrung (Items 1.23 & 1.24 [41] ). Die Prozentwerte sind pro Geschlechtsgruppe und Therapieart angegeben.
Der von den Probanden angegebene Leidensdruck (Item 22) ist in Abbildung 9 wiedergegeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Antwortverteilung zu Item 22: “ Leiden Sie unter Schmerzen/Verspannungen vom Zähneknirschen ? ” .
Erstaunlicherweise blieben die diesbezüglichen Antworten über die Behandlungsdauer hinweg relativ stabil. Einerseits könnte die Zeitspanne zwischen den Messungen zu kurz sein, als dass sich eine deutlich bemerkbare Veränderung einstellen konnte. Wie schon bemerkt, braucht das stomathognathe System längere Zeit zur Regeneration der Bruxismussymptome. Andererseits könnten Angaben zum Leidensdruck im Selbstkonzept verankert und somit relativ stabil sein. Trotzdem waren die Probanden hoch motiviert an den Kursabenden und Schlaflabornächten teilzunehmen.
Die Angaben zur Frage nach dem Knirschen tagsüber (Item 21) waren noch stabiler. Die Antworten verteilten sich zu je einem Drittel auf die Kategorien ‘nie‘, ‘selten‘ und ‘oft‘. Diese Angaben stehen im Gegensatz zu den Beobachtungen von Reding et al. (1968), die kein gemeinsames Auftreten von Zähneknirschen tagsüber und während der Nacht finden konnten. Ihr Schluss auf zwei qualitativ verschiedene Krankheitsentitäten des ‘diurnal‘ und ‘nocturnal bruxism‘ ist anhand unserer Resultate nicht nachvollziehbar.
C / Statistische Datenanalyse
6. Bruxismus
6.1. Deskription
a) Interraterreliabilität
Die 56 Nächte wurden je zur Hälfte von U. Zanardi und mir signiert. In gemeinsamen Diskussionen versuchten wir unsere Einschätzungen einander anzugleichen und unklare Situationen der Signierung zu klären. Zur Bestimmung der Interraterreliabilität diente eine Stichprobe von 4 Nächten. Diese stammten, wegen der starken interindividuellen Unterschiede im Erscheinungsbild des Bruxismus, von 4 verschiedenen Teilnehmenden.
Aus dem Total von 97 zur Diskussion stehenden Knirschepisoden wurden 92 von beiden Ratern als solche erkannt. Es wurde also in rund 95% der Fälle eine Übereinstimmung bezüglich der Identifikation der Bruxismusereignisse erzielt.
Um ein Mass für die Interraterreliabilität betreffend der Episodentypen zu erhalten, wurde Cohens Kappa berechnet, welches einen Wert von 0.79 annimmt. Zur Ermittlung der Übereinstimmung bezüglich der Episodendauer dient uns Spearmans Koeffizient, der einen Wert von 0.95 annimmt.
Die erreichte Interraterreliabilität ist mit den bei Keller (1994) angegebenen Werten vergleichbar und ist als gut zu erachten.
b) Schlafqualität
Eine weitere Voraussetzung für die Interpretierbarkeit der Daten ist eine normale Schlafqualität der Teilnehmenden in der Umgebung des Schlaflabors. Die Verteilung der Schlafstadien in den vier Nächten (Abb. 10) entspricht etwa den in der Fachliteratur angegebenen Normwerten. Wir können deutlich erkennen, dass der Schlaf von Nacht zu Nacht tiefer wird. Der hohe Anteil von Stadium 1 in der ersten Nacht liegt in den folgenden Nächten wieder im normalen Bereich. Der Anteil des Stadium 4 kann, trotz der starken Zunahme, schon in den ersten beiden Nächten als normal erachtet werden. Der Wachanteil verteilt sich auf Toilettenbesuche und kurze Arousals (meist infolge einer Bruxismusepisode), ansonsten traten keine längeren Wachphasen auf. Die objektive Schlafqualität der Teilnehmenden kann im Durchschnitt als normal bis gut bezeichnet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Prozentuale Verteilung der Schlafstadien in den vier Labornächten, gemitteltüber die Versuchspersonen.
c) Bruxismusaktivität
Die Verteilung der insgesamt 2857 signierten Bruxismusereignisse auf die verschiedenen Schlafstadien stimmt mit den Ergebnissen von Koller (1995, S.42) und Maetzler (1997, S.50) ziemlich gut überein (Tabelle 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Vergleichende Darstellung der prozentualen Verteilung aller Bruxismusereignisse auf die Schlafstadien.
63% der Knirschereignisse waren vom gemischten Typus, weitere 20% waren tonisch und die restlichen 17% phasisch. Der Anteil der gemischten Episoden entspricht den 77 Ergebnissen von Koller (1995, S.42) und Maetzler (1997, S.45), während sich die Verteilungen der tonischen und phasischen Ereignisse in allen Arbeiten klar unterscheiden (Tabelle 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Vergleichende Darstellung der Verteilung der Bruxismusereignisse auf die Episodentypen.
Hier werden grosse Unterschiede zwischen den Probanden im individuellen Knirschverhalten deutlich. Abbildung 11 gibt von diesen interindividuellen Differenzen, sowohl bezüglich der Art, wie auch betreffend des Ausmasses der Bruxismusaktivität einen Eindruck.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Verteilung der Knirschereignisse auf die Versuchspersonen, gegliedert nach dem Episodentyp.
Die gemischten Bruxismusereignisse weisen deutlich eine grössere durchschnittliche Länge auf (10.5 sec.) als die phasischen (8.2 sec) und tonischen (7.3 sec.) Episoden. Anhand einer Varianzanalyse erweisen sich diese Unterschiede als hochsignifikant: F=36.6, df=(2, 2854), p<0.000. Die Differenzen decken sich prinzipiell mit den bei Koller (1995, S.43) angegebenen Werten (gem.: 13.4 sec.; phas.: 8.1 sec.; ton.: 4.5 sec.), auch wenn sie nicht derart stark ausgeprägt sind.
Dass die gemischten Episoden sich in ihrer Länge so deutlich von den tonischen und phasischen unterscheiden, ergibt sich aus den Definitionskriterien dieser Kategorie. Unter den gemischten Typus können auch Ereignisse fallen, die kein eigentliches Knirschen sind (Bewegungen, Schmatzen, etc.), die jedoch unter alleiniger Berücksichtigung der Masseter- und Temporalismuskulatur nicht als solche identifiziert werden können.
c) Kennwerte
Die Verteilungen der Variablen ‘Anzahl der Knirschepisoden pro Nacht‘, sowie diejenige der Variable ‘Dauer der Bruxismusaktivität pro Nacht‘ weisen grosse inter- und intraindividuelle Unterschiede auf. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen ist jedoch, über die insgesamt 56 Nächte hinweg, ausserordentlich eng, was Abbildung 12 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Zusammenhang zwischen Gesamtdauer und Anzahl der Knirschepisoden pro Nacht.
Da bei der Variable ‘Anzahl der Episoden‘ keine Normalverteilung vorliegt, dient uns Spearmans Rho als Kennwert. Der Korrelationskoeffizient von 0.94 zeigt einen hochsignifikanten Zusammenhang an, 89% der Varianz der einen Dimension wird durch die Varianz der anderen Dimension erklärt.
Wir müssen zusätzlich prüfen, ob die Schlafdauer auf diese Kennwerte einen Einfluss hat. Das Spektrum der Schlafdauer (TST) liegt zwischen 3 und 8 Stunden und ist somit aussergewöhnlich breit[42]. Das Mass der prozentualen Dauer der Episoden bezüglich der TST würde diesen Einfluss auskorrigieren. Korrelieren wir diesen relativierten Kennwert mit der absoluten Dauer der Episoden pro Nacht, erhalten wir ein Rho von wiederum 0.94. Die Enge des Zusammenhanges entspricht genau den obigen Ausführungen. Es genügt demnach, wenn wir uns für die weitere Auswertung, in Übereinstimmung mit Keller (1994), auf die Variable ‘Dauer der Bruxismusereignisse‘ stützen.
e) Resultate
Die mittlere Bruxismusaktivität der Teilnehmenden von 8min. 52 sec. pro Nacht vor der Behandlung, hat pro Versuchsperson im Durchschnitt um 1min. 39sec. (= 18.5%) auf eine mittlere Dauer von 7min. 13sec. pro Nacht und Teilnehmenden abgenommen. Bei einer durchschnittlichen Episodenlänge von 9.7 Sekunden[43] entspricht das einer mittleren Reduktion pro Nacht um 10 Episoden (von 55 vorher auf 45 nachher).
Abbildung 13 gibt den Verlauf der durchschnittlichen Bruxismusaktivität pro Nacht anhand der arithmetischen Mittelwerte[44] wieder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 13: Mittelwerte der Bruxismusaktivität pro Nacht in Minuten.
Die Werte der Bruxismusaktivität streuen in den einzelnen Nächten ziemlich weit. Die Standardabweichung für die erste Nacht (vorher) beträgt 7.2 min., für die restlichen Nächte zwischen 4.6 und 5.2 Minuten. Für den Messzeitpunkt vorher beträgt der entsprechende Wert 5.5 min., nachher 4.9 min. In derart hohen Streuungsmassen spiegeln sich wiederum die grossen interindividuellen Unterschiede im Knirschverhalten.
Wir wollen uns deshalb anschauen, wie sich die mittlere Abnahme der Bruxismusaktivität von 1min. 39sec. auf die einzelnen Teilnehmenden verteilt (Abb. 14). Bei 8 Teilnehmenden hat sich die Knirschdauer nach der Behandlung verringert. Die Verringerung liegt im Grössenbereich von 2 - 3 Minuten. 4 Personen knirschten in den Nächten nach der Therapie um ca. 1 - 2 Minuten länger als davor.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 14: Durchschnittliche Differenz (vorher - nachher) der Gesamtdauer der Bruxismusepisoden pro Person und Nacht, in Minuten.
Mit den Versuchspersonen 12 & 14 sind zwei deutliche Ausreisser erkennbar, deren Veränderungen um ein mehrfaches stärker ausgeprägt sind. Bei beiden Teilnehmenden liegt die Vermutung nahe, dass es sich um folgende physiologische Artefakte handeln könnte: Versuchsperson 12 war der einzige Teilnehmende, der in einer (der ersten) Nacht wirklich schlecht geschlafen hat. Diese Tatsache äusserte sich dann auch in der Anzahl und der Art der Bruxismusereignisse[45], und dürfte zu einem grossen Teil an der extremen, positiven Veränderung beteiligt sein.
Versuchsperson 14 war zum zweiten Messzeitpunkt krank, weshalb auch der Termin um eine Nacht verschoben werden musste. Der Teilnehmende litt unter einer Erkältungsgrippe und nahm entsprechende Medikamente zu sich. Zwischen den beiden Messzeitpunkten zeigten sich jedoch keine Unterschiede in der Schlafqualität oder in der Art der Bruxismusereignisse.
6.2. Entscheidungsstatistik
a) allgemeine Betrachtungen
Bevor wir Hypothese 1 prüfen, die eine Abnahme der Bruxismusaktivität nach der erfolgten Behandlung postuliert, müssen wir noch ein paar Gedanken vorschieben. Wie wir gesehen haben, sind sowohl erhebliche intraindividuelle, wie auch starke interindividuelle Unterschiede in der Bruxismusaktivität vorhanden. Wir wollen daher als erstes untersuchen, ob die Knirschepisoden nach der Therapie betreffend ihrer Länge und ihrem Typ, im Vergleich zum Knirschverhalten vorher, gleich geartet sind.
Zuerst soll untersucht werden, ob sich die Länge der Bruxismusereignisse zwischen den beiden Messzeitpunkten unterscheidet. Wegen der Messwiederholungen pro Versuchsperson setzt sich die Varianz der Episodenlänge aus einer intra- und einer interindividuellen Streuung zusammen. Da wir uns für die intraindividuellen Unterschiede zwischen den Messungen vor und denjenigen nach der Therapie interessieren, gilt es die interindividuelle Varianz auszuschalten. Zu diesem Zweck wurden alle Werte der Episodenlänge pro Versuchsperson z-transformiert.
Ein T-Test für unabhängige Stichproben hilft uns bei der Entscheidung dieser Fragestellung weiter. Wie wir anhand der Ergebnisse in Tabelle 4 sehen, haben sich die einzelnen Bruxismusepisoden bezüglich ihrer zeitlichen Qualität nicht verändert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Ergebnisse des T-Tests für den Vergleich der z-transformierten Werte (vorher / nachher) der einzelnen Bruxismusepisodenlängen.
Ein weiterer qualitativer Aspekt, den es zu untersuchen gilt, ist die Art der Bruxismusepisoden. Abbildung verschiedenen Nächte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 15: Verteilung der Episodentypen auf die einzelnen Nächte.
Die Dauer der gemischten Episoden nimmt über die ersten drei Nächte hinweg ab, während sie zwischen Nacht 3 & 4 relativ konstant bleibt. Dieses Phänomen kann 83 teilweise durch die Verbesserung der Schlafqualität über die Nächte hinweg erklärt werden; denn unter die Kategorie ‘gemischt‘ können, wegen fehlender Unterscheidungsmöglichkeiten auch Ereignisse wie Schmatzbewegungen und andere kleinere Arousals fallen, die mit der Schlafqualität generell negativ korrelieren[46]. Andererseits haben wir aber auch gesehen, dass bruxistische Arousals selbst die Schlafqualität beeinträchtigen; ein kausaler Schluss anhand dieses Zusammenhanges ist nicht möglich. Ziehen wir jedoch die anderen zwei Kategorien mit in Betracht, so werden systematische Unterschiede deutlich. Das Verhältnis zwischen phasischen und tonischen Episoden kehrt sich nach der Behandlung um.
Betrachtet man die Verteilungen der Dauer der Episodentypen auf die Nächte vorher / nachher anhand eines Chi²-Tests, zeigt sich ein hochsignifikanter Unterschied: Das Chi² von 68.64 entspricht bei 2 Freiheitsgraden einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0.000. Inhaltlich ist dieser Sachverhalt schwierig zu erklären, es fehlt diesbezügliches Vergleichsmaterial aus anderen Untersuchungen. Die Unterschiede der beiden Verteilungen dürfen aber auch nicht überbewertet werden. Analysiert man die Fragestellung mit einem mächtigeren Test, ergeben sich relativierende Resultate. In einer multivariaten Varianzanalyse wurden die Differenzwerte (vorher - nachher) der Gesamtdauer der Episodentypen pro Versuchsperson untersucht. Tabelle 5 gibt die Ergebnisse wieder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Ergebnisse einer multivariaten Varianzanalyse der Differenzwerte (vorher-nachher, pro VP) der Gesamtdauer der Episodentypen.
Die Wilks-Lambda Teststatistik zeigt keine Signifikanz an, wobei die Reduktion der tonischen Episoden am stärksten ausfällt.
Grundsätzlich können wir über die vier Nächte hinweg also von qualitativ gleich gearteten Bruxismusereignissen ausgehen. Die Unterschiede der Verteilungen der Episodentypen beruhen mehr auf interindividuellen Differenzen in der Bruxismusaktivität, als auf grundsätzlichen, intraindividuellen Veränderungen der Bruxismusqualität nach der Behandlung.
b) Hypothesenprüfung
Wie sieht nun das Bild aus, wenn wir die Gesamtdauer aller Episoden vorher mit der Gesamtdauer aller Episoden nachher vergleichen? Zur Klärung dieser zentral interessierenden Fragestellung dient uns eine multivariate Varianzanalyse (zusammen mit den Werten zur Anzahl der Episoden), deren Resultate in der Tabelle 6 wiedergegeben sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6: Multivariate Varianzanalyse der Differenzwerte (vorher - nachher) ‘ Anzahl Episoden ‘ und ‘ Gesamtdauer ‘ pro Nacht.
Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist zu gross, als dass die Nullhypothese abgelehnt werden könnte. Die Abnahme der Bruxismusaktivität ist mit 35% Wahrscheinlichkeit zufällig bedingt und kann somit nicht mit genügender Sicherheit auf die Behandlung zurückgeführt werden. Erwartungsgemäss sind die Prüfstatistiken bezüglich der Anzahl und der Dauer der Episoden in etwa gleich gross.
Die Wilks-Lambda Prüfstatistik von F = 1.13 würde nicht einmal bei einer Stichprobengrösse von 1‘000 Personen die 5% Grenze der Irrtumswahrscheinlichkeit unterschreiten. Die Prüfstatistik F müsste mindestens einen Wert von 3.89 aufweisen, damit sie, bei der vorliegenden Stichprobengrösse die unterschreiten würde.
7. Fragebogen
7.1. Deskription
a) Gütekriterien
5% Signifikanzgrenze
Da eine Erhebung mittels Fragebogen stets auch eine interaktive Komponente hat, ist die Kenntnis und Berücksichtigung der Antwortsituation eine notwendige Voraussetzung für die Objektivität der erhobenen Daten. Die Rahmenbedingungen der Befragung sind leider nicht jedesmal identisch. Um Effekte der sozialen Erwünschtheit zu minimieren schien es uns jedoch wichtig, die Erhebung von der Behandlung klar zu trennen. Deshalb wurden die zweiten Fragebogen postalisch (mit frankiertem Rückantwortcouvert) zugestellt. Die ersten und dritten Bogen wurde im Schlaflabor ausgefüllt. Die Durchführungsobjektivität ist damit zufriedenstellend, während die Objektivitätsaspekte der Auswertung und der Interpretation beim gewählten Antwortformat unproblematisch sind.
Eine bescheidene Einschätzung der Reliabilität lässt sich anhand der Items 1-3, die alle verschiedene Aspekte der Propriozeption in der Mundhöhle erfassen, vornehmen. Als Kennwert der Zuverlässigkeit des Fragebogens dient uns Cronbach’s Alpha (Tabelle 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7: Einschätzung der Fragebogen-Reliabilität mittels Cronbach ’ s Alpha anhand der Items 1-3.
Der Wert bezüglich dem wahrgenommenen Nutzen (Bogen 2 & 3) ist als hoch zu beurteilen, während die Fragen zur Erwartungshaltung eine geringe Homogenität aufweisen. Dieser geringe Wert ist teilweise auf eine Verunsicherung und Unwissenheit seitens der Probanden zurückzuführen; eine Einschleiftherapie wurde am Informationsabend nicht ausführlich thematisiert. Eine Person beantwortete keines dieser drei Items und zwei Personen setzten bei Item 1.1 ein Fragezeichen und gingen weiter zur Frage 1.2. Während in den Items 2 & 3 allgemein von der zahnärztlichen Behandlung gesprochen wird, ist in Item 1 (gleich zur Eröffnung des Fragebogens) die Einschleiftherapie explizit erwähnt, was unter Umständen eine aversive, stressinduzierende Wirkung hat. Erfreulich ist, dass die durchschnittliche Korrelation auch bei der Kombinierung der drei Fragebogen sehr hoch ausfällt. Ich denke, die Reliabilität darf im allgemeinen als gut beurteilt werden.
Bezüglich dem Kriterium der Validität zeigen Visuelle Analogskalen erfahrungsgemäss bei verschiedensten Anwendungen hohe Werte (vgl. Fähndrich & Linden, 1982). Bis jetzt wurde einerseits die theoretisch ableitbare, inhaltliche Validität referiert. In einem nächsten Schritt soll nun auch der Frage nach der Übereinstimmungsvalidität nachgegangen werden.
Die Items 4 (Tragen der Zahnschiene), 9 (Praxis des AT) und 22 (Leidensdruck) wurden auch auf täglicher Basis, anhand des Tagebuches erfasst. Während die Fragebogen- Antworten von systematischen Einflüssen, wie Erinnerungseffekten, sozialer Erwünschtheit, usw. überlagert sein könnten, dürfen wir annehmen, dass die Tagebuch- Angaben ein valides Abbild des tatsächlichen Verhaltens und Befindens ergeben. Um die Korrelation der zwei Erhebungsmethoden zu berechnen, wurden die Tagebuch-Angaben in 3 Sequenzen von 4, 6 & 4 Wochen eingeteilt. Diese Art der Aufteilung bringt den Vorteil, dass die Therapiesitzungen am gleichmässigsten auf die Sequenzen verteilt sind (2/1/2). Es wurden Mittelwerte pro Sequenz und Versuchsperson gebildet. Da im Fragebogenitem 22 gleichzeitig nach Schmerzen und Verspannungen gefragt wurde, sind auch die TagebuchAngaben dieser beiden Kategorien in einem Wert gemittelt. Tabelle 8 gibt die entstandene Korrelationsmatrix (nach Pearson) wieder.
Die Enge des Zusammenhanges zwischen den Tagebuch-Angaben und den FragebogenAntworten liegt bei allen korrespondierenden Faktoren in der bei Hirsig (1993, S.6.27) angegebenen idealen Spannweite von 0.4 - 0.6: die Kriteriumsvalidität darf als sehr gut eingeschätzt werden. Trotz der Verzerrungen, die eine Sequenzierung der Rohdaten mit sich bringt, sind rund 30% der Varianzen gegenseitig bedingt.[47]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8: Korrelationsmatrix (Pearson) der pro Versuchsperson sequenzierten Tagebuchwerte (TGB) und der Fragebogenangaben zum Tragen der Zahnschiene (ZS), Praktizieren des Autogenen Trainings (AT) und zum Leidensdruck (LD).
* := Die Korrelation ist auf dem 5% Niveau signifikant (2-seitig).
**:= Die Korrelation ist auf dem 1% Niveau signifikant (2-seitig).
Interessant sind zudem die durchwegs negativen Korrelationen zwischen den Werten zum Leidensdruck und denjenigen zur Praxis des AT, die innerhalb desselben Antwortformates die 5% Signifikanzgrenze unterschreiten. Die naheliegende Vermutung, dass sich hier ein Erfolgsaspekt des AT kundtut, darf nicht überschätzt werden, die erklärte Varianz beträgt lediglich 10%.
Die Frage nach der prognostischen Validität fällt mit der Hypothesenprüfung zusammen und wir weiter unten noch angesprochen.
b) Itemanalyse
Zuerst wurde die Trennschärfe der einzelnen Testitems bestimmt. Der Trennschärfekoeffizient[48] eines Items gibt an, wie gut die Probanden aufgrund der Antwort zu diesem Item bezüglich der pauschalen Erwartungshaltung oder des insgesamt wahrgenommenen Nutzens differenziert werden können.
Nach den bei Hirsig (1993, s.7.12) angegebenen Erfahrungswerten sind die total 60 intervallskalierten Items folgendermassen zu beurteilen (Abbildung 16):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 16: Beurteilung der Items bezüglich der Trenn- schärfe nach Hirsig (1993).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9: Items in der Kategorie ‘ unbrauchbar
Im folgenden wollen wir die Items, die unter die Kategorie ‘unbrauchbar‘ fallen etwas näher betrachten (die Kategorie ‘revisionsbedürftig beinhaltet die Items 2.7 & 2.12). Anhand von Tabelle 5 lässt sich eine gewisse Systematik erkennen. So fällt z.B. auf, dass 50% der nicht trennscharfen Items aus Fragebogen 1 stammen: Mit einer Ausnahme (1.15) betreffen diese Items entweder die zahnmedizinische Komponente (1.1 - 1.4) oder den Faktor der Eigenaktivität (1.4, 1.14, 1.19).
Diese beiden Aspekte der Erwartung zeigen also nur einen geringen inhaltlichen Zusammenhang mit der globalen Erwartungshaltung. Was die zahnmedizinische Komponente betrifft, zeigt sich wahrscheinlich wieder die obengenannte Unsicherheit der Teilnehmenden; sie scheinen sich nicht schlüssig zu sein, was sie diesbezüglich erwartet. Der fehlende inhaltliche Bezug beim Faktor der Eigenaktivität erstaunt bei der traditionellen, bezeichnenden Rolle des Patienten[49] in der klassischen Medizin nicht weiter.
Beim tatsächlich erfahrenen Nutzen gliedern sich diese beiden Punkte aber wieder gut in das Gesamtbild ein. Einerseits wurde von den Teilnehmenden, wie wir im Kapitel 8.1. noch sehen werden, tatsächlich Eigenaktivität entwickelt, andererseits wird diese auch als nutzbringend bewertet. Als durchgehend nicht trennscharf erweisen sich lediglich die Items 1, 4, 13 & 14.
In einem zweiten Schritt wurde dann die Homogenität innerhalb der 4 postulierten therapeutischen Komponenten bestimmt. Als Kennwert der Item-Interkorrelation dient uns wiederum Cronbach’s Alpha (Tabelle 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6: Interkorrelation der Items innerhalb der postulierten Komponenten,über alle Fragebogen.
Während die Homogenität der Fragen zur zahnärztlichen Komponente als mässig zu beurteilen ist, fallen die Werte zu den restlichen Faktoren hoch aus. Lässt man die Items 1.1 - 1.5 jedoch ausser Acht (Alpha = 0.39), ergibt sich für die Bogen 2 & 3 bezüglich dem zahnmedizinischen Faktor wieder ein hoher Korrelationskoeffizient (Alpha = 0.79). Die genannte Unsicherheit der Probanden gegenüber der bevorstehenden zahnärztlichen Behandlung wird wahrscheinlich auch hier wieder deutlich.
Nun stellt sich noch die Frage nach der Korrelation der einzelnen Komponenten untereinander. Gemäss Tabelle 7 sind 2/3 dieser Korrelationskoeffizienten unbedeutend klein. Im allgemeinen sind die erfragten Komponenten also unabhängig voneinander und erfassen tatsächlich verschiedene Faktoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7: Korrelationen (nach Pearson) der erfragten Therapiefaktorenüber alle Fragebogen.
Die physiotherapeutische Komponente überschneidet sich jedoch mit denjenigen der Psychotherapie und der Impulsreferate, wie die diesbezüglichen Kennwerte anzeigen. Die Enge des Zusammenhanges ist nicht gering; die physiotherapeutische Komponente bestimmt 40%, bzw. 60% der Varianz der informativen, bzw. der psychotherapeutischen Komponente. Betrachtet man die Werte für die einzelnen Bogen, zeigt sich in etwa dasselbe Muster für die Versionen 1 & 3. Bei der 2. Erhebung fallen die Korrelationen generell unbedeutend schwach aus. Inhaltlich ist diese Beobachtung schwierig erklärbar.
Auffallend ist weiter die negative Korrelation des zahnmedizinischen und informativen Faktors. Diese zeigt sich in den Bogen 1 & 2, während sie bei der dritten Messung positiv ausfällt. Die Frage, ob diese Veränderung der Korrelation mit dem zahnmedizinischen Impulsreferat, das zwischen der 2. & 3. Fragebogenmessung gehalten wurde, zu tun hat, wird unten, in einem anderen Zusammenhang noch einmal kurz aufgegriffen.
Die obige Analyse hat ein paar wenige Ungereimtheiten zutage gebracht. Ich denke jedoch, dass wir in Anbetracht des geringen Ausmasses der Mängel und des erstmaligen Einsatzes des Bogens durchaus zufrieden sein können. Der Fragebogen dürfte seinen Zweck in dieser Studie erfüllen.
c) Verlauf
Wie sieht nun das Antwortverhalten der Teilnehmenden konkret aus? Abbildung 17 gibt den Verlauf insgesamt, sowie nach den therapeutischen Komponenten gegliedert wieder. Wir verwenden den Median als Kennwert, da die Antworten nicht normalverteilt sind.
Die x-Achse ist, wie auch das Antwortformat 10 cm lang, was die visuelle Beurteilung der dargestellten Werte erleichtert. Dabei liegt der negative Antwortpol bei 0 cm, das positive Extrem entsprechend bei 10 cm.
Die Veränderungen der Mediane zwischen den Messzeitpunkten schwanken zwischen 0.1 und 1.4 cm. Insgesamt betrachtet verlaufen die Faktoren von 7.8 über 7.1 zu 7.3 cm. Die durchschnittlichen Quartilabweichungen der einzelnen Komponenten betragen bei Fb1 rund 0.7 cm, bei Fb2 1.0 cm und bei Fb3 1.2 cm; die Streuung der Werte nimmt kontinuierlich zu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 17: Verlauf der Fragebogenwerte, gegliedert nach den therapeutischen Komponenten. Der Anschaulichkeit halber ist die x-Achse, entsprechend dem Antwortformat des Frage- bogens genau 10 cm lang, wobei der negative Pol bei 0 cm, der positive bei 10 cm liegt.
Alle vier Faktoren weisen eine deutliche Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung (Fb1) und dem wahrgenommenen Nutzen in der Mitte der Therapie (Fb2) auf. Falls das Antwortverhalten einen zeitlichen Verlauf aufweist, dann ist es eben genannter. Die Veränderungen zwischen den Messung 2 & 3 sind äusserst geringfügig, die Abbildung 17 lässt vermuten, dass sie zufallsbedingt sein könnten.
Weiteren Aufschluss erhalten wir, wenn wir uns ansehen, wie sich dieser ‘Verlauf‘ über die einzelnen Teilnehmenden hinweg verteilt (Abbildungen 18 & 19). Als Kennwert dafür benutzen wir die Differenzen zwischen den aufeinanderfolgenden Messzeitpunkten, obei der zeitlich früher gelegene Wert jeweils als Ausgangswert subtrahiert wird. Falls die so erhaltenen Differenzen positiv sind, zeigen sie einen Anstieg in der Bewertung an, falls sie negativ ausfallen, hat sich die Beurteilung verschlechtert. Die cm-Angaben auf der x-Achse sind wiederum 1:1, so dass die Balkenlänge in den Abbildungen 18 & 19 der tatsächlichen Verschiebung auf der Antwortskala entspricht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung18: Antwortveränderung zwischen Fb1 und Fb2. Die Balkenlänge entspricht der effektiven
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 19: Antwortveränderung zwischen Fb2 und Fb3.
Analog zu Abb. 18.
Bei 4 Personen fiel die Beurteilung im Fb 2 und bei einer Person im Fb 3 durchwegs negativer aus. Ansonsten zeigen Teilnehmenden in ihren Einschätzungen jeweils gemischte Veränderungen. Zudem lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass die Spannweite der Differenzen von Fb2 & Fb3 mit 4.5 cm wesentlich geringer ist, als diejenige zwischen Fb1 & Fb2 mit 7.8 cm. Entsprechend ist die Standardabweichung der 1. Differenz mit 1.37 einiges höher als die der 2. Differenz (0.98). Dies ist ein weiterer Indikator für eine relativ (im Vergleich zur Erwartung-Nutzen-Diskrepanz) stabile Beurteilung des therapeutischen Nutzens.
Eine genauere Betrachtung der Unterschiedswerte zeigt, dass bei den Teilnehmenden, die eine Einschleiftherapie erhielten (‘Gruppe mit‘)[50], nach der erfolgten zahnmedizinischen Korrektur, die Diskrepanz zwischen Erwartungs- und Nutzenwerten bezüglich der zahnmedizinischen Komponente grösser ist, als bei der ‘Gruppe ohne‘. Abbildung 13 zeigt die Differenzwerte der zahnmedizinischen Komponente für die Subgruppen mit / ohne Einschleiftherapie.
Anhand eines T-Tests für unabhängige Stichproben wird ersichtlich, dass sich diese beiden Subgruppen in ihrer Knirschaktivität vor der Therapie nicht unterscheiden (T=1.477, df=12, p=0.165). Auch bezüglich der Veränderung der Bruxismusaktivität (vorher - nachher) zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen (T=0.317, df=12, p=0.757).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 20: Differenzwerte der zahnmedizinischen Komponente gegliedert nach den Untergruppen mit / ohne Einschleiftherapie.
Die Einschleiftherapie erfolgte in der Zeitspanne zwischen der 1. & 2. Fragebogenerhebung[51]. Der Kontrast zwischen der Erwartungshaltung und dem wahrgenommenen Nutzen ist unmittelbar nach der Behandlung bei der Gruppe ‘mit‘ um ein vielfaches negativer ausgeprägt, als bei der Gruppe ‘ohne‘. Im Gegensatz dazu beurteilt die Gruppe ‘mit‘ in Fb3 den Nutzen der zahnmedizinischen Behandlung wiederum positiver als noch in Fb2, während die Beurteilung der Gruppe ‘ohne‘ stabil bleibt. Der Verlauf der zahnmedizinischen Komponente ist also im wesentlichen durch das Ereignis der Einschleiftherapie bestimmt, die Gruppe ‘ohne‘ zeigte eine stabile Bewertung der zahnärztlichen Behandlung. Betrachtet man die Subgruppen ‘mit / ohne Zahnschiene‘ gesondert, treten keine nennenswerten Unterschiede hervor.
Die anfänglich negative Diskrepanz in der Bewertung der Einschleifung der Zähne kann wohl teilweise durch die damit verbundenen Unannehmlichkeiten erklärt werden, die zum Zeitpunkt der 2. Fragebogenerhebung bestimmt noch salienter waren, als in der 3. Erhebung. Andererseits fand das Impulsreferat zur zahnmedizinischen Theorie der oralen Parafunktionen erst nach der erfolgten Behandlung statt, worauf die Nutzenbewertung sich geringfügig positiv veränderte. Es lässt sich spekulieren, dass eine kognitive Vorbereitung die Wahrnehmung und Bewertung der Behandlung wahrscheinlich von anfang an günstiger beeinflusst hätte.
d) Bemerkungen
Von den total 56 ausgefüllten Fragebogen wurde das mit ‘Wünsche, Kritik, Anregungen, Bemerkungen‘ beschriftete, offene Antwortformat lediglich 10 mal, von insgesamt 6 Teilnehmenden benutzt. Im folgenden sind die Kommentare pro Erhebungszeitpunkt stichwortartig zusammengefasst:
Fragebogen 1, 3 Stellungnahmen:
- Erhoffter Aufschluss im Sinne des ‘Erkenne dich selbst‘
- Hoffnung auf eine dynamische Gruppe
- Bessere Beurteilung der Fragebogenitems nach den Sitzungen möglich Fragebogen 2, 5 Stellungnahmen:
- Wunsch: Handouts zu den Referatsthemen
- Wunsch: individuelle Anleitung beim Erlernen der Entspannungsübungen
- Kritik: Diskussionszeit zu knapp bemessen
- Kritik Termine: 1. Beginn etwas später (18.30 Uhr) 2. Nicht während der Schulferien
- 2 mal positives Feedback zum Kurs insgesamt
Fragebogen 3, 2 Stellungnahmen:
- Wunsch: Mehr Zeit für Diskussionen
- Wunsch: Kleinere Gruppengrösse
- Bemerkung: Gefühl von grosser Distanz zwischen den Gruppenleitern und den Teilnehmenden
- 2 mal positives Feedback zum Kurs insgesamt
Der Wunsch nach längeren, dynamischen Diskussionen tritt am deutlichsten hervor. Dies erstaunt nicht, da die geplante Diskussionszeit meistens von den Referaten in Anspruch genommen wurde. Der Wunsch nach Handouts zu den Vorträgen erscheint mir gerade auch in diesem Kontext sinnvoll. Eine Idee wäre z.B. Thesenblätter zu Beginn der Referate auszuteilen. Einerseits würde somit eine Struktur vorgegeben, womit die Ausführungen auch knapper gehalten werden könnten. Andererseits lassen thesenartige Zusammenfassungen den Teilnehmenden noch genügend Raum für eigene Gedanken und Notizen.
Die Wünsche nach einer kleineren Gruppengrösse, individueller Betreuung beim Erlernen der Entspannungsübungen und flexibleren Terminen liegen, aus ökonomischen Überlegungen, im vorliegenden Setting nicht im Bereich des Realisierbaren.
Die angesprochene Distanz zwischen den Laien und professionellen Teilnehmenden der Gruppe erstaunt mich. Die Atmosphäre war meines Erachtens, zieht man die geringe Behandlungsfrequenz und die wenigen Sitzungen in Betracht, erstaunlich entspannt und warm. Zudem berichteten die Gruppenleiter, zur Illustration der Referate und zur Anregung von Diskussionen, oftmals von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen, was das Gefälle in meinen Augen auch wesentlich verringerte.
Im allgemeinen sind die Äusserungen (auch die mündlichen Kommentare im Schlaflabor) sehr positiv und konstruktiv ausgefallen. Die Teilnehmenden waren gut motiviert, auch gegenüber den Schlaflabornächten, die von einigen sogar als bereichernd empfunden wurden.
7.2. Entscheidungsstatistik
a) Verlauf
Wir wollen nun prüfen, ob eine zeitliche Systematik innerhalb der Fragebogenantworten vorliegt. Tabelle 12 gibt die Resultate einer multivariaten Varianzanalyse der Differenzwerte (Fb2-Fb1, Fb3-Fb2) wieder.
Die Wilks-Lambda Teststatistik prüft dabei die entsprechende Nullhypothese, dass die Mittelwerte aller Differenzen gleich null sind. Diese zeigt uns an, dass falls es Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten gibt, diese mit 39% Wahrscheinlichkeit zufällig entstanden sind. Es liegt also kein systematischer Verlauf im Antwortverhalten vor. Die univariaten Vergleiche dürfen deshalb entscheidungsstatistisch nich gedeutet werden. Trotzdem wollen wir diese Resultate für heuristische Zwecke noch etwas eingehender betrachten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 12: Multivariate Varianzanalyse der Differenzwerte (Fb2-Fb1; Fb3-Fb2) der einzelnen therapeutischen Komponenten.
Bei drei Differenzwerten sind ziemlich grosse Effekte vorhanden, was an den F- Quotienten abgelesen werden kann. Die Varianzen der zahnmedizinischen, physiotherapeutischen und informativen Komponenten sind zwischen den Messzeitpunkten um ein mehrfaches höher als innerhalb der einzelnen Messungen.
Diese Unterschiede zeigen sich lediglich vom 1. zum 2. Fragebogen und sind einmal auf dem 1% Niveau und zweimal tendenziell ‘signifikant‘. Wie wir auch anhand von Abbildung 10 sehen konnten, besteht eine wahrnehmbare Diskrepanz zwischen den Erwartungs- und Nutzeneinschätzungen. Diese Aussage gilt jedoch nur, wenn wir den Verlauf einer einzelnen Komponente über 2 Messzeitpunkte hinweg fokussieren. Betrachten wir den gesamten Verlauf über alle Komponenten hinweg, sind diese Unterschiede wahrscheinlich zufällig entstanden. Die Fragebogenwerte haben demnach keinen eigentlichen zeitlichen Verlauf. (Analysiert man die drei Fragebogen einzeln auf der Ebene der Items, lassen sich ebenfalls keine systematischen Tendenzen oder Unterschiede erkennen.)
Die Hypothese 2 formuliert Vermutungen über die Enge des Zusammenhanges zwischen den Werten der drei Fragebogenerhebungen. Wir haben angenommen, dass der Einfluss der Erwartungshaltung auf die Nutzenwahrnehmung in Fb2 grösser sein wird, als auf diejenige in Fb3. Wir wollen diese Vermutung anhand von linearen Regressionsanalysen überprüfen. Zuerst soll der Einfluss der Erwartungshaltung auf die Werte von Fb2 untersucht werden. In diese Regression wurden Mittelwerte pro Versuchsperson und Fragebogen einbezogen. Tabelle 13 gibt die Ergebnisse wieder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 13: Resultate der Regressionsanalyse der pro Proband gemittelten Werte von Fb2 auf Fb1.
Der R²-Wert zeigt uns an, dass die Erwartugshaltung rund 18% der Varianz von Fb2 erfasst. Der F-Wert gibt das Verhältnis der erfassten zur unerfassten Varianz wieder, und wir sehen, dass der Erklärungswert dieses Modells nur knapp tendenziell signifikant ist. Abbildung 21 dient der Veranschaulichung dieses abstrakten Zusammenhanges.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 21: Zusammenhang zwischen den gemittelten Werten von Fb1 und Fb2.
Der vermutete Zusammenhang zeichnet sich eigentlich unverkennbar ab, wir können aber auch einen Ausreisser erkennen, der weit entfernt von der Reggressionsgeraden liegt. Leider fallen bei kleinen Stichprobengrössen, wie der vorliegenden, Ausnahmefälle im entscheidungsstatistischen Verfahren stark ins Gewicht. Unter Ausschluss des Ausreissers klärt die Regressionsanalyse 55% der Varianz auf (korrigiertes R²), wobei der F-Quotient von 15.8 auf dem 1% Niveau signifikant ist. Der Beta-Koeffizient beträgt 0.77.
Inwiefern sind die Werte des dritten Fragebogens durch die zwei vorhergehenden bestimmt? Tabelle 14 gibt die Resultate der multiplen Regression von Fb3 auf Fb1 & Fb2 wieder.
Die Regression erklärt rund 71% der Varianz von Fragebogen 3. Entsprechend ist die Effektgrösse von 13.5 hochsignifikant. Die Ergebnisse fallen hier wie vermutet aus. Das Ausmass der Erwartungshaltung nimmt nicht mehr direkten Einfluss auf die zweite Nutzeneinschätzung. Die Werte von Fb3 können anhand der Angaben zu Fb2 jedoch gut vorausgesagt werden, wie der hohe Beta-Wert von 0.84 anzeigt. (Bei dieser Analyse ändern sich die Werte unter Ausschluss des Ausreissers nur noch unbedeutend gering.)
Einerseits zeigen diese Resultate nochmals die Stabilität und Zuverlässigkeit der Einschätzung des wahrgenommenen Nutzens auf. Andererseits unterstützen sie die vorgängig geäusserten Zweifel bezüglich der Erwartungshaltung als Prädiktor für den Behandlungserfolg.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 14: Multiple Regressionsanalyse der pro VP gemittelten Werte von Fb3 auf Fb2 & 1.
Wir wollen auch hier die Enge des Zusammenhanges wieder anhand eines Streudiagrammes veranschaulichen (Abbildung 22 & 23).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 22: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten von Fb1 & Fb3.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 23: Zusammenhang zwischen den Mittelwerten von Fb2 & Fb3.
b) Verknüpfung der Evaluationskriterien
Hypothese 3 postulierte einen positiven Zusammenhang zwischen dem subjektiv empfundenen Nutzen und dem tatsächlichen Ausmass der Reduktion des Bruxismus. Wir werden unsere Entscheidung wieder auf die Resultate einer Regressionsanalyse mit den Variablen ‘Differenz der Bruxismusaktivität (vor-nach)‘ und ‘durchschnittlich wahrgenommener Nutzen (Fb2 & Fb3)‘ stützen. Abbildung 24 veranschaulicht den Zusammenhang der beiden Dimensionen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 24: Zusammenhang zwischen den subjektiven und den objektiven Erfolgskriterien.
Tabelle 11 gibt den Zusammenhang in numerischer Form wieder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 11: Ergebnisse einer linearen Regressionsanalyse von der ‘ Differenz der Knirschaktivität (vor- nach) ‘ auf den ‘ durchschnittlich wahrgenommenen Nutzen (Fb2 & Fb3)
Die Korrelation der zwei Variablen, ersichtlich anhand des Beta-Koeffizienten, ist zwar positiv, mit r = 0.32 aber bloss mässig ausgeprägt; die durch diesen Zusammenhang aufgeklärte Varianz beträgt lediglich 10% (R²). Mit 27% ist dann auch die Irrtumswahrscheinlichkeit entsprechend hoch. Die Hypothese bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem objektiv messbaren und dem subjektiv wahrgenommenen Nutzen kann nicht mit genügender Sicherheit aufrechterhalten werden.
8. Tagebuch
8.1. Deskription
Die Teilnehmenden füllten während den 14 Wochen, über die sich die Behandlungsdauer erstreckte, jeden morgen ein ‘Knirschtagebuch‘ aus. Sie taten dies ausserordentlich gewissenhaft, von dem theoretischen Total von 1372 Nächten fehlen lediglich 30 (2.2%), von denen 16 ‘ferienhalber‘ entschuldigt sind. In diesen ca. 3 ½ Monaten vergass durchschnittlich jede Versuchsperson bloss ein Mal das Tagebuch auszufüllen. Betrachtet man die Werte der 7 erfragten Kategorien in ihrer zeitlichen Abfolge, so zeigen sich auf der Ebene der einzelnen Tage grosse Unterschiede. Es wurden deshalb Wochen-Durchschnittswerte gebildet, welche zumindest Schwankungen, welche durch die Wochenperiodizität bedingt sind, ausgleichen. Auch so ergeben sich keine glatten Verläufe, wie Abbildung 25 am Beispiel der Schmerz- und Verspannungskategorien zeigt. Auch anhand von Regressionen auf die Zeit treten keine Systematiken zutage.
Auf den ersten Blick sind keine zeitlichen Regelmässigkeiten ersichtlich. Die Werte zur Schmerzkategorie bleiben ziemlich stabil, während die Variable Verspannungen grosse Schwankungen aufweist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 25: Verlauf der Tagebuch-Kategorien Schmerzen & Verspannungen. Auf der Y-Achse ist die absolute Anzahl der Nennungen angegeben. Das theoretisch mögliche Maximum liegt bei 294 Kreuzen pro Woche (3 Subkategorien x 7 Tage x 14 Teilnehmende).
Einzig bei den Variablen des Autogenen Trainings (AT) und der Stressbelastung lassen sich Ansatzpunkte einer Systematik erkennen. Die Wochen, zu deren Beginn eine Therapiesitzung stand, haben im Vergleich zu den anderen Wochen klar höhere Werte. Abbildung 26 stellt dies am Beispiel der Kategorie AT dar. Die senkrechten Linien bei den Wochen 1, 3, 5, 11 & 13 markieren dabei diejenigen Wochen, zu deren Beginn eine Therapiesitzung stand. (Die Tagebuch-Erhebung wurde zu Beginn der Woche 15, vor der letzten, 6. Sitzung abgeschlossen.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 26: Verlauf der Tagebuch-Kategorie Autogenes Training. Zu Beginn der markierten Wochen (1,3,5,11,13) stand jeweils eine Therapiesitzung.
In den Wochen, in denen eine Sitzung stattfand, wurde also tendenziell mehr AT praktiziert, als in den übrigen Wochen. Eine plausible Erklärung wäre, dass nach den Sitzungen jeweils der Sinn und das Ziel der Übungen im Bewusstsein der Teilnehmenden präsenter waren. Das wirkt sich bestimmt positiv auf die Motivation aus. Zudem wurde bei jedem Zusammenkommen jeweils eine neue Übung des AT erklärt. Berechnet man die Punkt-biseriale Korrelation (nach Bortz, 1989, S.270) für das AT und Woche mit/ohne Sitzung, so erhalten wir einen Koeffizienten von 0.58. Dieser erreicht bei einer Effektgrösse von T=2.46 und 12 Freiheitsgraden folgende Irrtumswahrscheinlichkeit: 0.01<p<0.025. Immerhin klärt die Korrelation 34% der Varianz auf. Weil dieser Effekt anhand eines T-Tests sowohl für die Kategorie AT, wie auch für die Stresskategorie auf dem 1% Niveau signifikant ist (Variable AT: T=3.17, df=13; Variable Stress: T=2.96, df=13), drängt sich eine weitere Erklärungsmöglichkeit auf. Die vermutete Beziehung zwischen der Stressbelastung und der Praxis des AT wird im Kapitel Exploration diskutiert.
Da die meisten der erfragten Variablen in ihrem zeitlichen Verlauf keine Ordnung aufweisen, scheint es mir angebracht, die Kennwerte der Wochendurchschnitte in einer Tabelle (16) wiederzugeben. Da die Wochenmittelwerte der einzelnen Variablen dem Augenschein nach normalverteilt sind, werden der artihmetische Mittelwert, sowie die Standardabweichung zur Charakterisierung angegeben. Grundsätzlich wurde jede Ankreuzung mit dem Wert 1 kodiert. Das heisst, dass die mögliche Spannweite der Mittelwerte zwischen 0 und 1 liegt. Bei der Schlafqualität entspricht der Wert 1 der Antwort ‘gut geschlafen‘, der Wert 0 der Antwort ‘schlecht geschlafen‘[52]. Bei den Variablen die Mehrfachantworten erlauben (Verspannung, Schmerz und Stressbelastung), wurde so kodiert, dass pro Tag und Person ein Maximum von 1 möglich ist.
Obwohl die Teilnehmenden als starke Bruxisten identifiziert wurden, dieses Verhalten im Schlaflabor deutlich zeigten und sogar auf die Wahrnehmung des Knirschens sensibilisiert wurden, betreffen die Angaben zum bewussten Zähneknirschen bloss 14% der Nächte. Es scheint tatsächlich unmöglich zu sein, dieses Verhalten valide einschätzen zu können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 16: Verteilungskennwerte der Variablen des Knirschtagebuchs. Maximal möglicher Mittelwert = 1.
Die Teilnehmenden gaben in 83% der Nächte an, gut geschlafen zu haben. Direkte Vergleiche mit anderen Schlaffragebogenerhebungen sind schwierig, da praktisch jeder diesbezüglichen Untersuchung ein anderer Fragebogen zugrunde liegt. Grob geschätzt stimmen unsere Angaben jedoch gut mit den bei Görtelmeyer (1996) gegebenen Werten der Normstichprobe (1500 Personen) überein[53], die allgemeine Schlafqualität der Teilnehmenden kann anhand dieser Angaben als gut erachtet werden.
Die Werte zum Tragen der Zahnschiene und zur Praxis des AT stimmen, bezüglich dem Mittelwert vollkommen überein, während die Werte beim Tragen der Zahnschiene beinahe zweimal so weit gestreut sind. (Diese Unterschiede in der Streuung haben wahrscheinlich mit der Anweisung, die Zahnschiene nur bei Bedarf zu tragen zu tun.) Wir können diese Werte damit als Indikatoren für die Compliance nehmen, die in diesem Fall mit 63% als hoch zu beurteilen ist.
Die Zahlen zu den Variablen ‘Verspannungen‘ und ‘Schmerzen‘ erscheinen, in dieser Form angegeben, gering. Umgerechnet entsprechen die Werte jedoch einem Total von 225 Kreuzen unter der Variablen ‘Verspannungen‘, bzw. 181 Kreuzen unter der Variablen ‘Schmerzen‘. Das heisst, dass pro Tag über alle Teilnehmenden hinweg um die 2 Nennungen pro Kategorie vorliegen. Abbildung 27 zeigt die Verteilung der Ankreuzungen auf die jeweiligen Subkategorien. (Es existieren keine diesbezüglichen Vergleichsmöglichkeiten.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 27: Anzahl Ankreuzungen der Variablen ‘ Verspannungen ‘ und ‘ Schmerzen ‘ , gegliedert nach den Subkategorien..
Unter der Variablen Stressbelastung wurden ‘day-events‘, oder Mikrostressoren, im Gegensatz zum üblicheren Forschungsansatz der ‘life-events‘ erfasst. Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus (1981) konnten nämlich zeigen, dass Alltagsstressoren sich besser als Prädiktoren für psychologische und psychosomatische Symptome eignen, als Makrostressoren.
Es finden sich insgesamt 287 einzelne Nennungen, was einem Schnitt von 3 Ankreuzungen pro Tag entspricht. Ein Vergleich mit den bei Kanner et al. (1981) angegeben Mittelwerten zur Hassles-Scale ist wiederum nicht unproblematisch, da hier ein sehr unterschiedliches Antwortformat zur Anwendung kam. Grob abgeschätzt liegt die Stressbelastung der vorliegenden Stichprobe jedoch im Grössenbereich der Normstichprobe[54][.
8.2. Exploration
Durch die anfänglich nicht geplante Tagebucherhebung ergaben sich neue Fragestellungen, die hier a posteriori formuliert und untersucht werden sollen. Um die Analysen in diesem Kapitel so präzise wie möglich zu halten, werden wir uns jeweils auf die effektiven Rohwerte stützen und die Daten auf der Ebene der einzelnen Personen und Tage auswerten. Während die Variablen ‘Stressbelastung‘, ‘Schmerzen‘ und ‘Verspannungen‘ intervallskaliert sind, befinden sich die übrigen Variablen auf dem nominalen Niveau. Um systematische Differenzen zwischen den einzelnen Teilnehmenden zu eliminieren, wurden die Rohwerte der intervallskalierten Variablen pro Versuchsperson z-transformiert.
a) a posteriori Hypothesen
1. Wir haben gesehen, dass der zeitliche Verlauf der Variablen AT und Stressbelastung dieselbe Regelmässigkeit aufweist. Die Hypothese, dass das AT von den Teilnehmenden spezifisch bei erhöhter Stressbelastung eingesetzt wurde, drängt sich somit auf. Es lässt sich zudem vermuten, dass neben den Variablen ‘Woche mit Therapiesitzung‘ und ‘Stressbelastung‘ die Variablen ‘Schmerzen‘ und ‘Verspannungen‘ die Praxis des AT, im Sinne eines symptomspezifischen Einsatzes, ebenso bedingen.
Zur Untersuchung dieser Fragestellung dient uns eine Varianzanalyse mit den Nominaldaten als Faktoren. Tabelle 17 gibt die Resultate wieder. Wir können keine der gehegten Vermutungen bestätigen. Das AT zeigt keinen überzufällig ausgeprägten Zusammenhang, weder mit den Variablen ‘Schmerzen‘ und ‘Verspannungen‘, noch mit der Variable ‘Stressbelastung‘. Die Wechselwirkung der beiden Faktoren erweist sich ebenfalls als unbedeutend. Ein Chi²-Test mit den Variablen ‘Praxis des AT‘ und ‘Woche mit Therapie‘ zeigt, dass sich der, auf der Wochenebene gefundene Zusammenhang anhand der Tageswerte nicht bestätigen lässt. Das Chi² von 2.36 erreicht bei einem Freiheitsgrad von 1 eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0.13.
Wir können innerhalb dieses Modelles jedoch einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen der Variable ‘Woche mit Therapiesitzung‘ und der subjektiven Stressbelastung feststellen. Zusätzlich zeigt sich, dass die Teilnehmenden in den Wochen mit einer Therapiesitzung tendenziell verspannter waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 17: Resultate einer Varianzanalyse mit den Faktoren ‘ Praxis des AT ‘ und ‘ Woche mit Therapie ‘ und den abhängigen Variablen ‘ Schmerzen , Stressbelastung ‘ und ‘ Verspannungen
2. Eine weitere a posteriori Hypothese, die inhaltlich als sinnvoll erscheint, bezieht sich auf die Auswirkungen einer Stressbelastung der Teilnehmenden. Der Zusammenhang der Variablen ‘Stressbelastung‘ mit den Variablen ‘Schmerzen‘, ‘Verspannungen‘ und ‘Schlafqualität‘ wurde, anhand einer Regressionsvarianzanalyse geprüft. Zudem wurde die Variable ‘Tragen der Zahnschiene‘ miteinbezogen, die Teilnehmenden sollten ja die Zahnschiene spezifisch, das heisst bei einem Verdacht auf Bruxismus einsetzen lernen. Tabelle 18 gibt die relevanten Resultate wieder.
Es zeigt sich innerhalb dieses insgesamt hochsignifikanten Models eine hochsignifikante Beziehung zwischen der Stressbelastung und der Schlafqualität einerseits, dem Tragen der Zahnschiene und den Verspannungen andererseits. Die Reslutate der Regressionsanalyse zeigen, dass ein Zusammenhang der Stressbelastung mit den Verspannungen vorhanden ist, nicht aber mit den Schmerzen. Der Zusammenhang der Stressbelastung mit den Verspannungen ist jedoch tendenziell signifikant unterschiedlich bei den verschiedenen Schlafqualitäten. Insgesamt erfassen die Prädiktoren Schlafqualität, Tragen der Zahnschiene und Verspannung jedoch bloss 2.7% der Varianz der Stressbelastung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. Tagebuch 2. Exploration: a posteriori Hypothesen
Tabelle 18: Resultate einer Varianzanalyse mit der abhängigen Variable ‘ Stressbelastung ‘ , den Regressoren ‘ Schmerzen ‘ & ‘ Verspannung ‘ und den Faktoren ‘ Schlafqualität ‘ & ‘ Tragen der Zahnschiene Unten sind die Ergebnisse der Regression der Variable ‘ Stressbelastung ‘ auf die Variablen ‘ Schmerzen ‘ & ‘ Verspannung ‘ aufgeführt.
4. Wir haben im deskriptiven Kapitel schon gesehen, dass eine bewusste, valide Wahrnehmung des Bruxismus nicht möglich ist. Trotzdem haben die Teilnehmenden diesbezügliche Angaben gemacht. Es drängt sich somit die Vermutung auf, dass es sich bei den subjektiven Angaben zum Bruxismus um einen korrelativen Schluss handeln könnte. Die These, dass auf Bruxismus anhand von schlechtem Schlaf, sowie anhand von Schmerzen und Verspannungen geschlossen wird, erscheint plausibel. Mittels einer Varianzanalyse mit den intervallskalierten abhängigen Variablen Schmerzen, Verspannungen und Stressbelastung wurden die vermuteten Beziehungen untersucht; Tabelle 19 zeigt die Resultate.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 19: Resultate einer Varianzanalyse der Variablen ‘ Schmerzen , ‘ Stressbelastung ‘ und ‘ Verspan- nungen ‘ mit den Faktoren subjektiv wahrgenommenes Knirschen ‘ und ‘ Schlafqualität Zwischen den Abstufungen der einzelnen Faktoren ergeben sich tatsächlich signifikante Unterschiede. Wir sehen, dass die berichtete Knirschaktivität einen starken
Zusammenhang mit den Variablen ‘Schmerzen‘ und ‘Verspannungen‘ aufweist, nicht jedoch mit der Variable ‘Stressbelastung‘. Erwartungsgemäss finden wir die schon erwähnte Beziehung zwischen der Schlafqualität und der Stressbelastung wieder; die Schlafqualität weist zudem eine starke Beziehung zu der Variablen ‘Schmerzen‘ auf. Ferner sind die Zusammenhänge zwischen den subjektiven Angaben zum Zähneknirschen einerseits, und Schmerzen, Verspannungen sowie Stressbelastung andererseits hochsignifikant unterschiedlich bei den verschiedenen Schlafqualitäten.
Darüberhinaus gibt es einen starken Zusammenhang zwischen den subjektiven Angaben zum Zähneknirschen und der Schlafqualität. Der entsprechende Chi²-Wert von 47.13 erreicht bei einem Freiheitsgrad von 1 eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0.000.
Obwohl eine erhöhte Stressbelastung wahrscheinlich als Indikator für eine eventuelle Bruxismusaktivität diente, und gemäss zahnärztlicher Instruktion zum Tragen der Zahnschiene führte, zeigt diese Variablen keine Beziehung zur erfragten Knirschaktivität. Die Frage, ob anhand des Tragens der Zahnschiene auf Bruxismus geschlossen wurde, kann anhand eines Chi²-Tests verneint werden: Der Kennwert von 2.22 ergibt bei einem Freiheitsgrad von 1 eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0.14. Das Argument, dass das Tragen der Zahnschiene das Auftreten von Schmerzen und Verspannungen vermindert und deswegen mit den Bruxismusangaben wenig korreliert, kann mittels einer entsprechenden Varianzanalyse ebenso zurückgewiesen werden. Anhand der WilksLambda Teststatistik ergibt sich ein F-Wert von 1, der eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p=0.39 erreicht (df Hypothese=26, df Fehler=166).
b) Folgerungen
Was für Rückschlüsse können wir nun anhand der gefundenen Beziehungen auf das Verhalten der Teilnehmenden ziehen? Bezüglich der Praxis des AT haben wir keine Regelmässigkeiten aufdecken können. Es erstaunt jedoch, dass die Übungen nicht bei Bedarf, das heisst bei akuten Verspannungen, Stressbelastungen oder Schmerzen eingesetzt werden. Leider wurde die Anwendung der Dehnungsübungen nicht erfragt, was zumindest bei Schmerzen und Verspannungen eine spezifischere und naheliegendere Praxis wäre.
Auch der auf der Wochenebene signifikante Effekt der vermehrten Übung des AT in Wochen mit Therapiesitzungen konnte anhand der genaueren Tageswerte nicht aufrecht erhalten werden. Dies spricht eigentlich für eine zuverlässige und disziplinierte ‘Mitarbeit‘ der Teilnehmenden, die auf eigener Motivation zu beruhen scheint.
Diese Compliance lässt sich auch gegenüber den zahnärztlichen Instruktionen zum Gebrauch der Zahnschiene feststellen. Wir haben einen starken Zusammenhang zwischen der subjektiven Stressbelastung und dem Tragen der Zahnschiene gefunden. Wir können somit annehmen, dass eine akute Stressituation den Teilnehmenden als ein Indikator für einen vermuteten Bruxismus diente und damit zu einem spezifischen Einsatz der Zahnschiene führte.
Wir haben schon bemerkt, dass die subjektiven Angaben zum Bruxismus nicht valide sind. Unsere Vermutung, dass anhand von Schmerzen, Verspannungen und einer schlechten Schlafqualität von den Teilnehmenden auf Bruxismus geschlossen wurde, erhärtete sich anhand ausgeprägter Effektgrössen. Zudem nehmen weder die Stressbelastung, noch das Tragen der Zahnschiene einen Einfluss auf die Beurteilung eines erfolgten nächtlichen Knirschens.
Das Argument, dass das Tragen der Zahnschiene die Schmerz- und Verspannungssymptome reduziere und damit in indirekter Beziehung mit der Wahrnehmung des Bruxismus steht, konnte nicht bestätigt werden. Die Teilnehmenden nahmen die Folgen von Bruxismus (Schmerz, Verspannung, schlechter Schlaf) nicht durch die disponierenden Faktoren (Stress und das damit zusammenhängende Tragen der Zahnschiene) beeinflusst wahr.
Diese Feststellung spricht wiederum für die subjektive Beurteilung der Knirschaktivität, zumindest scheint die Wahrnehmung der mit Bruxismus korrelierenden Faktoren recht differenziert zu sein. Die subjektive Einschätzung des Bruxismus ist somit zwar nicht valide für das Auftreten des Verhaltens. Die naheliegende Frage, ob sich anhand der Angaben zum Bruxismus Rückschlüsse auf die Intensität des Knirschens ziehen lassen, müssen wir offen lassen.
“ Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren. ”
(Goethe, Maximen und Reflexionen)
“ Einfachheit ist von unendlicher Deutbarkeit. ” (Karl Jaspers)
“ Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter. ”
(Goethe, Zahme Xenien)
C / Statistische Datenanalyse
9. Diskussion
9.1. Zusammenfassung der Resultate
Die durchschnittliche Bruxismusaktivität hat bezüglich der Anzahl der Episoden, wie bezüglich der absoluten Dauer nach der erfolgten Behandlung um rund 18% abgenommen. Die Analyse dieses Trends zeigte jedoch, dass der Zufall nicht mit genügender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Die Qualität des Fragebogens zur Erfassung der Erwartungshaltung und des subjektiv wahrgenommenen Nutzens erwies sich als hinreichend. Es liess sich eine geringfügige Abnahme von der Erwartungshaltung zum wahrgenommenen Nutzen feststellen; die Einschätzung des Nutzens erwies sich als stabil. Die Resultate der statistischen Analyse zeigen jedoch auf, dass kein eigentlicher Verlauf vorliegt.
Der erste Teil der diesbezüglichen Hypothese, dass sich die Erwartungshaltung auf die erste Messung des subjektiven Nutzens auswirkt, ist nur tendenziell signifikant. Die zweite Annahme, dass sich der Einfluss der Erwartungshaltung über die Zeit hinweg reduzieren würde, konnte bestätigt werden.
Der in der dritten Hypothese vermutete Zusammenhang zwischen dem subjektiv wahrgenommenen Nutzen und der Reduktion der Bruxismusaktivität fiel positiv aus. Die Enge des Zusammenhanges ist mässig ausgeprägt und nicht signifikant.
Die zuverlässig ausgefüllten Tagebuch-Aufzeichnungen brachten vor allem eine hohe Compliance (betreffend des Tragens der Zahnschiene und der Praxis des Autogenen Trainings) der Teilnehmenden zutage. Die während den Sitzungen gegebenen Anregungen wurden durchaus ernst genommen, was eine wichtige Voraussetzung für die Interpretierbarkeit des Datenmaterials bildet. Es konnten einige weitere interessante Beobachtungen zum Verhalten der Teilnehmenden gemacht werden:
1. Das Autogene Training wurde nicht bedarfsmässig (bei Stress, Schmerzen oder Verspannungen) eingesetzt.
2. Die Teilnehmenden setzten die Zahnschiene, gemäss den zahnärztlichen Instruktionen, spezifisch bei Verdacht auf Bruxismus ein. Als ein Indikator dafür diente ihnen die wahrgenommene Stressbelastung.
3. Die subjektiven Angaben zum Bruxismus sind für dessen Auftreten nicht valide; sie stützen sich auf das Vorhandensein von Schmerzen, Verspannungen, sowie auf eine schlechte Schlafqualität.
4. Die Teilnehmenden zeigten eine differenzierte Wahrnehmung der mit Bruximsus korrelierenden Faktoren.
9.2. Abschliessende Bemerkungen
a) objektiver Nutzen
Die Tatsache, dass die Veränderungen in der Bruxismusaktivität die Signifikanzgrenze nicht zu unterschreiten vermochten, ist wahrscheinlich nicht auf eine fehlende Wirksamkeit des Behandlungspaketes zurückzuführen. Immerhin haben wir eine Abnahme der Bruxismusdauer von 18% zu verzeichnen.
Die Vermutung, dass die Zeitspanne zwischen den beiden Schlaflaborerhebungen zu kurz bemessen war, liegt auf der Hand, wenn wir auch die Resultate von Bazzana, Keller, Koller & Willi (1994-96) mit in Betracht ziehen. In ihrem Versuch führten sie mit Zähneknirschern ein Entspannungstraining durch, das sich über 8 Wochen erstreckte. Nach Ablauf der Behandlungsphase sahen sie sich mit einer signifikanten Zunahme der Knirschaktivität konfrontiert. Keller (1994, S.77) führt dazu folgendes aus: “So sind acht Wochen erwiesenermassen eine äusserst knapp bemessene Zeit um die Wirksamkeit eines Entspannungstrainings nachweisen zu können, und nicht selten kann bei Therapiebeginn als erstes Zeichen einer Besserung eine sog. Symptomverstärkung beobachtet werden.”[55] Diese Zunahme des pathologischen Verhaltens beruht dann wahrscheinlich auf einer bewussten Fokussierung des problematischen Verhaltens, was innerhalb der Behandlung ja auch angestrebt wird. Als weiteren Grund für den Anstieg der Bruxismusaktivität nennt Keller (1994, S.78) eine geringe Compliance ihrer Versuchspersonen: “In einer weiteren Untersuchung müsste (...) das tägliche, disziplinierte Üben unbedingt stärker betont werden; ... ”
Diese Erfahrung von Keller (1994) war einer der Gründe, warum wir uns für den Einsatz eines Tagebuches entschieden haben. Die täglich auszufüllenden Fragen dürften die Teilnehmenden, in Form einer steten Erinnerung oder eines sanften äusseren Drucks, in ihrer Selbstdisziplin unterstützt haben. Tatsächlich konnten wir eine gute Compliance verzeichnen.
Im vorliegenden Setting ist die Zeitspanne zwischen den Schlaflabormessungen mit 14 Wochen beinahe doppelt so gross. Anscheinend sind 3½ Monate genügend Zeit, dass sich eine tendenzielle Abnahme des fokussierten Verhaltens einstellen kann. Ob die erreichte Besserung sich als dauerhaft erweisen kann, oder sich sogar in noch stärkerem Ausmass abzeichnen wird, können wir anhand der vorliegenden Daten nicht beurteilen. Eigentlich ist aber die Frage nach der Persistenz der Verhaltensänderung der zentrale
Interessepunkt einer jeden Therapieprozessforschung. Eine zusätzliche Folgeuntersuchung, nach dem üblichen Zeitintervall von 6 Monaten, ist für eine fundierte Beurteilung der Effektivität des vorliegenden Behandlungsprogrammes ein eigentliches Muss.
Die Vorbereitungen dazu sind momentan im Gang. Wir hoffen, dass wir die Teilnehmenden anhand des sich abzeichnenden Trends motivieren können, nochmals eine Nacht im Schlaflabor zu verbringen.
b) subjektiver Nutzen
Die Erwartungshaltung der Teilnehmenden war, im Vergleich zum wahrgenommenen Nutzen, deutlich homogener ausgeprägt. Die Streuung der Fragebogenwerte verdoppelte sich über die drei Messzeitpunkte hinweg beinahe. Das Behandlungspaket löste bei den Teilnehmenden stark unterschiedliche Reaktionen aus.
Die Einschätzung der Nützlichkeit war in der Mitte der Behandlung noch tendenziell von der Erwartungshaltung beeinflusst. Die Nutzeneinschätzung zum Schluss der Therapie stand nicht mehr in Zusammenhang mit der initialen Erwartung. Vielmehr waren die Werte durch die vorherigen Angaben zum Nutzen der Behandlung gut vorhersagbar, die Wahrnehmung und Bewertung des Nutzens blieb ziemlich stabil.
Einerseits können wir uns dadurch in der Annahme einer gewissen Naivität der Erwartungshaltung bestätigt sehen. Sie hat eigentlich nichts mit der Behandlung selbst zu tun, und spielt nur zu Beginn der Therapie eine gewisse Rolle. Der Erwartungseffekt wird von der tatsächlich stattfindenden Behandlung überlagert und verschwindet mit der Zeit vollständig. Die Erwartungshaltung per se eignet sich somit nicht zur Vorhersage eines Therapieerfolges.
Andererseits erwies sich auch der wahrgenommene Nutzen nicht als guter Prädiktor für die Veränderung der Bruxismusaktivität. Die prognostische Validität von subjektiven Beurteilungen ist somit erheblich in Frage gestellt. Diese Feststellung spricht jedoch keineswegs gegen eine Verwendung subjektiver Daten in der Therapieevaluation.
Besonders in der angloamerikanischen Evaluationsforschung ist die Erhebung der Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung (‘patient’s satisfaction‘) weit verbreitet. Dieses Mass zeigt mit traditionelleren, objektiven Evaluationskriterien nur geringe bis mässige Korrelationen, die sich zwischen 0.0 und 0.4 bewegen (Pekarik & Wolff, 1996, S.202). Die Erhebung der Zufriedenheit erschien mir jedoch fragwürdig. Das Konstrukt der Zufriedenheit ist, im Zusammenhang einer Therapieevaluation, um einiges unspezifischer und unpräziser als ein direkt erfragter Nutzen. Die Zufriedenheit muss beispielsweise nicht mit einer Symptomveränderung assoziiert sein, was für das Konstrukt des therapeutischen Nutzens schon eher zutrifft. Zudem betont eine Nutzenbewertung in stärkerem Masse die aktive (handelnde, wie kognitive) Rolle der Teilnehmenden. Atkinson & Caldwell (1997) konnten zudem zeigen, dass Einschätzungen der allgemeinen Zufriedenheit signifikant mit der aktuellen Stimmungslage korrelieren, was bei einer objektiveren Nutzenbeurteilung nicht der Fall war.
Mit einer Korrelation von 0.32 befinden sich die vorliegenden Resultate jedoch genau im Bereich der, in der patient’s satisfaction - Forschung angegebenen, üblichen Zahlen. Diese Übereinstimmung erstaunt nicht weiter, wenn wir uns nochmals vor Augen halten, dass mit subjektiven Therapiebewertungen vor allem unspezifische, nicht näher bestimmbare Faktoren erfasst werden.
Für eine Benutzung der subjektiven Bewertung als unmittelbares Evalutationskriterium spricht einerseits die Differenziertheit der gegebenen Antworten. Betrachtet man die Daten auf individueller Ebene, zeichnen sich keine globalen Bewertungstendenzen ab; die Angaben stellen vielmehr ein breites Spektrum spezifischer, individueller Reaktionen dar. Andererseits spricht auch die zeitliche Stabilität der Nutzenbewertung für die Verwendung dieses Kriteriums.
Der qualitative Aspekt der Erhebung ist dabei grundsätzlich genauso wichtig, wie eine quantitative Erfassung der Nutzens. So können wir, anhand des offenen Antwortformates ein paar Vorschläge zur Optimierung des Behandlungsprogrammes unterbreiten. Der direkte Wunsch nach einer stärkeren Gewichtung des gegenseitigen Erfahrungsaustausches in Diskussionen wurde (auch direkt im Schlaflabor) deutlich ausgesprochen. Wie schon erwähnt, könnten Handouts mit den wichtigsten Thesen der Referate die Ausführungen verkürzen, so dass mehr Zeit für das Gespräch bleiben würde. Solche knappen, leicht überschaubaren Thesenblätter dürften, dank der vorgegebenen Gliederung wohl auch die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmenden erhöhen. Der Stellenwert einer kognitiven Strukturierung anhand von Informationen sollte nicht unterschätzt werden, dies zeigten einerseits die Ausführungen im theoretischen Teil. Andererseits lassen auch die Resultate der statistischen Analysen entsprechende Spekulationen zu. Um Informationen auch tatsächlich im Sinne einer Nutzenoptimierung verwenden zu können, sollten diese der praktischen Behandlung unbedingt vorangestellt sein.
Im Falle eines Follow-up, dürfte es äusserst interessant sein, den Verlauf der Nutzenbewertung über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. Zudem würde auch das Tagebuch den Teilnehmenden weiter zugestellt werden, wobei die Erfassung der Anwendung von Dehnungsübungen den Variablenkatalog ergänzen würde. Dies ist einerseits im Sinne einer weiteren Motivierung der Teilnehmenden gedacht. Andererseits ist eine gewisse Kontrolle bezüglich des Verhaltens der Teilnehmenden für die Interpretierbarkeit der noch zu erhebenden Daten von Bedeutung.
Die vorliegenden Resultate zeigen auf einer empirischen Basis, was theoretisch schon lange postuliert wurde: Bei psychosomatischen Beschwerden ist es sinnvoll mit einer Behandlung an möglichst vielen Subsystemen des Organismus anzusetzen. Das vorliegende Therapiekonzept könnte, mit entsprechenden Modifikationen, bestimmt auch gewinnbringend auf andere psychosomatische Störungen angewendet werden.
“ Die Forschung ist immer auf dem Weg, nie am Ziel. ”
(Adolf Peters)
“ Der Abschied von einer langen wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig, als erfreulich. ”
(Schiller, Brief an Goethe)
10. Literaturverzeichn is
Atkinson, M. & Caldwell, L. (1997). The differential effects of mood on patients‘ ratings of life quality and satisfaction with their care. In: Journal of Affective Disorders, 44, 169-175.
Bazzana, F. (1994). Subjektive und objektive Wirkungen von Biofeedback, progressiver Muskelentspannung und autogenem Training. Unveröffentl.
Lizentiatsarbeit des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, Abteilung klinische Psychologie.
Bernegger, H. & Welke, M. (1997). Bruxismus und Trauminhalt . Unveröffentl.
Lizentiatsarbeit des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, Abteilung klinische Psychologie.
Bieri, P. (Hrsg.) (1993). Analytische Philosophie des Geistes. Bodenheim: Athenäum Hain Hanstein.
Binder, H. & Binder, K. (1993). Autogenes Training - Basispsychotherapeutikum. Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
Birner, U.; Wankmüller, I.; Dhingra -Rother, A. & Kraiker, C. (1995). Der nächtliche Bruxismus - eine psychophysiologische Störung? Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin, 15 (2), 141-165.
Bortz, J. (1984). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.
Brokmeier, A.A. (1995). Manuelle Therapie. Stuttgart: Ferdinand Enke.
Christian, P. (1989). Anthropologische Medizin. Berlin: Springer.
Clark, G.T.; Rugh, J.D. & Handelmann, S.L. (1980). Nocturnal masseter muscle activity and urinary catecholamine levels in bruxers. Journal of Dental Research, 59 (10), 1571-1576.
Cramer, J.A. (1991). Overview of methods to measure and enhance patient compliance. In: Cramer, J.A. & Spilker, B. (Eds.). Patient compliance in medical practice and clinical trials. (S.3-10). New York: Raven Press.
Darwin, C. (1987). The expression of the emotions in man and animals. New York: Universitiy Press. (Original: 1872)
Dausch-Neumann, D. (1989). Kieferorthopädie. In Schwenzer, N. (Hrsg.), Zahn- Mund-Kiefer-Heilkunde. (S.1-231). Stuttgart: Thieme.
Davies, A.R. & Ware, J.E. (1988). Involving consumers in quality of care assessment. Health Affairs, 7 (1), 33-48.
Dies, R.R. (1992). Models of group psychotherapy: Sifting through confusion. International Journal of Group Psychotherapy, 42 (1), 1-16.
Egle, U.T. (1996). Schmerz. In Meyer, A.-E.; Freyberger, H., Kerekjarto, M.; Liedtke, R. & Speidel, H. (Hrsg.), Jores praktische Psychosomatik. (S.344-360) Bern: Hans Huber.
Engelhardt, J.P. (1995). Einschleiftherapie im natürlichen Gebiss. In Koeck, B. (Hrsg.), Funktionsstörungen des Kauorgans. (S.243-280). München: Urban & Schwarzenberg.
Erikson, E. (1976). Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart: Klett.
Evaskus, D.S. & Laskin, D.M. (1972). A biochemical measure of stress in patients with myofascial pain-dysfunction syndrome. Journal of Dental Research, 51
(5), 1464-1466.
Fähndrich, E. & Linden, M. (1982). Zur Reliabilität und Validität der Befindlichkeits - messung mit der Visuellen Analog -Skala. Pharmacopsychiatria, 15, 90-94.
Frank, J. D. (1981). Die Heiler. Wirkungsweisen psychotherapeutischer Beeinflussung. Stuttgart: Klett-Cotta.
Freesmeyer, W.B. (1995). Okklusionsschienen. In Koeck, B. (Hrsg.), Funktions- störungen des Kauorgans. (S.215-242). München: Urban & Schwarzenberg.
Fricke, U. (1983). Placebo - ein Effekt der Pharmakotherapie. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten, 6, 356-369.
Glaros, A.G. & Rao, S.M. (1977). Bruxism: a critical review. Psychological Bulletin, 84 (4), 767-781.
Gleick, J. (1988). Chaos - die Ordnung des Universum. München: Droemer Knaur.
Görtelmeyer, R. (1996). Schlaffragebogen SF-A und SF-B. In Collegium
Internationale Psychiatriae Scalarum (CIPS) (Hrsg.): Internationale Skalen für Psychiatrie, S.125-136. Göttingen: Beltz.
Graber, G. (1972). Myoarthropathien des Kauorgans. Unveröffentl. Habilitations- schrift der Universität Basel.
Graber, G. (1995). Der Einfluss von Psyche und Stress bei dysfunktionalen Er- krankungen des stomathognathen Systems. In Koeck, B. (Hrsg.), Funktions- störungen des Kauorgans, (S.49-72). München: Urban & Schwarzenberg.
Grawe, K.; Donati, R. & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Bern: Hogrefe.
Greene, C. & Marbach, J.J. (1982). Epidemiologic studies of mandibular dysfunction: A critical review. The Journal of Prosthetic Dentistry, 48 (2), 184-190.
Gruber, W. (1980). Die syndromale Erfassung der Bruxismus Persönlichkeit mittels der biographischen Anamnese, des TAT und des Rorschachtests. Unveröffentl.
Dissertation am Psychologischen Institut der Universität Salzburg.
Hicks, R.A. & Conti, P.A. (1989). Changes in the incidence of nocturnal bruxism in college students: 1966-1989. Perceptual and Motor Skills, 69, 481-482.
Hirsig, R. (1993). Methodische Grundlagen der Testpsychologie. Skriptum zur Lehr - veranstaltung der Universität Zürich.
Hübli, A. & Lübcke, P. (Eds.) (1995). Philosophielexikon. Reinbek: Rowohlt.
Jäger, K.; Borner, A. & Graber, G. (1987). Epidemiologische Untersuchung über die an dysfunktionellen Erkrankungen beteiligten ätiopathogenetische n Faktoren. Schweizerische Monatsschrift der Zahnmedizin, 97(11) , 1351-1356.
Kanner, A.; Coyne, J.; Schaefer, C. & Lazarus, R. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events.
Journal of Behavioral Medicine, 4 (1), 1-40.
Keller, I. (1994). Zusammenhänge zwischen subjektiven Krankheitstheorien und Therapie am Beispiel von Bruxismus. Unveröffentl. Lizentiatsarbeit des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, Abteilung klinische Psychologie.
Koller, R. (1995). Die Auswirkungen von Entspannung auf Bruxismus unter Berück - sichtigung der Schlafstadien: eine Schlaflaborstudie. Unveröffentl. Lizentiats- arbeit des psychologischen Instituts der Universität Zürich, Abteilung klinisc he Psychologie.
Klingler, O. (1989). Die Rolle von Erwartungen in verhaltenstherapeutischen Inter - ventionen. Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin, 10 (4) , 315-331. Koeck, B. (1982). Experimentelle Untersuchungen zur Dynamik des Unterkiefers während des Nachtschlafes. Berlin: Quintessenz.
Körber, K.H. (1995). Zahnärztliche Prothetik. Stuttgart: Thieme.
Krause, R.; Ebert, B.; Czeschick, E.R. & Müller, K. (1977). Ein verhaltens - therapeutisches Gruppenkonzept: Behandlung psychosomatischer Störungen. Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie, 25(1), 64-79.
Lakin Phillips, E. (1988). Patient compliance. Toronto: Hans Huber.
Langer, G. (1989). Placebo - ein Scheinmedikament? Widersprüche in der reduktionistischen Konzeption von Placebo. Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin, 10 (4) , 333-342.
Laurig, W. (1992). Grundzüge der Ergonomie. Berlin: Beuth.
Lewin, M. (1986). Psychologische Forschung im Umriss. Berlin: Springer.
Lindqvist, B. (1974). Bruxism in twins. Acta Odontologica Scandinavica, 32, 177-187.
Maetzler, N. (1997). Bruxismus als Schlafstörung: eine Schlaflaborstudie.
Unveröffentl. Lizentiatsarbeit am Psychologischen Institut der Universität Zürich, Abteilung klinische Psychologie.
Marie, M.M. & Pietkiewicz, M. (1907). Bruxomania. Revue de Stomatologie, 14, 107-116.
Meili, U.; Meyer, T. & Tritscheler, T. (1997). Interdisziplinäre Therapie bei Bruxismus. Unveröffentlichtes Manuskript.
Mercuri, L.G.; Olson, R.E. & Laskin, D.M. (1979). The specifity of response to experimental stress in patients with myofascial pain dysfunction syndrome. Journal of Dental Research, 58 (9), 1866-1871.
Mohl, N.; Zarb, G.; Carlsso, G. & Rugh, J. (1990). Lehrbuch der Okklusion. Berlin: Quintessenz.
Motsch, A. (1985). Epidemiologie funktioneller Störungen. Deutsche zahnärztliche Zeitschrift, 40 , 147-155.
Nadler, S.C. (1957). Bruxism, a classification: critical review. Journal of the American Dental Association, 54, 615-622.
Olkinoura, M. (1969). Bruxism. A review of the literature. Suomen Hammaslääkä - 114 riseuran Toimituksia, 65 , 312-324.
Pekarik, G. & Wolff, C. (1996). Relationship of satisfaction to symptom change, follow-up adjustment, and clinical significance. In: Professional Psychology: Research and Practice, 27 (2), 202-208.
Priebe, S. (1992). Die Bedeutung der Patientenmeinung. Göttingen: Hogrefe.
Pritz, A. (1989). Kurzgruppenpsychotherapie. Literaturüberblick und Forschungsper - spektiven. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 23, 113-138.
Ramfjord, S.P. (1961). Bruxism, a clinical and electromyographic study. Journal of the American Dental Association, 62 , 21-44.
Rechtschaffen, A.. & Kales, A. (Eds.) (1968). A manual of standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human subjects. Maryland: National Institutes of Health Publication.
Reding, G.R., Zepelin, H. & Monroe, L.J. (1968). Personality study of nocturnal teeth-grinders. Perceptual and Motor Skills, 26, 523-531.
Reinecker, H. (1986). 3.Grundlagen verhaltenstherapeutischer Methoden. 4. Methoden der Verhaltenstherapie. In Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (Hrsg.), Verhaltenstherapie, Theorien und Methoden. (S.43-179). München: Steinbauer & Rau.
Rohen, J. & Yokochi, C. (1988). Anatomie des Menschen. Stuttgart: Schattauer.
Rosenberg, J.; Rand, M.J. & Asay, D. (1993). Körper, Selbst und Seele. Oldenburg: 114 Transform.
Rudolf, G. (1990). Psychosomatik als Forschung und Therapie im Felde menschlicher Beziehungen. Zeitschrift für psychosomatische Medizin, 36, 276-292.
Rugh, J.D. & Solberg, W.K. (1976). Psychological implications in temporoman- dibular pain and dysfunction. Oral Science Review, 7, 3-30.
Ruppenthal, T. (1989). Psychosomatische und parodontale Aspekte des Bruxismus bei Erwachsenen. Unveröffentl. Inauguraldissertation, medizinische Fakultät der
Universität Mainz.
Schaefer, H. (1990). Das Prinzip Psychosomatik. Heidelberg: Verlag für Medizin.
Schandry, R. (1988). Lehrbuch der Psychophysiologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Schneider, W.; Dvorák, J.; Dvorák, V.; Tritscheler, T. (1989). Manuelle Medizin. Therapie. Stuttgart: Thieme.
Schramm, E. & Riemann, D. (Hrsg.)(1995). ICSD. Internationale Klassi fikation der Schlafstörungen. Weinheim: Psychologische Verlagsunion.
Schulte, W.; Lukas, D. & Sauer, G. (1981). Myoarthropathien. Epidemiologische Gesichtspunkte, analytische und therapeutische Ergebnisse. Deutsche zahn- ärztliche Zeitschrift, 36, 343-353.
Schultz, J.H. (1991). Das Autogene Training. Konzentrative Selbstentspannung. Versuch einer klinisch-praktischen Darstellung. Stuttgart: Thieme. (Original: 1932)
Siegenthaler, W. & Haas, R. (Hrsg.) (1992). Kommunikationsstörungen als Krankheitsfaktor. Stuttgart: Thieme.
Sonnabend, E. (1989). Röntgentechnik in der Zahnheilkunde. München: Urban & Schwarzenberg.
Speidel, H. (1996). Der erste Arzt-Patient-Kontakt: Ärztliches Gespräch. In: Meyer, A.E. et al. (Hrsg.). Jores praktische Psychosomatik. Bern: Huber.
Straus, J. L. & Cavanaugh, S. (1996). Placebo effects. Issues for clinical practice in psychiatry and medicine. Psychosomatics, 37 (4), 315-326.
Toseland, R.W. & Siporin, M. (1986). When to recommend group trea tment: a review of the clinical and the research literature. International Journal of Group Therapy, 36 (2), 171-201.
Tschuschke, V. (1989). Wirksamkeit und Erfolg in der Gruppenpsychotherapie. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 25, 60-78.
v. Uexküll, T. & Wesiack, W. (1988). Theorie der Humanmedizin. München: Urban & Schwarzenberg.
v. Uexküll, T. (1991). Psychosomatik als Suche nach dem verlorenen lebenden Körper. Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie, 41, 482-488.
v. Uexküll, T. & Wesiack, W. (1996). Wissenschaftstheorie und psychosomatische Medizin, ein bio-psycho-soziales Modell. In: v.Uexküll, T. (Hrsg.), Psycho- somatische Medizin. München: Urban & Schwarzenberg.
Wesiack, W. (1994). Von der Psychoanalyse zur psychosomatischen Medizin. In:
Hahn, P. et al. (Hrsg.), Modell und Methode in der Psychosomatik. (S.24-30) Weinheim: Deutscher Studienverlag.
Wigdorowicz-Makowerowa, N.; Czeslaw, G.; Panek, H.; Maslanka, T.; Plonka, K. & Palacha, A. (1979). Epidemiologic studies on prevalence and etiology of functional disturbances of the masticatory system. The Journal of Prosthetic Dentistry, 41 (1), 76-82.
Wilkins, W. (1973). Expectancy and therapeutic gain: an empirical and conceptual critique. Journal of Consulting and Clincal Psychology, 40 (1), 69-77.
Willi, R. (1996). Stress, Schlafqualität und nächtliches Zähneknirschen: eine Schlaf - laborstudie. Unveröffentl. Lizentiatsarbeit des Psychologischen Instituts der Universität Zürich, Abteilung klinische Psychologie.
Wojnilower, D.A. & Gross, A.M. (1981). The treatment of bruxism: A review and proposal for future research. Clinical Psychology Review, 1, 453-468.
Wolf, F.A. (1993). Körper, Geist und neue Physik. Eine Synthese der neuesten Er- kenntnisse von Medizin und moderner Naturwissenschaft. Frankfurt a. M.: Insel Verlag.
Wolf, C.M.(1994). Veränderung kardiovaskulärer und psychologischer Parameter durch autogenes Training. Inaugural Dissertation, der Medizinischen Fakult ät der Universität Bonn. Bonn: GS Druck.
Yalom, I.D. (1996). Gruppenpsychotherapie. Grundlagen und Methoden. München: Kindler. (Original: 1970)
Yemm, R. (1976). Neurophysiologic studies of temporomandibular joint dysfunction. 116
Oral Sciences Review, 7, 31-53.
Zimbardo, P. G. & Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New York: McGraw-Hill.
D / Anhang
11. Signierungsanleitung
Die folgende Signierungsanleitung wurde innerhalb des 4 -er Lizentiats (Bazzana, Keller, Koller & Willi, 1994-1996) über Bruxismus entwickelt, und richtet sich nach den Angaben von Koller, 1995, Anhang III:
Allgemeines:
- Grundbedingung für alle Bruxismus - Signierungen ist ein Tonusanstieg des
Masseter-Temporalis (EMG II) um mindest ens das Doppelte des durchschnittlichen Tonus - Hintergrundes der letzten 30 sec.
- Vor und nach einer Episode zeigt das EMG II während mindestens 3 sec. keinen (bzw. nur einen geringen) Tonusanstieg. Ist der Abstand zwischen zwei Bruxismusereignissen kleiner als 3 sec., gehören sie zu derselben Episode.
- Einzelne kurze Ausschläge (kürzer als 2 sec.) werden nicht als Bruxismusepisoden signiert, um Ereignisse wie Schlucken, Zuckungen, etc. auszuschliessen.
- Bei mind. 10 sec. Wach - EEG vor dem Ereigniss werden keine Bruxismusepisoden signiert.
- Die Schlafstadien werden für die ganze Nacht signiert.
Gruppeneinteilung bezüglich EMG II:
?? Phasische Episoden (P):
- mindestens 3 gut sichtbare Peaks
- jeder einzelne Peak länger als 0.25 sec. und kürzer als 2 se c.
- Abstand zwischen zwei Peaks kürzer als 3 sec.
- Die Länge einer Bruxismusepisode entspricht der Zeit vom ersten bis zum letzten Peak
?? Tonische Episoden (T):
- ein einziger, anhaltender Tonusanstieg
- mindestens 2 sec. lang
?? Gemischt Episoden (G):
Es ist möglich dass unter diese Kategorie, mangels Differenzierungsmöglichkeiten, auch andere nicht funktionelle Kieferbewegungen, wie Schmatzen,
Reden im Schlaf, etc. miterfasst werden.
Folgende Ereignisse fallen unter diese Kategorie:
- gemischte Episoden (phasische und tonische Ereignisse wechseln sich ab) welche die Bedingungen für Gruppe P, bzw. T erfüllen
- wiederholt tonische Episoden, d.h. mehr als ein tonischer Anstieg pro Episode
D / Anhang
12. Fragebogenitems
12.1. Fragebogen 1
Fragebogen 1: Persönliche Erwartung en.
Name:
In dieser Untersuchung sind wir an Ihren persönlichen Erwartungen gegenüber der Behandlung interessiert. Die Erhebung wird im Rahmen einer Lizentiatsarbeit der Universität Zürich realisiert. Die Daten -auswertung erfolgt unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen des Datenschutzes.
Bitte lesen sie die Fragen sorgfältig durch und lassen sie sich beim Ausfüllen Zeit. Ihre persönliche Antwort können Sie in Form eines Kreuzes irgendwo auf der Linie geben, die angegebenen Markierungen dienen Ihnen dabei als Orientierungshilfe.
Beispiel: Das Ausfüllen des Fragebogens empfinde ich als
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12. Fragebogen 1. Fragebogen 1
Besten Dank für Ihre Mitarbeit !
1. Nachdem der Zahnarzt meine Zähne eingeschliffen hat, wird das Gefühl in
meiner Mundhöhle [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] sein.
2. Ich glaube, dass nach der zahnärztlic hen Behandlung der Zahnkontakt beim Beissen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] sein wird.
3. Ich erwarte, dass nach der Behandlung vom Zahnarzt meine Kiefer -, bzw. Beissstellung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] sein wird.
4. Falls mir Herr Meili eine Zahnschiene verschreibt, werde ich sie wahrscheinlich [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] tragen.
5. Ich erwarte, dass durch die zahnärztliche Behandlung mein Wohlbefinden [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] wird.
6. Ich denke, dass durch die fokussierte Aufmerksamkeit während der Körperübungen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] werden wird.
7. Durch die verschiedenen Körperübungen wird meine Wahrnehmung einzelner [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] werden.
8. Mit den Körperübungen werde ich lernen, mit gewissen Körpervorgängen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] umzugehen.
9. Zu Hause werde ich die Entspannungsübungen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] durchführen.
10.Ich glaube, dass mein Wohlbefinden durch die Körperübungen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]wird.
11.Durch die Impulse der Referate werde ich mich auf mein eigenes Verhalten [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] achten.
12.Durch die Informationen der Vorträge wird meine Einsicht in mein Verhalten eher [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] werden.
13.Ich glaube, dass sich durch die Impulse der Referate [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] meiner Gewohnheiten in Frage stellen werden.
14.Ich denke, dass ich mich mit den angesprochenen Themen der Referate privat [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] als sonst beschäftigen werde.
15.Ich erwarte, dass mein Wohlbefinden durch die Impulsreferate [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] wird.
16.Ich denke, dass ich mich in der Gruppe [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] fühlen werde.
17.Die Diskussionsbeiträge der einzelnen Gruppenmitglieder werden wahrscheinlich [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] sein.
18.Ich glaube, ich werde meine persönlichen Erlebnisse und Meinungen in der Gruppe [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] diskutieren.
19.Ich glaube, dass ich die Themen, die in der Gruppe besprochen werden, priva t [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] als sonst diskutieren werde.
20.Ich habe das Gefühl, dass mein Wohlbefinden durch die Gruppendiskussionen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] beeinflussen werden.
21. Knirschen oder Pressen Sie Ihre Zähne auch tagsüber ? O oft O selten O nie
22. Leiden Sie unter Verspannungen / Schmerzen vom Zähneknirschen ? O oft O selten O nie
23. Waren Sie schon einmal in physiotherapeutischer Behandlung, oder haben Sie Erfahrung mit Entspannungsverfahren, wie z.B. Autogenem Training ? O ja O nein
24. Waren Sie schon einmal in psychotherapeutischer Behandlung ? O ja O nein
25. Wünsche, Kritik, Anregungen, Be merkungen:
12. Fragebogen
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit !
12.2. Fragebogen 2 / 3
Fragebogen 2 / 3: Persönlicher Nutzen der Behandlung
Name:
In dieser Erhebung sind wir am persönlichen Nutzen, der ihnen die Behandlung brachte, interessiert. Bitte lesen sie die Fragen sorgfältig durch und lassen sie sich beim Ausfüllen Zeit. Ihre persönliche Antwort können Sie in Form eines Kreuzes irgendwo auf der Linie geben, die angegebenen Markierungen dienen Ihnen dabei als Orientierungshilfe.
Beispiel: Das Ausfüllen des Fragebogens empfinde ich als [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
Besten Dank für Ihre Mitarbeit !
1. Seit der Zahnarzt meine Zähne eingeschliffen hat, ist das Gefühl in meiner Mundhöhle [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
2. Seit der zahnärztlichen Behandlung ist der Zahnkontakt beim Beissen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
3. Seit der Behandlung vom Zahnarzt ist meine Kiefer -, bzw. Beissstellung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] instabiler stabiler
4. Haben Sie von Herr Meili eine Zahnschiene bekommen? O ja / O nein (Falls Sie mit “nein” geantwortet haben, gehen Sie bitte zur Frage 5) Ich trage die Zahnschienec [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
5. Im allgemeinen beeinflusst die zahnärztliche Behandlung mein Wohlbefinden [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
6. Durch die fokussierte Aufmerksamkeit während den Körperübungen ist [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
7. Durch die verschiedenen Körperübungen ist meine Wahrnehmung einzelner [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
8. Die Körpererfahrung vermittelt mir das Gefühl, mit gewissen Körpervorgängen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
9. Zu Hause führe ich die Entspannungsübungen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
12. Fragebogen 2. Fragebogen 2 / 3
10. Im allgemeinen beeinflussen die Körperübungen mein Wohlbefinden[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
11.Durch die Impulse der Referate beachte ich mein eigenes Verhaltens[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
12.Durch die Informationen der Vorträge ist die Eins icht in mein eigenes Verhalten[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
13.Durch die Impulse der Referate stellen sich[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
14.Weil die Referate spezifische Themen behandeln, befasse ich mich privat mit[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten].
15.Im allgemeinen beeinflussen die Impulsreferate mein Wohlbefinden[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
16.In der Gruppe fühle ich mich[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
17.Die Diskussionsbeiträge der einzelnen Gruppenmitglieder sind [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
18.Ich teile meine persönlichen Meinungen und Erlebnisse in der Gruppe[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]c
19.Seit in der Gruppe gewisse Themen besprochen werden, diskutiere ich diese Themen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
20.Die Gruppendiskussionen beeinflussen im allgemeinen mein Wohlbefinden[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
21. Knirschen oder Pressen Sie Ihre Zähne auch tagsüber ?
22. Leiden Sie unter Verspannungen / Schmerzen vom Zähneknirschen ?
23. Wünsche, Kritik, Anregungen, Bemerkungen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
13. Tagebuch
Bitte jeweils morgens, vor dem Aufstehen ausfüllen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Spencer formuliert hier eine Vorstellung, die später, stark differenziert, auch als eine der Grundlagen Freuds Theoriegebäude, z.B. im Prinzip der Spannungsabfuhr oder Konversion diente.
[2] Hergeleitet aus dem griechisch ‚brychein‘ (knirschen) und ‚mania‘ (Wahnsinn, Begeisterung).
[3] Stammt aus dem griechischen ‚stoma‘ (Mund, Rachen) und ‚gnathos‘ (Wange).
[4] Masseter stammt aus dem griechischen ‘masasthai‘ (kauen). Das lateinische ‘tempus‘ (Schläfe) bezeichnet die Lokalisation des Muskelansatzes.
[5] Entsprechend ist die Wahrnehmung von Knirschepisoden nachts, sogar wenn diese zum Aufwachen führen, sehr gering (Maetzler, 1997, S.82).
[6] Deutsch: Anspannung, Druck.
[7] “Welch masochistisches Dilemma ergibt sich aus der Tatsache, dass die Spannung und der Schmerz, die von den Zähnen - diesen inneren Saboteuren verursacht werden, sich nur dadurch lindern lassen, dass man nur noch fester beisst? ” (Erikson, 1976, S.73)
[8] “Okklusion bezeichnet das Zusammenkommen der Zähne, das formanaloge Ineinandergreifen von Kauflächen. ” (Körber, 1995, S.74)
[9] Die wichtigsten Katecholamine sind Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin.
[10] Die zu den Gruppen angegebenen Alters- und Geschlechtsverteilungen weisen die typischen, ‘institutionsspezifischen‘ Verzerrungen auf (s.S.7).
[11] Descartes selbst verwies, anhand seiner programmatischen Forschungsmethodik, auf die Unvollständigkeit seiner dualistischen Analyse. Er formulierte nämlich zwei notwendige und hinreichende Schritte für einen sicheren Erkenntnisgewinn: 1. die Analyse eines Problems in seine kleinsten Bestandteile und 2. die darauf folgende Synthese anhand logischer Operationen (Hübli & Lübcke, 1995, S.126).
[12] Seit der Entwicklung der Quantentheorie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, hat das Konzept der mechanischen Kausalität einer relativistischen, probabilistischen, nichtlinearen Betrachtungsweise Platz gemacht: die Realität wird als vom Beobachter abhängig angesehen (Heisenbergsche Unschärferelation). Aus dem Einsteinschen Äquivalenzprinzip von Energie und Masse folgert, dass eine diesbezügliche ontologische Differenzierung aufgegeben werden muss. Für ein quantenphysikalisches Leib-Seele Modell, siehe Wolf, 1993.
[13] Das lateinisch ‘informare‘ bedeutet bilden, gestalten, organisieren. Demgemäss stellt der Zeichenempfänger, in einem kreativen Prozess, eine subjektive Anordnung seiner Wahrnehmungen her. Die damit im Begriff der Information implizierte Beziehung (und Beziehungsgestaltung) wird von den Kybernetikern (neben Energie und Materie) als dritte, den Aufbau der Welt bestimmende Qualität angesehen.
[14] In unserem konkreten Fall des menschlichen Organismus analysiert auch die Semiotik zirkuläre Relationen: aus Wahrnehmungen werden kognitive Ordungen erstellt, die, durch Erwartungen, usw., wiederum den Wahrnehmungsvorgang steuern. Die Semiotik setzt dabei jedoch auf einer anderen Analyseebene an. Während die Kybernetik die Strukturen eines Systems fokussiert, zielt die Semiotik auf die Analyse der innerhalb dieser Strukturen ablaufenden Prozesse.
[15] Piaget gebrauchte für dieses Phänomen den Begriff der ‘Epigenese‘, Lorenz denjenigen der ‘Fulguration‘; oder in den Begriffen der Gestaltpsychologie: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
[16] Als Anschauungsbeispiel hierzu mögen Fraktale, z.B. die Mandelbrot-Menge, dienen. Aufbauend auf einer einfachen, nichtlinearen Formel entstehen aus komplexen Zahlen, unabhängig vom Vergrösserungsgrad der Figur, immer wieder selbstähnliche Formen. Siehe z.B. Gleick, 1988.
[17] Umgebung bezeichnet jenen Teil der gesamten Umwelt, der für das optimale Funktionieren des Organismus relevant ist und damit von den Merk- und Wirkorganen als bedeutsam ‘wahr-genommen‘ wird.
[18] Experimentelle Befunde zu einem Krankheitsmodell, das auf den semiotischen Prämissen aufbaut, und somit Krankheit als Kommunikationsstörung versteht, sind für den psychischen Bereich bei v. Uexküll & Wesiack (1996, S.45) zu finden; für die molekulare, neuronale, kulturelle Analyseebene siehe Siegenthaler & Haas, 1992.
[19] Der Anteil der Patienten in allgemeinärztlichen Praxen, bei denen psychosoziale Probleme dominieren wird im Durchschnitt um 30% geschätzt, in Kliniken um 40%, in internistischen Kliniken um 50% (vgl. Speidel, 1996).
[20] Argelander, Balint, usw. betonten schon früh die Wichtigkeit einer empathischen Interaktion und entwickelten auch entsprechende, konkrete Handlungsstrategien (siehe beispielsweise Speidel, 1996).
[21] Placebos weisen sämtliche Eigenschaften anderer Kuren auf. Das sind, z.B. bezüglich einer Pharmakotherapie, eine dosis- und zeitabhängige Wirkung, eine von der zirkadianen Rhythmik abhängende Wirkung, das ganze Spektrum von Nebenwirkungen, Toleranz, Abhängigkeit und Entzugserscheinungen, usw. (vgl. Fricke, 1983). Nach Straus & Cavanaugh (1996, S.322) sind die Effekte gezielter Therapien denjenigen von Placebos jedoch überlegen.
[22] Aus dem lateinischen ‘nocebo‘ (ich werde schaden) und ‘placebo‘ (ich werde gefallen).
[23] Das heisst, diese Variablen zeigen in über 50% der berücksichtigten Studien, in denen insgesamt über 200 Faktoren untersucht wurden, signifikante Korrelationen mit der Compliance. Psychosoziale Variablen, wie Schichtzugehörigkeit, Bildungsniveau, Alter und Geschlecht korrelieren nur unbedeutend mit der Compliance (Lakin Phillips, 1988, S.84). Bei psychologischen Variablen liegen insgesamt kontroverse Befunde vor, sie erweisen sich jedoch bloss in rund 30% der Studien als bedeutsam (Lakin Phillips, 1988, S.85).
[24] Spezielles Röntgenverfahren, das überschneidungsfreie Panoramaaufnahmen des gesamten Kieferbereichs (je nach Schichttiefe können auch die Gelenke erfasst werden) liefert. Es wird, nicht zuletzt auch wegen der geringen Strahlenbelastung und der ökonomischen Herstellung, hauptsächlich in der kieferorthopädischen Praxis angewendet (Sonnabend, 1989, S.60).
[25] Nach der Angle-Klassifikation, sowie bezüglich der transversalen Gebissebenen, vgl. Mohl et al. 1990, S.188.
[26] Es wurden vor allem die Arbeits-, Balance- und RKP Vorkontakte untersucht, s. Mohl et al., 1990, S.213 ff.
[27] Für das Vorgehen und die metrische Analyse, siehe Dausch-Neumann, 1989, S.69 ff..
[28] Der Musculus pterygoideus dient dem Vorschieben des Unterkiefers, sowie dem Ausführen von Mahlbewegungen. Der Musculus sternocleidomastoideus dient der Neigung und Drehung des Kopfes; als Atemhilfsmuskel ist er auch an der Hebung des Brustkorbes beteiligt (siehe Abbildung 1, S.3).
[29] Spezifische Angaben zur Angemessenheit von Gruppentherapien lassen sich nach einer diesbezüglichen Literatursichtung von Toseland & Siporin (1986) nicht machen. Umgekehrt stellen auch psychosomatische Erkrankungen keine spezifische Symptomklasse bezüglich der Therapieindikation dar (Krause, Ebert, Czeschick & Müller, 1977).
[30] 12 der insgesamt 15 Teilnehmer waren schon vor Beginn des Behandlungspakets im Besitz einer Zahnschiene. Somit gehört die Zahnschiene lediglich bei 1 Person zum effektiven treatment.
[31] Momentan arbeitet der Zahnarzt an der Entwicklung einer zweiteiligen Schiene, die zugleich im Ober- und Unterkiefer plaziert wird. Während eine Schiene immer noch Möglichkeiten des ‘Einbeissens‘ (in die Zahnschiene) bot, ist mit einer zweiteiligen Schiene jegliche Grundlage dazu entzogen. Der wichtige Aspekt des Tragekomforts wird dabei keineswegs eingeschränkt.
[32] Neurophysiologisch ist dieses Gesetz mit der postkontraktorischen Hemmung, einer aus dem Alles-oder-nichts- Gesetz resultierenden Refraktärphase zu erklären. Für passive Dehntechniken der Kiefermuskulatur, s. Mohl et al., 1990, S.385 ff..
[33] Kleine, verhärtete, punktförmige Kontraktionen der Muskulatur, meist im Bereich einer Muskelspindelanhäufung. Aktive Triggerpunkte strahlen, begünstigt durch die hohe Dichte der Nozizeptoren in der Mundregion, Schmerzen in die lokale, sowie in die Referenzmuskulatur aus. Passive Triggerpunkte sind erst bei Berührung schmerzhaft. Als verursachend wird eine chronische Überbelastung in Korrelation mit entzündlichen Prozessen, Gelenkblockierungen, etc. angesehen (s. Borkmeier, 1995, S.147).
[34] Für Erkenntnisse und Prinzipien der Ergonomie, siehe z.B. Laurig, 1992.
[35] “Den Kopf halt kühl, die Füsse warm, das macht den besten Doktor arm.” (Volksmund)
[36] Auf dem Hintergrund des Situationskreiskonzepts ist es leicht verständlich, dass, ausgehend von Vorstellungsinhalten, solche breit gefächerten Reaktionen auf verschiedensten Integrationsebenen ausgelöst werden können. Für andere theoretischen Erklärungen zur Wirkungsweise des AT, siehe Binder & Binder, 1993.
[37] Für eine Übersicht siehe Dies, 1992.
[38] Für spezifische Angaben bezüglich der aktuellen Schmerztheorie und -forschung, siehe Egle, 1996.
[39] Für detaillierte Angaben, siehe Reinecker, 1986, S.160 ff..
[40] Die Rohdaten sind im Anhang, S.132 ff. aufgeführt.
[41] Schreibweise zur einfachen, eindeutigen Kennzeichnung der Items: die Ziffer vor dem Punkt bezeichnet die Fragebogennummer (1-3), die Zahl danach die Nummer der Items (1-20). Bei Itemangaben ohne Fragebogenspezifizierung wird Bezug auf alle Bogen genommen (und umgekehrt).
[42] Ein Teilnehmer ist Bäcker und musste jeweils um 4 Uhr früh wieder in Schaffhausen an der Arbeit sein.
[43] Die durchschnittliche Episodenlänge in der vorliegenden Stichprobe ist deutlich kürzer als bei Koller (1995) mit 10.8 sec., oder bei Maetzler (1997) mit 11.5 sec..
[44] Die Werte zur Bruxismusaktivität sind bloss in der 2.Nacht ‘vorher‘ nicht normalverteilt, die Verteilung ist linksschief. Betrachtet man den Verlauf anhand der Mediane, ist demnach ein geringer Anstieg der Bruxismus- aktivität von Nacht 1 zu Nacht 2 ‘vorher‘ zu erkennen. Eine tendenzielle Zunahme von den Adaptationsnächten zu den jeweiligen 2. Nächten zeigte sich auch bei Keller (1994).
[45] Das Schlafprofil der ersten Nacht zeigt folgende Kennwerte: St.1: 43.6%, St.REM: 6.7%, St.2: 39.1%, St.3: 6.8% und St.4: 3.8%. Entsprechend war die Anzahl der Episoden in Nacht 1 mit 126 wesentlich grösser, als in den übrigen Nächten (66/38/39). Zudem ist die Qualität des Bruxismus in Nacht 1 mit 97.6% gemischten und 2.4% phasischen Episoden klar anders , als in den übrigen Nächten (78.3% gemischt, 18.2% phasisch, 3.5% tonisch).
[46] Die Auftretenshäufigkeit dieser Artefakte liegt schätzungsweise klar unter 5%.
[47] Da das Antwortformat zu Item 22 ordinalskaliert ist, ist in dieser Zeile / Spalte Spearmans Rho wiedergegeben.
[48] Entspricht der Korrelation zwischen dem Resultat von Item x und den Wert im gesamten Fragebogen ohne Item x.
[49] Das lateinische ‘patiens‘ bedeutet ertragend, erduldend.
[50] Eine Einschleiftherapie wurde bei den Versuchspersonen 1, 2, 3, 5 & 6 vorgenommen.
[51] Dies gilt nicht für die Versuchsperson 2, der die Zähne zwischen der 2. & 3. Fragebogenmessung eingeschliffen wurden. Bei Vp2 blieb deshalb die Differenz Fb2 - Fb1 unberücksichtigt, während die Differenz Fb3 - Fb2 in der Abbildung 13 unter der Rubrik Fb2 - Fb1 aufgeführt ist.
[52] Es wurden hier absichtlich zwei, einander ausschliessende Subkategorien dargeboten. Bei dieser Kategorie muss, im Unterschied zu den übrigen Variablen, jeden Tag ein Kreuz gemacht werden. Das eröffnet die Möglichkeit, fehlende Werte überhaupt als solche identifizieren zu können.
[53] In den Schlaffragebogen von Görtelmeyer (1996, S.125) wird die Schlafqualität anhand von 5 Items erhoben. Das jeweilige Antwortformat ist eine 5-stufige Likertskala, wobei der Wert 5 dem positiven Pol entspricht. Über die 1500 Probanden seiner Normstichprobe ergab sich für die Schlafqualität ein Mittelwert von rund 3.8. Setzt man die theoretisch maximalen Mittelwerte von Görtelmeyer (=5) und unserer Erhebung (=1) gleich, so würde der Wert der Normstichprobe von 3.8 auf unserer Skala einem Wert von 0.76 entsprechen.
[54] Kanner et al. (1981) untersuchten 100 Personen während 9 Monaten mit der Hassles-Scale. Ähnlich wie bei unserer Skale konnte das Auftreten von einzelnen Stressoren einerseits (range:0-117), sowie andererseits deren Intensität (range 0-3) angegeben werden. Da der von ihnen berechnete Kennwert, der diese beiden Masse integriert hoch mit dem Mass der blossen Intensität korreliert (r=0.95) sind lediglich die diesbezüglichen Werte angegeben. Die mittlere Auftretenshäufigkeit von Stressoren lag bei 20.5 (von max. 117), was rund 17.5% entspricht.
[55] Anhand der Angaben zum Leidensdruck (Item 22) erkennen wir einen entsprechenden Trend auch in den vorliegenden Daten (siehe Abbildung 1, S.63). Vor der Abnahme des Leidensdrucks ist eine Zunahme zu verzeichnen; die Veränderungen sind jedoch ausgesprochen gering.
- Arbeit zitieren
- David Rudolf (Autor:in), 1998, Evaluation einer interdisziplinären, psychosomatischen Bruxismustherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99345
Kostenlos Autor werden










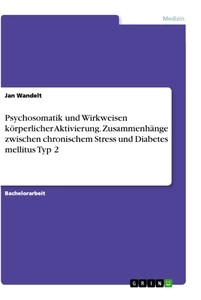
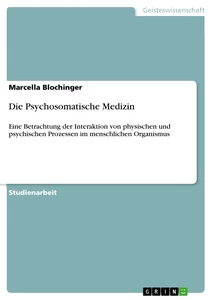










Kommentare