Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Aufgabe 1
1. Grundlagen von psychischen Störungen
1.2 Ursachen von psychischen Störungen
1.3 Integrative Störungsmodelle
1.4 Risiko- und Schutzfaktoren im Kontext psychischer Störungen
1.5 Empirische Studien zu Risiko- und Schutzfaktoren
1.6 Fazit
Aufgabe 2
2. Einflüsse auf Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
2.1 Soziale Unterstützung
2.3 Dysfunktionale Kognition
2.4 Fazit
Aufgabe 3
3. Psychologische Diagnostik
3.1 Fallbeispiel Schizophrenie
3.2 Diagnostischer Prozess bei Schizophrenie
3.3 Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgabe 1
1. Grundlagen von psychischen Störungen
Psychische Störungen werden nicht als grundlagenwissenschaftliche feststehende Entitäten, sondern für die Praxis sinnvolle Konstrukte nach dem jeweiligem aktuellen Stand der Forschung, definiert. Dies beinhaltet, dass sich die Definitionen von psychischen Störungen ändern können.1
Hinsichtlich der Diagnose einer psychischen Störung sind vier Kriterien zu beachten. Als erstes Kriterium gilt psychisches Leid oder Leidensdruck auf Seiten der betroffenen Person, was zudem ihr soziales Umfeld betreffen kann. Ebenso sind eine potentielle Selbst- oder Fremdgefährdung sowie eine Ich- Syntonie oder Ich-Dystonie (wird die Problematik als selbstverständlicher Teil der Person oder als fremd erlebt) zu nennen. Die Ich-Syntonie gilt insbesondere als Merkmal von Persönlichkeitsstörungen, die es den Betroffenen erschwert, die Problematik der eigenen Persönlichkeit wahrzunehmen.2
1.2 Ursachen von psychischen Störungen
Da es keine umfassende und allgemein gültige Gesamttheorie psychischer Störungen gibt, wird in (neuro-)biologische, psychodynamische oder kognitiv- behaviorale Perspektiven unterschieden.3
Die (neuro-)biologische Perspektive geht davon aus, dass psychische Störungen als spezifizierbare Defekte und Fehlfunktionen des Gehirns und des Nervensystems entstehen. Dieser Ansicht steht die psychodynamische Perspektive gegenüber, welche die Ursachen psychischer Störungen primär in intrapsychischen und nicht biologischen Prozessen konzeptualisiert. Der kognitiv-behaviorale Ansatz definiert die Ursachen psychischer Störungen als das Ergebnis einer fehlerhaften Wahrnehmung der Situationswirklichkeit, fehlerhafter Schlussfolgerung oder unpassender Problemlösung.4
1.3 Integrative Störungsmodelle
Um psychische Störungen in ihrer Komplexität angemessen verstehen zu können und vorschnelle Schlüsse in Bezug auf die Störungsursachen sowie erforderliche Interventionen zu vermeiden, dienen integrative Störungsmodelle wie das Vulnerabilitäts-Stress-Modell oder das bio-psycho-soziale Modell als adäquater Rahmen.
Das bio-psycho-soziale Modell dient als Grundlage eines ganzheitlichen Krankheitsverständnisses und ist aktuell das kompakteste Konzept zur Erklärung von Gesundheit und Krankheit. Gesundheit wird innerhalb dieses Modells anhand der Existenz autoregulativer Kompetenzen innerhalb des Systems der Person dargestellt und nicht als absolute Störungsfreiheit. Krankheit entsteht, wenn der Organismus diese autoregulativen Kompetenzen zur Bewältigung von Störungen nicht zur Verfügung stellen kann und dadurch wichtige Regelkreise für die Aufrechterhaltung und Funktionstüchtigkeit des Individuums überfordert sind bzw. ausfallen.5
Der Grundsatz dieses Modells ist die Theorie über eine hierarchische Grundordnung der Natur. Alle Bereiche dieser Hierarchie ergeben ein organisiertes, dynamisches System, das aus einer Verbindung verschiedener Ebenen besteht. Der Mensch ist ein eigenständiges System aus Physis und molarem Verhalten, trägt Subsysteme in sich (z. B. Organe, Gewebe) und ist selbst Subsystem eines größeren Systems (z. B. 2-Personen-Beziehung, Familie) innerhalb eines Netzwerks. Das Verhältnis dieser Systemelemente unterliegt einer sogenannten Kausalität. Geistige Phänomene sind somit emergent, da sie sich nicht als reduktionistische Beschreibung mittels der Kenntnis von partiellen Einzelteilen erklären lassen. Vielmehr ergibt sich aufgrund der vertikalen und horizontalen Vernetzung der unterschiedlichen Ebenen ein paralleler Ablauf eines Ereignisses, der durch eine Veränderung auf einer Ebene eine Veränderung auf anderer Ebene erwirkt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Bio-psycho-soziale Funktionsmodell von Gesundheit.
1.4 Risiko- und Schutzfaktoren im Kontext psychischer Störungen
Zwei zentrale Begriffe der Entwicklungspathologie sind Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Risikofaktoren werden in der klinischen Psychologie als potentiell, mittelbar oder unmittelbar auf die Gesundheit auswirkende Störung bezeichnet und als die erhöhte Wahrscheinlichkeit beschrieben, eine bestimmte Krankheit zu erwerben.6 7 Diese werden in interne (z. B. genetische Anfälligkeit für Erkrankungen) und externe Risikofaktoren (Stressoren aus dem Umfeld eines Kindes) unterschieden und können spezifische Merkmale (z. B. Regulationsstörung im Säuglingsalter), besondere Erfahrungen (z. B. Drogenkonsum) oder einschneidende Ereignisse (z. B. Scheidung) darstellen.8 Externe Risikofaktoren werden weiterhin unterschieden in distale Risikofaktoren, welche sich indirekt auf die Entwicklung eines Kindes auswirken (z. B. psychische Gesundheit der Eltern) und proximale Risikofaktoren (z. B. Auffälligkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion). Ob ein Risikofaktor tatsächlich negative Auswirkungen auf die Entwicklung hat, hängt davon ab, in welcher Häufigkeit, Dauer und Kontinuität er auftritt und wie die subjektive Bewertung ausfällt.9
Risikofaktoren wirken nicht unabhängig von Alter und Entwicklungsstand einer Person. Dies bedeutet, dass die Bewertung eines Zustandes als Risikofaktor davon abhängt, welche zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben aktuell bestehen. So stellt bspw. eine sehr enge und altersunangemessene Bindung zu den Eltern während der Jugendzeit einen Risikofaktor zur Entwicklung der Eigenständigkeit dar, während eine starke Bindung im Kindesalter als Schutzfaktor gilt.10
Schutzfaktoren und Ressourcen werden ebenso wie Risikofaktoren in kindbezogene (interne) und umgebungsbezogene (externe) Faktoren unterschieden. Interne Faktoren können beispielsweise eine hohe Intelligenz oder ein günstiges Temperament sein, externe Faktoren werden als Merkmale der Familie oder des sozialen Umfeldes definiert, die sich z. B. auf stabile emotionale Beziehungen beziehen.11 Da Schutzfaktoren durch Risikofaktoren aktiviert werden und somit bereits vor der Entwicklung einer Störung bestehen, sind sie zur Abmilderung oder Aufhebung von Risikofaktoren fähig.
Einen weiteren Einfluss auf Risikofaktoren bietet die Resilienz. Diese Form von erworbener Widerstandsfähigkeit lässt Menschen trotz widriger Umstände Bewältigungskompetenzen entwickeln, um mit ihren Belastungen angemessen umgehen zu können.12 Grundsätzlich kann daher gesagt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kind gut und gesund entwickelt, proportional zu den vorhandenen protektiven Faktoren steigt.13 Diese Faktoren werden auch als „Kette schützender Faktoren“ bezeichnet, deren Glieder sich gegenseitig verstärken und miteinander interagieren.14 Fehlentwicklungen sind somit das Resultat eines relativ ungünstigen Verhältnisses von Risikofaktoren zu Schutzfaktoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Zusammenhang Inzidenz mit Risiko- Schutzfaktoren nach Becker (1997).15
1.5 Empirische Studien zu Risiko- und Schutzfaktoren
Als bahnbrechende empirische Studie der Entwicklungspsychopathologie gilt die Isle-of-Wight-Studie des britischen Psychiaters Michael Rutter (1989), der zwischen 1964 und 1974 Kinder, die auf der Isle of Wight aufgewachsen waren, untersuchte. Zunächst wurden alle Eltern und Lehrer von Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren, die dort die Schule besuchten, mittels Fragebögen zur psychischen Gesundheit der Kinder befragt. Daraufhin wurden jene Kinder einem halbstrukturierten Interview unterzogen, deren Risiko eine psychische Krankheit zu entwickeln als hoch eingeschätzt wurde. Vier bis fünf Jahre später wurden die Kinder erneut interviewt. Es konnte festgestellt werden, dass zum ersten Messzeitpunkt sechs bis sieben Prozent der Kinder die ICD-Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllten, dies jedoch zum zweiten Messzeitpunkt bereits auf 21 Prozent zutraf. Rutter fand heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwicklen von der Anzahl der Risikofaktoren abhängt, denen das Kind ausgesetzt ist.16
Studien wie das Mannheimer-Kohortenprojekt (das beispielsweise die Erkenntnis hervorbrachte, dass nicht der Verlust eines Elternteils als solcher zu einer psychischen Störung führt, sondern das Fehlen eines Ersatzes), oder der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (die Schutzfaktoren hinsichtlich resilienter Jugendlicher untersuchte), sowie die Kauai-Studie lieferten wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung von psychischen Störungen. Letztere wurde von Emmy E. Werner und Ruth S. Smith (1982) als Längsschnittstudie zu Langzeitfolgen von Risikobedingungen entwickelt und beschäftigt sich mit sogenannten „Risikokindern“, die es trotz schwieriger Bedingungen schafften, sich positiv zu entwickeln. Über einen Zeitraum von 40 Jahren (1955 bis 1995) wurden 698 im Jahr 1955 geborene Kinder begleitet, beobachtet und interviewt. Etwa ein Drittel der Kinder war einer hohen Risikobelastung wie chronischer Armut oder familiärer Disharmonie ausgesetzt. Zu verschiedenen festgelegten Messzeitpunkten wurde die Entwicklung der Kinder von ExpertInnen (KinderärztInnen, PsychologInnen etc.) untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass zwei Drittel der Kinder lern- oder verhaltensgestört waren oder sogar psychische Krankheiten entwickelt hatten. Ein Drittel jener Kinder, die mehreren Risikobelastungen ausgesetzt waren, hatte sich trotz widriger Bedingungen erfolgreich entwickelt und zeigte resilientes Verhalten. Dieser Erfolg wird den Schutzfaktoren zugeschrieben, darunter beispielsweise eine positive ElternKind-Beziehung, Ehrgeiz oder ähnliche Determinanten.17
1.6 Fazit
Durch zahlreiche Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Entstehung einer psychischen Störung nicht auf einem Faktor im Sinn einer conditio sine qua non zurückgeführt werden kann, sondern vielmehr ein Konstrukt mehrerer Risikofaktoren ist. Somit lässt sich für die Entstehung einer psychischen Störung zusammenfassen, dass in vielen Fällen multifaktorielle Ursachen zu Grunde liegen. Dies bedeutet einerseits, dass eine genetische Veranlagung nicht notwendigerweise eine Krankheit nach sich zieht, und unterstreicht andererseits die Bedeutsamkeit der Faktoren, die vor der Erkrankung einer psychischen Störung schützen.
Aufgabe 2
2. Einflüsse auf Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
In der klinischen Psychologie wird die Aktivierung psychischer Störungen als Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren beschrieben.
So wird beispielsweise im Diathese-Stress-Modell angenommen, dass zu relativ zeitstabilen Prädispositionen aktuelle Stressoren hinzukommen, die eine Vulnerabilität aktivieren und zu einer psychischen Störung führen. Dieses Modell gilt durch seine Zeitverlaufs- und dynamischen Aspekte als Ergänzung zum bio-psycho-sozialen-Modell und beschreibt den Grad der „Empfänglichkeit“ zur Entwicklung einer bestimmten Störung.18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Diathese-Stress-Modell.19
Die jeweilige „Schwellenüberschreitung“ kann durch geringere Stressoreffekte bei höherer Vulnerabilität schneller sowie bei geringerer Vulnerabilität und vergleichsweise größeren Stressoren langsamer erreicht werden.20
Soziale Einflussfaktoren bedingen sich wechselseitig und lassen sich bezüglich der Entstehung psychischer Störungen in vier Faktoren-Gruppen unterteilen: soziodemographische Faktoren (z. B. Sozialschicht, Geschlechtsunterschiede); Einflüsse der sozialen Umgebung (z. B. Rollenstress, soziale Etikettierung); dysfunktionale Verarbeitung sozialer Informationen (z. B. Dysfunktionale Attributationsmuster); Dysfunktionale Kognitionen bzw. Kompetenzdefizite.21 Als die wichtigsten psychischen Diathesen gelten langanhaltende Gefühle von Abhängigkeit und Hoffnungslosigkeit, high-expressed-emotions innerhalb der Familie, unerfüllbare soziokulturelle Normen, Missbrauchauserfahrungen oder andere traumatisierende Erlebnisse. Aktuelle Forschungsergebnisse konnten Verbindungen zwischen psychischen und biologischen Diathesen aufzeigen. So wiesen Forscher der Max-Planck-Gesellschaft nach, dass traumatische Erlebnisse im Kindesalter das Erbgut im Gehirn sowie die Regulation der Stresshormone lebenslang verändern und das Risiko von psychiatrischen Erkrankungen erhöhen. Durch eine Hyperaktivität der Hypothalamus- Hypophysen-Nebennieren-Achse veranlassen geringe Reize eine übergeordnete Ausschüttung von Stresshormonen, welche auf Dauer zu Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen führen kann.22
Psychobiologische Theorien implizieren, dass Stressreaktionen als Folge von extremem Stress eng verknüpft sind mit hormonellen und neurologischen Veränderungen die zu psychischen Störungen führen. Zudem können auch intrusive Erinnerungen physiologische Veränderungen und biochemische Ausschüttungen verursachen.
Im psychodynamischen Modell nach Sigmund Freud wird eine psychische Störung primär auf eine frühkindliche Konfliktsituation zurückgeführt, die nachfolgend verdrängt wurde. Unbewusste Konsequenzen dieses Konflikts und das Ausmaß der Verdrängung aktivieren demzufolge die psychische Erkrankung.
[...]
1 Vgl. Wittchen/ Hoyer (2011), S. 7f.
2 Vgl. Caspar/ Pjanic/ Westermann (2018), S. 7.
3 Vgl. Wittchen/ Hoyer (2011), S, 11f.
4 Ebd. (2011), S. 19.
5 Vgl. Egger (2005), S. 3.
6 Vgl. La Marca, (2016), S. 66.
7 Vgl. Faller/ Reusch/ Vogel (2016), S. 343.
8 Vgl. Petermann/ Maercker/ Lutz/ Stangier (2011), S. 123f.
9 Vgl. Rolfe (2019), S. 106.
10 Vgl. Petermann/ Maercker/ Lutz/ Stangier (2011), S. 125.
11 Ebd., S. 126.
12 Vgl. Rolfe (2019), S. 105-107.
13 Vgl. Grulke (2013), S. 291.
14 Vgl. Bengel/ Meinders-Lücking/ Rottmann (2009), S. 14.
15 Vgl. Petermann/ Maercker/ Lutz/ Stangier (2011), S. 30.
16 Ebd. (2011), S. 125.
17 Vgl. Petermann/ Maercker/ Lutz/ Stangier (2011), S. 127f.
18 Vgl. Petermann/ Maercker/ Lutz/ Stangier (2011), S. 28.
19 Ebd., S. 29.
20 Ebd., S. 29f.
21 Vgl. Pinquart (2011), S. 320f.
22 Vgl. Meyer (2013), S. 138.
- Arbeit zitieren
- Kai Hövelmann (Autor:in), 2000, Korosion und Korrosionsschutz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98477
Kostenlos Autor werden
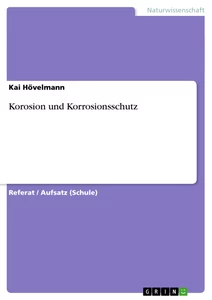

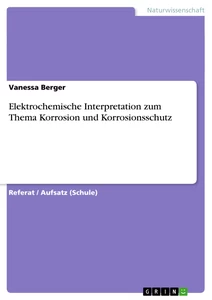
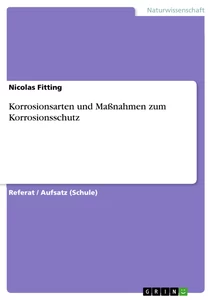


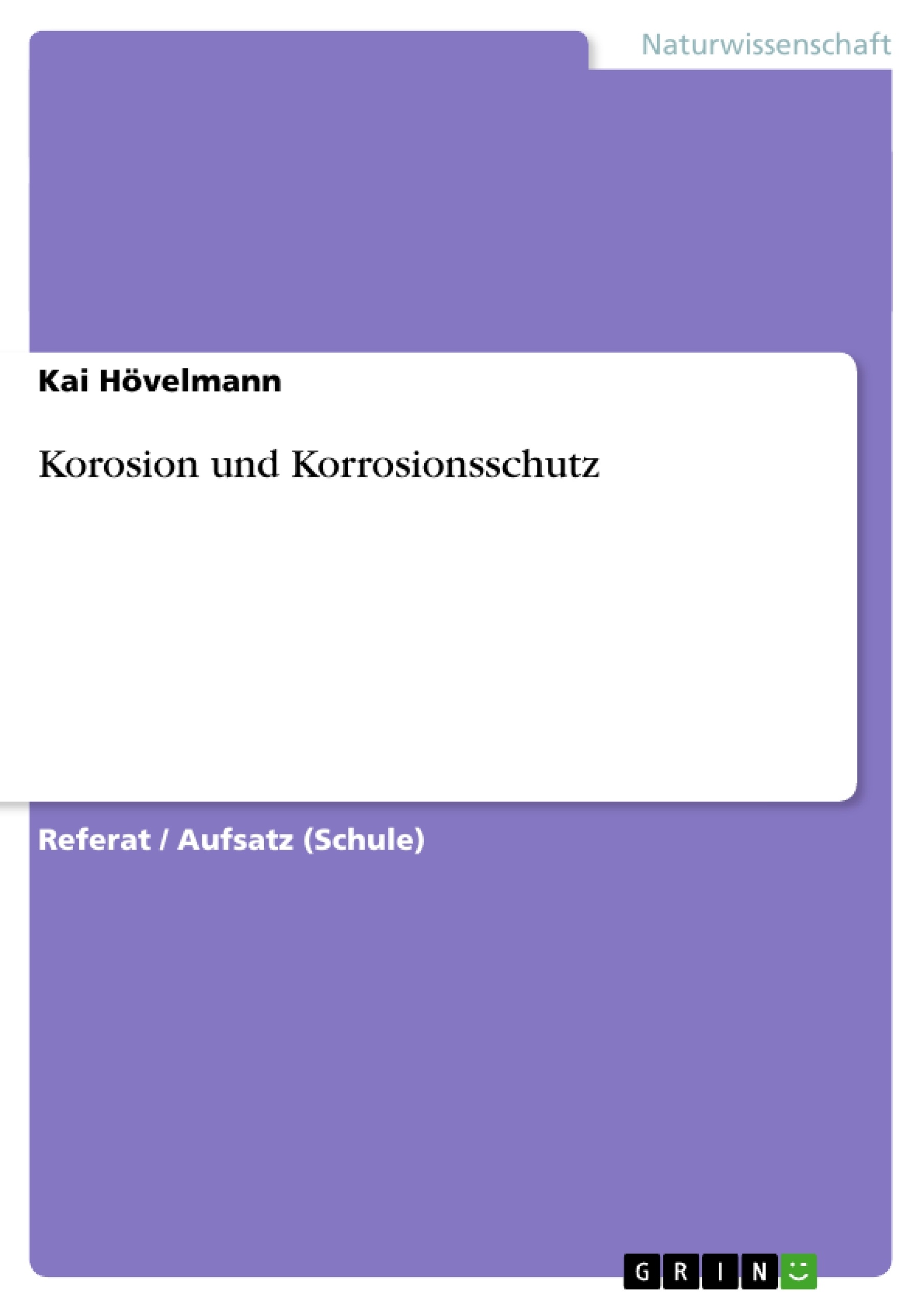

Kommentare
Schüler.
Ich fande die Arbeit echt gut, weil es relativ gut erklärt war.
Das einzige was zu bemängeln ist, ist das die Gleichungen nicht so gut erklätr sind.