Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I Vorbemerkungen
II Dionysos als Gestalt der griechischen Mythologie
II.1.Dionysos - Sohn der Semele und des Zeus
II.2.Dionysos - Zagreus
II.3.Wesensart, Erscheinungsbild und Wirkung des Dionysos
III Dionysos als der "große Freudebringer" im "Feenland der Lieder": Friedrich von Schillers Die Götter Griechenlandes
IV Dionysos als "Jahrhunderts Genius": Johann Wolfgang von Goethes Wandrers Sturmlied
V Dionysos als "der kommende Gott": Friedrich Hölderlins Brot und Wein 1
VI Dionysos als Symbol für einen der "Kunsttriebe der Natur" - das Prinzip des Dionysischen in Friedrich Nietzsches Die Geburt
VI.1.der Tragödie aus dem Geiste der Musik
VI.1.1.Nietzsches Kritik an der Geburt der Trag
VI.2 ö die Dionysos im späteren Werk Nietzsches
VI.3.Exkurs: Mythologie und Metaphysik - Begriffsklärung
VI.3.1.Nietzsches "ästhetische Metaphysik"
VI.3.1.1.Das Dionysische und das Apollinische bei Nietzsche
VI.3.1.2.Apollinische Kunst
VI.3.1.3.Dionysische Kunst Die attische Tragödie als Versöhnung apollinischer und dionysischer Kunst
VII Bibliographie
Auf Dionysos, den efeubekränzten, heb
ich mein Lied an!
Mächtig donnert er, Zeus' und der hochgefeierten Mutter
Semele strahlender Sohn! Vom Vater, dem Herrscher, empfingen
Nymphen in schönen Haaren das Kind und reichten die Brust ihm,
nährten es sorgsam auf Nysas Hügeln.
Homerische Hymnen, 26, An Dionysos
I Vorbemerkungen
Die Welt der antiken Griechen hat seit jeher die Menschen späterer europäischer Kulturen immer wieder fasziniert. Auf den Gebieten der Bildenden Kunst, des Dramas, der Architektur, der Philosophie, der Naturwissenschaft gilt die hellenische Hochkultur immer noch als Vorbild. Die Gestalten und Geschichten aus der griechischen Mythologie, die olympischen Götter, die Schicksale der mythologischen Helden sind uns durch Kunst und Literatur bis heute erhalten geblieben. Einen zentralen Stellenwert scheint dabei für das Abendland der Mythos des Gottes Dionysos zu haben, Werke, die sich mit dem Dionysischen beschäftigen sind zahlreich und vielfältig.
Bekannt ist Dionysos vor allem als der Spender des Weines. Und der Wein wird zu einem gewissen Grade auch heute noch mit Mythos belegt. Weinbau, Kellerei und fachgerechter Weingenuß gelten heute noch als die hohe Schule weniger Eingeweihter, wirkliche Kenntnis über Wein bedeutet Prestige und die Zugehörigkeit zu einem "Kreis der Erlauchten". Wein ist auch ein zentrales christliches Symbol bei der Feier des heiligen Abendmahls und in vielen biblischen Gleichnissen.
Eine hauptsächlich mit Dionysos verknüpfte Vorstellung ist die des dionysischen Taumels, Schwärmen und Rausch, Bilder von orgiastischer Besessenheit, Lust, Verzückung, rasenden Frauen, Satyrn, wilden Tänzen und Musik. Dionysos beinhaltet Geburt, Leben, Tod und Wiederkehr, seine Widersprüchlichkeit und Vielgestalt fasziniert und bietet eine Grundlage sowohl für naive Schwärmerei als auch für tiefgreifende Betrachtungen über das Sein. Der Einfluß der hellenischen Kultur allgemein und auch speziell des Dionysos-Mythos auf die abendländische Kultur ist vielfach erkennbar. Aus dem Dionysoskult hervorgegangen ist zum Beispiel die Kunstform des Dramas, welche auch für die heutige Kunst eine wichtige Rolle spielt. Die Stoffe der griechischen Antike sind zum heutigen Tag immer wieder bearbeitet worden und auch für moderne Schriftsteller nach wie vor interessant und faszinierend, man denke zum Beispiel an das bekannte Werk Ulysses von James Joyce.
Zum besseren Verständnis und als Basis für die Herausarbeitung von Parallelen und Unterschieden, soll in dieser Arbeit zunächst die mythologische Gestalt des Dionysos betrachtet und beschrieben werden. Problematisch dabei ist es, daß Dionysos als mythologische Gestalt nicht wirklich isoliert betrachtet werden kann, da sich unser Wissen um die antiken Mythen natürlich auch aus Quellen in der antiken Literatur und der bildlichen Darstellung nährt. Es handelt sich also bereits um literarische oder künstlerische Bearbeitungen. Allerdings stehen diese dem ursprünglichen Mythos natürlich noch sehr nahe.
Die Betrachtungen über das dionysische Prinzip Nietzsches mögen im Vergleich zu den vorangegangenen Kapiteln vielleicht überproportioniert erscheinen. Allerdings ist diese etwas weiter ausholende Betrachtung gerechtfertigt durch den großen Umfang und die Komplexität der Konzeption Nietzsches, ihren Zusammenhang mit seinen späteren Werken und ihren prägenden Stellenwert in der modernen Dionysos-Rezeption:
Measured by its impact on subsequent thought, The Birth of Tragedy was one of the most fruitful works of nineteenth century scholarship. Since its publication classicists have invoked the differences between Apollo and Dionysos as manifestations of an essential duality in Greek religion, whether this duality be labelled Apolline/Dionysian, Olympic/chtonic, Homeric/pre-Homeric, Indo-European/Mediterranean, or legalistic/mystical.2
Hier zeichnet sich auch deutlich eine sich von der in den anderen Texten unterscheidende Betrachtungsweise ab: Dionysos erfährt eine Wandlung von der mythologischen Wesenheit zum metaphysischen Begriff des Dionysischen.
Bei der Recherche dieses Themenkomplexes stößt man auf ein schier unendliches Reservoir immer neuer Quellen und inhaltlicher Bezüge. Die hier ausgewählten Texte bieten Bezüge zu Schelling, Fichte, Schlegel, Schopenhauer und Kant, um nur einige wenige zu nennen, und das schließt noch nicht einmal die Vielzahl der antiken Bearbeitungen des Dionysos-Motivs mit ein. Es mußte also im Rahmen dieser Arbeit eine Reduktion des Untersuchten auf einige ausgewählte Textbeispiele stattfinden. Die Vielzahl der Texte, die sich mit Dionysos oder dem Dionysischen im weitesten Sinne befassen, zeigt aber den starken Einfluß und die Wirkung des Dionysos-Mythos vor allem in Literatur und Philosophie. Die vorliegende Textauswahl ist bemüht, solche Beispiele zu zeigen, an denen sich verschiedene Betrachtungsweisen des Phänomens ausmachen lassen.
Schillers Die Götter Griechenlandes stellt einen wehmütigen, elegischen Rückblick aus einer modernen, rationalen, aufgeklärten und naturfernen Welt auf eine beseelte Natur und sinnlich präsente Götter dar und ist Ausdruck eines gespürten Verlustes. Goethes Wandrers Sturmlied ist gleichsam eine Dithyrambe, ein Preislied auf Dionysos als "Vater Bromius", der zum Genius des Jahrhunderts ausgerufen wird, eine Invokation des Gottes durch den Dichter (versinnbildlicht in der Figur des Wanderers), der gegen Kälte und Regen anzukämpfen hat. Wandrers Sturmlied betrachtet insbesondere die Rolle des Dichters, die Anforderungen, die der Verlust der mythischen Götterwelt an den Poeten stellt und geht der Frage nach, inwieweit er diesen gerecht werden kann. Hölderlins Brot und Wein begnügt sich nicht mit der wehmütigen Erinnerung, hier wird Hoffnung auf eine neue Zeit geweckt. Brot und Wein macht den Versuch einer Rückführung zum Mythos und verbindet den Dionysos-Mythos mit dem christlichen Glauben. Brot und Wein als Gaben des Dionysos und als Symbole des Abendmahls verbinden Himmel und Erde, Vergangenheit und Gegenwart und der Dichter als Prophet verkündet die Ankunft eines neuen Gottes. Nietzsches Geburt der Tragödie macht nicht den Versuch eine neue Mythologie zu gestalten. Es findet eine Abstrahierung der Mythosgestalt des Dionysos zum metaphysischen Konzept des Dionysischen statt. Dies alles stellt Nietzsche unter den Blickwinkel der Ästhetik, da er das Dasein lediglich als ,,ästhetisches Phänomen" gerechtfertigt sieht, und der Kunst, welche für ihn als die "eigentlich metaphysische Tätigkeit dieses Lebens" gilt. Das Dionysische gilt Nietzsche zudem als eine Art Gegenlehre zum Christentum, dem er sehr kritisch gegenüber steht.
II Dionysos als Gestalt der griechischen Mythologie
Walter F. Otto schreibt in seiner Einleitung zu Dionysos. Mythos3 und Kultus:
Das ganze Altertum hat Dionysos als Spender des Weines gepriesen. Aber man kannte ihn auch als den Rasenden, dessen Gegenwart die Menschen besessen macht und zur Wildheit, ja zur Blutgier hinreißt. Er war der Vertraute und Genosse der Totengeister. Und zu seinem Gottesdienst gehörte das dramatische Spiel, das die Welt um ein Wunder des Geistes bereichert hat. Auch die Frühlingsblumen zeugten von ihm; der Efeu, die Pinie, der Feigenbaum waren ihm lieb; aber hoch über all diesen Segnungen im Reiche der vegetativen Natur stand die tausendfach gebenedeite Gabe des Weinstocks. Dionysos war der Gott des seligsten Rausches und der verzücktesten Liebe. Aber er war auch der Verfolgte, der Leidende und der Sterbende, und alle, die er liebte und die ihn begleiteten, mußten mit ihm das tragische Schicksal teilen.4
Dionysos gilt zumeist als Gott thrakischen beziehungsweise lydisch-phrygischen Ursprungs, der erst auf dem Land- oder dem Seewege nach Griechenland gebracht wurde und erst gegen einige Widerstände seine Anerkennung und Verehrung in Griechenland durchsetzte. OTTO merkt jedoch an, daß es sich hierbei vermutlich um eine "Wiederbelebung uralter Gottesdienste"5 gehandelt haben muß. Das heißt, die mit dem Namen des Gottes verbundenen Vorstellungen und Riten seien nichts vollkommen Neues gewesen. Unterstützt sieht er diese These darin, daß sich keine Erinnerung an einen "gewaltsamen Einbruch" oder ein "Gefühl der Fremdheit" in den griechischen Dionysos-Mythen erhalten habe.6
Dionysos gilt als der Überbringer des Weines, aber er ist auch der rasende, wahnsinnige, trunkene Gott. Seine Anwesenheit löst bei den Menschen (insbesondere den Frauen) Besessenheit und Wildheit aus, so daß sie junge Tiere und mitunter sogar andere Menschen zerreißen. Er zeigt sich in der Vegetation, Frühlingsblumen, Efeu, Pinie und Feigenbaum gelten als Symbole für den Gott - und dem voran natürlich die Weinrebe. Er wird oft auch mit den unterirdischen Mächten in Verbindung gebracht, ist Gott des Lebens und des Todes zugleich. Diese Widersprüchlichkeit und Vielgestaltigkeit des Dionysos kommt in den verschiedenen Mythen seiner Zeugung und seines Untergang zum Ausdruck. Die Mythologie kennt ihn als Dionysos, den Sohn des Zeus und der Sterblichen Semele, aber auch als Zagreus den "großen Jäger", den "Zerreißer", der aber selbst von den Titanen zerrissen wird. Geburt, Lust, Leiden, Tod und Wiederkehr spiegeln sich in den verschiedenen Mythen und prägen das Verständnis vom Wesen des Dionysos.
II.1. Dionysos - Sohn der Semele und des Zeus
Dionysos, auch Bakchos genannt, ist ein Sohn des Zeus und der Kadmostochter Semele. Die eifersüchtige Hera rät der Geliebten ihres Gatten Zeus, sie solle verlangen, er möge sich ihr in seiner wahren Gestalt nähern. Zeus erscheint dieser auf ihre Bitte hin unter Donner und Blitz. Die sterbliche Semele verbrennt in dem göttlichen Blitzstrahl. Zeus kann den noch ungeborenen Knaben retten, schützt ihn mit kühlenden Efeuranken vor der Glut, in der die Mutter verbrannte, näht ihn in seinen Schenkel ein und trägt ihn dort bis zur Geburt aus. Dionyos ist somit gleichsam zweimal geboren und wird durch das Heranwachsen im göttlichen Leib des Vaters selber zum Gott. Der neugeborene Knabe wird von Hermes zu den Nymphen von Nysa gebracht, in deren Obhut er aufwächst. Seine spätere Erziehung übernimmt Silenos7.
Die Mutter Semele darf später aus der Totenwelt zu den olympischen Göttern aufsteigen. Der Sohn begibt sich selbst in das Totenreich, um mit der Mutter wieder heraufzusteigen. "Denn in Lerna erzählte man, daß Dionysos dort durch die unergründliche Tiefe des Alkyonischen Sees zu den Toten niedergefahren sei, um Semele heraufzuholen (Pausan. 2, 37, 5), und auch in Trozen zeigte man den Ort, wo der Gott mit seiner Mutter aus dem Hades emporgestiegen sein sollte (Pausan. 2, 31, 2)."8 Durch die Geburt des Dionysos stirbt die Mutter und wird durch das Hinabsteigen des Sohnes zur Unsterblichkeit erweckt. Hier spiegeln sich Geburt, Tod und Wiederkehr im Leben des Dionysos selbst.
II.2. Dionysos - Zagreus
In den Mysterien der Orphiker war er der Sohn des Zeus und der Unterweltsgöttin Persephone, wurde Zagreus genannt, der "große Jäger", und als der mächtigste aller Götter gefeiert. Die Titanen schnitten, von der eifersüchtigen Hera angestachelt, den Dionysos in Stücke und verschlangen ihn; das Herz des Knaben setzte Hera ihrem Gatten Zeus als Speise vor. Darauf gab Zeus einem zweiten Dionysos das Leben. Aus der Asche der Titanen entstanden die Menschen, in denen durch den von den Titanen verschlungenen Dionysos ein Teil des göttlichen Wesens wirkt, jedoch auch die Sündhaftigkeit der Titanen.9 Der Zagreus-Mythos zeigt das Leiden und Sterben des Gottes selbst. Zur Bedeutung des Zagreus-Mythos für das Wesen der Dionysos Gestalt schreibt OTTO: "Und eben dieser Mythos läßt uns klar erkennen, daß das Sterben des Gottes in seinem Wesen begründet ist. Denn er macht den Dionysos zum Verwandten der unterirdischen Gewalten, und was ihm widerfährt, ist nichts anderes, als was er selbst tut." (ebd. S. 172/73). Der Jäger Zagreus wird selber zum Gejagten, der Zerreißer wird selber zerrissen. In dem Zagreus-Mythos gleicht Dionysos einem seiner Opfer. "Wie die Frauen im Dionysischen Wahn ihre Knäblein zerstückeln, wie die Mänaden nach seinem Vorbilde die jungen Tiere zerreißen und verschlingen, so wird er selbst als Kind von den Titanen überwältigt, in Stücke gerissen und verzehrt." (ebd. S. 174).
II.3. Wesensart, Erscheinungsbild und Wirkung des Dionysos
Dionysos tritt oft in der Gestalt eines Tieres in Erscheinung (Bock, Löwe, Schlange, Stier), ihm als Begleiter untergeordnet sind die im Volksglauben seit je verbreiteten Natur- und Walddämonen wie etwa Nymphen, Siléne und Satyrn. In menschlicher Form wurde er durch eine bärtige Maske dargestellt.10 In der bildenden Kunst der Antike wandelt sich die Darstellung des Gottes vom Typus des älteren, bärtigen Mannes in langem Gewand zu dem eines schönen, aber unatlethischen, weichlichen Jünglings. Zum Symbol der Maske schreibt OTTO: "Das erschütternde Hereintreten des Gottes und seine unausweichliche Gegenwart hat ein Symbol gefunden, das noch mehr sagt, als die bisher besprochenen Kultformen; ein Bild, aus dem das verwirrende Rätsel seiner Doppelheit hervorblickt und mit ihm der Wahnsinn: Das ist die Maske."11 Er verweist auf das Phänomen, das die Maske keine Rückseite habe, also kein "volles Dasein". Die Maske hat eine unmittelbare Präsenz und rückt das, was hinter ihr verborgen liegt doch in "das unsagbar Ferne" (ebd. S. 84). In dem Symbol der Maske sieht Otto wie auch in dem plötzlichen, machtvollen Erscheinen des Gottes (Epiphanie) sehr deutlich die Widersprüchlichkeit des Gottes ausgedrückt: "Die letzten Geheimnisse des Daseins und Nichtseins starren den Menschen mit ungeheuren Augen an. Dieser Geist der Doppelseitigkeit, der den Dionysos und sein Reich [...] von allem, was olympisch ist, unterscheidet, kehrt [...] in allen Formen seines Wirkens immer aufs neue wieder. Er ist der Grund der Berückung und der Verwirrung, die alles Dionysische hervorruft. Denn er ist der Geist eines wilden Wesens. Sein Kommen bringt die Raserei." (ebd., S. 84/85).
Verknüpft wird mit dem Gott Dionysos allgemein vor allem das Bild des dionysischen Schwärmens, des Zuges des Bakchos. "Die Anhänger des D. sind des Gottes voll (,,Enthusiasmos"!), sie treten aus ihrer alltäglichen Lebens- und Wesensart heraus (,,Ekstasis"!) und folgen in begeistertem Rausche dem Schwarm (Thiasos) des Gottes über Berge und durch Wälder."12 An diesem Treiben nehmen nur Frauen teil, die als Bakchai, Mänaden, Thyiaden oder Bakchantinnen bezeichneten Frauen schmücken sich mit Kränzen aus Efeu und sind mit Rehfellen und Thyrsosstäben13 ausgestattet. Tanzend mischen sie sich unter die Satyrn und Nymphen, die Begleiter des Dionysos. In ihrem orgiastischen Rausch zerreißen sie mit den bloßen Händen junge Tiere und verzehren das rohe Fleisch. Begleitet wird der Zug von lärmender Musik. (Dionysos trägt auch den Beinamen Bromios: der Lärmende). Der Gott selbst erscheint bei den Bacchannalien in Tiergestalt und läßt Wein, Milch und Honig aus dem Boden quellen. Er gilt auch als Lysios, Lyaios, als Löser und befreit die Menschen von Sorgen und sprengt Fesseln, auch wilde Raubkatzen, macht er sanft und zahm, Panther ziehen sein Gespann. Somit vereinen sich in ihm die positiven Seiten des Rausches wie Befreiung, Loslösung aber auch das Negative, der Wahn und die totale Selbstvergessenheit. Das häufige Vorkommen des Phallos bei den dionysischen Festen und auf bildlichen Darstellungen zeigen auch die Verbindung des Gottes zu Sexualität und Fruchtbarkeit.
Ähnlich wie in dem Symbol der Maske, zeigt sich in dem dionysischen Lärm ebenso die starke, mächtige, plötzliche Präsenz des Gottes, der sich niemand entziehen kann, auf der anderen Seite beinhaltet der dionysische Lärm auch die Totenstille; darin zeigt sich abermals die Dualität des Gottes.
Der Lärm, mit dem Dionysos selbst und sein göttliches Gefolge einherfährt, der Lärm, den der menschliche Schwarm, von seinem Geiste getroffen, entfesselt, ist ein echtes Symbol des geisterhaften Ansturms. Mit dem Schrecken, der zugleich Bezauberung ist, mit der Aufregung, die einer Lähmung gleicht, mit der Überwältigung aller natürlichen und gewohnten Sinnesempfindungen tritt das Ungeheure plötzlich ins Dasein herein. Und in der höchsten Steigerung ist es, als wäre das wahnsinnige Getöse in Wirklichkeit die tiefste Stille. (OTTO, S. 85)14
In der Bekämpfung seiner Gegner, zum Beispiel von Menschen, die sich gegen die Einführung dieses dionysischen Schwärmens zur Wehr setzen, zeigt sich der Gott grausam.
"Die Töchter des Königs Minyas von Orchomenos, die Dionysos nicht feiern wollten, wurden hart gestraft: der Gott schlug sie mit Wahnsinn, so daß sie einen Knaben wie ein Hirschkalb zerrissen. Unwiderstehlich ist seine Macht, plötzlich erscheint er und nimmt jähe Rache." (Peterich/Grimal, S. 38). Auch der König von Theben, Pentheus, der die Feier der Bacchanalien verhindern will, wird von der grausamen Strafe des Dionysos getroffen: er wird von seiner eigenen Mutter Agaue, die sich bei den Mänaden befindet, in ihrer Raserei mit einem Eber verwechselt und getötet.
• Aber der Sohn des Echion beharrt. Nicht sendet er fürder, Sondern er selbst geht hin, wo geweihet zur Feier Cithäron Festlich erschallt von Getön und lautem Geschrei der Bacchanten.
[...]
Außen von Wald umkränzt liegt fast auf der Mitte des Berges Frei von Bäumen ein Feld, zu sehen von jeglicher Seite.
Hier nun, wie er das Fest unheiligen Auges betrachtet, Sieht ihn die Mutter zuerst, und zuerst hineilend in Tollheit Wirft sie zuerst nach dem eigenen Sohn den verletzenden Thyrsus.
,,Kommt!" - so ruft sie dann - ,,kommt her, ihr beide, o Schwestern!"Dort auf das riesige Tier, das streift durch unsere Felder, Dort auf den Eber die Jagd!" Da stürzt auf den einen der ganze Rasende Schwarm, und zu Hauf verfolgen den Bebenden alle Ihn, der bebt nunmehr, nun minder Vermessenes redet, Nun sich selber verdammt, nun, daß er gefrevelt, bekennet.
Als doch blutet sein Leib: ,,Autonoe, Schwester der Mutter", Fleht er, ,,hilf! O laß dich rühren den Schatten Actäons!" Doch nichts weiß von Actäon ihr Herz, und des Bittenden Rechte Reißt sie hinweg. Ein Ruck der Ino verstümmelt die andre. Arme gebrechen ihm nun, die klagend er hübe zur Mutter; Aber ihr zeigend den Rumpf, der beraubt der zerstückelten Glieder, Ruft er: ,,Mutter, oh sieh!" Bei dem Anblick jauchzet Agaue, Wirft den Nacken umher und schüttelt das Haar in den Lüften, Und das entrissene Haupt umfassend mit blutigen Fingern Schreit sie: ,,Io, mein Werk ist der Sieg, ihr begleitenden Weiber!"15
Diese sehr plastische Schilderung der Tötung des Pentheus durch seine Mutter und die sie begleitenden Mänaden aus den Metamorphosen Ovids zeigt sehr deutlich die blutrünstige Grausamkeit, die der dionysische Wahn beinhaltet.
Die Verehrung des Gottes kam aber nicht nur in dem orgiastischen Taumel der dionysischen Schwärmer zum Ausdruck. "[...] im Frühling aber streuten sie Blumen und sangen heitere Lieder. Im November und Dezember wurden burleske Tänze getanzt, aus denen die dramatische Dichtung der Griechen hervorgegangen ist: so wurde Dionysos zum Gott des Theaters."16
In all diesen Ausprägungen kann man Dionysos auch in der deutschen Literatur wiederfinden. Seine Widersprüchlichkeit, sein Geschenk des Weines, der dionysische Taumel, alle diese in der griechischen Mythologie begründeten Assoziationen mit dem Gott Dionysos, haben seine Darstellung in der Literatur geprägt. Die Faszination, die von dem Bild der Vereinigung von Geburt und Tod, von Rausch, orgiastischem Taumel, aber auch der absoluten Grausamkeit in einer sehr vielschichtigen, rätselhaften und umfassenden Göttergestalt ausgeht, erklärt vielleicht den häufigen Rückgriff der Schriftsteller auf das Dionysos-Motiv. Mit ihrer Vielschichtigkeit bietet die mythologische Gestalt des Dionysos viele Ansatzpunkte für eigene Deutungen. Einige dieser Betrachtungsweisen des Dionysos in der deutschen Literatur sollen nun im Folgenden dargestellt werden.
III Dionysos als der "große Freudebringer" im "Feenland der Lieder": Friedrich von Schillers Die Götter Griechenlandes
Schiller veröffentlichte Die Götter Griechenlandes in zwei Versionen, einer früheren (1788) und einer verkürzten und in einigen Aussagen des Gedichtes abschwächenden späteren Fassung (1793). Diese Arbeit möchte sich hier vor allem an das Gedicht in seiner früheren Fassung halten und die spätere lediglich an einigen Stellen zum Vergleich heranziehen. Als Grundlagen für die Betrachtungen zu diesem Gedicht dienten vor allem die Interpretation des Gedichtes von Benno von Wiese und das Kapitel über Die Methodik des Idealismus in Schillers philosophischen Schriften in Ernst Cassirers Idee und Gestalt.17
Mit den ersten beiden Strophen setzt das Gedicht gleich zur Klage über den Verlust der griechischen Götterwelt an. "Wie ganz anders war es da!". Die dritte Strophe schließt mit einem kurzen Blick auf die Gegenwart - "Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen - Seelenlos ein Feuerball sich dreht," - an und leitet einen Strom von Bildern der griechischen Mythologie ein. Diese Bilder werden immer eindringlicher und in der Mitte der zehnten Strophe wendet sich sogar das Tempus für einen Moment ins Präsens.
Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger, Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer. Faun und Satyr taumeln ihm voran, Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und die Wangen des Bewirters laden Lustig zu dem Becher ein.
[eigene Hervorhebung]
In dieser Strophe beschreibt Schiller das Auftreten des Dionysos mit seinem Gefolge, daß durch den Wechsel des Tempus besonders eindringlich und unmittelbar empfunden wird. Es scheint so, als sei für Schiller die Beschreibung des dionysischen Festes mit seinem rauschhaften Taumel in besonderem Maße ein Sinnbild für die Einheit von Mensch und Natur oder etwa eines, daß sich am ehesten noch den Menschen seiner Zeit erschließt und mitteilt. In dieser Beschreibung des dionysischen Taumels gipfelt dann die schwärmerische Bilderflut.
Die anschließende elfte Strophe teilt sich; zunächst blickt sie noch einmal auf das Bild des dionysischen Festes, indem der Gott selber an dem Fest seiner "Geschöpfe" teilhat:
Höher war der Gabe Wert gestiegen,
Die der Geber freundlich mit genoß,
Näher war der Schöpfer dem Vergnügen, Das im Busen des Geschöpfes floß.
Daran schließen sich die ersten Fragen des Gedichtes an die Zeit an, aus der es auf diese Götterwelt zurückblickt.
Nennt der Meinige sich dem Verstande? Birgt ihn etwa der Gewölke Zelt? Mühsam späh' ich im Ideenlande, Fruchtlos in der Sinnenwelt.
Doch zunächst werden diese Fragen wieder von eindringlichen Bildern der vergangenen mythologischen Welt verdrängt. Sie ziehen sich aber durch die Strophen 13 bis 16 hindurch als direkte Fragen ("Wohin tret ich? Diese traurge Stille - Kündigt sie mir meinen Schöpfer an?") oder dergestalt, daß Phänomene angesprochen werden, die es in der griechischen Götterwelt noch nicht gab. ( "Damals trat kein gräßliches Gerippe - Vor das Bett des Sterbenden.").
In der 17. Strophe gewinnt dann die Klage über das Verlorengegangene erneut die Oberhand, wird in der 18. Strophe noch einmal versucht zu verdrängen, bis sie in der 19. Strophe dann mit Macht wieder einsetzt. "Schöne Welt, wo bist du? - Kehre wieder, - Holdes Blütenalter der Natur!". Die Welt der Götter hat sich für den Betrachter nun endgültig in das "Feenland der Lieder" zurückgezogen.
Die Ursache für diesen Rückzug der Götter sieht das Gedicht in "des Nordens winterlichem Wehn" (Strophe 20) und dem Erscheinen des christlichen Gottes. ("Einen zu bereichern unter allen, - Mußte diese Götterwelt vergehn.") Inwieweit dies allerdings als ein direkter Angriff auf den christlichen Monotheismus zu verstehen ist, soll im Folgenden noch genauer geklärt werden.
In den anschließenden Strophen bis zur 24. Strophe wird die moderne Welt mit ihrer aufgeklärten Weltsicht, ihrer Einsicht in die Gesetze der Naturwissenschaft ("Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr, - Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere - Die entgötterte Natur!") charakterisiert und der zuvor beschriebenen Welt der mythologischen Griechen, in denen Mensch und Natur noch eins zu sein scheinen, entgegengestellt.Die Schlußstrophe beschreibt WIESE: "[...] daß am Ende in der Schlußstrophe der verzweifelte Wunsch nach Erlösung sich im sprachlichen, über die Versgrenzen hinübergreifenden Strömen, gepreßt und wuchtig zugleich, entladen mußte." (ebd., S. 326). Er verweist darauf, daß in 24 Strophen nur zweimal der formal dialektische Aufbau der Strophe in der Abgrenzung der vier ersten von den vier letzten Verszeilen durchbrochen und damit eine besondere Betonung erreicht werde.
Am deutlichsten ist das in der 14. Strophe: ,,Still und traurig senkt' ein Genius / Seine Fackel."
Solches vom Gefühl getragene Hereinholen des Vergangenen in das Gegenwärtige, das sich dann doch durch die Gegenwart der eigenen Zeit und ihre Seelenlosigkeit um diesen Gewinn in wachsendem Maße betrogen sieht - es geht in der zweiten Fassung in seiner inneren Dramatik weitgehend verloren, weil es Schiller jetzt sehr viel mehr auf den Einklang und Wohlklang des elegischen Tons ankam und nicht so sehr auf die vom Dichter bis zum Zerreißen erlittene Spannung der beiden Zeitalter. (ebd., S. 326/327)
Zu erörtern bleibt nach diesen inhaltlichen und formalistischen Betrachtungen, inwieweit das Gedicht eine direkte Kritik am Gott des Christentums darstellt, beziehungsweise wogegen es sich sonst wendet und, welche Forderung aus dem "verzweifelten Wunsch nach Erlösung" der Schlußstrophe an die Gegenwart gestellt wird.
Bald nach dem Erscheinen des Gedichtes in Wielands ,,Merkur", stößt es auf heftige Kritik. Das Zurücksehnen der griechischen Götterwelt wird als ein Angriff auf den christlichen Monotheismus und eine Verherrlichung des Polytheismus gedeutet. Zu diesen Vorwürfen äußert sich Schiller in einem Brief an Körner im Dezember 1788, indem er darauf verweist, der Gegenstand des Gedichtes sei ein "idealischer", nicht ein "wirklicher": "Der Gott, den ich in den Göttern Griechenlands in den Schatten stelle, ist nicht der Gott der Philosophen oder auch nur das wohltätige Traumbild des großen Haufens, sondern er ist eine aus vielen gebrechlichen schiefen Vorstellungsarten zusammengeflossene Mißgeburt. - Die Götter der Griechen, die ich ins Licht stelle, sind nur die lieblichen Eigenschaften der griechischen Mythologie in eine Vorstellungsart zusammengefaßt." (WIESE, S. 324).18 Ein Kunstwerk sei nur seiner eigenen Ästhetik verpflichtet, ,,wenn es auch `mittelbar' auf diesem Wege am Ende sich, wie jede Schönheit, `in allgemeine Wahrheit auflösen läßt'. (ebd.)
WIESE kritisiert diese Verteidigung Schillers, da sie nicht wirklich eine Antwort auf alle Fragen gebe.
Darf er einen Gegenstand ,,idealisch" nennen, der sich gerade mit dem Strömen der Zeit, mit dem geschichtlichen Schicksal der Religionen beschäftigt? Was ist mit der einen Vorstellungsart gemeint, in der die ,,lieblichen Eigenschaften der Mythologie" zusammengefaßt sind? Falls Schiller damit andeuten will, daß seine griechischen Götter keine Wirklichkeit besitzen, sondern nur Träume der Phantasie, nur ,,romantische" Bilder der dichterischen Sehnsucht sind, so nimmt er damit seinem Gedicht das Schwergewicht, und die eindringliche Klage über das verlorene wäre dann nur eine Klage über ein Entschwundenes, das auch früher nicht eigentlich anwesend, sondern immer schon ein idealischer Traum war. (ebd., S. 324)
Idee und Wirklichkeit stehen sich gegenüber, in den Göttern Griechenlands ausgedrückt in der "ernsten, strengen Göttin" Wahrheit und ihrer "sanft'ren Schwester", der Schönheit. Inwieweit aber gibt das Gedicht eine befriedigende Antwort, wie die zurückgesehnte Schönheit wieder in die Wirklichkeit zurückgerufen werden kann?
In der zweiten Fassung des Gedichtes ist die augenscheinliche Kritik am christlichen Monotheismus deutlich abgemildert. Die letzte Strophe ist stark verändert worden, sie stellt nicht mehr Wahrheit und Schönheit gegenüber und versucht nicht den Konflikt des Gedichtes aufzulösen, sondern weist tröstend auf das Überleben der schönen Götterwelt im Gesang hin.
Ja, sie kehrten heim und alles Schöne,
Alles Hohe nahmen sie mit fort,
Alle Farben, alle Lebenstöne,
Und uns blieb nur das entseelte Wort.
Aus der Zeitflut weggerissen, schweben
Sie gerettet auf des Pindus Höhn:
Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muß im Leben untergehn.
Dies könnte die oft geäußerte These stützen, daß Schillers eigentliche Kritik sich mehr gegen die Aufklärung und die "moderne mechanische Auffassung der Natur" (WIESE, S. 331) und gegen die abstrakten Anschauungen moderner Philosophie wende. Allerdings verschmelzen Aufklärung und christliche Weltsicht in dem Gedicht zu dem "abstrakten Gott des aufgeklärten Denkens" (ebd. WIESE). Dieser sei der Darstellung des Gedichtes nach, nicht mehr ein Gott der Liebe, sondern hier "von seiner - nach Schillers Meinung in ihm angelegten - Konsequenz, nur noch vernünftiger Gott zu werden, interpretiert." Von diesem Gott und die von ihm regierte Welt aus gibt es kein Zurück mehr in eine mythologische von Göttern durchdrungene Welt. Die Götter überleben nur noch als "schöne Wesen aus dem Fabelland".
Der aufgeklärte Gott ist unnahbar, gegen ihn der beste der Sterblichen ein "Wurm" - dem gegenüber steht die Welt der griechischen Götter, zu denen auch Sterbliche aufsteigen konnten (das Gedicht nennt hier zum Beispiel Semele, die Mutter des Dionysos, vergl. Kapitel II.1.), oder die sich mit Sterblichen vermählten. Der Gott der Aufklärung läßt sich nur schwerlich im "Ideenlande" festmachen und ist in der "Sinnenwelt" überhaupt nicht zu entdecken.
Sein Wesen ist ,,Wahrheit" - Schiller nennt diese eine ,,ernste strenge Göttin" -, aber Wahrheit übersteigt alle dem Menschen gesetzten Grenzen, Wahrheit kann nicht erlöschen, nicht frei machen, und so verlangt der Dichter mit einer fast verzweifelten Inbrunst nach der ,,sanft'ren Schwester", der Schönheit, wohingegen die Wahrheit für eine andere, jenseitige Welt aufgespart bleiben soll. (ebd. WIESE, S. 332)
So sehnt sich Schiller in den Göttern Griechenlandes nach einer Zeit, in der Wahrheit und Schönheit noch identisch oder zumindest nicht so unvereinbare Gegensätze zu sein schienen, wie es sich in der aufgeklärten Welt darstellt. Eine Zeit, "Da der Dichtkunst malerische Hülle - sich noch lieblich um die Wahrheit wand!". Das Gedicht bietet allerdings keine Hoffnung auf eine Rückführung der modernen Menschen zu einer mythologischen Einheit mit der Natur. Es scheint bei diesem resignierten Herbeisehnen zu bleiben, die Götter bleiben "schöne Wesen aus dem Fabelland", dem "Feenland der Lieder" und ihre Unsterblichkeit "im Gesang" soll dem modernen Menschen zum Trost gereichen.
WIESE bezeichnet der Definition Schillers in seiner Schrift Ü ber naive und sentimentalische Dichtung folgend19, Die Götter Griechenlandes als eine "Idylle".
Dieser Erhöhung der griechischen Götterwelt zu einem Ideal und einem "Gegenstand der Freude" sind somit auch einige der dunkleren Züge der antiken Götterwelt zum Opfer gefallen. Die Welt des mythologischen Totenreiches, des Hades, die von Novalis später zum Beispiel in der fünften der Hymnen an die Nacht als so qualvoll erdrückend, trostlos und grausam empfunden wird, wird "durch den Schleier sanfter Menschlichkeit" zu einer Welt der "frohen Schatten", um die "schöne lichte Bilder scherzten".
Auch Dionysos und sein Gefolge erscheinen in den Göttern Griechenlandes recht zurückhaltend und gesittet. Die rasenden Mänaden erscheinen gezähmt, werden zu ,,muntren Thyrsusschwingern", (vergl. II.3. "wirft [...] den verletzenden Thyrsus"), ihre ,,Tänze loben seinen Wein". Dieser heitere Reigen hat wenig mit den wilden Frauen gemein, die Ovid in seinen Metamorphosen beschreibt (vergl. II.3.) und Dionysos selbst wird zum "Bewirter" mit vollen roten Wangen, die "lustig zu dem Becher" einladen. Er ist - trotz der besonders eindringlichen präsentischen Beschreibung des dionysischen Festes - lediglich ein Teil dieser idealisierten, idyllischen Götterwelt, seine Dualität kommt hier nicht zum Ausdruck.
IV Dionysos als "Jahrhunderts Genius": Johann Wolfgang von Goethes Wanderers Sturmlied
Die Ausführungen in diesem20 Kapitel stützen sich zu großen Teilen auf die Betrachtungen von Max Kommerell zu Goethes freien Rythmen21, die Interpretation zu Wanderers Sturmlied von Emil Staiger22 und den Aufsatz von Jochen Schmidt über Pindar als Genie-Paradigma im 18. Jahrhundert.23.
Der Ton in Goethes Wanderers Sturmlied ist ein völlig anderer als der in den Göttern Griechenlandes. Hier wird nicht elegisch das Verschwinden der Götter beklagt, Goethe erkennt die Historizität der antiken Mythologie an und versucht nicht, sie wieder ins Leben der Gegenwart zu rufen. Christoph JAMME schreibt dazu in seinem Aufsatz über Goethes Begegnung mit dem Mythos:
Sein Leben lang hat Goethe seine religiöse Auffassung in Figurationen der griechischen Mythologie auszudrücken gesucht. Im Unterschied zu vielen seiner Zeitgenossen hat er dabei aber die Überzeugung vom historischen Wesen von Mythos und Mythologie nie aufgegeben. [...] Der Mythos wird von Goethe also schon früh begriffen als genuin poetische (Bilder) Transformation archaischer Lebensform; die Bilder der Mythologie mit ihren vielfältigen Deutungsmöglichkeiten appellieren an die Einbildungskraft und bekommen so ihre poetische Valenz.24
Dem Gedicht ist auch deutlich Goethes Bewunderung für die Oden Pindars anzumerken, wobei er sich natürlich nicht bloßer Nachahmung hingibt. Vielmehr dienen sie ihm als Orientierung, um sich selber in seiner Dichtung über literarische Konvention, das Rokoko und die französische Mode hinwegzusetzen und etwas Eigenes, Natürliches, Ursprüngliches zu schaffen.
Not indeed that Wanderers Sturmlied should be taken as an imitation of Pindar. Conscious imitation was contrary to all Goethe's principles at this time. But Pindar's example appeared to him to justify the abandonment of all rules of form. Like the old dithyrambist he sang without plan, just as the imagination poured forth ist glowing images.25
Weitere Einflüsse Pindars können gesehen werden in der Gefühlsübermacht, die bisweilen fast die Artikulation in zusammenhängenden Sätzen unmöglich macht ("Weh! Weh! Innre Wärme, Seelenwärme, Mittelpunkt!") oder in der Eigenkreation von Wörtern, Machtwörtern wie "Feuerflügeln", "Blumenfüssen", "bienensingender", "honiglallender", "blumenglücklicher" oder "Flutschlamm", grammatisch ungewöhnlichen oder sogar unmöglichen Konstruktionen "Dich, dich strömt mein Lied", "Glühte deine Seel Gefahren, Pindar, Mut". Allerdings kann es dabei kaum um eine Imitation der sehr formalisierten zum Liedvortag gedachten Lyrik Pindars gehen.
Goethe macht im Sturmlied recht eigensinnig Gebrauch von den mythologischen Gestalten, indem er sie in den Kontext der unmittelbar persönlich erfahrenen Situation des Dichters als Wanderer setzt. KOMMERELL spricht in diesem Sinne hier vom "Mythos als persönliches Symbol" (ebd., S. 435).
Das Gedicht lebt von der Spannung zweier Realitäten, der Dichter ist "glühend und mit dem Vorrecht des Glühenden Weltmittelpunkt" (ebd., S. 440), als Wanderer ist er aber der Situation ausgeliefert von den Naturgewalten bedroht zu sein, er ist vom Regen durchnäßt und friert. Eigentlich müßte er, der glüht und sich vom Genius begleitet fühlt, über diesen Elementen (dem Wasser, der Erde und der Verbindung aus beiden, dem Schlamm), stehen.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Nicht der Regen, nicht der Sturm
Haucht ihm Schauer übers Herz [...]
Den du nicht verlässest, Genius,
Wirst ihn heben übern Schlammpfad
Mit den Feuerflügeln.
Also spricht er die Elemente göttlich, redet mit der Sprache des Poeten zu ihnen. "So hält er sich auf der Höhe seines mythischen Bewußtseins" (ebd., S. 441). Er macht sich "göttergleich" als Schaffender. Der naturnahe "schwarze feurige Bauer", der ihm begegnet und im Gegensatz zu ihm nicht von den Musen und Charitinnen umschwärmt wird, die es zur Wärme, dem inneren Glühen des Dichters zieht, läßt sich nicht entmutigen, obwohl ihn bei seiner Heimkehr nur sein Herdfeuer und die Gaben des Dionysos (Bromius) erwarten. "Und ich [...] soll mutlos kehren?" fragt Goethe beschämt. Er sieht in dieser persönlichen Erfahrung bei seiner Wanderung vom Regen überrascht zu werden die "Zweideutigkeit der dichterischen Existenz" (ebd., S. 441). Ähnlich deutet STAIGER das Gedicht, indem er darauf verweist, daß eben darin die Not des Dichters bestehe, "daß sich mit schlotterndem Gebein kein glühender Hymnus anstimmen läßt". Es sei sogar im Grunde eine komische Situation, "die nur deshalb nicht lächerlich wird, weil es ernsthaft auf eine Kraftprobe angelegt ist und im Augenblick allzu viel auf dem Spiel steht" (ebd., S. 69).
Im Zuge dieser Betrachtungen allerdings interessiert die Frage: Welche Rolle spielt Dionysos für Goethes Wander? Er wird als der Genius des Jahrhunderts in die Gegenwart gestellt. Es finden sich in der Literatur verschiedene Deutungsmöglichkeiten des Ausrufs "Vater Bromius, - Du bist Genius, - Jahrhunderts Genius, ". Eine Möglichkeit der Interpretation ist es, Dionysos lediglich in seiner mythologischen Eigenschaft als Gott des Weines zu verstehen, das würde bedeuten, daß Goethe sagen will, daß sein Jahrhundert die Inspiration lediglich aus dem Rausch des Weines bezieht, wo es sie aus der inneren Glut beziehen sollte. Humphry TREVELYAN argumentiert dagegen, Bromius sei hier in einem tieferen, weit komplexeren Sinne gemeint:
This means, according to Morris (Max Morris, 1915, Anm.), that "our century finds in wine the inspiration which should arise from the inner glow (innre Wärme, Seelenwärme)". Bromius is then simply a label for the effect of wine on the human constitution [...] But this is impossible; Goethe would never at this period have put the Greek gods to the old misuse. [Zitat, Strophe 6, hier ausgelassen "Soll der...", Anm.] That is Bromius, the universal vitalising power, without whose gifts life in its simplest form would be impossible for man, and without whom there would be no higher inspiration. He is "the god of wine", because wine reveals in mysterious concentration the vital spirit that Bromius provides for all life. To turn such conceptions into poetry Goethe needed symbols and he found them ready to his hand in the Greek myths.26
KOMMERELL deutet die Anrufung des Gottes Dionysos als einen Teil der ironischen Wende des Gedichtes:
Dem glühenden Gott, der die Dithyramben eingibt, und den er so nötig hat, vindiziert er die Herrschaft über das Jahrhundert, das den Dichter darauf anweist, sich an eigner Glut die Hände zu wärmen. Wer nicht glüht, ist verloren. Auf dem Recht des Glühenden beruht der Herrschaftsanspruch des Dichters. Aber indem er sich, die Modedichtung verwerfend, zur Entfesselung des Dithyrambenschwungs bekennt, ereilt ihn in zerhackten und stockenden Rhythmen, denen ordentlich der Atem ausgeht, die unmythische, undichterische Not, und er höhnt sich selbst, daß er nicht genug Glut habe, um bis zu seiner Hütte zu waten (ebd., S. 441).
Aufschluß geben könnte, wenn man die Nennung Pindars in diesem Zusammenhang als Anspielung auf ein festgelegtes Geniekonzept liest. Wenn man Pindar hier als Sinnbild oder Inbegriff des Genies sieht, wie es der Aufsatz von Jochen SCHMIDT nahelegt. Er verweist auf die Nennung Pindars in Goethes Brief an Herder vom 10. Juli 177227 und im Sturmlied: "Er konnte sich damit in einem topologisch fixierten Rahmen bewegen: in einem Horizont schon etablierten Selbstverständnisses der Geniebewegung. Jede dieser [...] Anspielungen auf Pindarische Wendungen, das für uns Abgelegenste also, gehörte damals zum Repertoire genialischer Selbstverständigung." (ebd., S. 65). Auch TREVELYAN weist darauf hin, daß für Goethe Pindar sinnbildlich für den gott-berauschten Dithyrambensänger, den Verächter aller Regeln und Konventionen, die den Fluß der Inspiration hemmen, stand.28 So beschwört Goethes Wanderer wie ein Dithyrambensänger den Gott Dionysos, und schreibt ihm die Herrschaft über das Jahrhundert zu. Er solle dem Jahrhundert somit das sein, was "innre Glut" für "Pindar" war. Also das, was Pindars Genie am "glühen" hielt, das was "Phöb Apoll" der "Welt", also was das Licht (der Sonne) als Lebensspender für die Natur sei.
In diesem Sinne ließe sich auch die folgende Strophe verstehen. "Weh! Weh! Innre Wärme - Seelenwärme - Glüh' entgegen - Phöb Apollen, - Kalt wird sonst - Sein Fürstenblick - Über dich vorübergleiten, - Neidgetroffen - Auf der Zeder Kraft verweilen, - Die zu grünen - Sein nicht harrt." Ist der Wanderer also nicht von dieser Kraft erfüllt, die Pindar (als Sinnbild des Genies) zu eigen war und für die Bromius hier steht, wird der "Fürstenblick" ihn nur kurz "kalt" streifen, nicht wahrnehmen und dafür die Zeder beneiden, die sein Licht nicht braucht, um zu grünen, da sie auch in der dunklen Jahreszeit ihre grüne Farbe behält.
In einem anderen Gedicht Goethes, dem Wanderer heißt es:
Du geboren über Resten
Heiliger Vergangenheit,
Ruh ihr Geist auf dir!
Welchen der umschwebt,
wird in Götterselbstgefühl
Jedes Tags genießen.
Voller Keim, blüh auf,
Des glänzenden Frühlings
Herrlicher Schmuck,
Und leuchte vor deinen Gesellen!
Und welkt die Blütenhülle weg,
Dann steigt aus deinem Busen
Die volle Frucht und reift der Sonn entgegen!
Nach diesem Götterselbstgefühl, der Kraft aus dem eigenen "heilig glühend Herz" (Prometheus), nach der Selbstbehauptung des vom Genius beflügelten Dichters ringt hier der Wanderer in der widrigen Situation des plötzlich hereinbrechenden Regens. Er beschwört noch einmal "Jupiter Pluvius", den Gott des Regens, den sein Lied "strömen" und ihn so eins mit der Natur machen soll, doch wird er beim Anblick der Hütte von der Realität eingeholt, das strömende Lied wird zum müßig rinnenden "Nebenbach" und ihm bleibt nur zu seiner Hütte zu "waten". Goethe "steht noch da und gafft" wo Pindar seine Pfeile auf das "Wolkenziel" schießt. In Wanderers Sturmlied stellt Goethe somit die Herausforderung an den Dichter dar, der darum bemüht ist, durch seine Poesie von innerer Glut, dem Genius beflügelt, sich über die Realität zu erheben und damit dem der Neuzeit verlorengegangenen mythischen Einssein mit der Natur mit einer neuen "Frucht" entgegenzutreten. Er will den Mythos nicht wiederbeleben, sondern auf seinen "Resten" aus eigener Schaffenskraft etwas neues errichten.
V Dionysos als "der kommende Gott": Friedrich Hölderlins Brot und Wein
Der Wein und sein Gott spielen in der Dichtung Hölderlins eine große Rolle (vergl. Kapitel 3 Repertoire, Struktur und Gesichtspunkt im Werk bei BEHRE29, S. 63-181), die Elegie Brot und Wein ist nur eines von vielen seiner Werke, die sich mit dem Dionysos-Mythologem auseinandersetzen. In der Literatur finden sich unter anderem Bezüge zu Hyperion, Der Archipelagus, Tod des Empedokles und Wie wenn am Feiertage. Hölderlin war stark beeinflußt von einer Faszination für die hellenische Kultur, beschäftigte sich aber in diesem Zusammenhang auch mit Kant und Spinoza.
Aus Woltershausen berichtet er in Briefen an den Bruder vom Jahre 1794, daß Kant und die Griechen, was das Wissenschaftliche betrifft, jetzt seine einzige Beschäftigung seien, und daß sich ihm dieser herrliche Geist immer mehr enthülle. Und noch nach Jahren, nachdem er selbst bereits in einem wesentlichen Zuge sich von Kants abstrakter Freiheitslehre getrennt hat, erkennt er ihre Wirkung auf die Zeit und ihre unbedingte Erforderlichkeit für die Zeit ohne Einschränkung an. Die Deutschen hätten keinen heilsameren Einfluß erfahren können, als den der neuen Philosophie, die bis zum Extrem auf Allgemeinheit des Interesses dringe und das unendliche Streben in der Brust des Menschen aufde>und die daher, wenn sie schon zu einseitig sich an die große Selbständigkeit der Menschennatur halte, doch als Philosophie der Zeit die einzig mögliche sei (CASSIRER, S. 119).
Im Rahmen dieser Arbeit kann selbstverständlich nicht der volle Umfang der Hölderlinschen Auseinandersetzung mit dem Dionysos-Mythos und sein Bezug zur neuen Philosophie berücksichtigt werden. Die Elegie Brot und Wein ist hier deshalb ausgewählt worden, weil sie sich in ihrer Interpretationsweise des Dionysos-Mythos von den übrigen hier besprochenen Textbeispielen deutlich unterscheidet, und sich hier vor allem ein deutlicher Unterschied zu der im folgenden Kapitel besprochenen Metaphysik Nietzsches zeigt. Dionysos und seine Gaben fungieren hier als Bindeglied zwischen einer antiken mythologischen Welt und der gegenwärtig herrschenden Götter"nacht". Hölderlin verbindet in seiner Interpretation des Weingottes die Sphäre der antiken Götter mit den Symbolen des christlichen Abendmahls. Er füllt hier den Raum, den Goethe im Sturmlied mit seiner persönlichen Symbolik des Genieverständnisses belegt, mit christlich-religiösen Gehalten. Dionysos vermischt sich hier auf eigentümliche Weise mit Christus. In der ersten Reinschrift des Gedichtes war der Bezug zu Christus noch gar nicht so deutlich hergestellt. Dort ist es mehr der dionysische Geist, "der in der Nacht vom Göttlichen zeugt" (vergl. BÖCKMANN, S. 405). Inwieweit hier sich Christus und Dionysos überschneiden oder sogar gleichgesetzt werden, ist schwer zu beurteilen. Auch in der christlichen Lehre dienen die Gaben Brot und Wein als Erinnerung an das Gehen und Wiederkehren des Göttlichen in Jesus Christus, im Abendmahl gedenken die Christen des Todes und der Auferstehung Christi und so deutet das christliche Abendmahl auch auf die Erlösung durch Christus und eine Wiederkehr hin.
Dieses Kapitel stützt sich hauptsächlich auf die Interpretation von Paul Böckmann30, das Kapitel Hölderlin und der deutsche Idealismus in Ernst Cassirers Idee und Gestalt (ebd. S. 113-157) und die Monographie zu Friedrich Hölderlin von Gunter Martens31.
Die Elegie Brot und Wein ist in drei Bearbeitungsschichten zwischen 1800 und 1804 entstanden. Zunächst erschien die erste Strophe separat unter dem Titel Die Nacht im Musenalmanach des Jahres 1807 von Leo von Seckend.
So wurde die Stimmung besonders dieser ersten Strophe dahingehend gedeutet, daß sie sich, wie so viele andere Werke dieser Zeit mit dem Geheimnis der Nacht, der sich hierin besonders äußernden Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur befasse. Die Elegie in ihrer Gesamtheit bleibt aber nicht bei dieser stimmungshaften Beschreibung des Herannahens der Nacht, sondern drückt das Verhältnis von Geschichte, Natur, Mythos und Religion aus, indem es die Nacht als eine zeitenübergreifende höhere Macht darstellt, die die antike Götterwelt mit der modernen, götterfernen Zeit verbindet. In Brot und Wein drückt sich auch das Gefühl Hölderlins aus, in geschichtlicher Nacht zu leben (vergl. MARTENS, S. 112). Die Götter haben sich zurückgezogen, es herrscht eine Götternacht; jedoch beschreibt das Gedicht diese Zeit als eine Zeit zwischen Erinnerung und Erwartung. Es wird Hoffnung auf eine Wiederkehr der Götter erweckt, ein Zurück zur Einheit von Mensch und Natur, eine Aussöhnung von Tag und Nacht (9. Strophe).
"Die gesamte neun Strophen umfassende Elegie, die den Titel Brod und Wein trägt, ist der Versuch, aus einer geschichts-, kultur- und religionsphilosophischen Reflexion die gegenwärtige Dunkelheit als eine heilige Nacht zu deuten" (MARTENS, S. 112/113). BÖCKMANN sieht einen Schlüsel zum Verständnis des Gedichtes vor allem in der ersten Strophe und dem dort beschriebenen gewaltigen Hereinbrechen der Nacht als eine "Fremdlingin" unter den Menschen.
Der eigentliche Zusammenhang des Gedichts erschließt sich erst, wenn man beachtet, daß hier die Nacht als eine selbständige, dem Menschen fremde und unbegreifliche Erscheinung zur Geltung kommt, die der Zeit zugehört und darum sowohl das natürliche wie das geschichtliche Leben bestimmt. Sie will als eine über das Dasein gebietende Macht anerkannt sein, die vom Walten der Himmlischen, der Götter zeugt; ihr entspricht nicht die gefühlsmäßige Einstimmung, sondern das nachfrangende, ausdeutende, dankende oder rühmende Wort. Sie wird nicht im wörtlichen, sondern auch im gleichnishaft-übertragenen Sinn bedeutsam, als ein Zeichen, durch das sich die Einheit von natur und Geist zu erkennen gibt. Sie wird zur ,,heiligen Nacht", die von dem wechselnden Verhältnis der Menschen zu den Göttern zeugt. Erst damit wird es sinnvoll, daß sich am Bild der Nacht das Verhältnis zur Natur nicht nur, sondern auch zu Griechenland und seinen Göttern wie zu Christus zu erkennen gibt (ebd. S. 399).
Aus der Erinnerung an Griechenland entwickelt sich zunächst Hoffnungslosigkeit: "Indessen dünket mir öfters - Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, - So zu harren, und was zu tun indes und sagen, - Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit?" (7. Strophe). Hier stellt Hölderlin auch die Frage nach der Aufgabe des Dichters in der götterfernen Zeit. Hierzu schreibt KOMMERELL:
Die Elegie ,,Brot und Wein" leitet über zu den Hymnen. Das Überleitende ist: die gewonnene Deutung eines Wendepunktes in der Vergangenheit, nämlich der Erscheinung von Christus als letztem Gott - ein Abschied, in dem sich die Gottheit für immer aus dem Leben zurücknimmt - und noch des gegenwärtigen Momentes, in dem der Dichter sein Schicksal hat, aus diesem Wendepunkt. Damit werden Formen geschichtlichen Bewußtseins in Hölderlins Dichtung mächtig und eröffnen jenen heiligen Zusammenhang auf neue Art. [...] Vorher waren sie (die Götter, Anm.) ein Sein, jetzt sind sie ein Werden, genauer: ein Geschehen, das Zeichen anküngigen; [...] alles, worin Hölderlin sonst die Gebärden des gegen ihn aufgeschlossenen Allebens vernahm, wird ihm nun Orakel, Wahrzeichen und Wink, meint ein bevorstehendes, sich vollziehendes oder vollendetes Geschehen, dessen Enträtselung dem Dichter obliegt. So ist das Gedicht des Dichters jetzt durchweg das zweite Wort, die Antwort auf das Wort, das der Gott gesprochen hat. [...] Aber wie vorher das Göttliche Sein nur im Gedicht des Dichters sich selber feierte, so ist dies Geschehen gleichfalls verborgen und verständigt nur den Dichter durch Zeichen. [...] In diesem Sinne sind Hölderlins Hymnen Deutungen (ebd. S. 460-462).
Hölderlin deutet dieses Göttergeschehen, das der Natur zugehört und das Verhältnis des Abendlandes zu den Göttern bestimmt von Dionysos ausgehend. Dieser nimmt eine stellvertretende Bedeutung für die gesamte griechische Götterwelt an. Das Kommen und Gehen der Götter wird von ihm aus gedeutet.: "Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott." (3. Strophe). Er beinhaltet den "frohlockenden Wahnsinn", der in "heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift". Bernhard BÖSCHENSTEIN weist darauf hin, daß Hölderlin in seiner Dichtung die Reisen des Dionysos nachvollziehe: "Der Dichter, der sich als `Priester' des `Weingotts' versteht, bildet diese Reisen in seinen Elegien und Hymnen nach. Dies geschieht auf der thematischen wie auf der poetologischen Ebene. Man kann den Bau der Gedichte Hölderlins als Reisen des Dionysos nachvollziehen. Dann wäre die Kolonialisierung, die der Gott im Abendland vollbringt, auch in der Gestalt der Gedichte geleistet."32
In der Gestalt des Dionysos, in seiner Zeugung aus dem Blitz, in dem die sterbliche Mutter vergehen muß, zeigt sich für Hölderlin auch die für den Menschen bisweilen unfaßbare Natur des Göttlichen: "zu hell kommt, zu blendend das Glück" (5. Strophe), "Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen - Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch". BEHRE schreibt über die Rolle der verschiedenen mythologischen Aspekte der Dionysosgestalt in Brot und Wein:
In Dichotomie, dem Grundkonzept der Elegie, verbergen Anfangs- und Endbild (die schlafende Stadt - der schlafende Cerberus) die gefahrvolle Spannung der Zeit in Geschichte, die sich mit Dionysos entladen soll. Das Zeichen des Gewitters mit Blitz und Donner (Zagreus) wandelt sich in poetisch und mythologisch synkretistischer Weise zum Zeichen des Symposions mit Brot und Wein (Bakchos) und zum Zeichen der Erlösung mit Licht und Traum (Jakchos). (BEHRE, S. 217).
Es besteht aber bei Hölderlin ein Unterschied in seiner Auffassung der mythologischen Göttergestalt. CASSIRER weist darauf hin, daß für Hölderlin die Mythologie nicht bloß zur bildhaften Ausschmückung seiner Dichtung oder als symbolische Stellvertretung abstrakter metaphysischer Konzepte dient:
Der Mythos ist für Hölderlin kein bloß äußerliches allegorisches Sinnbild, in das sich der Gedanke kleidet, sondern er bildet für ihn eine ursprüngliche und unauflösliche geistige Lebensform. Die mythische Phantasie ist kein bloßes Schmuckstück, das wir nachträglich dem Bilde der Wirklichkeit hinzufügen, sondern sie ist eines der notwendigen Organe für die Erfassung der Wirklichkeit selbst. In ihr findet er Welt und Leben erst wahrhaft erschlossen und gedeutet. Er hat die Naturgewalten als ursprüngliche mythische Gewalten gefühlt, noch ehe er sie sich benannt hat und sie begrifflich gegeneinander abgesondert hat (ebd. S. 121).
Diese Auffassung unterscheidet das Denken Hölderlins beispielsweise von der Auffassung Schellings oder Fichtes, das " `Eine', das er sucht, ist nicht, wie bei Schelling und Fichte, das oberste Prinzip der Deduktion: nicht ein höchster und allumfassender Grundbegriff, von dem alles besondere Wissen sich ableiten soll." (ebd. S. 119/120). Hölderlin sucht nicht nach der "unendlichen allumfassenden Substanz, für die es keinen Wechsel und kein Werden gibt" sondern nach dem "Eins, das in sich selbst den Keim zur Vielheit und zum Wandel birgt." (ebd. S. 120). [vergl. hierzu Kapitel VI.2. Exkurs: Mythologie und Metaphysik - Begriffsklärung]. Weiter führt CASSIRER aus, Hölderlin wende sich erbost gegen die Dichter, denen die Götterwelt nur als rhetorisches Mittel und dichterische Ausschmückung dient: "Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Göttern nicht! Ihr habt Verstand! Ihr glaubt nicht an Helios, Noch an den Donnerer und Meergott; Tod ist die Erde, wer mag ihr danken?" (zitiert nach CASSIRER, S. 121). Wem der Mytjos lediglich eine dichterische Erfindung sei, dürfe von ihm eigentlich keinen dichterischen Gebrauch machen, da für ihn die Natur nur eine Ansammlung unbeseelter Materie und ein berechenbares, bestimmten (mechanischen) Gesetzen folgendes und mittels des Verstandes vollkommen erfaßbares System darstelle. CASSIRER sieht hier die Stimmung der Götter Griechenlands fortwirken mit dem Unterschied, daß Schiller der Welt der griechischen Götter, die er als vergangen und entschwunden betrachtet nur wehmütig nachtrauert, während Hölderlin ihr wieder "naiv und gläubig" gegenüber stehe. "Was Schiller nur fordert ist bei Hölderlin gesleistet." (ebd. S. 121/122).
Eine weitere Eigenart der Elegie Brot und Wein ist die Verbindung des dionysischen Geistes mit der Christusfigur. Ausgehend vom Weingott ("Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott" 3. Strophe) entwickelt sich hier in der 8. Strophe das Bild der Gaben Brot und Wein, die zum Andenken an die Existenz des Göttlichen, als "Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder - Käme" von dem "himmlischen Chor" zurückgelassen wurden, als der letzte Gott, ("als erschienen zuletzt ein stiller Genius" - Christus/Dionysos) das Dasein der Götter unter den Menschen beendete. Das Brot ist "der Erde Frucht" und ist vom "Lichte gesegnet". Somit verbindet das Symbol des Brotes Himmel und Erde, Licht und Dunkelheit. ( "Ja! Sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus, - Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf,") Und der Wein, der "vom donnernden Gott kommet" ist direkt göttlichen Ursprungs. Erst in der späten Fassung der letzten Strophe wird der Bezug zu Christus direkter erkennbar: "Aber indessen kommt als Fackelschwinger des Höchsten - Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab." Inwieweit sich die Figuren Dionysos und Christus hier entsprechen soll hier nicht erörtert werden. Vielmehr interessiert der direkte Bezug, der hier schon durch die Gaben des christlichen Abendmahls hergestellt wird. Hier zeigt sich auch ein Unterschied zu dem in den folgenen Kapiteln besprochenen Werken, Nietzsches, der Dionysos als prinzipiell lebensbejahendes Element als Gegenpol zum Christlichen sieht, das er für tendenziell lebensfeindlich hält(vergl. VI.I., VI.1.1.).
VI Dionysos als Symbol für einen der "Kunsttriebe der Natur" - das Prinzip des Dionysischen in Friedrich Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
Im Unterschied zu dem Hölderlinschen Mythoskonzept 33 Dionysos verfolgt Friedrich
Nietzsche in seiner Abhandlung über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik einen anderen Ansatz. Aufgrund von Nietzsches Bestimmung "der Kunst als der höchsten Aufgabe und der eigentlichen metaphysischen Tätigkeit dieses Lebens" (Geburt der Tragödie, S. 19) und der Aussage Nietzsches, das Dasein sei lediglich als "ästhetisches Phänomen" gerechtfertigt, bezeichnet er selbst das in diesem frühen Werk entworfene Konzept als "ästhetische Methaphysik" (ebd. S.38) 34 . Um den Unterschied dieses Ansatzes deutlich zu machen, wird es zunächst nötig, die Begrifflichkeit (Mythologie - Metaphysik) zu klären. (Abschnitt VI.2.)
VI.1. Nietzsches Kritik an der Geburt der Tragödie
Zwar bezeichnet Nietzsche in seinem 1886 angefügten "Versuch einer Selbstkritik" die Geburt der Tragödie als "ein Jugendwerk voller Jugendmut und Jugend-Schwermut, unabhängig, trotzig-selbständig auch noch, wo es sich einer Autorität und eignen Verehrung zu beugen scheint, kurz ein Erstlingswerk auch in jedem schlimmen Sinne des Wortes, trotz seines greisenhaften Problems mit jedem Fehler der Jugend behaftet" (Geburt der Tragödie, S. 5). Er schreibt weiter: "ich heiße es schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwütig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen" (ebd. S. 6). Dennoch macht es der beachtliche Erfolg dieses Buches und die lange Wirkungsgeschichte unabdingbar dieses Frühwerk Nietzsches genauer zu betrachten, wenn man sich mit der Rezeption des Dionysos in der deutschen Literatur beschäftigen möchte. So nennt Nietzsche es in diesem Sinne ein "bewiesenes Buch", eines das "jedenfalls »den Besten seiner Zeit« genug getan hat" und mit "einiger Rücksicht und Schweigsamkeit behandelt werden" sollte. Auch läßt ihn die Begeisterung für das Dionysische nicht los. In seinem "Versuch einer Selbstkritik" bezeichnet er es als seinen frühen Versuch eine Gegenlehre zum Christentum zu zeichnen.
Gegen die Moral also kehrte sich damals, mit diesem fragwürdigen Buch, mein Instinkt, als ein fürsprechender Instinkt des Lebens und erfand sich eine grundsätzliche Gegenlehre und Gegenwertung des Lebens, eine rein artistische, eine rein anti-christliche. Wie sie nennen? Als Philologe und Mensch der Worte taufte ich sie, nicht ohne einige Freiheit - denn wer wüßte den Namen des Antichrist? - auf den Namen eines griechischen Gottes: ich hieß sie die dionysische... - (ebd. S.11).
Obwohl sich diese Arbeit also in erster Linie dem Begriff des Dionysischen in der Geburt der Tragödie widmen möchte, kann sie natürlich nicht vollkommen ohne Erwähnung Nietzsches späterer Bearbeitungen des Dionysos-Motivs wie etwa in Also sprach Zarathustra oder den Dionysos-Dithyramben auskommen. Diese bisweilen sehr schwer zugänglichen späteren Werke in ihrer vollen Länge berücksichtigen zu wollen, würde natürlich weit über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, so soll hier lediglich eine grobe Richtung angedeutet werden.
VI.1.1. Dionysos im späteren Werk Nietzsches
In seinem späteren Werk wendet sich Nietzsche direkter und offener gegen das Christentum. Er bezeichnet die christliche Religion als eine lebensfeindliche und sieht in seinem "dionysischen Unhold" (ebd. S. 14.) Zarathustra ein Gegenmodell. "Der christliche Gottesbegriff", sagt Nietzsche im Antichristen 35 , "ist einer der corruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind; [...] Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Ja zu sein!" (a.a.O. S.183). Zarathustra sieht er - und die Zarathustra- Gestalt fühlt sich selber als - "die höchste Art alles Seienden"36 (a.a.O., S.342).
- die Seele, welche die längste Leiter hat und am
tiefsten hinunter kann,
die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich
laufen irren und schweifen kann,
die notwendigste, welche sich mit Lust in den Zufall
stürzt,
die seiende Seele, welche ins Werden, die habende,
welche ins Wollen und Verlangen will-
die sich selber fliehende, welche sich selber in wie-
testen Kreisen einholt,
die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süssesten
zuredet,
die sich selber liebende, in der alle Dinge ihr Strö-
men und Wiederströmen und Ebbe und Fluth haben - - Aber das ist der Begriff des Dionysos selbst.
So umschreibt Nietzsche in Ecce Homo diese "höchste Art alles Seienden" mit den Worten seiner Zarathustra-Gestalt. (ebd.). Sie ist ein dionysisches Idealbild und in diesem Sinne der vielzitierte "Übermensch", der "höherwerthige Typus", der "lebenswürdigere", "zukunftsgewissere" das Gegenbild zu dem, was Nietzsche sehr polemisch "das Hausthier, das Heerdenthier, das kranke Thier Mensch, - der Christ" nennt (Der Antichrist, Werke 6/3, S.168.) Hier wird auch die viel kritisierte Nähe Nietzsches zur nationalsozialistischen Propaganda sichtbar.
"Welche Sprache wird ein solcher Geist reden, wenn er mit sich allein redet?" fragt Nietzsche weiter in Ecce Homo. "Die Sprache des Dithyrambus." Nietzsche selber bezeichnet sich als der "Erfinder des Dithyrambus" (ebd. S.343) insofern verwischt hier die Linie zwischen der Gestalt des Zarathustra und ihrem Schöpfer Nietzsche. Es sind nicht nur die heiteren Lustbarkeiten des Rausches, die Nietzsche am Dionysischen faszinieren, es ist vor allem auch die düstere, zerstörerische Seite. "Für eine dionysische Aufgabe gehört die Härte des Hammers, die Lust selbst am Vernichten in entscheidender Weise zu den Vorbedingungen.
Der Imperativ `werdet hart!', die unterste Gewissheit darüber, dass alle Schaffenden hart sind, ist das eigentliche Abzeichen einer dionysischen Natur. - " (Ecce Homo, ebd. S. 347). Hier unterscheidet sich das Dionysos-Verständnis Nietzsches ganz deutlich und erheblich von den zuvor in dieser Arbeit besprochenen.
Die späten Dionysos-Dithyramben (1888) formen den dionysischen Rausch selbst als chaotischen Urgrund des Seins, der die Gestalt des Zarathustra in sich auflöst und verwandelt in den sich selbst in die Unendlichkeit Stürzenden. "Schild der Nothwendigkeit! Höchstes Gestirn des Seins! - das kein Wunsch erreicht, das kein Nein befleckt, ewiges Ja des Sein's, ewig bin ich dein Ja: denn ich liebe dich, oh Ewigkeit! - - ". (Dionysos-Dithyramben, ebd. S. 403).
VI. 2. Exkurs: Mythologie und Metaphysik - Begriffsklärung
Mythologie und Metaphysik haben eine wesentliche Gemeinsamkeit. Sie stellen beide verschiedene Weisen dar, allumfassende Aussagen über das Sein zu machen, beide mit dem Anspruch "so über das Sein zu sprechen, wie es der Wahrheit entspricht"37.
Im Gegensatz zur Methaphysik kennt die Mythologie "numinose Wesenheiten"38, das heißt, der mythologische Mensch nimmt Kräfte wahr, deren Wirkung er an sich erfährt, und benennt sie. So hält er die Kraft, die er für die Ursache seines Erlebten macht, im Wort, in einem Namen fest. So nennen die antiken Griechen die Kraft, die sich ihnen im Zustand der Ekstase und des Rausches mitteilt "Dionysos". Bei den dionysischen Festen ist der Gott sinnlich präsent und wird von den mythologisch denkenden Griechen in dem Gefühl der ekstatischen Begeisterung, das sie mitreißt, erkannt.
Die Wirklichkeit, das Erleben von Welt, hat sich für ihn zur Zeit des Festes verwandelt. Der Rausch gilt ihm nicht als Ursache einer verzerrten Wahrnehmung von Menschen und Dingen, die ihm alltäglich begegnen, und die ekstatische Erfahrung begreift er auch nicht als Illusion, die von einer Verwirrung der Sinne herrührt und in keine Wirklichkeit gründet: er macht die Erfahrung dionysischer Wirklichkeit. Während der Zeit des Festes lebt er in der wahren, weil real existierenden, Sphäre des Dionysos. Die alltägliche Wirklichkeit seiner Erfahrungswelt ist für ihn ebenso ontologisch fundiert wie das besondere Widerfahrnis der Gegenwart des Gottes beim Fest.39
Im metaphysischen Verständnis vollzieht sich die Erkenntnis nicht durch derartiges mythisches Erleben sondern auf der Ebene der Theorie, im Denken. Der Metaphysiker ist bemüht, die eine wahre Wirklichkeit, deren Existenz er annimmt, in ihrem Wesen zu erkennen. Dieses Erkennen bezieht sich im neuzeitlichen metaphysischen Denken auf ein Objekt, einen Gegenstand, der sich vom erkennenden Selbst, dem Subjekt abgrenzt. Das Objekt dieser Erkenntnisbemühungen, diese eine wahre Wirklichkeit muß der Annahme nach ewig und unveränderlich sein. Denn sonst könnte sie allenfalls in ihren vielfältigen Zuständen beschrieben, nie aber in ihrem Wesen erfaßt werden. Für seine Erkenntnis entwickelt der metaphysisch denkende Mensch Begriffe, im Gegensatz zu dem mythologisch denkenden Menschen, der Namen gibt. Es ist das Bestreben des Metaphysikers seine Aussagen über das Sein möglichst klar und exakt zu formulieren und zu abstrahieren, d.h. konkrete sinnliche Erfahrungsebenen auszuklammern. Die mythologische Weltsicht kennt abstrakte Konzepte und Begrifflichkeit in diesem Sinne nicht. Eine abstrakte Aussage zu machen über das, was das Wesen des Dionysos bestimmt und ausmacht, wäre dem mythologisch Denkenden fremd.
Die Metaphysik unterscheidet zwischen sinnlich Erfahrbarem, d.h. "Materie" und dem ideellen, dem "Geist". Dionysos ist im mythologischen Denken zugleich materiell und ideell. Er ist als " [...] besondere Widerfahrnis raumzeitlich bestimmbar. Und er ist zugleich allgemein, in der Ganzheit seines Wesens, an dem durch die je besondere Erscheinung nichts gemindert ist." (BEYER, S. 22). Wahre Aussagen können daher für den metaphysisch Denkenden nur über die "immaterielle Idee eines Seienden" gemacht werden, da alles sinnlich wahrnehmbare lediglich ein Abbild dieser Idee und somit vergänglich sei.
Die Metaphysik versucht auf dem Wege des rationalen Denkens auch nach den Gründen des Seienden zu forschen und ihre Erkenntnisse darüber in möglichst klarer und abstrakter Begrifflichkeit festzuhalten.
So fragt Aristoteles nach den ersten Ursachen alles Seienden, gerade weil sie die umfassendsten und allgemeinsten sind, von denen alles Seiende betroffen ist. Das Allgemeine, das ganze zu erfassen, ist nach Aristoteles die Aufgabe der Metaphysik als der Ersten Wissenschaft. Sie befaßt sich daher mit dem, was alle anderen einzelnen Wissenschaften schon voraussetzen. (BEYER, S. 23).
Die abstrakte Begrifflichkeit und das theoretische Denken sind somit für die Metaphysik der konkreten Wahrnehmung und der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung vorzuziehen. Nicht individuelle Erscheinung und spezielle Eigenheiten sind wichtig, sondern das wesentliche, der Kern des Seienden, das "was ein Seiendes als solches selbst ist" (ebd.).
So ist auch das Verständnis von "Gott" ein wesentlich anderes. Gott in der metaphysischen Denkweise wäre der "allgemeinste, erste Grund von allem was ist" (BEYER, S. 24). Er ist ein abstrakter Begriff. Ein gedankliches Konstrukt, abgeleitet aus erkannten Prinzipien und Strukturen. Er ist ewig und unbewegt, er ist nicht materiell und hat deshalb auch keine "zufälligen nicht notwendigen Eigenschaften" (ebd.). Das unterscheidet den metaphysischen Gottesbegriff deutlich von dem der numinosen, sinnlich erfahrbaren Wesenheit, die sich dem mythologisch denkenden Menschen unter bestimmten raumzeitlichen Gegebenheiten in konkreten Erfahrungen mitteilt.
VI.3. Nietzsches "ästhetische Metaphysik"
Nietzsche entlehnt für die Prinzipien, die er in seiner Metaphysik umschreibt, die Namen zweier Göttergestalten der antiken griechischen Mythologie, die "beiden Kunstgottheiten, Apollo und Dionysos" (Geburt der Tragödie, S. 19).
Nietzsche rekurriert hiermit auf das mythische, bildliche Denken der griechischen Antike, welches in der Kulturentwicklung vor dem abstrakt-metaphysischen steht: "Diese Namen entlehnen wir von den Griechen, welche die tiefsinnigen Geheimlehren ihrer Kunstanschauung zwar nicht in Begriffen, aber in den eindringlich deutlichen Gestalten ihrer Götterwelt dem Einsichtigen vernehmbar machen." (ebd.) Er betont jedoch, daß er diese Göttergestalten der griechischen Mythologie nur als Symbole, als Sinnbilder für abstrakt gedachte Prinzipien heranzieht. Er verbindet hiermit die mythologische Vorstellungswelt mit metaphysischer Erkenntnis.
Die Götter Apollo und Dionysos sind also in diesem Sinne nicht in ihrer Eigenschaft als mythische Wesenheiten zu begreifen, Nietzsche nimmt sie nicht als Wirklichkeiten an, ihre Existenz ist "für ihn nicht ontologisch fundiert, sondern psychologisch motiviert" (BEYER, S. 222). "Um leben zu können," sagt Nietzsche, " mußten die Griechen diese Götter, aus tiefster Nötigung, schaffen" (Geburt der Tragödie, S. 30) und stellt sie damit dar als Kunstwerke, geschaffen durch menschliche Bedürfnisse.
Die mythischen Götter gelten Nietzsche - wie die Musik, die Poesie, die Tragödie - als menschliche Kunstwerke. Mythische Elemente sind in die "aesthetische Metaphysik" insofern harmonisch integriert, als Nietzsche der Rekurs auf die mythischen Götter Apollo und Dionysos wesentlich zur Umschreibung für die begrifflich klaren Grundtermini der Metaphysik Schopenhauers: die Welt als Wille (Dionysos) und Vorstellung (Apollo), dient. (BEYER, S. 222).
Nietzsche betrachtet sie somit als sich in den mythischen Wesenheiten der antiken Götter ausdrückende, ihnen zu Grunde liegende Prinzipien, das Appolinische und das Dionysische.
VI.3.1. Das Dionysische und das Apollinische bei Nietzsche
Die antagonistischen Prinzipien des Dionysischen und des Apollinischen begegnen sich in der Natur und in der Kunst. Um sie zunächst in ihrem Wesen als Triebe der Natur zu beschreiben, vergleicht Nietzsche sie zunächst mit den "getrennten Kunstwelten des Traumes und des Rausches" (Geburt der Tragödie, S. 19). So sei der "schöne Schein der Traumwelten" die Wurzel aller bildenden Kunst und auch "einer wichtigen Hälfte der Poesie" (ebd.). Diese Welt verkörpert Apollo. Er beherrscht die Welt des schönen Scheins und des Traums und die Künste durch die "das Leben möglich und lebenswert gemacht wird" (ebd. S. 21). Aber Nietzsche stellt diese Welt auch als eine mit klaren Begrenzungen heraus. Die Linie zwischen Schein und Wirklichkeit muß akzeptiert werden "um nicht pathologisch zu wirken" (ebd. S. 22). Das Betrachten dieser Scheinwelt macht die Wirklichkeit erträglich, jedoch will sie eine Scheinwelt bleiben und nicht als Wirklichkeit angenommen werden; so gehört das Erwachen zu den Charakteristika des Traumes. Das Vertrauen in diese Begrenzung jedoch ist Quelle für Ruhe. Sehr gut drückt sich diese Vorstellung in dem von Nietzsche herangezogenen Bildes Schopenhauers aus:
Und so möchte von Apollo in einem exzentrischen Sinne das gelten, was Schopenhauer von dem im Schleier der Maja befangenen Menschen sagt, Welt als Wille und Vorstellung I: ,,Wie auf dem tobenden Meere, das, nach allen Seiten unbegrenzt, heulend Wasserberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sitzt, dem schwachen Fahrzeug vertrauend; so sitzt mitten in einer Welt von Qualen, ruhig der einzelne Mensch, gestützt und vertrauend auf das principium individuationis." (ebd.)
Zerbricht dieses principium individuationis an irgendeiner Stelle, erzeugt dies beim Menschen Entsetzen, aber auch Faszination ("Grausen" und "wonnevolle Verzückung"). Diese "wonnevolle Verzückung" entspringt - so Nietzsche - aus dem "innersten Grunde des
Menschen, ja der Natur". Hierin zeigt sich das Prinzip des Dionysischen, das Nietzsche hier mit dem Phänomen des Rausches beschreibt. "Entweder durch den Einfluß des narkotischen Getränkes" oder im "gewaltigen, die ganze Natur lustvoll durchdringenden Nahen des Frühlings" durch das Erwachen jener "dionysischen Regungen", die das "Subjektive" zu "völliger Selbstvergessenheit" auflösen, wird das Maß, die Begrenzung aufgehoben (ebd. S. 22/23).
Jetzt ist der Sklave freier Mann, jetzt zerbrechen alle die starren, feindseligen Abgrenzungen, die Not, Willkür oder `freche Mode' zwischen den Menschen festgesetzt haben. Jetzt, bei dem Evangelium der Weltharmonie, fühlt sich jeder mit seinem Nächsten nicht nur vereinigt, versöhnt, verschmolzen, sondern eins, als ob der Schleier der Maja zerrissen wäre und nur noch in Fetzen vor dem geheimnisvollen Ur- Einen herumflatterte. [...] Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden: die Kunstgewalt der ganzen Natur, zur höchsten Wonnebefriedigung des Ur-Einen, offenbart sich hier unter den Schauern des Rausches (ebd. S. 23/24).
Apollo, sagt Nietzsche, könne "nicht ohne Dionysus leben!", Dionysos wurzelt also tiefer als Apollo und bedingt ihn. So versteht Nietzsche das Dionysische und das Apollinische zwar als entgegenwirkende Prinzipien, jedoch nicht direkt als völlig entgegengesetzte Triebe, die sich bekämpfen.40
Weiter führt Nietzsche seinen Gedanken, indem er auf die Existenz der beiden Prinzipien in der Kunst verweist. Er führt an, jeder Künstler sei "Nachahmer" einer dieser Naturtriebe. So gebe es zwei Arten von Künstlern, den "apollinischen Traumkünstler" und den "dionysischen Rauschkünstler". Nietzsche stellt hier die Ausprägung dieser "Kunsttriebe der Natur" bei den antiken Griechen hier als ein Idealbild weit über die anderer Kulturen. Die Griechen seien ihrer Natur nach mit einem besonderen Sinn für das Ästhetische, klare, logische gesegnet. Ferner sei ihnen durch das apollinische die Fähigkeit gegeben, eine Entartung und Entgleisung des Dionysischen in bloße "Zuchtlosigkeit" zu vermeiden, sondern es, die "Zerreißung des principii individuationis" zu einem "künstlerischen Phänomen" werden zu lassen. (ebd. S. 27).
Von den Träumen der Griechen ist [...] nur vermutungsweise, aber doch mit ziemlicher Sicherheit zu sprechen: bei der unglaublich bestimmten und sicheren plastischen Befähigung ihres Auges, samt ihrer hellen und aufrichtigen Farbenlust, wird man sich nicht entbrechen können, zur Beschämung aller Spätgeborenen, auch für ihre Träume eine logische Kausalität der Linien, Umrisse, Farben und Gruppen, eine ihren besten Reliefs ähnelnde Folge von Szenen vorauszusetzen, deren Vollkommenheit uns, wenn eine Vergleichung möglich wäre, gewiß berechtigen würde, die träumenden Griechen als Homere und Homer als einen träumenden Griechen zu bezeichnen: in einem tieferen Sinne, als wenn der moderne Mensch sich hinsichtlich seines Traumes mit Shakespeare zu vergleichen wagt. (ebd., S. 25)
Dagegen brauchen wir nicht nur vermutungsweise zu sprechen, wenn die ungeheure Kluft aufgedeckt werden soll, welche die dionysischen Griechen von den dionysischen Barbaren trennt. [...] Fast überall lag das Zentrum dieser [nicht-griechischen, Anm.] Feste in einer überschwenglichen geschlechtlichen Zuchtlosigkeit, deren Wellen über jedes Familientum und dessen ehrwürdige Satzungen hinwegfluteten; gerade die wildesten Bestien der Natur wurden hier entfesselt, bis zu jener abscheulichen Mischung von Wollust und Grausamkeit, die mir immer als der eigentliche ,,Hexentrank" erschienen ist. Gegen die fieberhaften Regungen jener Feste, deren Kenntnis auf allen Land- und Seewegen zu den Griechen drang, waren sie, scheint es, eine Zeitlang völlig gesichert und geschützt durch die hier in seinem ganzen Stolz sich aufrichtende Gestalt des Apollo, der das Medusenhaupt keiner gefährlicheren Macht entgegenhalten konnte als dieser fratzenhaft ungeschlachten dionysischen. Es ist die dorische Kunst, in der sich jene majestätisch-ablehnende Haltung des Apollo verewigt hat. (ebd. S. 25/26)
Die beiden "Kunsttriebe der Natur" finden sich bei den Griechen also zunächst in den getrennten Sphären der apollinischen Kunst und einer davon unabhängigen dionysischen Kunst wieder. Erst in der Tragödie findet - so Nietzsche - eine ,,Versöhnung" beider Kunstformen statt.
VI.3.1.1. Appolinische Kunst
Nietzsche begreift selbst die olympischen Göttergestalten als einem bestimmten "Bedürfnis" der Griechen entspringende "Traumgeburt". Sie sind aus dem apollinischen Trieb entspringende Kunstgestalten. Nietzsche verweist auf die "Weisheit des Silen"41, um das Bedürfnis, das der Erschaffung der "künstlerischen Mittelwelt der Olympier" zugrunde liegt, zu verstehen. "Der Grieche kannte und empfand die Schrecken und Entsetzlichkeiten des Daseins: um überhaupt leben zu können, mußte er vor sie hin die glänzende Traumgeburt der Olympischen stellen." (ebd., S. 30). Um das "ungeheure Mißtrauen gegen die titanischen
Mächte der Natur" zu überwinden, brauchten die Griechen die Traumwelt der olympischen Götter, die über diesen titanischen Mächten steht. Diese künstlerischen Götter seien von den Griechen erschaffen worden, um überhaupt existieren zu wollen und zu können. In den Göttern zeige sich ihr eigenes Dasein in einer vollkommenen, ästhetischen, glänzenden Form.
Derselbe Trieb, der die Kunst ins Leben ruft, als die zum Weiterleben verführende Ergänzung und Vollendung des Daseins, ließ auch die olympische Welt entstehn, in der sich der hellenische ,,Wille" einen verklärenden Spiegel [vergl "Vorstellung" bei Schopenhauer, Anm.] vorhielt. So rechtfertigten die Götter das Menschenleben, indem sie es selbst leben - die allein genügende Theodizee! Das Dasein unter dem hellen Sonnenscheine solcher Götter wird als das an sich Erstrebenswerte empfunden, und der eigentliche Schmerz der homerischen Menschen bezieht sich auf das Abscheiden aus ihm, vor allem auf das baldige Abscheiden: so daß man jetzt von ihnen, mit Umkehrung der silenischen Weisheit, sagen könnte, das ,,Allerschlimmste sei für sie, bald zu sterben, das Zweitschlimmste, überhaupt einmal zu sterben". (ebd. S. 30/31)
Somit sei diese von der Moderne (u.a. geprägt von Schiller) als "naiv" bezeichnete Einheit von Mensch und Natur kein "sich von selber ergebender, gleichsam unvermeidlicher Zustand", sondern Ausdruck und Wirkung der "apollinischen Kultur [...] welche immer erst ein Titanenreich zu stürzen und Ungetüme zu töten hat". Als beispielhaft für diese "naive" apollinische" Kunst der "Schönheit des Scheins" empfindet Nietzsche Homer. "Mit dieser Schönheitsspiegelung kämpfte der hellenische ,,Wille" gegen das dem künstlerischen korrelative Talent zum Leiden und zur Weisheit des Leidens: und als Denkmal seines Sieges steht Homer vor uns, der naive Künstler.
VI.3.1.2. Dionysische Kunst
Als ein dem Apollinischen zugrunde liegendes Prinzip oder "Gesetz" bezeichnet Nietzsche "die Einhaltung der Grenzen des Individuums, das Ma ß im hellenischen Sinne". So beinhalte das Apollinische neben der Forderung nach Schönheit auch die Forderungen des "Erkenne dich selbst" und des "Nicht zu viel!", so daß jede Form von "Selbstüberhebung" und "Übermaß" diesem Prinzip entgegenlaufe und als "barbarisch" und "titanenhaft" empfunden werde. So erklärt sich für Nietzsche die Wirkung der dionysischen Musik und der im dionysischen Rausch sich zeigenden Selbstvergessenheit, die wie eine Drohung an den "verhüllten Untergrund des Leidens und der Erkenntnis", auf der die apollinische Welt des schönen Scheins ruht, erinnert.
Und nun denken wir uns, wie in diese auf den Schein und die M äß igung erbaute und künstlich gedämmte Welt der ekstatische Ton der Dionysusfeier in immer lockenderen Zauberweisen hineinklang, wie in diesen das ganze Ü berma ß der Natur in Lust, Leid und Erkenntnis, bis zum durchdringenden Schrei, laut wurde [...] Die Musen der Künste des ,,Scheins" verblaßten vor einer Kunst, die in ihrem Rausche die Wahrheit sprach, die Weisheit des Silen rief Wehe! Wehe! Aus gegen die heiteren Olympier. Das Individuum, mit allen seinen Grenzen und Maßen, ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände unter und vergaß die apollinischen Satzungen. (ebd. S. 35)
Als Beispiel für einen "dionysischen Künstler", bezeichnet Nietzsche den Lyriker Archilochus. Lyriker und Musiker gleichsetzend, erklärt Nietzsche, der Lyriker sei "zuerst, als dionysischer Künstler, gänzlich mit dem Ur-Einen, seinem Schmerz und Widerspruch, eins geworden" (ebd. S. 38). Der Lyriker produziere das Abbild dieses Ur-Einen als Musik, sei also Nachahmer des dionysischen Kunsttriebes der Natur. Hier sieht Nietzsche den "neuen Keim [...], der sich nachher bis zur Tragödie und zum dramatischen Dithyrambus entwickelt.".
VI.3.1.3. Die attische Tragödie als Versöhnung appolinischer und dionysischer Kunst
Nietzsche sieht zunächst das Widerstreiten des apollinischen und des dionysischen in der dorischen Kunst als ein kriegerisches. Das dionysische durchbricht immer wieder das apollinische und versucht es zu überherrschen, während das apollinische dem zu trotzen eine verhärtete übermäßige Strenge gewinnt.
Ich vermag nämlich den dorischen Staat und die dorische Kunst mir nur als ein fortgesetztes Kriegslager des Apollinischen zu erklären: nur in einem unausgesetzten Widerstreben gegen das titanisch-barbarische konnte eine so trotzig-spröde, mit Bollwerken umschlossene Kunst, eine so kriegsgemäße und herbe Erziehung, ein so grausames und rücksichtsloses Staatswesen von längerer Dauer sein.
Das ständige Widerstreiten der beiden Triebe in der griechischen Kunst, die "immer neuen aufeinanderfolgenden Geburten" sieht Nietzsche als Teil einer Entwicklung, die auf eine Versöhnung oder Verschmelzung beider Triebe zuläuft.
Wenn auf diese Weise die ältere hellenische Geschichte, im Kampf jener zwei feindseligen Prinzipien, in vier große Kunststufen zerfällt: so sind wir jetzt gedrängt, weiter nach dem letzten Plane dieses Werdens und Treibens zu fragen, falls uns nicht etwa die letzterreichte Periode, die der dorischen Kunst, als die Spitze und Absicht jener Kunsttriebe gelten sollte: und hier bietet sich unseren Blicken das erhabene und hochgepriesene Kunstwerk der attischen Tragödie und des dramatischen Dithyrambus, als das gemeinsame Ziel beider Triebe, deren geheimnisvolles Ehebündnis, nach langem vorhergehenden Kampfe, sich in einem solchen Kinde - das zugleich Antigone und Kassandra ist - verherrlicht hat. (ebd. S. 36/37)
VII Bibiliographie
Primärtexte
Goethe, Johann Wolfgang. Wandrers Sturmlied. In: Goethes Werke. Band I. hrsg. v. Erich Trunz. Hamburg: C. Wegner. 1960. (5. Aufl. u.ö.).
Hölderlin, Friedrich. Brot und Wein. In: Friedrich Hölderlin : Dichtungen, Schriften, Briefe. hrsg. v. Pierre Bertaux. Frankfurt a.M. und Hamburg: Fischer, 1957.
Nietzsche, Friedrich. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Stuttgart: reclam, 1952.
Nietzsche, Friedrich. Werke. (6,1 u. 6,3) hg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin: de Gruyter, 1968.
Ovid: Metamorphosen. Dt. Übersetzung v. Reinhart Suchier. München: Goldmann, 1959. (Goldmanns Gelbe Taschenbücher Band 583 . 584).
Schiller, Friedrich. Die Götter Griechenlandes (Erste Fassung von 1788). In: Die deutsche Lyrik I. Form und Geschichte: Interpretationen, Vom Mittelalter bis zur Frühromantik. hg. v. Benno von Wiese. Düsseldorf: A. Bagel, 1956.
Sekundärtexte
Behre, Maria. "Des dunkeln Lichtes voll" - Hölderlins Mythoskonzept Dionysos. München: W. Fink, 1987.
Beyer, Uwe. Christus und Dionysos: Ihre widerstreitende Bedeutung im Denken Hölderlins und Nietzsches. Münster, Hamburg: Lit, 1992. (Philosophie, Bd. II.).
Böschenstein, Bernhard. ,,Frucht des Gewitters" Hölderlins Dionysos als Gott der Revolution. Frankfurt a.M.: Insel, 1989.
Bux, Ernst et. al. Wörterbuch der Antike. Stuttgart: A. Kröner, 1966. (7. durchges. u. erg. Aufl. ).
Cassirer, Ernst. Idee und Gestalt. Goethe - Schiller - Hölderlin - Kleist. Darmstadt: WB, 1971.
Hunger, Herbert (Hg.). Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Wien: Hollinek, 1959. (5. erw. u. erg. Aufl.).
Jamme, Christoph. "Vom `Garten des Alcinous' zum `Weltgarten' - Goethes Begegnung mit dem Mythos im aufgeklärten Zeitalter". In: Goethe Jahrbuch (105, 1988). hrsg. v. Karl-Heinz Hahn. Weimar: Böhlhaus, 1988. S. 93-114.
Kerényi, Karl. Die Mythologie der Griechen: Band I: Die Götter und Menschheitsgeschichten. München: dtv, 1981.
Kommerell, Max. Gedankenüber Gedichte. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1956.
Martens, Gunter. Friedrich Hölderlin. Reinbek: Rowohlt TB, 1996. (rowohlts monographien 586).
McGinty, Park. Interpretation and Dionysos: Method in the Study of a God. Den Haag: Mouton, 1978. (Religion and Reason 16).
Otto, Walter F. Dionysos. Mythos und Kultus. 3. unveränd. Aufl. Darmstadt: WB, 1960.
Peterich, Eckart und Grimal, Pierre. Götter und Helden: Die klassischen Mythen und Sagen der Griechen, Römer und Germanen. 4. Aufl. München: DTV, 1985.
Schmidt, Jochen. "Pindar als Genie-Paradigma im 18. Jahrhundert". In: Goethe Jahrbuch (106, 1948). hrsg. v. Karl-Heinz Hahn. Weimar: Böhlhaus, 1984. S. 63-73.
Staiger, Emil. Goethe. 1749-1786. Band I. Zürich u. München: Artemis, 1978.
Trevelyan, Humphry. Goethe and the Greeks. New York: Octagon, 1982. (1. Aufl. 1941).
[...]
1 Auch: Brod und Wein
2 McGinty, Park. Interpretation and Dionysos: Method in the Study of a God. Den Haag: Mouton, 1978. (Religion and Reason 16). S. 2.
3 Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen in diesem Kapitel hauptsächlich folgenden Quellen entnommen: Hunger, Herbert (Hg.). Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. 5. erw. u. erg. Aufl. Wien: Hollinek, 1959. S. 92-96. Bux, Ernst et. al. Wörterbuch der Antike. 7. durchges. u. erg. Aufl. Stuttgart: A. Kröner, 1966. S. 124/125.
4 Otto, Walter F. Dionysos. Mythos und Kultus. Darmstadt: WB, 1960. S. 49.
5 Ebd. OTTO, S. 51
6 Ebd. S. 52.
7 Siléne - zweibeinige halbmenschliche Pferdewesen. Silenos begleitet Dionysos, huldigt ausgiebig dem Weingenuß und wird mit vielen komischen Zügen (glatzköpfig, dickbäuchig, stumpfnasig, als Eselsreiter) dargestellt.
8 Zitiert nach OTTO, S. 65.
9 vergl. Peterich, Eckart und Grimal, Pierre. Götter und Helden: Die klassischen Mythen und Sagen der Griechen, Römer und Germanen. 4. Aufl. München: DTV, 1985. S. 37-39.
10 Vergl. Kerényi, Karl. Die Mythologie der Griechen. Band I: Die Götter- und Menschheitsgeschichten. München: dtv, 1981. S. 197.
11 ebd. OTTO, S. 80.
12 Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, S. 93.
13 Thyrsos - ein langer Stab aus Narthexstaude mit einem Pinienzapfen an der Spitze
14 vergl. Nietzsche Dionysos-Dithyramben: "Oh todtenstiller Lärm!"
15 Ovid Metamorphosen 3, 701-703 und 708-728
16 ebd. Peterich/Grimal, S. 38.
17 Cassirer, Ernst. Idee und Gestalt. Goethe - Schiller - Hölderlin - Kleist. Darmstadt: WB, 1971.
18 Zitiert nach: Wiese, Benno v. Schiller, die Götter Griechenlandes. In: Die deutsche Lyrik !. Form und Geschichte. Interpretationen vom Mittelalter bis zur Frühromantik. hg. v. Benno von Wiese. Düsseldorf: A. Bagel, 1956. S. 318-336.
19,,Setzt der Dichter die Natur und die Kunst und das Ideal und die Wirklichkeit so entgegen, daß die Darstelkung des ersten überwiegt, so nenne ich ihn elegisch" [...] Die Natur und das Ideal sind hier ein Gegenstand der Trauer, weil ,,jene als verloren, dieses als unerreicht dargestellt wird." Dennoch ist das [...] Ideal in den ,,Göttern Griechenlands" zugleich ,,ein Gegenstand der Freude", es wird als ,,wirklich vorgestellt"; und damit verwandelt sich die Elegie in jene Dichtungsgattung, die Schiller "Idylle" nennt (WIESE, S. 328).
20 In der Literatur auch oft in der Schreibweise Wandrers Sturmlied
21 Kommerell, Max. Gedankenüber Gedichte. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1956. S. 434- 449.
22 Staiger, Emil. Goethe. 1749-1786. Band I. Zürich u. München: Artemis, 1978. S. 68-74.
23 Schmidt, Jochen. "Pindar als Genie-Paradigma im 18. Jahrhundert". In: Goethe Jahrbuch (106, 1948). hrsg. v. Karl-Heinz Hahn. Weimar: Böhlhaus, 1984. S. 63-73.
24 Jamme, Christoph. "Vom `Garten des Alcinous' zum `Weltgarten' - Goethes Begegnung mit dem Mythos im aufgeklärten Zeitalter". In: Goethe Jahrbuch (105, 1988). hrsg. v. KarlHeinz Hahn. Weimar: Böhlhaus, 1988. S. 95/96.
25 ebd. TREVELYAN, S. 55.
26 Trevelyan, Humphry. Goethe and the Greeks. New York: Octagon, 1982. (1. Aufl. 1941).
27 "Wenn er die Pfeile ein übern andern nach dem Wolkenziel schiest steh ich freylich noch da und gaffe; doch fühl ich indess, was Horaz aussprechen konnte [...]" zitiert nach SCHMIDT, S. 65.
28 Vergl. TREVELYAN, S. 55.
29 Behre, Maria. "Des dunkeln Lichtes voll" - Hölderlins Mythoskonzept Dionysos. München: W. Fink, 1987.
30 Böckmann, Paul. Hölderlin - Brod und Wein. In: Die deutsche Lyrik !. Form und Geschichte. Interpretationen vom Mittelalter bis zur Frühromantik. hg. v. Benno von Wiese. Düsseldorf: A. Bagel, 1956. S. 394-414.
31 Martens, Gunter. Friedrich Hölderlin. Reinbek: Rowohlt TB, 1996. (rowohlts monographien 586).
32 Böschenstein, Bernhard. ,,Frucht des Gewitters" Hölderlins Dionysos als Gott der Revolution. Frankfurt a.M.: Insel, 1989. S. 25.
33 Vergl. BEHRE (Hölderlins Mythoskonzept Dionysos)
34 Erst in dem 15 Jahre später angefügten "Versuch einer Selbstkritik" betitelt Nietzsche seine früheren Aussagen als "Artisten-Metaphysik" (Geburt der Tragödie, S.5).
35 Nietzsche, Friedrich. Der Antichrist. (Werke 6,3). Nietzsche: Werke hg v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin: de Gruyter, 1969.
36 Ecce Homo. (ebd. S. 254-372).
37 ebd. Beyer, S. 20.
38 ebd.
39 ebd. Beyer, S. 21.
40 vergl. Beyer, S. 223.
41 Silenos, der Begleiter des Dionysos wird gefangen und vor König Midas gebracht. Danach befragt, was für den Menschen das Allerbeste sei, antwortet er das Allerbeste für die Menschen sei nicht geboren, zu sein, nichts zu sein und das Zweitbeste sei bald zu sterben.
- Arbeit zitieren
- Dorothea Stobbe (Autor:in), 1999, Dionysos - Rezeption einer antiken Göttergestalt in der deutschen Literatur: Dargestellt an ausgewählten Textbeispielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97567
Kostenlos Autor werden


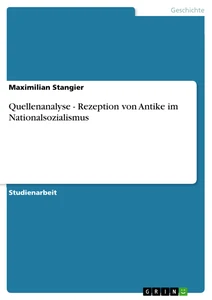



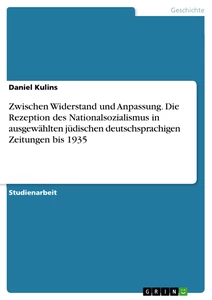

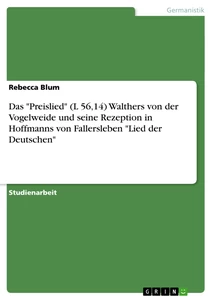







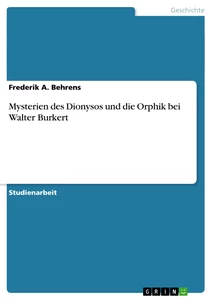


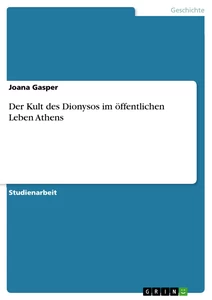
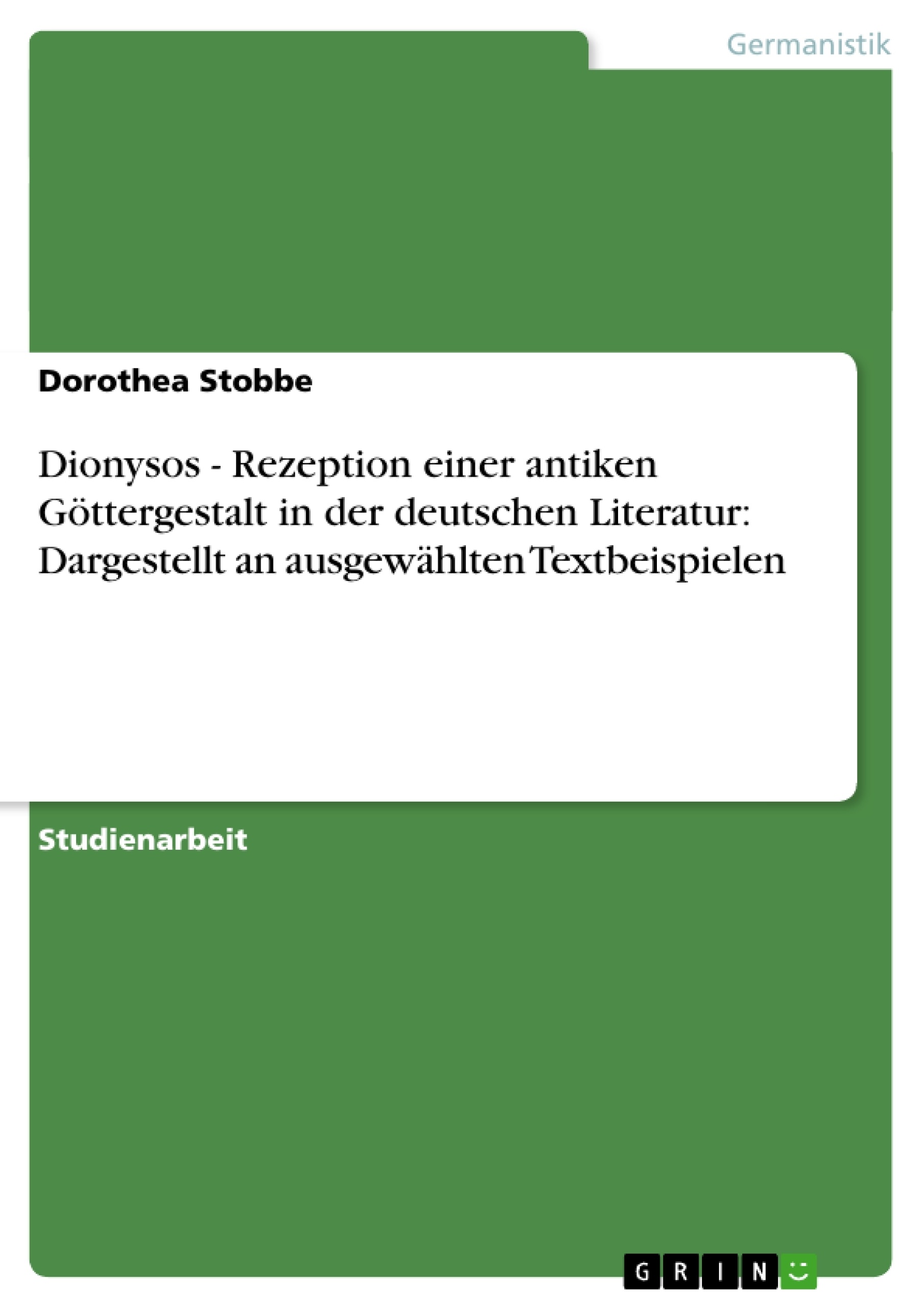

Kommentare