Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Allgemeines
2. Begrenzungen
II. Hauptteil
1. Die Sprache der Liebe (vergessen)
1.1. Liebe
1.2. Illusion
1.2.1. Sätze, Worte, Namen
1.2.2. Telefon, Briefe, Interviews, Gerede
1.2.3. Tabu
1.2.4. Das schöne Buch
2. Die Sprache der Träume (erinnern)
2.1. Analyse
2.1.1. Malina
2.1.2. Dialog
2.2. Vision
2.2.1. Orte der Macht
2.2.2. Bücher, Musik, Filme
2.2.3. Schreibverbot
2.2.4. Leben
3. Sprachverlust (erzählen)
3.1. Leben ¹ Schreiben
3.1.1. Männergeschichten
3.1.2. Briefgeheimnis
3.1.3. Nachrichtendienst
3.1.4. Inszenierung
3.1.5. Hallo - Holla
3.2. Das Rätsel der letzten zwei Seiten (schweigen?)
III. Abschluß
1. Das Bachmann-ICH und die ICH-Erzählerin
2. Die Vielgestalt der Sprache
Literaturverzeichnis
„Denn die Sprache ist für den Schreibenden nichts Selbstverständliches.“
Ingeborg Bachmann
I. Einleitung
1. Allgemeines
Der 1971 als erster und einziger vollendete Teil des Todesarten-Zyklus veröffent- lichte Roman >Malina< von Ingeborg Bachmann hat nicht zu Unrecht vielerlei Lesarten und Interpretationen heraufbeschworen, besteht er doch aus einem Ge- flecht von unterschiedlichen literarischen und musikalischen Formen, philosophi- schen und psychologischen Theorien, aus religiös oder rituell geprägten Elemen- ten, einer ausgefeilten Zahlensymbolik, poetischen Zitaten und verschiedenen Sprachen, historischen Zusammenhängen sowie aktuellen politischen Bezügen. Zu nennen wären in diesem Zusammenhang die klassische Dreiecksgeschichte (zwei Männer, eine Frau), der Kriminalroman („Es war Mord.“1 ), das Kunstmär- chen („Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran“2 ), die Satire (das Mühlbauer- Interview3 ; die Darstellung der „Künstlerkreise“ in St. Wolfgang4 ), Dialoge, Briefe, Monologe, librettoähnliche Passagen, Auflistungen von thematischen Sätzen und vieles mehr. Unter unzähligen anderen gibt es deutliche Bezüge zu Ludwig Witt- genstein, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Carl Jung, wie auf literarischem Gebiet zu Franz Kafka, Robert Musil, Jean Améry und natür- lich Paul Celan. Die unverkennbaren historischen und politischen Motive verdeutli- chen, daß Ingeborg Bachmann, wie sie selbst festgestellt hat, mit dem Todesar- ten-Projekt auf der Suche nach dem „Virus Verbrechen“5 war, der nach dem Ende der NS-Zeit „doch nicht ... plötzlich aus unserer Welt verschwunden sein“5 konnte. Das Aufspüren von Mordschauplätzen, an denen kein Blut fließt, keine Anklage er- hoben und kein Urteil gesprochen, aber dennoch unverkennbar gestorben wird, führte sie an die Tatorte alltäglichen Faschismus´, den sie vor allem auch in dem bestehenden gesellschaftlichen Mißverhältnis zwischen Männern und Frauen er- kannte.
Auf eine auch nur annähernd vollständige Auflistung oder gar lückenlose Aufde- ckung solcher Zusammenhänge soll an dieser Stelle verzichtet werden. Festzustel- len ist jedoch, daß sich in der analytischen Betrachtung innerhalb der dicht ge- knüpften Textstruktur des Romans immer wieder Abgründe auftun, grundsätzlich widersprüchliche Elemente, die selbstverständlich zu sich widersprechenden Interpretationsansätzen geführt haben, besonders in der Beurteilung der „Hauptfigur“ Malina und der Wertung der „Opferrolle“ der Ich-Erzählerin.
Diese beiden im Zusammenhang mit >Malina< zentral erörterten Fragen können als offenstehend angesehen werden und sind nicht eindeutig abzuschließen. Ob Malina sich als ausschließlich überlegen oder aber selbstverständlich als unterle- gen betrachten läßt und ob das Verschwinden der Ich-Erzählerin aufgrund einer (fragwürdigen) Opfertradition unumgänglich ist, dem grundsätzlichen Wahnsinn der Frau entspringt oder aber einen individuellen psychischen Verfall darstellt, das sind bei aller Dringlichkeit sekundäre Gesichtspunkte, die von der Klärung anderer wichtiger Fragen, z. B. der der verschiedentlich vorhandenen utopischen Elemente, ablenken. Zumindest soll an dieser Stelle auf eine Verstrickung in die Opfer-Täter-Diskussion, also die Lösung der Schuldfrage, verzichtet und ein eindeutiger Standpunkt in der Hinsicht nicht eingenommen werden.
Auch die immer wieder aufgeworfene Frage der biographischen Zusammenhänge ist zwiespältig beantwortet, einerseits ganz und gar verworfen und andererseits bis zur Ein-zu-Eins-Übertragung durchexerziert worden. Die Tatsache, daß Inge- borg Bachmann, die „das Erzählen von Lebensläufen, Privatgeschichten und ähnli- chen Peinlichkeiten“6 eher ablehnte, >Malina< als „Eine geistige, imaginäre Auto- biographie.“7 bezeichnet hat, spricht eine deutliche Sprache. Eine genauere Stel- lungnahme scheint mir bei einer Betrachtung der literarischen Bemühungen der Ich-Erzählerin, die hier geleistet werden soll, unerläßlich. Sie soll jedoch erst ab- schließend geschehen.
Eine oft vertretene Ansicht ist die, die Ich-Erzählerin und Malina zusammen als die eigentliche Hauptfigur zu betrachten, als ein auf den ersten Blick nicht klar abge- grenztes Individuum, dessen zwei ihm zugehörigen, im Roman durchaus unab- hängig voneinander agierenden Spielfiguren lediglich unterschiedliche Aspekte ein und derselben Person darstellen. Stützen läßt sich diese Auffassung durch die theoretischen Ausführungen Carl Jungs, wonach im Individuationsprozess des Menschen eine weibliche Instanz im Mann (Anima) und eine entsprechend männ- liche in der Frau (Animus) ausgebildet wird. Entwicklungsgeschichtlich läßt sich Malina jedoch auch als eine Nachfolgepersönlichkeit denken, die aus dem Ich der Erzählerin erwachsen ist, eine erfundene Figur also, reine Fiktion und als solche von der Gunst seiner Erzählerin abhängig. Doch auch unter diesem Aspekt ist die schizoide Grundstruktur unverkennbar, die an keiner Stelle erklärt oder gar aufge- hoben ist, sie wird im Gegenteil immer weiter ausgearbeitet, verfeinert und an- satzweise auf noch weitere „Personen“ (Lina, Lily) übertragen.
Indizien für die Richtigkeit einer Doppelgängerkonzeption sind also vielfältig vor- handen. Ingeborg Bachmann selbst gibt eindeutige Hinweise darauf, sowohl indi- rekt in den Frankfurter Vorlesungen, wo sie von dem „Versuchsfeld Ich“8 spricht, als auch direkt auf >Malina< bezogen, indem sie sich z. B. über die „Zwitterfigur“ äußert, die „Ich-Figur“, die einen männlichen „Doppelgänger“ hat9, sowie natürlich in >Malina< selbst. („... die Doppelfiguren und ihre Tanzschritte.“10 ; „..., daß ich doppelt bin. Ich bin auch Malinas Geschöpf.“11 ; „So ist leider Malina, und so bin leider ich.“12 ; „Malina und ich, weil wir eins sind: die divergierende Welt.“13 ; „..., es ist ein anderer in mir, ...“14 ; „Du bist nach mir gekommen, du kannst nicht vor mir dagewesen sein, du bist überhaupt erst denkbar nach mir.“15 ; „... nicht das Bild von einem Menschen, sondern von zweien, die im äußersten Gegensatz zu- einander stünden, es müsse eine dauernde Zerreißprobe für mich sein, ...“16 ) Eine strikte Festlegung auf diese eine Lesart scheint bei der Vielschichtigkeit des Ro- mans zwar unangebracht, ist aber doch für genauere Betrachtungen hilfreich und soll auch hier weitgehend zugrunde gelegt werden.
2. Begrenzungen
Ohne die im Vorfeld erwähnten Aspekte aus den Augen zu verlieren, soll im folgenden ein genauerer Blick auf das Schriftstellerinnen-Ich geworfen werden, auf die Arbeit, die die weibliche Hauptperson leistet. Sie ist es, die den gesamten Text vorträgt. Einzig durch ihre Wahrnehmung und Vermittlung werden sämtliche anderen Figuren, einschließlich Malinas, betrachtet, dargestellt und gewertet. Immer wieder wird demontiert, neu aufgebaut, umgedeutet und variiert, die unterschiedlichsten Ebenen auf diese Art geschickt miteinander verbunden.
Das Ringen um und mit Sprache steht im Zentrum des Romans, der ausschließlich aus literarischen Versuchen besteht. In unterschiedlicher Weise werden die Bemü- hungen der Ich-Erzählerin vorgeführt, die sich allerdings nicht ausschließlich auf das Gebiet des Schreibens konzentrieren. Intensive Ausarbeitungen („Die Geheim- nisse der Prinzessin von Kagran“17 ) stehen neben reinen Skizzen (Listen, Satz- gruppen, Briefe) und Erzählübungen (Die Geschichte des Briefträgers Otto Krane- witzer18 und die vom Tod Marcels19 ). Doch auch Textpassagen, die scheinbar kei- nem eindeutig literarischen Bestreben zuzuordnen sind, lassen sich so interpretie- ren. Überall zeigt sich „schreibendes“ Denken, Sehen, Fühlen und Wissen, die im Grunde zwangsläufige Lebensart einer Erzählenden, der gedankliche Alltag einer
Schriftstellerin, die nicht zu Unrecht um den Fortbestand der Worte bangt. Und damit um ihre eigene Existenz.
Schreiben zu können ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, Wirklichkeiten zu er- fassen und auszudrücken und der Ich-Erzählerin eine existentielle Grundbedin- gung. Diese allerdings ist in Gefahr geraten, einerseits durch eine raumgreifende Unfähigkeit der Ich-Erzählerin, die sich offensichtlich nur noch schwer im Leben zurechtfindet, andererseits durch die Wucht des zu bewältigenden Materials, die zu bezeugende Wahrheit, die sich in vielerlei Hinsicht als un(be)greifbar erweist.
Auch die Unzulänglichkeit der Sprache selbst wird mehr und mehr zu einer beson- ders zwischen Malina und der Ich-Erzählerin kontrovers diskutierten Problematik.
So ist die unüberwindbare Kluft zwischen Kunst und Leben, zwischen dem Gesag- ten und dem Gemeinten beständig gegenwärtig und eines der zentralen Themen des ganzen Romans. Immer wieder wird die Frage nicht funktionierender Kommu- nikation aufgeworfen und die daraus resultierende Erfahrung unsagbarer Wirklich- keit variabel durchgespielt. Wie bei einem angestrengten Blick in eine Nebelwand verschwimmen mehr und mehr die Konturen, die Grenzen der Bilder wie der Wor- te, bis am Ende auch die unverzichtbare (?) Figur der Erzählerin spurlos verschwunden ist, scheinbar nie existiert hat.
II. Hauptteil
1. Die Sprache der Liebe (vergessen)
Die Ich-Erzählerin trifft Ivan auf der Straße, folgt ihm und geht noch am selben Tag (heute!) ein Verhältnis mit ihm ein. Damit stürzt sie augenblicklich, noch vor der eigentlichen Begegnung, vor dem ersten Wort sogar, in bodenlose Abhängigkei- ten. Sie reduziert sich und ihr Leben auf ihr „Ungargassenland“20, in dem nur zwei Häuser stehen, seines mit der Nummer 9 und das ihre mit der Nummer 6. Darüber hinaus ist nichts mehr von Bedeutung, alles ist ausschließlich auf die nächste Ver- abredung, auf eine mögliche zufällige Begegnung oder ein herbeigesehntes, aber nicht unbedingt erfolgendes Telefonat ausgerichtet. Zwischen Warten und Rau- chen und den wenigen, überwiegend enttäuschenden Treffen kreisen die Imagina- tionen der Ich-Erzählerin, immer in dem Bestreben, gedanklich die Eindeutigkeit der Beziehung herstellen zu können. Eine äußere Welt als Fixpunkt ist nicht mehr existent, stellt schlimmstenfalls eine Bedrohung dar, bestenfalls etwas ebenso Unwichtiges wie Unwirkliches, das es zu vergessen gilt.
1.1. Liebe
Die Fortdauer des Zustands ausgesprochener Unklarheit, in dem die Ich-Erzäh- lerin sich aufhält, sowie die zum Teil demütigende Behandlung, die sie durch ihren Liebhaber erfährt, aber kaum noch wahrnimmt, sind selbst mit einer ers- ten verliebtheitsbedingten Verwirrtheit auf die Dauer nur schwer zu entschuldigen. Vielmehr scheint ein solches Verhalten einem tiefverwurzelten selbstquälerischen Prinzip zu entspringen.
Konträr zu den vielfach wiederholten Beschwörungen der Ich-Erzählerin, in I- van einer einzigartigen, einer wahren Liebe begegnet zu sein, die Ewigkeiten überdauern wird, steht die Unverbindlichkeit des Mannes, der, vermutlich aus Bequemlichkeit, wegen der Nähe der beiden Wohnungen, der leichten Verfüg- barkeit einer Frau nebenan, zunächst nicht geneigt ist, das Verhältnis sofort wieder aus den Augen zu verlieren. Sein Interesse an gelegentlichen Treffen ist aber eher gering, meist ist er zu müde, wenn er aber kommt, dann bleibt er nicht lang. Auch gemeinsame Unternehmungen sind selten und zeitlich knapp bemessen, lediglich das Schachspielen und Telefonieren beherrscht er meisterhaft und damit das taktische Spiel des Hinhaltens, das aber nach seinen Regeln und Gesetzen zu erfolgen hat, wie überhaupt die ganze Affäre.
Die Unmöglichkeit einer wirklichen Liebe tritt in den Passagen, in denen Ivan zugegen ist, überdeutlich zutage. Seine Haltung in bezug auf die Bücher der Ich-Erzählerin ist ebenso vernichtend wie seine Einstellung ihr selbst gegen- über, die er von Anfang an herrisch behandelt, mit der er spricht wie mit einem Kind, entweder beiläufig, belanglos oder aber befehlend. Dennoch bezieht er mitunter klar Stellung, auch wenn er nicht dazu aufgefordert wird („Ich liebe niemand. Die Kinder selbstverständlich ja, aber sonst niemand.“21 ), und immer wieder bekundet er deutlich sein Desinteresse. („... er geht besonders rasch zur Tür, wie immer ohne Gruß.“22 ; „...denn er wird nie wissen wollen, ...“23 ) Er schämt sich für nichts, weder für seine Neigung, Wirklichkeit einzig an ihrer Funktionalität zu messen, noch für seine demonstrativ zur Schau getragene
Oberflächlichkeit. Sein Hauptinteresse gilt dem, was er „das Spiel nennt“24, und „im Spiel zu bleiben“25 verlangt er auch von der Ich-Erzählerin. Nicht zuletzt der Versuch, diesen strengen Vorgaben Ivans Folge zu leisten, stürzt sie im zweiten Kapitel in die Abgründe der Traumsequenzen.
1.2. Illusion
Die unübersehbar vernichtende Komponente der „Liebesgeschichte“ mit Ivan wird von der Ich-Erzählerin über weite Teile des ersten Kapitels kunstvoll über- spielt, wohl wahrgenommen, aber unter größten Anstrengungen immer wieder bewußt auf die Seite geräumt. Hierbei kommt der Macht der Sprache und ihrer Vieldeutigkeit eine übergeordnete Bedeutung zu. Die Ich-Erzählerin beherrscht die Situation einzig aus dem Grund, daß sie sie unaufhörlich sprachlich zu fas- sen versucht. Indem sie einerseits gedanklich ein permanentes Sprechen und Deuten in sich austrägt, andererseits aber auch tatsächlich schreibt, sich zumindest bemüht, wenn auch vieles, insbesondere Arbeiten der Alltagssprache, entsetzt wieder verworfen werden, ermöglicht sie sich die einzige kontinuierliche Linienführung, der sie noch fähig ist.
Die entscheidende Bedeutung, die paradoxer Weise ausgerechnet Ivan in diesem Zusammenhang zugesprochen wird, ist enorm.
Denn er (= Ivan s.e.) ist gekommen, um die Konsonanten wieder fest und faßlich zu machen, um die Vokale wieder zu öffnen, damit sie voll tönen, um mir die Worte wieder über die Lippen kommen zu lassen.26
Einer solchen Überhöhung zu entsprechen scheint unmöglich. Selbst wenn I- van, was nicht der Fall ist, davon wüßte, wäre die Aufgabe der Rettung eines Menschen, der Erhaltung seiner Sprach- und Lebensfähigkeit in der Welt durch die lediglich projizierte Kraft der wahren Liebe („... Injektionen von Wirklich- keit.“27 ) kaum zu leisten.
Sprache ist der Schriftstellerin jedoch zwangsläufig weit über die Verbindung zu Ivan hinaus wichtig. Aus ihr, und nicht aus ihm, zieht sie die letzte Versi- cherung im Leben, ihre so gering bemessene Sicherheit. Mit Hilfe der Worte, derer sie nicht mehr fähig zu sein glaubt und die sie nur aus diesem Grund un- ablässig aus Ivan auszugraben versucht, erforscht sie ihr tägliches Erleben, folgt allen Widrigkeiten zum Trotz einer Sehnsucht nach Vollständigkeit. Die feste Überzeugung von der Existenz des Unsagbaren, mehr noch, der Überein- stimmung von Wahrheit und Klang im Kern der Sprache ist das tatsächliche Motiv ihrer Suche nach der wahren Liebe, deren Name letztlich auch anders lauten könnte als Ivan.
1.2.1. Sätze, Worte, Namen
Besonders im ersten Kapitel springt die Isolierung von Sätzen, die im Zu- sammenhang mit Ivan entstehen, und deren Kategorisierung und zwang- hafte Festschreibung in regelmäßig auftauchenden Auflistungen ins Auge. („Immerhin haben wir uns ein paar erste Gruppen von Sätzen erobert, ...“28 ) Meist nicht mehr als Sprachfetzen, Satzanfänge, Satzenden und Halbsätze werden hier unter Rubriken zusammengefaßt, die z.B. Telefonsätze,
Schachsätze, Kopfsätze, Beispielsätze, Lehrsätze, Müdigkeitssätze und Schimpfsätze heißen. Diese fleißige Sortierarbeit der einmal in die Welt ge- setzten Wortgefüge bildet das Fundament, auf dem die Illusion einer funkti- onierenden Kommunikation ebenso gestellt werden kann wie die der Ewig- keit. In seinen Fragmenten ist Ivan bedingt tragfähig, tatsächlich getragen jedoch wird die Liebesillusion allein von der Bereitwilligkeit der Ich- Erzählerin. Daß sie dabei angewiesen ist auf eine, wenn auch geringfügige,
Mitarbeit seinerseits, ist allen Beteiligten von Anfang an vertraut. („..., und wenn er keine Lust hat, mit mir Sätze zu bilden, stellt er sein oder mein Schachbrett auf, ... , und zwingt mich zu spielen.“29 ) Der alltägliche Kampf um diesen minimalen Beitrag ist unverhältnismäßig hart und die Ausbeute meist unzureichend oder aber unverdient. („Doch erwartet mich der höchs- te Preis dafür Fünf Stunden mit Ivan, das könnte reichen für ein paar Tage Zuversicht, ...“30 ; „... es könnte Ivan sein, aber dann lege ich den Hö- rer leise nieder, weil mir für heute kein letzter Anruf erlaubt war.“31 ) Sätze über Gefühle gibt es dementsprechend nicht, „weil Ivan keinen aus- spricht,“32 und weil die Ich-Erzählerin ihrerseits, mit der Kraft des gespro- chenen Wortes und vermutlich auch der tatsächlichen Einstellung Ivans vertraut, den grundlegenden ersten Satz nicht wagt. (..., ich muß den ers- ten Satz finden, ich bin nicht vorbereitet.“33 )
Auch einzelne Worte erhalten eine besondere Gewichtung. Sie werden den Personen als Besitz zugeordnet („..., es ist kein Wort von mir, es ist ein Wort von Ivan - ...“34 ) oder aber in ihrer Gesamtheit intensiv betrachtet und begutachtet. („..., über die Wörterbücher gebeugt, über die Worte herge- macht, wir suchen alle Orte und Worte auf und lassen die Aura aufkom- men, ...“35 )
Namen werden ähnlich, aber mit noch größerer Tragweite eingeschätzt, zum Teil ist es völlig unmöglich sie auszusprechen. Der eigene Name taucht nirgends vollständig auf, Briefe werden, wenn überhaupt, mit „Eine Unbekannte“36 unterzeichnet. Der Name des guten Virus der Liebe, der weit über die Grenzen des „Ungargassenlandes“ hinaus allen Menschen helfen könnte, ist zwar bekannt, darf aber auf keinen Fall in Ivans Gegenwart ge- nannt werden.37 Herr Ganz wird allein aufgrund der alltäglichen Ungeheuer- lichkeit seines Nachnamens als unangenehm empfunden, so daß der Er- träglichkeit wegen zumindest ein Buchstabe abgewandelt, besser aber gleich die ganze Person gemieden werden muß, da sich ein Ausweichen auf den Vornamen aus Gründen der Distanz ebenfalls als unmöglich erwie- sen hat.38
Ivans Name dagegen wird zelebriert. („Sein Name ist ein Genußmittel für mich geworden.“39 ) Er wird oft und gern ausgesprochen, zumindest aber gedacht und auf diese Weise in der ganzen Stadt verteilt. („... ich sorge dafür, daß Ivans Name überall in der Stadt fällt, geflüstert und leise gedacht wird.“40 ) Einzig sein Name, dieses Wort darf unwidersprochen sein. („... wie könnte dieses Wort, das heute schon für die Zukunft steht anders hei- ßen als Ivan.“41 )
1.2.2. Telefon, Briefe, Interviews, Gerede
Die überlebenswichtigen Telefonate der Ich-Erzählerin („...Injektionen von Wirklichkeit.“42 ) sind ausnahmslos bruchstückhaft und unvollständig wie- dergegeben, sie tauchen lediglich innerhalb der Auflistungen einzelner Sät- ze auf (siehe II.1.2.1.) und sind keiner Person explizit zuzuordnen. Das Tele- fon an sich ist, ähnlich wie die Briefe, einerseits ein heiliges Objekt („... ich knie auf dem Boden vor dem Telefon und hoffe, ...“43 ), andererseits aber nur schwer zu handhaben. („..., wer weiß schon, was ein Telefon tut ...“44 )
Durch die Art und Weise seiner augenblicklichen Beschaffenheit, wie sehr sich die Schnur verdreht hat, wie schrill der Ton klingt - oder eben nicht klingt - und wie sich der Hörer anfühlt, sind Rückschlüsse auf das Funktionieren, bzw. Nichtfunktionieren der Kommunikation möglich.45
Unzählige Briefe sammeln sich auf dem Schreibtisch der Ich-Erzählerin und warten auf ihre Beantwortung, die letztendlich aber niemals erfolgt. Die Schriftstellerin, die mit dem Finden einer neuen Sprache, der Sprache der Liebe beschäftigt ist, hat ihr alltagstaugliches Sprachvermögen weitgehend eingebüßt. In ihrem fortwährenden Kampf um Ordnung auf diesem Gebiet, den sie mit Fräulein Jellinek austrägt, die „vor der Schreibmaschine sitzt und wartet, sie hat zwei Blätter eingezogen und ein Karbonpapier dazwi- schen,“46 zeigt sich, daß es vor allem die Einengungen sind, die Erwartun- gen anderer, die es der Ich-Erzählerin unmöglich machen, die richtigen Worte zu finden. Wobei die Ursache des Versagens eher in einem Zuviel als in einem Zuwenig zu suchen ist.
In dem Mühlbauer-Interview47 wird diese unerträgliche sprachliche Diskre- panz, „die Schizothymie, das Schizoid der Welt, ihr wahnsinniger, sich wei- tender Spalt“48 mit satirischen Mitteln, aber auch in tragischer Weise vorge- führt. Daß sich das Unverständnis, auf das die Ich-Erzählerin in dem Frage- Antwort-Spiel trifft, in erster Linie als Inkompatibilität ihres sprachlichen Vermögens mit der wenig differenzierten Sprache der Printmedien erklären läßt, ist nur eine Seite der Medaille. Die andere beinhaltet wiederum die Un- fähigkeit zur Kommunikation, das Zuviel an Wissen und das „Kranksein an der Zeit“49, in diesem Fall durch die Gepflogenheiten des Herrn Mühlbauer repräsentiert, das die Ich-Erzählerin ständig begleitet.
Ihre Kapitulation erfolgt schließlich vor den Anforderungen der „Künstlerkreise“ in St. Wolfgang, deren Gerede sie nicht anders als als Lüge begreifen kann.50 Die offensichtlich nicht mehr vorhandene Übereinstimmung von Wort und Inhalt, von Tonfall und Geste, von Gesagtem und Gedachtem, vor allem aber die Selbstverständlichkeit dieser Mißverhältnisse, das alles ist ihr dermaßen unerträglich, daß sie fluchtartig die Rückkehr in die Einsamkeit und Tiefe ihres „Ungargassenlandes“ antritt.
1.2.3. Tabu
Neben aller Dringlichkeit, die Wahrheit sagen zu können, die Dinge aus- sprechen zu müssen und sie zwanghaft festzuschreiben, steckt die Ich- Erzählerin andererseits immer wieder weite Bereiche ab, über die nichts gesagt werden darf. Das Schlafzimmer beispielsweise wird - sprachlich - nie betreten, obwohl die Affäre mit Ivan unverkennbar auch auf diesem Gebiet stattfindet. („Das also ist deine Religion, ...“51 ) Das Wiederherstellen von Tabus52 umfaßt jedoch nicht nur den Bereich privater Indiskretionen, wie sie etwa im Mühlbauer-Interview53 begangen oder in den Ausführungen zum Du- und zum Sie-sagen54 verdeutlicht werden, sondern in verkehrter Weise auch den der Politik und der damit verbundenen Macht. („..., es sind die Sprachlosen, die zu allen Zeiten regieren.“55 )
1.2.4. Das schöne Buch
Nachdem Ivan in den fragmentarischen Schreibversuchen der Ich-Erzähler- in gestöbert und diese ebenso verworfen hat wie den gesamten Bestand ihrer Bibliothek („... diese Bücher sind widerwärtig.“56 ), entsteht parado- xerweise der Wunsch, ihm, der es sicherlich nie lesen wird, >Das schöne Buch< zu schreiben. Dieses Werk, das im krassen Gegensatz zu den unmit- telbar zuvor verworfenen Ansätzen (TODESARTEN) steht und die reine
Freude (ESULTATE JUBILATE57 ) verkörpern soll, folgt einer „Eingebung“, die nahezu wortwörtlich ausgerechnet von Ivan übernommen wird.58
Ein Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und dann ein Leuchten, einige Silben flimmern schon auf, und aus allen Satzschachteln fliegen bunte Kommas, und die Punkte, die einmal schwarz waren, schweben aufgeblasen zu Luftballons an meine Hirndecke, denn in dem Buch, das herrlich ist und das ich also zu finden anfange, wird alles sein wie ESULTATE JUBILATE [!].59
Als Ivan kurz darauf beiläufig erklärt, daß er niemanden liebe,60 folglich auch nicht die Ich-Erzählerin, und er bald danach etwas ausspricht, was ei- ner Drohung gleichkommt („Ich lösche dir aber einmal alle Lichter aus, schlaf du endlich, sei glücklich.“61 ), stürzt das nur mühsam aufrecht erhal- tene Bild, das die Schriftstellerin von ihm pflegt, nicht etwa in sich zusam- men. Tatsächlich beginnt sie unbeirrt zu arbeiten, >Das schöne Buch< zu verfassen. Wieder einmal tritt die Sprache ins Zentrum des Geschehens, soll retten, was nicht mehr zu retten ist, die Illusion der wahren Liebe be- wahren.
„Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran“62, die die Ich-Erzählerin nie- derzuschreiben beginnt, finden sich als ein mehrseitiger vollständiger Teil sowie in einigen Fragmenten im ersten Kapitel. Bruchstücke, die als diesem Komplex zugehörig bezeichnet werden können, sind auch im dritten Kapitel vorhanden, und im zweiten Kapitel tauchen etliche der inhaltlichen Kompo- nenten der Erzählung als Traumfragmente auf. Der Versuch: >Das schöne Buch<, den die dem Roman inhärente Kagran-Legende darstellt, zieht sich wie ein roter Faden durch das Denken der Ich-Erzählerin und läßt sich, ne- ben dem märchenhaften Liebesabenteuer der Prinzessin und des Fremden, im Wesentlichen als eine Utopie von Sprache im weitesten Sinne lesen.
Die Zeit ist unbestimmt. Obwohl es noch keine Grenzen gibt, existiert ein Land, in dem Sprache zu Hause ist. Die Rückkehr in dieses Land, die Heim- kehr in die ureigene Sprache also, ist das Ziel der Reise. Sprache selbst ist einerseits untrennbar verbunden mit Wahrnehmung, dem Sehen und erfas- sen können, was Wahrheit ist, andererseits aber ist die Bedeutung der Wor- te aufgehoben. Es genügt allein der Klang der Stimme, es reichen Blicke und Schweigen, um zu erkennen.
In diesen Sphären spielt sich die Begegnung der Prinzessin und des Frem- den ab, die zwar unter den Vorzeichen ihrer Gefangenschaft und seiner Ret- terrolle steht, aber dennoch unverkennbar Freiheit beinhaltet. Obwohl das Totenreich betreten wird und „die gewaltigste Kolonne aus Schattenwe- sen“63 immer näher rückt, ist die Hoffnung nicht verloren. Licht und Schatten erweisen sich als einander verwandt. („kein Menschenlicht ... nur ein Geisterlicht ...“; „Er war schwärzer als vorher das Schwarz um sie, ...“64 )
Die Verständigung der beiden Figuren hat zunächst weit weniger mit Wor- ten zu tun als vielmehr mit dem Klang der Stimme, des Fremden hoff- nungsvollem Gesang. Auch die Beschaffenheit der Augen, ihre grenzenlo- sen Fähigkeiten tragen bei zu der von der Prinzessin als absolut erkannten Gewißheit der Liebe. Daraus erwächst Sprache. Sie nach der fragwürdigen Bedeutung der Worte zu bemessen, käme dem Versuch gleich, „eine Gren- ze durchs Wasser65 “ zu ziehen. Grenzen aber existieren nicht.
An der „Grenze der Menschenwelt“66 jedoch lauert Gefahr. Die vermeintliche Eindeutigkeit der Worte nimmt überhand, und auch die Prinzessin und der Fremde werden davon eingenommen. Ihre Trennung, ihr Tod kann nicht mehr verhindert werden. Beide gehen den ihnen vorgezeichneten Weg, von dem sie weiß, weil sie gesehen hat, bevor sie ihre Augen verliert.67 Beschreiben allerdings kann sie nur noch unzulänglich. („... Was ist ein Jahrhundert? ... Was sind Stadt und Straße? ... ich weiß nur die Worte dafür, doch wir werden es sehen, ...“68 )
Die anschließend in den verstreuten Fragmenten der „Geheimnisse“ immer wieder erfolgenden Beschwörungen der Augen und Hände, der lang ver- gangenen und kaum erinnerten Zeit („Einmal werden alle Frauen goldene Augen haben, ...“; „... die Poesie ihres Geschlechts wird wiedererschaffen werden ... “69 ; „Ein Tag wird kommen ... an dem ihre Hände begabt sein werden für die Liebe, und die Poesie ..."70 ) können nicht verhindern, daß die massiven Störungen der alltäglichen Menschenwelt ihren Weg auch in >>Das schöne Buch< finden. („..., und sie kämmte sich ihr goldenes Haar, sie raufte sich, nein! und im Wind wehte ihr goldenes Haar, ...“71 ) (Hervorh.: s.e.) In letzter Konsequenz verkehrt sich die Utopie in ihr Gegenteil.
Kein Tag wird kommen, es werden die Menschen nie- mals, es wird die Poesie niemals, und sie werden nie- mals, die Menschen werden schwarze, finstere Augen haben, von ihren Händen wird die Zerstörung kommen, ... .72
2. Die Sprache der Träume (erinnern)
Die Grundbedingungen des zweiten Kapitels sind deutlich von den bisherigen Vor- aussetzungen abgesetzt. In einer knappen Vorrede wird alles Maß der Dinge aus- drücklich aufgehoben, die vertrauten Einheiten von Zeit und Raum sind nicht mehr greifbar, und auch die faktische Realität wird als nicht unbedingt gegeben ange- zeigt, ebenfalls ein Umstand, der bislang anders bestimmt war. Malina, der im ers- ten Kapitel nicht persönlich, nur indirekt in Erscheinung getreten ist, wird jetzt mit dem ersten Wort unmittelbar ins Zentrum gerückt, und die Ich-Erzählerin bestimmt, daß es sich im folgenden um „die Träume von heute nacht“73 handelt, die ihm rückhaltlos zur Kenntnis gebracht werden sollen.
Es soll also etwas zur Sprache gebracht werden, etwas Bestimmtes, wie über- haupt als zentrales Element des Romans immer wieder irgend etwas ganz Konkre- tes und dennoch nicht wirklich Greifbares endlich in Worte gefaßt werden muß. Der Kampf um das Finden und Aussprechen eben dieses einen, nicht genauer be- zeichneten Sachverhalts ist die treibende Kraft, die tragende Komponente auch des zweiten Kapitels.
Wie bereits in der Geschichte der Prinzessin von Kagran74 ist hier ebenfalls das Se- hen und Erkennen eng mit dem Wissen um die Wahrheit und mit der allein da- durch bestehenden Möglichkeit eines abschließenden Wortes verknüpft. („ ... ob- wohl es mich anwidert, ihn anzusehen, muß ich es tun, wissen muß ich, ..., wo- her das Böse kommt, ...“75 ) Die Ich-Erzählerin verfolgt konsequent den Weg in die Tiefe, Abgründe auszuleuchten und sich auf diese Art Klarheit zu schaffen, Wahr- heiten zu finden und auszudrücken, ist ihr einziges Bestreben. Um das ewig Ver- schwiegene begreifen zu können, nimmt sie vor allem auf sich selbst keine Rück- sicht mehr, und letztendlich geht sie daran zugrunde, womit sie in gewisser Weise ihr Ziel erreicht hat. („ ..., ich will, nur den Satz vom Grunde schreiben. Ich bin vernichtet ...“76 ) Sie zahlt den Preis der Einsamkeit für ihre Konsequenz, Ivan tritt die ganze Zeit nicht in Erscheinung, er taucht erst wieder auf, um sich endgültig zu verabschieden. Einzig Malina steht ihr in dieser Lage noch zur Seite und entwi- ckelt zwangsläufig seine zwiespältige Rolle bis zur Perfektion.
2.1. Analyse
Die Art und Weise des Umgangs mit der radikalen Bildersprache, die auf die Ankündigung der Übermittlung der Träume folgt, erinnert an die um die Jahr- hundertwende von Sigmund Freud entwickelte Psychoanalyse, die im Wesent- lichen der Behandlung neurotischer Störungen mit Hilfe der Erhellung unbe- wußter psychischer Prozesse dient. Die schonungslose Aufdeckung der nächtli- chen Träume und deren anschließende Ausdeutung durch den Analytiker, die in dem Zusammenhang entwickelt wurde (S. Freud: Die Traumdeutung, 1900), ist auch hier von entscheidender Bedeutung.
2.1.1. Malina
Mit seinem plötzlichen Auftreten als eigenständige Person, im ersten Kapi- tel nur angedeutet, erst ganz am Ende angekündigt, übernimmt Malina ent- schieden seinen zentralen Part. Als Repräsentant einer mentalen Kontrollin- stanz, die innerhalb der Ich-Erzählerin installiert ist, kommt ihm die lebens- wichtige Aufgabe zu, in dem Gewirr übereinanderstürzender Träume, Bilder und Geschichten größtmögliche Eindeutigkeit zu schaffen, mit allen ihm zur Verfügung stehenden rationalen Mitteln für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zwischen die einzelnen Traumpassagen geschaltet ist er es, der die Ich- Erzählerin im Leben hält, ihr zu trinken gibt, sich überhaupt um die notdürf- tige Abdeckung der grundlegenden Bedürfnisse ihrer physischen Existenz kümmert. („Malina hebt mich auf ...“77 ; „Es geht schon wieder, ... , ich hal- te dich ja, ...“78 )
Er hört ihr aber auch zu, läßt sie reden, wenn sie reden muß, fragt nach, redet mit und gibt vor, genauer als sie zu verstehen, was er selbst gar nicht gesehen hat. Sehen aber ist die Grundvoraussetzung, um sagen zu können, die Sprache zu sprechen, die der Musik gleichkommt. (siehe II.1.2.4.) Malinas Äußerungen dagegen sind knapp und präzise, wie es sich für einen Beam- ten des Heeresmuseums gehört. Besser als die Ich-Erzählerin scheint er zu wissen, wie die Worte gesetzt werden sollen, was gesagt sein muß, um ei- ne Erleichterung der Situation zu erreichen. („Darüber hat man nicht zu sprechen, man lebt eben damit.“79 ) Und die Erfüllung eben dieser präzisen Vorgaben fordert er vehement ein, ohne jemals auch nur den geringsten Zweifel an der Richtigkeit seiner Strategie zu hegen. (siehe auch II.2.1.2.)
Mitunter steht Malina auch nicht zur Verfügung, er schweigt, greift nicht ein, ist nicht einmal anwesend, sondern hat lediglich die Dinge bereitge- stellt, die gebraucht werden. („Malina ist nicht da, ... ich finde das Glas mit dem Mineralwasser, ... ich trinke, am Verdursten Warum schläft Malina jetzt? ... Er soll mir meine Worte erklären.“80 ) Doch mit seiner Abwesenheit kann die Ich-Erzählerin umgehen, besser als man erwarten würde. Sie schläft zwar nicht, weiß sich aber abzulenken, ist anschließend lediglich unzufrieden mit sich und mit ihm.81
2.1.2. Dialog
Die im Zusammenhang mit Malina erstmals auftauchende Dialogform ist von ausgesprochener Unausgewogenheit bestimmt. Zu behaupten, daß sich hier zwei Menschen verständigten, wäre vermessen, auch von gegen- seitigem Verstehen kann nicht die Rede sein. Respektlos durchbricht Malina die noch gar nicht vollständig entfalteten Gedankengänge der Ich-Erzähler- in, er wischt das eben Gesagte gnadenlos aus und setzt an die freigewor- dene Stelle seine nicht näher bezeichneten Erwartungen, die nur unter der Voraussetzung seiner Allwissenheit bestehen. („Hast du mir noch immer nichts zu sagen?“82 ; „Was gehen mich diese Geschichten an.“83 ; „... ich will deine Geschichte nicht, ...“84 ; „Du wirst es mir sagen, verlaß dich dar- auf.“85 ; „... es ist sinnlos, mit dir zu reden, solange du zurückhältst mit der Wahrheit.“86 ; „In dir ist kein Frieden, auch in dir nicht.“87 ) Seine kurzen Fra- gen und analytischen Weisungen, in denen von Fürsorglichkeit keine Rede mehr sein kann, stehen im krassen Gegensatz zu dem Redefluß (auch dem „inneren Redefluß“ der Träume) der zur Uferlosigkeit neigenden Ich-Erzäh- lerin, auf die dementsprechend sämtliche „Regieanweisungen“, also die ge- fühlsbetonenden Momente bezogen sind. Aufgrund dieser bestehenden Ungleichheit wird der Dialog zum zusätzlich ausgetragenen Kampf, der a- ber, ähnlich wie die Liebesbeziehung zu Ivan, nicht thematisiert wird.
Malinas gottgleiche Allwissenheit, die grundsätzliche Verhörstruktur der Dialoge und die beständig wiederholte Aufforderung, selber zu denken und richtig zu denken und es dann ihm zu sagen, zwingt die Ich-Erzählerin ei- nerseits dazu durchzuhalten, immer noch genauer hinzusehen, zu erken- nen, was kaum zu ertragen ist. Um sich dem von Malina geforderten, aber auch von ihr selbst gewünschten Verstehen zumindest annähern zu kön- nen, ist das eine unumgängliche Voraussetzung. Andererseits jedoch findet eine Reduzierung ihrer Sichtweise, sowie auch ihrer Sprache auf Malinas verengte Vorgaben statt, und ihr verzweifelt zitiertes „KRIEG UND FRIE-
DEN88 “ (Hervorh.: s.e.) mutiert letztendlich zu einem sinnlos akzeptierten „Es ist immer Krieg der ewige Krieg.“89 Das aber sind eindeutig Malinas Worte, nicht die ihren.
Vor allem anderen besteht die sprachliche Taktik Malinas aus fein gearbei- teter Suggestion („... du warst einverstanden.“90 ), wenn auch die ange- strebte Einflußnahme zunächst eindeutig der Rettung der Ich-Erzählerin dient, ihr Überleben in dieser Welt sichern soll. Wahrnehmung und Sprache sind aus diesem Grund jedoch auf das gerade noch erträgliche Maß eingeschränkt. Die Wahrheit aber, die in der Konzentration auf die Träume gesehen und gesagt werden soll, das erklärte Ziel der Ich-Erzählerin, wird voreilig einseitig, vor allem aber eindimensional gedeutet und auf eine dürftige Überlebensration zusammengegestrichen.
2.2. Vision
Da eine Reduzierung des zweiten Kapitels auf Sprache und Technik der Traumanalyse und deren grundlegende Problematik, wie sie unter 2.1. angedeutet wurde, als nicht ausreichend anzusehen ist, soll an dieser Stelle der Begriff >Traum< durch den der >Vision< erweitert werden.
Die explizit ausformulierten „Träume“, Inszenierungen eines fortdauernden Schreckens, sind treffender mit einer traumatisch veränderten Wahrnehmung zu erklären als mit nächtlichen Phantasiereisen, unbedacht im Schlaf geborenen Monstern. Sie sind einerseits die Antwort auf Malinas Fragen91 und in diesem Sinne nicht nur geträumt, sondern immer zugleich auch gesagt, zumindest in- wendig ausgesprochen und demzufolge aktiv gestaltet. Andererseits stellen sie das Resultat des im ersten Kapitel beständig beschworenen Versuchs von
Wahrhaftigkeit innerhalb der Sprache dar. Anstelle der dort fest ins Auge gefaß- ten Glücksvorstellung führen sie jedoch konsequent Todesangst und Todesar- ten der Ich-Erzählerin vor, decken die in der Gesellschaft vorherrschenden Machtverhältnisse und den daraus resultierenden alltäglichen Machtmißbrauch schonungslos auf. Denkbar wäre, nachdem irgend etwas mit dem Kopf der Ich- Erzählerin passiert ist („... was mir und meinem Kopf zugestoßen ist.“92 ), aber auch eine realistisch begründete Störung der Erinnerung93, etwa durch erlittene Behandlungen. Auch in diesem Fall ginge es weniger nur um Träume als viel- mehr auch um durch ein Trauma verursachte „Wahrnehmungsstörungen“, die möglicherweise als Wahnsinn, zumindest aber als Gestörtheit zu bezeichnen wären.
Im Zusammenspiel der beiden beteiligten Kräfte kommen Elemente der Erinne- rung (Ich-Erzählerin) ebenso zum tragen wie auch solche der Prophetie (Mali- na), ohne daß allerdings zwischen ihnen die notwendige Brücke geschlagen würde. (siehe II.2.1.2.) Daß das Element Zeit hierbei ausdrücklich aufgehoben ist („Die Zeit ist überhaupt nicht mehr,...“94 ), Vergangenheit und Zukunft also als Einheit im Jetzt auftritt, stellt zusätzlich einen erschwerenden Faktor dar, der es zunächst unmöglich erscheinen läßt, zu einem zufriedenstellenden Ergebnis finden zu können.
In seiner Gesamtheit betrachtet bildet der visionäre Anteil des Traum-Komplex- es ein krasses Gegenstück zu den insbesondere in den Schreibversuchen vorhandenen Zukunftsutopien des ersten Kapitels. (Das schöne Buch95 vs. Todesarten/„Buch über die Hölle“96 )
2.2.1. Orte der Macht
Bei den im Traum aufgesuchten Schauplätzen handelt es sich vorwiegend um Orte des Grauens, an denen Gefangenschaft und Vernichtung stattfin- den oder aber stattgefunden haben. Lüge, Angst und Folter werden an den verschiedensten Lokalitäten immer wieder durchgespielt, als wäre die Ich- Erzählerin auf der Suche nach einem adäquaten Standort, einem Gelände, das ihren Bedingungen, dem radikalen Bestreben, Wahrheit zu finden und zu sagen standhält. Mehr als die unaufhörliche Wiederholung der Zerstö- rung kommt dabei aber zunächst nicht zum Vorschein, ein solcher Ort scheint nicht zu existieren, zumindest aber unerreichbar zu sein. Dennoch werden auf diese Art Kirche97, Psychiatrie98 und Gaskammer99, Familie, Krieg und politische Manöver dicht nebeneinander gestellt, in ihrer vernichtenden Bedeutung entlarvt.
Dem Komplex Familie und Sexualität als intimsten und gefährdetsten aller möglichen Orte kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeu- tung zu. Durch sämtliche Träume hindurch zieht sich der ebenso viel- schichtige wie undurchsichtige Konflikt mit dem Vater („Der dritte Mann“100 ), der sich in jedem der oben genannten Bereiche als machtvoller Herrscher wiederfindet. Mutter, Schwester und Geliebte in ihren vielen ver- schiedenen ineinanderfließenden Versionen werden nur als Randerschei- nungen erwähnt, sie sind in ihren Konturen unscharf und zu wenig eigen- ständiger Handlung fähig, zum Teil verschwinden sie ergeben in der Figur des omnipotenten Vaters. („Mein Vater hat jetzt auch das Gesicht meiner Mutter.“101 ) Die einzig konkrete Benennung einer Ursache dieser grundle- genden Problematik lautet „Blutschande, es war Blutschande“102, womit ein wie auch immer gearteter Mißbrauch angedeutet ist. Ansonsten ist le- diglich mit großer Selbstverständlichkeit eine endlose Reihe von Demüti- gungen, Mißhandlungen und Quälereien aufgeführt, die offensichtlich kei- nerlei Begründung bedürfen.
Analog zu der familiären Situation steht der ständig wiederkehrende „Friedhof der ermordeten Töchter“103, der sich zu einer immer konkreter werdenden Bedrohung entwickelt, die letztendlich in der „Vorstellung“ vom Erwachen der Toten mündet, dem der Vater aber mit Hilfe eines eilig vollzogenen Massenmordes an den bereits Verstorbenen zuvorkommt.104
Im ausführlichen Aufsuchen dieser Orte, im detaillierten Ausleuchten des erlebten Schreckens wird, neben der wiederholten Belebung desselben, auch eine Exposition der Sprache der Gewalt bewirkt, die Spirale einmal in Gang gesetzter Vernichtung eindringlich aufgezeigt. Gleichzeitig jedoch erfolgt zwangsläufig eine Beschwörung der gegebenen Zustände und ihrer Unabänderlichkeit, was Malina bis zur Unerträglichkeit aufzugreifen und für seine vorgegebenen Zwecke auszuspielen versteht.
2.2.2. Bücher, Musik, Filme
Die Demontage der Bücher durch den Vater und seine Handlanger setzt ei- nen ersten Höhepunkt in der schrittweisen Beschneidung des literarischen Potentials der Ich-Erzählerin. Die Bücher gehören ihr, befinden sich bei ihr zu Hause, dementsprechend muß dort eingedrungen werden. Obwohl der Vater zuvor die Schlüssel an sich gebracht hat, wird Gewalt angewandt, das Haus wird verwüstet, Glas und Porzellan zerschlagen, das Mobiliar ebenso zerstört wie die Bücher. Zwar gelingt es der Ich-Erzählerin letztend- lich diese zu retten, indem sie sich gegen den Vater stellt, aber sie liegen bereits alle auf dem Boden, die Männer haben „ganze Arbeit geleistet“105. Fortan ist ihr der Zugang zu den Texten verbaut, denn „es ist keine Ord- nung mehr, und ich werde nie wieder wissen,“106 wo sie zuvor gestanden haben. Der Ich-Erzählerin ist der Schlüssel zu ihrer geistigen Heimat ge- nommen, wie zuvor bereits der zu ihrer Wohnung.
Die Musik gehört dem Vater. Der Tochter wird unvermittelt die weibliche Hauptrolle in dessen großer Oper untergeschoben, auf die sie jedoch kei- neswegs vorbereitet ist, schließlich ist sie keine Sängerin. „Es ist nicht mei- ne Rolle“107, sie kann auf die Fragen der Journalisten nicht antworten, da sie die Figur, die sie darzustellen hat, gar nicht kennt, weiß sich ihr aber auch nicht zu entziehen. Die Angst der Ich-Erzählerin in ihrer Unzulänglich- keit vorgeführt, auf einer ihr fremden Bühne präsentiert zu werden, ohne über eine entsprechende Stimme zu verfügen, ja, ohne überhaupt den Text zu kennen, mündet in einem verzweifelt intonierten „>Tot ist alles. Alles tot!<“108 und letztendlich mit dem Absturz in den Orchestergraben. Das gebrochene Genick nimmt jedoch niemand mehr zur Kenntnis, da das Publikum längst gegangen ist. Die Aufführung aber ist durch den Einsatz der Tochter, die ihre Pflichtschuldigkeit über die Bühne gebracht hat, gerettet. Und nichts anderes ist von Anfang an von ihr erwartet worden.
In den Filmen des Vaters, die er unter falschem Namen veröffentlicht, spielt die Tochter keine große Rolle, ist als Person nicht kenntlich, hat lediglich zu agieren, wie er es als Regisseur für richtig befindet. Die Filme sind allein seine Produkte, seine Geschichten, und sie sind erfolgreich, werden in den Kinos der halben Welt gezeigt. Die Aufgabe der Tochter besteht aus der be- ständigen Bereitschaft, sich beliebig ausnutzen lassen. Das Recht am eige- nen Bild, eine Wahrung der Intimsphäre existiert nicht, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. Skrupellos sollen auch private Aufnahmen, die von der Ich-Erzählerin ausdrücklich nicht freigegeben sind, veröffentlicht wer- den. Indem sie sich vorsichtig aus der Fremdbestimmtheit zu lösen ver-sucht, gelingt es ihr zwar überraschend, das Imperium des Vater zum voll- ständigen Zusammensturz zu bringen, sie landet aber auch in grundlosen Schuldgefühlen und damit in einer ebenso aussichtslosen Position.109
Die Darstellungsweise der Kunstformen Literatur, Musik und Film steht ex- emplarisch für eine subtile Art der Lüge. Wenn geschrieben wird, aber nicht gelesen, die Oper in ihrer Tragik verkannt und der Erfolg von Filmen allein auf voyeuristischen Instinkten aufgebaut wird, ist es um die Hoffnung auf Wahrheit innerhalb der Kunst offensichtlich schlecht bestellt. Selbst wenn der kulturelle Betrieb reibungslos abläuft und alle zufrieden sind, die schlei- chende Vernichtung also nicht weiter ins Auge fällt, so ist doch nicht zu- letzt auch damit die Existenz der Ich-Erzählerin und ihrer Sehnsucht nach der Lebbarkeit von Wahrheit und Kunst in Frage gestellt.
2.2.3. Schreibverbot
Je tiefer die Ich-Erzählerin offenen Auges in das Entsetzen der Erinnerung hinabsteigt und je klarer sie die umgebenden Machtstrukturen zu erkennen beginnt, desto gefährlicher wird sie für alles, was dem Vater zugehörig ist, desto härter werden auch die Maßnahmen, die gegen sie ergriffen werden müssen.
Die Gefangenschaft, eine Art „Sicherheitsverwahrung“, die der Ich-Erzäh- lerin letztendlich, selbstverständlich auch ohne jegliche Begründung, ange- tan wird, scheint ihr jedoch wenn schon nicht gerechtfertigt so doch erträg- lich, solange sie glaubt, das Buch fertigschreiben zu dürfen. Erst als ihr auch diese Hoffnung genommen wird („...Schreiben für mich nicht zugelassen...“110 ) beginnt sie selbst, ihr Leben in Frage zu stellen. Nachdem sie, obwohl sie bettelt und bittet, nicht schreiben darf (- ihrem Vater nicht schreiben darf, was sicher auch nicht in ihrer Absicht gelegen haben dürfte, doch wem sollte man wohl sonst schreiben wollen -), ist sie vernichtet und beginnt sich zu vernichten, zu verwüsten, indem sie sich selbst das ihr zustehende Wasser verweigert.111
Das Elend, ohne Stift und Papier zu existieren, die Qual, die Sätze aushalten zu müssen, ohne sie ausdrücken, aufschreiben zu dürfen, bedeutet jedoch einen Wendepunkt. Die Erkenntnis, daß am Grund der Sprache eine andere Substanz lebt als einzig die der Worte, manifestiert sich in den drei Steinen, die eine Botschaft tragen, über die der Vater keine Macht hat und die die Ich-Erzählerin in jedem Fall überdauern werden. Auch hier handelt es sich um eine Vision, die Sprache und Leben der Ich-Erzählerin enthält, eine staunende Eigendynamik jenseits der vielen Gewaltmanifestationen, ihnen allen beständig zum Trotz und unvernichtbar.
2.2.4. Leben
Mit der Gewißheit der drei Steine und deren zum Teil im Dunkeln liegenden Bedeutung besteht die Ich-Erzählerin die letzten verwirrenden Konfrontatio- nen mit der Figur des Vaters. Mehrmals wiederholt sie ihm den einen, ein- zig wichtigen Satz, ihren unbeirrbaren Glauben an die eigene Existenz betreffend.
„Ich habe mir erlaubt, trotzdem zu leben.“112 „Ich lebe, ...,ich nehme mir das Recht ...“113 „Ich sage: Ich werde leben!“114
Konsequent spielt die Ich-Erzählerin die ganze Macht dieser Worte gegen den Vater aus, der daraufhin das Gesicht verliert, und aus der schnell wachsenden Distanz versteht sie, wer er ist.115 Damit ist die Bindung an ihn gelöst, er ist augenblicklich nicht mehr wichtig. Von Malina jedoch ist die Ich-Erzählerin nicht befreit („... wir kommen nicht voneinander los, ...“116 ), er behält seine Position, besteht weiterhin auf der Ausformulierung von Gewalt.
Es ist immer Krieg.
Hier ist immer Gewalt.
Hier ist immer Kampf.
Es ist der ewige Krieg.117
Indem die Ich-Erzählerin dieser Forderung nachkommt, tritt sie in das dritte, eigentlich zerstörerische Kapitel ein. Den Staffelstab der Macht, den der Va- ter bereits zuvor von Ivan übernommen hatte, trägt von jetzt an Malina. Es gelingt ihm ohne Schwierigkeiten das Konzept des Überlebens zu installie- ren, wo noch wenige Worte zuvor nur von Leben die Rede war, und er weiß genau, was er damit tut. („Wenn man überlebt hat, ist Überleben dem Erkennen im Wege, ...“118 )
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten119
3. Sprachverlust (erzählen)
Nachdem im ersten Kapitel der Schwerpunkt auf dem Kreisen der Ich-Erzählerin um Ivan und ihre Liebe zu ihm liegt, ist im abschließenden Kapitel ihre Doppelexis- tenz mit Malina ausführlich dargestellt. Vorwiegend in der Fortführung der Dialog- form des zweiten Kapitels wird weiterhin um die Vorherrschaft gerungen, vor al- lem seinerseits das Erreichen einer Alleinvertretung in bezug auf die Wahrneh- mung der Ich-Erzählerin angestrebt. Malina besteht auf der Festschreibung alther- gebrachter Statuten („Wer ein Warum zu Leben hat, erträgt fast jedes Wie.“120 ) und einer bedingungslosen Wirklichkeitsinterpretation durch niemand anderen als ihn selbst, einer Instanz, die die selbstverständliche Präsenz vielschichtiger Wahr- heiten, eines variablen Erinnerungsvermögens und vor allem einen entsprechend vielfältigen Umgang mit Sprache ausschließt. („... es ist sinnlos, mit dir zu reden, solange du zurückhältst mit der Wahrheit.“121 ; „Malina: Warum denkst du immer noch >Krieg und Frieden<? ... Es gibt nicht Krieg und Frieden. Ich: Wie heißt es dann? Malina: Krieg.“122 ) Eine etwaige Infragestellung seiner Ansprüche ist er not- falls bereit mit - seinem und ihrem Temperament entsprechend - mäßiger körperli- cher Gewalt zu verteidigen. („..., er könnte mich mit der Faust ins Gesicht schla- gen, aber das wird er nicht tun, ... dann kommt ein flacher Schlag, ...“123 ) Ein sol- ches Vorgehen ihrerseits, das grundsätzliche Ablehnen von Eindeutigkeit in wel- chem Bereich auch immer, bedroht seine eindimensionale Existenz als geistiger Ableger der Ich-Erzählerin. Diese wehrt sich zunächst erzählend, weigert sich standhaft, die Geheimnisse ihres Lebens (z.B. Ivan) Malinas rigorosem Urteil zu unterwerfen. Nachdem sie jedoch einmal von ihm geschlagen wird, verkehrt sich das Spiel in einen ernsthaften Kampf, in dem ihre einzigen Waffen im permanenten Rückzug, in der weiteren Verschleierung ihrer Person und ihrer Gefühle sowie in der Verkleidung ihrer Worte liegen. Letztendlich wird Schweigen als einziges Vo- kabular des Überlebens kenntlich.
Die kurz zuvor noch so dominante Vaterfigur und alle damit zusammenhängenden Erinnerungen werden im dritten Kapitel nicht mehr erwähnt, nicht ein einziges Mal, und auch Ivan schrumpft auf ein normalsterbliches Maß zusammen, mutiert zunehmend zu einer, über die Vorgänge nur dürftig informierten Randfigur. („Ivan ist nicht mehr Ivan, ...“124 ) In die intensive Auseinandersetzung mit Malina fällt der endgültige Bruch des Liebesglücks,125 was, zusammen mit einem bereits zuvor er- littenen Verlust des Schreibens („... mein Buch, es ist mir abhanden gekommen, es gibt kein schönes Buch, ich kann das schöne Buch nicht mehr schreiben, ...“126 ), zu dem allmählichen Zusammenbruch der Ich-Erzählerin, zu dem langsamen Zer- fall all ihrer Illusionen, aber auch ihrer utopischen Visionen, erheblich beiträgt. In diesem Zustand, der von Malina nicht nur begrüßt, sondern massiv vorangetrie- ben wird, wortreich und zwingend zunächst („Töte ihn! töte ihn!“127 ), dann mehr und mehr passiv und abschließend beinah schweigend, ist die Existenz der Ich- Erzählerin letztendlich keinerlei Gesten oder Worte mehr wert. („Bist du fertig?“128 )
3.1. Leben ¹ Schreiben
Die zunehmende Unfähigkeit Erinnern und Erzählen zusammenzubringen und das deutliche Empfinden einer dadurch unvermeidbaren eigenen Verlogenheit, sowie die wachsende Unmöglichkeit einen Standpunkt gegenüber der Welt einzunehmen oder gar Wahrheit mit Hilfe von Sprache zu übermitteln, das alles nimmt, neben den zuvor geschilderten Komponenten, den wesentlichen Teil im Verzweifeln der Ich-Erzählerin ein.
Ihre Existenzgrundlage innerhalb der Sprache beginnt in dem Ausmaß aufzu- reißen, in dem Malina die Autorität in Frage stellt, die sie unzweifelhaft reprä- sentiert, die Herrschaft nämlich, die sie als Autorin über ihre fiktiven Figuren und damit auch über ihn ausübt. Malina mißt ihre literarischen Bemühungen mit einem unzulänglichen Maß, dem seiner eigenen Unwissenheit um die All- täglichkeit der Welt. Seine verschiedentlich durchscheinende Auffassung, die Ich-Erzählerin würde Leben und Schreiben nicht etwa nicht mehr zusammen- bringen, sondern im Gegenteil hoffnungslos miteinander verwechseln, ist in dem Sinne als Schutzbehauptung zu verstehen, als er von eben dieser ihrer Fä- higkeit abhängig ist und es immer bleiben wird. Der Grund seiner gut getarnten Sabotageakte liegt also in sich selbst verborgen („Es ist Malina, der mich nicht erzählen läßt.“129 ), in seiner Alltags- und Leblosigkeit, die mehr und mehr zu der allwissenden Überheblichkeit verkümmert, mit der er die Existenz der Ich- Erzählerin zunehmend attackiert.
3.1.1. Männergeschichten
Im Zuge des dritten Kapitels macht die Ich-Erzählerin verschiedene Versuche, Malina Geschichten zu erzählen, die auf ihre Faktizität hin nicht überprüfbar, sondern lediglich einem persönlichen Wahrhaftigkeitsanspruch verpflichtet sind. Diese Ansätze stellen das Bemühen dar, Alltagswelt auf ihren Wahrheitsgehalt zu testen, Erinnern und Erleben erzählend zusammenzufassen und sich auf die Art verständlich zu machen.
Schonungslos berichtet die Ich-Erzählerin von ihrem Hang zu Bauarbei- tern130 und Briefträgern131, über ihre Ansichten zu Männern im Allgemei- nen132 wie auch im Besonderen (Marcel133 ; die drei/vier Mörder134 ) und auch Bruchstücke der Kagran-Legende135 fließen immer wieder als Erzählfrag- mente ein, verbinden sich hier am deutlichsten mit ihrer Persönlichkeit. Alle diese Geschichten werden jedoch von Malina, der im Gegensatz zu Ivan durchaus versteht, systematisch blockiert, in ihre Bestandteile zerrieben und indirekt für null und nichtig erklärt. („Erzähl keine Märchen.“136 ; „Ich glaube dir kein einziges Wort, ich glaub dir nur alle Worte zusammen.137 ) Die Ich-Erzählerin findet so zwangsläufig zu der Erkenntnis, nicht mehr er- zählen zu wollen, nicht einmal dazu in der Lage zu sein, nicht so zumin- dest, wie es von ihr verlangt ist. („Malina sieht mich etwas unsicher an, obwohl er sonst nie unsicher ist. Ich hätte mir die Geschichte ersparen können.“138 )
Aus den beständig scheiternden Erzählversuchen der Ich-Erzählerin resul- tiert die >Störung der Erinnerung<139, die im folgenden gehäuft thematisiert wird, aber bereits im Vorkapitel explizit ans Ende gesetzt ist.140 Vor dem ei- gentlichen Beginn des Erzählens also ist das Erzählen selbst bereits in Fra- ge gestellt. Das Scheitern an der Sprache wird verdeutlicht in dem Verzwei- feln an der Unwirklichkeit Malinas. („Ich verstehe Malina nicht, ..., er ist unmenschlich mit seinen Einflüsterungen, seinem Schweigen ...“141 )
3.1.2. Briefgeheimnis
Die Geschichte des Postbeamten Otto Kranewitzer bildet den Auftakt des dritten Kapitels und wird als erster Ansatz einer Geschichte ausgeführt und mit Malina diskutiert. Während die Ich-Erzählerin jedoch das Gewicht des geschriebenen Wortes in die Waagschale wirft und in dem Schicksal Kranewitzers eine „postalische Krise“142 wittert, stellt Malina sich dumm und ahnungslos. Worte sind für ihn nicht gleichbedeutend mit Tatsachen, und „die Krise der Post und des Schreibens“143, der Spannweite also zwischen Intimität und Öffentlichkeit, vermag er nicht zu überblicken. („Warum liegt dir soviel an dem Briefgeheimnis?“144 )
Später sind es die Briefe von Ivan - „Meine einzigen Briefe!“145 - , die vor Malina, dem ansonsten sämtliche Papiere als Vermächtnis übergeben wer- den sollen, verborgen werden, um derer Willen das Briefgeheimnis heimlich und mit testamentarischen Mitteln gesichert werden muß. („Ich möchte das Briefgeheimnis wahren. Aber ich möchte auch etwas hinterlassen.“146 )
3.1.3. Nachrichtendienst
Eine weitere Geschichte dieser Art ist die von der Jahre zurückliegenden journalistischen Arbeit der Ich-Erzählerin, von dem unglaublichen Betrug147 bei der Herstellung von Nachrichten, von der beliebigen Machbarkeit einer öffentlichen Meinung. („..., von einer zufälligen Laune ausgewählte Nach- richten, und ich schrieb sie ins reine.“148 ) Auch dieses Erzählen weiß Malina zu widerlegen, zumindest aber mit Hilfe einer einzelnen Nebensächlichkeit grundsätzlich in Frage zu stellen. („Du hast mir das einmal ganz anders er- zählt deswegen bist du später in den Nachtdienst gegangen, weil es etwas mehr Geld gab ...“149 ) Der tatsächliche Gehalt des Gesagten („Zwei Jahre lang war ich ohne Nachrichten.“150 ) fällt dabei unbeachtet unter den Tisch, wird zwar de facto nicht angezweifelt, ist aber auch nicht weiter er- wähnenswert.
3.1.4. Inszenierung
Ein einziges Mal wird die Ich-Erzählerin körperlich von Malina angegangen; als sie ihm eine reale Existenz, das Vorhandensein einer ihm eigenen Vergangenheit, die konkrete Angst vor einem Unfall etwa oder vor dem Wasser oder aber vor Licht, alles Vorgänge, bei denen sie selbst nicht zugegen war,151 anzudichten versucht, verliert er über eine solche Anmaßung zunächst die Beherrschung, reißt sich dann aber zusammen und schlägt schließlich nur mit der flachen Hand zu.
Im Anschluß an diese Tat bestehen die Dialoge zwischen beiden weiterhin fort, sie erhalten jedoch eine neue äußere Form, die einer Partitur gleicht und als inszeniert bezeichnet werden kann. Die „musikalischen Regiean- weisungen“ (z. B.: accelerando, crescendo, presto, più mosso, forte, ...), die nur für die Ich-Erzählerin selbst aufgeführt sind, tauchen hier zum ersten Mal auf. Auch die Ehrenbezeugungen gegenüber Malina nehmen Über- hand, treten mitunter gehäuft direkt aufeinanderfolgend in Erscheinung. (z.B.: Höchst Ehrenwerter Malina, Exzellenz, Generalissimus, Euer Gnaden, Herr von Malina, Eure Herrlichkeit und Allmächtigkeit, Euer Ehren, ... )
Insgesamt betrachtet ist unklar, für wie echt die Worte der Ich-Erzählerin fortan genommen werden können, welchen konkreten Wahrheitsgehalt ihre Aussagen transportieren, ob sie nicht vielmehr in hohem Ausmaß von Schutzfunktionen geprägt sind. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Ich-Erzäh- lerin in einer Malina entsprechenden Tonlage singt, um der Gefahr zu ent- gehen, ist groß. Zumindest in den Dialogen steht unfraglich das Bestreben im Zentrum, sprachlich eine deutliche Distanz zwischen sich und ihn zu bringen. Mit Ironie und beständiger geistiger Flexibilität ist die Ich-Erzäh- lerin bemüht, sich als un(an)greifbar darzustellen, sich auf keinen Fall fest- zulegen, also eine sprachliche Ungenauigkeit herzustellen.
Auf dem Hintergrund des zuvor formulierten sprachlichen Anspruchs (siehe II.1.2.4.), der in einem krassen Gegensatz dazu steht, muß dieses jedoch mißlingen. Sie trägt Malinas Kleid, von dem sie immer wußte, daß es ihr unerträglich sein würde. („..., ich weiß plötzlich, warum ich es nie anziehen konnte.“152 )
3.1.5. Hallo - Holla
An dem entwicklungsgestörten Kind, das jahrelang kein Wort dazulernt, sondern einfach nur ihr beständiges „Hallo, hallo! holla, holla!“153 über den Hof ruft, zeigt sich einerseits, daß es eine adäquate Antwort der Welt nicht gibt, andererseits wird die grundsätzlich unterschiedliche Einstellung Mali- nas und der Ich-Erzählerin verdeutlicht. Während sie die Mutter des offen- sichtlich vernachlässigten Kindes zur Rechenschaft ziehen will, nimmt er das Geschehen gelassen, gleichsam als eine interessante Spielart der Na- tur.
In dem Zusammenhang ist die von Malina propagierte Bewegungs- und Hilflosigkeit („Du mußt auf der Stelle bleiben Du sollst nicht vordringen und nicht zurückgehen.“154 ), die der Ich-Erzählerin mehr und mehr zu eigen wird („Ich rufe leiser und lauter: Hallo! Bitte! Hallo! So bleiben Sie doch bitte stehen!“155 ), von entscheidender Bedeutung. Diese äußerst hartnäckige Störkraft, die den völligen Verzicht auf Mitgefühl und Heilung, sowie auf das aktive Mitwirken und die damit verbundene Hoffnung auf Veränderun- gen miteinschließt, gräbt der Ich-Erzählerin das letzte Wasser ab, wird ihr doch zugleich auch Sinn und Zweck der Existenz und Akzeptanz des eige- nen Ichs abgesprochen. („...ein Ich ist ergriffen, und ein Ich handelt. Du a- ber wirst nicht mehr handeln.“156 ; „Du änderst nichts.“157 ) Unter der Prä- misse, daß Sprechen eine Form des Handelns eines Menschen darstellt, ist ihr jede Möglichkeit genommen, ihre utopischen Ideale weiterhin zu vertre- ten. („Ich springe aus dem Bett, sprachlos, hilflos, er hat die Tür zugewor- fen,...“158 )
3.2. Das Rätsel der letzten zwei Seiten (schweigen?)
Für das Romanende sind verschiedene mögliche und unmögliche Lesarten präsentiert worden, die grundlegende Frage jedoch, wer der eigentliche Erzäh- ler des Finales sei, bleibt ungeklärt. Die schlichte Annahme, daß es sich um Malina handeln müsse,159 da ihm von der Ich-Erzählerin zuvor mehrfach das Weitererzählen angetragen wurde („Übernimm du die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht ist. Nimm sie alle von mir.“160 ), greift in jeder Hinsicht zu kurz. Auch die Äußerung Ingeborg Bachmanns, der gesamte Text sei auf die Gewinnung Malinas als zukünftigen Erzähler, als überlegene Figur, die aus Leben Kunst zu machen versteht, ausgerichtet,161 ist, zumindest im Wissen um die nur zu mutmaßende Tragweite einer solchen öffentlichen Einlassung, mit Vorsicht zu genießen.
Nach dem wortlosen Verschwinden der Ich-Erzählerin in dem sich seit langem langsam auftuenden Riß im Mauerwerk, beginnt Malina augenblicklich damit, die Spuren ihrer Existenz zu beseitigen, als hätte er nur darauf gewartet. Er zerbricht und zerreißt Dinge, die (zu) ihr gehören, er versteckt ihre Sachen oder wirft sie demonstrativ in den Papierkorb - auch die Schriften, die Briefe, das Vermächtnis der Schriftstellerin. Mehrfach verleugnet er seine frühere Mitbe- wohnerin am Telefon, womit er zum Teil strikt ihre vermeintlich klaren Anwei- sungen aus früherer Zeit befolgt. („Bitte, Ivan darf das nie erfahren, nie wissen ... versprich es mir, ..., Ivan darf nie, nie etwas wissen, ...“162, „..., er weiß nicht, was er Ivan sagen soll, ich höre das Telefon läuten. Sag ihm, sag ihm, bitte sag ihm! Sag ihm nichts. Am besten: Ich bin nicht zu Hause.“163 ) Keines ihrer Worte scheint er vergessen zu haben, andererseits jedoch hat er nicht im Geringsten verstanden. Er weiß weder um die Gleichzeitigkeit der Gegensätze und die daraus resultierende Ambivalenz von Sprache (= Leben!), noch um die vergängliche Gültigkeit einzelner Worte und deren stetig wechselnde Hinter- gründe. („Ich habe den Verdacht, daß er die Menschen nicht durchschaut, Malina erschaut sie, und das ist etwas ganz anderes, ... mein Einbildungsver- mögen, das er belächelt, ist wahrscheinlich eine niedere Abart von seinem Vermögen, mit dem er alles ausbildet, auszeichnet, auffüllt, vollendet.“164 ; „Er wird nie ein Wort aus seinem Leben sagen, nie über mich sprechen, aber trotzdem nicht den Eindruck erwecken, er verschweige etwas. Malina ... hat im besten Sinn, nichts zu sagen.165 “) Das unvermeidliche Verfallsdatum eines wie auch immer formulierten >heute< ist ihm als Historiker fremd.
Auf den letzten zwei Seiten des Romans wird diese Unlogik, ja Sinnlosigkeit aller sprachlicher Bemühungen deutlich wie an keiner anderen Stelle vorgeführt. Angeblich ist Malina allein zurückgeblieben, er handelt autonom, zielgerichtet und ohne falsche Scham. Gleichzeitig aber wird er von außen betrachtet, er wird beobachtet, nahezu observiert, und Leser und Leserin werden somit Zeugen seiner radikalen Aufräumarbeiten und leichtfertigen Lügen.
Das, was spricht, sitzt fest in der Wand. Es versteht sich selbst nicht mehr als Mensch unter Menschen. Das, was weiterhin spricht, ist etwas anderes. Es ist ein ES, das jede Verbindung zur Welt und eigenen Angaben zufolge jede Mög- lichkeit zur Äußerung verloren hat. Etwas, das nicht einmal mehr schreien kann. Aber dennoch schreit ES. ES schreit nach Ivan. ES schreit nach Leben.166 Und ES nimmt wahr.
Das Subjekt hat aufgehört zu existieren, das Individuum hat das Zimmer,167 das Leben (=Sprache?) verlassen, seine substantielle Existenz aber scheint nicht vernichtet, wie auch das entsprechende Objekt, Malina, als die zugehöri- ge zweite Hälfte, nach wie vor vorhanden ist. Er kann handeln und ohne Schwierigkeiten in der Welt bestehen, während ES auf dieser Ebene nicht mehr in Erscheinung tritt. ES ist jedoch trotzdem noch in der Lage, eine Situations- beschreibung eben dieser Welt zu geben, die ES gerade hinter sich gelassen hat. Die Vorgänge werden auf den ersten Blick als eine schlichte Auflistung, eine Abfolge von Tatsachen dokumentiert. („Das Telefon läutet, Malina hebt es ab, er spielt mit meiner Sonnenbrille und zerbricht sie, er spielt dann mit dem blauen Glaswürfel, Er hat meine Brille zerbrochen, er wirft sie in den Pa- pierkorb, ... er schleudert den blauen Glaswürfel nach, ..., er läßt meine Kaffee- schale verschwinden, er versucht eine Schallplatte zu zerbrechen, sie bricht aber nicht, sie biegt sich ...“168 )
ES geht jedoch punktuell weit über den reinen Dokumentationsstil hinaus. Kurz und knapp wird das Verhalten Malinas kommentiert und entlarvt, seine Unge- duld und Kälte wird benannt, eine verhaltene Wut verdeutlicht und die ruhige, abgeklärte Suche nach zu vernichtendem Beweismaterial plastisch vorgeführt. Zudem disqualifiziert ES ihn durch die Feststellung „..., er sieht alles, aber er hört nicht mehr“169 unwiderruflich als Erzähler, sowohl dieser letzten zwei Sei- ten als auch zukünftiger Werke, der >Todesarten< etwa, wie es von der Ich- Erzählerin ursprünglich vorgesehen war.170 Malina selbst bestätigt das Zutref- fen dieser These in dem darauffolgenden Telefonat, in dem er jegliche Kenntnis der Ich-Erzählerin, ihrer Anliegen und Absichten rigoros dementiert.
Wer zwar alles sehen kann, aber nichts mehr hört, verfügt auch im herkömmli- chen Sinn über eine nur unvollständige Wahrnehmung. Die Ansprüche jedoch, die die Ich-Erzählerin diesbezüglich an Sprache (=Leben!) richtet, sind von un- gleich höherer Qualität, eine tiefe Vertrautheit mit Stimme und Klang markiert genau genommen nur den Auftakt ihrer Kunst. (siehe II.1.2.4.) Malinas Sache ist eine Annäherung an diese Forderungen nicht, er wird „immer Distanz halten, weil er ganz Distanz ist.“171 „Er webt nicht an dem großen Text mit, ...“172 und „er hat eine Tarnkappe, ein fast immer geschlossenes Visier.“173 Grundsätzlich verfügt er über nahezu alle Eigenschaften, die ein angemessenes Fortführen der begonnenen Arbeit der Ich-Erzählerin durch ihn unmöglich erscheinen las- sen.174
Über die Bloßstellung Malinas hinaus wird auch nicht Vorhandenes beschwo- ren. ES weiß, als der Täter den Tatort verläßt, Rettung und Hilfe als Bestandteil der Welt durchaus noch zu erwähnen, selbst wenn diese Dinge nicht mehr er- reichbar sind.
Es ist eine sehr alte, starke Wand, aus der niemand mehr fallen kann, die niemand aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann.175
Die Welt aber existiert noch, ihr ist fortan die Ich-Erzählerin überantwortet, die aus ihrer Position heraus selbst nicht mehr handlungsfähig ist.
Mit einem Finale in einer derart ambivalenten Form wird verdeutlicht, daß mit dem Versagen der althergebrachten Sprache und dem Verlust der Figur der Erzählerin, ihrem Aufgehen in Verschwiegenheit noch lange kein Schweigen ein- tritt. Letztendlich ist ein Mord behauptet, eine ungesühnte Tat verübt, die zu- vor angekündigt und akribisch beschrieben wurde. Die Suche nach dem Mör- der und, was weit wichtiger erscheint, das Auffinden der Leiche beginnt erst mit dem letzten Satz.
III. Abschluß
1. Das Bachmann-ICH und die ICH-Erzählerin
Autobiographische Momente spielen in diesem Roman, wie im modernen Roman überhaupt, sicherlich eine Rolle, dennoch lassen sich genaue Übertragungen nur vermuten. Eine Aussage Ingeborg Bachmanns respektierend, nachdem „die Anga- ben zur Person“ immer das sind, „was mit der Person am wenigsten zu hat“176, soll in diese Thematik insofern nicht weiter eingedrungen werden als diese Vorge- hensweise Hypothesen über ihr Privatleben beinhalten müßte. Festgestellt werden muß jedoch, daß Ingeborg Bachmann und die Ich-Gestalt des Romans sich in kei- ner Hinsicht so eng zusammenfinden wie in ihrer Ausrichtung auf Sprache, ihrer grundsätzlich schreibenden Existenz, eine Übereinstimmung, die als nahezu de- ckungsgleich anzusehen ist.
Im Vorkapitel177, der Eröffnung des Romans, die den bis hierher erörterten drei Ka- piteln vorgeschaltet ist, werden unverkennbar die Eckdaten einer literarischen Ar- beit gesetzt. Ort, Zeit und die personale Ausstattung werden festgelegt und damit das Repertoire, das gespielt werden kann. Schon in der Vorstellung der Ich-Figur im Personenregister wird die biopraphische Nähe zu Ingeborg Bachmann deutlich. Beide sind Österreicherinnen, in Klagenfurt geboren, leben oder lebten einmal in Wien und sind, wie sich später herausstellt, schreibend tätig. Bis zum Beginn des ersten Kapitels läßt sich demzufolge nicht eindeutig festlegen, ob die Definition von Zeit, Ort und Malina durch das Bachmann-ICH oder bereits durch die ICHErzählerin geschieht. Die erörterte Materie könnte in gleichem Maße die Lebensreflektion eines fiktiven Ichs darstellen wie auch die Ausarbeitung von Erzählvoraussetzungen durch eine übergeordnete Instanz.
Das Bachmann-ICH setzt ein literarisches >heute< fest und erklärt noch im selben Satz, im selben Atemzug sozusagen, daß eine so eng gefaßte Bedingung aus der Perspektive einer Schriftstellerin nur schwer zu handhaben ist. („... vernichten müßte man es sofort, was über das Heute geschrieben wird, ...“178 ) Die ICH-Er- zählerin hingegen verzweifelt an der alltäglichen Schicksalhaftigkeit dieses >heu- te<, eines Tages „also, an dem etwas zu geschehen hat oder besser doch nicht geschieht.“179 Die Beschreibungen Wiens, insbesondere der Ungargasse sind e- benso doppeldeutig zu begreifen. Sie verkörpern gleichermaßen die Erschließung der Örtlichkeiten bis in ihren historischen Zusammenhang180 wie auch eine Hei- mat, einen Raum für Erinnerungen und Düfte, ein „Gefühl von Nachhausekom- men“.181 Selbst das Auftreten Malinas bleibt in dieser Hinsicht unbestimmt, eine Vorgeschichte mit ihm ist beiden Schriftstellerinnen gleichermaßen zugehörig. Das Bachmann-ICH beherrscht ihn als eine fiktive Person, ist in der Lage, ihn neu zu benennen und an den verschiedensten realen und irrealen Orten zu beheimaten. („...darum exilierte ich ihn aus Belgrad, nahm ihm seinen Namen, dichtete ihm mysteriöse Geschichten an, ... wenn ich besser gelaunt war, ließ ich ihn aus der Wirklichkeit verschwinden und brachte ihn unter in einigen Märchen ...“182 ) Gleichzeitig ist Malina jedoch auch ein Phantom, eine unwirkliche Angstfigur, die eigenwillig auftaucht und wieder im Nichts verschwindet, bis sie sich schließlich endgültig konkretisiert, den lange vorbestimmten Platz einnimmt. Die ICH-Erzäh- lerin ist es, die daraufhin bekennt, daß sie sich fühlt, „als hätte er mich ausge- schieden, einen Abfall, eine überflüssige Menschwerdung ...“183.
Die Ausformung der Ich-Figur, das Erforschen ihrer Gedanken und Gefühle sowie die Recherchen ihre Vergangenheit betreffend werfen unvermeidlich das Thema der Erinnerung auf. („..., aber muß ich mich erinnern daran?“184 ) Ingeborg Bach- mann widmet sich dieser, von ihr eindeutig auch mit historischem Gewicht beleg- ten, Problematik seit jeher bewußt und intensiv, insbesondere das Todesarten- Projekt ist konsequent darauf ausgerichtet. Unter der Last der Vergegenwärtigung eines längst vergangenen >heute<, wie es von einer Schriftstellerin im Prozeß des Schreibens verlangt ist (ganz gleich, ob es sich dabei um ein „fiktives“ oder ein „reales“ >heute< handelt), läßt sich gewissermaßen auch das Bachmann-ICH un- ter die (von ihr vorgegebenen) Menschen fallen185, in die vorbestimmten Bedin- gungen eines noch nicht existierenden Romans. In diesem Sinne ist sie hier der ICH-Erzählerin nicht unähnlich, die an derselben Stelle erstmals zu Grunde geht.186
... gleich darauf das Klatschen einer harten Hand ins
Gesicht: Da, du, jetzt hast du es! Es war der erste
Schlag in mein Gesicht und das erste Bewußtsein von der tiefen Befriedigung eines anderen, zu schlagen. Die erste Erkenntnis des Schmerzes ohne zu weinen ist jemand, der einmal ich war, den Schulweg nach Hause getrottet, ... zum erstenmal unter die Menschen gefal- len, und manchmal weiß man eben doch, wann es an- gefangen hat, wie und wo, und welche Tränen zu wei- nen gewesen wären.187
Zweifellos findet in diesem Moment eine punktuelle Verschmelzung der beiden (fiktiven?) Frauen statt, stellt sich augenblicklich die tragende Verbindung zwischen Leben und Kunst her, durch die auch imaginären Figuren Menschlichkeit verliehen werden kann. Insofern ist die eigentliche Ich-Erzählerin des Romans, die Figur, die von nun an autonom erzählen, sich erinnern und letztendlich wieder sterben wird, durch diese Fusion erst entstanden.
Die Frage, ob der erste Schlag die fiktive Ich-Gestalt oder Ingeborg Bachmann selbst trifft oder jemals getroffen hat, steht in dem Sinne nicht zur Debatte, in dem eine Differenzierung zwischen Kunst und Leben nicht mehr vorliegt. So gesehen präsentiert sich im Roman bereits an dieser Stelle, lange bevor eine zusammen- hängende Musik herauszuhören ist, die erste, präzise Schrittfolge im Tanz der Doppelfiguren.
2. Die Vielgestalt der Sprache
Selbstverständlich gibt es viele Möglichkeiten, sich durch die Vielschichtigkeit die- ses Romans zu arbeiten, ganz andere Wege als den hier beschrittenen, die zwangsläufig zu abweichenden, zum Teil von Grund auf widersprüchlichen Er- kenntnissen und Schlußfolgerungen führen. Malina ließe sich beispielsweise durchaus als Helfer verstehen, als einzige der Ich-Erzählerin zugeneigte, in sich selbst gesicherte Existenz, einem Rettungsanker gleich. Ivan wäre als tatsächlich Liebender, als Möglichkeit zu lieben zumindest, denkbar, wenn auch wenig wahr- scheinlich. Der Tod der Ich-Erzählerin schließlich, ihr Verschwinden aus der Welt könnte ohne Schwierigkeiten als freie Entscheidung, gefällt aufgrund der eigenen stetig wachsenden Lebensuntauglichkeit, gewertet werden. Oder aber als endgül- tiges Abgleiten in den Wahnsinn. Und noch wesentlich mehr Türen als die weni- gen offensichtlichen wären zu öffnen, bislang kaum betretene Räume zu finden und bis in die Hintergründe zu erschließen.
Für jeden der oben genannten Interpretationsansätze ließen sich sowohl Belegstel- len finden als auch logisch schlüssige Handlungsabfolgen nachweisen, und, ähn- lich wie im vorliegenden Fall, wäre das Problem der Widersprüchlichkeit, eingebet- tet in die zwangsläufig zwiespältige Grundhaltung eines Individuums, dessen Aussagen jederzeit in Frage gestellt werden können, nach wie vor gegeben.
Die Sprache an sich macht natürlich nur einen Bruchteil der Paradoxie, der selbst- verständlichen Vielschichtig- und Vieldeutigkeit von >Malina< aus. Das tatsächli- che Fundament eines solchen Erlebens findet sich in der alltäglichen menschlichen Realität sowie in einer gewollten künstlerischen Sensibilität. Dennoch ist es insbe- sondere eine Frage der schriftstellerischen Kompetenz, ein Verdienst der sprachli- chen Umsetzung, daß eine derartige Vielfalt innerhalb „einer Geschichte“ gleichbe- rechtigt nebeneinander stehen kann. In Anbetracht der im Text selbst formulierten Sprachutopie jedoch, die in gleichem Maße auch eine Liebesutopie darstellt (siehe II.1.2.4.), scheint die Lebensgewohnheit des Schreibens und Lesens von Literatur lediglich eine außergewöhnlich verkümmerte Variante menschlicher Kommunikati- on zu sein.
Liebe ist ein Kunstwerk, und ich glaube nicht, daß sehr viele Menschen es können. Ob es mir gelungen ist, das Genie der Liebe zu zeigen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß die wenigen großen Beispiele so außerordentlich sind, daß man sagen muß, es gibt zweifellos Men- schen, die dort, wo die anderen ein kleines gelegentli- ches Talent haben, etwas geschenkt bekommen haben; das erwirbt man sich nicht, deswegen ist es etwas Verbrennendes.188
Die unvermeidlich sich aufdrängende Frage, welcher Gestalt Sprache tatsächlich ist, wie sie zu ihrem Gehalt jenseits der Syntax findet, wie die Brücke geschlagen wird, immer wieder aufs neue, zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, zwi- schen dem Wort und seinem jeweils einmaligen Inhalt, so vielfältig er auch sein mag, muß zwangsläufig offen bleiben. In den zentralen Dialogen zwischen Malina und der Ich-Erzählerin schwingt immer auch die innere Zwiespältigkeit einer
Schriftstellerin, eines Schriftstellers mit, die eine ständige Auseinandersetzung mit den vermeintlichen Gegensätze (ich + die Welt, innen + außen, a + `, ...) nach sich zieht. Innerhalb dieser Zerrissenheit tut sich letztendlich kaum eine Möglichkeit auf, die Grenzen der Sprache zu sprengen, um zumindest punktuell zu der existentiellen Substanz der Dinge jenseits der Worte vordringen zu können.
Grenzenlosigkeit ist und bleibt eine Utopie.
„Aufhören ist eine Stärke, nicht eine Schwäche“
Ingeborg Bachmann
Primärliteratur
Ingeborg Bachmann: Malina, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1980, (suhrkamp taschenbuch 641)
Ingeborg Bachmann: Der Fall Franza/Requiem für Fanny Goldmann, München, R. Piper GmbH & Co.KG, 1989
Ingeborg Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, Probleme zeitgenössischer Dichtung, München/Zürich, R. Piper & Co. Verlag, 1982
Sekundärliteratur
Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Ingeborg Bachmann, München, edition text + kritik GmbH, 1984
Kurt Bartsch: Ingeborg Bachmann, Zweite Auflage, Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 1997, (Sammlung Metzler; Bd. 242)
Heidi Borau: „Malina“, Eine Provokation?, Würzburg, 1994, Verlag Königshausen & Neumann GmbH, (Reihe Literaturwissenschaft; Bd. 109)
Elfriede Gerstl (Hg.): eine frau ist eine frau ist eine frau..., Autorinnen über Autorinnen, Wien, Promedia Druck- u. Verlagsges. mbH, 1985
Dirk Göttsche/Hubert Ohl: Ingeborg Bachmann, Neue Beiträge zu ihrem Werk: internationales Symposion Münster 1991, Würzburg, Könighausen & Neumann, 1993
Sabine Grimkowski: Das zerstörte Ich, Erzählstruktur und Identität in Ingeborg Bachmanns „Der Fall Franza“ und „Malina“, Würzburg, Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 1992, (Reihe Literaturwissenschaft; Bd. 76)
Hans Höller: Ingeborg Bachmann, Monographie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1999
Elfriede Jelinek: Jelinek über Bachmann, Emma, Zeitschrift von Frauen für Frauen, Köln, EmmaFrauenverlag, Februar 1991
Annette Klaubert: Symbolische Strukturen bei Ingeborg Bachmann, Malina im Kontext der Kurzgeschichten, Bern/Frankfurt am Main/New York, Verlag Peter Lang AG, 1983
Gudrun Kohn-Waechter: Das Verschwinden in der Wand, Destruktive Moderne im Widerspruch eines weiblichen Ich in Ingeborg Bachmanns „Malina“, Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Ernst Poeschel Verlag GmbH, 1992, (Ergebnisse der Frauenforschung; Bd. 28)
Christine Koschel/Inge von Weidenbaum (Hg.): Ingeborg Bachmann, Wir müssen wahre Sätze finden, Gespräche und Interviews, München/Zürich, R. Piper & Co. Verlag, 1983
Ellen Summerfield: Ingeborg Bachmann, Die Auflösung der Figuren in ihrem Roman >Malina<, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1976, (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komaparatistik; Bd. 40)
Sonstige
Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne, Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Stuttgart, Klett-Cotta, 1977
C.G. Jung (Hg.): Der Mensch und seine Symbole, Solothurn/Düsseldorf, Walter-Verlag AG, 1968, Sonderausgabe 1993
John Kotre: Weiße Handschuhe, Wie das Gedächtnis Lebensgeschichten schreibt, München/Wien, Carl Hanser Verlag, 1996
Meyers Lexikonredaktion (Hg.): Meyers Großes Taschenlexikon, Mannheim/Leipzig/Wien/ Zürich, B.I.Taschenbuchverlag, 1998
Hilde Spiel: Glanz und Untergang, Wien 1866 bis 1938, München, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, 2. Auflage, Juni 1995
[...]
1 Ingeborg Bachmann: Malina, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1980, (suhrkamp taschenbuch 641), S. 356
2 Malina, wie Nr.1, S. 62ff u.a.
3 Malina, wie Nr.1, 89ff
4 Malina, wie Nr.1, S 156ff
5 Ingeborg Bachmann: Der Fall Franza/Requiem für Fanny Goldmann, München, R. Piper GmbH & Co.KG, 1989, S. 9
6 Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden, Gespräche und Interviews, Hg. Christine Koschel/Inge von Weidenbaum, München/Zürich, R. Piper & Co. Verlag,1983, S. 88
7 ebd., S. 73
8 Ingeborg Bachmann: Frankfurter Vorlesungen, Probleme zeitgenössischer Dichtung, München/Zürich, R.Piper & Co. Verlag, 1982, Kap. III, Das schreibende Ich, S.42
9 Wir müssen wahre Worte finden, wie Nr.6, S. 87
10 Malina, wie Nr.1, S. 23
11 Malina, wie Nr.1, S. 105
12 Malina, wie Nr.1, S. 121
13 Malina, wie Nr.1, S. 129
14 Malina, wie Nr.1, S. 144
15 Malina, wie Nr.1, S. 260
16 Malina, wie Nr.1, S. 260f
17 Malina, wie Nr.1, S. 62ff u.a.
18 Malina, wie Nr.1, S. 252ff
19 Malina, wie Nr.1, S. 297f
20 Malina, wie Nr.1, S. 353
21 Malina, wie Nr.1, S. 57
22 Malina, wie Nr.1, S. 48
23 Malina, wie Nr.1, S. 31
24 Malina, wie Nr.1, S. 84
25 ebd.
26 Malina, wie Nr.1, S. 29
27 Malina, wie Nr.1, S. 43
28 Malina, wie Nr.1, S. 35
29 Malina, wie Nr.1, S. 44
30 Malina, wie Nr.1, S. 84
31 Malina, wie Nr.1, S. 39
32 Malina, wie Nr.1, S. 46
33 Malina, wie Nr.1, S. 126
34 Malina, wie Nr.1, S. 47
35 ebd.
36 Malina, wie Nr.1, S. 80, 109, 111 u.a.
37 Malina, wie Nr.1, S. 32f
38 Malina, wie Nr.1, S. 106ff
39 Malina, wie Nr.1, S. 87
40 ebd.
41 Malina, wie Nr.1, S. 29
42 Malina, wie Nr.1, S. 43
43 Malina, wie Nr.1, S. 41
44 Malina, wie Nr.1, S. 40
45 Malina, wie Nr.1, S. 42
46 Malina, wie Nr.1, S. 49
47 Malina, wie Nr.1, S. 89ff
48 Malina, wie Nr.1, S. 28
49 Malina, wie Nr.1, S. 13
50 Malina, wie Nr.1, S. 156ff
51 Malina, wie Nr.1, S. 46
52 Malina, wie Nr.1, S. 30
53 Malina, wie Nr.1, S. 89ff
54 Malina, wie Nr.1, S. 129ff
55 Malina, wie Nr.1, S. 98
56 Malina, wie Nr.1, S. 52
57 In der vorliegenden, wie in der Erstveröffentlichung wie hier, in späteren Ausagen richtiger: EXULTATE JUBILATE!
58 Malina, wie Nr.1, S. 52f
59 Malina, wie Nr.1, S. 53
60 Malina, wie Nr.1, S. 57
61 Malina, wie Nr.1, S. 60
62 Malina, wie Nr.1, S. 62ff u.a.
63 Malina, wie Nr.1, S. 67
64 ebd.
65 Malina, wie Nr.1, S. 65
66 Malina, wie Nr.1, S. 66
67 Malina, wie Nr.1, S. 69
68 ebd.
69 Malina, wie Nr.1, S. 140
70 Malina, wie Nr.1, S. 142
71 Malina, wie Nr.1, S. 140
72 Malina, wie Nr.1, S. 320
73 Malina, wie Nr.1, S. 181
74 Malina, wie Nr.1, S. 62ff
75 Malina, wie Nr.1, S. 215
76 Malina, wie Nr.1, S. 240
77 Malina, wie Nr.1, S. 186
78 Malina, wie Nr.1, S. 193
79 Malina, wie Nr.1, S. 244
80 Malina, wie Nr.1, S. 200
81 ebd.
82 Malina, wie Nr.1, S. 216
83 Malina, wie Nr.1, S. 218
84 Malina, wie Nr.1, S. 232
85 Malina, wie Nr.1, S. 187
86 Malina, wie Nr.1, S. 218
87 Malina, wie Nr.1, S. 193
88 Malina, wie Nr.1, S. 192
89 Malina, wie Nr.1, S. 247
90 Malina, wie Nr.1, S. 232
91 Malina, wie Nr.1, S. 181
92 Malina, wie Nr.1, S. 145
93 Malina, wie Nr.1, S. 24
94 Malina, wie Nr.1, S. 181
95 Malina, wie Nr.1, S. 52ff
96 Malina, wie Nr.1, S. 185
97 Malina, wie Nr.1, S. 199
98 Malina, wie Nr.1, S. 185f
99 Malina, wie Nr.1, S. 182f
100 Malina, wie Nr.1, S. 181
101 Malina, wie Nr.1, S. 241
102 Malina, wie Nr.1, S. 188
103 Malina, wie Nr.1, S. 182, 207 u.a.
104 Malina, wie Nr.1, S. 229
105 Malina, wie Nr.1, S. 191
106 ebd.
107 Malina, wie Nr.1, S. 196
108 Malina, wie Nr.1, S. 197
109 Malina, wie Nr.1, S. 207ff
110 Malina, wie Nr.1, S. 239
111 Malina, wie Nr.1, S. 240
112 Malina, wie Nr.1, S. 242
113 ebd.
114 Malina, wie Nr.1, S. 245
115 Malina, wie Nr.1. S. 246
116 ebd.
117 Malina, wie Nr.1, S. 247
118 Malina, wie Nr.1, 233
119 Malina, wie Nr.1, S. 243f
120 Malina, wie Nr.1, vgl. S. 225 u. S. 307
121 Malina, wie Nr.1, S. 218
122 Malina, wie Nr.1, S. 192/193
123 Malina, wie Nr.1, S. 305
124 Malina, wie Nr.1, S. 331
125 Malina, wie Nr.1, S. 341f
126 Malina, wie Nr.1, S. 320
127 Malina, wie Nr.1, S. 334
128 Malina, wie Nr.1, S. 352
129 Malina, wie Nr.1, S. 279
130 Malina, wie Nr.1, S. 249
131 Malina, wie Nr.1, S. 249ff
132 Malina, wie Nr.1, S. 282ff
133 Malina, wie Nr.1, S. 297
134 Malina, wie Nr.1, S. 296f
135 Malina, wie Nr.1, S. 320 u. S. 353
136 Malina, wie Nr.1, S. 348
137 Malina, wie Nr.1, S. 350
138 Malina, wie Nr.1, S. 298
139 Malina, wie Nr.1, S. 275
140 Malina, wie Nr.1, S. 24
141 Malina, wie Nr.1, S. 336
142 Malina, wie Nr.1, S. 255
143 Malina, wie Nr.1, S. 256
144 ebd.
145 Malina, wie Nr.1, S. 351
146 Malina, wie Nr.1, S. 345
147 Malina, wie Nr.1, S. 270
148 Malina, wie Nr.1, S. 271
149 Malina, wie Nr.1, S. 274
150 Malina, wie Nr.1, S. 273
151 Malina, wie Nr.1, S. 304f
152 Malina, wie Nr.1, S. 338
153 Malina, wie Nr.1, S. 262
154 Malina, wie Nr.1, S. 330
155 Malina, wie Nr.1, S. 319
156 Malina, wie Nr.1, S. 329
157 Malina, wie Nr.1. S. 327
158 Malina, wie Nr.1, S. 343
159 vgl. Kurt Bartsch: Ingeborg Bachmann, Zweite Auflage, Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 1997, (Sammlung Metzler; Bd. 242), S. 138
160 Malina, wie Nr.1, S. 350
161 vgl. Wir müssen wahre Sätze finden, wie Nr. 6, S.95 u. Hans Höller: Ingeborg Bachmann, Monographie, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1999, S. 145
162 Malina, wie Nr.1, S. 205
163 Malina, wie Nr.1, S. 205f
164 Malina, wie Nr.1, S. 263
165 Malina, wie Nr.1, S. 315
166 Malina, wie Nr.1, S. 355
167 Malina, wie Nr.1, S. 354
168 Malina, wie Nr.1, S. 354f
169 Malina, wie Nr.1, S. 355
170 Malina, wie Nr.1, S. 303ff u. 345ff
171 Malina, wie Nr.1, S. 315
172 ebd.
173 Malina, wie Nr.1, S. 316
174 Ingeborg Bachmann stimmt in diesem Punkt offensichtlich nicht mit der Meinung ihrer Ich- Erzählerin überein. Verschiedene Äußerungen deuten darauf hin, daß sie Malina als Erzähler für möglich hält und eventuell auch in dieser Richtung weitergearbeitet hat. Welche Intention jedoch hinter dieser nach außen verkündeten Absicht steckt, läßt sich vermutlich nicht mehr klären. Denkbar wäre eine geniale Fortführung der in Malina begonnenen Demaskierung von Sprache gleichermaßen wie ein fataler Irrtum, der die gegen Ende ihres Lebens offensichtlich bestehende Schreibunfähigkeit besser erklären könnte, als die ebenso bestehende Tablettenabhängigkeit.
175 Malina, wie Nr.1, S. 356
176 Wir müssen wahre Sätze finden, wie Nr.6, S.81
177 Malina, wie Nr.1, S. 7 - 24
178 Malina, wie Nr.1, S. 8
179 Malina, wie Nr.1, S. 9
180 Malina, wie Nr.1, S. 11
181 Malina, wie Nr.1, S. 13
182 Malina, wie Nr.1, S. 17
183 Malina, wie Nr.1, S. 19
184 Malina, wie Nr.1, S. 20
185 vgl. Malina, wie Nr.1, S. 22
186 vgl. Hans Höller: Ingeborg Bachmann, Monographie, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1999, S. 17f
187 Malina, wie Nr.1, S. 22
188 Wir müssen wahre Sätze finden, wie Nr.6, S. 109f
- Arbeit zitieren
- Susanne Englmayer (Autor:in), 1999, Wenn Wände reden könnten - Die Kunst der Sprache zwischen Wahrnehmung und Lüge in Ingeborg Bachmanns >Malina<, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96792
Kostenlos Autor werden
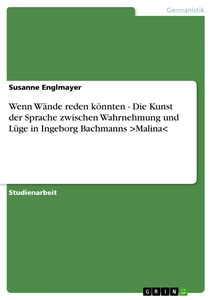






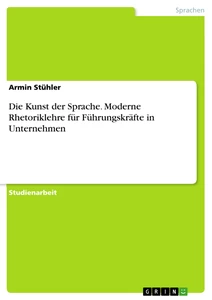












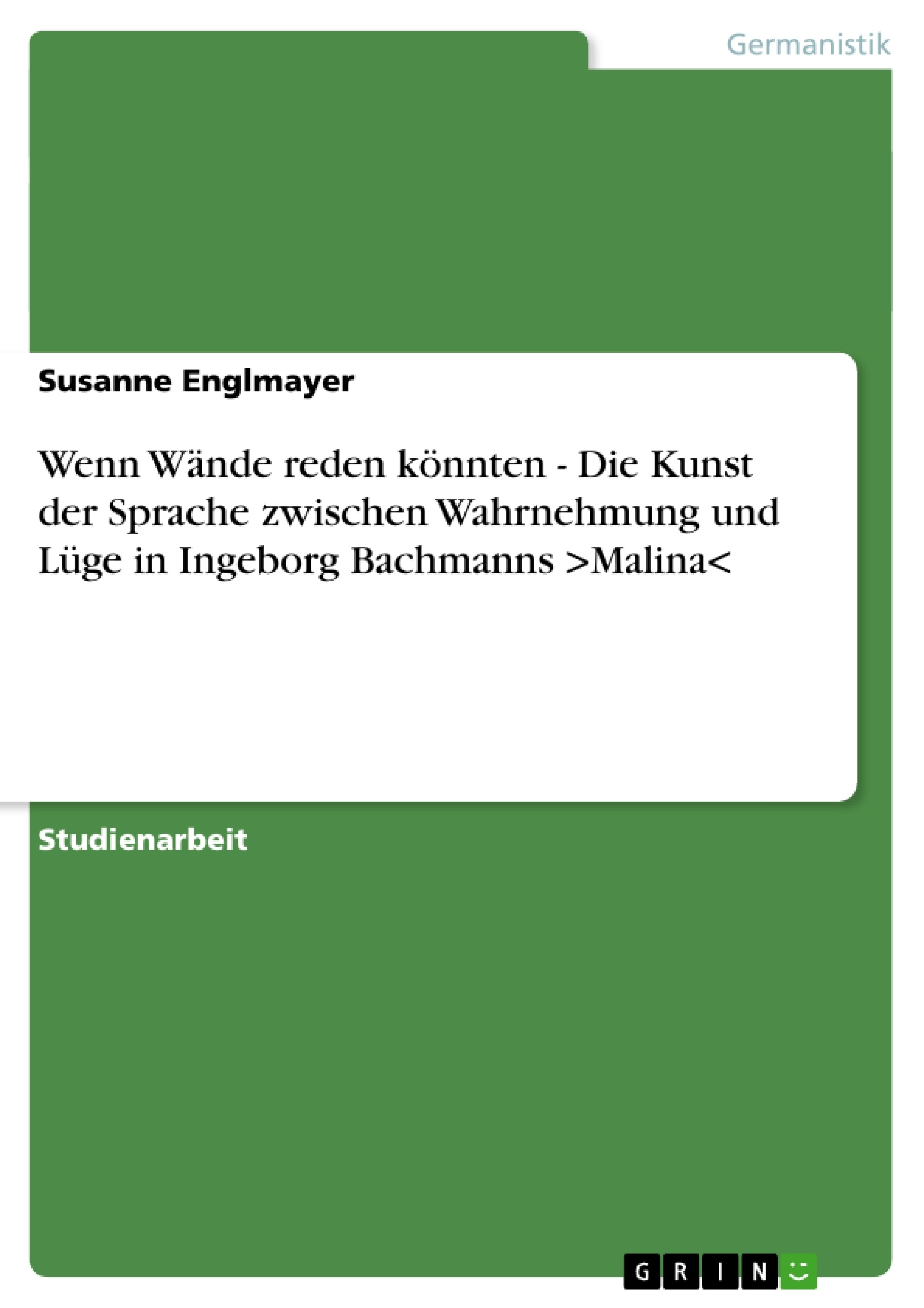

Kommentare