Excerpt
INHALTSVERZEICHNIS
I. EINLEITUNG
ERSTER ABSCHNITT „ÜBER DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DER PHILOSOPHIE“
ZWEITER ABSCHNITT „ÜBER DEN URSPRUNG DER VORSTELLUNGEN”
DRITTER ABSCHNITT „ÜBER DIE ASSOZIATION DER VORSTELLUNGEN”
II. HAUPTTEIL
GESCHICHTE DER ASSOZIATIONSTHEORIE
PHILOSOPHISCHER ASSOZIATIONISMUS UND ÜBERGANG ZUR PSYCHOLOGIE
MODERNE ASSOZIATIONSTHEORIEN
GEDÄCHTNIS UND BEWUßTSEIN
EINIGE WAHRNEHMUNGSTHEORIEN
Die Schablonentheorie .
Das Modell der Merkmalsanalyse
WANDLUNG DER ASSOZIATIONSLEHRE
THEORIE DES ZUFÄLLIGEN HAFTENS
THEORIE DES BINDEGLIEDES
ERSTE VERSUCHE ZU ÜBERWINDUNG DES BELIEBIGKEITSANSATZES
III. SCHLUß
VERSUCH EINES RESÜMEES
IV. LITERATURNACHWEIS
I. Einleitung
Ein Mann wird von einem hartnäckigen Schluckauf heimgesucht, welcher stets und immer dann auf wunderbare Weise verschwindet, wenn der Geplagte sich bückt, um sich die Schuhe zu schnüren. Vernünftigerweise gelangt dieser zu der festen Überzeugung, daß irgendein rätselhafter Zusammenhang zwischen seinem Leiden und dem Binden von Schnürsenkeln bestehen muß, so daß er sich dazu entschließt niemals mehr barfuß zu gehen, damit er ständig die heilbringenden Schuhriemen an sich trage. Immerfort wird er sich bücken, um sich schnürend von seinem Leiden zu erlösen, ohne zu vermuten, daß auch das bloße Herabbeugen den gleichen Effekt haben könnte. Man wird diesem Mann wohl für sonderbar halten und ihm eine seltsame Marotte unterstellen, gleichwohl er vielleicht nichts anders unternommen hat, als etwas für die Ursache einer bestimmten Wirkung zu halten und nach diesem vermeintlichen Gesetz zu handeln.
Doch was hat den Menschen veranlasst, so zu denken, sich so zu entscheiden? Sollte auch unser ganzes Handeln von dem gleichen Prinzip geleitet sein? könnte man fragen, wenn man hinter dem Handeln des Menschen irgendein Prinzip vermutet. Unser Verständnis für die Welt erschließt sich erst mit dem Finden von Zusammenhängen. In den Naturwissenschaften, als auch in der Philosophie ist es daher nicht ungewöhnlich, alles auf ein erstes allgemeines Prinzip zurückführen zu wollen, welches auch dort gelten muß, wo sich beide Wissenschaften treffen: im Bewußtsein.
Hume hielt es daher für zweckmäßig, dieses hinsichtlich seiner Fähigkeiten zur Urteilsbildung und seines Erkenntnisvermögens zu untersuchen und erhebt skeptischen Zweifel an den Verstandestätigkeiten und den Sinnen. Sein Ziel ist es herauszufinden, welcher Art von erkenntnistheoretischen Aufgaben der menschliche Geist gewachsen ist.
Mein Ziel ist es, Humes Beitrag zur Untersuchung des menschlichen Verstandes, insbesondere der Assoziationen mit dem Standpunkt der modernen Psychologie zu vergleichen.
Erster Abschnitt „Über die verschiedenen Arten der Philosophie“
Im ersten Abschnitt der Untersuchung über den menschlichen Verstand nimmt Hume eine grundlegende Unterscheidung der verschiedenen Arten der Philosophie vor. Im besonderen betrachtet er die Philosophie des Geistes (moral philosophie), die Wissenschaft von der menschlichen Natur, als deren Aufgabe er es betrachtet, die Menschheit zu unterhalten, zu belehren und durchaus auch diese zu bessern, bevor er sie in zwei Kategorien teilt. Da die eine den Menschen vornehmlich als zum Handeln betrachtet und ihn in seinen Maßnahmen stark durch Gefühl und Neigung beeinflußt sieht, will sie demnach den Mensch ebenso beeinflussen, „ indem sie [die Philosophen] , der Dichtung und der Redekunst alle Hilfsmittel entlehnen und ihren Gegenstand in leichter und einleuchtender Weise behandeln, in einer Art, die bestens geeignet ist, die Phantasie zu befriedigen und Gemütsbewegungen hervorzurufen”1. So erscheint es verständlich, daß sie einzelne Beispiele aus dem Leben betrachtet, deren treffliche Wahl gelungen sein muß, damit sie die Mehrzahl der Menschen, welche diese Art von Philosophie entschieden bevorzugt, auf den Pfad der Tugend zu locken vermag, sie „... den Unterschied zwischen Tugend und Laster spüren [zu] lassen...”2. Daher gelingt es ihr mehr und leichter in das tägliche Leben einzudringen, als die schwerer verständliche, aber dafür sorgfältig erwogenere Philosophie, welche mit eben jener komplizierten Genauigkeit die menschliche Natur untersucht, um jene Prinzipien zu finden, die unseren Verstand leiten, unsere Gefühle erregen und uns zu Urteilsbildungen veranlassen. So betrachtet diese die Menschen hinsichtlich ihrer Gabe zur Vernunft und es als ihre Aufgabe, nicht eher zu ruhen, bis sie aus den Einzelfällen zu den letzten, obersten Prinzipien gelangt ist, um die allgemeinsten Grundlagen der Moral zur Unterscheidung, beispielsweise von Laster und Tugend, Wahrheit und Schein, Glaube und Wissen, aufstellen zu können, auf das sie von jedermann anerkannt werden muß, hinsichtlich ihres Anspruches auf Gerechtigkeit und Gültigkeit, wobei diese Begriffe wiederum selbst Gegenstand ihrer Untersuchungen zur Wahrheitsfindung werden, während natürlich existierende unumstößliche Wahrheiten, mögliche Gewißheiten überhaupt, in Zweifel gezogen werden. Da infolge ihrer abstrakten Spekulationen, die keinen tatsächlichen Zugang mehr zum praktischen Leben haben, eine Nützlichkeit jener Erwägungen für viele Menschen nicht einzusehen ist, bleibt ihr der Zugang zum Leben auch aus diesem Grunde verwehrt. So ist es nicht leicht für diese Art von Philosophie auf die Lebensführung und Verhaltensweisen der Menschen Einfluß zu nehmen, falls dies überhaupt Zweck ihrer Überlegungen gewesen sein sollte. Sind einmal Fehler oder Unschlüssigkeiten in ihnen aufgetreten, werden diese auch mit der nötigen Konsequenz weiterführt, so daß sich für beide Arten der Philosophie genügend Vor- und Nachteile finden, daß es vergeblich wäre, „ ...das eine durch Herabsetzung des anderen zu preisen.”3
Beide sind jedoch um Wahrheitsfindung bestrebt, auf der Suche nach Erkenntnis, die jedoch, wie Hume vernünftigerweise meint, den Menschen in seinem Handeln leiten und sich nicht in Selbstgenügsamkeit verlieren sollte. „ Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen...[und]... Der Mensch ist ferner ein handelndes Wesen...”4, behauptet Hume und findet in der gemischten Lebensweise, die die Natur dem Menschen als die geeignetste angewiesen habe, eine insgeheime, aber wohl doch offensichtliche Warnung, „ ... sich keiner dieser Neigungen zu sehr hinzugeben und dadurch unfähig für andere Beschäftigungen und Vergnügen zu werden. ” 5
„ Sei ein Philosoph, doch bleibe, bei all deiner Philosophie, stets Mensch.”6, empfiehlt Hume unter der Berücksichtigung der Meinung, daß der vollkommenste Mensch zwischen den Extremen liegt.
Damit einem Künstler das Gemälde eines schönen Menschen gelingen kann, bedarf er nicht nur eines unentbehrlichen Gespürs für Ästhetik, sondern neben seinem Talent auch einer nicht ganz unwesentlichen Kenntnis von der Anatomie der Menschen, von der Lage der Knochen und der Muskel, ihrem Gebrauch, ihrer Gestalt und ihrem Zusammenspiel. So ist das eine dem anderen dienlich, wie auch die abstrakte der lebensnahen Philosophie, was die erstere und die Bestrebungen ihrerseits ebenso rechtfertigt, wie das dem Menschen innewohnendem Bedürfnis nach Befriedigung seiner Wißbegierden. Denn: ” Dunkelheit ist in der Tat dem Geiste ebenso peinvoll wie dem Auge; jedoch das Dunkel zu erhellen muß, welche Mühen es auch erfordert, Vergnügen und Freude bereiten.”7 Doch ist es nicht nur mühselig und ermüdend, Licht in dieses Dunkel zu bringen, „ ...sondern auch die unvermeidliche Quelle von Ungewißheit und Irrtum.”8 Daher erlaubt sich Hume an dieser Stelle einen gerechten Einwand gegen einen beträchtlichen Teil der Metaphysik, die „... nicht eigentlich eine Wissenschaft sei, sondern [...] entweder aus den fruchtlosen Bemühungen menschlicher Eitelkeit [entstehe] , die in dem menschlichen Verstande völlig unzugängliche Gegenstände eindringen möchte, oder aus der List gängigen Aberglaubens... ” 9,den er im gleichen Satz mit einer Gestrüpp züchtenden Hinterhältigkeit vergleicht, da sie sich auf freiem Felde zu verteidigen scheut und es lieber vorzieht, im Wald auf der Lauer zu liegen, um bei gekommener Gelegenheit die unachtsamen Passanten der Straße des Geistes überwältigen.
Daraus schlußfolgert er, daß die wahre Metaphysik von der falschen und verderblichen getrennt werden müsse, dies aber nur geschehen kann, wenn die Natur des menschlichen Verstandes ernsthaft untersucht wird, um in exakter Analyse seine Kräfte und sein tatsächliches Vermögen nachzuweisen . Was vermag der Verstand tatsächlich zu erkennen und was nicht? Dazu muß natürlich der Verstand erst einmal verstanden werden, das leuchtet ein. Schlechterdings aber scheint sich der klare Verstand in Dunkel zu hüllen, wenn er darum bemüht ist, selbst der Gegenstand seiner Reflexion zu sein und wird spätestens bei diesem Vorhaben seiner Bezeichnung keineswegs mehr gerecht und auf geschickte Weise erspart er es den Regeln und Grenzen seiner Operationen, in Augenschein genommen zu werden. Dieser Schwierigkeit ist sich Hume natürlich auch bewußt, findet es aber, trotz der Mühen und Schwierigkeiten, welche dieses Vorhaben mit sich bringt, doch einer nützliche Überlegung wert, diese zu bewältigen.
„ Es kann nicht bezweifelt werden, daßder menschliche Geist mit verschiedenen Kräften und Tätigkeiten ausgestattet ist, daßdiese Kräfte voneinander verschieden sind und daßdas, was wirklich in der unmittelbaren Perzeption verschieden ist, auch in der Reflexion unterschieden werden kann; daßes folglich eine Wahrheit und Falschheit in allen Sätzen hierüber gibt, die nicht außerhalb des menschlichen Verstandesbereiches liegen.”10
Hier taucht erstmalig der Humesche Begriff der Perzeption auf, der in Humes Erkenntnistheorie von entscheidender Bedeutung ist. Perzeption in Humes Sinne bedeutet gewissermaßen die Gesamtheit aller Sinneswahrnehmungen, jedes Gefühl, jedes Wünschen und Wollen, alles Denken, allgemeiner das Resultat des erkennenden Verhaltens, kurz: perception = Bewußtseinsinhalt. Nachdem Hume nun im ersten Abschnitt sein Anliegen geklärt hat, die verderbliche Metaphysik von der nützlichen zu trennen zu wollen, um als Mittel der Wahrheitsfindung Aberglauben und Wissenschaft zu unterscheiden, sowie die Methode, den menschlichen Verstand zu untersuchen, um aufzuweisen, was dieser tatsächlich vermag, schickt er sich im zweiten Abschnitt dazu an, den Ursprung der Vorstellungen aufzuzeigen.
Zweiter Abschnitt „Über den Ursprung der Vorstellungen”
Hier nimmt Hume eine klare Unterscheidung von Einbildungskraft und Sinneswahrnehmung vor, wobei er der Meinung ist, das die Einbildungskraft die Sinneswahrnehmungen nur nachahmen, aber Stärke und Lebendigkeit der ursprünglichen Empfindung niemals erreichen könne. Die Vorstellungen von Zuständen, wie Zorn oder Liebe, können niemals mit den wirklichen Gemütsbewegungen dieser Empfindungen verwechselt werden, insofern nicht Störungen des Geistes, wie Krankheit oder Wahnsinn derartige Täuschungen hervorrufen. Der auf frühere Gefühle reflektierende Gedanke sei „ ..ein getreuer Spiegel, der seine Gegenstände zuverlässig abbildet; doch die von ihm verwendeten Farben sind schwach und blaßim Vergleich zu den Farben unserer ursprünglichen Perzeptionen. ” 1 1 , behauptet Hume, während er darauf hinweist, daß es keines mit Scharfsinn versehenen metaphysischen Kopfes bedarf, um diesen Unterschied zu bemerken.
Nach dieser klaren Aussage nimmt er eine ebenso klare Trennung der Gedanken von den Eindrücken vor:
Gedanken (THOUGHTS) und Vorstellungen (IDEAS) unterscheiden sich im wesentlichen von den Eindrücken (IMMPRESSIONS) dadurch, daß sie weitaus schwächer und weniger lebhaft sind als die letzteren, welche alle lebhaften Perzeptionen, wie hören, sehen, fühlen, lieben, hassen, begehren oder wollen beinhalten. Die blassen Gedanken sind es aber dann, die auf die lebhaften Eindrücke zu reflektieren vermögen. Doch hin und wieder unterliegt man verblüffenden Täuschungen oder es gelingt, sich etwas Vorzustellen, „ Was niemals gesehen wurde und wovon man noch niemals gehört hat... ” , so daß„ auf den ersten Blick [nichts] unbegrenzter [erscheint] als das Denken des Menschen, das sich nicht nur aller menschlichen Macht und Autorität entzieht, sondern sich nicht einmal in den Grenzen von Natur und Wirklichkeit halten l äß t. ” 12
Doch in der scheinbaren Grenzenlosigkeit unseres Denkens entdeckt Hume nur die Gabe, „ das durch die Sinne und Erfahrung gegebene Material zu verbinden, zu transportieren zu vermehren oder zu verringern ” 1 3 als die einzige schöpferische Kraft des menschlichen Geistes. Dabei raubt er den Begriffen Einfall und Inspiration ihre Bedeutung und setzt an deren Stelle Kombination. Das Phantasiegespinnst eines güldenen Berges ist demnach nicht aufregenderes als die Kombination der bekannten Vorstellungen von Gold und Berg. So ließe sich auch die Vorstellungen von Ungeheuern erklären. Man nehme nur alle Merkmale, deren Auftreten bei Lebewesen uns auf lähmende Weise entsetzlich gruseln ließen und setze diese dergestalt zusammen, daß uns bei dem Gedanken an eine mögliche Begegnung mit dem Ungetüm doch ein wenig unbehaglich zu Mute werden muß. Dies entspricht auch Humes These: “Aufgabe des Geistes und des Willens ist einzig und allein ihre Mischung und Zusammensetzung (der äußeren und inneren Sinnesempfindungen) ...Alle unsere Vorstellungen oder schwächeren Perzeptionen sind Abbilder unserer Eindrücke oder lebhafteren Perzeptionen. “14
Nun muß sich nur noch ein Beweis für diese Behauptung finden lassen, den Hume auch gleich in einleuchtender Weise liefert. Will man diese, seine Aussage als falsch widerlegen, muß man nur eine Vorstellung aufzeigen, deren Ursprung sich nicht in der Erfahrung finden lässt.
Doch selbst eine so abstrakte, nicht überprüfbare Vorstellung wie die Gottes, lässt sich bei genauerem nachdenken zurückführen auf die Kenntnis der Operationen unseres eigenen Geistes und der grenzenlosen Steigerung dieser. Wir kennen Menschen, die wir durchaus als weise bezeichnen können, wir selbst wissen auch schon etwas und gelegentlich und glücklicherweise treffen wir auch auf gütige Menschen. Wir haben unter anderem auch feststellen müssen, daß Zustände, darunter auch Eigenschaften, sich steigern lassen und sind auch hin und wieder mit dem Phänomen einer Grenze konfrontiert worden. Schon diese Erfahrungen wären reichhaltig genug, um sich daraus Gott anzufertigen, ähnlich dem Ungetüm.
Ein weiteres, ebenso schlüssiges Argument ist, daß wir uns ohne die entsprechenden Sinnesorgane keine Vorstellung von den Reizen machen könnten, für welche diese empfänglich sind. Ein Blinder hat kein Vorstellung von Farben, außer vielleicht von der Konsistenz und dem Geruch, vielleicht auch dem Geschmack der Substanz, die ihrer Erscheinung nach einen besonders reinen Farbton vorzuweisen hat, so daß wir sie z.B. als Rot bezeichnen und sie zum Färben von Gegenständen benutzen. Ähnlich verhält es sich bei einem Tauben, der sich keine Vorstellung von Tönen machen kann, außer vielleicht wenn sich durch eine genügend hohe Lautstärke die Schallwellen im ganzen Körper bemerkbar machen.
Daraufhin schlußfolgert Hume, daß alle Vorstellungen nur der Erfahrung entspringen können, was sich mit der Analyse einer jeweiligen Vorstellung und der Zurückführung ihres Ursprunges auf bereits erfahrenen Eindrücke immer beweisen läßt. Sollte sich nun doch einmal herausstellen, daß dieser Ursprung nicht vorhanden sein sollte, so fehlt natürlich auch ihr Bezug zum Erfahrbaren, zum Leben gewissermaßen, was Grund genug für Hume ist, solcherlei Ideen als unnütz und abstrus abzulehnen und verleiht somit seiner Philosophie eine verblüffende Unantastbarkeit.
Dritter Abschnitt „Über die Assoziation der Vorstellungen”
Nachdem nun Hume im zweiten Abschnitt die Einbildungskraft und den Bestand der komplexen Vorstellungen aus einfachen behandelt hat, will er im dritten die Prinzipien finden, nach denen die Gedanken und Vorstellungen verknüpft werden. Dabei geht er davon aus, daß ein Gedanke stets einen weiteren nach sich zieht, sobald er im Gedächtnis oder in der Vorstellung erscheint. Die conexion of ideas muß offensichtlich nach den Regeln eines psychischen Mechanismus‘ geschehen, daher regelmäßig und auch auffindbar sein.
Da der Mensch in gewisser Weise ein ordnendes Wesen ist, ist er stets darum bemüht, Zusammenhänge zu entdecken. Etwas, ein Ding oder eine Erscheinung kann wahrscheinlich nie verstanden werden, ohne daß uns irgendein vermeintlicher Zusammenhang zu anderen Phänomenen ersichtlich ist. Wenn ein Ding Merkmale aufweist, grundverschieden von denen, die wir kennen, seine Herkunft und sein Zweck uns rätselhaft bleibt, so wird es uns wohl auf eine sonderbare Weise befremdlich bleiben, ein Rätsel. Es sind zumindest einige Anhaltspunkte nötig, einen Ansatz für dessen Lösung zu finden. Diese Punkte werden dann wie in einem Zahlenmalspiel miteinander verbunden. Einige können sich als unsinnig erweisen, andere als recht zweckmäßig oder doch wenigstens als bemerkenswert. So ergibt sich aus der ungeordneten Anhäufung von Punkten ein Bild, welches wir verstehen können. Doch nach welchen Regeln sollen man die Punkte verbinden? Wie geraten Eindrücke, Erfahrungen und Ideen miteinander in Verbindung und nach welchen Gesetzmäßigkeiten?
Hume fand nur drei Prinzipien der Vorstellungsverknüpfung, „ nämlichähnlichkeit (Resamblance) , raum-zeitliche Berührung (Contiguity) und Ursache und Wirkung (Cause or Effect) . “ Jede noch so planlose erscheinende Regung unseres Geistes, sei es im Traum oder beim Abschweifen unserer Gedanken, folgt diesen Gesetzmäßigkeiten, welche sich beim genauen folgen oder reflektieren dieser auch finden läßt.
Damit wurde Hume zum Begründer der modernen Assoziationspsychologie, deren Wurzeln aber schon weit in der Vergangenheit liegen: in der Antike.
II. Hauptteil
Geschichte der Assoziationstheorie
Das erste Konzept der Assoziationen findet sich erstmals in Platos Werk „Phaidon“. Dort beschrieb Plato, daß der bloße Anblick der Lyra ihres Geliebten oder dessen Kleidung ähnliche Gefühle und Gedanken in ihr weckte, die hervorzurufen sonst nur der Geliebte selbst vermochte. Hierbei erhob der Philosoph jedoch noch keinen Anspruch auf eine Gesetzmäßigkeit oder Kategorisierung von Prinzipien. Er beschrieb nur das Phänomen als solches. Den ersten Versuch, dieses auf eine Regelmäßigkeit zu untersuchen unternahm Aristoteles, als er „Über das Gedächtnis und die Erinnerungen“ schrieb. Darin stellte er die vier Assoziationsgesetze auf, welche die nachfolgende Philosophie entscheidend beeinflußten und für die spätere Psychologie von wegweisender Bedeutung waren. Unbezweifelbar wird seine These sein, daß uns Form und Gestalt, Farbe und Struktur eines Gegenstandes gelegentlich an ein anderes Objekt erinnern, vermutlich, weil gewisse Eigenschaften beider sich in bestimmter Hinsicht zu gleichen scheinen. Aus dieser nicht ungewöhnlichen Beobachtung formulierte er sein erstes Gesetz: Das Gesetz derähnlichkeit.
Aber ebenso, wie ähnliche oder sich gleichende Gedächtnisinhalte miteinander verknüpft werden, läßt sich dieser Vorgang auch bei gegensätzlichen Elementen vermerken, insofern wir für das Betrachtete ein Gegenteil finden. Da dies durchaus häufig der Fall ist und wir uns in einer polar aufgebauten Welt zu bewegen meinen, erscheint das zweite Gesetz so vernünftig wie brauchbar: Das Gesetz des Kontrastes. Wer denkt schon bei Liebe nicht auch gleich an Schmerz?
Wenn es nun aber nicht zwischen zwei Menschen „funkt“, sondern am Himmel, dann sagen wir Blitz dazu. Kurz darauf folgt für gewöhnlich der Donner. Unser Verstand vermutet zwischen diesen zwei Naturerscheinungen einen unmittelbaren Zusammenhang und so, nachdem die Verknüpfung hergestellt, werden wir eine Person, die nach einem Gleißen am Himmels uns einen akustischen Reiz beachtlicher Intensität vorhersagt, nicht ohne Vorbehalte als einen Propheten bezeichnen. Wenn wir uns dann für unsere Skepsis rechtfertigen müssten, könnten wir uns, dank Aristoteles, auf das Gesetz der Kontiguität berufen: zwei gleichzeitig oder kurz nacheinander auftretende Elemente werden miteinander verknüpft. Räumliche und zeitliche Nähe sind also ebenfalls entscheidende Kriterien, welche uns zu assoziieren veranlassen. Dazu muß gesagt werden, daß Aristoteles die zwei Kategorien getrennt betrachtete, so daß er, noch einmal zusammengefasst, die folgenden vier Prinzipien der Vorstellungsverknüpfung postulierte:
1. Das Gesetz derähnlichkeit
2. Das Gesetz des Kontrastes
3. Das Gesetz der räumlichen und
4. das der zeitlichen Nähe
Überdies glaubte Aristoteles, daß Wiederholung, Gefühl und Aufmerksamkeit sowie bestimmte Formen und Gestalten der Objekte an der Bildung von Assoziationen nicht unbeteiligt seien. Wir müssen ihn Recht geben, wenn wir bedenken, daß das unangenehme Gefühl des Ertappt-seins uns ebenso an unsere Unaufmerksamkeit erinnern kann, wie die zürnende Gestalt einer überforderten Lehrerin, die zum wiederholten male mehr Konzentration fordert, und uns dabei unweigerlich auf unsere Mangelhaftigkeit hinweist. Aber unsere Mangelhaftigkeit unterscheidet uns von Gott, der uns unsere Assoziationen nicht gibt, wie Aristoteles meint, sondern diese sind Wirkungen unserer Umwelt.
Dies war für die Scholastiker nicht annehmbar. Nach dem Tode des Philosophen verstummten die Spekulationen über die Assoziationen für ungefähr 2000 Jahre. Das konnte einerseits bedeuten, daß man dem nichts mehr hinzuzufügen hatte, oder aber daß das Interesse an dieser Thematik verloschen war (bzw. gelöscht wurde).
Philosophischer Assoziationismus und Übergang zur Psychologie
Erst die britischen Empiriker T. Hobbes, J. Locke, D. Hume, D. Hartley, A. Bain u.a. belebten die Assoziationstheorie wieder. Anknüpfend an Aristoteles gingen sie davon aus, daß alles geistige Leben von sensorischer Stimulation herrühre und daß ähnliche Erfahrungen später als Ideen oder geistige Elemente ohne die ursprüngliche Stimulation vorkommen können, wie von Esper (1964) zusammengefasst wurde.
In einer Reihe von sekundären Gesetzen versuchte Brown Mechanismen oder Prinzipien zu formulieren, welche die Selektion bestimmter Assoziationen steuern. Er vertrat die Ansicht, daß Begriffe, die schon in der Vergangenheit am häufigsten assoziiert wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft am häufigsten miteinander assoziiert würden. Gesetzt dem Falle, zwei Assoziationen traten in der Vergangenheit gleich häufig auf, dann würde die rezentere von beiden, also die frischeste oder mit der Gegenwart unmittelbarer in Beziehung stehende bevorzugt. Dies sind nun aber zwei Prinzipien, die durchaus miteinander in Widerspruch geraten können, so daß, falls dieser Konflikt zwischen Frequenz- und Rezenzprinzip entstünde oder ein anderer determinierender Faktor nicht vorliegt, es sehr wahrscheinlich sei, daß die lebhafteste oder eindringlichste Assoziation von beiden sich behauptet, also die mit der größten emotionalen Bedeutung.
Der von Herbart entwickelte Vorschlag von Kombinationsprinzien bezog sich weniger auf die Quantität, d.h. Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit, als auf die Qualität der verknüpften Begriffe. Er bezeichnete solche Begriffe, die sich anziehen als kongruent und jene, die sich wechselseitig abstoßen oder hemmen, Widersprüche etwa, als inkongruent. Aus der Verbindung inkongruenten Materials ergebe sich ein bestimmtes Erlebnisquantum, was er als die Apperzeptionsmasse bezeichnet. Dieses Phänomen ist das Aufbauzentrum des bewußten Erlebens. Kongruente Erlebnisse und Erfahrungen werden in das Bewußtsein aufgenommen, inkongruente oder bedeutungslose hingegen werden entweder so modifiziert, d.h. den Umständen angemessen verändert, daß sie passen oder sie bleiben vom Bewußtsein ausgeschlossen.
Hartley erweiterte die Assoziationsgesetze, um auch die Muskelbewegungen mit einzubeziehen, und stellte verschiedene neurophysiologische Regeln als Grundlage der Assoziationspsychologie auf. Da jedoch vor allem auf dem Gebiet der praktischen Psychologie diese Begriffe und Gesetze nicht ausreichten, um das Phänomen der assoziativen Verknüpfung von Bewußtseinsinhalten 15 ausreichend zu beschreiben, begann man nach neuen Mustern und Algorithmen zu suchen, derer sich der Verstand bedient, um das zu leisten, was im allgemeinen als Erinnerung oder Erinnerung-an-etwas bezeichnet16.
Bain glaubte daher, daß man wohlberatener daran sei, die Prinzipien Freude und Schmerz zu ergänzen. Dies sei so gemeint, daß Assoziationen, welche zu einem Lustgewinn führen wiederholt und solche, die Schmerz und Unbehagen erzeugen vermieden oder blockiert werden.
Nun galt es, den sich mehrenden Thesen eine experimentelle Grundlage zu geben, da die Wissenschaft, welche durch den Empirismus mitbegründet wurde, empirisch nachweisbare Grundlagen für ihre Behauptungen aufzuweisen haben sollte. Die ersten dieser Art schuf Sechenov, welche in seinem Werk „Gehirnreflexe“ (1863) veröffentlicht wurden. Darin beschrieb und erklärte er bestimmte geistige und zweckbestimmte Handlungen durch neurologische Mechanismen, welche im Laboratorium demonstriert worden waren. Sechenovs Arbeit war wegbereitend für Pawlows, der Mensch und Tier hinsichtlich der Bildung von Assoziationen zwischen bekannten und neuen Reizen untersuchteFehler! Keine Indexeinträge gefunden.. Pawlow (1934) behauptete, es gäbe keinen Unterschied zwischen den psychologischen Fachausdrücken Assoziation, Konditionierung und zeitweilige nervöse Verbindung.
Was geschieht während der Konditionierung? Die Vertreter der Pawlowschen Thesen nahmen an, daß durch das gemeinsame Auftreten von bedingten Reiz und unbedingtem Reiz eine Assoziation zwischen beiden geknüpft würde, deren Stärke von der Häufigkeit der Wiederholung der Reize abhängig sei. Die einfache und einleuchtende Assoziationstheorie der Konditionierung hat die gegenwärtige Psychologie zwar stark beeinflußt, ist nach heutigem Wissen aber unhaltbar, was Kamin (1969) experimentell bestätigte und unter anderem auch von Popper entschieden abgelehnt wurde.17
Daraufhin folgte eine Unterscheidung zwischen Assoziation und Erwartung, so daß man Erwartungstheorie und Assoziationstheorie trennt. Die Prozesse und Gesetze der assoziativen Verknüpfung waren jedoch hinsichtlich eines wissenschaftlichen psychologischen und neurologischen Anspruches noch nicht ausreichend und erschöpfend beschrieben und erklärt.
Moderne Assoziationstheorien
Das Fach der Psychologie spezialisierte sich zusehends, doch die Assoziationsprinzipien spielen in vielen Teilbereichen dieser eine wichtige Rolle. In der von Watsons Behaviorismus (1919) stark beeinflußten Entwicklungspsychologie knüpfte man an die von Pawlow entwickelten Prinzipien der Konditionierung an. Watson experimentierte seiner Zeit mit menschlichen Kleinkindern, um herauszufinden, daß, mit einfachen Worten gesagt, die Probanden einen behaglichen Zustand einem angsteinflößenden durchaus vorziehen und dementsprechend Wünsche und Ängste (nicht nur die der Kleinkinder) durch physischen Schmerz und Lust konditioniert werden können. Aus Watsons Programm des Behaviorismus formulierte Thorndike das Kernstück der behavioristischen Lernpsychologie: das Gesetz des Effektes, welches aussagt, daß Handlungen, die angenehme Folgen haben wiederholt und solche, die unangenehme nach sich ziehen, vermieden würden. Der wohl bekannteste und einflußreichste Behaviorist Skinner (1953) unternahm dann Versuche, die so angelegt waren, daß Belohnung und Ignoranz auf das Verhalten des Versuchstieres Einfluß nahmen.18 Die Psychologie des Lernens welcher ein besonders wichtiger Teil dieser Wissenschaft ist, lehnt sich sehr stark an die Assoziationstheorie. Robinson (1932) erachtete die folgenden Gesetze als wichtig:
Kontiguität, Assimilation, Häufigkeit, Intensität, Dauer, Zusammenhang, Bekanntheitsgrad usw. Da sie sich mit den Fragen beschäftigt, wie wir lernen und warum wir vergessen, untersucht sie nicht nur die Regeln, nach welchen wir Begriffe und Vorstellungen verknüpfen, sondern auch, wie die Verknüpfung als solche beschrieben oder modellhaft dargestellt werden können.
Ein altes, aber immer noch akzeptables Modell ist das der Gedächtnisspuren oder Engramme (dt. das Eingeschriebene). Der psychologische Begriff Engramm bezeichnet eine Spur im Gedächtnis, die beim Erlernen eines neuen Elementes entsteht, welches ein Gegenstand, ein Begriff oder ein komplexerer Sachverhalt sein kann. Bei jeder Wiederholung, so nimmt man an, wird die Gedächtnisspur tiefer und dauerhafter. Aber ähnlich wie eine Zimmerpflanze bedarf sie guter Pflege. Vergißt man sie zu gießen, verkümmert sie und stirbt ab, wobei das Phänomen des Vergessens genau dem Verschwinden eines Engrammes entspricht. Oder anders ausgedrückt: man kann sich diesen Vorgang so vorstellen, wie das Einritzen eines Zeichens in den Sand, welches immer tiefer wird, wenn man es wiederholt nachzieht, was mit der Zeit aber auch wieder verschwinden kann, z.B. wenn verständnislose Passanten es wieder wegwischen oder der Wind es zuweht. Der unbestreitbare Vorteil dieses Erklärungsversuches liegt darin, daß er sehr anschaulich ist und die Vorgänge des Lernens und Vergessens einheitlich erklärt, d.h. mit einer Idee. Diese funktioniert jedoch nur, betrachtet man den menschlichen Geist nach aristotelischem Vorbild als eine tabula rasa.19
Wie aber erklärt dieses Modell nun Assoziationen?
Diese seien entsprechend eine spezielle und besonders wichtige Art der Gedächtnisspur, welche ebenfalls durch Wiederholung geprägt wird und bei Ausbleiben dieser zerfällt.
Bildlich beschrieben stellt sie einen Pfeil im Sand dar, der von einem Zeichen auf ein anderes verweist. Eine Behauptung also, die darauf hinweist, das viele Bilder in unser Gedächtnis eingeschrieben sind, die durch Pfeile (assoziative Verknüpfungen) miteinander in Beziehung stehen. Doch wie kommen diese dahin? Nun, bei dem Versuch einer Beantwortung dieser Frage sind wir schon unversehens in die Gefilde der Bewußtseins- und Gedächtnisforschung geraten.
Gedächtnis und Bewußtsein
Bevor ich im folgenden einige Phänomene behandele, die Begriffe wie Gedächtnis und Bewußtsein voraussetzen, möchte ich möglichen Verständnisschwierigkeiten aus dem Weg gehen.
Der sicherste und wissenschaftlichste Weg, dieses zu tun wäre das klare Definieren dieser Begriffe. Schlechterdings führt der Versuch einer Definition dieser Begriffe wieder in neue Schwierigkeiten, wie jeder festgestellt haben wird, der beispielsweise über die rätselhafte Klarheit des alltäglichen Verständnisses von Begriffen wie Bewußtlosigkeit in Verwunderung geraten ist.
„Er hat das Bewußtsein verloren!“, hört man Leute sagen, die sich als erlebnisgierige Traube um einen regungslosen Leib eines Menschen scharen, der irgendwie nicht dazu bereit scheint, auf die prüfenden Kniffe zu reagieren. „Wo liegt es denn? “, könnte JEMAND fragen, würde aber sicherlich nur argwöhnische Blicke ernten.
„Was denn?“
„Das Bewußtsein! Dann könnten wir es ihm wiedergeben, wenn wir es gefunden haben.“ Die Leute würden diesen, ihnen wohl albern erscheinenden Vorschlag sicher mit der gleichen Entschiedenheit ablehnen, wie die Vorstellung, daß das Bewußtsein ein zu suchender Gegenstand sein soll und diesem JEMAND statt dessen nahelegen, seine törichten Bemerkungen für sich zu behalten.
Bewußtsein zu sprechen, so sind doch seine Siliciumbausteine verblüffender weise auch erst aus Sand hergestellt worden...)
Törichte Idee oder wissenschaftliches Ziel? oder
Wissenschaftliche Idee und törichtes Ziel?
Die wissenschaftliche Erforschung des Bewußtseins hat begonnen, als man sich fragte, wie dieses Phänomen beschaffen sei, wie es entsteht und funktionieren könne. In diesem Kontext soll Bewußtsein im Sinne von der Gesamtheit der Erlebnisse, d.h. der erlebten psychischen Zustände und Aktivitäten einer Person zu verstehen sein. Der Gebrauch der Wendung Etwas-im-Bewußtsein-haben soll nicht zu der Vorstellung verführen, daß Bewußtsein sei eine Art Kübel, soll aber auch nicht als eine Art reglementierende Instanz verstanden werden, da dies weder durch unsere eigenen, noch durch experimentelle Erfahrungen bestätigt ist und daher zu Schwierigkeiten führen kann.
Wie verhält es sich nun mit dem Gedächtnis?
„ Gedächtnis ist die geistige Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern und später zu reproduzieren und wiederzuerkennen. Daneben bezieht sich die Bezeichnung Gedächtnis auch auf das, was behalten wird - sowohl auf die gesamte erinnerte Erfahrung als auch auf den Abruf einer erinnerten Erfahrung Die meisten Kognitionspsychologen definieren Gedächtnis als aktiv wahrnehmendes kognitives System, das Information aufnimmt, enkodiert, modifiziert und wieder abruft. Im Mittelpunkt dieser Perspektive steht jener Bereich des Organismus, der durch die Konzentration der Behavioristen auf Reiz-Input und Reaktions-Output vernachlässigt wurde - das, was zwischen den beiden Prozessen geschieht. Die Assoziationen , die sich zwischen Reizereignis und Reaktion bilden, sind selbst Gedächtniseinheiten. Ein Organismus ohne Gedächtniskapazität ist nicht fähig, von Erfahrung undübung zu profitieren, Assoziationen zu nutzen, um auf der Basis dessen, was war , vorhersagen zu können, was sein wird . “20
Unser Gedächtnis ist also eine grundlegende Voraussetzung dafür, daß wir Beziehungen zwischen Zu- und Gegenständen und ein Gesetz wie das von Ursache und Wirkung überhaupt erst aufstellen können. Trotz der Uneinigkeit der Psychologen, wie das Gedächtnis im besonderen funktioniert, stimmen sie sich weitgehend darin überein, das es drei Gedächtnissysteme gibt: das sensorische Gedächtnis, welches nur flüchtige Impressionen von Bildern, Tönen, Gerüchen und Strukturen für wenige Sekunden aufbewahrt; das Kurzzeitgedächtnis, welches nur begrenzte Informationen beinhaltet, wenn sie nicht mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht und wiederholt werden und das Langzeitgedächtnis, welches für gewöhnlich immer abrufbar ist und gewissermaßen unser Weltwissen bildet. Doch in welcher Form wird Wissen aufbewahrt?
Einige Wahrnehmungstheorien
Die Schablonentheorie.
Diese Art der Wahrnehmungstheorie nimmt an, daß wir alle Eindrücke als starre Abbilder in unserem Gedächtnis speichern. So entspreche das Muster der Buchstabens A dem der Schablone des Lautes a. Zwischen beiden bestehe notwendigerweise eine Assoziation, die durch Erfahrung entstanden ist. Eine Identifizierung von Reizen geschehe nun dergestalt, daß alle wahrgenommenen Reize mit den bereits vorhandenen verglichen und gegebenenfalls wiedererkannt werden. Diese Annahme besticht durch ihre Einfachheit ebenso, wie durch ihre Unschlüssigkeit. Wie erklären es sich Vertreter dieser Theorie, daß wir auch verschiedene Varianten des Musters A eindeutig als A erkennen, gleichwohl wir sie vorher vielleicht noch nie gesehen haben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Tat lassen sich diese verschiedenartig aussehenden Zeichen problemlos als Repräsentanten den lateinischen Buchstabens A identifizieren.
Demzufolge, damit die Theorie nicht ins Schwanken geriete, müsste man also zusätzlich annehmen, daß eine große Vielzahl von Schablonen in unseren Köpfen gespeichert sei, welchen bei jedem Lesen einer bisher unbekannten Handschrift wüchse. Um sich der Worte Schopenhauers zu bedienen: „Welch ein Tumult wäre dann in unserem Kopfe, während des Anhörens einer Rede, oder dem Lesen eines Buches!“21
Dies wurde natürlich auch von der neueren Psychologie erkannt und es wurde daher ein anderes Modell entwickelt
Das Modell der Merkmalsanalyse
Diese Theorie vertritt, daß es sich mit den starren Abbildern durchaus nicht so verhalten kann und gelangte zu dem Schluß, daß nur die wesentlichen, charakteristischen Merkmale eines Objektes gespeichert werden. So ergibt sich ein Reizmuster, welches bei dem Großbuchstaben A zwei sich spitzwinklig treffende, für gewöhnlich gleich lange schräge Linien sind, welche zusätzlich durch eine, von diesen begrenzte, sich ungefähr in der Mitte des Reizmusters befindliche horizontale Linie verbunden werden. Demzufolge geht eine Wahrnehmungstheorie, die sich auf diesen Grundgedanken stützt, davon aus, daß alle Reize vorerst zergliedert würden, um dann diese mit den im Gedächtnis angelegten Merkmalslisten zu vergleichen. Bei einer Übereinstimmung des Analyseergebnisses mit einer Liste im „mentalen Katalog“ stellt sich der Effekt ein, den man „Etwas-als-etwas-Erkennen“ bezeichnen könnte. Identifizierung also.
Diese Theorie geht also schon nicht mehr von einem bloßen passiven Wahrnehmen aus, da sie eine notwendige Aktivität des Subjektes voraussetzt. Diese beginnt schon bei der Feststellung, mit welcher Art von Reiz der Betrachter es zu tun hat. Dann folgt die Vorauswahl der Kategorien der Merkmalslisten. Es wäre müßig, bei der Identifikation von Menschen Merkmalslisten von Buchstaben zu verwenden. Der zweite Beitrag der Innensteuerung, wie es die Psychologen bezeichnen, besteht darin, daß sehr viel erraten wird. Das heißt, daß nicht jedes Zeichen analysiert wird, sondern nur eine gewisse Teilmenge. Dxr Rxst wxrd xxfgrxnd vxn Erwxrtxngxn xnd dxs Vorwxssxns xxnfxch xrgxnzt. Also wird nur ein Teil des Reize wirklich wahrgenommen und der Rest wird erraten. Dadurch spart man nicht nur Zeit, sondern ermöglicht auch Fehlerkorrekturen und eine Ergönzung fehlender oder falscher Reizteile (Fehler im Reizmuster werden einfach übersehen, es sei denn, man sucht danach). Diese Theorie postuliert also eine ständige Aktivität des wahrnehmenden Subjektes, d.h. Wahrnehmung ist, wie schon der Begriff nehmen einen aktiven Prozeß beschreibt, alles andere als ein bloßes passives Empfangen von Reizen. Daraus jedoch ergibt sich, daß eine scharfe Trennung zwischen Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken nicht möglich ist. Um denn Zusammenhang dieser Phänomene noch einmal in einem Satz zu verdeutlichen: Bei der Wahrnehmung von Reizen findet ein Denkproze ß während des Analysierens der Reizmuster statt, dessen Resultat dann mit den im Gedächtnis befindlichen Merkmalslisten verglichen wird. Oder: Eine Taube erkenne ich nur als solche, wenn ich ihre Erscheinung auf bestimmte, für Vögel geltende Merkmale hin untersuche und diese daraufhin mit meinen gespeicherten Merkmalen vergleiche (z.B.: gurrendes, sich vornehmlich in Menschennähe aufhaltendes, grau gefiedertes, flugtaugliches Geschöpf mit Schnabel; eventuell mit einem Grünzweig in diesem, um friedliche Koexistenz zu proklamieren...). Stimmen diese überein, kann ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon aus gehen, daß es sich dabei tatsächlich um einen Vogel namens Taube handelt. Gewiß aber kann ich mir dabei nicht sein. Wie kann ich mit Sicherheit behaupten, daß erstens mir die Wahl meiner Merkmalsliste geglückt ist und zweitens, daß diese fehlerfrei zusammengestellt ist? Überdies ist auch noch nicht geklärt, wie diese Merkmalslisten zustande kamen oder wie sie miteinander zusammenhängen. Ergeben sie sich zwangsläufig durch Erfahrung, logische Schlüsse oder Gewohnheit. Ist das Subjekt, unser Ich, auch schon an der Entstehung dieser Muster beteiligt oder entsteht es selbst aus diesen Mustern? Die Beantwortung dieser Fragen fordert nun neue Ansätze.
Wandlung der Assoziationslehre
In der Geschichte der Assoziationen ist immer wieder und auch heute noch ein Bestreben beobachtbar, sich von den Aristotelischen Verknüpfungsregeln zu lösen. Dennoch war stets ein Wandel und der Assoziationslehre zu vermerken, ohne daß das Grundsätzliche in Frage gestellt wurde. Zumeist betrafen sie die Ursache und Art der Verknüpfung. Die einfachste Vorstellung ist das kettenförmige Aneinanderhaften. Durch eines der Assoziationsgesetze, welches man als die
Theorie des zufälligen Haftens
bezeichnen könnte, sind alle Bewußtseinsinhalte folgendermaßen miteinander verknüpft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jeder Teil ist einfach an den nächsten geheftet und mit rasch abnehmender Stärke an die übernächsten und noch entfernteren Teile, so daß es verschiedene Grade der Intensität der Verknüpfung ergibt. Es gehöre zur Natur aller psychischen Gebilde, bei häufiger Berührung so aneinander haften zu bleiben. Bei dieser Art der Verknüpfung bedürfe es keines Zwischengliedes.
Da diese Theorie allerdings als nicht haltbar angenommen wird, vermutet man in neuerer Zeit ein zusätzlich vorhandenes Bindeglied.
Theorie des Bindegliedes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Jordan 1935)
Dieses Bindeglied kann das Gefühl (Herder), die Gestaltqualität (Ehrenfels), die Bedeutung oft im Sinne des Gebrauchszwecks (Rignano), ein Name (Schuhmann , Titchener und Wittmann) oder das Ergebnis des willkürlichen Zusammenfassens: die zusammenfassende Aufmerksamkeit (G.E. Müller), die Apperzeption (Wundt, Wittmann, Petermann) oder eine synthetische (Kant) , reichere Gebilde produzierende (Komplexe) und zusammenhaltende Tätigkeit des Betrachters (Meinong, Benussi).
Ähnlich wie in einem dynastischen Staat , dessen beliebige Untertanen durch das gemeinsame Herrscherhaus zusammengehalten werden, entspricht in der Theorie des Denkens der Begriff der Ganzheit der Obervorstellung 2 2. Durch die Einführung des Bindegliedes erhält die anschauliche Einheitlichkeit nicht nur eine gewisse Verkörperung, sondern es verlieren auch der Zusammenschluß und die Verknüpfungen ihre Zufälligkeit, sobald man dieses Bindeglied in den Bestrebungen und Tätigkeiten des Ich sucht. Aber auch dieser Theorie kann man ihre unbedingt Gültigkeit nicht ohne Vorbehalte zusprechen. Sehr wahrscheinlich ist es, daß unter dem zweckbestimmten Begriff „Küchengeräte“ nicht wahllos oder zufällig irgendwelche Gegenstände unterschiedlichster Art zusammengefasst werden und daher durchaus von einer ordnenden Tätigkeit des Ich ausgegangen werden kann, aber wie verhält es sich beispielsweise oder besonders bei Gefühlen?
Nach welchen Kriterien wählt ein Kind schreckliche Situationen und Gegenstände aus und fasst diese unter dem Gefühl Furcht zusammen?
Beispiel: Die Gegenwart von großen Hunden erfüllt einen Knaben mit großem Entsetzen. Vermutlich rührt seine Furcht vor großen Hunden daher, daß sich einst unglücklicherweise und zufällig seine nicht unbegründete Annahme der Bissigkeit eines sehr bedrohlich wirkenden Exemplars bestätigt hat.
Wenn die Gruppenbildung von Begriffen verschiedener Gebiete Behelfs eines Bindegliedes erklärt werden kann, wird das Wesen des Zusammenhanges im Seelischen um so schleierhafter, betrachtet man die Fälle, in denen zwar ein Bindeglied vermutet, aber nicht gefunden werden kann.
Erste Versuche zu Überwindung des Beliebigkeitsansatzes
So scheint es also Assoziationen zu geben, die eine Tätigkeit des Ichs erfordern und andere, deren Zustandekommen scheinbar nur zufällige Ursachen zum Grunde haben. Eine grundsätzliche Wandlung vollzieht sich mit Wundts Unterscheidung zwischen innerer und Äußerer Assoziation (um 1880). Als Äußere Assoziationen nimmt Wundt eben jene an, deren Ursprung in der zufälligen raum-zeitlichen Aufeinanderfolge von Ereignissen verstanden wird, während die inneren Verknüpfungen aus Gründen der Ähnlichkeit oder sachlich-inhaltlicher, d.h. logischer Beziehung vorgenommen werden. Diese logischen Beziehungen also sind nun keine Verstärkung des äußeren, empirischen Zusammentreffens, sondern vom Subjekt selbständig gesetzte Verknüpfungen von Inhalten, deren gemeinsames äußerliches Auftreten niemals zuvor wahrgenommen wurde.
Absurderweise aber führt diese Unterscheidung der beiden Arten von Assoziationen zu dem paradoxen Schluß, daß es keinen Unterschied ihrer Ursprünglichkeit gibt, da Wundt alle Arten der inneren Verwandtschaft auf die Ähnlichkeit zurückführt. Da wir aber nur von Ähnlichkeit sprechen, wenn wir eine Gemeinsamkeit der Elemente der verglichenen Objekt festgestellt haben, so bedeutet doch die Gemeinsamkeit der Elemente das beobachtbare gleichzeitige und räumlich nah beieinander liegende Auftreten dieser allein schon bei einem der Objekte als dessen Eigenschaften. Wenn wir einem Gegenstand Eigenschaften zuschreiben, erwarten wir, daß diese nicht nur gelegentlich auftreten, sondern ausnahmslos und kontinuierlich. Andererseits würde eine Zuschreibung einer Eigenschaft auch keinen Sinn machen. Wir kategorisieren, um Ordnung zu schaffen. Ordnung ist eine Kontrollinstanz. Doch kontrollieren können wir nur , wenn das, was wir gern kontrollieren würden, auch berechenbar ist. Daher bezeichnen wir als eine Eigenschaft von Gegenständen und Objekten nur das, was in unser Auffassung nach sicher zum Wesen des Beschriebenen gehört und wenn ein Ausbleiben dessen, was wir als Eigenschaft bezeichnen, dazu führte, daß es sich nicht mehr um den beobachteten Gegenstand handelt. Wir wären überrascht. Ein Stein wäre eben kein Stein mehr, wenn uns seine Konsistenz einen gallertartigen Eindruck macht.
Also ist ein Vergleich zweier Objekte, um eventuelle Ähnlichkeiten festzustellen notwendig mit der Beobachtung zweier raum-zeitlich nah beieinander liegenden Phänomene verbunden, deren Zufälligkeit zwar bestritten, aber nicht widerlegt werden kann.
Die bedeutete: Die scheinbare innere Assoziation zwischen zwei Gebilden a b c d e und c d e f g wäre zurückzuführen auf zwei äußere Assoziation der gemeinsamen Elemente c d e mit dem abweichenden a b und f g (Wundt1887).
III. Schluß
Versuch eines Resümees
Diese Behauptung bestärkt nun schließlich die Annahme, wie sie vor allem die Empiristen, besonders aber Hume vertraten, daß jede Art von Vorstellung letztendlich sich auf der Erfahrung begründe, der Wahrnehmung der beobachtbaren Ereignisse, deren Zufälligkeit wir nur durch die Gewohnheit Herr werden. „ Der psychologische Mechanismus der Assoziationen zwingt ... [uns] , gewohnheitsm äß ig zu glauben, daßdas, was in der Vergangenheit geschah, auch in der Zukunft geschehen werde.
Das ist ein biologisch rein nützlicher Mechanismus - vielleicht könnten wir ohne ihn gar nicht leben -, aber er hat nicht die geringste rationale Grundlage. So ist der Mensch nicht nur ein irrationales Wesen, sonder gerade der Teil von uns, den wir für rational hielten - die menschliche Erkenntnis , einschließlich der praktischen -, ist völlig irrational “23 Hume sagt, trotz logischer Ungültigkeit spiele die Induktion im praktischen Leben eine unentbehrliche Rolle. Wir können nur leben, da wir uns Wiederholungen anpassen und methodisch Regeln und Gesetze einführen, welche den zufälligen Wiederholungen eine rationale Grundlage geben sollen. Wir bewegen uns inmitten von Wahrscheinlichkeiten und die Realität ist die Summe der größten Wahrscheinlichkeiten, ließe sich da herauslesen. Das Leben - reine Stochastik? In dieser Welt wachsen wir auf und unser Verstand wird entsprechend geprägt, bevor er sich selbst daran machen kann, die Welt zu prägen.
Wir beobachten, daß ein Ereignis unter gleichen Bedingungen immer den gleichen Verlauf hat und nehmen an, daß es sich damit in der Zukunft ebenso verhalten werde; d.h. bei jeder Bestätigung einer unserer Meinungen, Vermutungen oder Vorurteile, bewußt oder unbewußt, verstärkt sich die Assoziation zwischen den verknüpften Vorstellungen. Dies hat zur Folge, daß wir beim nächsten Auftreten dieses Ereignisses um so überzeugter von der Richtigkeit unseres Vorurteils sind, welches wir dann schon lange nicht mehr als ein solches betrachten, sondern als sicheres Wissen bezeichnen.
Auch da, wo es vielleicht gar keinen Zusammenhang gibt, ist der Mensch durchaus dazu in der Lage, einen solchen herzustellen. Selbst, wenn wir ihn nur glauben zu sehen, ist er schon da - in Form einer Assoziation zumindest. So entstehen auch Glaube, Erwartungen und andere Phänomene, wie vielleicht Wunderlichkeit (der vom Schluckauf gepeinigte Schnürschuhträger).
Der Mensch - ein vernünftiges Wesen, was seiner Irrationalität auf die Schliche gekommen ist?
Nun, daß der Mensch kein Wesen ist, was sich rein durch Vernunft leiten lässt, selbst dann, wenn er darum bemüht ist, zeigt sich in der Bewältigung auch der kleinsten Lebensfragen. Der ist verloren, wer sich in Vertrauen auf die Fähigkeiten seines Verstandes verlässt. Rational denken und berechnend handeln wäre durchaus vernünftig, wenn sich jeder rational verhielte und alles berechenbar wäre. Schlechterdings ist dem nicht so. Sonderlinge, Käuze und Nonkonformisten - Bezeichnungen für verschrobene Marginalexistenzen, die für die Unberechenbarkeit einiger Exemplare der Spezies Menschen sprechen. Diese Bezeichnungen weisen unmissverständlich auf die Eigenschaft dieser Leute hin, sich für gewöhnlich den Regeln der Üblichkeiten und somit auch einer Berechenbarkeit zu entziehen. Wer ist nun unvernünftiger: die alles berechenbar zu machen Bestrebten oder die Unberechenbaren?
Selbst, wenn sich im Sinne eines LaPlace´schen Geistes alles erfassen ließe, jede Information über sämtliche Zustände, Dinge und Vorgänge verfügbar wäre, so muß das nicht notwendig bedeuten, daß alles berechenbar sei. Zumindest liegt dieses Vorhaben weit über der Grenze der Möglichkeiten der menschlichen Verstandes, worauf uns auch Hume in seiner Untersuchung hinweist. Und gerade weil dem so ist, halten wir an den lebensnotwendigen Überzeugungen fest, gleichwohl sie unbegründbar, aber dem praktischen Leben unentbehrlich sind. Dort, wo die Vernunft versagt, tritt an ihre Stelle ein anderes Phänomen, welches unsere Entschlüsse, unsere Entscheidungen beeinflußt, mag es ein Gefühl, eine Erwartung oder die Gewohnheit sein. Wer in seinem Gefühl und seinen Gewohnheiten eine Schwäche von sich findet, die es mit der Stärke des Vernunft zu besiegen gilt, wird wohl verzweifeln an jener Stärke des Verstandes, der er versteht alles in Zweifel ziehen zu können. Aus übertriebenem Skeptizismus kann „ nichts dauerhaft Gutes entstehen", meint Hume, „ solange er in seiner vollen Kraft und Stärke verharrt. Wir brauchen einen solchen Skeptiker nur zu fragen, was seine Absicht sei und was er mit all diesen sorgfältigen Untersuchungen bezwecke. Er gerät dann sofort in Verlegenheit und weißkeine Antwort. “24 Das Infragestellen sollte nicht der Selbstgenügsamkeit Anheim fallen.„ Ich lobe mir jede Skepsis auf welche mir erlaubt ist zu antworten: ,Versuchen wir ’ s! ‘ Aber ich mag von allen Dingen und allen Fragen, welche das Experiment nicht zulassen, Nichts mehr hören. Diess ist die Grenze meines ,Wahrheitssinnes ‘ : denn dort hat die Tapferkeit ihr Recht verloren.“25, urteilte Nietzsche über den Zweck des Zweifelns. Das gilt wohl auch für jede Art von Untersuchung. Wozu also eine Untersuchung eines so abstrakten Gebietes wie das der Assoziationen? Wo ist der von Hume verlangte Praxisbezug?
Einerseits ist die Betrachtung der Gesetzmäßigkeiten der Assoziationen ein wesentlicher Ausgangspunkt seiner erkenntnistheoretischen Entwicklungen, andererseits aber untersuchte Hume die Bedeutung der Vorstellungsverknüpfungen in den verschiedenen Literaturgattungen. Diese Untersuchungen waren bis zu elften Auflage als ein Addendum des Abschnittes III beigefügt, fehlen aber in der weitverbreiteten Reclam-Ausgabe. „ Ausgangspunkt ist die Beobachtung, daßder Mensch ein Wesen ist, das ,beständig sein Glück ‘ verfolgt und daher selten ,ohne Vorsatz und Absicht ‘ spricht und handelt. Aus diesem Grunde müssen auch Schriftsteller, wenn sie die Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer fesseln wollen, in ihren Werken einen Plan oder Zweck verfolgen, das heißt: Ereignisse und Handlungen, die vom Schriftsteller berichtet werden, müssen durch eine Art Kette oder Band verknüpft werden, also ,eine Einheit bilden ‘ “ . 26 Ein Chronist muß sich in seinen Berichten an der raum-zeitlichen Berührung der Ereignisse orientieren, ein Historiker hingegen an der Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Je lückenloser ihre Darstellungen der Geschehnisse gelingen, um so überzeugender werden ihre Arbeiten wirken. Hume bezeichnet die Beziehung von Ursache oder Verknüpfung nicht nur als die stärkste von allen, sondern auch die lehrreichste, da das Wissen um sie uns dazu befähigt, Gewalt über die Ereignisse zu haben und die Zukunft zu beherrschen.
Lückenlose Kausalketten in der epischen Dichtung jedoch gäben uns keine Gelegenheit dazu, uns in die Geschichte hineinzuversetzen, sie ließen unsere Gemüter kalt. Fehlte aber ein nachvollziehbarer Zeitstrang, hätten wir sicher große Mühe, den Ausführungen zu folgen. Ebenso verhält es sich mit Beschreibungen. Ist ein Gegenstand, eine Szene oder eine Person zu erschöpfend beschrieben, ist mit Sicherheit der Leser danach auch erschöpft. Kunstvoll ist es wohl, wenn es gelungen ist, statt einer umfassenden Beschreibung ein Bild zu finden, dessen Verknüpfung mit dem Geschehen uns auf überwältigende Weise einen Eindruck davon zu geben vermag, was der Dichter empfunden haben muß, um dies zu schreiben, wozu es unter anderem auch der Phantasie bedarf. Phantasie ist wohl die Gabe, die durch die Erfahrung gewonnenen Vorstellungen auf überraschende Weise miteinander zu verknüpfen. Auch wenn nach Hume die einzige schöpferische Kraft des Menschen darin liegt, das durch die Sinne erworbene Material zu kombinieren, so bleibt es dennoch rätselhaft, wie dies gelingt und wieso wir einige Ergebnisse solcher Verknüpfungen als ästhetisch, umwerfend oder berauschend empfinden, sei es Literatur, Musik oder bildende Kunst und andere als abstrus, lächerlich oder verwerflich. Schnell finden wir Gefallen an nie Gesehenem, nie Gehörtem, nie Geschmecktem, aber auch ebenso schnell Mißfallen. Etwas weckt unsere Aufmerksamkeit, anderes scheint so belanglos, daß wir nicht einmal Notiz davon nehmen. Nun kann man davon ausgehen, daß die Aufmerksamkeit, unser Gefallen an etwas und unsere Phantasie komplizierte Mechanismen sind, die unser Handeln entschieden beeinflussen, gar steuern und man würde sicher noch vielerlei solcher Mechanismen unseres Geistes finden, auf deren Funktion sich unser Verhalten zurückführen lässt, die wiederum ihren Ursprung in den Assoziationen haben werden, bei denen es sich „... um natürliche, durch den Ablauf eines psychischen Mechanismus von selbst sich einstellende Verbindung von Vorstellungen [handelt]“.27 Somit bewahrt sich das Zustandekommen dieses psychischen Phänomens noch eine gewisse Rätselhaftigkeit. Zumindest müsste man annehmen, daß wir seit unserer Geburt mit einem „Datenverarbeitungsprogramm“ ausgestattet sind, welches aus den unvorhersehbaren Zufällen der erfahrbaren Erscheinungen eine Art Wahrscheinlichkeitsgleichung errechnet und unser Handeln entsprechend auf die größte Wahrscheinlichkeit abstimmt. Das verstehen wir dann unter Gewohnheit.
„ Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen... [und] Der Mensch ist ferner ein handelndes Wesen.“28
Vielleicht nicht nur ferner, sondern gleichermaßen. Doch ein vernünftiges Wesen wird seine Handlungsfähigkeit verlieren, wenn es immerfort darüber nachdenkt, ob es vernünftig ist, vernünftig zu denken und dabei nur die Unvernünftigkeit seiner Vernunft erkennt. Überdies ist der Mensch in seinem Handeln auch von seinen Gefühlen geleitet und das nicht unwesentlich. Glücklicherweise. Denn dann, wenn der Zweifel die Vernunft verlässt und aus dem Verstand in die Verzweiflung führt, ist es wohl am ratsamsten, sich nicht zu scheuen, seinen Gefühlen zu glauben, die uns gelegentlich eindeutiger von der Existenz unserer erkenntnisgierigen Selbst überzeugen, als ein durch das Verlangen nach der Gewißheit unserer Vorstellungen gelenkten Versuche eines Beweises der in ihrer Existenz anzweifelbaren Wahrheit.
Die zahllosen, analytischen und spekulativen Untersuchungen des menschlichen Geistes, des Bewußtseins und dessen Fähigkeiten auf den Gebieten der Psychologie und Philosophie sind ebenso wissenschaftlicher Selbstzweck, wie der Versuch einer Standpunktbestimmung der Spezies Mensch vermittels einer Abstraktion durch Sprache.
„ Mit dem Zauberstab der Worte bildet der Mensch aus der Formlosigkeit und Bewegtheit der Welt die ordnenden Gestalten der Begriffe. “ 29
Begriffe benötigt er, um etwas zu begreifen, Ordnung zu schaffen in die unerschöpfliche Vielfalt der Erscheinungen, die er zergliedert und vergleicht, sich selbst darin einzuordnen versucht, um letztendlich sich selbst begreifen zu können. Aber: „ Weder darf der Mensch glauben, er gleiche den Tieren, noch er gleiche den Engeln, noch darf er in Unkenntnisüber dieses und jenes, sondern er mußdieses und jenes wissen.
Schmeichelt er sich, so erniedrige ich ihn; erniedrigt er sich, so schmeichele ich ihm; und immer widerspreche ich, bis er begreift, daßer ein unbegreifbares Unwesen ist. “30
IV. Literaturnachweis
- Arnold, W./Eysenck, H.J. /Meili R.(Hg.), Lexikon der Psychologie Band 1, Augsburg 1996
- Aster, E.v., Geschichte der Philosophie, Stuttgart 1988
- Gadenne, V., Bewußtsein, Kognition und Gehirn. Einführung in die Psychologie des Bewußtseins, Bern 1996
- Herkner, W., Psychologie, Wien 1992
- Hume, D. ; Herring, H., (Hg.), Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Stuttgart 1967
- Metzger, W.; Brügel, W./ Jäger, R.(Hg.), Psychologie. Wissenschaftliche Forschungsberichte Band 52, Darmstadt 1968
- Mosch, A., Kleines Wörterbuch der angewandten Philosophie, Zürich 1996
- Nietzsche, F., Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke Band III. München
- Popper , K.R., Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hamburg 1993 - Schopenhauer, A.; Lütkehaus, L.(Hg.), Die Welt als Wille und Vorstellung. Erster Band, Zürich 1988
- Streminger, G., David Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Ein einführender Kommentar, Paderborn 1995
- Zimbardo, P.G.; Hoppe-Graf, S./Keller, B. (Hg.), Psychologie, Berlin Heidelberg
[...]
1 Hume 1967,3.
2 Hume 1967,3.
3 Hume 1967,7.
4 Hume 1967,6.
5 Hume 1967,6.
6 Hume 1967,6.
7 Hume 1967,8.
8 Hume 1967,8.
9 Hume 1967,8.
10 Hume 1967,10.
11 Hume 1967,14.
12 Hume 1967,14.
13 Hume 1967,14.
14 Hume 1967, [14-15].
15 Der Bewußtseinsinhalt entspricht der Bedeutung des Begriffs perception, welchen Hume in der „Untersuchung über den menschlichen Verstand“ einführte.
16 Es ist durchaus gebräuchlicher zu sagen: „Das erinnert mich an etwas.“ anstatt „Dieses Phänomen weckt in mir Assoziationen zu einem bestimmten Sachverhalt meiner erlebten Vergangenheit.“ Ein anderer gebräuchlicher Ausdruck ist der Einfall: „Dabei fällt mir ein, ...“ beschreibt in der Tat nichts anderes als einen assoziativen Vorgang.
17 Popper 1993
18 Die sogenannte Skinnerbox, ein Versuchskäfig, ist so konstruiert, daß bei einer Betätigung eines zu diesem Zwecke angebrachten Hebels Nahrung in den Futternapf fällt. Der Forscher behauptet, die darin konditionierten Tierchen darauf dressiert zu haben, Hebel zu drücken. [...Andererseits - begibt man sich auf den Standpunkt der Versuchstiere - könnte man auch die Ansicht vertreten, daß diese den Forscher dressiert hätten, ihnen stets bei Betätigung des Hebel Futter zu verabreichen...]
19 Hierbei betrachtet man den Geist oder das Bewußtsein zwangsläufig nicht als einen Zustand, sondern als Gegenstand, so daß man, um das Modell anschaulich zu gestalten, immer wieder auf dingliche Vergleiche zurückgreift, wie z.B. Tafel oder Sand. (Um dem Modell entgegen zu kommen: Selbst, wenn ein Computer so etwas wie Assoziationen aufweisen sollte, um nicht gleich von
20 Zimbardo 1992, 268
21 Schopenhauer 1988, 72; Schopenhauer bezog diese Aussage zwar auf die Annahme, das wir bildhaft denken, d.h. Zeichen, die wir wahrnehmen in Bilder unserer Phantasie übersetzen, um die Unanschaulichkeit unserer Vorstellungen zu beweisen, jedoch schien mir, daß ich ihm mit der Verwendung dieses Zitates in diesem Zusammenhang kein Unrecht tue. 16
22 Begriff nach Liepmann 1904 und Ach 1921.
23 Popper 1993, 92.
24 Hume 1967, [131-132].
25 Nietzsche 1988, 415.
26 Streminger 1995, 96 aus Hume Originaltext des Addendums, Ausgabe Green/Grose Band IV, 19-23 24
27 Streminger 1995, 93.
28 Hume 1967,6.
29 Reiners, Stilkunst 1943 in Mosch (Hg.) 1996, 79.
30 Pascal, Pensées 1669 in Mosch (Hg.) 1996, 91.
- Quote paper
- Alexander Friedrich (Author), 1999, Über die Assoziationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96516
Publish now - it's free


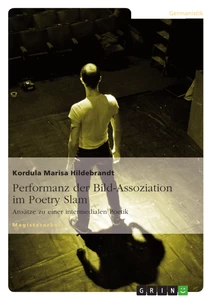
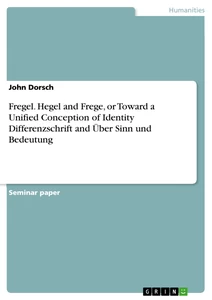

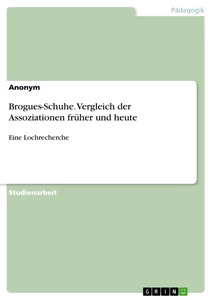
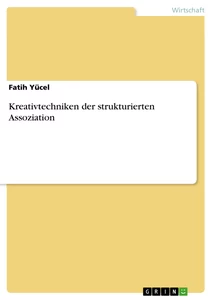













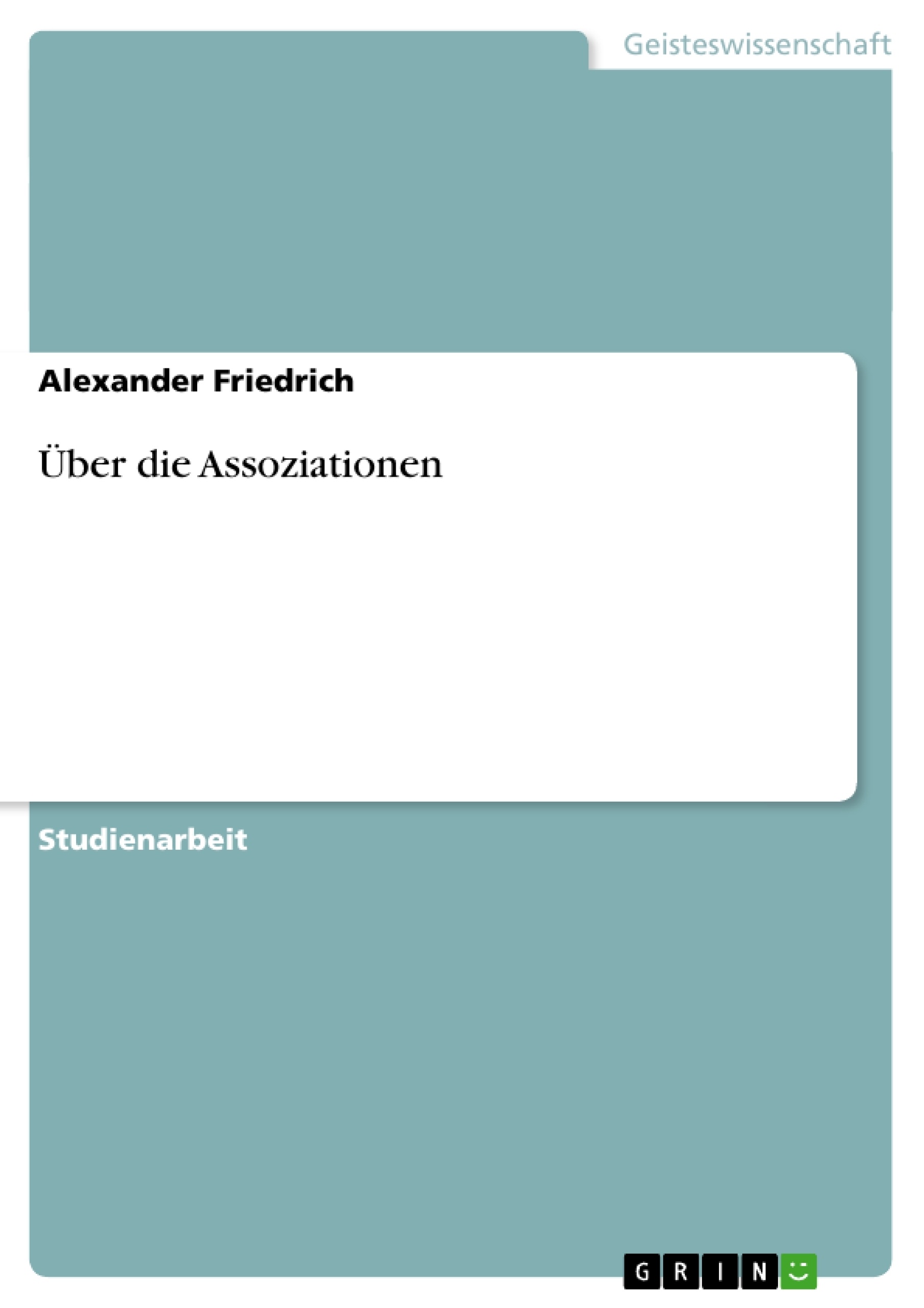

Comments