Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bedeutung und Entwicklung der Bildung in Japan
2.1 Bildungsexpansion im 20. Jahrhundert
2.2 Bedeutung der Eliten
2.3 Reformen und Tendenzen
3. Erziehung und Gesellschaft
3.1 Allgemeine Ordnungsprinzipien
3.2 Rolle der Mutter
4. Bildungsinstitutionen - Orte zur Reproduktion der Gesellschaft
4.1 Kindergarten und Grundschule
4.2 Mittel- und Oberschulen
4.3 Bedeutung der juku
4.4 Mathematikunterricht an japanischen Schulen
1. Einleitung
Das heutige japanische Bildungssystem basiert auf den Vorgaben der amerikanischen Besatzungs- macht, die nach dem Zweiten Weltkrieg demokratische Werte garantieren wollte. Dabei entstand eine Konstellation, die auf der einen Seite Freiheit und Gleichheit betont und auf der anderen Seite von Tradition, der Betonung von Kleingruppen, und dem Ideal der Harmonie geprägt ist. Nach international vergleichenden Studien nimmt das japanische Bildungssystem zumindest in der Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern eine Spitzenposition ein. Somit ergibt sich die Frage, inwiefern Japan in diesem Bereich eine Vorbildfunktion für andere Bildungssysteme haben kann.
In der folgenden Arbeit soll zunächst die Entwicklung und die heutige Bedeutung der Bildung in Japan beschrieben werden. Weiterhin sollen die japanischen Ordnungsprinzipien in der Gesellschaft und ihre Grundlegung in Form der Erziehung durch die Mutter und dem Leben im Kindergarten und in der Schule aufgezeigt werden.
2. Bedeutung und Entwicklung der Bildung in Japan
2.1 Bildungsexpansion im 20. Jahrhundert
Der eindrucksvolle Aufstieg Japans vom Entwicklungsland zur Industriemacht ging einher mit einer enormen Expansion der Bildung.
Historische Berichte über die japanische Kultur und Mentalität weisen auf eine besonders ausgeprägte Wißbegier und eine vergleichsweise hohe Betonung der Erziehung. Die Neugierde der Japaner wird bereits von europäischen Missionaren des 16. Jahrhunderts als besonderes Phänomen be- schrieben. Diese besondere Haltung scheint in der japanischen Kultur fest veran- kert und hat sich bis in die heutige Zeit hinein gehalten. „Sie [die Japaner] brauchen keinen ideellen Überbau, aus dem die Argumente für Bildung abzuleiten wären. Sie sind von jeher davon überzeugt, daß es darauf ankommt und sich lohnt, Neugier auf noch Unbekanntes zu haben beziehungsweise zu wecken“ (Schaarschmidt 1996, 146).
Die Meiji-Reform 1868 brachte nach jahrhunderterlanger Abgeschlossenheit nach außen die Öffnung des Landes und somit die Möglichkeit und die Hoffnung, sich den modernen westlichen Nationen anzugleichen. Dabei sollte die Aneignung von Wissen auch ein Beitrag zur „Festigung der kaiserlichen Regierung“ sein und wurde somit von der Regierung stark gefördert (ebd., 156). Die Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkrieges war für die Japaner ein Zeichen dafür, daß die Öffnung des Landes zur übrigen Welt und die Auseinandersetzung mit ihr gescheitert war. So sollte es die Aufgabe der jungen Generation sein, es besser zu machen. Zudem schufen die USA als Besatzungsmacht ein Ge- samtschulsystem, das die höhere Bildung für alle Bürger ermöglichen sollte. Dieser Umstand und die traditionelle Haltung der Japaner zu Bildung und Erziehung bildeten die Grundlage für den Bildungs- Boom der Nachkriegszeit (vgl. ebd.).
Die Entwicklung in der japanischen Gesellschaft geht somit seit Ende des Zweiten Weltkrieges hin zu immer höherer Bildung, was sich an dem Wachstum der Absolventenzahlen der Oberschulen und Universitäten eindeutig zeigt. Der Anteil der japanischen SchülerInnen, die nach der Mittelschule noch die dreijährige Oberschule besuchen, betrug 1950 noch 42,5 % und steigerte sich danach lau- fend, bis er 1975 sogar die 90 % überschritt. Dieser Trend setzte sich noch weiter fort, so daß heute nahezu alle SchülerInnen die Oberschule absolvieren (vgl. Hara 1996, 199). Weiterhin studieren 35 % eines Jahrgangs an einer Hochschule oder an einer zweijährigen Kurzuniversität (vgl. Schubert 1992, 129). Die Bedeutung der Bildung in Japan zeigt sich aber nicht nur an der hohen Zahl der O- berschul- und Universitätsabsolventen, sondern ebenso an der Zeit, die die SchülerInnen in der Schule verbringen. Die Anzahl der jährlichen Schultage beträgt etwa 230 bei einer Stundenzahl von mindestens sieben pro Tag (vgl. Schubert 1992). Deutsche Kinder dagegen verbringen etwa 210 Tage im Jahr in der Schule, wobei die durchschnittliche Stundenzahl bei fünf pro Tag liegt.1
Das gute Abschneiden japanischer SchülerInnen bei international vergleichenden Studien2weist wei- terhin auf einen qualitativen Vorsprung zumindest in den naturwissenschaftlichen Fächern und der Mathematik hin, auch wenn nicht eindeutig geklärt ist, ob dieser Vorsprung durch den Aufbau und die Inhalte der Curricula oder durch höhere Motivation der SchülerInnen verursacht ist. Da die beschriebene Bildungsexpansion parallel mit einem enormen wirtschaftlichen Erfolg des Lan- des verlief, stellte sich automatisch die Frage, inwieweit das Bildungssystem für das japanische Wirt- schaftswunder verantwortlich war. Anfangs ging man davon aus, daß der hohe Bildungsstand der japanischen Bevölkerung der bedeutendste Faktor für diesen Erfolg war. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch Einschränkungen in diesem Zusammenhang. Teichler (1992) kommt zu der Feststel- lung, daß die Expansion der Bildung durch die Praxis der Beschäftiger, jeweils die leistungsstärksten Absolventen einzustellen, stimuliert wurde, ohne daß die hohe Zahl von „hohen“ Abschlüssen eigent- lich erforderlich gewesen wäre. Somit sei es durch die hohe Bewertung der Bildung auch zu einer „strukturellen Überqualifikation“ gekommen (Teichler 1992, 24). D.h. dadurch, daß die Unterneh- men nur die besten SchülerInnen einstellten und jeder einen Platz in der „Unternehmensfamilie“ mit ihrer umfassenden Integration und lebenslangen Versorgung anstrebt, sei ein Bildungsbestreben ent- standen, welches eine hohe Allgemeinbildung schuf, die für die spätere Tätigkeit jedoch relativ unbe- deutend und somit zumindest teilweise nicht erforderlich gewesen wäre. Hier bleibt jedoch zu beden- ken, daß das japanische Ausbildungssystem sich von dem deutschen System grundlegend unter- scheidet. Eine Berufsausbildung im Sinne einer „Lehre“ gibt es in Japan nicht. Zur Sicherung der Qualifikation setzt man dagegen auf den hohen Wert einer breiten Allgemeinbildung3mit anschließen- dem on-the-job-training, wobei der Arbeiter jeweils direkt an eine spezielle Aufgabe herangeführt werden soll. Dabei soll das hohe allgemeine Bildungsniveau die Flexibilität des Arbeitnehmers inner- halb des Betriebes sichern. So bleibt die Frage, ob nicht gerade hier, in der Bedeutung der Allge- meinbildung für die Flexibilität und den „betrieblichen Modernisierungsprozeß“, der Schlüssel für die Leistungsfähigkeit japanischer Unternehmen liegt (Georg 1997, 385).
2.2 Bedeutung der Eliten
Blickt man auf Statistiken über die Biographien von japanischen Ministerial-Beamten und bedeuten- den Persönlichkeiten in der Wirtschaft, so zeigt sich, daß eine bedeutender Anteil dieser Personen- gruppe aus Absolventen der japanischen Elite-Universitäten besteht. Denjenigen, die beispielsweise die Tokyo-Universität besucht haben, ist eine glänzende Karriere quasi sicher (vgl. Teichler 1992, 25). Entscheidend ist allerdings nicht die Ausbildung an den Universitäten, denn ihre Ansprüche sind nicht so hoch wie man vielleicht vermuten würde (vgl. ebd.). Wirklich wichtig ist lediglich der Zugang zu den Universitäten und für die Auswahl der Absolventen von den Unternehmen zählt in erster Linie der Name bzw. der Ruf der Ausbildungsanstalten. Da in Japan allerdings über 90 % der Schüler die Oberschule besuchen, besteht für nahezu alle die theoretische Chance für den Eintritt in eine angese- hene Universität. Somit scheint die Verwirklichung einer jedermann zugänglichen Bildung erreicht. Der japanische Begriff der Elite unterscheidet sich von dem europäischen dadurch, daß er nicht auf sozialen Schichten beruht und auch keine Schichten schafft (vgl. Saarschmidt 1996,160). Die Expan- sion der Bildung schafft in Japan eher ein Phänomen, das sich als „Massen-Elite“ bezeichnen läßt (ebd.). Es handelt sich hierbei also um eine reine Leistungselite, zu der jeder Zugang hat, der die Aufnahmeprüfung einer hochangesehenen Universität besteht. Der Zugang ist für jeden ein harter Weg, für den die Weichen durch entsprechende Förderung und durch die Wahl der Schulen zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen der Oberschulen gestellt werden. Der finanzielle Aufwand der Familien für die Förderung der Kinder ist (z.B. durch den Besuch der privaten Nachhilfeschulen) relativ hoch, so daß SchülerInnen aus kinderreichen Familien schlechtere Chancen haben.
2.3 Reformen und Tendenzen
Für ein umfassendes Bild des japanischen Bildungssystems ist auch der Blick auf die in Japan wahrgenommenen Probleme und die bisherigen und aktuellen Reformbestrebungen notwendig. Der Übergang vom Bildungs- zum Beschäftigungssystem, die im internationalen Vergleich herausragenden Leistungen der SchülerInnen und die japanische Erziehung allgemein wurden von westlichen Autoren in den vergangenen Jahren oft als vorbildhaft gelobt.
Japans Fähigkeit, Elemente fremder Kulturen zu übernehmen und in Verbindung mit der eigenen Kul- tur diese Eigenschaften zu perfektionieren, wurde mit Staunen beobachtet. Die Japaner selbst sehen ihr Bildungssystem jedoch in vielen Punkten als reformbedürftig.
In Japan gab es seit der Öffnung des Landes im 19. Jahrhundert zwei Bildungsreformen. Die erste fand während der Meiji-Ära im Jahre 1872 statt, die zweite Reform folgte nach der Kapitulation von 1945. Beide Reformen zielten auf das Aufholen des erzieherischen Rückstandes gegenüber den westlichen Nationen (vgl. Ito 1997, 452). 1872 wurde ein neues Bildungssystem geschaffen, das unabhängig von Ständen eine Elementarerziehung schaffte, die an die Qualität der Leistung die Berufsaussichten knüpfte. Ziel war somit die optimale Nutzung der Arbeitskräfte, die eine Industriealisierung ermöglichen und die wirtschaftliche Entwicklung anspornen sollte.
Die zweite Reform 1946 beinhaltete einen Schwerpunkt auf demokratische Werte, die die Grundlage der Erziehung bilden sollten. Eine Art der Umsetzung dieses Ziels war die Vereinheitlichung und Zentralisierung des Systems. So wurden Lehrbücher, Lehrpläne und die Vorgaben für die Erziehungsmethoden vereinheitlicht (vgl. ebd.).
Waren diese ersten beiden Reformen unmittelbar mit politischen Umwälzungen verbunden, so ver- bindet sich die dritte Reform mit der Kritik an der mangelnden Kreativität4der japanischen Schüle- rInnen. Der 1984 von Ministerpräsident Nakasone einberufene Nationale Bildungsreformrat berich- tete von 1985 bis 1987 über den Zustand des Bildungssystems. Nach dieser aufwendigen Analyse war das Bildungswesen zu dieser Zeit „desolat und von tiefsitzenden Pathologien gekennzeichnet, wobei auf Schikanieren und Gewalt in der Schule und exessiven Wettbewerb als deutlichste Phäno- mene verwiesen wird“ (Teichler 1992, 32). Daneben wird auch auf den Verlust der traditionellen Werte, auf die starren Strukturen und die Rigidität der Lernaktivitäten in den Schulen sowie auf den starken Druck auf die Individuen, der eine „gesunde Charakterentwicklung verhindert“, hingewiesen (ebd. 33).
Somit wurden drei grundlegende Ziele formuliert, die diesen Verhältnissen entgegenwirken sollten : Diversifizierung, Individualisierung, und Internationalisierung der Bildung. Durch die Diversifizierung sollte den Schulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten und den SchülerInnen mehr Wahlmöglichkeiten gegeben werden, die Individualisierung sollte die Entwicklung der Kreati- vität ermöglichen und die Internationalisierung die internationale Handlungsfähigkeit für die Zukunft sicherstellen (vgl. ebd. 34).
Ito (1997) merkt an, daß die Ziele „Kreativität“ und „Diversifikation“ nicht neu sind. Sie waren be- reits die Grundlage der zweiten Reform von 1946, fanden in der Praxis jedoch keinerlei Verwirkli- chung. Dabei sieht er den „Widerspruch zwischen der Förderung der erzieherischen Effezienz und der Förderung der Individualität“ als eine Hauptursache für das Ausbleiben einer wirklichen Förde- rung von Kreativität bisher (Ito 1997, 454). D.h. man verließ sich auf ergeb-nisorientierte Ziele und war gegenüber pädagogischen, nicht direkt „sichtbaren“ Zielen eher skeptisch. Weitere Kritik übt er an der reinen Bedeutung wirtschaftlicher Interessen, die unter dem Deckmantel des Interesses an der Erziehung verfolgt werden. „Was die Regierenden mit ihremInteresse an der Erziehungheute he- ranziehen wollen, sind schöpferische Eliten, die zur wirtschaftlichen und politischen Gestaltung des 21. Jahrhunderts beitragen können“ (ebd.). Der relativ große Einfluß der Wirtschaft im japanischen System ist auch bedingt durch die direkte Vermittlung von Arbeitsstellen durch die ausbildenden Institutionen. Die Unternehmen richten sich an bestimmte Schulen und fordern ihren Vorstellungen entsprechende Arbeitskräfte. Diese direkte Verbindung sorgt scheinbar für die Dominanz wirtschaftlich orientierter Qualifikationsprofile auf Kosten pädagogischer Interessen.
Durch das System der Aufnahmeprüfungen an den Oberschulen und Universitäten blieben viele Re- formbemühungen mit pädagogischen Zielen ohne den erwünschten Erfolg. So erfolgte auf die Herab- setzung der Anzahl der Unterrichtsstunden in den 70er Jahren bei gleichbleibendem Niveau der Auf- nahmeprüfungen eine Expansion der privaten Nachhilfeschulen (juku). Im Zuge der sog. „Neuen Anschauung über die Lernfähigkeit“ in den 90er Jahren sollten Qualifikationen wie „Hilfsbereit- schaft“, „Lerneifer“ oder „Aktivität in den Schülerversammlungen“ in die Bewertung der einzelnen SchülerInnen mit einfließen und somit in den Zeugnissen sichtbar werden. Dieses schien notwendig, da die vorherigen Versuche Individualität zu schaffen keinen Erfolg gezeigt hatten (vgl. ebd. 461). Diese Bemühungen sollen in Zukunft noch weiter durch die Erweiterung der Bewertung von individu- ellen Faktoren als Kriterium für die Aufnahme an den Oberschulen ausgebaut werden. Neben den Aufnahmeprüfungen sollen Empfehlungen der Lehrer, Vorstellungsgespräche und eine Einschätzung des Charakters über die Aufnahme entscheiden. Ito kritisiert hieran, daß sich somit das Verhalten der SchülerInnen zwar ändert, es bleibt aber auf die Prüfungen fixiert, d.h. sie verändern ihr Verhal- ten nicht aus Überzeugung, sondern zeigen z.B. soziales Engagement nur durch den Druck, den das Examenssystem jetzt auch auf ihr Benehmen und ihre Art, wie sie sich nach außen präsentieren, ausübt. Mit dieser neuen Aufgabe des Lehrers (der Bewertung des Charakters) ändert sich auch die Lehrer-Schüler- Beziehung entscheidend. War früher der Lehrer eher Partner bei der Vorbereitung auf die Examen, so zeichnet sich durch den Zwang zur Bewertung individueller Eigenschaften der Persönlichkeit und somit der Beobachtung individuellen Verhaltens eine Störung dieser bisher kooperativen Beziehung ab. „Es besteht die Gefahr, daß die Erziehungsbehörde durch ihreneue Anschauungüber die Lernfähigkeitden Schülern ein detailliert normiertes Verhaltens- muster aufzwingt, anstatt ihnen tatsächlich Raum für Kreativität und Diversifikation zu geben“ (Ito, 1997,461).
3. Erziehung und Gesellschaft
3.1 Allgemeine Ordnungsprinzipien
Mit Hilfe des Bildungssystems reproduziert sich eine moderne Gesellschaft. Somit ergibt sich beim Blick auf die Bildung in einer anderen Kultur die Notwendigkeit zur Betrachtung der Ordnungsprinzipien des gemeinschaftlichen Lebens.
Die Grundprinzipien gesellschaftlicher Ordnung in Japan unterscheiden sich wesentlich von den unsrigen. Den westlichen Individualismus prägt ein Bild von der Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen. Freiheit gilt als oberstes Prinzip, auch bei der Wahl der Beziehungen und der Art, in der sie gestaltet sind. Bindungen zu anderen Menschen beruhen auf individuellen Entscheidungen. Formen sozialer Kontrolle und emotionale Abhängigkeit laufen dieser Vorstellung zuwider und gelten als Beschränkungen, die möglichst vermieden werden (vgl. Rohlen 1996,94).
Das japanische Prinzip sozialer Ordnung dagegen beruht nicht auf Individuen, sondern auf die Betonung von Gruppen. In den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Miteinanders werden Gruppen gebildet, in denen bestimmte Ordnungsprinzipien gelten. Dabei gilt es immer die individuellen Interessen dem Ziel der Gruppe unterzuordnen, um die Harmonie zu erhalten und um eine homogene Struktur mit möglichst hoher Effektivität zu schaffen.
Da die Mitgliedschaft in einer Gruppe jeweils einen großen Teil im Lebensbereich der Japaner ausmacht, gilt der Eintritt in eine neue Gruppe als ein bedeutender Wendepunkt, der immer auch entsprechend gefeiert wird. Zu Beginn der Gruppenbildung spielt das Einüben von Routinen eine besondere Rolle. So gibt es z.B. bestimmte Kleidervorschriften, Diskussionsregeln und Rituale der Begrüßung und Verabschiedung, die mühevoll und zeitaufwendig eingeübt werden. Dabei zählt im Gruppenleben besonders auch die „informelle Geselligkeit“ zur Förderung der emotionalen Bin- dung eine große Rolle5(ebd., 121). Der emotionale Druck einer Gruppe anzugehören, ist entspre- chend groß, und „Nichtteilnahme gilt als Ablehnung, als Geste der Mißachtung und als Zeichen der Entfremdung. Kooperationsbereitschaft und Ordnung stehen auf dem Spiel, und der Prozeß der Gruppenbildung bleibt unvollendet“ (ebd., 122). Somit wird auch die Entstehung vieler Probleme durch den Gruppendruck verhindert, und auf das Eingreifen einer regulierenden Führungsperson kann meistens verzichtet werden. Zwischen den Mitgliedern einer Gruppe bemüht man sich also im- mer um Konsens, und man versucht Konkurrenzsituationen auszuschließen. Das ist bei der Bezie- hung zwischen den Gruppen jedoch anders. Hier wird die Konkurrenz gefördert. Jedoch kann sich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe je nach dem Stand der Konkurrenz auch ändern, so daß auch „Kooperationsmöglichkeiten über fließende Grupppengrenzen durchaus möglich sind“ (Yamamura 1996, 325).
Durch die Betonung der Bedeutung von Gruppen und durch das diesen Gruppen entgegengebrachte Vertrauen in ihr Leistungsvermögen, einen bedeutenden Teil der Erziehung zu übernehmen, werden in Japan die pädagogischen Institutionen in den Mittelpunkt gestellt. Somit verzichten z.B. auch die El- tern weitgehend auf ein Mitspracherecht in den Schulen und übergeben ihnen möglichst viel pädago- gische Autorität.6
3.2 Rolle der Mutter
Die Rolle der japanischen Mutter bei der Erziehung unterscheidet sich sehr von der westlichen Praxis. Dieses bedeutet auch, daß japanische Kinder bereits vor dem Kindergarten und der Schule ganz andere Verhaltensmuster lernen. Somit ist es von Bedeutung die Voraussetzungen, die bereits vor der institutionalisierten Bildung geschaffen werden, zu beleuchten.
Mit der Modernisierung Japans setzte auch eine Veränderung der Erziehung ein. War während des Mittelalters vorwiegend der Vater für die Erziehung zuständig, so geht seit der Meiji-Zeit die Mutter dieser Aufgabe nach. Das Ideal der „weisen Ehefrau und guten Mutter“, die den bedeutenden Einfluß auf die Nachkommen der Nation hat, steigerte sich bis zum zweiten Weltkrieg bis zum Bild der „Mutter des Militarismus“ (Elschenbroich 1996, 17). Die Entwicklung der modernen Familie folgte dann nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend dem westlichen Muster. Die Intensität der Emanzipa- tionsbestrebungen war jedoch nicht gleich. Japanerinnen sehen das Erwerbsleben in der Regel nicht als Ort der Selbstverwirklichung. Vielmehr sehen sie sich und ihren Ehemann als jeweils unterschied- lichen Teil der Familie mit ebenso unterschiedlichen Aufgaben. Die Frau ist verantwortlich für den Haushalt7mit allen seinen Aufgaben, der Mann konzentriert sich nur auf seinen Beruf. Damit in Ver- bindung steht ein anderes Bild von Abhängigkeit als in westlichen Ländern. „Abhängigkeit wird aber in Japan nicht nur in höherem Maße als unabänderlich hingenommen; sie gilt in mancher Hinsicht so- gar als gesellschaftliches Ideal“ (Weber-Deutschmann 1992, 141). Diese Art der Abhängigkeit ist jedoch nicht einseitig, sondern wechselseitig zu sehen und findet sich in vielen Bereichen der japani- schen Gesellschaft. Die japanische Mutter empfindet also ihre Abhängigkeit nicht unbedingt als be- lastend und die Rolle des arbeitenden Mannes nicht als ein Privileg und als Mittel zur Selbstverwirkli- chung. Somit kommt sie mit ihrer eigenen Rolle auch weniger in Konflikt und identifiziert sich mit ihr vollständig. Sie kommt in der Regel nicht in die ambivalente Situation zwischen Karriere und Familie, sondern sie legt sich eindeutig fest. Die meisten Frauen geben jedoch auch an, vor der Ehe gern ge- arbeitet zu haben (vgl. Elschenbroich 1996, 19). Doch wenn das erste Kind geboren worden ist, arbeiten sie in der Regel nicht mehr. Durch diesen „Rollenperfektionismus“ herrscht ein nicht unbe- deutender gesellschaftlicher Druck, und die Mütter, die ihre Aufgabe nicht wirklich ernst nehmen, fallen somit sofort auf (ebd.).
Das Kind ist der Mittelpunkt im Leben der Mutter,8und auch der Ehemann muß hier zurückstehen. Die Kindererziehung macht die Aufgabe der Frau der des Mannes gleichwertig. Die Mutter sieht sich im allgemeinen nicht als unterdrückt, sondern ihre Aufgabe ist nur eine andere als die ihres Ehemannes. In Japan bezeichnet ihre Hingabe an das Kind „nur die spezifisch weibliche Variante eines allgemeinen Musters, das auch vom Mann eine ebenso uneingeschränkte Hingabe an seine Aufgaben im Berufsleben fordert (was natürlich umgekehrt auch kein Indiz für die Gleichberechtigung der Frau ist)“ (Schubert 1992, 83). Zur Aufgabe der japanischen Ehefrau gehört aber neben der Erziehung der Kinder auch die Versorgung des Ehemannes, der zu Hause im allgemeinen als eine Art Gast gesehen wird, der sich erholen soll, um sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren zu können.
Auch in der Mutter-Kind-Beziehung wird gezielt auf eine Abhängigkeit des Kindes von seiner Mutter gesetzt. Ziel ist eine enge emotionale Bindung, die lebenslangen Bestand haben kann. Dabei wird die Abhängigkeit nicht als „Entwicklungsrisiko“ gesehen (Elschenbroich 1996, 21). Westliche Erziehung ist dagegen von der Förderung des Individuums, das möglichst unabhängig von anderen sein soll, geprägt. Dieser Unterschied allein läßt schon eine Schlußfolgerung auf den erhöhten Zeitbedarf bei der japanischen Mutter zu.
Bei der westlichen Erziehung gibt es immer zwei Seiten: Die Interessen des Kindes und die der El- tern. Bei unterschiedlichen Interessen ergibt sich eine Phase des Aushandelns eines Kompromisses. Dabei ist auch die Feststellung der Unvereinbarkeit der Bedürfnisse möglich. Die japanische Mutter hat ein differenziertes Ziel: Sie tut alles, um Auseinandersetzungen zu vermeiden und setzt auf eine Kooperation zur „Sicherung und Entfaltung einer grundlegenden Übereinstimmung von Mutter und Kind“ (Schubert 1992, 68). Dabei wird immer davon ausgegangen, daß das Kind nicht seinen Wil- len durchsetzen oder die Grenzen austesten will, sondern man glaubt, daß das Kind es eben noch nicht besser weiß und deshalb der sorgfältigen Anleitung zum „richtigen“ Verhalten bedarf.
Dieses bedeutet für die Mutter eine beinahe totale Verpflichtung, in der sie völlig eingebunden ist und in der für eigene Interessen so gut wie kein Platz mehr bleibt. Sie muß stets anwesend sein, um das Kind zu beaufsichtigen und um ggf. seine Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen. Schubert (1992) bezeichnet die Mutter-Kind-Beziehung als „harmonisch-kooperativ“9. In der Zusammenar- beit für die optimale Förderung des Kindes strebt man eine harmonische Übereinstimmung an. Die weitgehende Verpflichtung der Mutter in dieser Beziehung kann für sie allerdings auch eine Entlastung bedeuten. Sie kann sich ohne wenn und aber auf ihre Aufgabe der Kindererziehung festlegen und steht daher weniger unter dem Zwang, sich für eine von vielen Aufgaben entscheiden zu müssen.
Der Begriff „professionelle Mutter“ (Elschenbroich 1996) trifft somit die genau definierte Aufgabe der Mutter: ihre bedingungslose Haltung über die Priorität der Kindererziehung.
4. Bildungsinstitutionen - Orte zur Reproduktion der Gesellschaft
4.1 Kindergarten und Grundschule
Die Grundlagen für die Funktion der Gruppenprozesse in der japanischen Gesellschaft werden heut- zutage bereits im Kindergarten gelegt. In einer insgesamt lockeren und ungezwungenen Atmosphäre wird dort das Miteinander in den Gruppen geübt, so daß diese Sozialform schon für Kinder zur Selbstverständlichkeit wird. Die Erzieherinnen versuchen dabei ihre Autorität zurückzuhalten, um möglichst viel Verantwortung und Selbständigkeit in die Gruppe zu bringen. Da- bei zählt das gemeinsame, auf gleiche Ziele gerichtete Handeln (vgl. Schubert 1992, 107). Nachdem im Kindergarten die erste Ablösung von der Mutter, das Einüben von Ritualen und die erste Gewöhnung an Gruppen stattgefunden hat, wird der Eintritt in die Schule als ein besonderer Abschnitt gesehen und von den Familien auch entsprechend gefeiert. Mit diesem Schritt in die Schule sind sich Eltern und Lehrer bewußt, daß im Prinzip die Vorbereitung auf die späteren Aufnahmeprü- fungen schon beginnt. Der Unterricht ist jedoch nicht besonders von Konkurrenz geprägt, und auch direkte Leistungsvergleiche zwischen den SchülerInnen werden weitgehend vermieden (vgl. Schubert 1992,137).
In der Grundschule wird bezüglich der Gruppenerfahrung der Kinder an die Kindergartenzeit angeknüpft, die Rituale und der Tagesablauf insgesamt unterscheiden sich z.T. jedoch sehr.
„Meist sieht man etwa 40 SchülerInnen und Schüler in einem verhältnismäßig kleinen Klas- senzimmer ruhig dasitzen, die Hände auf den Oberschenkeln oder hinter dem Rücken, offen- sichtlich sehr aufmerksam dem Vortrag des Lehrers lauschen, den sie manchmal sogar (oft wieder unisono) mit Ausdrücken begleiten, die man im Deutschen mit „aha“ o.ä. übersetzen könnte. Frontalunterricht ist die Regel. Die Schüler beteiligen sich hauptsächlich, indem sie gemeinsam nachsprechen, rezitieren, kurz gemeinsam antworten oder einzeln - etwa so, wie wir es aus konventionellen Unterrichtssituationen bei uns kennen - vorlesen oder auf Fragen des Lehrers antworten. Dabei pflegen sie in der Regel aufzustehen, den Stuhl sorgfältig unter die Bank zu schieben, sich dahinter oder daneben aufzustellen (selbst wenn die Antwort nur aus zwei bis drei Wörtern besteht), laut und deutlich zu sprechen, um sich dann wieder hinzu- setzen“ (Schubert 1992, 137f.).
Im Vergleich zum deutschen Grundschulunterricht fällt hier sofort die Disziplin und der „Drill“ ins Auge. Es handelt sich scheinbar um einen von vorne bis hinten durchorganisierten Unterricht, mit dem wir eher den Alltag beim Militär assoziieren als den in einer Grundschule. Natürlich ist der Unterricht nicht immer und überall so strukturiert, wie er oben geschildert wurde. So wird auch von Klassen mit so „lebhafter Atmosphäre“ berichtet, „daß amerikanische Lehrer durch den tolerierten Lärm wahr- scheinlich gestört wären“(ebd.). Was jedoch den Unterricht so diszipliniert erscheinen läßt, ist nicht eine autoritäre Lehrerin, sondern wohl eher die Selbstverständlichkeit der Rituale und Regeln bei
Schülern und Lehrern. Denn der Unterrichtsstil in den Grundschulen wird als „keineswegs autoritär“ bezeichnet, so daß die Einübung der Regeln nicht durch Strenge erreicht wird, sondern mehr durch die frühe Gewöhnung an Rituale und durch vielfache Wiederholungen. (ebd.). Ebenso wird über größtenteils lebhafte Kinder berichtet, die „bei aller punktuellen Förmlichkeit keineswegs einen ange- spannten oder gar eingeschüchterten Eindruck“ machen (ebd.). Somit werden zwei Ebenen des ja- panischen Schullebens sichtbar, die sich eindeutig trennen lassen: Wo Aufmerksamkeit notwendig ist, greifen in kurzer Zeit die Regeln, so daß wenig Zeit verloren geht. In ihrer „freien Zeit“ zeigen die SchülerInnen aber ebenso Ausgelassenheit und Lebhaftigkeit sowie ein unbefangenes und „oft gera- dezu herzliches Verhältnis“ zu ihren Lehrerinnen (ebd.). Die so diszipliniert ablaufenden Phasen des Unterrichts sind also nicht repräsentativ für den gesamten Ablauf des Schultages an den Grundschu- len zu sehen, sondern sie sind nur ein Teil des Ganzen, das auch aus einer vielfältigen Abwechslung der Tätigkeiten besteht. So finden sich die SchülerInnen zu Beginn des Tages zu einer Morgenver- sammlung zusammen, nach den ersten Unterrichtsstunden am Vormittag folgt das gemeinsame Mit- tagessen, und danach wird im Schulgebäude aufgeräumt und geputzt. Nach einer weiteren Unter- richtsphase verteilen sich die SchülerInnen dann auf verschiedene außerunterrichtliche Aktivitäten, so daß der Schultag erst am späten Nachmittag endet (vgl. ebd. 139). Somit nimmt schon die sechsjäh- rige Grundschule die Kinder zeitlich sehr in Anspruch. Den größten Teil des Wochentages sowie den halben Samstag verbringen sie in der Schule. Durch die lange Anwesenheit in der Schule und die Förderung durch die Eltern aufgrund ihrer allgemeinen Überzeugung für den hohen Wert der Bildung sind japanische Kinder „immer und unter allen Umständen in erster Linie Schüler; es gibt für sie keine auch nur annähernd gleich wichtigen Verpflichtungen oder wünschenswerten Optionen als die, die sich aus dem Schulleben ergeben“ (ebd. 141).
Die Bedeutung der Schule mit ihrem ausfüllenden täglichen Programm nimmt im Leben japanischer SchülerInnen somit einen weit größeren Teil ein als in Deutschland.
Da der elterliche Einfluß auf das Kind fast den ganzen Tag über ausbleibt, geben die Eltern auch ei- nen größeren Teil an Verantwortung und Möglichkeiten zur Einflußnahme ab. Die Lehrer wiederum verlagern durch das Gruppenprinzip einen Teil dieser Komponenten auf die SchülerInnen selbst. Der Freizeitbereich der Kinder ist also sehr beschränkt. Jedoch ist die Trennung von Schule und Freizeit auch nicht so scharf. Freizeit wird durch die außerunterrichtlichen Aktivitäten in die Schule integriert.
Das Grundschulcurriculum betont aufgrund der sehr weitgehenden Integration des Kindes in die Schule somit auch besonders die soziale, emotionale und moralische Entwicklung (vgl. Lewis,1996, 227). Den Unterricht begleitend werden z.B. persönliche und gemeinsame Ziele formuliert, die auf Spruchbänder geschrieben werden. Diese werden dann im Klassenraum auf- gehängt. Als eine Grundvoraussetzung für die Gruppenbildung wird die Bildung von Freundschaften aber auch die Förderung des Individuums gesehen. Die Gruppenbildung erfolgt in der Grundschule nicht mehr nach gegenseitiger Sympathie, sondern durch eine Einteilung durch die Lehrerin nach den Charaktereigenschaften der Kinder (vgl. ebd. 283). Die gebildeten Gruppen (4-8 Kinder) arbeiten zwischen zwei und sechs Monaten zusammen und sind auch für einen Großteil von organisatorischen Angelegenheiten des Klassenlebens verantwortlich. Die Einübung der Interaktion in den Kleingrup- pen, der Regeln und der Rituale nimmt zu Beginn des ersten Schuljahres viel Zeit in Anspruch, so daß der Unterricht im eigentlichen Sinne erst nach der Beherrschung dieser Voraussetzungen beginnt (vgl. Schubert 1992, 142). Der Unterricht ist somit in einer Form organisiert, in der gemeinsame Verpflichtungen herrschen und in der jeder einzelne Verantwortung trägt. Bedingt durch diese Orga- nisation ist die Passivität des einzelnen schwieriger möglich als im westlichen Unterricht. Jeder ist eingebunden in die gemeinsame Aufgabe, wobei die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe notwendige Disziplinierung in erster Linie durch die spezifische Form der Interaktion und nicht durch laufenden Ermahnungen von seiten der Lehrerin erfolgt. Somit ist die Aufgabe der Lehrerin in den ersten Grundschuljahren diese Form der Kooperation einzuüben. Das sog. „soziale Lernen“ steht also an erster Stelle und bildet die Grundlage für die weitere Schulzeit.
4.2 Mittel- und Oberschulen
Mit dem Eintritt in die Mittelschulen beginnt für die japanischen Schüler die Phase der Vorbereitung auf die Eintrittsexamina der Oberschulen. Diese Examina entscheiden über den weiteren Lebensweg der Japaner in vielfacher Hinsicht. Denn die Qualität der Oberschule entscheidet über die Chancen bei den Hochschulzugangsprüfungen.
Das Problem der Mittelschulen besteht somit aus der angemessenen Förderung derjenigen, die auf das Bestehen der Aufnahmeprüfung an einer Oberschule mit höherem Ansehen setzen können sowie derjenigen, bei denen dieses Ziel außer Reichweite scheint (vgl. Schubert 1992, 164). Durch den Besuch der privatenjukuwird die Struktur der Mittelstufe noch heterogener. Die Ansprüche der Lernenden gehen weit auseinander, denn ein gemeinsames Ziel ist in dieser Schulstufe oft außer Sichtweite. Das Interesse am Unterricht unterscheidet sich durch die unterschiedlichen Ziele der ein- zelnen Schüler voneinander. Die Selektion rückt in den Vordergrund und löst zwangsläufig das Prin- zip der Kooperation in vielfacher Hinsicht auf. Die Auflösung des harmonischen Prinzips spiegelt sich ebenso durch die vermehrten Berichte über Schulangst, Schulverweigerung oder Gewalt10an den japanische Mittelschulen. Entgegenzuwirken versucht man durch künstliche Wiederherstellung der Konformität, z.B. durch Vorschriften über gleichen Haarschnitt oder durch die Erhöhung des Anteils an Moralunterricht (vgl. ebd. 169).
In den Oberschulen bereiten sich die SchülerInnen dann auf die entscheidende Hochschulzugangs- prüfung vor. Der Anteil der SchülerInnen, die die Oberschule besuchen, beträgt schon seit den 70er Jahren über 90% (1993 = 96,2%). Je nach Ansehen und Qualität dieser Schulen haben die Schüle- rInnen Chancen, auch einen entsprechenden Platz an einer Universität zu erhalten. Die besseren und durchschnittlichen Oberschulen konzentrieren sich somit ganz auf die Vorbereitung auf die Aufnah- meprüfungen.
4.3 Bedeutung der juku
Mit dem Eintritt in die Mittelschulen beginnt für die japanischen SchülerInnen auch die Konfrontation mit der Selektion. Dem harmonischen Miteinander, das die Kinder im Kindergarten und in der Grundschule kennengelernt und eingeübt haben, tritt die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen der Oberschulen gegenüber. Da es sich bei den Mittelschulen um Gesamtschulen handelt und somit die Leistungsfähigkeit der Schüler weit auseinander gehen, müssen sie die Kandidaten für die höher angesehenen Oberschulen ebenso fördern, wie diejenigen, die nur Zugang zu einer Oberschule mit niedrigerem Ansehen bekommen. Da die Betriebe jedoch z.T. allein nach dem Namen der Ober- schule ihre zukünftigen Arbeitskräfte auswählen, legt die Zulassungsprüfung zur Oberschule fest, wie das weitere Leben des Schülers bezüglich seiner Berufswahl und seinem sozialen Status verlaufen wird (vgl. Schubert 1992, 164). Aus diesen Gründen besuchen mehr als die Hälfte aller Mittelschüler private Vor- und Nachbereitungsschulen, die sog.juku. Waren diesejukufrüher eher fast nur kleine Institutionen zur Betreuung der Hausaufgaben, so wuchsen sie in den letzten Jahren vor allem zu An- stalten mit manchmal Hunderten von Schülern heran, die sich ganz auf die Prüfungsvorbereitung kon- zentrieren. Somit fördern diejukudie SchülerInnen, die eine angesehene Oberschule anstreben. Sie sorgen aber auch dafür, daß die öffentlichen Schulen bei ihrer egalitären Orientierung bleiben können. „Der Konflikt zwischen den Ansprüchen einer auf Kooperation gründenden Erziehung zur Gruppe und den Selektionserfordernissen sowie den ihnen entsprechenden individuellen Orientierungen wird durch diejukugleichsam privat überbrückt.“ (ebd., 166). Jedoch ist die zeitliche Belastung durch den Besuch der zusätzlichen privaten Institutionen enorm, denn neben den in der Regel zwei- bis dreimaligen Besuch in der Woche kommen die Wochenenden und die Ferien oft noch dazu.
Durch die enge Verbindung des Bildungssystems mit dem Beschäftigungssystem ist die Konkurrenz unvermeidbar. Sie wird jedoch vorwiegend in die privatenjukuverlagert. Die Balance zwischen dem kooperativen Prinzip der öffentlichen Schule und dem Konkurrenzprinzip derjukuschuf die idealen Voraussetzungen für das Beschäftigungssystem. (vgl. Ito 1997,456). Ito sieht die ausgleichende Funktion dieser beiden Komponenten gefährdet, da der Ausbildungswettlauf immer stärker zu wer- den scheint und somit die außerschulische Examenskonkurrenz die Harmonie der Regelschule immer weiter verdrängt (vgl. ebd. 457).
4.4 Mathematikunterricht an japanischen Schulen
Japanischer Grundschulunterricht wird allgemein als „kohärent“, „dramaturgisch geplant“ und mit eindeutig erkennbarem Anfang und reflektierendem Abschluß beschrieben. Es wird viel wiederholt und es wird zur Suche nach alternativen Lösungswegen angeregt, die anschließend bezüglich ihrer Effektivität verglichen werden. So wird in den Aufgabenstellungen oft die direkte Suche nach mög- lichst vielen Lösungswegen formuliert (vgl. Elschenbroich 1996, 34f.). Aufgaben dieser Art nehmen natürlich viel mehr Zeit in Anspruch, als das rein auf das Ergebnis zielende Arbeiten. Es ergibt sich aber vor der eigentlichen Lösung ein ganz anderer Zugang zu den gestellten Aufgaben, der nicht nur alternatives Herangehen an das Problem zuläßt, sondern gerade diese als Ziel sieht. Dieses Prinzip ermöglicht die Erfassung des eigentlichen Problems im Gegensatz zu einer rein „schematischen“ He- rangehensweise. Das offene Ergebnis einer Aufgabe möglichst schnell mit der richtigen Lösung zu füllen, scheint für japanische Lehrer und Schüler nicht das primäre Ziel. Es geht vielmehr um die Er- fassung des Problems aus möglichst vielen Perspektiven. Dabei besteht ein eher freundschaftliches Verhältnis zur Lücke. Nach der Problemlösung findet man sehr ausgiebige Phasen des Übens vor. D.h. Fertigkeiten werden in kleine Schritte zerlegt und immer wieder geduldig wiederholt. Dabei scheinen die LeherInnen weniger unter dem Druck zu stehen, laufend für Unterhaltung und Abwechs- lung zu sorgen (vgl. ebd.). Die Wiederholung des Gewohnten wird somit nicht so schnell als langwei- lig gesehen als in westlichen Ländern und sorgt für die kontinuierliche Verbesserung. Dieses Bild des Unterrichts bestätigt auch die TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), die erstmalig den Vergleich von Unterrichtsprozessen unterschiedlicher Kulturen systema- tisch durchführte. Die Ergebnisse bezüglich des Mathematikunterrichts zeigen, daß die SchülerInnen den Stoff „variationsreicher“ und „mathematisch anspruchsvoller“ durchnehmen (Baumert u.a.1997, 31). Dabei sind die Unterrichtsstunden im Vergleich zu Deutschland und den USA „komplexer und zugleich in sich kohärenter“ aufgebaut (ebd.). Der japanische Unterricht kann als „Problemlöseunter- richt“, der deutsche und amerikanische als „ Wissenserwerbsunterricht“ bezeichnet werden. Dies zeigt, daß in den westlichen Ländern das Rechnen nach Schemata und das Beherrschen von muster- haften Verfahren oft als ausreichend angesehen wird und auf eine Vertiefung und eine Variation von Verfahren eher verzichtet wird. In Japan werden die von den SchülerInnen entwickelten Konzepte angewandt und kognitiv anspruchsvoller geübt.
Außerdem lassen die Aufgabenstellungen „Lösungen unterschiedlicher Güte zu“(ebd.). Das Unterrichtsgeschehen wird in Japan ebenso wie in Deutschland vorwiegend durch den Lehrer bestimmt, jedoch wechseln die Sozialformen insgesamt häufiger.
Dieser Schilderung widersprüchlich ist die Kritik Itos: „Das ausschließliche Interesse an der Frage- form der Examen besteht in der Engführung von Frage und Antwort [...] Die Mathematikprüfung verlangt zum Beispiel den auswendig gelernten kürzesten Lösungsgang und kein Nachdenken über verschiedene Lösungswege11. Die Schüler werden dementsprechend für diese Form des Examens trainiert“ (Ito, 1997,464). In der Phase der Examensvorbereitung geht man also einen Weg, der um einiges vereinfacht und kürzer ist. Nur durch die Gestaltung des Examens sind die Lehrer also ge- zwungen die „kreativere“ Form des Unterrichts (die in der Grundschule mühevoll eingeübt wurde) aufzugeben und fertige Lösungswege vorzugeben. Es stellt sich dadurch die Frage, inwieweit japani- sche Schüler die reine Form des Auswendiglernens übernehmen und was von der „kreativeren“
Form in den Mittel- und Oberschulen noch bleibt. Auf jeden Fall bedeutet die Vorbereitung auf die Examen jedoch Veränderungen in den Lehr- und Lernmethoden. Da die Aufnahmeprüfungen der Oberschulen und Universitäten für das weitere Leben der japanischen Schüler die entscheidende Rolle spielen, muß die Bewertbarkeit der Prüfungen objektiv sein. D.h. man wünscht sich „sichtbare“ und eindeutige Ergebnisse mit möglichst wenig Interpretationspielraum. So ist es verständlich, daß man aus diesem Grund auf die Bewertung von „kreativen“ Leistungen verzichtet, wodurch diese bei den Examensvorbereitungen in den Hintergrund rücken.
[...]
1Hierbei bleibt zu berücksichtigen, daß japanische SchülerInnen auch sehr viel Zeit mit außerunterrichtlichen Aktivitäten in der Schule verbringen. Es zeigt sich dadurch jedoch auch eine sehr weitgehende Integration in das Schulleben, wodurch gleichzeitig eine enge Identifikation mit der SchülerInnen-Rolle ermöglicht wird.
2Die Ergebnisse der TIMMS (Third International Mathematics and Science Study) weisen beispielsweise auf einen Leistungsvorsprung japanischer SchülerInnen hin, der gegenüber deutschen Schülern teilweise mehrere Jahre beträgt (vgl. Baumert u.a.1997).
3Welche vergleichsweise geringe Bedeutung die Fachkenntnisse haben, zeigen Untersuchungen, die die Zahl der Berufsanfänger ohne Bezug zum Studienfach auf mindestens 50 % schätzen (vgl. Schubert 1992, 134).
4Über die Kreativität der japanischen SchülerInnen finden sich widersprüchliche Berichte. Von anderen Autoren wird gerade das Problemlösungsverhalten und somit auch die Kreativität japanischer SchülerInnen gelobt (vgl. Elschenbroich 1996).
5Formen dieser „informellen Geselligkeit“ sind z.B. die fast verbindlichen Treffen von Arbeitskollegen nach der Arbeit
6Viele Dinge, die im Westen als Privatsache gesehen werden, sind in Japan in die Schule verlagert. Dazu gehört z.B. auch die enge Kooperation zwischen Schulen und Betrieben bei der Vermittlung von Arbeitsstellen (vgl. Elschenbroich 1996, 40).
7Die Verantwortung für den Haushalt erstreckt sich auf nahezu alle Bereiche. Dazu gehört z.B. auch die Ve rwaltung der Finanzen und Versicherungen der Familie (vgl. Schubert 1992, 86).
8Ebenso gelten Kinder als „Erfüllung und primärer Inhalt der Ehe“ (Schubert 1992, 29). Kinder zu haben gilt als selbstverständlich und nicht als eine Möglichkeit unter vielen (vgl. ebd.).
9Diese Kooperation betrifft fast den gesamten Lebensbereich von Mutter und Kind. So sind z.B. viele Spiels a- chen und auch Fernsehprogramme für Kinder im Vorschulalter für Mutter und Kind gemeinsam konzipiert (vgl. Schubert, 1992, 72).
10Diese Probleme lösen in der japanischen Gesellschaft eine extreme Beunruhigung aus. Ein Blick auf den internationalen Vergleich zeigt aber, daß z.B. die Gewalt gegenüber Lehrkräften in den USA um ein vielfaches höher liegt (vgl. Elschenbroich 1996, 42).
11Zu ähnlichen Ergebnissen kommen frühere Studien, die einerseits ein allgemein gutes Abschneiden japanischer SchülerInnen bei den internationalen Vergleichstests feststellen, andererseits aber Schwächen bei der Lösung von Aufgaben mit hoher analytischer Kompetenz und Problemlösungsfähigkeiten erfordern (vgl. Schubert 1992,159).
- Arbeit zitieren
- Frank Poppen (Autor:in), 1997, Bildung und Gesellschaft in Japan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96067
Kostenlos Autor werden








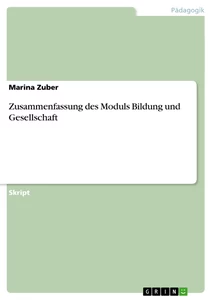













Kommentare