Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort S
Teil 1: 1. Wa verteht man unter dem Thema „Öffnung der chule“
1.1.über die Bedeutung de Begriffe chulautonomie
1.2. Zur Dikuionituation
1.3. Da Konzept der Autonomen chule
1.4.über die Finanzierung der Autonomen chule
1.5. Die Bedingungen für die chulautonomie
1.6. Gegenargumente zur chulautonomie
1.7. Die Rolle de taate
1.8. Der Weg zur chulautonomie
Teil 2: 2. Über die Notwendigkeit der „Offenen chule“: Wo betehen Mängel in der biherigen Organiation der chule und welche Faktoren machen einen Wandel der chule erforderlich?
2.1. Die Familienituation und der Beruf der Eltern
2.2. Die Ernährung der Kinder
2.3. Die zunehmende Mediatiierung
2.4. Die Drogenproblematik an chulen
2.5. Die Kriminalität an chulen
2.6. Die ituation der Hauptchulen
2.7. Anmerkungen zu Integration, elektion und Differenzierung in unerem chulytem
2.8. Zuammenfaung
Teil 3: 3. Vortellung de Modell der Geamtchule aarbrücken- Bellevue
3.1. Die Artitengruppe
3.2. Die Finanzierung
3.3. Die Ziele de Projekte
- Die chulung motoricher Fähigkeiten
- oziale Geichtpunkte
- Zur ituation der Lehrer
- Weitere Gruppen
- Dieöffentlichkeit
3.4. Zuammenfaung
Teil 4: 4. Die Öffnung der chule im Hinblick auf die Zuammenarbeit mit der chulozialarbeit
4.1. Die Ziele de Projekte zur chulozialarbeit
4.2. Da Verhältni zwichen chule und chulozialarbeit
4.3. Bechreibung de Projekte
4.4. Nutzung und Bewertung der chulozialarbeit durch die chüler
4.5. Bewertung der chulozialarbeit durch die Lehrer
Teil 5: 5. Vortellung der Geamtchule al mögliche Alternative zum dreigliedrigen chulytem
5.1. Die Dikuionüber die Chancengleichheit
5.2. Die Begründung der Geamtchule au pädagogicher icht
5.3. treaming und etting- die kooperative und die integrierte Geamtchule
5.4. Die integrative Förderung der chüler an der Geamtchule
5.5. Die Lehrerkooperation an der Geamtchule
5.6. Die Entchulung de Lernprozee
5.7.über Veränderungen durch die Geamtchule und deren Leitungen
6. Die Öffnung der chule im Zuammenhang mit der Bildungpolitik
6.1 Eindrücke einer Tagung der GEW
- Beipiel 1: Die Geamtchule in Markdorf
- Beipiel 2: Eine „ regionale chule “ in Rheinland Pfalz
- Beipiel 3 :Da Bodnegger chulkonzept
6.2. Zur bildungpolitichen ituation
Erklärung
Literaturverzeichni
Vorwort
Am Anfang dieser Arbeit stand die Idee, diese mit einem Lösungsvorschlag oder dem Vorstellen einer optimalen Schulform abzuschließen. Diese Idee habe ich jedoch recht schnell verworfen. Das Thema ist zu komplex und zu vielschichtig, um es auf einen so einfachen Nenner zu reduzieren. Jede Schule und Region stellt ihre eigenen und auch unterschiedlichen Anforderungen an Struktur und Organisation. Es geht mir in dieser Arbeit auch nicht darum, unser bisheriges Schulsystem zu verteufeln und eine unbedingte Position für neue Reformen zu ergreifen. Vielmehr habe ich versucht, die Änderungen unserer Gesellschaft und Probleme, die sich daraus für unsere Schulen ergeben können, darzustellen und anhand bereits existierender Modelle oder Versuche vorzustellen, wie man versucht, dem ein oder anderen Phänomen entgegenzuwirken. Wer also am Ende eine Art Handbuch erwartet, in dem für jedes Problem die richtige Lösung steht, für den wird diese Arbeit von nicht allzu hohem Wert sein. Wer sich jedoch für unsere Schulsituation interessiert und auch bereit ist, sich auf neue Ideen einzulassen, der wird in dieser Ausarbeitung bestimmt den ein oder anderen Ansatz finden, der zu einer „Aktualisierung“ unseres Schulsystems führen kann oder den Alltag in der Schule erleichtern kann. Da ich mich im Rahmen dieser Arbeit nicht mit allen Aspekten dieses Themas auseinandersetzen konnte, habe ich Schwerpunkte, wie z.B. die Schulsozialarbeit oder der Schulautonomie, gewählt, die wohl auch meinen persönlichen Interessen entsprechen. Diese Arbeit soll dem Leser / der Leserin einen Einblick in dieses Thema verschaffen und helfen, sich eine Meinung zu bilden.
Ich bitte zu entschuldigen, daß ich mich bei der Auseinandersetzung mit Schülern und anderen durchweg auf die maskuline Form berufe. Dies geschieht lediglich der Einfachheit halber, Schülerinnen, weibliche Leser und Beteiligte sind hier genauso angesprochen.
Meinen Dank möchte ich noch Professor Rolf Prim und Professor Norbert Rückriem aussprechen, die sich zur Betreuung meines Themas bereiterklärten.
Teil 1: 1. Was versteht man unter dem Thema „Öffnung der Schule“?
„Öffnung der Schule“ soll bedeuten, daß die Schule vor allem für die Schüler wieder attraktiver gestaltet werden soll. Die Schule als reine Lernanstalt, so wird sie leider von vielen Schülern empfunden, soll zu einer „aufsuchenden Schule“ werden. Dies bedeutet, daß der Schüler seine Erfahrungen, die er als junger Mensch mit unserer Gesellschaft macht und die ihm viele Denkanstöße bietet, in der Schule reflektieren kann. Diese Reflexion des Alltags und auch unserer Gesellschaft sollte ein fester Bestandteil von Lehrplan und Unterricht werden, denn was die Schule für viele Schüler unattraktiv macht, ist die Trennung zwischen Gesellschaft und Schule. Hilfen zur Lebensbewältigung findet der Schüler nicht in ausreichendem Maße. Für den Schüler bedeutet dies einen Bruch: Die Schule als Institution zur Wissensvermittlung auf der einen Seite und das Leben im Alltag und unserer Gesellschaft auf der anderen Seite. Die „Öffnung der Schule“ soll dem Schüler also helfen, die Schule als Abbild unserer Gesellschaft zu begreifen, diese sozusagen als eine Übungsform zum späteren Leben betrachten, in der nicht nur Wissen erlernt werden kann, sondern auch Sozialverhalten, Problemlösungsverhalten, Umgang mit Sexualität und Rollenverhalten zwischen Mann und Frau. Genau hier sehe ich auch eine Chance, die Schule interessant zu machen und die Schüler stärker in das System „Schule“ zu integrieren. Man sollte aber auch nicht unser bisheriges System verteufeln, auch dieses bietet einige Vorteile, jedoch werden Bereiche, die für die Entwicklung des Schülers sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht entscheidend sein können, nicht zeitgemäß verarbeitet. Als Beispiel sei hier das veränderte Sexualverhalten der Jugend und die rasende Entwicklung in der elektronischen Datenverarbeitung genannt: Erfahrungen mit Sexualität werden heute bedeutend früher gemacht als in vergangenen Zeiten. Eine Anpassung des Lehrplanes an diese zeitliche Verschiebung hat jedoch nicht stattgefunden. Dies kann zum Beispiel zur Folge haben, daß Themen, die die Kinder im Alltag bereits betreffen, in Schule und Gesellschaft vertagt oder gar tabuisiert werden, was wiederum zu einem gestörten Rollen- oder Sexualverhalten führen kann. Beim Beispiel der Computertechnologie gestaltet sich die Problematik etwas anders: In bereits 60 % aller Berufe wird mit Computern gearbeitet, die Schule sollte sich also auf irgendeine Weise mit diesem Thema auseinandersetzen. Nun geht die Entwicklung in diesem Bereich jedoch derart schnell, daß einerseits das Lehrpersonal total überfordert ist, da es an Seminaren, Richtlinien und Informationen fehlt und da wir uns mit einer Technik in der Schule befassen, deren Folgen, und damit auch deren Sinn oder Unsinn, noch kaum abzusehen sind.
Unter Öffnung der Schule verstehe ich also eine Öffnung in Richtung Gesellschaft, um Probleme, die sich ergeben, leichter bewältigen zu können und auch Chancen, die sich durch gesellschaftliche Veränderungen bieten, nutzen zu können.
Mit in den Themenbereich der Öffnung der Schulen fällt auch die aktuelle Diskussion um die Schulautonomie, die eng mit der Öffnung der Schulen zusammenhängt, oder anders gesagt: die Öffnung der Schulen impliziert ein mehr an Schulautonomie. Im folgenden Kapitel soll erläutert werden, was unter der Öffnung der Schule oder der Schulautonomie zu verstehen ist und worin sich die neuen Formen vom bisherigen Schulsystem unterscheiden.
Ich werde also in meinen folgenden Ausführungen die Begriffe „Öffnung der Schule“ und „Schulautonomie“ gewissermaßen als Synonym verwenden.
1.1. Über die Bedeutung des Begriffes Schulautonomie
Bevor wir uns mit dem Thema Schulautonomie befassen, sollte zunächst der Begriff und dessen Bedeutung näher erläutert werden.
„Autonomie“ als Rechtsbegriff ist die Befugnis einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, ihre Angelegenheiten durch Erlaß von Rechtsnormen selbst zu regeln. Nun sind Schulen aber keine juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sondern nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten. Das kennzeichnet ihre Rechtsstellung in allen Bundesländern.1
Dieser Begriff wird aufgrund seiner Definition oft mißverstanden. Man vermutet dahinter eine Art Selbstbestimmung der Schule über innere und äußere Angelegenheiten ohne staatliche Kontrolle. Dies widerspricht jedoch den Zielsetzungen der Autonomen Schule. Zeller, Mendler und Mayr halten in ihrem Text über die Schulautonomie den Begriff „Gestaltungsautonomie“2 für besser geeignet. Dieser Begriff macht auch die Forderungen der Autonomen Schule besser deutlich. Die Schule soll die Freiheit erhalten, sich in staatlich festgelegten Rahmenbedingungen frei zu bewegen, d.h. die Möglichkeit haben, diese Rahmenbedingungen autonom auszugestalten. Doch nun konkret gefragt: Welche Gestaltungsfreiheiten wünscht sich die Autonome Schule? Als Beispiele wären hier folgende aufzuführen:
- konkrete Ausgestaltung von Lehrplänen
- Gestaltung des Stundenplanes und der Jahresstundentafel
- Festlegung der Anzahl der Klassenverbände
- Zahl der Funktionsstellen
- Schulsozialarbeit
- Schülerzuweisung
- Auslandsfahrten und Schüleraustausch
- Zusammenlegung von Fächern zu Lernbereichen
- Kompetenzausweitung für gemischte Schulgremien
- Kompetenzverteilung und flachere Hierarchiestrukturen
- Aufhebung des „Schulleiters auf Lebenszeit“
- Einrichtung eines schulischen Findungsausschusses für die Schulleiterbesetzung
- Flexibilisierung der Unterrichtsorganisation
- Aufgabe des 45-Minuten Taktes der Schulstunde
- Öffnung der Schule nach außen, d.h. Zusammenarbeit mit Vereinen, Eltern...
3
All diese Forderungen sollen innerhalb der staatlichen Rahmenbedingungen liegen. Nun stellt sich natürlich die Frage, was dem Staat noch zu entscheiden bleibt, oder welches diese Rahmenbedingungen sein sollen? In diesem Fall bestünde die Aufgabe des Staates darin, die Grundstrukturen der Lehrpläne festzulegen, die Pflichtschulzeiten und die Abschlüsse zu bestimmen, sich um die Lehrergehälter zu kümmern und sich um die Chancengleichheit und die Qualitätssicherung an den einzelnen Schulen zu kümmern, und dies möglichst bundesweit.
1.2. Zur Diskussionssituation
Obwohl noch recht häufig über das Für und Wider der Schulautonomie diskutiert wird, kann man bereits feststellen, daß diese Fragestellung nicht mehr zeitgemäß ist. Die bildungspolitische Entwicklung, genauergesagt die Sparmaßnahmen, werden zwangsweise mehr Schulautonomie zur Folge haben.
Für uns stellt sich also vielmehr die Frage, wie wir mit mehr Schulautonomie umgehen und wie wir ein neues Konzept sowohl bildungspolitisch als auch pädagogisch sinnvoll in die Realität umsetzten. Es kommt hier vor allem darauf an, die Risiken zu erkennen, die Bedingungen und Freiräume festzulegen und die Chancen der Schulautonomie bestmöglichst zu nutzen.4
Auf die Risiken der Schulautonomie werde ich später noch näher eingehen.
1.3. Das Konzept der Autonomen Schule
Trotz der Schulautonomie soll der Staat weiterhin das Erziehungsmonopol behalten. Das muß aber nicht heißen, das der Staat selbst auch der Experte für die Ausführung und Kontrolle sein muß. Es geht hier um den direkten Einbezug von fachkompetenten Leuten in Diskussionen um Entscheidungen oder Neuerungen. Harm Paschen5 bringt hier als Beispiel den TÜV oder das Gesundheitsamt, welche zwar unter staatlicher Kontrolle stehen, die Ausführung aber von Experten übernommen wird. Für die Schule hieße das aber, daß alle Beteiligten, Lehrer, Eltern und auch die Schulverwaltung, Experten sein sollten.
Eine autonomere Gestaltung der Schule fordert also auch ein höheres Maß an Kompetenz von allen Beteiligten.
Wichtig für die Autonome Schule ist vor allem ein pädagogisch durchdachtes Konzept, d.h. die Motivation zur Durchsetzung der Autonomen Schule sollte nicht der Budgetrückgang sein. Dieses Konzept soll von der sogenannten Schulkonferenz erstellt werden, die sich aus Lehrern, Eltern, Schülern und je nach Bedarf auch aus anderen Personen, wie z. B. Kommunalpolitikern, Finanzexperten oder Sozialarbeitern, zusammensetzt. Die wesentliche Neuerung an einer solchen Schulkonferenz soll, natürlich innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen, die Beschlußfähigkeit sein. Bisherige ähnliche Konferenzen hatten nur eine beratende Funktion. Mit Hilfe einer solchen Konferenz kann jede Schule ihr eigenständiges Profil entwickeln, so wie es die lokalen Bedingungen von ihr verlangen. Dieses Konzept muß allerdings fest verankert sein, d.h. es sollte dokumentiert werden, um z.B. den Eltern und zukünftigen Schülern die Entscheidung zur Schulwahl zu erleichtern. Anhand dieses dokumentierten Konzeptes läßt sich das Schulprofil erkennen und deren Vorstellungen und Schwerpunkte besser beurteilen. Dies ist auch ein entscheidender Punkt zur Qualitätssicherung: Auch der Staat sollte die Möglichkeit haben, Leistungen einer autonomen Schule zu beurteilen und nachzuvollziehen. Wird dies so gehandhabt, verlieren auch viele Gegenargumente an Bedeutung: Trotz Autonomie besteht ein klar ersichtliches Konzept, welches beurteilt, mit anderen Schulen verglichen und auch korrigiert werden kann. Sinn und Zweck dieser Autonomie soll hauptsächlich sein, sich den lokalen Bedingungen, die an die Schule gestellt werden, anpassen zu können. Eine Großstadtschule ist nicht mit einer Landschule gleichzusetzen. Hier sind andere Schwerpunkte vor allem in der Pädagogik zu setzen. Diese Differenzen lassen sich bisher nur schwer ausgleichen, da sie oftmals Stundenplanänderungen oder auch Änderungen des Schulkonzeptes mit sich bringen. Ein Beispiel hierfür wäre die Schulsozialarbeit, die zeitlich eingeplant und auch finanziert werden muß.
1.4. Über die Finanzierung der Autonomen Schule
Man erhofft sich von der Autonomen Schule Einsparungen im Finanzetat, oder anders ausgedrückt: Schon lange existierende pädagogisch durchdachte Konzepte wie z.B. Einbezug der Eltern oder Leitung von Arbeitsgemeinschaften durch Schüler werden plötzlich befürwortet, da man hier eine Möglichkeit zur Einsparung sieht. Man möchte einer Schule in Zukunft nur noch einen fixen Betrag, der sich aus dem lokalen Bedarf errechnet und der nicht zu hoch ausfallen wird, zuweisen und sich somit auch aus der Verantwortung ziehen und die Schule sich selbst zu überlassen.
Diese Entwicklung ist schon aufgrund ihrer Motivation nicht gerade wünschenswert, muß aber auch nicht allzu negativ gesehen werden. Trotz der Einsparungen bietet sie neue Möglichkeiten, die sich so manche Schule schon länger gewünscht hat.
Eine Möglichkeit zur Einsparung soll durch die Vermietung der Räumlichkeiten der Schule erreicht werden: Die Zimmer sollen z.B. nach Schulschluß an Vereine oder private Schulen vermietet werden können, um der Schule so zusätzliches Kapital zu verschaffen. Dies erfordert allerdings auch wieder einen höheren Organisationsaufwand, der zusätzlich geleistet werden muß.
Außerdem soll sich die Schule teilweise durch private Träger finanzieren können. So kann sich z. B. eine ortsansässige Firma bereit erklären, die Schule mit einem gewissen Betrag zu unterstützen. Es ist allerdings wichtig, daß hieraus keine Forderungen entstehen. Die von den Gegnern der Schulautonomie als „Mac Donald´s Schule“ bezeichnete Einrichtung soll also nicht real werden. Private Träger haben zwar die Möglichkeit, die Schule zu unterstützen, sie sind jedoch nicht berechtigt, sich an Diskussionen über Lehrpläne, Schulstruktur und der Form des Unterrichts zu beteiligen. Hier muß ganz klar gesehen werden, daß die Schule eine staatliche Einrichtung mit genau festgelegten Rahmenbedingungen bleibt.
Weist der Staat jeder Schule einen fixen Betrag zur Finanzierung zu, so hat dies den Vorteil, daß Finanzen gezielter eingesetzt werden können als bisher. Betrachtet man die bisherige Situation, so achtet doch jeder darauf, seinen Etat bis zum Schuljahresende zu verbrauchen, um im nächsten keine Kürzungen zu erfahren. Ob diese Ausgaben unbedingt nötig sind, oder das Geld an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen wäre, ist hier kaum von Interesse.
Kann die Schule direkt über die Zuweisung von Finanzen entscheiden, können hier tatsächlich Einsparungen erfolgen, und wenn dies nicht möglich ist, das Kapital zumindestens optimal eingesetzt werden.6
Ein weiterer Punkt, der Einsparungen zuläßt, ist die komplette Umstrukturierung einer Schule. So besteht vor allem im ländlichen Bereich die Möglichkeit, eine kleinere Hauptschule und eine kleinere Realschule als Gesamtschule zu vereinigen. Hierdurch entsteht ein geringerer Aufwand an Räumlichkeiten und deren Ausrüstung und auch der Verwaltungsapparat läßt sich verringern. Dies bedeutet heutzutage auch eine Sicherung der Schule gegen sinkende oder schwankende Schülerzahlen. Gesamtschulen sind hier weniger empfindlich, da sie mehrere Schultypen in sich vereinigt. Egal ob die Schüler die Haupt- oder Realschule besuchen, sie bleiben auf jeden Fall auf der Gesamtschule. So kann eventuell die eine oder andere Schule von einer Schließung bewahrt werden.
Die Idee, Außenstehende wie z.B. Eltern in die Schule einzubeziehen, ist zwar durchaus geeignet, um Einsparungen vorzunehmen, meiner Meinung nach jedoch mit Vorsicht zu genießen. Ein Beitrag zum Unterricht von einem Experten ist durchaus sinnvoll und bringt auch Abwechslung für die Schüler, doch dabei sollte es auch bleiben. Schließlich besteht Unterricht nicht nur aus der reinen Wissensvermittlung, sondern es geht auch um die Sozialisation einer Klasse und um erzieherische Aufgaben. Ob diese Leistungen von Personen erbracht werden können, die hierfür nicht ausgebildet sind, bleibt zumindestens fragwürdig, und ist deshalb aus Gründen der Verantwortung gegenüber der Klasse gut zu prüfen.
All diese Möglichkeiten lassen sich natürlich nicht an jeder Schule umsetzen. Dazu sind die lokalen Gegebenheiten zu verschieden und deshalb ist es wichtig, daß der Staat einer Schule einen Mindeststandard garantiert, um finanzstarke Gemeinden nicht schulisch attraktiver zu machen und die Chancengleichheit an jeder Schule zu garantieren. Die Zuweisung des Etats muß also flexibel sein und muß genau auf die jeweiligen Gegebenheiten einer Schule abgestimmt sein.
Auch sollte die Schulautonomie nicht nur als eine Möglichkeit der Einsparung angesehen werden. Die Motivation, sich der Schulautonomie zu widmen, sollte in erster Linie eine pädagogische sein: Wir benötigen mehr Schulautonomie, weil die Situation an den Schulen und unsere Gesellschaftsstrukur es fordern und nicht nur, weil Bildung momentan einen geringen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion hat und deshalb die Mittel relativ knapp sind.
1.5. Die Bedingungen für die Schulautonomie
Ein wichtiger Punkt ist die Kompetenz. Schulautonomie heißt, das Verwaltungssystem zu dezentralisieren, wodurch an den Schulen ein höherer Verwaltungsaufwand erforderlich wird. Hierzu müssen auch kompetente Leute vorhanden sein, die sich z.B. mit der Finanzierung der Schule beschäftigen, denn dies soll ja Angelegenheit der Schule sein. Hier sind natürlich Fortbildungskurse zur Steigerung der Kompetenz erforderlich, oder solche Themen sollten sogleich im Pädagogikstudium berücksichtigt werden.
Gleichermaßen gestalten sich die Anforderungen an die pädagogische Kompetenz der Lehrer. Am Beispiel der Gesamtschule wird klar, daß Probleme wie die Leistungsdifferenzierung einen größeren Stellenwert einnehmen. Ob wir auf diesen sogenannten „ganzheitlichen Unterricht“ mit unserer derzeitigen Ausbildung zu genüge vorbereitet sind bleibt fraglich. Der Weg zur Schulautonomie kann folglich nur ein Prozeß sein, eine Umstellung von heute auf morgen wäre kaum sinnvoll, eher wäre eine Entwicklung von unten herauf sinnvoll: Die oben schon genannte Schulkonferenz soll Mißstände an Schulen erkennen und hierfür in Absprache mit dem Lehrerkollegium Lösungsvorschläge erarbeiten, die nach und nach erprobt und schließlich in den Schulalltag übernommen werden. Die Schulautonomie soll zur individuellen Verbesserung der Situation an jeder einzelnen Schule führen, was mit einer zentralen Steuerung nicht möglich wäre.
1.6. Gegenargumente zur Schulautonomie
Natürlich kann die Schulautonomie nicht sofort die Lösung aller Probleme mit sich bringen und auf den einen oder anderen Kritikpunkt muß in der Entwicklung sicherlich geachtet werden. Solche Kritikpunkte sind beispielsweise:
- Man befürchtet die Entwicklung von Eliteschulen vor allem in finanzstarken Regionen, die dann ihre Schulen besser ausstatten könnten. Deshalb ist die Garantie eines staatlich gesicherten Mindeststandards an den Schulen wichtig, um sämtliche Schulen attraktiv zu machen.
- Es stellt sich die Frage, ob unsere Gesellschaft und auch die Pädagogen, die an ein eher hierarchisches System gewohnt sind, überhaupt ausreichend autonomiefähig sind, um eine derartige Schule zu gestalten. Hier weise ich nochmals darauf hin, daß Autonomie nur als Prozeß verstanden werden kann, der die Weiterbildung und Erweiterung der Qualifikationen des Lehrpersonals einschließt, sich von unten heraus und über einen längeren Zeitraum hinweg entwickeln muß.
- Auch wird befürchtet, daß es zu einer Unübersichtlichkeit kommt, die Schulen in ihrer Struktur stark differieren und ein klares Konzept nicht mehr ersichtlich ist. Hierzu wäre zu sagen, daß das Ziel einer jeden Schule ein Abschluß sein muß, der von staatlicher Seite bestimmt wird und an allen Schulen in der gesamten Bundesrepublik der gleiche sein muß. Somit wäre eine allen Schulen gemeinsame Zielsetzung gewährleistet.
Der Weg zu diesem Ziel wird zwar an den einzelnen Schulen leicht variieren: die Ausbildung an einer Großstadtschule wird sich nicht in gleicher Weise vollziehen wie die Ausbildung an einer Gesamtschule. Wichtig ist hier jedoch, daß ein Konzept vorhanden ist, in dem Zielsetzungen und der Kurs dorthin festgelegt sind. Dieses Konzept sollte auch zugänglich sein, erstens als Entscheidungshilfe für Schüler und Eltern, zweitens als Hilfe für den Staat, die Schule auf ihre Qualitäten hin zu überprüfen.
- Da der Schule nur noch ein fixer Etat zugewiesen werden soll, den die Schule eigenverantwortlich verwaltet, wird befürchtet, daß bei auftretenden Finanzengpässen eine Abhängigkeit von Sponsoren entstehen könnte. Dies soll jedoch dadurch vermieden werden, daß Sponsoren trotz finanzieller Unterstützungen kein Mitspracherecht erhalten sollen, und daß der Staat den Etat so kalkuliert, daß bei mangelnden Sponsoren trotzdem ein Mindeststandart gewährleistet bleibt.
- Schulautonomie fordert mehr Engagement von uns Pädagogen. Sind überhaupt genügend Lehrer dazu bereit, ihr Konzept umzustoßen und sich auf neue Schulformen einzulassen, da dies auf jeden Fall einen Mehraufwand bedeuten wird ?
7
1.7. Die Rolle des Staates
Der Begriff Schulautonomie hört sich so an, als ob sich die Schule verselbstständigen wird und sich der staatlichen Kontrolle entziehen wird. Dies entspricht natürlich nicht den Vorstellungen der Schulautonomie. Der Staat soll weiterhin wichtige Funktionen übernehmen, um unserem Schulsystem einen einheitlichen Rahmen zu geben. Dazu gehören z.B. die Festlegung von Bildungsgängen, Abschlüssen und Pflichtschulzeiten. Diese Entscheidungen dürfen nicht der Schule überlassen bleiben, da es hier um einen einheitlichen Standard in der gesamten Bundesrepublik geht.
Zudem soll der Staat für die Qualitätssicherung und die Chancengleichheit verantwortlich sein. Hierzu gehört eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Schulkonzepten und eine Beurteilung derer. Somit besteht auch die Möglichkeit Korrekturen an vorhandenen Konzepten vorzunehmen und diese zu verbessern.
Auch soll der Staat, wie bisher, für die Festlegung der Gehälter verantwortlich sein. Beachtet man diese Punkte, so bewegt sich die Autonome Schule immer innerhalb staatlich festgesetzter Rahmenbedingungen und eine unkontrollierte Ausdifferenzierung verschiedener Schulkonzepte bleibt ausgeschlossen.
1.8. Der Weg zur Autonomen Schule
Wie oben schon erwähnt, kann der Weg zur Schulautonomie nur als Prozeß verstanden werden, der Zeit und vielerlei Überlegungen beansprucht. Zu Beginn dieses Prozesses sollte die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema
Schulautonomie stehen. Hier sollen die Schwachpunkte und Verbesserungsvorschläge einer Schule erörtert werden. Aus dieser Erörterung sollte ein Diskussionspapier entstehen, welches der späteren Schulkonferenz vorgestellt wird. Diese soll dann über Qualität und Durchführbarkeit entscheiden. Daraufhin kann man Schulversuche starten, um das neue Konzept zu erproben. Ist dies mit Erfolg geschehen, so steht der Durchführung der neuen Idee nichts mehr im Wege. Parallel dazu ist natürlich auch eine Novellierung des Schulgesetzes erforderlich, um den Schulen die rechtliche Freiheit zu solchen Neuerungen zu geben.8
Schlägt man diesen Weg ein und beachtet die oben erwähnten verschiedenen Aspekte, so bietet die Autonome Schule meiner Ansicht nach viele mögliche Ansätze, mit denen sich die Situation an unseren Schulen verbessern läßt, mit denen sich die Schule vor allem attraktiver für die Schüler gestalten läßt. Daß dies mit Anfangsschwierigkeiten und Mehraufwand verbunden sein wird, steht außer Frage, sollte jedoch keinen abschrecken.
Teil 2: 2. Die Notwendigkeit der Öffnung der Schule
Für viele stellt sich die Frage, wozu wir eine Öffnung der Schulen brauchen, oder warum unser Schulsystem nicht einfach wie bisher fortbestehen kann, wozu eine Flexibilisierung überhaupt notwendig ist. Unter Flexibilisierung könnte man folgendes verstehen: In Gegenden, in denen vorwiegend beide Elternteile berufstätig sind, würde sich eher eine Ganztagesschule anbieten, um die Schüler hier aufzufangen. Einer erlebnisarmen Umwelt, wie wir sie oft in Großstädten aufgrund mangelnder altersgerechter Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vorfinden, kann mit sogenannter Erlebnispädagogik entgegengewirkt werden. Wie man diese Erlebnispädagogik in die Praxis umsetzen kann, werde ich in Teil 3 am Beispiel der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue noch erläutern.
Auch berufliche Standortfaktoren sollten im Unterricht angemessen berücksichtigt werden können. Ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, daß ein hoher Prozentsatz der Schüler aufgrund regionaler Bedingungen den gleichen Berufszweig wählen wird, so kann dies in der Berufsvorbereitungsphase bereits berücksichtigt werden. Ein weiteres Beispiel wären die sogenannten „sozialen Brennpunkte“. In solchen Regionen empfiehlt es sich eventuell Sozialarbeiter in die Schule zu integrieren, um z.B. Ausländerfeindlichkeit, Drogenproblematiken oder einem hohen Gewaltpotential besser entgegenwirken zu können. Solche Entscheidungen können, da unser Schulsystem zentral gesteuert wird, bislang kaum vor Ort und vor allem schnell getroffen werden.9
Schüler sollen aber verantwortungsbewußt und zur Selbständigkeit erzogen werden. Diesen Anspruch stellt heutzutage auch die Industrie, die immer mehr auf Teamarbeit umstellt und längst die Vorteile flexibler und verantwortungsbewußter Arbeitskräfte erkannt hat. Dies läßt sich in einem streng hierarchischen System nur schwer verwirklichen. Es fehlt an Vorbildern, an denen die Schüler ein solches Verhalten erkennen können und die auch zur Nachahmung dessen auffordern. Wie soll eine Schule und auch ein Lehrer eigenverantwortliches Verhalten an Tag legen, wenn das System oder besser gesagt das Oberschulamt ihm sämtlichen erforderlichen Handlungsspielraum beschneidet?
Da Lehrer, Eltern und Schüler in der Autonomen Schule nun direkt an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, bieten Lehrer und Eltern eine bessere Vorbildfunktion und eigenverantwortliches Handeln kann bereits in der Schule geübt und erlernt werden. Die Schule kann mehr als funktionierendes System verstanden werden und diese Kenntnisse lassen sich später auch leicht auf den Beruf übertragen, sofern Schüler aktiv an der Schule beteiligt werden.
Im folgenden sollen nun einige Veränderungen in unserer Gesellschaft dargestellt werden, die die Notwendigkeit der Flexibilisierung unseres Schulsystems verdeutlichen sollen.
2.1. Die Familiensituation und der Beruf der Eltern
Man kann heutzutage von einem Zerfall der Familien sprechen, wenn wir von der Wandlung der Großfamilie zur Klein- oder Kleinstfamilie ausgehen. Kinder wachsen immer seltener im Rahmen der Großfamilie auf, zu der Eltern, Großeltern und auch Geschwister zählen. Die Großfamilie wird von der Klein- oder Kleinstfamilie abgelöst. Viele Kinder wachsen ohne Geschwister auf oder werden von einem alleinerziehenden Elternteil erzogen.
Aus dieser Situation können sich folgende Probleme ergeben:
2.1.1. Die Aufsichtssituation
Bedingt durch unser Schulsystem beschränkt sich die Aufsicht der Schule über die Kinder hauptsächlich auf den Vormittag, was bei einer Großfamilie auch kaum Probleme verursachte. Die Kinder kamen nach der Schule nach Hause, konnten sich mit ihren Geschwistern beschäftigen und auseinandersetzen und wurden von den Eltern oder, falls diese durch ihren Beruf verhindert waren, von den Großeltern bekocht und versorgt.
In der heutigen Kleinfamilie sind häufig beide Eltern berufstätig, entweder aufgrund hoher Lebenshaltungskosten oder auch aus persönlichen Gründen. Dies wirkt sich natürlich auf die Aufsichtssituation über die Kinder aus. Da sich die Schule im Ver- gleich zur Familie kaum gewandelt hat, kommen die Kinder immer noch mittags aus der Schule, sind dann aber häufig auf sich gestellt. Es fehlen Ansprechpartner, um in der Schule erlebtes zu erzählen, zu verarbeiten oder zu kompensieren.
Ich möchte hier nicht unbedingt behaupten, daß es die Aufgabe und Pflicht der Schule sei, die veränderte Familiensituation zu kompensieren, doch stellt sich mir die Frage, ob eine derartige Diskussion noch zeitgemäß ist. Es handelt sich hier nicht um die Planung der Zukunft, bei der eine solche Diskussion noch angebracht wäre, sondern um das Eingehen auf eine bereits vorhandene Situation, deren Aus- wirkungen sich im heutigen Schulalltag zeigen. Hier wären z.B. mangelhafte Ernährung, Konzentrationsstörungen, mangelnde motorische Fähigkeiten, nicht ausreichende Sinnesschulung, steigende Kriminalität und die Drogenproblematik, auf die im folgenden noch eingegangen werden soll.
2.2. Die Ernährung der Kinder
Die Fähigkeit zur Konzentration und auch die Leistungsbereitschaft ist unter anderem auch von der Ernährung abhängig. Die sich auf Pommes, Hamburger, Schokolade und Cola reduzierende Ernährung vieler Kinder bietet in dieser Hinsicht keine optimalen Vorraussetzungen. So meint Barbara Leykamm in einer Ernährungsinfo10, unsere durchschnittliche Ernährung sei mit „Zu viel, zu fett, zu süß“ gut beschrieben.
Es fehlt an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, die hauptsächlich in Obst und Gemüse vorkommen.Viele Schulen gehen deshalb schon dazu über, vor Unterrichtsbeginn ein gemeinsames Frühstück, welches den Bedürfnissen der Kinder entspricht, einzunehmen, denn mittlerweile gehen bereits 15% der deutschen Schüler ohne Frühstück aus dem Haus.11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„ Man sagt, das Frühstück sei das Sprungbrett in den Tag. Dies ist sicher ein richtiger Spruch, und gerade für Kinder ist die Einnahme eines vollwertigen Frühstücks nach der langen Nachtruhe besonders wichtig.
Etwa ein Drittel des gesamten Energiebedarfs soll mit dem ersten und zweiten Frühstück aufgenommen werden. Und nicht nur dies
- es soll in Ruhe eingenommen werden. Ein hübsch gedeckter Frühstückstisch und die Gesellschaft anderer Familienmitglieder wecken den Appetit.
- das Frühstück soll ausgesprochen vitamin-, mineralstoff- und eiweißreich sein.
- ein warmes Getränk macht zudem munter.
Haben Kinder nicht ausreichend gefrühstückt, so sind sie in der ersten Tageshälfte auch unzureichend mit Nährstoffen versorgt. Das wirkt sich aus: In der Schule z.B. können sie durch Hunger vom Unterricht abgelenkt werden. Haben sie einseitig gefrühstückt, so schlafen sie womöglich während des Unterrichts ein, oder sie können sich einfach nicht richtig konzentrieren.
Schulversuche in Holland jedenfalls haben ergeben, daßKinder, die vollwertig frühstücken, bessere Schulleistungen aufweisen als solche, die nicht oder nur einseitig frühstücken!... “ 12
Die oben dargestellte Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen der Einnahme der Mahlzeiten und der dementsprechenden Leistungsfähigkeit. Liegt nun eine fehlerhafte Ernährung vor, ändert sich diese Leistungskurve, die Leistungsfähigkeit sinkt ab. Betrachtet man nun die Bedeutung der Ernährung im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit der Schüler, so stellt sich mir die Frage, warum man diesem Thema im Schulalltag so wenig Stellenwert beimißt. So wäre es doch denkbar, das Frühstück in Schulen, in denen bekannterweise schon 15% aller Schüler ohne Frühstück in der Schule erscheinen, fest in den Tagesablauf einzubeziehen, wenn sich damit eine Zunahme der Leistungsfähigkeit erreichen läßt. Hierzu bedarf es jedoch der Möglichkeit einer flexiblen Planung des Tagesablaufes, die im derzeitigen Schulsystem kaum realisierbar ist. Im heutigen Schulsystem steht die Wissensvermittlung immer noch im Vordergrund, was grundsätzlich nicht falsch sein muß, wenn für andere wichtige Themen, wie z.B. der Ernährung, die ja gewissermaßen eine Grundlage für die Wissensvermittlung darstellt, genügend Raum vorhanden ist. Hier zeigen sich dann deutliche Mängel im derzeitigen Schulsystem.
2.3. Die zunehmende Mediatisierung
Der oben schon erwähnte Wandel der Großfamilie zur Kleinfamilie führt auch zu einer höheren Mediatisierung der Jugend. Kinder sind, da es an Geschwistern oder Spielgefährten mangelt, oft dazu gezwungen, ihre Freizeit selbst zu gestalten, was sich nicht immer als einfach erweist. So fehlt es vor allem in älteren großen Wohn-siedlungen, die den Bewohnern eigentlich nur als Schlafstätte dienen, oft an aus-reichenden Spielmöglichkeiten für Kinder. Der Weg zum Fernseher ist dann nicht weit, wenn nicht überhaupt die einzig bekannte Art der Freizeitgestaltung.
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, bestanden die Nachmittage zum großen Teil aus Fahrradfahren, Fußballspielen, spielen im Wald, oder sonstigen Aktivitäten. Es bestanden auf jeden Fall ausreichend Möglichkeiten der Sozialerfahrung, was sich, wenn z.B. in einer Großstadt kaum Spielmöglichkeiten bestehen, als schwierig erweist.
Nun beeiflußt häufiges Fernsehen aber die Entwicklung des Kindes. Beim Fernsehen werden hauptsächlich Auge und Ohr beansprucht und die anderen Sinne vernach-lässigt, was zu einer mangelnden Entwicklung der motorischen Fähigkeiten eines Kindes führen kann. So stellt man in Grundschulen immer häufiger fest, daß einige Schüler Probleme beim einfachen Rückwärtslaufen haben. Solche Kinder werden auch häufig zu Unfallopfern, da sie Schwierigkeiten haben, Distanzen und Geschwindigkeiten abzuschätzen. Um dem entgegenzuwirken, bieten einige Schulen „psychomotorisches Extraturnen“13 an, eine Sportveranstaltung, die spezielle Sinneserfahrungen nachliefern soll.
Bedenkt man, daß Kindern die Trennung zwischen der realen und der Fersehwelt schwerer fällt als uns Erwachsenen, so ist das Risiko eines Realitätsverlustes bei häufigem Fernsehen relativ hoch. Werden häufige soziale Kontakte, wie z.B. Spielen mit anderen Kindern, in einem Sportverein aktiv sein oder mit anderen Personen kommunizieren, durch Fernsehen ersetzt, besteht die Möglichkeit, daß die Kinder die Bildschirmwelt nicht mehr von der realen Welt unterscheiden können. Peter Struck bringt hier das Beispiel der Comic-Figuren „Tom und Jerry“. In diesen Zeichentrickfilmen werden Unfälle jeglicher Art schadlos überstanden, sei es der Sturtz von einem Hochhaus oder eine heftige Auseinandersetzung mit anderen Figuren.
Dies begünstigt eine Herabsetzung der Hemmschwelle gegenüber Gewalt und beein-flußt das Schuld- und Unrechtsbewußtsein. Können Kinder Erfahrungen wie z.B. Raufereinen nicht im Umgang mit anderen Kindern „erlernen“, es also an einem natürlichen Sozialisationsprozeß fehlt, so kann es bei Konfliktsituationen zu Fehl-einschätzungen kommen. Die Folgen von Verletzungen sind nur aus dem Fernsehen bekannt und dort führen sie zu keinen wesentlichen Schädigungen. Die Folgen einer Rauferei mit anderen können also schlecht abgesehen werden und es kann zu ernst-haften Verletzungen kommen.
Auch Computerspiele tragen hierzu ihren Teil bei, da sie nicht nur konsumiert werden, sondern aktiv gespielt wird.
In manchen Schulen spricht man sogar schon von einem „Montags-Syndrom“. Kinder, die am Wochenende bis zu 30 Stunden fernsehen, sind am Montag nicht mehr in der Lage, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, weshalb einige Schulen, vor allem in Großstädten, den Montagmorgen für Sport und Bewegungsspiele reservieren. Allerdings haben Versuche gezeigt, daß es in unserer Gesellschaft kaum möglich ist, sich des Mediums Fernsehen zu entziehen. Es hat sich so weit zu einem Bestandteil unseres täglichen Lebens entwickelt, daß sich auch ein beträchtlicher Teil gesellschaftlicher Kommunikation auf das Fernsehen bezieht. Man spricht über Spielfilme, Sportreportagen, Diskussionen, Nachrichten uns sonstiges. Besitzt man nun keinen Fernseher, so kann man an einem gewissen Teil der Kommunikation nicht mehr teilhaben und wird in eine Außenseiterposition gedrängt. Es kann also nicht Sinn und Zweck sein, das Fernsehen als Medium zu verteufeln, vielmehr sollte man versuchen, die Schüler an einen vernünftigen Umgang mit diesem Medium heranzuführen, seine Vorteile zu nutzen aber auch Alternativen zum Fernsehen aufzuzeigen. Obwohl sich die Auswirkungen des Fernsehens direkt auf unseren Schulalltag übertragen, so wird dieses Medium wenn überhaupt, dann doch nur am Rande behandelt. Da das Fernsehverhalten sicherlich im ländlichen Bereich oder in einer Großstadt stark differiert, sollte auch jede Schule die Möglichkeit haben, sich individuell je nach ihren Bedürfnissen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Habe ich wie oben erwähnt erhebliche Probleme beim Unterricht am Montagmorgen, die auf erhöhtem Fernsehkonsum beruhen, so wäre eine intensivere Beschäftigung mit diesem Thema wohl angebracht.
2.4. Die Drogenproblematik an Schulen
Es ist natürlich schwierig, die Ursachen des Drogenmißbrauchs eindeutig zu klären und auch noch in verallgemeinerter Form darzustellen, da die Drogenproblematik ein sehr individuelles Problem ist, d.h. die Ursachen bei mehreren Personen recht unterschiedlich sein können, mehrere Ursachen zusammenhängen oder Ursachen fließend ineinander übergehen können. Als häufige Faktoren, die zum Drogenmißbrauch führen, kann man jedoch die Bereiche Persönlichkeit, Gesellschaft, soziales Umfeld und die Droge selbst zählen. Diese Bereiche müssen im konkreten Fall natürlich weiter differenziert werden. Wichtig wären hier z.B. die Drogenart, die Art und Häufigkeit der Einnahme und die Verfügbarkeit.
Man kann davon ausgehen, daß menschliche Verhaltensweisen Lernprozeße darstellen, die durch die Umwelt beeinflußt werden. Das Konsumverhalten gegenüber Drogen kann also erlernt werden, und zwar wenn Drogenmißbrauch ein Mangel an negativen Verstärkern und ein Überschuß an positiven Verstärkern zur Folge hat, wenn Drogenmißbrauch also überwiegend von scheinbarem Erfolg begleitet wird.
Solche Einflüsse durch unsere Umwelt können sein:
- die derzeitigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- geringe gesellschaftliche Konfliktfähigkeit
- Mangel an Kommunikation
- übersteigertes Konsumverhalten
Können solche äußeren Einflüsse nicht verarbeitet werden, können Drogen leicht zu einer Ersatzhandlung werden. Drogen stellen oft die scheinbare Lösung für nicht verarbeitete Probleme dar, oder können auch eine Form des Protestes sein. Im folgenden einige mögliche Motivationen und Gründe für den Drogenkonsum:
- demonstrative Vorwegnahme des Erwachsenenalters
- bewußte Verletzung der elterlichen Kontrollvorstellung
- Ausdrucksmittel für sozialen Protest
- Mittel zur Suche nach grenzüberschreitenden Erfahrungen
- jugendtypischer Ausdruck des Mangels an Selbstkontrolle
- der Versuch, sich mit Hilfe von Drogen zu entspannen
- Zugangsmöglichkeit zu Freundesgruppen (peer-group-Verhalten)
- Symbol der Teilnahme an subkulturellen Lebensstilen
- Ohnmachtsreaktion gegenüber Konflikten im sozialen Nahraum
- Mittel zur Lösung von frustrierendem Leistungsversagen
- Notfallreaktion auf heftige psychische und soziale Entwicklungsstörungen
14
Viele dieser Motivationen und Gründe entwickeln sich gerade im Schulalter und könnten durch eine sinnvolle Prävention und auch durch eine intensivere Förderung von Sozialverhalten und sozialem Problemlösungsverhalten in der Schule verständlich gemacht oder gar gemildert werden. Dazu kommen schulspezifische Gründe wie z.B. elterlicher Leistungsdruck oder Notendruck überhaupt.
Schüler stellen untereinander Leistungsvergleiche an, wobei sich ergibt, daß Schüler, die ihre Leistungen als eher schwach beurteilen, verstärkt zu z.B. Zigaretten greifen.
Drogenkonsum getrennt nach Alter und Drogenart
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15
Notendruck und Drogenkonsum
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16
Meineserachtens machen diese Tatsachen deutlich, daß die Drogenproblematik an unseren Schulen durchaus ernstzunehmen ist und auch, daß ausreichende Maßnahmen, um diesem Symptom entgegenzuwirken, kaum vorhanden sind. Es gilt hier, schwächere Schüler besser zu integrieren, erbrachte Leistungen nicht nur auf ihre Mängel hin zu untersuchen und auch die Bewertungskriterien um Bereiche wie z.B. Sozialverhalten und Integration in den Klassenverband zu erweitern. Dies macht eine individuellere Beurteilung des einzelnen Schülers möglich und zeigt ihm nicht nur seine Schwächen, sondern auch Stärken, auch wenn diese weniger im Bereich der Fachwissenschaft liegen. Hierdurch ließe sich auch vermeiden, daß sich Schüler selbst als schwach beurteilen. Berücksichtigt man das Symptom der „self-fulfilling-prophecy“, läßt sich feststellen, daß solche Selbstbeurteilungen nicht folgenlos bleiben.
2.5. Kriminalität an Schulen
„ In Berlin sind im letzten halben Jahr die Gewalttaten an Schulen drastisch gestiegen, wie Oberschulrat Wilfried Seiring berichtete. Es vergehe kein Tag, an dem nichts geschehe. Allein von Mitte Februar bis Mitte März registrierte die Polizei an 29 Schulen insgesamt 95 Straftaten. Zu den Delikten gehören einfache und schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung, „ Jacken abziehen “ , Diebstahl von Walkman und Monatskarten für die U-Bahn. “ 17
Die Medien berichten in letzter Zeit immer häufiger von Straftaten, die an Schulen begangen werden, Lehrer beklagen sich über die steigende Kriminalität und auch Brutalität an unseren Schulen. Messer, Baseballschläger, Wurfsterne und Schlagringe stellen keine Seltenheit mehr dar.
Grundsätzlich kann man nun sagen, daß Delinquenz, also strafbares Verhalten, kein Problem ist, was nur bestimmte Schüler betrifft oder an ein bestimmtes soziales Umfeld gebunden ist. Bei der Delinquenz gibt es kein „entweder-oder“, sondern nur ein „mehr oder weniger“, was heißt, daß Ansätze delinquenten Verhaltens bei jedem von uns vorhanden sind. Inwieweit sich delinquentes Verhalten nun entwickelt ist nun eine Frage der Sozialisation. Bei Schülern findet nun ein großer Teil dieser Sozialisation im Elternhaus und auch in der Schule statt. Wir könnten die Schule also auch als eine „Sozialisationseinrichtung“ betrachten. Bedenkt man nun, daß delinquentes Verhalten keine Abnormalität darstellt, sondern jedem Schüler bis zu einem gewissen Grad zueigen ist, und wir in der Schule einen gewissen Teil zur Sozialisation beitragen, ist Kriminalität, vor allem die steigende, ein Thema dem wir uns nicht entziehen können. Hierzu die Meinung der Zeitschrift „Der Spiegel“:
„ Die Schulen sind erst recht nicht geeignet, die Opfer der vielen Gesellschaftsmiseren aufzurichten. Den Beladenen der jungen Generationöffnen sich morgens um acht keine beschützenden Häuser Statt daßder Unterricht im weitesten Sinne der Lebensbewältigung dient, schafft er Probleme. “ 18
Selbst die Öffentlichkeit scheint also von der Schule eine Anleitung der Schüler zu einer besseren Lebensbewältigung zu erwarten. Ob dies nun unbedingt die Aufgabe der Schule sein soll, darüber ließe sich diskutieren. Da aber gesellschaftliche Mängel bestehen, diese Aufgabe zu erfüllen, und die Auswirkungen direkt den Schulalltag und auch das Leistungsvermögen der Schüler beeinflussen, sind wir gezwungen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, allein schon, um den Auftrag der Schule ausführen und gewährleisten zu können.
Was sind nun diese im Spiegel genannten Gesellschaftsmiseren, die ein Ansteigen der Kriminalität verursachen? Viele Ursachen sind hier im Elternhaus zu suchen.
Laut H.J. Schneider sind hier vor allem zerrüttete Familien verantwortlich, die in dauerndem Streit leben und die Eltern sich nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern. Der Vater bietet oft kein ausreichendes Rollenmodell mehr, mit dem sich Kinder identifizieren können. Dies kann zu einem gespannten Verhältnis gegenüber der väterlichen Autorität führen. Diese Fehlerfahrung im Umgang mit Autorität kann sich natürlich auch auf die Schule und die Lehrerrolle übertragen und den Schüler in eine Außenseiterposition drängen, welche delinquentes Verhalten begünstigt.
Ein weiteres Problem ist in der Entwicklung von verschiedenen Gesellschaftstypen zu sehen. H.J. Schneider unterscheidet hier drei Typen: der ländlich- gemeinschaftliche Typ, der Sozialtyp der Austauschgesellschaft und die. Der erstgenannte Typ zeichnet sich durch ein starkes Gemeinschaftsgefühl, gegenseitige Abhängigkeit und einer Gruppenverantwortlichkeit aus und ist somit auch ein Gesellschaftstyp mit recht wenig Problemen. Delinquentes Verhalten kommt hier selten vor. Schon problematischer ist der Sozialtyp der Austauschgesellschaft. Seine Kennzeichen sind der Individualismus und der Wettbewerb. Es gilt hier, seine eigenen Interessen zu vertreten. Dem Mitmenschen gegenüber ist man eher gleichgültig, soziale Bindungen werden seltener, es entwickelt sich eine Anonymität, die oft Ursache für delinquentes Verhalten ist. Im Vergleich zum ländlich-gemeinschaftlichen Typ fehlt hier die „Kontrollinstanz“ der Familie, des Freundeskreises oder der Gemeinschaft, um delinquentes Verhalten negativ zu bestärken. Subkulturbildung ist in diesem Gesellschaftstyp recht häufig. Die nachindustrielle, nachkapitalistische städtisch- bürokratische Gesellschaft zeichnet sich durch riesige Organisationen und Bürokratien aus, die immer weniger durchschaubar sind. Dies führt, bei gleichzeitigem Mangel an Kommunikation, zu einer Hilflosigkeit und Vereinsamung der Menschen. Kinder haben kaum noch Möglichkeiten, ihre Kindheit auszuleben und flüchten sich ins frühzeitige Erwachsensein. Da es an Vorbildfunktionen für Problem- und Lebensbewältigung fehlt, werden diese Mängel häufig durch Drogen, Alkohol, Zigaretten und Kriminalität kompensiert, genau wie es von der Erwachsenenwelt vorgelebt wird.
So gab es 1990 in Baden Württemberg bei Erwachsenen z.B. 8134 Fälle von schwerer und gefährlicher Körperverletzung, Raub, räuberischer Erpressung, 410 Vergewaltigungen, 4663 Diebstähle aus Wohnraum, Keller, Neubau u.Ä19
Dazu kommt, daß Kinder in diesem Gesellschaftstyp in materiellem Überfluß aufwachsen. Dies führt zu einem Verlust an Motivation, für seine Bildung und berufliche Zukunft zu investieren, da eine Steigerung des Lebensstandards kaum noch möglich ist.
2.6. Die Situation unserer Hauptschulen
Hier kommen wir nun zu einem entscheidenden Punkt, der eine Öffnung der Schulen, eine Flexibilisierung und Neuerung unseres Schulsystems verdeutlicht. Betrachten wir zunächst die Entwicklung der Hauptschulen in den letzten Jahrzehnten. Allein der Begriff „Hauptschule“ verdeutlicht, daß es sich hier um eine Schule handelt, oder besser gesagt handelte, die die hauptsächliche Schule, also auch die meistbesuchte Schule unserer Gesellschaft darstellt. So war dies in den fünfziger Jahren auch noch der Fall: 70% aller Schüler, die die Grundschule verließen, gingen auf die Hauptschule. Ende der sechziger Jahre waren es dagegen nur noch 50%. Mit der Aufhebung der Aufnahmeprüfung für Realschule und Gymnasium 1968 ging es mit der Hauptschule weiter bergab. In machen Regionen, vor allem im ländlichen Bereich, konnten noch Werte um die 50% gehalten werden, doch im städtischen Bereich fielen die Zahlen oft auf Werte um die 20%, in manchen Ballungszentren sogar bis auf 10% ( Bsp. Berlin in den achtziger Jahren: 20% aller Grundschüler wechseln auf die Hauptschule). Diese Entwicklung hängt auch mit bildungspolitischen Ideen wie der „Erschließung von Begabungsreserven“ vor allem im ländlichen Raum zusammen und damit verbunden auch der steigenden Erwartungshaltung der Eltern an ihre Kinder. So ergab eine Untersuchung des Dortmunder Institutes für Schulentwicklungsforschung, daß nur noch 10% aller Eltern den Hauptschulabschluß für ihre Kinder erwarten. Die Folge hiervon: Viele unserer Hauptschulen klagen über mangelnde Schülerzahlen oder werden ganz geschlossen. In Nordrhein-Westfalen wurden 1970 allein 66 Hauptschulen geschlossen, im Saarland waren es von 1985 bis 1990 44 Schulen.
Wie kommt es nun, daß Eltern ihre Kinder nicht mehr auf die Hauptschule schicken und daß die Schülerzahlen derart abnehmen? Dazu sollte man sich kurz mit dem eigentlichen Konzept der Hauptschule befassen. Die Ausbildung an der Hauptschule soll mehr praktischen Charakter haben, die an Realschulen und Gymnasien dagegen mehr wissenschaftlichen. Man geht hier also an den verschiedenen Schulen auch von verschiedenen Begabungstypen aus: der praxisbezogene und der theoriebezogene Lerntyp, dem ein höherer Intellekt zugeschrieben wird und der in unserer Gesellschaft auch mehr Anerkennung findet. Es ist nun aber erwiesen, daß auch der Gymnasiast besser lernt, wenn direkter Praxisbezug vorhanden ist, also die Theorie mit der Praxis verknüpft wird. Diese Tatsache macht die Einteilung in verschiedene Begabungstypen fragwürdig. Zudem führt diese Einteilung zu einer Kategoriebildung und zur Bildung von „Klassen verschiedenen Intellekts“ je nach Schulartbesuch in unserer Gesellschaft. Die Hauptschule gilt oftmals als „Verliererschule“ oder „Billigschule“ und hat einen wesentlich geringeren gesellschaftlichen Stellenwert als Realschule und Gymnasium. Dies spiegelt sich auch in der Bezahlung der Lehrer wieder. Ein Hauptschullehrer hat ein höheres Stundendebutat und verdient weniger, da er scheinbar keine gleichwertige Arbeit verrichtet wie ein Realschul- oder Gymnasiallehrer. Hier wird auch wieder deutlich, daß in unserem Schulsystem das Augenmerk hauptsächlich auf der reinen Wissensvermittlung liegt. Leistungen im erzieherischen Bereich oder im Bereich des Sozialverhaltens haben kaum einen Stellenwert.
Ich möchte hier auch nochmals kurz auf die „self-fulfilling-prophecy“ eingehen.
Ein Satz über die Hauptschule lautet: „Niemand ist Hauptschüler, wenn er in die Hauptschule kommt, aber jeder ist Hauptschüler, wenn er die Hauptschule wieder verläßt.“
Es ist bekannt, daß das Lernverhalten von Schülern unter anderem auch von der Erwartungshaltung abhängt, die man an sie stellt. So wirkt schon die Aufteilung nach der Grundschule in Haupt- Realschüler und Gymnasiasten stigmatisierend.
Die Hauptschüler bilden den „Bodensatz“, sind diejenigen, die den Übergang in Realschule oder Gymnasium nicht geschafft haben. So wird die Hauptschule leider oft betrachtet.
Es kommt auch zu einer Trennung der sozialen Umfelder, die sich negativ auf die Leistungen der Schüler auswirken kann. Ließe man Haupt- und Realschüler in einer Klasse, würde der Anteil an problembelasteten Kindern im Verhältnis sinken und der Klassenverband hätte in Hinsicht auf Lern- und Sozialverhalten eine bessere Vorbildfunktion. Hauptschhüler hätten nicht länger den Eindruck zum „Bodensatz“ zu gehören, wären also nicht von vornherein als Hauptschüler stigmatisiert, was sich positiv auf Verhalten und Leistungen auswirkt. Modelle dieser Art werden z.B. in der Regionalen Schule in Rheinland-Pfalz erfolgreich praktiziert. Hier findet eine Differenzierung der Schüler erst mit der Abschlußprüfung statt: ein Hauptschüler ist erst dann Hauptschüler, wenn er die Regionale Schule nach der neunten Klasse mit dem Hauptschulabschluß verläßt. Für schwächere Schüler ist diese Schulform wesentlich motivierender.
Hieraus ergibt sich, daß Schüler eigentlich nur noch die Hauptschule besuchen, wenn vom Schüler oder den Eltern eine möglichst kurze Schullaufbahn erwünscht wird, wenn der Schulkarriere gegenüber eine gleichgültige Haltung besteht, oder eine andere Schulart nicht in erreichbarer Nähe liegt. Im letzten Fall stelle ich auch die Chancengleichheit vor allem für Schüler in ländlichen Regionen in Frage, die für den Besuch einer höheren Schule sehr lange Anfahrtszeiten in Kauf nehmen müssen, die eventuell von manchen Eltern nicht akzeptiert werden. Gerade das Beispiel der Regionalen Schule kann hier Abhilfe schaffen, aber darauf soll später noch ausführlicher eingegangen werden.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Dieter Wunder, bezeichnete die Hauptschule bereits als „auslaufendes Modell“. Daran wird langfristig auch kein 9+1 Modell etwas ändern, hier Bedarf es neuer Konzepte, die in anderen Bundesländern schon erfolgreich als Modellschulen praktiziert werden, denn welcher Elternteil schickt sein Kind schon gerne auf eine Schule, die als „auslaufendes Modell“ bezeichnet wird.
Zudem ist momentan die Bildungsversorgung gefährdet, da viele Hauptschulen von einer Schließung bedroht sind und auch Sparmaßnahmen von politischer Seite erfordern grundlegende Änderungen.20
2.7. Anmerkungen zu Integration, Selektion und Differenzierung in unserem Schulsystem.
Betrachtet man unser Schulsystem, so läßt sich schwerlich ein klares Konzept hinsichtlich der Integration, Selektion und Differenzierung erkennen. Aufgrund unserer Erkenntnisse in der Pädagogik besteht wohl kein Zweifel, daß es sich als sinnvoll erweist, Schüler, die in der Klasse eine Außenposition einnehmen, durch integrative Maßnahmen im Klassenverband zu halten, sie trotz irgendwelcher Eigenheiten, in die Klasse zu integrieren. So stellt man oft fest, daß sich eine starke Klasse positiv auf etwas schwächere Schüler auswirkt. Bei einem gut funktionierenden Klassenverband ziehen stärkere Schüler die schwächeren mit und wirken motivierend. Auch fällt es Kindern aus sozial schwachen oder problembelasteten Schichten leichter, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, wenn sie z.B. trotz Verhaltensauffälligkeiten weiterhin im Klassenverband bleiben dürfen. Meiner Ansicht nach ist der theoretische Hintergrund wohl kaum umstritten, doch wie gestaltet sich die Praxis?
Hier sehe ich einen deutlichen Unterschied zwischen innerer und äußerer Schulstruktur. Im inneren Rahmen, damit meine ich die Schule selbst und den einzelnen Lehrer mit seiner Klasse, wird natürlich versucht, Schülern durch integrative Maßnahmen ein Verbleiben im Klassenverband zu ermöglichen. Der äußere Rahmen, damit meine ich unsere gesamte Schulstruktur und die Seite des Schulgesetzes, funktioniert dagegen eher nach dem Prinzip der Selektion:
- Schon bei der Einschulung findet die erste Selektion statt: Welcher Schüler wird für Schulreif erklärt, welcher Schüler bleibt noch für ein weiteres Jahr im Kindergarten? Diesen Test halte ich, da die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule noch nicht ausgereift ist, für selektiv.
- Die nächste selektive Maßnahme findet dann beim Übergang in die verschiedenen Formen der Sekundarstufe I statt. Hier werden die Empfehlungen für die weiterführenden Schularten ausgesprochen. Bedenkt man, daß solche Empfehlungen oft eine gesamte Schulkarriere bestimmen und daß die Kinder am Ende der vierten Klasse immer noch vorpubertär sind, also ihre Entwicklung sich noch erheblich verändern kann, kann es sich hier wohl auch nur um Selektion handeln. Sogenannte Orientierungsstufen bieten hier gute Möglichkeiten Schülerleistungen zu erproben und zu fördern. Sie erleichtern damit die Entscheidung beim Übergang in weiterführende Bildungsgänge.
- In der Sekundarstufe wird dann durch verschiedene Fächerkombinationen ( z.B. im Bereich der Fremdsprachen an Hauptschulen ) und verschiedene Abschlüsse weiter selektiert. Es gibt dann zwar weiterführende Modelle wie das 9+1 Modell, doch halte ich dies für kein durchdachtes Konzept einer integrativen Form der Leistungsdifferenzierung. Bei diesem Modell bleibt die Hauptschule weiterhin normale Hauptschule und wer dann noch motiviert ist und die nötigen Fähigkeiten besitzt, der kann an seiner Schule noch die mittlere Reife machen. Dies mag zwar für den einzelnen Schüler eine gute Lösung darstellen, ändert aber an dem Profil einer Schule wenig und gerade diese Änderung im Profil ist bei den sinkenden Schülerzahlen an Hauptschulen und sonstigen Problemen doch wichtig. Hier wird das 9+1 Modell wohl keine langfristigen Besserungen bieten.
21
Dieser Widerspruch ist für die momentane Situation unseres Schulsystems bezeichnend. Einerseits die Pädagogik, in der integrative Konzepte von Bedeutung sind und andererseits ein eher selektives Schulsystem. Die Waldorfschulen wären hier ein gutes Beispiel für eine integrative Schule. Auch die Ausdifferenzierung über den Notendruck fällt hier weg. Natürlich muß die
Waldorfschule nicht die Idealform einer Schule darstellen, doch sind sie immerhin funktionierende Modellschulen für integrative Konzepte. Daher würden sie eventuell den ein oder anderen Ansatz bieten, diesen Widerspruch zwischen innerer und äußerer Schulstruktur aufzuheben.
2.8. Zusammenfassung
All die oben genannten Punkte könnten nun einen sehr negativen Eindruck von unserem Schulsystem vermitteln. Dies sollte nicht Sinn und Zweck dieses Teils sein. Es soll nicht heißen, daß unser dreigliedriges Schulsystem nicht funktionsfähig ist und deshalb sofort abzuschaffen wäre. Grundsätzlich wehre ich mich gegen allzu radikale Reformen, die oft nur ins Gegenteil umschlagen. Es geht hier nicht darum, irgendeine Ideologie oder ein bestimmtes Konzept durchzusetzen, sondern für jede einzelne Schule die Beste Konzeption auszuarbeiten. Dies ist meiner Meinung nach mit einem einzigen Konzept gar nicht möglich. Es geht darum, sich den Schwierigkeiten zu stellen, aber auch neue Chancen zu nutzen. Die oben genannten Fakten sollen nun darstellen, daß es beinahe unmöglich ist, auf so verschiedenartige Momente zu reagieren. Deshalb wäre es sinnvoll, ohne sich gleich wieder auf ein neues Konzept festzulegen, der Schule mehr Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit zuzugestehen, um auf die individuellen Bedürfnisse einer Schule eingehen zu können. Dies läßt sich unter zentraler Steuerung nur schwer verwirklichen.
Teil 3: 3. Vorstellung des Modells der Gesamtschule Saarbrücken- Bellevue
Im folgenden Kapitel soll der theoretische Ansatz der Öffnung der Schule und der Schulautonomie am Beispiel der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue konkretisiert werden. Es sollen Möglichkeiten aus diesem bereits bestehenden Projekt vorgestellt werden, welche sich direkt auf andere Schulen übertragen läßt, und dessen Auswirkungen auf die Projektschule auch dokumentiert wurde. Diese Schule beklagte ein sehr hohes Gewaltpotential und daher stark abnehmende Schülerzahlen. Deshalb dachte man hier über neue Möglichkeiten nach und fand diese auch, hauptsächlich im Bereich der Erlebnispädagogik. Die Informationen zu meinen folgenden Ausarbeitungen stammen hauptsächlich aus dem Verlaufsbericht22, der zu diesem Modell erstellt wurde.
3.1. Die Artistengruppe
Ein Projekt der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue ist die Artistengruppe. Die Teilnahme ist freiwillig und somit auch nicht an Notengebung und schulische Leistungskontrolle gebunden. Sie bietet den Schülern die Möglichkeit, sich außerhalb des unterrichtlichen Rahmens an der Schule zusammenzufinden und gemeinsam für ein Ziel zu arbeiten: Die Vorbereitung auf einen Auftritt in der Öffentlichkeit und somit die Perfektionierung der artistischen Fähigkeiten.
Die Artistengruppe besteht aus ca. 35 Schülern, 16 davon nehmen regelmäßig am Training und an Auftritten teil.
3.2. Die Finanzierung
Hierzu muß man sagen, daß für die Gründung eines solchen Projektes ein gewisses Grundkapital vorhanden sein muß, um Sportgerät und andere notwendige Dinge zu beschaffen. Im Falle der Gesamtschule Saarbrücken- Bellevue erklärten sich die ansässige Sparkasse und die VGS zur finanziellen Unterstützung bereit. Um anfängliche Kosten abzudecken, sponsorten sie insgesamt 24000.- DM. So konnten Einräder, Jonglierbälle, Stelzen, Zaubertricks und sonstiges Material beschafft werden. Dies ist bei der Gründung einer solchen Gruppe ein durchaus kritischer Punkt: Das Sponsoring muß sichergestellt werden und die anfängliche Organisation bedeutet einen Mehraufwand, der im Stundendebutat nicht vollständig berücksichtigt werden kann. Dies gilt hauptsächlich für den Anfang. Inzwischen ist es der Gruppe schon möglich, kleinere Anschaffungen durch die Einnahmen der Auftritte selbst zu finanzieren. Der Kostenaufwand sinkt also mit der Zeit, da die Gerätschaften auch über längere Zeit hinweg benutzt werden können.
Die zwei Lehrer, die momentan an dieser Gruppe beteiligt sind, erhalten für ihren zeitlichen Aufwand eine Debutatsermäßigung von jeweils drei bis vier Stunden. Da es sich hier um ein Pilotprojekt handelt, dessen Ergebnisse nach Abschluß über die GEW in ganz Deutschland veröffentlicht werden sollen, wurde diese Debutatsregelung auch vom Kultusministerium genehmigt.
Mit dem Lehrplan läßt sich dieses Projekt recht gut vereinbaren, da recht viele Veranstaltungen auf den Nachmittag fallen, sich also nicht mit dem normalen Schulbetrieb überschneiden. Zudem läuft das Projekt für die Schüler auch auf freiwilliger Basis.
Ansonsten versucht man bei der Finanzierung der anderen Gruppen und Veranstaltungen des Projekts, möglichst viele Geldquellen anzuzapfen. Der zur Zeit an der Schule tätige Schulsozialarbeiter wird z.B. vom Arbeitsamt mit Hilfe des ABM- Programms finanziert. Hier wechselt allerdings die Finanzierung nach den sich ergebenden Möglichkeiten. Entfällt diese Geldquelle, so wird auch versucht über Sozialamt oder Jugendhilfe zu finanzieren. Ein Polizist, der die Judogruppe leitet, auf die ich später noch kurz zu sprechen komme, erhält eine Aufwandsentschädigung von 25.- DM pro Stunde, die wiederum über das Sponsoring finanziert wird.
Andere Maßnahmen, wie z.B. Gruppengespräche mit Schülern, die eher in den Bereich der Schulsozialarbeit23 fallen, versucht man z.B. über das Jugendministerium oder Arbeitsministerium zu finanzieren, da diese Aktionen oft auch parallel mit kinder- oder familientherapeutischen Maßnahmen laufen und sich daher gut durch andere Einrichtungen finanzieren lassen. Hier hilft in diesem Fall auch die Gründung eines eingetragenen Vereins zur Förderung von Schülern, gerade wenn man versucht auch die Eltern in dieses Projekt einzubeziehen.
3.3. Die Ziele des Projektes
Da die Planung und Durchführung eines solchen Projektes einen Mehraufwand für die Beteiligten bedeutet, stellt sich natürlich die Frage nach den Zielsetzungen und damit der Rechtfertigung dieses Mehraufwandes.
Die Zielsetzungen dieser Gruppe betreffen mehrere Bereiche:
Die Schulung motorischer Fähigkeiten:
Schüler, die im normalen Schulsport durch motorisch eher geringere Fähigkeiten auffielen, deshalb auch durch andere gehänselt und vom Lehrer weniger gut beurteilt wurden, konnten sich in der Artistengruppe verbessern. Hier fehlt einerseits der Notendruck, andererseits bietet diese Gruppe ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Leistungsdifferenzierung. So könnte sich ein Schüler, der wenig Begabung für Leichtathletik zeigt, sich hier z.B. als guter Zauberkünstler darstellen. Ein Vorteil dieser Artistengruppe ist die Erweiterung des Angebotes über die Grundsportarten hinaus, also ein guter Beitrag zur Leistungsdifferenzierung und individuellen Förderung einzelner Schüler.
Soziale Gesichtspunkte:
Hier geht es hauptsächlich um Integrationsprozeße, sowohl Integration in der Gruppe, als auch Integration in das System Schule. Die Artistengruppe ist unabhängig von Klassenstufen, Nationalitäten und sozialen Schichten. Was zählt, sind die Begabungen in den jeweiligen Bereichen und die Unterstützung der Gruppe durch eigenes Engagement. So konnte man an der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue feststellen, daß Gewalttaten zwischen verschiedenen Altersgruppen deutlich reduziert wurden. Schüler aus den unterschiedlichsten Milieus haben hier die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen und somit mehr Verständnis füreinander aufzubringen.
Zudem steigt die Identifikation mit dem System Schule: Sie verliert ihren Ruf der reinen Wissensvermittlungsanstalt, und bietet dem Schüler zwanglose Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Durch die Leistungen, die hier erbracht werden, steigt das Selbstbewußtsein der Schüler, schwache Schüler bleiben trotzdem im System Schule integriert, da sie auch in anderen Bereichen ihre Fähigkeiten zeigen können.
Die Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe vermindert auch die Bereitschaft zu Gewalttaten. Sie hilft dem Schüler, seine Freizeit auf sinnvolle Weise zu gestalten. Dies zeigt sich auch darin, daß dieses Angebot gerne von
Schülern berufstätiger Eltern und sozial schwacher Familien in Anspruch genommen wird. Kommunikation und Beschäftigung, die zu Hause fehlt, findet hier statt. Somit kann die Artistengruppe auch als Ventil für Aggressionen oder auch Depressionen dienen: sie können im Training in Bewegung und Kreativität umgelenkt werden. Diese Faktoren, ein höheres Selbstbewußtsein durch positive Bestärkung von erbrachten Leistungen, die höherer Identifikation mit der Schule und die Möglichkeit zur Kompensation von Problemen, führen zu einer verminderten Gewaltbereitschaft. Dies wirkt sich direkt auf den normalen Tagesablauf in der Schule aus. Probleme, die Autorität des Lehrers zu akzeptieren, werden geringer. Dies begründet sich unter anderem darin, daß die Person des Lehrers nicht nur im Unterricht erlebt wird, sondern auch außerhalb und somit mehr persönliche Kontakte stattfinden. Durch den zwanglosen Umgang miteinander lernt man sich besser kennen und kann somit auch mehr Verständnis füreinander aufbringen. Zudem empfindet sich der Schüler hier mehr als gleichwertiger Partner. Mit einem guten Engagement kann der Schüler Leistungen für die Gruppe erbringen, die gleichwertig mit denen des Lehrers sind. Man lernt sich auf einer anderen Ebene kennen: Der Lehrer verliert die Position des Vermittlers, der durch sein Fachwissen meistens den Schülern überlegen ist. Gerade diese Erfahrung erleichtert es dem Lehrer, Schüler trotz des geringeren Alters und geringeren Wissenstandes als ernstzunehmenden Partner zu akzeptieren. Dies kann in unserem Beruf durch die ständige ( fachliche ) Überlegenheit im Unterricht zu einem Problem werden. Unbewußt kann sich die Vorstellung entwickeln, daß sämtliche Äußerungen seitens der Schüler von Personen kommen, die mir als Lehrer in gewisser Weise unterlegen sind. Dementsprechend weniger Bedeutung wird diesen Aussagen beigemessen. Solchen unbewußten Prozessen läßt sich entgegenwirken, wenn der Schüler auch in gleichwertiger oder mir überlegener Position erlebt wird.
In der Artistengruppe wird auch nicht der Anspruch gestellt, eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Zeit zu erbringen, wie sie der Lehrplan im Regelunterricht erwartet. Somit kann sich der Schüler frei entfalten, so arbeiten, wie er es für richtig hält, sein eigenes Arbeitstempo entwickeln. Diesen Prozeß halte ich für durchaus wichtig. Besonders in der Zeit nach der Schule ist man auf selbständiges Arbeiten angewiesen. Findet sich nun in der Schule eine Möglichkeit, bei der sich der Schüler ausprobieren kann, ist dies nur zu begrüßen. Im normalen Regelunterricht erweist es sich als schwieriger, auf die individuellen Arbeitsweisen der Schüler einzugehen, da ich als Lehrer bestimmte Zielsetzungen verfolge, die von möglichst allen Schülern in einem vorgesehenen zeitlichen Rahmen erbracht werden sollten. Ich möchte hiermit nicht ausdrücken, daß diese Methode nicht auch ihre Berechtigung hat. Es wäre wohl unrealistisch davon auszugehen, daß sich jegliches Arbeiten nach meinen Vorstellungen und meinem Rhythmus vollzieht. Insofern ist es auch wichtig, bestimmte Vorgaben in einem festgelegten Rahmen zu erfüllen. Faktoren wie die Reduzierung eines Themas auf die wichtigsten Elemente und sinnvolle Strukturierung gewinnen hier an Stellenwert und können im Regelunterricht erlernt werden. Doch wann hat der Schüler die Möglichkeit sich mit Aufgaben zu beschäftigen, bei denen solche Vorgaben fehlen? Es gibt zwar die Hausaufgaben, die selbständig erledigt werden sollen, doch auch diese sind meist recht klar vorstrukturiert. Arbeiten unter der Voraussetzung, eine bestimmte Idee verwirklichen zu wollen, erfordert die Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten. Hierbei muß ich zwangsweise meinen individuellen Arbeitsrhythmus und auch mein Tempo erkennen und ausnützen. So gibt es Typen, die am späten Abend produktiver Arbeiten, Typen die mehr Zeit benötigen, aber trotzdem gleiche Leistungen erbringen. Auf diese individuellen Unterschiede im Unterricht einzugehen erweist sich als schwierig. Hier bietet die Artistengruppe eine gute Hilfestellung. Ich möchte hier das Wort „Hilfestellung“ betonen, denn genau so sollte ein solches Projekt auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Sie bietet natürlich nicht die Lösung aller Probleme und kann auch keinen abgeschlossenen Lernprozeß in Hinsicht auf den Umgang mit eigenem Arbeitsrhythmus und Tempo liefern, jedoch bietet sie eine sinnvolle Hilfestellung, Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. So kann sich z.B. der Zauberkünstler sein Ziel selbst stecken, den zeitlichen Rahmen dafür selbst festlegen und auch erfahren, zu welchen Zeiten und mit welchen Methoden er dieses Ziel am sinnvollsten verfolgt.
Ein weiterer interessanter Punkt an diesem Projekt ist die Mitarbeit der Eltern. Dies erleichtert der Familie die Kommunikation über Schule, sie wird besser verstanden, Kinder werden in der Schule erlebt, beim Training oder bei Auftritten, im Umgang mit anderen Schülern, Beziehungen und Verhältnis zu Lehrern. Dies führt auch zu einer höheren Anerkennung der Kinder. Hierzu ein Zitat einer Mutter zu dem Auftritt ihres Sohnes: „ Wenn ich meinen Sohn sehe, wie er Kunststücke vorführt, dann kommen mir vor Freude die Tränen. Ich bin richtig stolz auf ihn. “
Solche Aussagen erhöhen das Selbstwertgefühl bei Kindern und tragen zu einem angenehmen Verhältnis in der Familie bei. Ein weiterer Punkt ist die intensivere Kommunikation der Eltern untereinander. Hier können Erfahrungen ausgetauscht, Kontakte geknüpft werden. Dies kann auch dazu beitragen, sich der Probleme schwacher oder auffälliger Schüler bewußt zu werden und solchen Phänomenen entgegenzuwirken. Gerade dieser Punkt stellt oft ein Problem in unserem Schulsystem dar. Selbst wenn in der Schule gute Arbeit an auffälligen Kindern geleistet wird, ist eine Verbesserung der Situation doch oft nur in Zusammenarbeit mit den Eltern oder familientherapeutischen Maßnahmen möglich. Beziehe ich nun Eltern mehr in das System Schule ein, wird der Zugang erleichtert, Gedankenaustausch der Eltern untereinander oder mit dem Lehrer finden häufiger statt und auch Mängel am System Schule können eventuell erkannt werden und bei genügend Schulautonomie verbessert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Kommunikation und auch eine gewisse Integration aller Beteiligten in das System Schule. Hier sehe ich ein eindeutiges Manko in der jetzigen Schulstruktur. Entscheidungen werden zentral getroffen, Mitspracherechte und eigene Verantwortung für diese Institution sowohl seitens der Schüler und Eltern als auch seitens der Lehrer und sonstiger Personen werden zu stark beschnitten, was sich auch negativ auf Motivation und Berufsmoral auswirkt. Je höher das Mitspracherecht und die Verantwortung sind, desto höher ist auch die Identifikation mit einem System.
Zur Situation der Lehrer:
Wie oben schon erwähnt sind solche Aktivitäten mit einem Mehraufwand für den Lehrer verbunden. Der normale Stundenplan reicht für derartige Vorhaben nicht ganz aus. Dies soll aber nicht bedeuten, daß z.B. diese Artistengruppe eine reine AG darstellt, wie wir sie aus unserem bisherigen Schulwesen schon kennen. Eine Unterrichtsform wie die Aritstengruppe ist auch fester Bestandteil des Stundenplanes und wird auch im Debutat des Lehrers berücksichtigt. Dies bedeutet, daß dem Lehrer in diesem Bereich auch Möglichkeiten zur Fortbildung geboten werden, die nicht nur über die Führung einer solchen Gruppe informieren, sondern auch die Ziele dieser, wie z.B. Förderung des Sozialverhaltens, Kompensation von Aggression oder Depression und Förderung einer besseren Konzentrationsfähigkeit, verdeutlichen sollen. Man wird als Lehrer also nicht in absolutes Neuland hineingestoßen, sondern man erhält die Möglichkeit, sich intensiv mit diesen neuen Methoden auseinanderzusetzen.
Doch wie läßt sich ein solcher Einbezug in den Stundenplan rechtfertigen? Bisher war doch auch kein Platz für derartige Arbeitsformen. Im Fall der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue waren die stark sinkenden Schülerzahlen und das steigende Gewaltpotential die Hauptmotivation, vom bisherigen Weg abzuweichen. Selbst ich mit meiner geringen Praxiserfahrung mußte mich bereits mit dem „Montagssyndrom“ auseinandersetzen. Grundschüler der zweiten Klasse kamen durch stundenlanges Fernsehen, mangelnde körperliche Auslastung oder auch durch Probleme in der Familie derart verstört in die Schule, daß ein Unterricht nach Plan kaum, oder nur auf wenig sinnvolle Weise, möglich war. Da der Lehrplan dieser Altersstufe noch relativ viel Freiheit läßt, ging ich bereits dazu über, diesen Montagvormittag verstärkt für Bewegungsspiele und motorische Übungen zu nutzen. Doch wie wirke ich dem in höheren Klassenstufen entgegen? Ich möchte hiermit sagen, daß ich aufgrund mir gegebener Situationen teilweise gezwungen bin, meinen Tagesablauf flexibler zu gestalten, mehr auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen, da ich ansonsten Lernfortschritte behindere, oder diese nicht mehr stattfinden. Hier liegt auch die Begründung solcher Arbeitsgruppen: Sie sind in manchen Fällen eine der wenigen Möglichkeiten, Schüler an konzentriertes Arbeiten heranzuführen und ihnen weitere Lernfortschritte zu ermöglichen. Positive Ergebnisse zeigten sich bereits im Falle der Gesamtschule Saarbrücken- Bellevue: Das Gewaltpotential sank und die Schüler zahlen steigen wieder.
Weitere Gruppen:
Da nicht die Interessen jeden Schülers sich gerade in der Artistengruppe wiederfinden, werden auch andere Gruppen angeboten. So gibt es eine Gruppe, die sich der Sportart Judo widmet, eine andere klettert regelmäßig, und schließlich gibt es noch eine Gruppe, die sich mit dem Erstellen von Videofilmen beschäftigt. Auf diese Weise können schon recht verschiedene Interessen abgedeckt werden. Ein großer Vorteil dieser Gruppen ist, daß sie über viele Jahre hinweg praktiziert werden können. Verlassen Schüler die Schule, so rückt einfach die nächste Jahrgangsstufe nach und erhält so die Gruppe am Leben. Investitionen lohnen sich daher auch, da eine gewisse Zukunftsperspektive gegeben ist.
Die Öffentlichkeit:
Ein Grund für die wieder steigenden Schülerzahlen ist bestimmt auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die verschiedenen Gruppen präsentieren sich mit Auftritten und sonstigen Darbietungen in der Öffentlichkeit. Somit wird auch das gesamte Schulkonzept präsentiert und in diesem Fall auch positiv von der Öffentlichkeit aufgenommen. So bezeichnete der Bildungsminister Prof. Dr. D. Breitenbach in einer Ansprache das Projekt als „innovativ und wegweisend“ für die Entwicklung schulischer Angebote an Jugendliche.
Diese Öffentlichkeitsarbeit hilft auch bei der Finanzierung. Sponsoren können sich durch Werbung präsentieren oder sind eher bereit sich zu engagieren, wenn Schule und deren Arbeit transparenter gestaltet werden. Im folgenden noch einige Pressestimmen zu diesem Projekt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
24
25
3.4. Zusammenfassung
Dieses Beispiel zeigt, daß es durchaus Mittel und Wege gibt, den Problemen an Hauptschulen entgegenzuwirken und daß sich die Öffnung der Schule hin zu Gemeinde, Eltern und Schülern nicht nur als sinnvoll erweist, sondern sogar mit Begeisterung aufgenommen wird. Die Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue bietet ein Beispiel dafür, daß eine Schule durchaus ihr eigenständiges Konzept entwickeln kann, ohne gleich außerhalb der staatlichen Rahmenbedingungen zu agieren, wie es von Kritikern so oft befürchtet wird. Auch hier wäre es sicherlich falsch gewesen, der Schule von staatlicher Seite ein neues Konzept aufzuoktruieren, solche Neuerungen bedürfen einer Entwicklung von unten heraus, das heißt die treibenden Kräfte sollten die an einer Schule Beteiligten sein: Lehrer, Schüler, Eltern usw..
Teil 4: 4. Die Öffnung der Schule im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit.
Für die Öffnung der Schulen stellt die Schulsozialarbeit ein wichtiges Element dar. Aufgrund ihrer Konzipierung ist gerade sie in der Lage, Brücken zwischen Schule und ihrer Umwelt zu schlagen. Sie stellt die Institution dar, die Kontakt zu Gemeinde, Sportvereinen, Eltern intensivieren kann, da die Schulsozialarbeit nicht an den Lehrplan und Unterricht gebunden ist.
Als ich mir zum ersten Mal Gedanken über dieses Thema machte, war meine Haltung diesbezüglich eher ablehnend. Wir als Lehrer haben doch nicht nur die Aufgabe, den Schülern Wissen zu vermitteln, sondern haben genauso erzieherische Aufgaben und sollten uns auch mit den Eigenheiten einzelner Schüler auseinandersetzen. Mir stellte sich die Frage, wozu wir dann überhaupt Schulsozialarbeiter brauchen, wenn die Aufgaben, die diese an der Schule vollbringen sollen, doch genauso auch in unserem Job verankert sind? Reduziert sich mein Job dann nicht immer mehr auf die reine Wissensvermittlung und den Rest, der meine Arbeit auch interessant macht, bleibt dem Sozialarbeiter überlassen? Diese Meinung scheinen einige Lehrer mit mir zu teilen. Hier ein Zitat eines Lehrers zu diesem Thema:
„ Diese Rollenteilung, die da stattfindet, d.h. daßauf der einen Seite der Lehrer ist, der den Anspruch Schule an die Schüler heranträgt, d.h. sie sollen lernen, wie das so allgemein von den Schülern aufgefaßt wird, und auf der anderen Seite die Sozialarbeiter, die genau das Gegenteil anbieten, etwas Attraktives, etwas, was Spaßmacht, was Spiel bedeutet. Dann ist das sehr schwer, wenn sich das auf diese reinen Pole bezieht, das inübereinstimmung zu bringen bzw. zu vermeiden, daßein Bruch dazwischen entsteht. Das ist der Nachteil, wenn sich das auf schulische Personen bezieht. “ 26
Dies scheint in der Praxis tatsächlich ein Problem darzustellen. Hierzu ein Schülerzitat :
„ Ich weißauch, warum die Lehrer so streng sind. Also wir haben mal mit Herrn Z. gesprochen, als mein Vater kam. Und der Lehrer hat gesagt, also wenn wir so wie die Sozialarbeiterinnen sind, dann lernt ihr nichts, die Lehrer müssen das sagen, wenn wir stören, weil sonst we rden wir nie ruhig werden. “ 27.
Aufgrund dieser Einschätzungen und auch Ängste gegenüber der Schulsozialarbeit werde ich im folgenden die Aufgaben der Schulsozialarbeit anhand mehrerer Modellschulen im Raum Kassel näher darstellen.
4.1. Die Ziele des Projektes zur Schulsozialarbeit
Die Zielsetzungen der Schulsozialarbeit bezogen sich hier auf verschiedene Bereiche:
- Die Schulsozialarbeit bot Hilfestellungen im Bereich der Curriculumentwicklung und -implementation. Dieses Curriculum hat ähnliche Aufgaben, wie der von mir in Teil 1.8. beschriebene Arbeitskreis zur Schulautonomie, nur daß er sich um speziellere und fachbezogene Aufgaben kümmert. So wurden neue Unterrichtsmaterialien für die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch entwickelt, die später die Qualität des Unterrichts verbessern helfen sollten. Zudem beschäftigte man sich mit dem Ausbau der Angebote in den Wahlbereichen und einer besseren Kooperation innerhalb der verschiedenen Schulen.
- Ein weiteres Gebiet waren zusätzliche Lern- und Sozialisationshilfen für Schüler. Hier ging es hauptsächlich um schulbegleitende Förderkurse, die Förderung von Sonderschülern und Schulsozialarbeit. Darunter wären z.B. die Einleitung familientherapeutischer Maßnahmen oder Gespräche mit Schülern zu verstehen.
- Zudem wurden mit Hilfe der Schulsozialarbeit integrierte Stadtteilbibliotheken und eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Hiermit konnte das Angebot an kindgerechter Literatur erweitert werden und für Fragen der schulischen oder beruflichen Zukunft wurde eine zusätzliche Anlaufstelle geschaffen.28
Das Regionale Verbundsystem Kassel ( RVK ), wie sich dieser Modellversuch nennt, beschreibt seine Zielsetzungen folgendermaßen:
„ Ziel des Versuchs ist es unter anderem, die bisher zufällig und lokal bestimmten Aktivitäten in einen geregelten, aufeinander bezogenen und miteinander verflochtenen Gesamtzusammenhang zuüberführen. “ 29
Dieser Satz beschreibt die Aktivitäten der Schulsozialarbeit recht treffend: Aktivitäten, die an einer Schule außerhalb des Unterrichts stattfinden, sollen unterstützt, strukturiert und in einen sinnvollen Gesamtkontext gestellt werden. Hier wird auch der unterschiedliche Aufgabenbereich zwischen Lehrer und Sozialarbeiter deutlich. Der Lehrer beschäftigt sich mehr mit Handlungen und Aktivitäten innerhalb des Unterrichts und des Lehrplanes, die Schulsozialarbeit kümmert sich mehr um einzelne Problemfälle und den Aufbau eines attraktiven Angebotes außerhalb des Unterrichts an der Schule. Hierbei sollen die Befugnisse der Lehrer nicht beschnitten werden, es geht mehr darum ein Gebiet abzudecken, für das niemand an der Schule sonst Zeit hat. Die Lehrer sind derart in Lehrplan und Schulalltag eingebunden, daß oft wenig Zeit für den Aufbau einer „Infrastruktur“ bleibt.
4.2. Das Verhältnis zwischen Schule und Schulsozialarbeit
In diesem Kapitel möchte ich auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen zwischen Lehrern und Sozialarbeitern eingehen. Die Schulsozialarbeit unterscheidet sich hauptsächlich in zwei Punkten30 von der Arbeit der Lehrer:
Erstens: Im Gegensatz zum Lehrer leistet der Sozialarbeit fast hauptsächlich Beziehungsarbeit. Es geht um soziale Gruppenarbeit und soziale Einzelhilfe. Diese Arbeit ( soziales Lernen ) muß ein Lehrer zwar auch leisten, jedoch meistens im Rahmen des Unterrichts. Die Schulsozialarbeit muß also keine Lerninhalte vermitteln, sondern leistet reine Arbeit an der Person oder Personen . Der Schulbetrieb ist darauf fixiert, täglich große Schülermengen zu bewältigen und diese in Lernprozeße einzubinden. Diese tägliche Zielsetzung fehlt der Sozialarbeit, ist in diesem Fall gar nicht möglich. Sie beschäftigt sich mit wechselnden sozialen Problemlagen und muß daher in Einzelarbeit oder kleinen Gruppen arbeiten.
Zweitens: Es gehört zur Aufgabe der Schulsozialarbeit, die Umwelt auf problemverursachende Strukturen hin zu untersuchen. Sie ist nicht nur dazu da, sich mit ihrem Klientel zu befassen, sondern sie sollte auch die Produktion von neuem Klientel verhindern, d.h. die Ursachen verschiedener Probleme erkennen und zu beheben versuchen. Schulsozialarbeit steht der Institution Schule also kritisch gegenüber. Die Organisation und Struktur der Schule wird daraufhin befragt, ob sie als Mitverursacher für Probleme in Frage kommt. Dies ist meiner Meinung nach zwar auch Aufgabe eines jeden Lehrers, doch geht es hier mehr um die grundsätzliche Auslegung des Berufes. Hier gehören solche Dinge, wenn überhaupt, nur in den Randbereich des Berufes Lehrer. Er ist vielmehr dazu da, feste Vorgaben bestmöglichst umzusetzen, nicht aber dazu, diese Vorgaben in Frage zu stellen. Dadurch begründet sich auch das Verhältnis zwischen Sozialarbeiter und Lehrer. Der Schulsozialarbeiter sollte aufgrund seiner Ausbildung in der Lage sein, Unterricht, und damit die Leistung des Lehrers, kritisch im Hinblick auf vorhandene Beziehungsstrukturen zu untersuchen. Hier liegt wahrscheinlich, ähnlich wie beim fächerübergreifenden Unterricht oder dem Team-Teaching, ein kritischer Punkt in der Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Sozialarbeiter. Aufgrund seiner Ausbildung ist der Lehrer kaum in der Lage, die Arbeit, zumindest was die Methodik angeht, zu beurteilen, andererseits sollte der Lehrer aber kritikfähig sein, d.h. mit Kritik über seinen Unterricht oder die Fähigkeit der Führung einer Klasse umgehen können. Ich halte dies für eine Art von Kritik, die durchaus zu einer erhöhten Produktivität führen kann, doch gehört hierzu seitens der Sozialarbeiter viel Fingerspitzengefühl und seitens der Lehrer ein gesundes Selbstbewußtsein und die Fähigkeit, professionell mit Kritik umzugehen. Aggression und Abwehr würden hier nur schaden. Dies ist für den Lehrer nicht immer einfach zu akzeptieren, da die Schulsozialarbeiter meist auch noch neu an eine Schule kommen und trotzdem das Recht zur Kritik haben. In diesem Fall ist es wichtig, sich die Ziele des gesamten Projekts vor Augen zu halten: Die Optimierung des Systems Schule, die Öffnung hin zur Gesellschaft und zum Umfeld der Schule, die Schaffung einer eigenen Infrastruktur in der Schule, auch außerhalb des Unterrichts. Von diesen Tatsachen können alle, auch die Lehrer, profitieren und sie werden hoffentlich auch dazu verhelfen, den Beruf des Lehrers angenehmer zu gestalten. Mit dieser Zukunftsperspektive sollte sich die Kritik leichter ertragen lassen, auch unter dem Aspekt, daß ich durch Kritikfähigkeit eine Steigerung meiner persönlichen Kompetenz als Lehrer erreichen kann. Daß diese konstruktive Verarbeitung der Konflikte nicht immer funktioniert, hängt vielleicht auch mit den unterschiedlichen institutionellen Machtverhältnissen zusammen. Meistens stehen nur sehr wenige Sozialarbeiter einem relativ großen Lehrerkollegium gegenüber und sind zusätzlich auch noch eine meist neue Einrichtung an der Schule. Dies macht es relativ schwer, Kritik zu akzeptieren. Hier liegt auch die Gefahr des Scheiterns der Sozialarbeit: Entwickelt sich das „emanzipatorische Selbstbewußtsein“ der Sozialarbeit in Richtung einer kämpferischen Konfrontation mit der Institution Schule, so ginge dadurch jegliche Kooperation zwischen Schule und Sozialarbeit und jegliche Produktivität verloren.
Auch die Schüler sollten in dieser Situation nicht außer Acht gelassen werden. Für die Schüler stellt die Schulsozialarbeit ebenfalls eine neue Institution an der Schule dar, deren Sinn und Zweck und auch die konkrete Arbeitsweise nicht ohne weiteres ersichtlich sind. Gerade hier kommt der Unterschied zwischen der Rolle des Lehrers und des Sozialarbeiters zum Tragen. Da der Lehrer mehr inhaltsbezogen arbeiten muß und der Sozialarbeiter eher beziehungsbezogen arbeitet, kann sich auch hier eine Art Konkurrenzkampf entwickeln: Schulsozialarbeit wird mehr mit Freizeitcharakter in Verbindung gebracht, der Unterricht mehr mit Arbeit, die erledigt werden muß. Dies kann sich auch auf die Rolle des Lehrers negativ auswirken. Ein weiteres Problem kann sein, daß sich Schüler der Sozialarbeit gegenüber zurückhaltend verhalten, da sie ja hauptsächlich mit „Problemfällen“ arbeitet und man als Schüler nicht als solcher stigmatisiert werden möchte. Hier kommt es auf eine gute Einführung und Vorstellung der Institution Sozialarbeit an der Schule an, die nur durch eine gute Kooperation von Lehrern und Sozialarbeitern erreicht werden kann.
4.3. Beschreibung des Projektes
Das Projekt wurde an drei verschiedenen Gesamtschulen durchgeführt: In Oberzwehren, Bettenhausen und Waldau. Alle drei Schulen befinden sich in städtischen Wohngebieten, die als problembelastet und benachteiligt angesehen werden können. Die Wohnviertel werden hauptsächlich von der Arbeiterbevölkerung besiedelt, der Ausländer- und Aussiedleranteil ist relativ hoch. Eltern aus den sogenannten „besseren Schichten“ versuchen ihre Kinder in anderen Schulen unterzubringen, wodurch sich negative Effekte an diesen drei Schulen noch verstärken, da eine Durchmischung der sozialen Umfelder kaum noch stattfindet. Die Schule wird häufig mit leistungsschwachen oder Schülern aus problembelasteten Familien konfrontiert. Dies ist auch ein Grund dafür, daß ausgerechnet diese Schulen für diesen Modellversuch ausgewählt wurden. Hilfestellungen schienen hier auch aus der Sicht der Lehrer dringend notwendig zu sein.31
Die Schulsozialarbeit steckte sich folgende Ziele32:
- Mitwirken an einer ganzheitlichen Erziehung, d.h. über die unterrichtliche Arbeit hinaus erzieherische Arbeit zu leisten.
- Förderung der individuellen als auch kooperativen Fähigkeiten.
- Unterstützung bei der Wahrnehmung und Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse.
- Hilfestellung bei einer verantwortungsvollen persönlichen und kollektiven Lebensplanung.
Diese Ziele sollten mit folgenden Methoden verfolgt werden33: Planung und Durchführung von Unterrichtsvorhaben, die Schwerpunkte im Bereich des sozialen Lernens aufweisen: Unterrichtsprojekte, Klassenfahrten. Hier hat der Lehrer die Möglichkeit, mit Hilfe einer zweiten kompetenten Person, seinen Unterricht auf die speziellen Anforderungen der Klasse abzustimmen.
Schaffung von außerunterrichtlichen Angeboten im Nachmittagsbereich, wie z.B. Klassentreffs oder themenzentrierte Gruppen. Ein ähnliches Projekt führt auch die Kuppelnauschule Ravensburg. Hier nennt sich das Nachmittagsangebot „freie Nachmittagsschule“. Sinn und Zweck dieser Einrichtung war es, die Schule auch als außerunterrichtlichen Treffpunkt für die Schüler attraktiv zu gestalten. Zu diesem Zweck wurde ein Cafeteria eingerichtet, in der die Schüler zusammensitzen können und auch die schuleigenen Sportanlagen werden nachmittags gerne z.B. zum Basketballspielen genutzt. Allein die Tatsache, daß die Schule einen Raum zur Verfügung stellt, der den Schülern als Treffpunkt dienen kann, bewerte ich als sehr positiv und läßt sich vor allem recht leicht in die Praxis umsetzen. Für die Gestaltung eines solchen Raumes bieten sich die Fächer Kunst und Technik sehr gut an. In meiner Zeit als Praktikant an dieser Schule nutzten wir diesen Raum desöfteren für ein gemeinsames Frühstück. Die Kuppelnauschule war nach meiner Erfahrung bisher die einzige Schule die ein solches Angebot zur Verfügung stellt, und es wurde gerne angenommen. An den meisten anderen Schulen beschränkte sich dieses Angebot auf einen alten Tisch und zwei Stühle, die irgendwo im Flur abgestellt wurden, und auch dementsprechend bereitwillig angenommen wurden. Dies vielleicht nur als kleiner Tip am Rande. Eine Situation, die jede Schule recht leicht und mit wenig Mitteln schaffen kann und die einen guten Beitrag zur Identifikation mit der Schule und auch Integration der Schüler leistet. Soweit ich mich an meine Schulzeit erinnere, wurde dieses Angebot von uns sehr gerne in Anspruch genommen. Es war damals sozusagen unser „Lehrerzimmer für Schüler“, in das man sich jeder Zeit zurückziehen konnte oder auch gemeinsam arbeiten konnte.
Gründung einer Arbeitsgruppe zwischen Lehrern und Sozialarbeitern zu schulbezogenen Themen ( Projektgruppe, Jahrgangskonferenzen) , ähnlich wieder wie die von mir in 1.8. vorgeschlagene Arbeitsgruppe zur Schulautonomie. Diese Gruppe dient zur Verständigung zwischen Lehrern und Schulsozialarbeit und auch zur Koordination geplanten Aktionen.
Als Leitgedanke dieses Projektes galten hauptsächlich zwei Dinge: die Ausgrenzung von Problemschülern zu verhindern und Außenseiter in den Klassenverband zu integrieren.
Die Aufgaben der Schulsozialarbeit erstreckt sich auf folgende Bereiche:
- offene Kinderarbeit ( Pausen- und Schülertreffs )
- Mitarbeit im Unterricht. Unter Mitarbeit versteht man hier nicht das gleiche wie beim Teamteaching, bei dem der Unterricht tatsächlich zu zweit gestaltet wird, sondern der Sozialarbeiter leistet vielmehr Hilfestellungen seinen Bereich betreffend. Er soll aktive Hilfestellung im Hinblick auf Motivationsförderung bei einzelnen Schülern leisten, Gruppenarbeiten begleiten und über die anzufertigenden Arbeiten reden, die Gruppenfähigkeit fördern, Schüler auffangen, die nicht im Klassenverband integriert sind und diese in die einbeziehen. Zudem sollte er Interaktionsschwierigkeiten ansprechen, das heißt er kann auch den Unterricht unterbrechen, um konkret über die Klassenstruktur und spezielle Verhaltensweisen zu reden. Auch kann er dem Lehrer helfen, den Unterricht handlungsorientierter zu gestalten, um Sachverhalte auf mehr spielerische Weise zu vermitteln.
- Angebote im Klassenverband ? Gruppenarbeit
- Betreuung einzelner Kinder
- Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrern
Das bedeutet, daß der Schulsozialarbeiter zwar innerhalb der Schule oder gar des Unterrichts tätig ist, jedoch seinen eigenen Handlungsspielraum benötigt, also sozusagen parallel zum Schulgeschehen arbeitet.
4.4. Nutzung und Bewertung der Schulsozialarbeit durch die Schüler
Zu diesem Zweck wurden die Schüler direkt befragt, inwieweit sie an den Nachmittagsangeboten der Schule teilnahmen und wie sich der Kontakt zu den Schulsozialarbeitern gestaltete. Kontakte zu den Sozialarbeitern heißt hier auch Teilnahme an den Vorbereitungen zu Klassenfesten, Einschulungsfesten oder Teilnahme an Theatergruppen, Pausengesprächen usw..
Die Ergebnisse wurden in der folgenden Tabelle34 zusammengefaßt.
Von den 112 befragten Schülern nahmen 51 ( 46 % ) an keiner der angebotenen Veranstaltungen teil, 61 Schüler ( 54 % ) nutzten die Schulsozialarbeit in irgendeiner Weise. Diese 54 % rechtfertigen meiner Meinung nach schon den Einsatz von Schulsozialarbeit. Zudem muß man sehen, daß die Sozialarbeit an einer Schule nur ein Prozeß sein kann, der sich im Laufe der Jahre entwickelt. Bei einer gut geleisteten Arbeit müßte die Teilnahme im Laufe der Zeit eher steigen. Doch dazu müssen angebotene Aktivitäten zuerst ausprobiert und bekannt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Geschlechterspezifische Unterschiede konnten bei der Gesamtteilnahme an den verschiedenen Angeboten nicht festgestellt werden.
Die häufigsten Gründe für die Nicht-Teilnahme waren Nachmittage, die bereits anderweitig belegt waren, die mangelnde Lust an der Teilnahme oder auch ein zu langer Schulweg, der den Nachmittagsbesuch erschwert.
Ein Ziel der Sozialarbeit sollte deshalb sein, ein möglichst breites Spektrum an Möglichkeiten anzubieten, um vor allem Schüler, die ansonsten wenig Interesse an schulischen Aktivitäten zeigen, in diesen Rahmen einzubeziehen.
Bei einer Diskussion mit den Schülern ergab sich ein recht positives Bild gegenüber der Sozialarbeit, da diese auch weniger leistungsbezogen ist, als der Unterricht und insofern auch mehr Spaß macht. Dagegen gehen die Meinungen der Schüler über die Beteiligung der Sozialarbeiter am Unterricht auseinander. Einige fühlen sich durch die Anwesenheit gestört. Es wird bemängelt, daß sich die Sozialarbeiter des öfteren Notizen machen und die Schüler den Sinn und Zweck dessen nicht erkennen können. Dies führt dazu, daß sich manche Schüler von ihnen beurteilt fühlen und das löst wiederum eine gewisse Nervosität aus, die die Prozesse eher negativ beeinflußt. Hier wäre eine intensive Aufklärung von Nöten, um den Schülern dieses Moment zu nehmen. Hierzu die Aussage eines Schülers :
35
„ Ich finde, die sollten wegbleiben, denn wenn sie in den Unterricht kommen, dann machen sie sich immer so viele Notizen, und wenn man sie fragt: Warum macht ihr euch Notizen, dann sagen sie: Das geht euchüberhaupt nichts an, das sagen wir euch nicht, und wenn wir das nicht wissen, wenn die Notizen machen, dann macht es einen nervös. “
Ich kann die Aussage des Schülers sehr gut verstehen. Mir stellte sich in der Schulzeit das gleiche Problem bei der Notengebung für Mitarbeit und Verhalten. Allein die Tatsache, daß der Lehrer irgendwelche Notizen über einen macht, die man nie zu Gesicht bekommt, löste bei mir ein gewisses Unbehagen aus.
Wahrscheinlich ist es die fehlende Transparenz, die einen stört. Man wird beurteilt, ohne daß man zu dem Ergebnis Stellung beziehen kann.
Abschließend zu diesem Punkt noch eine Tabelle über die Zukunftsperspektive der Schulsozialarbeit aus der Sicht der Schüler: Soll die Schulsozialarbeit weitergeführt werden oder nicht?36
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.5. Bewertung der Schulsozialarbeit durch die Lehrer
37 Ein wesentlicher positiver Aspekt der Beurteilung war, daß man als Lehrer neue Anregungen und Tips für die Praxis erhalten kann. Dies erleichtert doch die Arbeit und wirkt sich auch positiv auf die Kooperation zwischen Lehrer und Sozialarbeiter aus. Ein weiterer Punkt war die Steigerung der Motivation der Schüler durch die Sozialarbeiter und ihre aktive Teilnahme am Unterricht. Allein die Tatsache, daß sich zwei Pädagogen im Raum befinden, erleichtert die Durchführung anderer Unterrichtsformen und auch die Durchsetzung der Autorität fällt von vornherein leichter. Diese Erfahrung kann ich aus in meinem letzten Blockpraktikum und meiner einjährigen Arbeit an einer Behindertenschule nur bestätigen. Im Blockpraktikum hospitierte ich nur wenig, sondern beteiligte mich meistens aktiv am Unterricht, ähnlich wie beim Teamteaching. Dies empfand auch die Ausbildungslehrerin als wesentliche Erleichterung, da Schülerfragen bei Gruppen- oder Einzelarbeiten schneller beantwortet werden können und auch auffällige Schüler weniger Möglichkeiten haben, den Unterricht unbemerkt zu stören. In der Sonderschule stellt man einfach fest, daß zu zweit eine wesentlich intensivere Betreuung der Schüler möglich ist, welche sich gerade im Sonderschulbereich als sehr zeitaufwendig erweist.
„ Der Unterricht läuft sogar besser, wenn man z.B. mehr Ruhe l äß t oder Spiele macht, als wenn man immer auf dieses Leistungsverhalten drängt und das ist das Wesentliche, daßman sagt, ja, so möchte ich das im nächsten Jahr mal versuchen. z.B. einen Raum schaffen in der Klasse, der ein bißchen gemütlich ist. Das ist jetzt nicht direkt von den Schulsozialarbeitern, sondern so das Ganze, daßman versucht, Unterricht und Schule anders zu gestalten und zu organisieren. “ 38
Dieses Zitat paßt insofern gut in meine Ausarbeitung, als daß auch hier die Notwendigkeit zur Umgestaltung oder der Öffnung unseres Schulsystems erkannt wird. Zudem zeigt dieses Zitat, wie wichtig Fragen der Motivation für unseren Unterricht sind, und daß es andere Möglichkeiten gibt, als nur den reinen Inhalt des Lehrplans im Frontalunterricht zu vermitteln.
Durchaus positiv wird auch die Nachmittagsarbeit bewertet. Sie wird als sinnvoll und für die Schüler wichtig bezeichnet. Sie leistet einen guten Beitrag zu Entwicklungs- und Sozialisationsprozeßen der Kinder. Als problematisch erweist sich lediglich die Tatsache, daß die Kinder, die eine intensivere Betreuung nötig hätten, sich am schwersten in die Nachmittagsaktivitäten einbinden lassen. Dies sehe ich allerdings auch eher als einen Entwicklungsprozeß, der einfach seine Zeit braucht.
Teil 5: 5. Vorstellung der Gesamtschule als mögliche Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem.
Dieses Kapitel möchte ich mit einem fiktiven Dialog39 beginnen, da die öffentliche Meinung über die Gesamtschule hier einfach sehr treffend wiedergegeben wurde.
Mutter :Spätestens nächste Woche mußich Thomas bei der weiterführenden Schule anmelden. Und ich weißimmer noch nicht an welcher. Vater: Du weißt nicht an welcher? Das kapiere ich nicht. Es kommt doch nur das Gymnasium in Frage.
Mutter: Sicher wäre das Gymnasium das beste. Aber ich weißnicht, ob Thomas das schafft. Sein Klassenlehrer hat in das Gutachten „ vielleicht geeignet “ geschrieben.
Vater: „ Vielleicht geeignet! “ Das zeigt doch nur, daßder Lehrer selber nicht weiß, was los ist. Bismarck und andere große Leute sind ein- bis zweimal sitzengeblieben - und haben das Abitur trotzdem geschafft. Thomas mußdas Abitur einfach bestehen! Was soll denn sonst aus ihm werden? Man braucht doch heute schon das Abitur, wenn man Banklehrling werden will! Bald verlangen die es noch für den Straßenkehrer!!!
Mutter: Sicher, sicher. Aber wenn ’ s Thomas nicht schafft? Wenn er scheitert? Wenn er das Gymnasium nach der 10. Klasse verlassen muß? Sollten wir ihn da nicht gleich auf die Realschule schicken? Danach können wir ja immer noch weitersehen.
Vater: Nein, umgekehrt. Soll er es doch erst einmal auf dem Gymnasium versuchen! Auf die Realschule kann er auch noch später gehen. Warum denn gleich aufgeben? Du mußt nicht immer soängstlich sein.
Mutter: Weil man ja so viel hört von Schulstreßund Angst und Leistungsdruck... Und weil Karin von nebenan auf dem Gymnasium fast kaputtgegangen ist, nachdem sie einmal sitzengeblieben war, es dann immer noch nicht schaffte und die Schule verlassen mußte. Sie hat doch noch ein Jahr danach so getan, als ginge sie immer noch zum Gymnasium und heute ist sie ein Häuflein Elend. Vater: Karin ist ein Mädchen, aber aus Thomas soll ein ganzer Kerl werden! Mutter: Oder- Sag ’ mal, mir fällt da ein... Wir schicken Thomas auf die Gesamtschule - und dann brauchen wir unsüberhaupt nicht zu entscheiden. Vater: Wieso denn das?
Mutter: Weil die Gesamtschule nicht nach Schulen aufgeteilt ist. Da gibt es keine Realschule, kein Gymnasium und auch keine Hauptschule. Das ist alles eins. Da geht es noch ein paar Jahre wie in der Grundschule weiter. Vater: Und wann wird dannüber den Schulabschlußentschieden?
Mutter: Ganz spät. In der 9. oder 10. Klasse und sogar noch danach. Was hälst du von meiner Idee?
Vater: Hört sich gut an.- Geht aber nicht. Das weißich von einem Kollegen. Man kann doch nicht alle Schüler bis zum Ende gleichbehandeln. Das ist doch Gleichmacherei!
Mutter: Aber die Leute sagen doch auch, die Gesamtschule würde die
Schwachen besser fördern. Und es gäbe weniger Schulangst.
Vater: Unser Thomas ist kein Schwacher. Er gehört zu den Guten. Und die versauern auf der Gesamtschule.
Mutter: Aber die Leute sagen auch, das sei gar nicht wahr. Jeder wird nach seinen Möglichkeiten gefördert. Und alle haben gleiche Chancen. Vater: Das ist doch Quatsch. Das geht doch gar nicht. Das ist doch in dieser Welt gar nicht möglich, für alle das Beste und Chancengleichheit. Das ist doch Sozialisierung, nein ... sozialistische Ideologie und ganz gefährlich. Ich habe sowieso gehört, daßan den Gesamtschulen die roten Lehrer sitzen- und daßdas Abitur nicht gilt!
Mutter: Ja, was ist denn nun wahr?
In diesem Dialog wird deutlich, welches Bild von der Gesamtschule in der Öffentlichkeit besteht und wie wenig konkrete Informationen über diese Schulform vorhanden sind. Diese Tatsache beeinflußt natürlich die Schulwahl und damit die Schülerzahlen einer solchen Schule. Es wird verständlich, daß Eltern Entscheidungsschwierigkeiten haben und die Gesamtschule anzweifeln. Das Beispiel der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue zeigt allerdings, daß sich dieses Bild mit Hilfe von etwas „publicity“ und der nötigen Transparenz des Systems schnell in Wohlgefallen auflöst.
Ein weiterer Punkt in der öffentlichen Diskussion ist der, daß die Gesamtschule zwangsläufig viel mit Kritik über unser Schulsystem zu tun hat. Es ist also keine Entwicklung die parallel und im Einklang zum dreigliedrigen Schulsystem stattfindet, sondern diese Entwicklung ist mit Kritik und Konflikten verbunden, was sich für die Zielgruppe der Schule und die öffentliche Meinung eher negativ auswirkt. Es entsteht der Eindruck von Intoleranz gegenüber dem bestehenden System seitens der Begründer solcher Konzepte und, wie es in dem Dialog mit der Aussage über die „roten Lehrer“ deutlich wird, werden beinahe radikal- progressive Vorstellungen vermutet. Mangelnde Information und geringe bestehende Erfahrungswerte mit der Gesamtschule führen in der Öffentlichkeit zu einer eher distanzierten Haltung.
Wie kommt es nun, daß die Gesamtschule mit so viel Kritik in Verbindung steht? Entwickelt man ein neues Konzept, so wird zwangsläufig das bereits bestehende System auf seine Vorzüge und Nachteile hin untersucht. Es stellt sich die Frage, welche Elemente man übernimmt und in welchen Bereichen neue Ideen zum Zuge kommen sollen. Gerade diese neuen Ideen beruhen oft auf Mißständen, die man hier zu ändern versucht. Selbst wenn Neues durchdacht und auch pädagogisch begründet wird, so fehlt doch die Erfahrung aus der Praxis und es entwickeln sich in der öffentlichen Diskussion konträre Standpunkte gegenüber dem neuen Konzept. Es gibt Befürworter und Kritiker, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, was durchaus produktiv sein kann, wenn man von konstruktiver Kritik ausgeht. Hier liegt meiner Meinung nach ein Problem: Die objektive Betrachtung der Sache ansich verliert oft auf Kosten von innerparteilichen Ideologien und dem festen Willen diese durchzusetzen an Stellenwert. An Stelle des Versuches neue Konzepte mit professionellen Hilfsmitteln wie Statistiken und Expertenaussagen zu prüfen steht oft der Vorwurf der reinen „Ideologie“, um Vorschläge aus Gründen des persönlichen Standpunktes abzuwerten. Daraus entstehen diese Konflikte, die der Sache wenig zuträglich sind und Verwirrung in der Öffentlichkeit stiften. Um hier ein wenig entgegenzuwirken werde ich mich im folgenden um eine sinnvolle Darstellung des Sachverhaltes bemühen. Den Ausdruck „objektive Darstellung“ vermeide ich absichtlich, da auch ich meinen Standpunkt zu diesem Thema habe und eine absolut objektive Darstellung sich als schwierig erweisen würde.
5.1. Die Diskussion über die Chancengleichheit
Ein wichtiges Argument bei der Entstehung der Gesamtschule war die soziale Gerechtigkeit und auch die Verbesserung der Chancengleichheit in unserem Schulsystem. Erwiesenermaßen waren besonders Kinder aus sozial schwachen Schichten in unserem Bildungswesen benachteiligt. So wurde bei diesen Gruppen Mitte der sechziger Jahre ein Bildungsdefizit festgestellt und man folgerte daraus einen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsniveau. Eine statistische Erhebung40 belegt dies:
?Kinder von Beamten und Richtern machen in der Gruppe der 10 - 15 jährigen einen Anteil von 7.9 Prozent aus, sind aber im Gymnasium mit 16.6 Prozent vertreten.
Mehr als die Hälfte aller Schüler stammen aus Familien mit Vätern, die entweder gelernte oder ungelernte Arbeiter sind, oder zu den erwerbslosen zählen.
21.2 Prozent der Schüler in der Altersgruppe von 10-15 Jahre am Gymnasium entstammen aus Familien, in denen Väter ungelernt, gelernt oder nicht erwerbstätig sind.
Da diese Angaben schon etwas veraltet sind möchte ich nicht näher darauf eingehen. Es sollte nur das Mißverhältnis zwischen dem Anteil der Schüler aus Arbeiterfamilien an der Gesamtschülerzahl und dem entsprechenden Anteil der Schüler aus Arbeiterfamilien, die das Gymnasium besuchen, dargestellt werden. Da man nicht davon ausgehen kann, daß derartige Unterschiede auf intellektuellen Differenzen beruhen, liegt der Gedanke nahe, daß die Chancengleichheit in unserem Schulsystem nicht in jedem Fall gegeben ist. Die Gesamtschule hat nun den Vorteil, daß durch die Zusammenlegung der verschiedenen Schultypen zumindestens gleiche Startchancen gegeben sind und eine bessere Durchmischung der sozialen Schichten stattfindet. Allerdings stellt sich mir hier die Frage, ob diese Durchmischung überhaupt von allen Seiten gewünscht wird. Obwohl sie bei sinnvoller Führung zu mehr Verständnis und weniger Problemen im Schulalltag führt, stehen konservative Seiten dieser Durchmischung kritisch gegenüber. Die Frage ist, ob die Gesamtschule mit ihrem Konzept nicht im Widerspruch zu unserer gesellschaftlichen Situation steht? Auch in unserem gesellschaftlichen und privaten Leben findet eine Trennung nach sozialen Schichten statt, im Beruf trifft man auf hierarchische Strukturen und es wird klar unterteilt in Arbeiter, Vorarbeiter, Meister und Geschäftsleitung. Wie läßt sich hier die Gesamtschule begründen? Meine Meinung hierzu ist, daß unsere gesellschaftliche Struktur nicht unbedingt als perfektes Vorbild für die Schule genommen werden muß. Existieren solche Strukturen in unserer Gesellschaft, so muß das nicht heißen, daß diese wünschenswert sind oder einen optimalen Zustand darstellen. Zeigen nun Versuche mit der Gesamtschule, daß sich gemeinsam mit mehreren sozialen Schichten effektiv und auch problemlos arbeiten läßt, so reicht das meiner Meinung als Begründung aus. Bedenkt man, daß Veränderungen in unserer Gesellschaft Prozesse darstellen, die einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen, so kann die Generation, die diese Veränderung in der Schule erfährt, vielleicht später dazu beitragen, unsere gesellschaftlichen Strukturen zu lockern und das Verständnis und die Toleranz innerhalb verschiedener sozialer Schichten zu fördern. Auch die Industrie hat heutzutage begriffen, daß das hierarchische System im Betrieb nicht die einzige Möglichkeit der Leitung ist und verteilt die Verantwortung auf Teams, die, ähnlich wie in der Gesamtschule, gemeinsam arbeiten und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Hier begründet sich unter anderem auch der Anspruch der Industrie nach mehr integrativen als selektiven Maßnahmen in unserem Schulsystem, da bei Teamarbeit mehr Verantwortung auf die gesamten Arbeiter übertragen wird und daher eine höhere Qualifikation und die Fähigkeit in Teams zu arbeiten an Stellenwert gewinnen. Insofern sehe ich diesen Zwiespalt zwischen unsrer gesellschaftlichen Situation und einem abweichenden Schulkonzept nicht unbedingt als Problem oder anders gesagt nicht als ausreichende Begründung gegen die Gesamtschule.
Ein weiterer Kritikpunkt an der Chancengleichheit der Gesamtschule ist der enge Bezug zu unserem Wirtschaftssystem. Es wird behauptet, daß die Gesamtschule nur für gleiche Startchancen sorgt. Chance bedeutet hier, sich bei guten Leistungen möglichst hoch in unserem Wirtschaftssystem zu qualifizieren. So besteht zwar eine Gleichheit der Startchancen für Mitglieder aus sämtlichen sozialen Schichten, doch findet später wieder eine Klassifizierung statt: Eine Trennung nach Intellekt, in der sich begabtere Schüler höher qualifizieren als weniger begabte. Betrachtet man die Chancengleichheit unter dem Aspekt des vollständigen Abbaus von Vorrechten und Benachteiligungen und orientiert man sich nur an den Leistungen, die durch Zensuren gemessen werden können und unserem Wirtschaftssystems zuträglich sind, so wäre nach dieser Ansicht Chancengleichheit nicht gegeben. Diese Betrachtungsweise ist aber zu einseitig. Ähnlich wie die „geheimen Lernziele“, die wir aus unserem Unterricht kennen, verfolgt die Gesamtschule auch andere Ziele. Hier wären Persönlichkeitsentwicklung, Förderung von individuellen Talenten und soziale Integration von z.B. Behinderten oder verhaltensauffälligen Kindern zu nennen. Das Ziel der Gesamtschule ist also, die Lernpotentiale von Kollektiven41 nutzbar zu machen. Lernpotentiale müssen hier keine Leistungen sein, die sich anschließend an Zensuren messen lassen. Es geht hier mehr um die ganzheitliche Betrachtung des Menschen und die Förderung seiner individuellen Möglichkeiten. Gerade diese sogenannten „geheimen Lernziele“ sind entscheidende Faktoren, die es dem Schüler später ermöglichen, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Ich möchte hier nochmals auf Problematiken wie Kriminalität, Persönlichkeitsstörungen oder Drogenkonsum verweisen, die unsere Gesellschaft nicht unerheblich beeinflussen und denen man durch integrative Maßnahmen und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung auf sinnvolle Art und Weise entgegenwirken kann. Eine Betrachtungsweise, die nur die an Zensuren meßbare Leistungen sieht, kann also nicht Sinn der Sache sein. Chancengleichheit bedeutet nicht nur, die Chance auf einen möglichst hochwertigen Arbeitsplatz zu haben, sondern auch die Chance zu haben, seinen Platz in unserer Gesellschaft zu finden.
5.2. Die Begründung der Gesamtschule aus pädagogischer Sicht
Wie ich schon in Teil 1 anklingen ließ, wäre es wünschenswert, wenn sich Konzepte wie die Gesamtschule aus rein pädagogischen Gründen durchsetzen könnten, ohne von politischen Ideologien oder finanziellen Interessen beeinflußt zu werden. Bei der Gesamtschule stehen die Forderung nach Erneuerung von Unterricht und Erziehung42 im Vordergrund, oder das bestreben, Schule wieder zu aktualisieren, den Änderungen unserer Gesellschaft anzupassen. Diese Neuerungen sollen sich auf folgende Bereiche erstrecken:
- Eine wissenschaftliche Schule für alle: Das bedeutet, daß Wissenschaft für die Schüler verständlich gemacht werden soll. Sie sollen lernen, logisch zu denken und die Grundformen wissenschaftlichen Denkens einüben, um später auch auf das Berufsleben vorbereitet zu sein. Wichtig ist aber auch, die Wissenschaft kritisch zu durchleuchten, ihre Risiken darzustellen und ihre Grenzen aufzuzeigen.
- Individualisierung des Lernens: Der Schüler soll mehr Möglichkeiten erhalten, seine Ausbildung nach seinen Fähigkeiten zu gestalten. Ein wichtiger Punkt ist die flexiblere Zusammenstellung der Kurse, natürlich unter pädagogischer Betreuung.
- Intensivere Förderung des einzelnen Schülers: Dies soll durch eine durchdachte Leistungsdifferenzierung im Unterricht erreicht werden. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang auch die Verstärkung der Lernmotivation, die Vermittlung von Erfolgserlebnissen und Unterricht, der stärker handlungsbezogen sein soll.
- Soziale Erfahrungen in der Gesamtschule: Die Gesamtschule soll Möglichkeiten bieten, andere soziale Schichten kennenzulernen, sich mit den Unterschieden zu befassen und auch Konflikte, die unter verschiedenen Schichten auftreten können, im Rahmen der Schule und unter pädagogischer Betreuung auszutragen. Im Vergleich zum bisherigen dreigliedrigen Schulsystem sollen soziale Komponenten eine stärkere Rolle spielen.
5.3. Streaming und Setting- die kooperative und die integrierte Gesamtschule
Man unterscheidet hauptsächlich zwei verschiedene Gesamtschulformen: die kooperative und die integrierte Gesamtschule. Die kooperative Gesamtschule lehnt sich noch enger an unser dreigliedriges Schulsystem an. Eine Möglichkeit wäre z.B. nur die 5. und 6. Klasse, ähnlich wie in der Orientierungsstufe, gemeinsam zu unterrichten, und dann wie bisher in Haupt- Realschul- oder Gymnasialzweige zu trennen. Beispiel: Erweist sich ein Schüler nach der Orientierungsphase als weniger begabt, so kann er sich dem Hauptschulzweig anschließen, ist er begabt genug, kann er sich dem Gymnasialzweig anschließen. Diese kooperative Gesamtschule ähnelt dem amerikanischen Streaming-System. Alle Schüler müssen ein gewisses Grundniveau in ihren Fächern belegen und anschließend teilen sie sich in verschiedene Züge ( „streams“ ) auf. Diese Züge sind dann die Kurse, die entweder dem Haupt-, Realschul- oder Gymnasialniveau entsprechen. Die Durchlässigkeit innerhalb der verschiedenen Züge hängt stark vom Ausmaß der Kooperation unter den Zügen ab. Im schlechtesten Fall ähnelt eine solche Gesamtschule unserem dreigliedrigen Schulsystem, das heißt die Durchlässigkeit erweist sich als schwierig, im besten Fall ähnelt die kooperative Gesamtschule der integrierten. Zudem ist es nicht immer der Fall, daß an einer Schule alle möglichen Abschlüsse angeboten werden können. Bei der kooperativen Gesamtschule wird also eher fächerübergreifend differenziert, das heißt nach der Orientierungsphase legt man sich für eine bestimmte Richtung fest. Dieses Modell geht von der Theorie aus, daß ein begabter Schüler seine Begabung in allen Fächern gleichermaßen zeigt und ein weniger begabter Schüler durchweg geringere Leistungen zeigt. Diese Theorie läßt sich nach heutigen Erkenntnissen jedoch nicht mehr vertreten.
Die zweite Form der Gesamtschule ist die integrierte Gesamtschule. Hier wird von vornherein nicht im Klassenverband unterrichtet, sondern in einem Fachleistungskurssystem. Das heißt es findet eine Trennung nach verschiedenen Niveaus statt. Der Unterschied zum dreigliedrigen Schulsystem ist also der, daß nicht der gesamte Klassenverband alle Fächer gleichen Niveaus durchläuft, sondern daß sich der Schüler das Niveau seiner Fächer selbst wählen kann und sich dann in diesen Kursen eine Klasse zusammenfindet, ähnlich wie beim Studium an einer pädagogischen Hochschule. Das Problem an diesem System ist, daß ein Schüler seine Leistungsfähigkeit in einem Fach erst erkennen muß und sich diese auch im Laufe seiner Schullaufbahn ändern kann. Wichtig ist also eine Durchlässigkeit innerhalb der verschiedenen Kurse. Ist das Niveau zu hoch oder zu niedrig, sollte der Schüler problemlos in einen anderen Kurs wechseln können. Diese Durchlässigkeit wird nun folgendermaßen verwirklicht: Die Lehrpläne sollen in ihrer Grundstruktur an allen Kurstypen übereinstimmen. Die verschiedenen Niveaus sollen durch eine Vertiefung und Erweiterung dieser Grundstruktur erreicht werden. Es gibt also sozusagen ein Grundprogramm, welches in allen Kursen zeitgleich behandelt wird und die Differenzierung der Kurse findet durch Zusatzaufgaben oder diffizilere Aufgabenstellungen statt. Zudem werden die Stundenpläne an den drei Kurstypen gleich gestaltet, so daß z.B. das Fach Deutsch in jeder Schulart zur gleichen Uhrzeit stattfindet. Diese Struktur ermöglicht es dem Schüler seine Kurse je nach Begabung und Interesse auszuwählen. Bei diesem System halte ich eine intensive Beratung, die dem Schüler bei der Kurswahl hilft, für wichtig. Diese Form der Gesamtschule läßt sich mit dem amerikanischen Setting vergleichen, oder anders gesagt wird in diesem Fall fachspezifisch differenziert.
Die Unterscheidung zwischen kooperativer und integrierter Gesamtschule erweist sich nicht immer als eindeutig, da die Übergänge fließend sind. Eine gut organisierte kooperative Gesamtschule mit hoher Durchlässigkeit zwischen den Schultypen kommt der integrierten Gesamtschule sehr nahe, eine kooperative Gesamtschule mit geringer Durchlässigkeit und wenig Kooperation ähnelt unserem dreigliedrigen Schulsystem mit Orientierungsstufe. Für welchen Gesamtschultyp man sich entscheidet, hängt von den lokalen Anforderungen und Möglichkeiten ab. Ich möchte keinen der beiden Typen als besser oder schlechter klassifizieren, jedoch ist die integrierte Gesamtschule wohl das konsequenter gedachte Modell und wird heutzutage auch häufiger verwendet.
5.4. Die integrative Förderungder Schüler an der Gesamtschule
43 Hier kommt der Unterschied zu der Schülerpopulation an Regelschulen zum tragen: Die Population an einer Gesamtschule ist heterogen, das heißt die Schüler kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Man kann nun davon ausgehen, daß Schüler aus jeder Schicht, abgesehen natürlich von den individuellen Erfahrungen, die jeder macht, ihre schichtspezifischen Vorerfahrungen mitbringen. Kinder aus Arbeiterfamilien wachsen nicht mit den gleichen Einstellungen oder Erfahrungen auf wie Kinder aus z.B. Beamtenfamilien. Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß diese Aussagen wertungsfrei sind, daß es sich um verschiedene Polungen handelt, die alle ihre Vor- und Nachteile und damit auch ihre Berechtigung haben. Es hat sich erwiesen, daß Eltern aus Beamtenfamilien mehr Wert auf die Spracherziehung ihrer Kinder legen, da sie in ihrem Berufsleben auch mehr mit mündlicher und schriftlicher Kommunikation konfrontiert werden, und daß auch die Erwartungshaltung an die Kinder aufgrund der eigenen beruflichen Position höher ist. Dies rührt daher, daß der Beruf der Eltern Einstellungen, soziales Umfeld und Lebenserfahrungen beeinflußt, die sich wiederum auf die Erziehung der Kinder übertragen.
Wie wirkt sich nun diese heterogene Zusammensetzung der Schüler auf den Schulalltag in der Gesamtschule aus?
Gerade durch das fehlen gemeinsamer Vorerfahrungen spielen peer-groups an der Gesamtschule eine sehr große Rolle. Die Schüler streben nach einer Zugehörigkeit, nach einer Gruppe und Umgebung, mit der sie sich identifizieren können. Die peer-group ist in dieser Phase eine wichtige Instanz der schulischen Sozialisation und der eigenen Identitätsfindung. Aufgrund der Tatsache, daß Kinder aus gleichen sozialen Schichten auch ähnliche Vorerfahrungen aufweisen, finden sich diese Kinder auch meistens in denselben peer-groups wieder. Außerhalb des Unterrichts findet also eine Art schichtspezifische Trennung statt. Das dies bis zu einem gewissen Grad Stereotype sind und daß es auch hier fließende Übergänge und Ausnahmen gibt, ist selbstverständlich. Da es mir auf die Darstellung von grundsätzlichen Tendenzen geht, bitte ich dies zu entschuldigen.
Diese schichtspezifische Trennung, die außerhalb des Unterrichts stattfindet, soll nun im Unterricht kompensiert werden. Ziel der Gesamtschule ist ja die integrative Förderung der Klasse und damit eine gemeinsame edukative und soziale Organisation . Anders als in der peer-group wird im Unterricht die gesamte heterogene Klasse von den gleichen Lehrern betreut und sie haben die Möglichkeit in diesem Rahmen gemeinsame Erfahrungen zu machen. Diese gemeinsamen Erfahrungen tragen dazu bei, die schichtspezifischen Unterschiede zu relativieren und auch zu kompensieren. Sie verbinden die Klasse als ganzes, bieten Anlaß zur Kommunikation und fordern eine Auseinandersetzung mit anderen sozialen Schichten.
Ein Punkt, dem man in diesem Fall besondere Beachtung schenken sollte, ist, für Schüler, bei denen ein differenzierter Unterricht nicht ausreicht, einen Ausgleich zu schaffen, um sie weiterhin im Klassenverband integrieren zu können. Dies läßt sich durch geeignete Förderkurse oder, wie schon im Kapitel zur Schulsozialarbeit angesprochen, durch gezielte Gruppenarbeit erreichen. Bei auffälligen Schülern kämen hier auch wieder therapeutische Maßnahmen in Frage. Durch diese zusätzliche Einrichtung von Förderkursen und Gruppenarbeiten, die außerhalb des normalen Unterrichts stattfinden, soll ein gewisses Grundniveau in der Klasse gewährleistet werden. Intellektuelle Unterschiede, die dann noch auftreten, sollten durch einen differenzierten Unterricht aufgefangen werden können.
5.5. Die Lehrerkooperation an der Gesamtschule
Dieses Kapitel möchte ich mit dem Zitat eines Gesamtschullehrers beginnen:
„ Bei allen Fortschritten, die die laufenden Gesamtschulen gegenüber dem herkömmlichen Schulsystem gebracht haben, sind doch bestimmte Schwierigkeiten nicht zuübersehen. Insbesondere im Bereich des sozialen Lernens konnten die angestrebten Ziele noch nicht in befriedigender Weise verwirklicht werden. Dazu sind vor allem die folgenden Sachverhalte verantwortlich zu machen:
Trotz eines hohen Zeitaufwandes haben viele Lehrer das Gefühl, die dringendsten Aufgaben nur unzureichend erledigen zu können. Curriculare und didaktische Kooperation zwischen den Kollegen gibt es nur in Ansätzen. Besonders im Unterricht bleiben viele Lehrer in der Isolation; die Einzelkämpferpraxis des tradierten Schulsystems ist noch nicht weit genugüberwunden. Gegenseitige Hospitationen und kooperatives Lernen sind durch das Fachlehrerprinzip, durch organisatorische Vorgaben wie Stundenplan und Raumverteilung sowie durch administrative Festschreibungen der Stundentafel etc. in Umfang und Intensität eingeschränkt. Der Wechsel der Lehrer und damit der Lehrstile ( ... ) ruft bei Schülern Orientierungsschwierigkeiten hervor, was eine Ursache der häufig beklagten Disziplinschwierigkeiten sein dürfte... “ 44
Den letzten Satz dieses Zitates kann ich aus meiner eigenen Praxis bestätigen: Als Fachlehrer hat man nicht die Möglichkeit, sich so intensiv mit der Klasse auseinanderzusetzen wie z.B. der Klassenlehrer. In dieser Situation seine Autorität zu vertreten und Probleme in der Klasse zu kompensieren, ist relativ schwierig. Hierfür sind mehrere Gründe verantwortlich. Der erste wäre, daß zu einem guten Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden sein muß, die sich nur über einen längeren Zeitraum hinweg und durch positive Verstärkung entwickeln kann. Allein dies gestaltet sich im 45- Minuten Takt als schwierig. Die oben genannten Vorgaben und Festschreibungen engen besonders den Fachlehrer in seinen pädagogischen Möglichkeiten ein. Ein zweiter Punkt ist, daß ich von einem auffälligen Schüler wohl kaum erwarten kann, daß er sich aufgrund eines einzigen kurzen Gespräches oder einer Rüge grundlegend ändern wird, wenn die schon erwähnte Vertrauensbasis noch nicht existiert. Der Umgang mit solchen Schülern ist oft ein Prozeß, der viel Zeit und Geduld in Anspruch nimmt, die der Fachlehrer oft nicht hat. Dieses Zitat bekräftigt auch nochmals die in Teil 1 erwähnten Argumente für mehr Schulautonomie. Vielleicht entsteht deshalb auch bei den Lehrern der Eindruck, man würde seine Aufgaben nur unzureichend erledigen. Dies ist meiner Meinung nach ein sehr schwieriger Punkt, der auch stark von der Erwartungshaltung der Lehrer an die Gesamtschule abhängt. Sie stellt ein neues Konzept mit neuen Ideen und neuen pädagogischen Ansätzen dar und bietet somit auch viele Möglichkeiten. Doch bleibt auch die Gesamtschule nur eine Schule und gerade soziales Lernen wird auch stark vom Umfeld, dem Elternhaus oder den peer-groups außerhalb der Schule beeinflußt. Ich muß also als Lehrer auch die Grenzen meiner Möglichkeiten erkennen und vor allem im Bereich des sozialen Lernens viel Geduld mitbringen. Soziales Lernen ist nun mal keine Lehrplaneinheit, die sich in einem vorgesehenen Zeitraum abhandeln läßt.
Gerade in diesem Bereich und unter den formellen Einschränkungen, die sich auch mit mehr Schulautonomie nicht vollständig aufheben lassen, wird die Lehrerkooperation zu einem wichtigen Faktor. So kann z.B. der Fachlehrer im Gespräch mit anderen Lehrern wichtige Informationen über die Klasse, einzelne Schüler oder die Art des gewohnten Unterrichts erhalten. Dies, verbunden mit gelegentlichen gegenseitigen Hospitationen, kann schon zu einer Entspannung der Situation führen. Rolff45 führt noch folgende Argumente zur Lehrerkooperation an:
? Kooperation der Lehrer ist organisatorische Voraussetzung, um regelmäßig , auch fachübergreifende Kleingruppenarbeit der Schüler bestimmter Klassen oder Kerngruppen einführen oder ausbauen zu können.
Erst Kooperation der Lehrer ermöglicht eine intensive schülerbezogene Interaktion mit dem Ziel, sich unterschiedliche Erziehungs- und Unterrichtsstrategien bewußt zu machen und ein gemeinsames Rahmenkonzept zu entwickeln.
Kooperation erhöht durch gegenseitige Anregung und Kritik die Kompetenzen der Beteiligten im fachlichen und im pädagogisch-sozialen Bereich. Sie ist eine wichtige Form der Lehrerfortbildung.
Kooperation der Lehrer - realisiert in Lehrerkleingruppen - ist nicht zuletzt deswegen so wichtig, weil Lehrer, die die Vorteile und Schwierigkeiten der Gruppenarbeit selbst erfahren und die Techniken erlernt haben, eher in der Lage sind, Gruppenarbeit mit Schülern durchzuführen.
Gerade den letzten Punkt, das „learnig by doing“, halte ich für bedeutsam, da es hilft, die Theorie in einem fiktiven Unterricht, nämlich der Lehrerkleingruppe, zu erproben und somit direkt in die Praxis umzusetzen. In dieser Gruppe können und dürfen Fehler gemacht werden, die im Gespräch und mit konstruktiver Kritik anschließend verdeutlicht werden können.
Ein weiterer Punkt, der die Lehrerkooperation immer wichtiger macht, st der durch das Konzept der Gesamtschule und durch mehr Schulautonomie wachsende Bedarf an Kompetenz in Sachen Organisation und Verwaltung. Durchlässigkeit innerhalb der Kurse oder Schularten und eine höhere Selbstverwaltung müssen durchdacht und organisiert werden, was mit der im Zitat erwähnten „Einzelkämpferpraxis“ nicht mehr zu bewältigen ist.
Wie das Projekt der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue zeigt, wirkt sich auch die Öffnung der Schule hin zur Gesellschaft durchaus positiv aus, was zur Folge hat, daß sich die Kooperation der Lehrer nicht nur auf ein untereinander beschränkt, sondern daß auch mit Eltern, Gemeinde oder Vereinen kooperiert wird. Dies ist für den Lehrer nicht immer einfach, da die Lehrerbildung noch kaum Kompetenzen, die hier erforderlich wären, vermittelt und da diese Kooperation auch mit Ängsten verbunden ist. Gerade der Neuling in seinem Beruf zweifelt oft noch an sich oder ihm fehlen Erfahrungen in seinem Beruf, was sich negativ auf die Kritikfähigkeit auswirkt. Da Kritik von außerhalb nicht immer nur konstruktiv ist, kann dies zu Konflikten und zu einer ablehnenden Haltung gegenüber der Kooperation führen. Auch hier können sich Gespräche mit Kollegen als sehr hilfreich erweisen.
5.6. Die Entschulung des Lernprozesses
Unter Entschulung des Lernprozeßes verstehe ich die Erweiterung des unterrichtlichen Rahmens um weniger leistungsbezogene Komponenten der Schule. Solche Komponenten wären beispielsweise:
- Ausbau der Schülermitverwaltung.
- Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und Gesellschaft. ? Ausbau von Angeboten im kreativen Bereich.
- Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung
Doch diese Entschulung des Lernprozesses kann auch Probleme mit sich bringen. Betrachten wir z.B. die engere Kooperation mit Eltern und Gesellschaft. Bei einem Gespräch mit einem Elternteil aus dem Hamburger Raum ergab sich, daß sich aufgrund der Konzeption der dortigen Gesamtschule erhebliche Probleme ergaben. Dort trat nämlich der Fall ein, daß ein Gesamtschulkonzept, welches sicherlich auch pädagogisch begründet war, keinen Konsens in der Bevölkerung fand. Gehört nun eine enge Kooperation zu meinem Konzept und läßt sich dies wegen Meinungsverschiedenheiten nicht realisieren, so wird die Entschulung des Lernprozesses zumindestens in diesem Bereich in Frage gestellt. Die Folge dieser Meinungsverschiedenheit war, daß die Eltern ihre Kinder auf die bisherigen Schulen schickten und die Gesamtschule an Attraktivität verlor. Das Problem an der Kooperation mit der Gesellschaft ist, das ich sie wohl nirgends als homogenes Konstrukt vorfinde. Es existieren verschiedene persönliche und politische Ansichten, die nicht immer leicht zu vereinbaren sind. Im weiteren Verlauf des Gespräches stellte sich heraus, daß bei der Einführung der Gesamtschule wohl eine Projektphase wie bei der Schule in Saarbrücken-Bellevue fehlte oder nicht genug publik gemacht wurde. Da man scheinbar bei der Einführung der Gesamtschule noch auf die Kooperation verzichtete, fühlten sich viele Eltern übergangen und lehnten das Konzept ab. Dies bestimmt auch wegen mangelnder Transparenz oder Information. Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die Wichtigkeit eines runden Tisches oder einer Schulkonferenz verweisen, in der alle Beteiligten schon in der Planung einbezogen werden. Auf diesem Weg hätten sich im Fall der Hamburger Eltern bestimmt einige Unklarheiten aus dem Weg räumen lassen. Zu diesem Beispiel muß ich allerdings sagen, daß die Einschulung der Kinder meines Gesprächspartners schon einige Zeit zurücklag und die Aussage heute nicht mehr repräsentativ sein muß. Wichtig war mir nur darzustellen, daß sich die Öffnung hin zur Gesellschaft in der Praxis als problematisch erweisen kann.
Zur Entschulung des Lernens meint der Deutsche Bildungsrat46, daß dies nur in Verbindung mit der Einrichtung von Ganztagesschulen möglich sei. Dies ergibt sich daraus, daß der Unterricht, der der Erfüllung des Lehrplans nachkommt, beinahe den gesamten Vormittag in Anspruch nimmt. Eine Schule mit Halbtagscharakter bietet demnach nur eingeschränkte Möglichkeiten für soziale Lernprozeße und kompensatorische Arbeiten. In der Ganztagesschule sollen vor allem diese Grenzen des herkömmlichen Unterrichts überwunden werden. Betrachtet man die steigende Anzahl von berufstätigen Eltern47, so findet eine Ganztageseinrichtung auch hier ihre Rechtfertigung. Die Aufgabe der Ganztagesschule, vor allem des Nachmittagsangebotes, soll also vor allem im außerunterrichtlichen Bereich liegen. Die Gestaltung der Freizeit und die Kompensation von negativen Erfahrungen, die sich auch im Unterricht anstauen können, stehen hier im Vordergrund. Seine Bestätigung findet das Argument für eine Ganztageseinrichtung z.B. bei der Organisation der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue, bei der sich bei der Verwirklichung des Konzeptes auch ein Angebot ergab, welches sich über den ganzen Tag erstreckt. Die Göttinger Gesamtschule „Lichtenberg“48 bietet ihren Schülern folgende Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung:
- Sport Club - Bastel Club
- Handball Club - Experimentier-Club
- Schach Club - Arbeitslehre/Technik Club
- Hockey Club - Film Club
- Tischtennis Club - Koch Club
- Kanu Club - Handarbeits-Club
- Schwimm-Club - Bläser Gruppe
- Gitarren Club - Elektrobastel- Club
- Französisch- Club - Medien- Club
- Astronomie-Club - Mal- Club
- Buch-Club - Töpfer- Club
- Beat- Club - Batik Club
- Discothek- Club - Orchester- Club
- Theater Club - Chor
- Photo Club - Amateurfunk Club
Einige unter diesen Aktivitäten, wie z.B. der Tischtennis Club oder der Schach Club sind kaum personalintensiv, können also zum großen Teil von den Schülern selbst gestaltet werden. Andere Aktivitäten müssen von Lehrern, Sozialarbeitern, oder auch Eltern betreut werden. Die Einrichtung solcher Aktivitäten gestaltet sich oft recht schwierig, da unsere Schule vor allem auf Leistungsoptimierung und Leistungsselektion49 ausgerichtet ist. Freizeit hat die Funktion der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und fand deshalb bisher wenig Beachtung im Schulalltag. Die „Gunst der Zeit“, nämlich die Berufssituation der Eltern, mangelndes Freizeitangebot außerhalb der Schule und steigende Probleme im Umgang mit Schülern, lassen dieser Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit einen höheren Stellenwert zukommen. Ein gutes Beispiel ist das Montagssyndrom: Bevor ein sinnvoller Unterricht beginnen kann, muß erst die Leistungsfähigkeit der Schüler wiederhergestellt werden. Zu diesem Zweck eignet sich das entsprechende außerunterrichtliche Freizeitangebot sehr gut. Es trägt zu einem produktiveren Unterricht bei und findet somit auch seine Rechtfertigung.
5.7. Über Veränderungen durch die Gesamtschule und deren Leistungen
An dieser Stelle soll nochmals hervorgehoben werden, was die Gesamtschule als Konzept mit all ihren Vorüberlegungen und Auswirkungen erreicht hat. Rolff50 stellt hierzu folgende Thesen auf:
These1: Die Gesamtschule hat den Erziehungsbegriff durch das Konzept sozialen Lernens erneuert und verstärkte Aufmerksamkeit auf Erziehungsprobleme gelenkt. Sie ist die erste Bewegung, die versucht, gesellschaftliche Wandlungen in der Schule zu berücksichtigen und zu kompensieren.
These2: Die Gesamtschule hat sich radikal mit dem Menschenbild überkommener Bildungstheorien auseinandergesetzt und dabei eine Persönlichkeitstheorie entwickelt, die den Schüler als Individuum sieht, das sich im sozialen Zusammenhang mit anderen mit sich selbst und der Umwelt aktiv auseinandersetzt, das durch Erfahrung lernt, sich ganzheitlich, d.h. kognitiv und emotional zugleich entwickelt und dem der politische Zusammenhang allen Lernens bewußt ist. Gerade der emotionale Bereich des Lernens kam in unserem bisherigen Schulsystem wesentlich weniger zur Geltung, ist aber doch ein entscheidender Faktor für den Lernprozeß.
These3: Die Gesamtschule hat die Schulerfolgschancen von Arbeiterkindern und Mädchen gegenüber dem herkömmlichen System deutlich verbessert. Sie leistet also einen guten Beitrag zur Chancengleichheit und ist insofern meiner Meinung nach auch das gerechtere System nicht nur hinsichtlich der Startchancen, sondern auch hinsichtlich des Prozesses, sich in unserer Gesellschaft einzuordnen.
These4: Die Gesamtschule hat ein neues Lernklima geschaffen, das stärker als in der bisherigen Schule von Solidarität und angstfreierer Kooperation geprägt ist.
These5: Die Gesamtschule hat Bereiche der sozialen Umwelt stärker in die Schule hineingeholt und sich selbst stärker zur Umwelt geöffnet.
Obwohl ich diesen Thesen im großen und ganzen zustimme und sie gut mit meinem Thema, der „Öffnung der Schule im gesellschaftlichen Wandel“, einhergehen, möchte ich sie an dieser Stelle doch relativieren. Die Thesen klingen stark danach, als hätte die Gesamtschule schon alles erreicht und die Probleme gehörten bereits der Vergangenheit an. Dem kann ich nicht ganz zustimmen und möchte deshalb folgendes hinzufügen: Die Gesamtschule stellt eine attraktive Alternative zu unserem bisherigen Schulsystem dar, bietet viele Möglichkeiten zur Kompensation von Mißständen, doch ist der Weg dorthin ein langer, der auch mit einigen Hindernissen verbunden ist. Als Beispiel sei hier nur die Finanzierung erwähnt. Insofern würde ich in diesen Thesen nicht schreiben „die Gesamtschule hat ... geleistet“, sondern die Gesamtschule sorgt für gute Voraussetzungen, dieses oder jenes zu leisten. Inwieweit sich dies verwirklichen läßt, hängt aber auch stark von unserer Bildungspolitik ab, auf die ich im folgenden Kapitel noch zu sprechen kommen werde.
Teil 6: 6. Die Öffnung der Schule im Zusammenhang mit der Bildungspolitik
Bevor ich mich näher mit dem Thema Bildungspolitik auseinandersetze, möchte ich meinen eigenen Standpunkt zu diesem Thema darlegen:
Die bisherige bildungspolitische Situation läßt wenig Freiräume, um gesellschaftlichen Wandlungen, wie z.B. der steigenden Berufstätigkeit beider Elternteile oder der steigenden Problematik an Schulen in sozialen Brennpunkten, entgegenzuwirken. Die Existenz kleinerer Schulen vor allem im ländlichen Bereich ist momentan gefährdet und langfristige Lösungen sind nicht erkennbar. Forderungen an die Schule, wie z.B. wohnortnähe, Schule als Ganztageseinrichtung, Erlebnispädagogik in Großstädten, regional angepaßte Berufsvorbereitung und Schulsozialarbeit, können zum jetzigen Zeitpunkt kaum erfüllt werden. Deshalb sollte eine strukturelle Veränderung unserer Schullandschaft vor allem hier in Baden Württemberg stattfinden. Strukturelle Veränderung heißt die Einführung zusätzlicher Schulformen, wie z.B. Gesamtschulen, Ganztagesschulen und der Schulautonomie, dort, wo sie zur Verbesserung einer Schule und der Situation für die Schüler beitragen können. Dies soll von einer sogenannten Schulkonferenz entschieden werden, dem Gremium, welches sich aus Lehrern, Eltern, Schülern, Regionalpolitikern und sonstigen beteiligten Leuten zusammensetzen kann.
Die konkrete Forderung an die Bildungspolitik also: Jetzige Strukturen können den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen und müssen neu überdacht werden.
In den folgenden Ausführungen werde ich mich hauptsächlich auf die Bildungspolitik unseres Bundeslandes beschränken, besonders die des Landkreises Ravensburg.
6.1. Eindrücke einer Tagung der GEW
51 An dieser Stelle möchte ich einige Beispiele von Schulen bringen, die den Versuch nach der Erschaffung einer neuen Schulstruktur kurz beschreiben und die Reaktion der Bildungspolitik dazu aufzeigen.
Beispiel 1 : Die Gesamtschule in Markdorf
In den 70-ger Jahren lagen große Bildungszentren im Trend und so beschloß man den Bau einer Gesamtschule in Markdorf, d.h. eines Schulkomplexes bestehend aus Haupt- , Realschule und Gymnasium. Da in Raum Markdorf noch kein Gymnasium vorhanden war , ging es auch darum, neue „Bildungsreserven“ zu ergründen, sozusagen den ländlichen Raum zu erschließen.
Ein weiteres Argument war die Rationalisierung der Schule, d.h. es sollte mit dem Zusammenschluß der drei Schularten Personal gespart werden und gleichzeitig die Qualität der Ausbildung erhöht werden. Wie dies geschehen sollte, wurde nicht weiter erläutert, ich vermute jedoch, da . Ein sinnvolles Projekt war jedoch die Einführung von Stützkursen und sogenannten Kernfachstunden, in denen der Stoff nochmals aufgearbeitet werden konnte oder beim Erledigen der Hausaufgaben Hilfestellungen gegeben werden konnten.
Nun zur bildungspolitischen Seite. Es begann damit, daß man die Schülerzahlen für den Raum Markdorf wohl leicht überschätzte. Der Gebäudekomplex wurde mit viel zu großen Klassenzimmern ausgestattet. Die Zimmerzahl war jedoch für drei Schulen in einer knapp bemessen. Die erste Sparmaßnahme bestand also darin, für 1.5 Millionen Trennwände in die Zimmer einzuziehen.
Ein weiteres Problem war die Organisation eines Stundenplanes für alle drei Schulen, der eine sinnvolle Raumbelegung zuläßt: die Stundenpläne überschnitten sich und es gab Engpässe. Auch gab es Schwierigkeiten mit einer angemessenen Raumausstattung, die den Bedürfnissen der drei Schularten gerecht wurde. Man beschloß also eien Anbau und somit trennten sich auch die Schularten. Aus dem Konzept einer Gesamtschule wurden drei getrennte Schulsysteme in einem Raum, natürlich auch mit getrennten Lehrerzimmern.
Beispiel 2 : Eine „regionale Schule“ in Rheinland Pfalz
Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um eine Schulform, die eine gesamte Region abdecken soll, d.h. die Schüler sollen die Möglichkeit haben, ihrer Ausbildung, egal welchen Schulgrades, in ihrer Region nachzugehen. Interessant war auch, im Vergleich zu der eher konservativ gehaltenen Struktur in Baden Württemberg, die Selbstbestimmung der regionalen Schule. Das Konzept der regionalen Schule wurde nicht vom Oberschulamt vorgegeben, sondern war Beschluß der Schule, der Gemeinden und sogar der Elternbeiräte. Es zeigt sich also, daß eine Art „runder Tisch“ oder eine „Schulkonferenz“, wie ich sie in Teil 1 beschrieben habe, durchaus schon praktiziert werden.
Das Konzept ist folgendermaßen: Bis zur 9. Klasse besuchen die Schüler der Haupt- und Realschule dieselben Klassen, ähnlich wie in der Gesamtschule. Erst ab beginn der 9. Klasse wird entschieden, wer den Haupt- oder Realschulabschluß machen möchte. Schüler, die das Gymnasium besuchen möchten, können entweder nach der fünften oder nach der zehnten Klasse zu den Gymnasialkursen wechseln, und das jeweils ohne Zeitverlust. Im Vordergrund steht bei dieser Schulart, bedingt durch das Konzept, die individuelle Förderung der Schüler. Dies wird mit Hilfe von Teamteaching, offenen Lernmaterialien ( ähnlich wie bei der Montessori-Pädagigik ), unterschiedlichen Aufgabenstellungen ( Leistungsdifferenzierung im Unterricht ) und auch dem Wechsel von Sozialformen erreicht. Das Teamteaching verlangt natürlich einen höheren Personalaufwand, da aber Haupt- und Realschule konform laufen, ist der effektive Personalaufwand im Vergleich zum gewöhnlichen Schulsystem eher geringer. Zudem behilft sich die regionale Schule indem sie motivierte Eltern und sogar Schüler (paarweise) für die Leitung von Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Zusatzveranstaltungen heranzieht.
Zudem ist ein solches System krisensicherer52, da es egal ist, ob die Schüler Haupt- Realschule oder Gymnasium besuchen, sie bleiben doch immer in der regionalen Schule.
Dieses Konzept bewährte sich in der Praxis und fand auch bei den Eltern großen Anklang. Dazu ist jedoch eine freizügige Bildungspolitik erforderlich, welche gerade bei uns in Baden Württemberg eher konservativ ist. Hierzu möchte ich die Presse53 unserer Region zitieren:
Kreis Ravensburg: „ Morgens werden die Kinder in die Mittel- und Oberzentren reingekippt, mittags um 14 Uhr werden sie wieder rausgefahren: “ So könnte jedenfalls nach Meinung des Bildungsplaners Wolf Krämer-Mandeau,...,über kurz oder lang die Bildungslandschaft in einer ländlichen Region wie dem Kreis Ravensburg aussehen. Um dem zu entgehen,empfiehlt Krämer-Mandeau vor allem eines: „ Bildungsabschlüsse dort anbieten, wo die Kinder sind “ .
Hier wird deutlich, daß diese Forderungen auch in unserem Raum vorhanden sind, sich jedoch nur sehr schwer durchsetzen lassen, da konservative Meinungen noch weit verbreitet sind54:
Ravensburg- Ein Gymnasium für die Weststadt? Umwandlung der Hauptschule Obereschach zu einer Realschule? Eine bessere Zusammenarbeit der städtischen Gymnasien bis hin zur Zusammenlegung ( wenigstens ) der Oberstufen? Erhebliche Brisanz birgt ein Gutachten zur
Schulentwicklungsplanung der Stadt Ravensburg, das gestern in kleiner Runde im Rathaus präsentiert wurde. Die von der Stadt beauftragte Projektgruppe „ Bildung und Region “ mit Sitz in Bonn hat in ihrer gründlichen Bestandsaufnahme und Zukunftsentwicklung vor alteingesessenen Ravensburger Tabus nicht zurückgeschreckt. Ja die drei Gutachter wären gerne nochüber das hinausgegangen, was die baden-württembergische Bildungspolitik mit ihrem strikten festhalten am dreigliedrigen Schulsystem zul äß t.
Gerade diese Tabus spielen oft eine wesentliche Rolle bei bildungspolitischen Entscheidungen. Schulen, die seit jeher als Eliteschulen galten und in unserer Region schon eine beachtliche Tradition mit sich bringen, bangen um Imageverlust. Pädagogische oder objektive bildungspolitische Aspekte werden somit oft in den Hintergrund gedrängt. Auch hier war der Anlaß zu diesem Schulentwicklungsplan nicht etwa nur die pädagogische Einsicht, sondern einerseits die Entstehung eines neuen Stadtteils, in dem die Schulversorgung sichergestellt werden muß, andererseits auch wieder die Situation der Hauptschulen, die über mangelnde Schülerzahlen klagen. Daraus entstand die Notwendigkeit zur Reform und die Vorschläge hierzu gingen in Richtung Gesamtschule. Um die jetzigen Schulen wenigstens vom Standort her erhalten zu können, sollten sie als Gesamtschulen, die Haupt- und Realschule vereinen, weitergeführt werden. Dies wurde jedoch vom Kultusministerium abgelehnt, obwohl der Schulentwicklungsplan, der schließlich von Experten erstellt wurde, die Gesamtschule befürwortete. So entstand die Zusammenlegung zweier Hauptschulen und die Umstrukturierung einer Hauptschule zur Realschule. Hier wird deutlich, wie stark an dem bisherigen dreigliedrigen System festgehalten wird, obwohl Aussagen von Experten andere Wege für sinnvoller halten.
Beispiel 3 : Das Bodnegger Schulkonzept
Hier wurde die Orientierungsstufe mit scheinbar guten Ergebnissen durchgeführt. Haupt- und Realschüler begannen gemeinsam in der fünften Klasse und trennten sich dann je nach Begabung und Interesse in der achten Klasse, wobei der Klassenleher derselbe bleibt, da er doch als Hauptbezugsperson angesehen wird. Für die Schüler bedeutet die Orientierungsstufe Flexibilität und auch die Aufhebung der strikten Trennung der Schulsysteme. Dieses Konzept fand allgemein großen Anklang, konnte sich aber aus bildungspolitischen Gründen nicht durchsetzen.
Für mich bedeutet dies schlichtweg, daß in Baden Württemberg die Zeichen der Zeit nicht erkannt werden und alte Konzepte nicht überdacht werden. Das soll nicht heißen, daß das bisherige Schulsystem schlecht gewesen sein muß, aber so wie die Gesellschaft wandlungsfähig ist, sollte auch unser Schulsystem wandlungsfähig sein und sich den Bedürfnissen der Zeit anpassen können.
So sprechen z. B. für die regionale Schule die relativ kurzen Anfahrtszeiten und die engere Bindung an den Heimatort. Ein Argument für Gesamtschulen wäre z.B. die Krisensicherheit gegenüber Schwankungen der Schülerzahlen der einzelnen Schularten und die Aufhebung des drei Klassensystems und eventuell auch die Schaffung einer einheitlichen, übergreifenden Pädagogik. Gerade dieser Punkt wird in der Bildungspolitik kaum berücksichtigt. Alle drei Schultypen besitzen unterschiedliche Lehrpläne, die die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schularten erschweren und somit auch wieder die Chancengleichheit in Frage gestellt werden muß.
Die Orientierungsstufe bietet den Schülern längere Zeit einen Entscheidungsfreiraum, man muß sich nicht sofort auf ein Schulniveau festlegen, ist also nicht schon in gewisser Weise für diese Schulart und einen bestimmten beruflichen Werdegang prädestiniert.
Derartige neue Schulkonzepte können auch durch ihren geringeren Organisationsaufwand die Finanzen schonen und neue pädagogische Ansätze wie z.B. Teamteaching lassen sich leichter verwirklichen.
Stattdessen beruft man sich lieber auf das relativ neue 9+1 Modell, der sogenannten „Werkrealschule“.
Kreis Ravensburg - Gymnasium, Realschule oder Hauptschule? Im Kreis Ravensburg ist das Votum der Grundschul-Abgänger und deren Eltern eindeutig: 40.6 Prozent entschieden sich zu Beginn des laufenden Schuljahres für die Hauptschule, die damit den Gymnasien (29.7 Prozent ) und den Realschulen (28.6 Prozent) klar den Rang abläuft. Die Gründe für die Beliebtheit der Hauptschule im Landkreis liegen für den stellvertretenden Amtsleiter des Schulamtes Tettnang und Leiter des Fachbereichs Hauptschule, Günther Maurer auf der Hand: Nähe zum Wohnort, und das seit 1992 eingeführte 10.
Schuljahr stabilisieren seiner Meinung nach die Hauptschule und machen sie zur Schulart mit dem offenen Horizont “ . 55
Diese bietet den Hauptschülern zwar die Möglichkeit, den Realschulabschluß an ihrer eigenen Schule zu machen, jedoch halte ich das 9+1 Modell nicht für ein gut durchdachtes Konzept. Es ist vielmehr der Versuch, die Situation der Hauptschule mit möglichst geringem Aufwand zu retten. Im Grunde bleibt die Werkrealschule weiterhin eine Hauptschule. Schüler, die von vornherein den Realschulabschluß anstreben, machen von dem 9+1 Modell keinen Gebrauch, sondern suchen die nächstgelegene Realschule auf. So ist das 9+1 Modell zwar eine attraktive Möglichkeit für Schüler, die bereits die Hauptschule besuchen, wird aber an den Einschulungszahlen der jeweiligen Schule nicht viel ändern und somit die Hauptschulproblematik nur verzögern.
Ein wichtiger Punkt in dem oben genannten Zitat ist das Argument der Wohnortnähe. Zwar entscheiden sich 40.6 Prozent der Grundschüler für die Hauptschule, doch wenn die Wohnortnähe hierbei eine entscheidende Rolle spielt, so würden sich eventuell mehrere Schüler für Realschule oder Gymnasium entscheiden, wenn auch hier die wohnortnähe gegeben wäre. Dies spricht wieder für die Einrichtung einer Gesamtschule, die zumindestens Haupt- und Realschule vereint.
6.2. Zur bildungspolitischen Situation
Ein großes Problem stellt der Stellenwert der Bildungspolitik in unserer gesamten politischen Landschaft dar. Das Interesse an bildungspolitischen Fragen hat nachgelassen, oder besser gesagt keine Partei beschäftigt sich gerne mit diesem Thema, da es in der Bildungspolitik oft auch um zusätzliche Ausgaben geht, hinter die sich momentan keine Partei stellen möchte. So ist Bildungspolitik zu einem Thema für finanzielle Schönwetterlagen56 geworden. Dem entgegen steht das Bewußtsein, daß wir aufgrund unseres Witschftssystemes sehr stark auf ein hohes Bildungsniveau angewiesen sind. Dieses hohe Bildungsniveau bedeutet für uns Zukunftssicherung, gerade weil in Deutschland die Produktproduktion und Fertigung aufgrund eines relativ hohen Lohnniveaus an Bedeutung verliert. Viel wichtiger ist der Verkauf von „know-how“ und neuen Technologien. Dies verlangt eine hohe Flexibilität und ein möglichst hohes Bildungsniveau von den Arbeitskräften, die nur mit Hilfe einer zeitgemäßen Bildungspolitik gewährleistet werden kann. Diese wiederum hängt von einer bildungspolitischen Kompetenz ab, die sachliche Informiertheit, pädagogische und politische Kompetenz57 erfordert. Nur mit dieser Kompetenz ist eine Vermittlung zwischen pädagogischen und wirtschaftlichen Interessen möglich, die ja nicht unbedigt konform sind. Weitere Fragen mit denen sich die Bildungspolitik auseinanderzusetzen hat sind z.B.58:
Wie geht man mit sogenannten „Schulversagern“ um?
Wie politisch soll die Schule sein?
Wird die Schulreform auf dem Rücken der Eltern ausgetragen?
Sind neue Reformen pädagogisch sinnvoll, lassen sie sich in die Praxis übertragen oder beinhalten sie eine reine Ideologie, die gar nicht realisierbar ist. Hier geht es mir hauptsächlich um die Unterstützung von Modellversuchen und vor allem um eine objektive und kompetente Auswertung, wie dies z.B. bei der Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue geschieht.
Wer bestimmt, was mein Kind lernen soll?
Dazu kommen noch die in Kapitel 1.7. genannten Aufgaben, wie festlegen von Rahmenbedingungen, Besoldung der Lehrer usw..
Diese Bedingungen, der Gegensatz zwischen finanziellen, pädagogischen und ideologischen Interessen, machen die Bildungspolitik zu einem Instrument, welches nur sehr langsam auf gesellschaftliche Wandlungen reagiert und somit eine Öffnung der Schule erschwert. So ist z.B. die CDU in einem Zeitungsartikel59 der Meinung, daß neue Modelle auf dem Rücken der Kinder ausprobiert werden. An dieser Stellungnahme, die durch keinerlei Fakten belegt wird, zeigt sich eindeutig das Interesse und die Einstellung zu diesem Thema, nämlich die Bewahrung von althergebrachten Systemen um den Preis der politischen Ideologie. Gegnerische Ideen werden als „ungebetene Einmischungsversuche“ abgewertet. Ich frage mich hier, wo das Interesse an der Sache selbst bleibt. Der Wille, die bestmögliche Lösung für die Region und die Kinder zu finden, tritt selten in den Vordergrund. Dies macht gute Ideen, wie z.B. die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für den Ravensburger Raum, zunichte, wenn objektive Gutachten anschließend politischen Ideologien zum Opfer fallen.
Erklärung
Hiermit versichere ich, daß ich diese Arbeit allein angefertigt habe und nur die im Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Zitate sind als solche gekennzeichnet.
(Jens Weigand)
Weingarten, den 12.02.1996
[...]
1 Zeller / Mendler / Mayr 1995 S. 7
2 Zeller / Mendler / Mayr 1995 S. 7
3 Zeller / Mendler / Mayr 1995 S. 10
4 siehe hierzu auch Harm Paschen 1995 S. 14
5 Harm Paschen 1995 S. 14
6 siehe hierzu auch Manfred Weiß 1995 S. 43 ff.
7 siehe hierzu auch Harm Paschen 1995 S. 15 ff.
8 siehe hierzu auch Zeller / Mendler / Mayr 1995 S.12
9 siehe hierzu auch Zeller / Mendler / Mayr 1995 S. 11
10 Ernährungsinfo des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten des Landes Baden Württemberg 1985
11 Peter Struck 1995
12 Ernährungsinfo des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Baden Württemberg 1985
13 Peter Struck 1995 S.31
14 Hurrelmann / Hesse S.241
15 Engel / Hurrelmann S.175
16 Engel / Hurrelmann S.179
17 Süddeutsche Zeitung vom 3.5.1990
18 Zeitschrift „Der Spiegel“ 21/1991
19 Jugendkriminalität und Jugendgefährdung in Baden Württemberg Jahresbericht 1990
20 vergleiche hierzu auch Peter Struck 1995 S. 119 ff.
21 vergleiche hierzu auch Raab / Rademacker / Winzen 1987 S. 13 ff.
22 „Wege zur Gewaltlosigkeit“ Verlaufsbericht 1/95 16.06.1995 Gesamtschule Saarbrücken-Bellevue
23 siehe Kapitel 4.
24 „ Jonglieren statt schlagen“ Sonntagsgruß ( Saarbrücken ) 7 / 1995
25 „ Judo, Artistik und Klettern...“ Saarbrücker Zeitung Nr. 34 Donnerstag, 9. Februar 1995
26 Schulsozialarbeit zwischen Konflikt und Akzeptanz. S.89
27 Schulsozialarbeit zwischen Konflikt und Akzeptanz S. 75
28 siehe Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 4 -5
29 Skript „RVK- ein Modell stellt sich vor“ 1981 S.2
30 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 10 ff.
31 siehe auch Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 51 ff.
32 Modellprojekt Schulsozialarbeit in Kassel, April 1983 S. 2
33 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 52
34 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984, Tabelle 6 S. 55
35 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 57
36 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 66
37 siehe auch Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 59 ff.
38 Faulstich-Wieland / Tillmann 1984 S. 59-60
39 Rolff 1979 S. 9-11
40 siehe Rolff 1979 S. 18
41 siehe auch Rolff 1979 S. 20 ff.
42 siehe auch Rolff 1979 S. 25 ff.
43 siehe auch Rolff 1979 S. 84 ff.
44 Rolff 1979 S. 93- 94
45 Rolff 1979 S. 94
46 siehe Rolff 1979 S. 106
47 siehe auch Teil 2.1.
48 siehe Rolff 1979 S.109
49 siehe Rolff 1979 S. 110
50 Rolff 1979 S. 118
51 Tagung der GEW „Denkanstöße“ zum Thema „Schulentwicklung in Baden Württemberg“ vom 3.5.1995 im Gasthaus Waldhorn in Ravensburg
52 siehe hierzu Kapitel 2.6. Die Situation der Hauptschulen
53 Schwäbische Zeitung vom 20.2.1995 Winfried Leiprecht „Der Experte sieht Schullandschaft aus dem Lot „Verödung der ländlichen Region droht““.
54 Schwäbische Zeitung vom 16.12.1994 Sibylle Emmerich „Brisantes Gutachten zur Schulentwicklungsplanung vorgelegt. Realschule in Obereschach?- Gymnasium in der Weststadt“.
55 Schwäbische Zeitung vom 14.3.1995 Jan Mende „Schulamt widerspricht „Kongreß-Gefasel“: Hauptschule hat imKreis einen Hohen Stellenwert.“
56 „Bildungspolitik - kein Thema mehr?“ Westdeutsche Rektorenkonferenz 1981 S. 251
57 Josef Derbolav 1977 S. 331
58 siehe auch Josef Derbolav 1977 S. 335
59 Schwäbische Zeitung vom 6.7.1995 „CDU Bildungspolitiker: Ravensburg keine Spielwiese der Ideologien“
- Arbeit zitieren
- Jens Weigand (Autor:in), 1995, Die Öffnung der Schulen im gesellschaftlichen Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95832
Kostenlos Autor werden







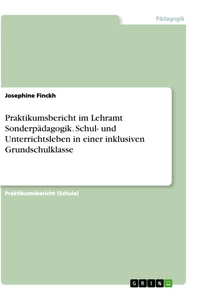














Kommentare
die öffnung der schulen im gesellschaftlichen wandel.
hallo, also die arbeit von jens weigand finde ich sehr gut aber habt ihr vielleicht eine e-mail adresse von ihm. ich schreibe gerade eine hausarbeit über die gesamtschule und würde gerne wissen welche bücher er als sekundärliteratur verwendet hat. Im volltitel, also wenn ihr mir behilflich sein könnt, es wäre echt klasse.
danke im voraus
derya