Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Kommunikation in der Hochschule - Ein kurzer Forschungsüberblick von Sandra Kainzbauer
III. Thesen zur Hochschul-Kommunikation von Sandra Kainzbauer
IV. Typische Formen der Lehr-Lern-Kommunikation in der Hochschule von Sandra Kainzbauer
V. Die Prüfungsfrage als Sonderform der Frage: Die mündliche Prüfung an der Hochschule von Doris Gerstlohner
VI. Zusammenfassung
VII. Bibliographie
I. Einleitung
Kommunikation in der Hochschule - diesen umfangreichen Themenkomplex haben wir uns für unser Referat und die schriftliche Arbeit zur Lehrveranstaltung „Diskurse in Institutionen“ vorgenommen.
Die Kommunikation in der Hochschule erscheint zunächst relativ klar abgrenzbar, auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch ihr umfangreicher Charakter. Sie ist so vielseitig und verschieden wie ihre Aktanten - Lehrende, Studenten, Angestellte der Universität ... Gleichzeitig existiert aber Forschungsliteratur zum Thema in nicht allzugroßem Umfang, viele Aspekte der Hochschul-Kommunikation wurden bislang gar nicht beleuchtet. Die vorhandene Literatur behandelt oft erst in zweiter Linie die Kommunikation in der Hochschule und beschäftigt sich vorrangig mit schulischen Diskursen. Unser Interesse war für dieses Thema deshalb besonders groß, weil hochschulische Kommunikation im Leben eines Studenten eine nicht geringe Rolle spielt. Die Übertragung von Forschungsergebnissen auf unsere tägliche Kommunikations-Praxis wird vielleicht nicht immer möglich sein, das Durchleuchten gängiger Muster ist aber gewiß nicht unerheblich für den Umgang des Einzelnen mit der Institution Hochschule.
Doris Gerstlohner, Sandra Kainzbauer
II. Kommunikation in der Hochschule - Ein kurzer Forschungsüberblick
Wie wir in der Einleitung bereits erwähnten, beschäftigt sich der Großteil der Literatur zum Thema erst in zweiter Linie mit Hochschul-Kommunikation und behandelt vorrangig die Kommunikation in der Schule. Zur Kommunikation in der Hochschule sind erst wenige Arbeiten erschienen.
Weber (1980)1 analysiert erstmals die gesellschaftliche Bedeutung der Hochschule für ihre Klienten. Er weist dabei besonders auf den Übergangscharakter hin: Die Studenten befinden sich in einem Zustand verlängerter Sozialadoleszenz. Als Folge entsteht Infantilisierung. In der von der Gesellschaft abgehobenen Universität bilden sich eigene Jargons und Fachsprachen. Es entsteht eine besondere Form institutioneller Kommunikation. Weber analysiert in diesem Zusammenhang die Studentensprache.2
Ehlich (1981)3 reflektiert darüber, ob der schulische Diskurs als Dialog betrachtet werden kann. Er führt dabei den emphatischen Dialogbegriff ein. Den Lehr-Lern-Diskurs analysiert Ehlich als Handlungsform eigener Art und unterscheidet davon den Unterrichtsdiskurs.4
Gülich (1981)5 analysiert empirisches Gesprächsmaterial, unter anderem eben auch aus der Institution Universität, um zu erforschen, welche Phänomene der Dialogkonstitution institutionell geregelter Kommunikation allgemein als charakteristisch für die Kommunikation in Institutionen angesehen werden können.6
Lotzmann (1982)7 behandelt die mündliche Kommunikation in Studium und Ausbildung. Klann (1983) untersucht die geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen an der Hochschule und stellt dabei die Seminardiskussion in den Mittelpunkt.
Auch Koerfer und Zeck (1983)8 beschäftigen sich mit der Seminardiskussion und untersuchen deren Einleitungsphase.
Redder (1983)9 befaßt sich in ihrem Beitrag mit dem Forschungsstand zur schulischen Kommunikation seit Mitte der siebziger Jahre. Dabei behandelt sie auch Arbeiten zu sprachlichen Handlungen außerhalb des offiziellen Unterrichtsgeschehens.10
Ehlich und Rehbein (1985)11 behandeln die Kommunikation in den Institutionen Schule und Hochschule und untersuchen 198612 typische schulische Muster, die sich zum Teil auch auf die Hochschule übertragen lassen.
Brünner (1987)13 befaßt sich ebenfalls mit institutionellen Lehr-Lern-Prozessen.
Rehbein (1989)14 beschäftigt sich mit nicht-erzählenden rekonstruktiven Diskursformen innerhalb der Hochschul-Kommunikation.
Lindenberg (1996)15 vergleicht schließlich das Gesprächsverhalten von weiblichen und männlichen Lehrenden im Unterricht.
III. Thesen zur Hochschul-Kommunikation
Fraktionierung des gesellschaftlichen Gesamtwissens als Voraussetzung für die Institution Hochschule
Die Institution Schule setzt eine entwickelte gesellschaftliche Arbeitsteilung voraus. Für die entstandenen Praxisfelder ist jeweils ein spezifisches Wissen erforderlich. Das gesellschaftliche Gesamtwissen wird dadurch fraktioniert. Einzelne Gruppen der Gesellschaft verfügen über spezifische Teile oder Fraktionen dieses Wissens. Einer der wichtigsten Aspekte bei der Zerlegung der Gesamttätigkeit ist die Trennung in Hand- und Kopfarbeit. Für die Reproduktion des Wissens werden deshalb komplexe Organisationen entwickelt.
Das Wissen wird in praxisfremden Reservoirs repräsentiert, wie Archiven, Bibliotheken, Akademien, Universitäten und Forschungsinstitutionen, also den Einrichtungen der Wissenschaft. Hochschulen befassen sich vor allem mit der Tradition und Erweiterung des Wissens.16
Die Paradoxie der Wissensvermittlung in der Hochschule
„Die Kommunikation in der Schule erscheint als eine unablässige, äußerst dichte, selten abbrechende Folge des Sprechens. Die sprachlichen Äußerungen kennzeichnen diese Institution wie kaum etwas anderes. Wahrscheinlich wird nur in wenigen anderen Institutionen soviel gesprochen wie in der Schule.“17
Diese Charakterisierung von Ehlich/ Rehbein läßt sich auch auf die Kommunikation in der Hochschule übertragen. Die Hochschule dient unter anderem der Vermittlung von Wissen, und Wissensvermittlung läuft nun einmal fast ausschließlich über die Sprache ab. Verstärkt wird diese Tendenz dadurch, daß in den meisten Studienrichtungen fast ausschließlich versprachlichtes Wissen vermittelt wird.
Die Sprache als leicht konvertierbarer, umsetzbarer Wissensträger macht ja die Übermittlung des Wissens von der Praxis zur Reproduktions- und Verarbeitungsinstanz Universität erst möglich. Auch die Rückvermittlung der erarbeiteten Resultate an die Praxis kann nur auf sprachlichem Weg erfolgen.18
„Mit der Trennung der Praxis vom Wissen über die Praxis nimmt das Wissen, je mehr es sich von der Praxis unmittelbar löst, immer mehr die Form nur noch versprachlichten Wissens an“, analysieren Ehlich und Rehbein.19 Weil die Realität aber nur bedingt versprachlicht werden kann, gerät die Hochschule in eine paradoxe Lehrsituation. Die Institution erzwingt eine Selektion von Wissenselementen, die durch sie vermittelt werden können. Die offizielle Zwecksetzung, nämlich die Vermittlung eines möglichst umfassenden Wissens, kann dann nicht mehr erreicht werden.
Die durch diesen Konflikt entstehenden Probleme äußern sich in den permanenten Klagen der Vertreter der Wirtschaft, die universitäre Ausbildung sei zu praxisfern. Eine Aufgabe der Hochschule ist es ja, der Wirtschaft hochqualifizierte Arbeitskräfte zu liefern. Daß dieses Ziel nicht immer erreicht wird, und daß das vermittelte Wissen häufig von der Praxis weit entfernt ist, liegt vermutlich an der fast ausschließlichen Vermittlung versprachlichten Wissens.
Die Widersprüchlichkeit der Institution
Viele Handlungsmuster der Hochschul-Kommunikation sind Praxisformen, die die Aktanten bereits aus anderen Zusammenhängen kennen. Die Muster werden in der Hochschule dann so angewandt wie in anderen gesellschaftlichen Situationen. Der Einsatz der außerinstitutionellen Muster wie etwa Frage, Entschuldigung, Antwort, Begründung... innerhalb der Institution Hochschule darf jedoch nicht als einfache Applikation betrachtet werden. Bei vielen Handlungsmustern zeigen sich Modifikationen.
So bestehen etwa große Unterschiede zwischen der alltäglichen Frage und der Examensfrage.
Mit der Examensfrage möchte der Sprecher nicht eine Vergrößerung seines Wissens erreichen, sondern den Wissensstand des Angesprochenen überprüfen. Auch die schulische Regiefrage hat mit der außerinstitutionellen Frage nichts mehr zu tun.
Charakteristisch für diese beiden Formen ist, daß der Fragende über das „erfragte“ Wissen bereits verfügt.
Die institutionsspezifischen Varianten alltäglicher Muster können deshalb häufig nur mehr als Para-Form der außerinstitutionellen Ausgangsformen betrachtet werden.
Daneben gibt es Muster, die spezifisch für die Institution Hochschule entwickelt werden, wie etwa Beantragungen.20
Typische Störfälle in der Hochschul-Kommunikation
Für die Hochschule ist es typisch, daß Äußerungen der Lehrenden zwar oft richtig verstanden, von den Studenten aus sozialen und interaktionellen Gründen aber nicht erwidert sondern übergangen werden.
So wird beispielsweise der Vorwurf eines Professors nur selten mit einer Rechtfertigung erwidert, sondern er wird meist „überhört“.
Eine Äußerung wie
Weil das Referat jetzt doch länger als geplant ausgefallen ist, können wir nur noch ganz wenige und kurze Diskussionsbeiträge zulassen.
wird vom Referenten zwar wahrscheinlich als Vorwurf aufgefaßt, die Zeit überzogen und damit die erwartete Diskussion verhindert zu haben. Der Referent wird jedoch auf eine Rechtfertigung verzichten.
Darüberhinaus ist es in vielen hochschulischen Situationen verpönt, sich zu vergewissern, wie eine Bemerkung gemeint war beziehungsweise entsprechend zu reagieren.
Der Hörer versteht häufig etwas ganz anderes, als der Sprecher gemeint hat.21
Zu allgemein „schiefen“ Interaktionsverläufen kommt es in der Hochschule deshalb häufig, weil die Kommunikation zwischen den Vertretern der Institution hochgradig konventionell geregelt ist. Sprachbarrieren bestehen aber nicht nur unter den Institutionsvertretern.
In der Hochschule sind dem Anfangssemester gegenüber Hindernisse durch eine entsprechende Fachsprache gegeben. Hier treten bei der Wissenschaftssprache und bei Fremdwörtern, aber auch bei der terminologisierten Umgangssprache Verstehensprobleme auf.
Für Neulinge ist der institutionelle Rahmen mit seinen spezifischen Situationen fremd. Äußerungen der Institutionsvertreter werden häufig falsch verstanden, und dementsprechend reagieren die Studenten auch falsch.22
Schwierigkeiten treten in der Hochschule auch auf, wenn Studenten in der Schule erworbene Verhaltensmuster wieder ablegen sollen. So halten sich Studenten oft strikt an das erlernte Frage- und Abrufsystem, anstatt sich an einer wissenschaftlichen Diskussion zu beteiligen.
Selbst provokante Thesen des Dozenten werden dann nicht als Aufforderung zum Widerspruch, sondern als Lehrervortrag verstanden. Diskussionen kommen oft nur schleppend in Gang.
Stubbs führt ein Verständnisproblem aus seiner eigenen Erfahrungspraxis als Dozent an.
Äußerungen wie im Beispiel werden von den Studenten häufig als Anweisung fehlinterpretiert, und dementsprechend reagieren sie mit Fragen:
You might be interested in having a look at X ’ s article on this. Do you want us to read that for the next essay?
Die Ursache für derartige Verständnisprobleme sieht Koerfer in der institutionsgegebenen Autorität des Lehrenden.23
Interaktive Fehlschläge können in Lehrveranstaltungen zu erheblichen Zeitproblemen führen. Da die Zeit institutionell begrenzt ist, ist es nicht verwunderlich, wenn etwa im Fall einer Themenaushandlungsphase in einem Hochschulseminar nach einer Viertelstunde ein x-beliebiger Einstieg in die thematische Phase gegenüber einer Fortsetzung der Themenaushandlung favorisiert wird. Angesichts der fortgeschrittenen Seminarzeit scheint der willkürliche Themeneinstieg rationaler zu sein als die Fortsetzung einer Verfahrensdebatte, die im nachhinein ad absurdum geführt wird. Durch den beliebigen Einstieg erweist sich die Themenaushandlung im nachhinein als überflüssig.24
Das Wahrheitsproblem
Auch in der Hochschule gibt es das Problem der didaktischen Reduktion. Manchmal kommt es dadurch zur Vermittlung und Aneignung von „halben Wahrheiten“, auf denen das Wissen der Studenten beruht und aufbaut. Der Verfall ganzheitlichen Wissens zu fragmentarischem Stichwort-Wissen gefährdet den Sinn und Zweck von universitärer Forschung und Lehre.25
Der ideale Hochschuldiskurs ist nicht von persönlichen Interessen getragen. Der Streit um Wahrheit in Argumentationsdiskursen ist institutionell vorgesehen. Das gesamte Wissen zur Lösung des anstehenden Problems muß von den Aktanten eingesetzt werden. Argumente, Behauptungen und Begründungen dürfen nicht vorenthalten werden. Unbedingte Offenheit ist das oberste Prinzip des wissenschaftlichen Diskurses.26
IV. Typische Formen der Lehr-Lern-Kommunikation in der Hochschule
Prinzipiell werden in der Hochschule alle sprachlichen Muster des Alltags angewandt. In der Universität finden ja nicht nur von der Institution vorgegebene Diskurse statt, sondern auch informelle, wie etwa Privatgespräche zwischen den Studenten oder auch zwischen Studenten und Lehrenden.
Unter den institutionell vorgegebenen Gesprächsmustern finden wir nicht nur den wissenschaftlichen Diskurs als Suche nach den besten Erklärungen und Argumenten. Neben der Forschung ist es die Lehre, die als wichtiges Aufgabengebiet der Institution Hochschule gilt. Wie für die Schule können auch für die Hochschule bestimmte Muster als typische Formen der Lehr-Lern-Kommunikation betrachtet werden.
In der Forschungsliteratur wurden bisher folgende Typen ausführlich behandelt:
Der Lehrervortrag
Der Lehrervortrag mit verteilten Rollen
Das Muster Aufgabe-stellen/ Aufgabe-lösen
Die Lehrerfrage
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Ehlich/ Rehbein27 und auf BeckerMrotzek28 sowie auf Koerfer29.
1. Der Lehrervortrag
Der Vortrag besteht aus einer Verkettung von Sprechhandlungen ohne turn-Wechsel, vor allem aus Verkettungen von Thema-Rhema-Strukturen. Diese Diskursart eignet sich deshalb besonders für den Transport von komplexem Wissen.
Der Vortrag setzt aufgrund seiner Komplexität ein aufmerksames Auditorium voraus. Die Zuhörer müssen am Wissenserwerb interessiert sein und auch selbst Anstrengungen unternehmen, um das komplexe vermittelte Wissen in das eigene Wissen zu integrieren.
Um die Informationsaufnahme zu erleichtern, werden in den Vortrag häufig reflexive Betrachtungen eingebaut, die sich auf den ganzen Vortrag oder auf einzelne Vortragsteile beziehen.
Der Vorteil des Lehrervortrags ist die konzentrierte Form des Wissenstransfers. Weil der Vortrag aber intensive mentale Mitarbeit der Zuhörer erfordert, ist er selbst für die hochschulische Wissensvermittlung nur bedingt geeignet. Der Lehrervortrag wird in Vorlesungen eingesetzt. Oft kann das Handlungsmuster auch hier nur einseitig realisiert werden, wenn die Studenten mental „aussteigen“ und nur mehr rein physisch Beteiligte des Vortrags sind.30
2. Der Lehrervortrag mit verteilten Rollen
Der Lehrervortrag mit verteilten Rollen ist eine Variation der Diskursform Vortrag, die speziell für den Unterricht entwickelt wurde. Bei dieser Kombination aus Vortrag und Frage wird mit Hilfe sogenannter Regiefragen in die mentalen Prozesse der Zuhörer eingegriffen.
Der eigentliche Zweck der Frage liegt ja darin, Wissen aus dem Wissensvorrat des Angesprochenen durch dessen Antwort in das Wissen des Sprechers zu transportieren. Durch die Frage werden also die mentalen Prozesse des Angesprochenen beeinflußt. Der Sprecher kann bei Bereitschaft des Hörers an dessen Wissen angeschlossen werden. Der Hörer orientiert sich auf das Wissensdefizit des Sprechers und darauf, dieses Defizit auszufüllen.
Bei der Regiefrage wird von diesen beinahe automatisierten Vorgängen Gebrauch gemacht. Der Angesprochene soll gezielt gesteuert werden. Der Sprecher verfügt zwar bereits über Thema und Rhema, eröffnet dem Angesprochen mit seiner Frage aber einen ganz bestimmten Rahmen von Antwortmöglichkeiten. Insgesamt werden somit die Gedanken des Angesprochenen gesteuert.
Beim Lehrervortrag mit verteilten Rollen wird der Nachteil des Handlungsmusters Vortrag, nämlich daß er konzentrierte mentale Mitarbeit des Auditoriums voraussetzt, durch den Vorteil des Handlungsmusters Frage ausgeglichen.
Die Form dieses neuen Diskurstyps ist nun nicht mehr die Verkettung von Assertionen, sondern die Sprechhandlungssequenz, also eine Abfolge von Sprechhandlungen mit systematisch bestimmtem turn-Wechsel.
Durch den wiederholten Einsatz der Regiefrage steuert der Lehrende den Ablauf des Gesprächs. Die Rhema-Gewinnung wird dabei auf die Studierenden übertragen. Lehrende und Lernende gestalten so gemeinsam den Lehrervortrag, wodurch der Wissenserwerb in akzelerierter Form stattfindet und doch keine zu hohen Anforderungen an die Zuhörer gestellt werden.31
In der Hochschule findet man diese Diskursart vor allem in Proseminaren und Übungen.
3. Das Muster Aufgabe-stellen/ Aufgabe-lösen
Ehlich/ Rehbein zeigen auf, welche Veränderungen das Muster Problemlösen erfährt, um zum schulischen bzw. hochschulischen Unterrichtsmuster Aufgabe-stellen/ Aufgabelösen abgewandelt zu werden.
Das Problemlösungs-Muster besteht aus mehreren Schritten, welche der Problemlösende nacheinander durchführen muß, um erfolgreich zu sein. Wer ein Problem behandelt, verfügt zuerst einmal über die Problemkonstellation; ihm wird bewußt, wo das Problem liegt. Um das Problem gemäß seiner Zielsetzung lösen zu können, bildet er Pläne aus und zerlegt die Gesamtproblematik in Teilprobleme. Für diese Teilprobleme müssen Probehandlungen ausgeführt werden, und das Unbekannte muß als unbekannt ausgezeichnet werden. Ehlich/ Rehbein charakterisieren dies als „Prozesse der konkreten Negation“32. Auf diese Weise werden Lösungswege erarbeitet, die schließlich zu einer Lösung führen, welche richtig oder falsch sein kann.
Alle diese Elemente werden beim Muster Aufgabe-stellen/ Aufgabe-lösen auf zwei Aktanten bzw. Aktantengruppen aufgeteilt: diejenigen, die die Aufgabe stellen und diejenigen, die die Aufgabe, das Problem, lösen. Der Aufgabensteller, im Lehr-Lern- Diskurs ein Lehrender, verfügt über die Problemkonstellation, die Zielsetzung, die problemrelevante Zerlegung der Aufgabe, die Lösungswege und die Lösung. Der Aufgabensteller braucht deshalb weder Pläne auszubilden, noch Probehandlungen auszuführen oder Unbekanntes als solches zu erkennen. Problematisch wirkt sich das veränderte Problemlösungs-Muster für den Lernenden aus. Er soll die Lösung zu einer Aufgabe finden, ohne über die gesamte Problemstellung zu verfügen. Auch die Zerlegungsmöglichkeiten des Problems fehlen ihm, ebenso die Zielsetzung. Der Aufgabenlösende entwickelt dadurch oftmals kein ausreichendes Zielbewußtsein, welches aber als Steuerungsmechanismus des Musters für ihn überaus wichtig wäre.
Das Zielbewußtsein organisiert nämlich nicht nur die Zerlegung der Problematik, es leitet auch die Planbildung an.
Weil das Zielbewußtsein im Muster Aufgabe-stellen/ Aufgabe-lösen in den Lehrenden hinein verlagert ist, ergibt sich für den Schüler oder Studenten häufig ein Motivationsproblem.
Aufgabe des Professors ist es nun, die Auslagerung von Problemlösungsteilen auf seine Handlungsseite zumindest tendenziell rückgängig zu machen. Strategien, die zu höherer Motivation der Studenten führen sollen, sind beispielsweise
- der Versuch des Lehrenden, bei den Studenten Interesse für die Gesamtproblematik zu wecken.
- der Versuch, die Problematik in „schülernaher Weise einzupacken“.
- die didaktische Umsetzung der Problematik in Teilaufgaben.
Für die Studenten kommt es im Hochschul-Alltag vor allem darauf an, den gewünschten Schein zu wahren und das Muster institutionsadäquat zu verwenden. Das geschieht mit der Präsentation von Lösungen ohne gleichzeitige Kenntnis der Gesamtproblematik und der Zielsetzung. Die Studenten liefern häufig „als-ob-Lösungen“, ohne ein Gesamtverständnis zu besitzen.
Lehrende unterstützen solche Pseudo-Problemlösungen, indem sie auch einfache Aufgabenlösungen als Erkenntnisfortschritt anerkennen.
Die Routinen zur Bewältigung und Rechtfertigung des Musters werden von den jeweiligen Aktanten in etwa gleicher Weise beherrscht und in geeigneten Augenblicken angewandt.33
4. Die Lehrerfrage
Im Alltag ist die Frage ein Mittel, mit dem sich ein Nicht-Wissender Zugang zum Wissen eines anderen verschafft. Die Lehrerfrage aber soll bei den Lernenden mentale Prozesse anregen. Der Lehrer kennt die Antwort bereits, und die Schüler sollen für sich eine Antwort suchen.
Für die Regiefrage des Lehrers ist charakteristisch, daß der Fragende bereits über Thema und Rhema verfügt und mit seiner Frage den Antwortbereich eingrenzt. Durch gezielte Fragen kann der Lehrer aber auch halb vergessenes Wissen reaktivieren und dem Lernenden dadurch Hilfestellung geben.
Eine Sonderform der Lehrerfrage ist die Prüfungsfrage. Auch hier möchte der Sprecher nicht sein Wissen vergrößern, sondern er will erfahren, ob der Prüfling über das erfragte Wissen verfügt. Gerade in Prüfungsgesprächen kann die Lehrerfrage für den Kandidaten oft eine wertvolle Hilfe sein.
V. Die Prüfungsfrage als Sonderform der Frage: Die mündliche Prüfung an der Hochschule
1. Allgemeines zur mündlichen Prüfung
Der Verlauf einer solchen Prüfung ist immer von vielen bewußten und unbewußten Faktoren abhängig und kann auch methodisch sehr unterschiedlich gestaltet werden.34
Je nachdem, was dem Prüfer angemessen erscheint, orientiert er sich an konkreten Handlungen und praktischer Erfahrung, bezieht sich auf vorgegebene Situationen, z. B. ausgehändigte Texte, oder er richtet sein Vorgehen individuell auf das jeweilige Stoffgebiet und den betroffenen Prüfling aus.
2. Die verschiedenen Niveaus der Fragen und mögliche Einteilungen
Es gibt verschiedene Einteilungen, um Prüfungsfragen nach ihrer jeweiligen Qualität zu trennen. Einige dieser Möglichkeiten sollen hier näher beschrieben werden.
Ganz grundsätzlich wird differenziert zwischen reinen Wissensfragen, bei denen vom Geprüften nur verlangt wird, auswendig gelernte Fakten wiederzugeben, und den handlungs- oder zukunftsorientierten Fragen. Letztere sind komplexe Fragen, deren Antworten durch Nachdenken erschlossen werden können, wie dies z. B. bei Erklärungen, Verbesserungen und Begründungen der Fall ist. Auf diese Art und Weise wird ersichtlich, ob die erworbenen Kenntnisse auch im Zusammenhang verstanden wurden und auf neue Situationen und Problemstellungen übertragen werden können.35 Wenn als Kriterium für die Unterscheidung von Fragetypen der Ermessensspielraum, den eine Frage für die Bewertung zuläßt, benutzt wird, entsteht ebenfalls eine Zweiteilung : Offene Fragen werden beurteilt durch „angemessen“ oder „unangemessen“, während es bei geschlossenen Fragen „richtig“ oder „falsch“ heißt. Eine genauere Unterscheidung wird aufgrund der BLOOM’ SCHEN TAXONOMIE von Lernzielen vorgenommen. Es gibt sechs Kategorien, von K 1 bis K 6, wobei K für komplex oder kognitiv steht und sich die Ansprüche, die an den Beantworter gestellt werden, mit jeder höheren Stufe steigern.
K 1 - Wissensfragen36
Mit ihrer Hilfe werden Inhalte aus dem Gedächtnis abgerufen und die Wiedergabe von auswendig Gelerntem verlangt, außerdem wird automatisches Problemlösen überprüft. Hinweise dafür, daß es sich um diesen Fragentyp handelt, sind z. B. typische Formulierungen wie „Zählen Sie auf ...“, „Nennen Sie ...“, „Bezeichnen Sie ...“, oder der Prüfer fragt etwas am Beispiel ab.
„Welche Aufgaben hat die Einleitung einer Interpretation?“ gehört in diese Sparte.
K 2 - Verständnisfragen37
Hier fordert der Prüfer Erklärungen, Erläuterungen, das Vernetzen von Wissen, das Erkennen eines inneren Aufbaus, Deutungen, Schlußfolgerungen, Verallgemeinerungen oder das Finden von Fehlern. Typisch für diese Anforderungsstufe ist unter anderem die Vergleichsfrage. „Erklären Sie den Unterschied zwischen Ablauf- und Aufbauorganisation!“ könnte eine Frage der K 2-Stufe im Bereich Betriebswirtschaft lauten.
K 3 - Anwendungsfragen38
Sie verlangen von den Prüflingen produktive Leistungen wie den Stoff in unbekannte Situationen zu übertragen, Abstraktionen in der Praxis einzusetzen, Wissen zu strukturieren und an neue Bedingungen anzupassen.
Aus dem Gebiet Schulrecht stammt folgendes Beispiel für die K 3-Frage: „Beschreiben Sie den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und übertragen Sie ihn auf eine konkrete Situation!“
K 4 - Analysefragen39
Auf dieser Stufe sollen Zusammenhänge und Aufbauprinzipien erkannt und analysiert, bei Phänomenen die Wirkungsmechanismen gefunden, neue und komplexe Gegenstände oder Sachverhalte behandelt und wesentliche Punkte aus einem Ganzen herausgefiltert werden können. Häufig werden bei diesen Fragestellungen zur Anregung und Konfrontationsmöglichkeit Skizzen, Diagramme und Forschungsberichte vorgelegt. Ein Beispiel aus der Biologie könnte so aussehen: „Erläutern Sie die Regelung des arteriellen Blutdrucks anhand eines Schemas!“
K 5 - Synthesefragen40
Sie testen Produktivität und Kreativität, wobei der Student Neues schaffen, vorher nicht Zusammengehöriges verknüpfen, Wissensstücke vereinigen, aus allgemeinen Gesetzen etwas konstruieren und Verbesserungsvorschläge machen soll. Projektaufgaben müssen gelöst und Handlungsentwürfe erstellt werden. Fragen, die in diese Stufe eingeordnet werden müssen, sind bereits sehr komplex. In die Kategorie K 5 einzuordnen wäre in der Chemie beispielsweise die Aufgabe: „Wie würden Sie die Herstellung von Viskose verändern und zugleich verbessern?“
K 6 - Beurteilungsfragen41
Um diese Fragen erfolgreich zu bestehen, müssen die Geprüften abwägen können, ihr selbständiges Denken unter Beweis stellen, konstruktive Leistungen erbringen und ein fachlich korrektes und sachbezogenes Urteil über einen größeren Komplex unter den Gesichtspunkten Zweckmäßigkeit, Folgen und Verallgemeinerbarkeit der Darstellung fällen können. Es werden also Systemvergleiche oder eine argumentativ aufgebaute Beurteilung verlangt.
Folgendes Beispiel ist der Romanistik entnommen: „Analysieren und beurteilen Sie die Entwicklung des französischen Theaters der 60er-Jahre!“
Mit der eben genau ausgeführten Einteilung der Fragen nach ihrem Schwierigkeitsgrad sind verschiedene Vorteile für den Prüfer und den Prüfling verbunden:42 Dieses Spektrum an Fragen bietet dem Prüfer die Gelegenheit, sein Anforderungsniveau bewußt zu steuern und somit die Qualität seiner Prüfungen zu erhöhen und nach Möglichkeit für alle Prüflinge auf gleicher Ebene abzuhalten. Des weiteren wird die Kommunikationsfähigkeit verbessert, da der Prüfling häufig schon an den Formulierungen erkennen kann, auf welcher der sechs Stufen er sich bewegen muß und andererseits der Prüfer bei der Wahrnehmung und in der Folge auch bei der Bewertung der Antworten sensibilisiert ist. Wenn sich der Prüfer also nach diesen Kategorien richtet, bewirkt dies eine größere Transparenz sowohl für den Prüfer als auch für den Prüfling und vereinfacht die Benotung, da die Kriterien durch die Abstufung etwas objektiviert werden.
3. Lernzielbezug
Unterricht zielt nicht nur darauf ab, Wissen zu vermitteln, sondern es geht auch darum, denkerische Fähigkeiten des Lernenden weiterzuentwickeln und neue aufzubauen und einzulernen. Eine Prüfung erfüllt dann in der Folge auch die Funktion zu beweisen, daß dem Lehrenden dies gelungen ist. Auch hier stehen verschiedene Modelle einander gegenüber, die mit den Begriffen einen weiteren oder engeren Rahmen abstecken, sich aber ähneln.
Im folgenden sollen zwei Theorien vorgestellt werden:
Die erste ist die BLOOM’ SCHE TAXONOMIE, nach der die ausführlichste der oben erwähnten Einteilungen von Fragestellungen vorgenommen wurde. Entsprechend den sechs Kategorien von Fragen gibt es sechs Stufen von Lernzielen, die erreicht werden sollen. Jeder Fähigkeit, die vermittelt werden soll, wird ein bestimmter Fragetyp zugewiesen, der überprüfen soll, ob die geforderte Fähigkeit vom Prüfling beherrscht wird. Der Unterricht ist laut dieser Taxonomie darauf ausgerichtet, Wissen weiterzugeben und die Fähigkeiten, etwas zu verstehen, anzuwenden, zu analysieren, zu synthetisieren und zu evaluieren (= beurteilen, bewerten) auszubilden.43
Eine andere Taxonomie stammt vom Deutschen Bildungsrat, der nur vier Lernziele differenziert:44
- Reproduktion (= Kennen)
Auf diesem Niveau muß nur Gelerntes wiedergegeben werden.
- Reorganisation (= Verstehen)
Das Gelernte muß selbständig verarbeitet und angeordnet werden.
- Transfer (= Anwenden)
Das Wissen muß auf neue oder ähnliche Aufgaben übertragen werden.
- Problemlösung/ Beurteilung
Das Gelernte soll kritisch bewertet und neue Lösungsansätze sollen gefunden werden.
Diese Darstellung ist stark verkürzt, aber ihr Sinn ist nur, zu zeigen, auf welches Ziel hin Fragen in Prüfungen formuliert werden. Welche Signalwörter ein Hinweis auf eine bestimmte Stufe in diesem System sind, kann oben bei der Einteilung der Fragen nachgelesen werden.
4. Prüfungsmethoden45
Unter diesem Punkt sollen fünf Techniken vorgestellt werden, mit deren Hilfe der Prüfer den Verlauf eines Tests gestalten kann. Es besteht die Möglichkeit, nur eine Methode einzusetzen oder mehrere auszuwählen und zu mischen. Wie das aussehen kann, ist unter dem Punkt
5. Prüfungsarten zu finden.
Die simpelste Weise, eine mündliche Prüfung zu organisieren, ist die Frage-Antwort- Technik, die vor allem die Aufgabe erfüllt, kurz und effektiv die erste Stufe der Bloom’ schen Taxonomie zu kontrollieren. Allerdings wird sich auf diese Weise selten ein Gespräch zwischen Prüfer und Prüfling entwickeln können, auch ist es schwer, mit diesem Verfahren das Niveau der Prüfung auch auf anspruchsvollere Lernziele hin zu lenken. Außerdem ist hier die Autorität ein Problem. Häufig ist der Kandidat nämlich befangen, eine neue Idee vor dem Professor auszubreiten, wenn dieser auf seine Kompetenz pocht, weil die Gefahr bestünde, er würde such vor dem Professor blamieren. Dergleichen Hemmungen fallen leichter weg, wenn die Illusion der Gleichberechtigung zwischen dem Prüfer und seinem Prüfling erzeugt werden kann. In dieser Hinsicht sind sicher Denkanstöße des Examinierenden didaktisch klüger, da sie verlangen, daß selbständig gedacht und beurteilt wird, so daß eigene denkerische Leistungen provoziert werden. Besonders Transfers und Bewertungen können getestet werden, und zudem kann ein Denkanstoß dazu dienen, einen Diskurs einzuleiten, sodaß die oben angesprochene Illusion entstehen kann.
Eine weitere Methode wäre, ein Kurzreferat halten zu lassen, bei dem es sich um einen kurzen, fünf- bis sechsminütigen Vortrag ohne Unterbrechung handelt, der vor allem die höheren Lernziele kontrolliert, wie z. B. Analyse, Synthese oder Evaluation. Bei der Vorbereitung auf eine solche Prüfung ist aber eine sprachliche oder rhetorische Übung notwendig.
Ähnlich wie bei den Denkanstößen muß sich der Kandidat bei Demonstrationen mit vorhandenem Material auseinandersetzen, dazu kritisch Stellung nehmen und in der Folge anhand der ihm zur Verfügung stehenden Utensilien (z. B. Graphiken, technische Geräte etc.) Erklärungen, Beschreibungen und Deutungen durchführen. Dabei wird das Schlußfolgern und die Ausdrucksfähigkeit geprüft. Außerdem „fördert (es) oft überraschend bei Kandidaten, die ängstlich sind, (...) erhebliches Können zutage.“46 Die letzte und anspruchsvollste Möglichkeit ist, die Prüfung in Form einer Diskussion abzuhalten. Eine Kontroverse zwischen Prüfer und Prüfling wird so lange geführt, bis ein Ergebnis vorliegt, das auch verschiedene divergierende Ansichten enthalten kann. Dabei werden vom Kandidaten komplexes Wissen über Sachverhalte und Zusammenhänge, rhetorisches Können und nicht zuletzt soziale Verhaltensweisen gefordert. Ein Nachteil dieser Technik besteht jedoch in der langen beziehungsweise unvorhersehbaren Dauer einer derartigen Auseinandersetzung, sodaß die Diskussion ausfällt, wenn ein fester zeitlicher und nicht allzu großzügiger Rahmen für die Prüfung abgesteckt wurde. Es muß auch beachtet werden, daß die Regeln der Auseinandersetzung im Vorhinein festgelegt und eingeübt werden, damit ein reibungsloser Ablauf ermöglicht wird.
5. Prüfungsarten
Grundsätzlich kann man Prüfungen einteilen nach der Anzahl der Kandidaten, die gleichzeitig an der Reihe sind. Es gibt Einzelprüfungen, Einzelprüfungen in Gruppen und Gruppenprüfungen47, in die man die oben aufgezählten Varianten der Gestaltung mit verschiedenem Anteil an der zur Verfügung stehenden Zeit einbauen kann. Stary listet sechs verschiedene Modelle auf, die vorstellbar sind:48 In Modell 1 muß der Kandidat zu einem bearbeiteten Gebiet ein Referat halten, zu dem der Prüfer anschließend Fragen stellt. Er plant dafür die Hälfte der Gesamtzeit ein. Die zweite Hälfte wird damit gefüllt, daß der Prüfer Fragen zu einem beliebigen Thema stellt. Modell 3 läuft im Grunde genau gleich ab, nur daß für die Auswahl des dem Kandidaten unbekannten Stoffes im zweiten Teil ein Zettelkasten benutzt wird. Das erste Viertel von Modell 2 wird ebenfalls mit einem Referat des Prüflings und der Rest der verbleibenden Zeit mit Fragen des Prüfers gefüllt. In Modell 4 legt der Kandidat zusätzlich zum Referat ein Thesenpapier vor, das sachlich und mit ausreichender fachlicher Kompetenz diskutiert werden soll. Die wenigsten Möglichkeiten, ein Ausweichmanöver zu starten, falls dem Prüfling auf eine Frage des Prüfers kaum etwas oder gar nichts einfällt, läßt das Modell 5 zu, bei dem die ganze Zeit über ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Prüfer und Kandidat abläuft. Bei dieser Methode fallen Wissenslücken sehr rasch und deutlich auf, vor allem wenn der Prüfer beginnt, nachzufragen. Ein großer Freiraum eröffnet sich hingegen den Kandidaten in Modell 6, wenn sie sich zu mehreren (höchstens zu dritt) mit einem Thema auseinandersetzen, ein Thesenblatt vorlegen, das im Verlauf der Prüfung bewertet wird. Es kann hier immer der von den dreien antworten, dem eine Erwiderung einfällt, so werden eventuell Denkanstöße für die anderen gegeben, die dann ergänzend ihre Ideen einbringen können, sodaß bei einem günstigen Verlauf ein dynamischer Diskurs entstehen kann. Natürlich lassen sich hier beliebig viele weitere Modelle kreieren, wenn man die Techniken variiert in ihrer Ausführung, die Reihenfolge ändert oder den Zeitraum für die einzelnen Aufgaben in ihrem Verhältnis zueinander verschiebt.
In einem anderen Aufsatz von M. Rauch wird unterschieden zwischen schulischen und außerschulischen Prüfungen, die jeweils schriftlich, mündlich oder praktisch abgenommen werden können.49 Rauch läßt dieser Aufzählung die Ergebnisse einer recht interessanten Erhebung folgen, bei der untersucht wurde, welche Prüfungsart vorgezogen wird. Es stellte sich heraus, daß dies individuell völlig variierte und kein Modell von der Mehrheit ausgewählt wurde, sondern die Präferenzen häufig von vorangegangenen Erfahrungen abhingen, je nachdem ob positive oder negative Erinnerungen mit der betroffenen Prüfungsart verbunden wurden. Zudem erwies sich, daß außerschulische Tests klar favorisiert wurden, weil sie erstens ohne Zwang absolviert werden und durch sie oft ein hoch bewertetes Ziel erreicht wird, z. B. Führerschein (= außerschulisch, praktisch und mündlich).
Abschließend soll hervorgehoben werden, daß es nur von den individuellen Vorlieben und Ansprüchen der Prüfer abhängt, für welche der vorgestellten Prüfungsarten sie sich letztendlich entscheiden, wie überhaupt besonders in der mündlichen Prüfung vieles von den Individuen und ihrem Aufeinandertreffen gelenkt wird, ohne daß wirklich die Schuld an einem möglichen Scheitern einer Person eindeutig in die Schuhe geschoben werden kann.
6. Prüfungsablauf
6.1. Funktion mündlicher Prüfungen
„Prüfungen dienen dazu, erworbene Qualifikationen von Lernenden mit Zertifikaten zu verbinden. Ziel ist es, die Lernenden in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und Auslese zu betreiben.“ (= Adressatenevaluation)50
Sie sollen den Nachweis erbringen, daß der Kandidat fähig ist, „Wissen und Fakten reflektierend, kritisch zu diskutieren.“51 Dabei sei die Form personenspezifisch verschieden, z. B. ob das Hauptaugenmerk auf reine Wissensabfrage oder Reflektion gelegt wird, dies hängt aber auch damit zusammen, daß für manche Fächer (z. B. Naturwissenschaften) Faktenfragen günstiger erscheinen als bei anderen (z. B. sozialund geisteswissenschaftliche Fächer).52
6.2. Vorbereitung
Zur Vorbereitung auf schriftliche Prüfungen werden Seminararbeiten oder Berichte über diverse Praktika verlangt, oder es wird ein bestimmter Termin festgelegt, an dem eine Probeklausur geschrieben wird. Wenn es um eine Ausführung praktischer Handlungen geht, können diese eingelernt werden, indem man sie so lange wiederholt, bis jeder Handgriff sitzt.
Schwieriger ist allerdings die Vorbereitung auf mündliche Prüfungen, da z. B. ein Referat nur eine mangelhafte Übung darstellt. Es gäbe dann noch die Möglichkeit, Probeprüfungen abzuhalten,53 um den Studenten einige Einblicke in den Ablauf zu gewähren. Jedoch wird man, will man das für die Praxis nutzen, mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Wie will man es rein zeitlich schaffen, für 20 oder meist noch mehr Seminarteilnehmer Termine festzulegen? Obendrein ist auch die Realitätsnähe sehr fraglich. Nicht zuletzt befürchten wahrscheinlich einige Studenten auch, daß sie dadurch im Sinne von „Der ist gut.“ und „Der ist sowieso schlecht.“ vorverurteilt werden, sodaß sich ein Leistungsdruck aufbaut: für den einen, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, für den anderen, im „Ernstfall“ besser abzuschneiden. Dennoch ist es sinnvoll, solche Probeprüfungen zu organisieren, da dem Prüfling somit immerhin einige Informationen zukommen und er sich einer bedeutenden Tatsache bewußt wird: der Subjektivität dieser Situation.54
In jeder Prüfung werden von Student und Professor immer verschiedene Ansprüche gestellt. Ebenso sind Vorbereitung, Durchführung und Leistungsbeurteilung immer subjektive Ereignisse, sogar wenn es sich um den gleichen Prüfer dreht. Ganz abgesehen davon, daß verschiedene Prüfer verschiedene Methoden haben und diese Techniken wiederum in Verbindung mit dem jeweiligen Fach stehen.
6.3. Beginn55
Im Normalfall verfolgt der Prüfer beim Einstieg eine Strategie, deren Zielsetzung es ist, dem Kandidaten die Angst zu nehmen, ihn zu ermutigen und eine entspannte Atmosphäre zu gestalten. Stary nennt vier Möglichkeiten, das zu erreichen:
a) förmlich, z. B.: „Wer will beginnen?“ oder „Wie heißen Sie?“
b) sachlich, z. B.: „Die erste Frage wäre ...“ oder „Sie haben sich mit ... beschäftigt. Können Sie erläutern ...“
c) offen, z. B.: „Wie wollen Sie beginnen?“ oder „Was haben Sie alles gemacht?“
d) spaßig, z. B.: „Welche Note wollen Sie?“ oder „Fühlen Sie sich stark genug?“ Diese letzte Möglichkeit erscheint mir allerdings mehr als fragwürdig und zweifelhaft, was die Erfüllung ihres Zwecks betrifft, nämlich die Auflockerung der Situation. Da der Student einen derartigen Beginn wahrscheinlich nicht erwartet, könnte bei ihm das Gefühl entstehen, der Prüfer wolle ihn auf den Arm nehmen oder er nehme ihn oder gar den Test nicht ernst genug, was dann unweigerlich zu einer Verunsicherung führen muß, die dann schnell und flexibel weggesteckt werden muß, um normal reagieren zu können und sich nicht zu verkrampfen. Ein einfühlsamer Prüfer wird also vermutlich einen solchen Einstieg meiden, es sei denn, er weiß, daß es diesem speziellen vor ihm stehenden oder sitzenden Kandidaten hilft.
6.4. Ort56
Laut einer Umfrage wird von den Kandidaten im allgemeinen das Zimmer des betroffenen Prüfers als atmosphärisch angenehmster Ort empfunden, während der Seminarraum oder ein extra vorbereiteter Raum eher als beklemmend beschrieben wurden, weil dadurch die Wichtigkeit der Prüfung noch mehr hervorgehoben wurde, sodaß die Nervosität deutlich anstieg.
6.5. Kritische Situationen
An diesem Punkt kommt die didaktische Evaluation zum Tragen, die das gesamte Unterrichtssystem im Blick hat. Bei Pestalozzi heißt es: „Einen jeden Fehler seines Zöglings suche der Erzieher bei sich selbst!“57 Dieser Satz ist sicherlich etwas simplifizierend, und man kann sicher nicht immer dem Lehrer die Schuld am Versagen eines Schülers oder Studenten geben, aber die Essenz der Forderung ist, daß vom Prüfer Unterstützung für den Kandidaten in brenzligen, unklaren oder peinlichen Augenblicken während der Prüfung erwartet wird. Kritische Momente tauchen jedesmal auf, wenn der Prüfling Schwierigkeiten hat, eine Antwort zu finden, er Symptome von Nervosität zeigt wie z. B. Stottern oder übermäßiges Gestikulieren oder wenn er gar ein totales „Black-Out“ hat. In allen diesen Fällen kann der Professor aus einem langen Katalog von Hilfestellungen die für den akuten Anlaß geeignetste Methode auswählen.58 Er kann z. B. Antwortalternativen bieten, um dem Kandidaten Auswahlmöglichkeiten zu geben oder versuchen, durch Stichworte den Prüfling in die gewünschte Richtung zu lenken. Ein peinliches oder zu langes Schweigen kann dadurch vermieden beziehungsweise beendet werden, daß der Prüfer sich erkundigt, ob die Frage richtig verstanden wurde und gegebenenfalls die Aufgabe mit anderen Worten wiederholt. Indem der Professor einen Widerspruch formuliert, kann er den Studenten eventuell aus der Reserve locken und erreichen, daß dieser seine Thesen argumentativ verteidigt und unterstützt.
Um eine lückenhafte Antwort in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, kann der Prüfer das Gesagte aufpolieren: „Sie drücken sich zwar ein bißchen unklar aus, meinen aber das Richtige.“ Wenn sich der Kandidat in seinen Aussagen verirrt hat, hilft es vielleicht, wenn ein anderer Stoff in Angriff genommen wird: „Lassen Sie uns nun ein anderes Gebiet behandeln!“ (= „Abbiegen“) Eine andere List, die der Unterstützung nicht mitteilungswilliger Prüflinge dient, ist das vorsichtige „Heranschleichen“ an ein Thema, indem einleitende und hinführende Ausführungen gegeben werden, an die sich dann die eigentliche Frage anschließt. Sehr hilfreich ist es häufig auch, ein Beispiel zu geben. Gelegentlich nützt es auch, wenn der Prüfer dem Kandidaten einfach nur Zeit und Ruhe zum Nachdenken läßt und dies explizit sagt, damit der Student nicht glaubt, die Pause so schnell wie nur möglich durch die korrekte Antwort unterbrechen zu müssen und so in Zugzwang gerät, was der Denkarbeit sehr zum Nachteil gereichen könnte. Weniger opportun beurteile ich folgende Hilfestellungen. Mit folgender Aussage soll versucht werden, dem Studenten Mut einzuflößen: „Das wissen Sie!“ Hiermit wird der Prüfling wiederum unter Druck gesetzt, was Verkrampfung zur Folge haben kann. Noch ungünstiger erscheint es mir, im Sinne von „Das war eine schwere Frage. Macht nichts, wenn Sie das nicht wissen.“ ein Nicht-Wissen abzuschwächen, weil man doch gerade dadurch mit der Nase darauf gestoßen wird, daß die Antwort unzureichend ausgefallen ist, und das während der Prüfung, was dem Betroffenen vielleicht das Gefühl vermittelt, er sei schon die ganze Zeit über schlecht gewesen, was ja durchaus nicht der Fall gewesen sein muß.
Schwierig ist auch der Umgang mit einer angekündigten „leichten“ Frage: „Eine einfache Frage: ...“, da sie die Nervosität des Gefragten steigert. Ähnlich verhält es sich mit Fragen, die selbstverständliche Dinge und Begriffe durchleuchten, z. B. „Was ist ein PC?“ Verwirrend muß auch eine rhetorische Frage wirken, da eventuell unklar ist, ob nicht doch eine Erwiderung erwartet wird.
Der Prüfer muß also bei der Auswahl seiner Hilfestellungen sein psychologisches Gespür unter Beweis stellen und Menschenkenntnis besitzen, um je nach den individuellen Bedürfnissen des Prüflings optimale Unterstützung bieten zu können.
6.6. Prüfungssituation59
Die Prüfungssituation ist sehr komplex, viele verschiedene Mechanismen greifen ineinander, zwei mehr oder weniger unterschiedliche Persönlichkeiten des Professors und des Studenten treffen aufeinander, sodaß ein äußerst schwer zu durchblickendes Geflecht von zusammenwirkenden und beeinflussenden Faktoren entsteht. Aus einer Modellvorstellung von Flechsig griff Rauch die für die mündliche Prüfung relevanten Variablen heraus, um zu verdeutlichen und verständlich zu machen, daß aufgrund der unendlichen mitspielenden veränderlichen Größen der Ablauf einer solchen Prüfung unberechenbar und unvorhersehbar bleiben muß. Die erste Hürde, die ein Kandidat überwinden muß, ist die Vorbereitung, die angemessen, ausreichend und vor allem mit einer zweckdienlichen Methode bewältigt werden sollte. Des weiteren wird die Einstellung zur Prüfung selbstverständlich auch von den mit dieser Art zu testen gemachten vorangegangenen Erlebnissen geprägt. Förderlich sind dann natürlich positive Erinnerungen, da sie die Sicherheit erhöhen, während eine negative Ansicht das Gegenteil bewirkt und leicht Nervosität und Ängstlichkeit auslöst. Hinzu kommt in jedem Fall auch noch die physische und psychische Verfassung, in der sich der Prüfling am betreffenden Tag befindet. Als bedeutsam erweist sich dann, ob man an einer Erkältung leidet, erst vor kurzem gesundet ist oder z. B. ausgerechnet dann einen Migräneanfall bekommt. Wenn das seelische Gleichgewicht in Unordnung ist, weil man z. B. von privaten Schwierigkeiten vereinnahmt ist, ist das sicherlich der Konzentrationsfähigkeit abträglich und behindert einen glatten Prüfungsverlauf. Nicht vergessen werden darf auch, zu beachten, welche Techniken der Kandidat bei der Lösung der Aufgaben zu gebrauchen imstande ist. Wichtig ist auch, wie der Charakter des Prüfers mit dem des Studenten harmoniert. So kommt es darauf an, ob der Prüfer starr an ein festes vorher festgelegtes Schema geklammert eine Frage nach der anderen abhandelt oder sich bemüht, flexibel auf die erhaltenen Antworten einzugehen und interessante Aussagen aufzugreifen, sodaß sich möglicherweise ein echter Diskurs entwickelt. Auch das Handlungsrepertoire, über das der Prüfer verfügt, kann vieles verbessern oder auch manches verschlechtern, wenn es klein ist oder qualitativ unzureichend ausgebildet. Positive Folgen zeitigen jedenfalls sicher viele verschiedene Unterstützungsmethoden, wozu z. B. die Aufmunterung hinzuzuzählen ist. Unangenehm berührt fühlt sich der Prüfling vermutlich, wenn der Prüfer eine einschüchternde, autoritäre Ausstrahlung hat oder mit seinen Worten diese Emotionen auslöst, sei es beabsichtigt oder auch unbeabsichtigt. Hilfreich kann gegebenenfalls zudem eine humorvolle, lockere Art sein. Verschieden je nach Typus reagieren die Studenten wahrscheinlich auf einen Professor, der ein sogenanntes „Poker-Face“ zur Schau trägt oder wenn das Gegenteil der Fall ist und dem Prüfer an der Mimik seine Meinung abzulesen ist. Der eine wird ersteres bevorzugen, während der andere lieber weiß, woran er ist. Ein weiterer Einfluß nehmender Faktor ist das Engagement, das ein Prüfer aufbringt für den Kandidaten und auch für das Thema. Beherrscht er die Fachliteratur, ist er aufmerksam und hört konzentriert zu, oder lenkt er von einem vom Studenten initiierten Thema ab und spielt nebenbei z. B. mit einem Stift in der Hand?
Vernachlässigt dürfen dabei nicht die äußeren Bedingungen werden. Ob ein Raum als zu groß oder zu beengend empfunden wird, ob es einem kühl oder zu warm erscheint, ob man durch Lärm oder sonstige Störungen, wie z. B. Telefonklingeln, beeinträchtigt wird, spielt eine entscheidende Rolle. Aber auch die Einrichtung trägt zur Prüfungsatmosphäre bei, z. B. ob die Möbel dunkel oder hell gestrichen sind, ob sachlich oder gemütlich gestaltet wurde oder welche technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Häufig wird auch das Vorhandensein von Zuhörern als Minuspunkt gewertet von den Geprüften, wobei sicher wieder die Anordnung der Sitze beachtet werden muß, denn wenn die Zuschauer hinter dem Kandidaten sitzen, hat er sie zwar vielleicht im Hinterkopf, aber er ist nicht mit ihnen, ihren Blicken, ihrer Mimik und ihren Gesten konfrontiert.
7. Leistungsbeurteilung
Stary zitiert in seinem Aufsatz eine Aufforderung von Breuel60: „Immer sollten sich Prüfer fragen: Möchte ich auch auf diese Weise und von diesen Leuten geprüft werden?“ Auch meiner Meinung nach ist dies sicher eine gute Leitlinie für den Professor, um zumindest vor sich seine Art, eine Prüfung durchzuführen, kontrollieren und rechtfertigen zu können. Allerdings sollte sich der Prüfer bei der Bewertung immer bewußt sein, daß sein Urteil unweigerlich von externen Kriterien mitgefällt wird, das heißt nicht nur mit Hilfe der unmittelbar gezeigten Leistungen. In diese Kategorie gehört z. B. jegliches Vorwissen des Prüfers über den Kandidaten, sei es ob er allgemein den Ruf besitzt, gut oder schlecht zu sein, sei es, daß man sich persönlich kennt, was sich bei Sympathie als positiv und bei Antipathie als negativ herausstellen wird. Außerdem ist der Prüfer eher voreingenommen, wenn er alte Klausurnoten oder die Seminarleistungen kennt. Wenn der Prüfer zwischen zwei Noten schwankt, wird die Entscheidung manchmal unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Gesamtnote getroffen. Wer sein Wissen geschickt an den Mann bringen kann, hat sicher einen Vorteil gegenüber jemand anderem, der die Fähigkeit, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen, nicht besitzt. Selbstverständlich darf aber der Zufall nicht außer acht gelassen werden, denn vielleicht hätte der Prüfling ja eine andere Frage zu allseitiger Zufriedenheit beantworten können, wäre sie gestellt worden oder hätte er einen Zettel aus dem Kasten gezogen. Diese Aufzählung könnte noch fortgesetzt werden.61
8. Verhaltensstrategien der Studenten62
Stary stellt die Resultate einer schottischen Studie vor, die 1974 in Edinburgh von Parlett und Miller gemacht wurde, und die zumindest als richtungsgebend interessant ist, um zu zeigen, wie die Studenten sich auf die Prüfungssituation vorbereiten.
Die Untersuchung unterscheidet drei Typen:
- Studenten, die nach der cue-seeking-Strategie arbeiten, vertreten die Ansicht, daß eine Prüfung ein Spiel nach festen Regeln sei und daß die Prüfungsleistung weniger der Lohn harten Lernens sei, sondern vielmehr die Fähigkeit, sich auf den jeweiligen Prüfer einzustellen; sie sind überzeugt von der Wichtigkeit des Eindrucks. Während der Vorbereitungszeit suchen sie AKTIV Hinweise, Anhalts- und Schwerpunkte. Die Erfolge, die sie aufweisen können, sprechen für sich; sie erreichen das Optimum, weil sie den „objektivistischen Schein von Prüfungen durchschauen und ein Höchstmaß an Anpassung zeigen.“63
- Kandidaten, die sich an die cue-conscious-Strategie halten, sehen im Erfolg eine Mischung aus Glück und Anstrengung. Sie nehmen Hinweise zwar auf, werden aber NICHT aktiv, um sie zu erhalten, sondern bleiben passiv. Ihre Ergebnisse sind in der Mitte anzusiedeln.
- Eindeutig schlechter schneiden dagegen Prüflinge ab, die sich der cue-deaf- Strategie verschrieben haben. Sie sehen in der Prüfung ein Ritual mit einem Höchstmaß an Objektivität, deren Beurteilung ausschließlich von den erbrachten Leistungsnachweisen abhänge. Ihre Vorbereitung orientiert sich vor allem am Stoff und an den behandelten Inhalten. Ein eventuelles Versagen werden sie als Ausdruck eigener Unzulänglichkeit, was die betroffenen Studenten vermutlich schon vor der Prüfung unter Druck setzt.
Insgesamt decken die vorgetragenen Argumente auf, daß Sprache eine enorm subtile Wirkung ausübt. Der Verlauf einer mündlichen Prüfung kann durch die Art und Weise der Formulierung einer Frage einfach oder erheblich erschwert gestaltet werden. Daraus können sowohl Prüfer als auch Studenten vorteilhafte Schlüsse für ihren Umgang mit dieser Situation ziehen.
VI. Zusammenfassung
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema Hochschul-Kommunikation bin ich der Ansicht, daß dieses interessante Gebiet bislang von der Forschung zu Unrecht vernachlässigt worden ist.
Dabei könnten gerade hier wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die - auf die tägliche Praxis angewandt - zur Lösung mancher Kommunikationsprobleme an der Universität beitragen könnten. Konkrete Vorschläge sind aber in der Forschungsliteratur nicht zu finden und aus der vorhandenen Literatur auch schwer abzuleiten.
Der erste Teil unserer Arbeit war für mich deshalb sehr interessant, weil ich mir dadurch erstmals die gängigen Diskursmuster bewußt machen konnte anstatt sie nur anzuwenden.
Aus dem zweiten Teil - Die mündliche Prüfung an der Hochschule - hoffe ich, persönlichen Gewinn ziehen zu können.
Insgesamt denke ich, daß sich die Linguistik in Zukunft verstärkt mit dieser Thematik beschäftigen sollte, da die erarbeiteten Ergebnisse im eigenen Bereich, der Universität, angewendet werden können und für die tägliche Kommunikationspraxis sicher wertvolle Hilfestellung leisten könnten.
Sandra Kainzbauer
VII. Bibliographie
1. Becker-Mrotzek, Michael (1990) Kommunikation und Sprache in Institutionen. Ein Forschungsbericht zur Analyse institutioneller Kommunikation. In: Deutsche Sprache 2/1990, 158 - 190; Deutsche Sprache 3/1990, 241 - 259.
2. Becker-Mrotzek, Michael (1992) Diskursforschung und Kommunikation in Institutionen. (Studienbibliographie Sprachwissenschaft 4) Heidelberg, Groos.
3. Becker-Mrotzek, Michael (1995) Angewandte Diskursforschung und Sprachdidaktik. In: Der Deutschunterricht 1995.
4. Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1980) Sprache in Institutionen. In: Althaus, Peter u.a. (Hrsg.) Lexikon der Germanistischen Linguistik, 2. Auflage, 338 - 345. Tübingen.
5. Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1986) Muster und Institution: Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen, Narr.
6. Koerfer, Armin (1994) Institutionelle Kommunikation. Westdeutscher Verlag, Opladen.
7. Wodak, Ruth (1987) Kommunikation in Institutionen. In: Ammon, Ulrich u.a. (Hrsg.) Soziolinguistik Band 3.1., 799 - 820. Berlin, N.Y.
8. Handbuch Hochschullehre - Handreichungen aus der Praxis für die Hochschullehre. Grundwerk: 1994, Bonn, Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH.
3 Aufsätze:
- Handlungsorientiertes Prüfen (F1.3.) von Birgit Mangler. 10 September 1996, Seite 1 - 23.
- Doch nicht durch Worte nur allein ... (F3.1.) von Dr. Joachim Stary. 1 Juni 1994, Seite 1 - 26.
- Nur ruhig Blut (F/3.2.) von Prof. Dr. Martin Rauch. 1 Oktober 1994, Seite 1 - 16.
1 Weber, Heinz (1980) Studentensprache. Über den Zusammenhang von Sprache und Leben. Weinheim.
2 Siehe: Wodak, Ruth (1987) Kommunikation in Institutionen. In: Ammon, Ulrich u.a. (Hrsg.) Soziolinguistik Band 3.1., 799 - 820. Berlin, N.Y.
3 Ehlich, Konrad (1981) Schulischer Diskurs als Dialog? In: Schröder, P./ Steger, H. (Hgg.) (1981) Dialogforschung. Jahrbuch des IDS 1980. 334 - 369. Düsseldorf, Schwann.
4 Siehe: Becker-Mrotzek, Michael (1990) Kommunikation und Sprache in Institutionen. Ein Forschungsbericht zur Analyse institutioneller Kommunikation. In: Deutsche Sprache 1990.
5 Gülich, Elisabeth (1981) Dialogkonstitution in institutionell geregelter Kommunikation. In: Schröder, Peter/ Steger, Hugo (1981) Dialogforschung. Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 1980. Düsseldorf.
6 Siehe: Becker-Mrotzek, Michael (1990)
7 Lotzmann, G. (Hg.) (1982) Mündliche Kommunikation in Studium und Ausbildung. Königstein.
8 Koerfer, Armin/ Zeck, Jürgen (1983) Themen- und personenzentrierte Interaktion in der Hochschule. Am Beispiel der Einleitungsphase einer Seminardiskussion. In: Ehlich/ Rehbein (Hgg.) (1983) Kommunikation in Schule und Hochschule. Linguistische und ethnomethodologische Analysen; 441 - 471. Tübingen.
9 Redder, Angelika (Hg.) (1983) Kommunikation in Institutionen. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 24.
10 Siehe: Becker-Mrotzek, Michael (1990)
11 Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (Hgg.) (1985) Kommunikation in Schule und Hochschule. Tübingen, Narr.
12 Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1986) Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen.
13 Brünner, Gisela (1987) Kommunikation in institutionellen Lehr-Lern-Prozessen. Tübingen, Narr.
14 Rehbein, Jochen (1989) Biographiefragmente. Nicht-erzählende rekonstruktive Diskursformen in der Hochschulkommunikation. In: Kokemohr, R./ Marotzki, W. (Hgg.) (1989) Biographien in komplexen Institutionen. 163 - 254. Frankfurt/ Bern, Lang.
15 Lindenberg, Dorothee (1996) Unterrichten Lehrerinnen anders als Lehrer? Zum Gesprächsverhalten von Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht. In: Der Deutschunterricht 1/1996. 16 - 26. Friedrich Verlag.
16 Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1986) Muster und Institution. Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen, Narr. Seite 165 f.
17 Ehlich / Rehbein (1986) Seite 1.
18 Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 170 f.
19 Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 170.
20 Siehe: Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 173 f.
21 Siehe: Koerfer, Armin (1994) Institutionelle Kommunikation. Westdeutscher Verlag, Opladen. Seite 127 f.
22 Siehe: Koerfer (1994) Seite 130 ff.
23 Siehe: Koerfer (1994) Seite 136.
24 Siehe: Koerfer (1994) Seite 192 ff.
25 Siehe: Koerfer (1994) Seite 272 f.
26 Siehe: Koerfer (1994) Seite 274 ff, Seite 279.
27 Ehlich, Konrad/ Rehbein, Jochen (1986) Muster und Institution: Untersuchungen zur schulischen Kommunikation. Tübingen, Narr.
28 Becker-Mrotzek, Michael (1995) Angewandte Diskursforschung und Sprachdidaktik. In: Der Deutschunterricht 1995. Becker-Mrotzek, Michael (1990) Kommunikation und Sprache in Institutionen. Ein Forschungsbericht zur Analyse institutioneller Kommunikation. In: Deutsche Sprache 1990.
29 Koerfer, Armin (1994) Institutionelle Kommunikation. Westdeutscher Verlag, Opladen.
30 Siehe: Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 81 - 86.
31 Siehe: Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 71 - 86.
32 Siehe: Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 14.
33 Siehe: Ehlich/ Rehbein (1986) Seite 14 - 22 sowie Koerfer (1994) Seite 220 f. 10
34 F1.3: Mangler, Birgit (1996) Handlungsorientiertes Prüfen. Seite 2.
35 F1.3: Seite 2/3.
36 F1.3: Seite 9.
37 F1.3: Seite 10.
38 F1.3: Seite 11f.
39 F1.3: Seite 13f.
40 F1.3: Seite 15f.
41 F1.3: Seite 16f.
42 F1.3: Seite 5, Seite 8.
43 F3.1: Stary, Joachim (1994) Doch nicht durch Worte nur allein ... Seite 22.
44 F3.1: Seite 23.
45 F3.1: Seite 17 - 19.
46 F3.1: Seite 18.
47 F3.1: Seite 4.
48 F3.1: Seite 5.
49 F3.2: Rauch, Martin (1994) Nur ruhig Blut ... Seite 3.
50 F3.2: Seite 2.
51 F3.1: Seite 2.
52 F3.1: Seite 6.
53 F3.2: Seiten 4 und 5.
54 F3.2: Seiten 10 und 11.
55 F3.1: Seite 8.
56 F3.1: Seite 7.
57 F3.2: Seite 3.
58 F3.1: Seite 8/9.
59 F 3.2: Seite 7 - 9.
60 F3.1: Seite 14.
61 Vergleiche F3.1: Seite 14 - 16.
62 F3.1: Seite 24/ 25.
63 F3.1: Seite 25.
- Arbeit zitieren
- Sandra Kainzbauer (Autor:in)Doris Gerstlohner (Autor:in), 1998, Kommunikation an der Hochschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95592
Kostenlos Autor werden


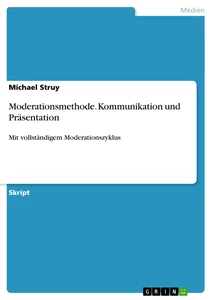






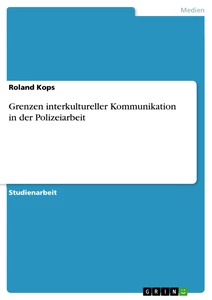



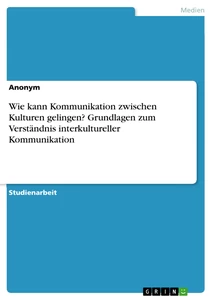








Kommentare