Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1. Binationale Familien in Deutschland
2.2. Erziehung und Erziehungsstile
2.3. Bedeutung von Fähigkeiten und Kompetenzen
2.4. Das Forschungsfeld: Binationale Erziehung
2.4.1. Zur Situation von Menschen mit binationalem Hintergrund
2.4.2. Forschungsstand
3 Erziehung in monokulturellen und binationalen Familien
3.1. Erziehungsziele
3.2. Geschlechterdifferente Erziehung von Jungen und Mädchen
3.3. Einstellungen zur multikulturellen Erziehung
3.4. Erziehung zur Zweisprachigkeit
4. Erziehung in binationalen und monokulturellen Familien im Vergleich
4.1. Trends
4.2. Verschiedenheiten
5 Zusammenfassung
Literatur
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Erziehungsziele in Abhängigkeit von der Nationalität von Vater/Mutter
Tabelle 2: Geschlechterdifferente Erziehung von Jungen und Mädchen in den Ländergruppen
Tabelle 3: Einstellung zur multikulturellen Erziehung
1. Einleitung
„Die Ergebnisse des Mikrozensus 2005 haben verdeutlicht, dass Deutschland zu den bedeutendsten Einwanderungsländern der Welt gehört. Ein Fünftel der gesamten deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund und schaut man sich die Situation in den Großstädten noch genauer an, hat sogar mehr als jedes vierte Kind bzw. jeder vierte Jugendliche in Deutschland einen Migrationshintergrund“ (Polat, 2008, S. 185). Der Prozess der internationalen Vergesellschaftung ist kein neues Phänomen der Gegenwart, vielmehr gelten Migration und Wanderungsbewegungen als unabdingbarer Bestandteil der Menschheit und lassen sich bis zu den Anfängen des menschlichen Lebens zurückverfolgen. Heute äußert sich die Wanderungsbewegung vor allem durch die Globalisierung, die Arbeitswanderung sowie Flüchtlingsströme. Migranten erhoffen sich bessere Lebensbedingungen oder bessere Verdienstmöglichkeiten. Sie fliehen vor Krieg, Hunger und Armut, damit ihre Kinder in Sicherheit aufwachsen und ihre Familien zur Normalität zurückkehren können. „Alljährlich verlassen etwa 50 Mio. Menschen ihre Heimat. Etwa 50% von den Migranten bleiben innerhalb der Grenzen ihres Landes, die andere Hälfte überschreitet die Landesgrenze“ (Datta, 2005, S. 4), wobei Integration, Transformation von Kulturen sowie die Wahrnehmung und Entwicklung der kulturellen Identität nur im Falle eines dauerhaften Aufenthaltes oder der Absicht, über einen längeren Zeitraum in der neuen Heimat zu verbleiben, entstehen (vgl. Datta, 2005, S. 4).
Vor allem in den letzten Jahren sind die internationale Mobilität sowie das weltweit Migrations- und Fluchtgeschehen weiter stark angestiegen. Deutschland gilt seit den Fünfzigerjahren aufgrund der florierenden Wirtschaft, dem hohen Lebensstandard und des gut funktionierenden Sozi al systems, als eines der bevorzugten Einwanderungsländer. Auch heute wollen viele Menschen als Arbeitnehmer, Fachkräfte oder Selbstständige in Deutschland arbeiten. Im Rahmen der Arbeitsmigration kommen ebenfalls viele junge Menschen, um eine Ausbildung zu absolvieren oder zu studieren. Deutschlands Rolle als Einwanderungsland hat vor allem durch die Flüchtlingsströme 2015 und 2016 zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hunderttausende Asylbewerber suchen Zuflucht vor Krieg und Verfolgung (vgl. BMI, 2018).
Die daraus resultierende Migrationsgesellschaft steht im Fokus des wissenschaftlichen Interesses, sodass sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Vielzahl von Beiträgen, Studien sowie Tagungen, Symposien und Vortragsreihen ein multikultureller Diskurs etabliert hat (vgl. Robertson-Wensauer, 2000, S. 15). Eine Komponente der Migrationsforschung bildet das Themenfeld der bikulturellen bzw. binationalen Familien und Ehen, welches in den USA bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts als lange Forschungstradition besteht und als wichtiger Indikator für die Integration von Minderheiten gilt (vgl. Khounani, 1999, S. 15). Die damit verbundene Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus binationalen Familien wird mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus gleichkulturellen Familien verglichen und bildet den Gegenstand dieser Arbeit.
Im Besonderen soll untersucht werden, inwiefern sich die Erziehungsschwerpunkte von deutsch-deutschen, deutsch-europäischen und deutsch-islamischen Paaren in den Aspekten der Erziehungsziele, der geschlechterdifferenten Erziehung, der Einstellung zur multikulturellen Erziehung und dem mehrfachen Spracherwerb unterscheiden. Erwartet wird, dass vor allem Familien mit islamischem Hintergrund traditionelle, familiäre und religiöse Aspekte schwerer gewichten als andere und generell stärker geschlechterdifferent erzogen wird als in westlich geprägten Familien. Inwiefern sich empirisch fundierte Rückschlüsse über Einstellungen zum sogenannten doppelten Erstspracherwerb in binationalen Familien ziehen lassen, bleibt abzuwarten.
Dazu erfolgt zunächst ein Überblick über den theoretischen Hintergrund binationaler Paare und ihrer Familien, der Erziehung sowie den Erziehungsstilen und den Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Hinzu kommen die Bedeutung der erlernten Fähigkeiten und Kompetenzen sowie das Forschungsfeld der binationalen Erziehung, wobei die Situation der binationalen Menschen exemplarisch dargestellt und der aktuelle Forschungsstand beleuchtet wird. Im dritten Kapitel wird die Erziehung in gleichkulturellen und binationalen Familien hinsichtlich der Erziehungsziele, der geschlechterdifferenten Erziehung sowie der Einstellung zur multikulturellen Erziehung und die Erziehung zur Zweisprachigkeit erläutert. Daraufhin wird das Erziehungsverhalten beider Familienmodelle verglichen und auf Trends und Verschiedenheiten geprüft. Das fünfte Kapitel fasst die zuvor dargestellten Resultate zur Erziehung in monokulturellen und binationalen Familien zusammen und beleuchtet die Relevanz von Erziehung im Rahmen der Migrationsgesellschaft.
2. Theoretischer Hintergrund
Ziel dieses Kapitels ist es, die Familienform von binationalen Familien vorzustellen und ihre Relevanz für die Integration zu beleuchten. Hierbei werden neben statistisch erhobenen Zahlen auch die verschiedenen Dimensionen der Integration herangezogen. Zudem thematisiert das Kapitel die Erziehung und ihre Bedeutung für die Vorbereitung auf das Leben sowie die Unterstützung im Rahmen der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Darauf aufbauend werden die Relevanz der interkulturellen Kompetenz sowie die Fähigkeiten der Empathie, Rollendistanz, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz zur Identitätsdarstellung dargestellt. Anschließend wird das Forschungsfeld der binationalen Familien hinsichtlich der Wahrnehmung Situation durch Aussagen von Menschen mit bikulturellem Hintergrund aufgezeigt und der aktuelle Forschungsstand zur Thematik beschrieben.
2.1. Binationale Familien in Deutschland
Im Rahmen der Migrationsgesellschaft nehmen Eingliederung und Integration der immigrierten Personen einen zentralen Stellenwert ein, wobei in der Soziologie vier Dimensionen der Integration aufgeführt werden, welche „in einem wechselseitigen Bedingungs- und Verstärkungsverhältnis [zueinander] stehen: die kulturelle, die strukturelle, die soziale und die emotionale Dimension“ (Schroedter, 2006, S. 420). Unter der kulturellen Assimilation wird die Angleichung der Migranten an die vorherrschenden Fertigkeiten und das Wissen der Aufnahmegesellschaft verstanden. Hierbei steht vor allem die Sprache im Mittelpunkt, da diese als wichtigstes Mittel der Kommunikation gilt und somit die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe schafft. Die strukturelle Dimension umfasst die Positionierung innerhalb verschiedener Funktionssysteme wie zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem. Die Entstehung intensiver Beziehungen zwischen zugewanderten Personen und Personen aus dem jeweiligen Aufnahmeland erfolgt im Rahmen der sozialen Dimension und beschreibt die dauerhafte, geographische Grenzen überschreitende Interaktion der Gesellschaftsmitglieder. Die vierte Integrationsdimension umfasst die emotionale Identifikation des Individuums mit der jeweiligen Aufnahmegesellschaft und ist das Produkt der zuvor genannten Dimensionen. Hierzu zählen insbesondere Freundschaften, Beziehungen, Ehen und Familien, wodurch das gesellschaftliche Miteinander und die Interaktion zwischen Personen des Aufnahme- und des Herkunftslandes unabdingbare Bedingungen für eine erfolgreiche Integration darstellen.
Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung von kommunikativen Kompetenzen deutlich: Nur wenn Sprachbarrieren abgebaut werden können, kann Integration bestmöglich gelingen. Deshalb bilden Überlegungen zur mehrsprachigen Erziehung einen zusätzlichen Untersuchungsschwerpunkt, die im Verlauf der Arbeit dargestellt werden.
Heiratsbeziehungen sind das Ergebnis einer langfristig angelegten persönlichen Interaktion zwischen zwei Personen, die vor allem durch Intimität und Exklusivität gekennzeichnet sind (vgl. Schroedter, 2006, S. 419). „Ehen zwischen Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen gelten daher als zentrale Indikatoren der gesellschaftlichen Integration“ (Schroedter, 2006, S. 419).
Im Jahr 2016 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 407.466 Ehen geschlossen. 85,6% waren deutsch-deutsche Ehen und 14,4% Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung, darunter waren 48.097 binationale Paare, die den Bund der Ehe eingingen (vgl. Verband binationaler Familien und Partnerschaften, 2018). Um ein binationales Paar handelt es sich im Verständnis dieser Arbeit bei Ehen, in denen einer der Partner über eine deutsche, der andere über eine ausländische Staatsbürgerschaft verfügt (vgl. Beck-Gernsheim, 2001, S. 75). Die Begriffe „-national“ und „-kulturell“ werden im Folgenden synonym verwendet. Die Partnerwahl basiert generell auf „individuellen Präferenzen der Akteure, dem Einfluss der jeweiligen sozialen Gruppe auf das Individuum und der strukturellen Restriktionen des Heiratsmarktes“ (Schroedter, 2006, S. 421), wobei deutsche Frauen vor allem Partner mit türkischer Abstammung bevorzugen, gefolgt von Männern polnischer sowie italienischer Herkunft. Deutsche Männer präferieren osteuropäische Frauen aus Polen, Russland oder der Ukraine sowie Frauen türkischer und asiatischer Herkunft (vgl. Verband binationaler Familien und Partnerschaften, 2018). Trotz der großen Anzahl an Heiratsbeziehungen sowie der hohen Relevanz für die Integration und Eingliederung der Immigranten, stehen binationale Paare unter „vielfältiger und durchaus paradoxer Beobachtung durch die Gesellschaft“ (Menz, 2007, S. 5). Während manche Menschen binationalen Paaren eher skeptisch und misstrauisch gegenüberstehen, empfinden andere diese Konstellation als Realisierung des interkulturellen Dialogs. Paare unterschiedlicher sozialer Herkunft gelten zudem als Wegbereiter einer zukünftigen modernen Gesellschaft, welche insbesondere durch eine multikulturelle Handlungsfähigkeit gekennzeichnet wird. Aufgrund der Befürchtungen hinsichtlich der Überschreitung kultureller und nationaler Grenzen, der Auflösungserscheinungen der deutschen Gesellschaft sowie der Angst vor Überfremdung entsteht ein Spannungsfeld innerhalb der deutschen Bevölkerung, sodass die Thematik binationaler Paare vielfache Zugangsmöglichkeiten für die Forschung bietet. Das Forschungsinteresse liegt auf der Verarbeitung dieser Differenzen (vgl. Menz, 2007, S. 5 ff.) und den Herausforderungen der Biographiegestaltung bezüglich der Sprachkenntnisse, der religiösen und ethnischen Herkunft sowie dem Umgang mit der Herkunftsfamilie, Erziehung der Kinder und Geschlechterbeziehungen. Jedoch „liegen vergleichsweise wenige Forschungsergebnisse zur Lebensgestaltung binationaler Paare in Deutschland vor. Statistische Analysen gibt es, mit Ausnahme von Klein 2001, nicht. Dies ist zum Teil auch der mangelhaften statistischen Erhebung geschuldet: Registriert werden nur Ehen, die in Deutschland zwischen Deutschen und Ausländern geschlossen werden, im Ausland geschlossene Ehen werden ebenso wenig erfasst wie Ehen zwischen Personen mit und ohne Migrationserfahrung, die aber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die fehlende Eignung des Staatsangehörigkeitsmerkmals für Untersuchungen des Migrationsprozess ist schon an vielen Stellen bemängelt worden“ (Menz, 2007, S. 8).
Zudem fokussiert sich die Forschungslandschaft überwiegend auf qualitative Studien zur Lebenswirklichkeit binationaler Paare. Diese methodologische und theoretische Ausrichtung der Forschung ist mit einem Paradigmenwechsel zu begründen, welcher sich zunehmend sozial-konstruktivistisch orientiert (vgl. Menz, 2007, S. 8).
Die zu erforschende Lebenswirklichkeit binationaler Paare und ihrer Familien ist zwischen unterschiedlichen Kulturen und Ländern sowie Erfahrungen und Traditionen aufgespannt. Handlungen aus dem familiären Binnenraum sind nur unter Berücksichtigung beider Kulturen zu verstehen, da es neben dem „Hier“ auch ein „Dort“ gibt, sodass die Familien im Rahmen der Transkulturalität individuelle Biographien, Lebensformen und Identitäten entwickeln (vgl. Beck-Gernsheim, 2001, S. 77). So identifizieren sich Kinder aus binationalen Familien selten mit nur einer ethnischen Gruppe, da der Intergruppenkontakt durch die kulturelle Vielfalt in den sozialen Kreisen der Familie gefördert wird. Durch die Erfahrungen mit der jeweils anderen Gruppe können bestehende Vorurteile und Stereotype abgebaut werden (vgl. Schroedter, 2006, S. 420). Wenn die kulturellen Vorgaben der beteiligten Nationen jedoch zu weit voneinander entfernt sind, sind die Partner angehalten eigene Lösungen zu finden, Entscheidungen in einem kaum vorstrukturierten Raum zu treffen und eine interkulturelle Lebenswelt für die Familie zu schaffen. Beim Zusammentreffen zweier verschiedener Welten gibt es weder Vorbilder noch spezifische Regeln, an denen sich binationale Paare orientieren könnten. Vielmehr müssen Fragen und Aufgaben, die als selbstverständlich gelten, zunächst entschieden, abgewogen und ausgewählt werden. Jedes Paar muss seinen eigenen Weg gehen und entsprechende Arrangements treffen (vgl. Beck-Gernsheim, 2001, S. 77). Hierbei lassen sich drei mögliche Arrangements binnen binationaler Ehen aufzeigen: „das einseitige Arrangement, in welchem sich [ein Partner] an die Kultur anpasst und diese die dominierende Rolle zugesprochen bekommt“ (Menz, 2007, S. 9), der Kompromiss, wobei beide Kulturen gleichberechtigt sind und letztlich das kreative Arrangement: durch die Vermischung beider Nationen entsteht dabei eine eigenständige dritte Form der Kultur (vgl. Menz, 2007, S. 9). Ob sich das Paar dazu entschließt, ganz der einen oder der anderen Kulturform zu folgen, ob sie eine Mischform nutzen, Elemente verknüpfen oder flexibel zwischen den Arrangements variieren, hängt von der persönlichen Lebensgeschichte, dem aktuellen Aufenthaltsort und den Zukunftsplänen ab. Zudem sind binationale Paare auf sich selbst gestellt und müssen suchen, experimentieren und neue Anfänge wagen, um ihre eigene Version der binationalen Familienkultur zu leben.
Insgesamt verkörpern binationale Familien nicht nur das höchste Ziel der erfolgreichen Eingliederung und Integration für die Migrationsgesellschaft, sondern auch eine „neue Form der Familie, die es in früheren Zeiten nur als seltene Ausnahme gab, die aber zu Gegenwart hin zunehmend häufiger wird, ja bald eine Normalform neben anderen wird“ (Beck-Gernsheim, 2001, S. 75).
2.2. Erziehung und Erziehungsstile
Erziehung ist ein Bestandteil des alltäglichen Lebens und wird im Allgemeinen als bewusste und beabsichtigte Einflussnahme auf den Geist und den Charakter eines Individuums oder einer Gruppe verstanden. Diese Beeinflussung ist mit einem bestimmten Ziel verbunden, welches sowohl reflektiert als auch unreflektiert und auf unterschiedlichen Allgemeinheitsebenen angesiedelt sein kann. So kann sich ein Erziehungsziel beispielsweise speziell darauf beschränken, dem Zögling die Buchstaben des Alphabets beizubringen. Wird das Erziehungsziel sehr generell formuliert, könnte es etwa daraus bestehen, dem Zögling die Übernahme der gesellschaftlichen Normen und Werte beizubringen. Erziehung bewirkt demnach einen Lernprozess, welcher eine dauerhafte Veränderung des Verhaltens anstrebt. Zudem betont die Psychologie den Handlungs- und Interaktionsaspekt, welcher sich zwischen dem Erzieher und dem zu Erziehenden stattfindet (vgl. Myers, 2014, S. 747). Erziehung umfasst „alle Erfahrungsmöglichkeiten, die innerhalb eines kulturellen Rahmens bereitgestellt werden, um die Lern- und Entwicklungsprozesse eines Menschen zu unterstützen“ (Myers, 2014, S. 747). Diese Prozesse finden oftmals in interpersonellen Beziehungen z. B. in der Familie, in der Schule, beim Sport oder während der Ausbildung statt. Familien und Schulen zählen zu den einflussreichsten Erfahrungsräumen, wobei die Erziehung binnen der Familie als beiläufig und intuitiv beschrieben wird. Die Erziehung in der Schule wird hingegen als bewusste und strukturierte Handlung verstanden, die vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Diskussion erfolgt. Trotz der unterschiedlichen Strukturen beziehen sich die Erziehungsprozesse auf motivationale und affektive Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Myers, 2014, S. 747 ff.). Hierbei geht es um den Erwerb von Wertehaltungen, Orientierungen und Einstellungen sowie der Aneignung gesellschaftlich erwünschter Kompetenzen und Verhaltensweisen. Werden falsche oder schädliche Intentionen bei Kindern und Jugendlichen erkannt, so werden diese durch Erziehung verhindert oder gehemmt. Erziehung beabsichtigt demnach die Verbesserung sowie die Vervollkommnung der Persönlichkeit des zu Erziehenden. Da die zu Erziehenden häufig in unmittelbarer Beziehung zu ihren Erziehern stehen, haben sie die Möglichkeit die angestrebten Erziehungsziele subjektiv zu beeinflussen. Ehrlichkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungsgefühl und Selbstvertrauen gelten als bevorzugten Eigenschaften von Kindern und Jugendlichen (vgl. Hurrelmann, 2006, zit. n. Stangl, 2018).
Der deutsche Philosoph Immanuel Kant befürwortete ebenfalls die praktische Selbstständigkeit der Zöglinge. Sie sollen gesellschaftliche Gegebenheiten nicht als festgeschrieben betrachten, sondern versuchen diese aktiv mitzugestalten und zu verändern. Den Heranwachsenden muss bewusst werden, dass sie nicht von der Vorsorge anderer abhängig sind (vgl. Koller, 2014, S. 36 ff.). Vielmehr müssen sie den Mut haben „von [ihrer] Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen“ (Kant, 1784, zit. n. Koller, 2014, S. 38). Zugleich spricht sich Kant jedoch auch für die Notwendigkeit des erzieherischen Zwanges aus, da „der Zögling tun muß [sic], was ihm vorgeschrieben wird, weil er nicht selbst urteilen kann, und die bloße Fähigkeit der Nachahmung noch in ihm fort dauert“, der Zögling „[muss tun,] was andere wollen, wenn er will, daß [sic] andere ihm wieder etwas zu Gefallen tun sollen“ und weil er „den unvermeidbaren Widerstand der Gesellschaft fühlen müsse, da er nur so die Schwierigkeit kennen lernen könne, sich selbst zu erhalten, zu entbehren, und zu erwerben, um unabhängig zu sein“ (Kant, 1784, zit. n. Koller, 2014, S. 39 ff.). Durch den Zwang entsteht eine Einschränkung der Freiheit, die Kant wie folgt rechtfertigt: „Man müsse [...] dem Kind beweisen, daß [sic] man ihm einen Zwang auferlegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit führt, daß [sic] man es kultiviere, damit es einst frei sein können“ (Kant, 1784, zit. n. Koller, 2014, S. 40). Erziehung wird demnach als Aneignung vorherrschender gesellschaftlicher Regeln und Normen unter Zuhilfenahme von Zwängen und Freiheiten verstanden, sodass der Zögling auf das Leben in der gegenwärtigen Welt vorbereitet und bei der Findung der individuellen Bestimmung unterstützt wird.
Der folgende Abschnitt thematisiert elterliche Erziehungsstile. Als Erziehungsstil wird die Konstellation aus elterlichen Einstellungen, Handlungsweisen und Ausdrucksformen beschrieben, die das Klima der Eltern-Kind-Interaktion über eine Vielzahl von Situationen bestimmt. Der autoritative, der autoritäre und der permissive Erziehungsstil haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Fach- und Elternliteratur durchgesetzt und gelten im Wesentlichen als am meisten verbreitete Erziehungsstile.
Eltern, die den autoritativen Erziehungsstil praktizieren, stellen Anforderungen an ihre Kinder und erwarten die Einhaltung von Regeln. Im Gegenzug öffnen sie sich ihren Kindern, zeigen Interesse und betrachten diese als ernstzunehmende Gesprächspartner, wodurch autoritative Eltern ihre Kinder ermutigen ihren eigenen Standpunkt zu suchen und selbstständig zu werden.
Autoritäre Eltern fordern ebenfalls die Einhaltung von Regeln, wobei sie jedoch auf die Begründung dieser verzichten und strikten Gehorsam verlangen. Im Falle einer Missachtung der Vorschriften und Regeln werden die Kinder oftmals körperlich bestraft. Zudem zeigen autoritäre Eltern nur sehr geringes Interesse an den Handlungen und Absichten ihres Kindes, sodass das Klima der Eltern-Kind-Interaktion als kalt und feindselig beschrieben wird (vgl. Myers, 2014, S. 756). „Die Befolgung von Regeln und Normen sowie die Achtung der elterlichen Autorität werden von ihnen als ein eigenständiger Wert gesehen - es geht ihnen also um die psychologische Kontrolle (im Unterschied zur Handlungskontrolle bei den autoritativen Eltern)“ (Myers, 2014, S. 756).
Der permissive Erziehungsstil wird vor allem durch die Zurückhaltung der Eltern hinsichtlich der Regeln und Anforderungen gekennzeichnet. Im Vergleich zum autoritativen oder zum autoritären Erziehungsstil stellen die Eltern hier weniger Anforderungen an ihre Kinder und erlauben diesen weitaus mehr. So können die Kinder ihren Impulsen nachgehen und ihr Verhalten selbst steuern. Permissive Eltern versuchen möglichst wenig zu reglementieren, zu lenken sowie zu kontrollieren, wodurch die Selbstständigkeit der Kinder im Vordergrund steht (vgl. Myers, 2014, S. 756).
„In einer Vielzahl von Untersuchungen hat sich der autoritative Erziehungsstil als überlegen erwiesen“ (Myers, 2014, S. 759). Grund hierfür ist die bestimmte, aber nicht restriktive Kontrolle, die den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt ein Gleichgewicht zwischen der Notwenigkeit von Regeln und der Autonomie sowie der Entfaltung des eigenen Denkens zu finden. Die Eltern schaffen eine Umwelt, in welcher ihre Kinder durch positive Rückmeldungen Erfolge verzeichnen und aktiv zum Aufbau der erlebten Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens beitragen. Desweitern fördert die autoritative Erziehung die psychologisch gesunde Entwicklung des Kindes und stellt einen Schutzfaktor gegen Verhaltensprobleme jeglicher Art dar. Das ausgewogene Verhältnis von Regeln und Freiheiten gilt als besonders günstiger Erziehungsstil für die Kindesentwicklung.
Der universelle Anspruch der einzelnen Erziehungsstile wurde jedoch aufgrund der kulturellen Unterschiede widerlegt. Erziehung ist ein Teil des kulturellen Vermittlungsprozesses und äußert sich vor allem durch unterschiedliche Wertesysteme, die Sprache sowie die Religion und die vorherrschenden Verhaltensregeln (vgl. Myers, 2014, S. 759 ff.). Beispielsweise haben „Kontrolle und Gehorsam [...] im Rahmen des konfuzianischen Wertesystems, für Familien aus Ostasien eine völlig andere Bedeutung als im Westen“ (Myers, 2014, S. 760). Demnach variieren Erziehung sowie der Einfluss der Erziehungsstile abhängig vom sozialen und kulturellen Milieu, in welches die Familie eingebunden ist. Die kulturellen Besonderheiten der Erziehung gilt es im Verlauf dieser Arbeit hinsichtlich der binationalen und monokulturellen Familien zu berücksichtigen.
2.3. Bedeutung von Fähigkeiten und Kompetenzen
Durch die elterliche Erziehung und Unterstützung zur Selbstständigkeit erlangen Kinder und Jugendliche eine Ich-Identität, die vor allem im multikulturellen Rahmen für das Zusammenleben und in Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen sozialen und ethnischen Anforderungen und Verhaltensweisen in allen Lebensbereichen notwendig ist. Die Ich-Identität unterliegt weder festgelegten Identifikationen noch stabilen Selbstbildern oder konkretisierten Rollenverhältnissen (vgl. Khounani, 2000, S. 41), sondern entwickelt sich in wechselnden sozialen Situationen zu einer „angemessenen Selbstrepräsentation, die Diskrepanzen und Konflikte nicht verleugnet und [sich] doch immer wieder auf Verständigung mit stufenweise immer mehr Partnern orientiert“ (Khounani, 2000, S. 41). Demnach gilt die Identität als Auf- und Ausbau einer ausgeglichenen Persönlichkeit, welche sich in Wechselwirkung mit zwischenmenschlichen Beziehungen und der sozialen Umwelt ständig neu erfindet. Um die Ich-Identität dauerhaft zu fördern sind Grundfähigkeiten des kommunikativen Handelns unabdingbar, wodurch der interkulturellen Kompetenz und die Fähigkeiten von Empathie, Rollendistanz, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz sowie Identitätsdarstellung hinsichtlich der Interaktion binnen der multinationalen Gesellschaft eine große Bedeutung zukommt.
„Interkulturelle Kompetenz umfasst kognitive Kompetenzen und Handlungskompetenzen“ (Gündogdu & Zenk, 2011, S. 18; Hervorhebungen modifiziert, L.W.), wobei kognitive Kompetenzen durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und das Verständnis für fremdkulturelle Verhaltensmuster gekennzeichnet wird, während die Handlungskompetenz als praktische Umsetzung des erlangten Wissens gilt.
Die kognitive Kompetenz umfasst unter anderem Kenntnisse über die Herkunftsgesellschaften, Sprachen und Ursachen von Migration und deren Folgen, den rechtlichen, politischen und sozialen Status der Migranten, Formen und Ursachen der Vorurteilsbereitschaft und Rassismus sowie Methoden des interkulturellen Lernens und der antirassistischen Arbeit. Hinzu kommt Wissen über die verschiedenen Religionen, die Heterogenität der Einwanderungsgruppen und deren Schichtung sowie die Kulturdimensionen, die die menschlichen Haltungen und Verhaltensweisen beeinflussen. Zum Beispiel gilt der Individualismus in westlichen industrialisierten Gesellschaften, vor allem in Nordeuropa oder -amerika, als vorherrschende Kulturdimension. Hier steht das „Ich“ im Mittelpunkt. Individuelle Interessen und Meinungen stehen über den Ansichten der Gruppe, Sachbezüge dominieren gegenüber der Beziehungsorientierung und das Individuum strebt nach Selbstständigkeit. Anders sieht es in Südeuropa, Lateinamerika und im Mittleren Osten aus: Dort ist das Augenmerk der vorherrschenden Kulturdimension auf den Kollektivismus gerichtet. Die Gruppe, z. B. die Familie, nimmt hierbei einen hohen Stellenwert ein, da diese mit Schutz, Loyalität und Harmonie verbunden wird. Gruppenzugehörigkeit und kollektive Interessen werden meist vor persönliche Belange gestellt (vgl. Gündogdu & Zenk, 2011, S. 18).
Die Handlungskompetenz zeigt sich im Umgang und im individuellen Verhalten innerhalb der Migrationsgesellschaft. Vor allem „Sensibilität und Offenheit für anderen Kulturen, Sitten und Gebräuche unter dem Aspekt der Gleichwertigkeit“ (Gün- dogdu & Zenk, 2011, S. 19) sind von großer Bedeutung. Hinzu kommen Beziehungsaufbau zu unterschiedlichen sozialen Gruppen sowie Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit im Dialog mit Fremden. Handlungskompetenz äußert sich auch durch die Schaffung von Erlebnis- und Begegnungsräumen, der Entwicklung und Durchführung von integrationsfördernden Handlungssituationen, Sprachförderung, interreligiöse Dialoge, in der Umsetzung eines interkulturellen Leitbildes und besonders im Entgegenwirken von wahrgenommener Diskriminierung (vgl. Gündogdu & Zenk, 2011, S. 19 ff).
Interkulturelle Kompetenz ist demnach die Fähigkeit, sich mit der eigenen sowie der fremden Kultur auseinanderzusetzen, Differenzen zu erkennen und diesen, durch die persönliche Einstellung sowie eigene Handlungen, respekt- und verständnisvoll zu begegnen.
Empathie wird als Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Erwartungen von Interaktionspartnern einzufühlen, beschrieben. Hierbei werden affektiv-motivationale und kognitive Strukturen beteiligt und ermöglichen die Erfassung der Interessen, der Absichten und der Bedürfnisse des Interaktionspartners, welche wiederum im eigenen Handeln berücksichtigt werden können. Durch den Vorgang des Einfühlens und der Anpassung wird deutlich, dass der Akteur in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Situationen die Rolle seines Gegenübers übernimmt und somit die Fähigkeit zur sozialen Sensibilität besitzt. Ungenügende Empathiefähigkeit gilt hingegen als Auslöser für Stereotypbildung, Vorurteile und Intoleranz (vgl. Khounani, 2000, S. 42).
Die Rollendistanz ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechseln und zur kulturellen und sozialen Selbstwahrnehmung. „Der [Akteur] begegnet dem [Migranten] als Individuum mit subjektiven Wahrnehmungen und beschreibt seine Rolle unabhängig von seiner sozio-kulturellen Herkunft. Er vermeidet es zu verallgemeinern, zu kategorisieren und zu kulturalisieren“ (Gündogdu & Zenk, 2011, S. 20). Erfolgreiches Rollenverhalten kennzeichnet sich demnach durch die Entwicklung der Distanz zu den jeweiligen Erwartungen, die der Akteur gegenüber seinem Interaktionspartner empfindet und diese entsprechend auswählen, negieren und modifizieren kann.
Als Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz bezeichnet man die Fähigkeit von Interagierenden, die Interaktion trotz Diskrepanzen oder Konflikten weiterzuführen. Das aus unvereinbaren Gegensätzen und Mehrdeutigkeiten entstandene Spannungsfeld gilt es auszuhalten und psychosozial handlungsfähig zu bleiben, auch wenn die Interaktion keine vollständige Bedürfnisbefriedigung hinsichtlich der eigenen Normen, Interessen und Verhaltenserwartungen bietet. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den persönlichen Rollenvorstellungen und denen des Gegenübers herzustellen.
Die Fähigkeit, die eigene Identität mittels gemeinsamer kulturspezifischer Kommunikations- und Symbolsysteme im Rahmen einer Interaktion einzubringen bezeichnet man als Identitätsdarstellung. Hierbei werden die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse entsprechend dargestellt und durchgesetzt. Die Fähigkeit, die eigene Identität binnen einer Interaktion zu präsentieren, steht in Abhängigkeit der sprachlichen Möglichkeiten. Auf diese Weise wird die Identität nicht nur subjektiv erlebt, sondern objektiv gelebt (vgl. Khounani, 2000, S. 43 ff). „Verfügt beispielsweise der ausländische Elternteil über eine weitgehende reduzierte Sprachmöglichkeit, so hat er im gleichen Maße zum einen weniger Chance, im familiären Feld über Sprache seine soziokulturellen Bedürfnisse und Sichtweisen zu artikulieren und Berücksichtigung zu finden, wie auch weniger Chancen, an sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Vorgängen aktiv teilzunehmen“ (Khounani, 2000, S. 47). Sprache gilt demnach als unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an Interaktion und für die Entwicklung der Ich-Identität (vgl. Khounani, 2000, S. 47).
Insgesamt gelten die beschrieben Kompetenzen und Fähigkeiten als Bestandteil der Identität und fördern das Verständnis für Haltungen und Verhaltensweisen des jeweiligen Interaktionspartners. Das Individuum lernt über die Grenzen der eigenen Erwartungen, Normen und Interessen hinauszuschauen und so offen und tolerant für Fremdes zu sein.
[...]
- Arbeit zitieren
- Linda Wieczorek (Autor:in), 2018, Erziehung in binationalen Familien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951123
Kostenlos Autor werden





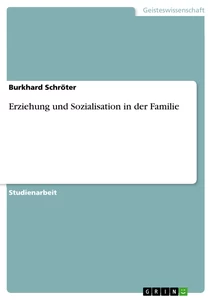




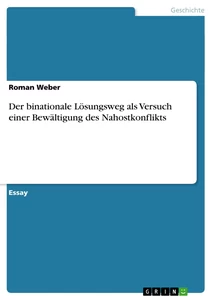









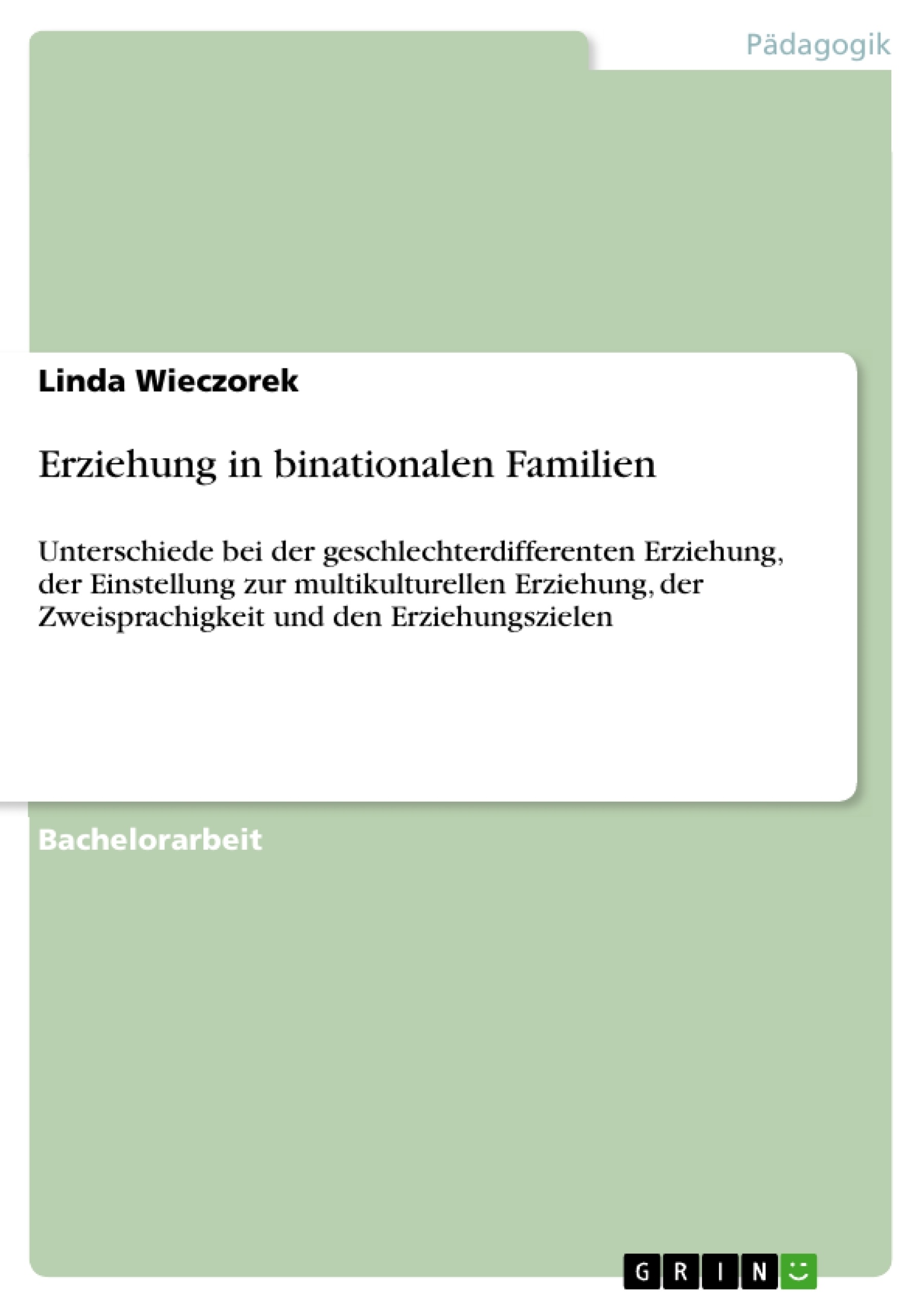

Kommentare