Leseprobe
Inhalt
0 Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ruanda
3 Kongo-Kinshasa
4 Kongo-Brazzaville
5 Ausblick
6 Literaturverzeichnis
6. 1 Monographien, Aufsätze in Sammelbänden und Fachzeitschriften
6.2 Zeitungsartikel (ohne Autorenangabe)
1 Einleitung
Für Ansprenger (1999: 7-9) stellt der Kongokonflikt einen „Einschnitt“ in der afrikanischen Geschichte dar, da hier ein afrikanisches Land direkt militärisch Einfluss auf ein anderes nimmt, was bis dato die seltene Ausnahme darstellte und sich auch dann eher in Form von Grenzkonflikten begrenzte.
Ebenfalls neu ist die hohe Zahl der involvierten Staaten: Kongo-Kinshasa, KongoBrazzaville, Zentralafrika, Uganda, Ruanda, Burundi, Angola, Simbabwe und Namibia.
Das theoretische Rüstzeug, welches uns als Studenten der Internationalen Beziehungen zur Verfügung steht, stammt zu einem überwiegenden Teil noch aus der Zeit des Ost - West - Konflikts. Als vorherrschendes Paradigma gilt immer noch der Realismus bzw. seine Weiterentwicklung in Form des Neorealismus. Dessen entscheidende Implikation besteht in der These der systeminduzierten Balance-of-Power, welche den primären Ordnungseffekt in anarchischen Systemen ausmacht. (Waltz 1979: 102-128)
Tatsächlich war diesem Konzept während der bipolaren Weltordnung einige Erklärungskraft nicht abzusprechen. Auch in Afrika, welches in der Zeit des Ringens zweier Supermächte, verschärft durch die über allen schwebende Option des nuklearen Holocausts, nur die Rolle eines Nebenschauplatzes zukam, fand in diesem Zeitraum eine Allianzbildung entsprechend des globalen Gesamtkonflikts statt. Die afrikanischen Länder waren in nahezu jedem Fall ziemlich klar der einen oder anderen Seite zuzuordnen.
Mit dem Ende des Ost - West - Konflikts verschwand auch für Afrika quasi über Nacht das ordnende Koordinatensystem. Dies scheint eine neue Welle der, jetzt ungeordneteren, Gewalt nach sich gezogen zu haben. Das Resultat war ein in Europa aufziehender „Afro- Pessimismus“. (Ansprenger 1999: 7)
Zugleich ist auch dem gesamten Bereich der Internationalen Beziehungen der Boden unter den Füßen weggezogen worden, was sich in einer weitzersplitterten Theoriendebatte in den letzten zehn Jahren äußert. Auch die Kriegstheorie ist in diesen Strudel geraten. Da eine elegante deduktive Großtheorie auf Basis einer starken Reduktion von Komplexität à la Waltz immer weniger in der Lage scheint die zunehmend vielschichtigeren Interaktionen und deren Kausalitäten zwischen den differenzierten sozialen Systemen unseres Globus zu fassen, bewegt sich der Trend immer mehr in Richtung eines datenorientierten induktiven Erklärungsansatzes. Aber auch dieser Ansatz muss allerdings aufgrund der mit ihm verbundenen infiniten Variablenproliferation (Waltz 1979: 67-9) in seinem Erklärungspotential begrenzt bleiben. (zum Forschungsstand siehe: Schlichte 1996: 12-59)
Nichtsdestotrotz wird diese Arbeit einem akteurszentrierten Ansatz folgen und nicht zuletzt aufgrund ihres Rahmens im wesentlichen eine systematisierte Darstellung der Einzelereignisse des Konflikts im Gebiet der Großen Seen Afrikas bieten.
Gerade in Hinblick auf die gerade kurz angerissene methodische Problematik, kann die Darstellung der Ereignisse keinesfalls eine vollständige sein (wahrscheinlich wäre in ganz Deutschland für ein solches Projekt nicht genügend Papier vorhanden), was aber diese Arbeit keinesfalls von dem Anspruch befreit, durch die Darstellung und Kontextuierung der Schlüsselereignisse ein möglichst hohes Maß an Stimmigkeit und Ergiebigkeit zu erzielen.
Aus diesem Grunde werden die drei Kriegsschauplätze getrennt nacheinander dargestellt, wobei gerade durch die Auswahl der Reihenfolge eine möglichst prägnante Darstellung der zahlreich vorhandenen Schnittstellen gewährleistet werden soll.
In allen drei Teilen wird der Einstieg im wesentlichen mit der Unabhängigkeit beginnen. Im Anschluss soll das in allen drei Fällen entstandene Ein-Parteien-Regime unter Hervorhebung der jeweiligen spezifischen Merkmale zum Gegenstand der Betrachtung werden. Wiederum allen drei Ländern ist der Zerfall „ihres“ Einparteiensystems in Folge des Endes des Ost - West - Konfliktes gemeinsam. Die damit verbundene Destabilisierung, welche auf die sich uns noch heute präsentierenden desolaten Situation in der Region hinausläuft, soll den dritten Teil der jeweiligen Darstellung ausmachen.
Im Falle Ruandas wurde aus Platzgründen auf eine Darstellung des internationalen Gerichtshofs und seiner Tätigkeit verzichtet, da dies nur sekundär die Entwicklung des Konflikts beeinflusst.
Der Hutu-Tutsi-Antagonismus wird am Beispiel Ruandas dargestellt werden. Obwohl die Bedeutung dieses ethnischen Konflikts für den Krieg im Gebiet der Großen Seen umstritten ist (vgl. Schlichte 1996: 227-8), ist ihm doch eine entscheidende Bedeutung für zumindest das Verständnis nicht abzusprechen.
Den Schluss wird ein Ausblick bilden, der verschiedene Perspektiven aufzeigen soll.
Die Literaturlage zum Thema Ruanda kann als sehr gut bezeichnet werden, dasselbe trifft mit Abstrichen auch auf Kongo-Zaïre zu. Die Recherchen zu Kongo-Brazzaville hingegen blieben doch recht unergiebig, so dass besonders für die letzte Zeit kaum Material gefunden werden konnte. Aus diesem Grund baut die Darstellung in diesem Teil ausschließlich auf der Chronik des ‚Internationalen Afrikaforums’ auf.
2 Ruanda
Der Konflikt, welcher Ruanda in den letzten Jahrzehnten prägte und welcher 1994 in dem erschreckenden Völkermord seinen Höhepunkt fand, ist als langwierige Entwicklung zu betrachten, die entscheidend durch die Kolonisation mitgeprägt wurde, und dessen Ursachen bis heute bestehen und wahrscheinlich das Haupthindernis für eine Demokratisierung darstellen.
Die Darstellung der Medien, die in den westlichen Staaten die öffentliche Meinung maßgeblich bilden, war in diesem Fall klar. Der Völkermord war in dieser Sichtweise das Ergebnis eines jahrhundertlang schwelenden Konfliktes zwischen Hutu und Tutsi, zweier unterschiedlicher Volksgruppen, welche durch konkrete Umstände anlässlich aber nicht ursächlich ausgelöst worden sind. (Neubert/ Brandstetter 1996: 96)
Diese Ansicht lässt sich bei näherer Betrachtung der Literaturlage nicht halten. Vielmehr ist die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi sehr komplex. (vgl. hierzu: Strizek 1996: 40-74) Vereinfacht kann man sagen, dass es sich eher um eine soziale als um eine ethnische Unterscheidung handelt. So leben beide Gruppen seit langem in den gleichen Regionen, haben eine gleiche Sprache und üben dieselbe Religion aus, welche aber regional unterschiedlich sein kann. Somit fehlen primäre Faktoren für eine ethnische Abgrenzung. (Neubert/ Brandstetter 1996: 96) Im Gegenteil war das vorkoloniale Ruanda, als autokratische Monarchie, ein recht einheitlicher Staat, geprägt von einem für afrikanische Verhältnisse sehr hohen Maß an Homogenität in Hinsicht auf Faktoren wie Sprache, Sitten und Gebräuche, Kultur sowie der wirtschaftlichen Zustände. (Reif 1996: 82)
Die Einordnung erfolgte vielmehr erst durch die Kolonialherren, denen sich zwar eine segmentierte Gesellschaft darbot, deren Segmentierung aber nicht auf ethnischen, sondern vielmehr auf wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten basierte. So wurde bei Volkszählungen der Belgier 1933 und 1934 einfach jeder, der mehr als zehn Stück Vieh besaß, zu den Tutsi gezählt, jeder andere hingegen den Hutu zugeordnet. (Marx 1997: 68)
Nichtsdestotrotz gab es diese Klassen in der ruandischen Gesellschaft bis zur Unabhängigkeit, wobei Tutsi diejenigen waren, „welche sich die Macht angeeignet hatten, und eben nicht Angehörige einer bestimmten Ethnie oder Rasse.“ Zwischen diesen beiden Klassen bestand aber durchaus die Möglichkeit der sozialen Mobilität. (Neubert/ Brandstetter 1996: 97)
Die ruandische Gesellschaft ist also von einem Zweiklassensystem geprägt, dessen herrschender Klasse - den Tutsi - natürlicherweise einer sehr viel größeren Klasse Beherrschter - die Hutu - gegenüberstand.1
Diese Unterscheidung, die wesentlich also erst durch die Europäer geprägt wurde, erfuhr aber von den Betroffenen eine so starke Rezeption, dass sie nun von ihnen im immer stärker zunehmenden Maße politisch instrumentalisiert wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kritisierten gebildete Hutu die Privilegierung der Tutsi und forderten Gleichberechtigung. Zugleich richtete sich der Unmut über das Kolonialsystem gegen die von Tutsi geführte Verwaltung. Dabei machten auch die Intellektuellen die ethnische Interpretation der ruandischen Gesellschaft zu einem zentralen Element ihres politischen Denkens. (Neubert/ Brandstetter 1996: 97)
So kam es dann 1959 zu den ersten gewalttätigen Übergriffen der Hutu gegenüber den Tutsi, infolgedessen zahlreiche Tutsi in die Nachbarländer, vor allem nach Uganda, Burundi und Zaïre, flohen. Zu diesem Zeitpunkt war der Prozess der Ethnogenese perfekt. Die ethnische Einteilung, die eigentlich den Machtanspruch der Tutsi manifestieren sollte, wurde nun gegen sie gewandt und seinerseits als Begründung für die Revolution gebraucht, in deren unblutigen Verlauf der Tutsikönig abgesetzt und eine republikanische Ordnung errichtet wurde. Diese Ordnung stand unter der Führung einer Hutupartei, der Parmehutu (Parti du Mouvement d’Emancipation Hutu), welche Ruanda in die Unabhängigkeit führte und der es gelang bei den ersten Wahlen 1962 ein Ergebnis von 77,7% zu erzielen. In den folgenden Wahlen erfreute sich die Parmehutu immer stärkeren Zuspruchs, was zu einer Auflösung anderer Parteien und politischer Organisationen führte und sich somit de facto ein Einparteiensystem etablierte.
Nachdem 1973 wieder ethnische Unruhen aufgeflammt waren, putschte der General Habyarimana wiederum unblutig und löste die Parmehutu und das Parlament auf. 1975 wurde durch ihn die MRND (Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement) gegründet, welcher jeder Ruander von Geburt an angehörte. Auf diesem Wege entstand ein klassisches Einparteiensystem. (Reiff 1996: 83)
In diesem autokratischen Regime spielte ein Proporzsystem eine wichtige Rolle, durch welches die Administration ethnisch gerecht ausgeübt werden sollte. Zu diesem Zweck wurde die ethnische Zugehörigkeit sogar in die Ausweispapiere eingetragen. Trotzdem gelangten keine Tutsi in gesellschaftliche Führungspositionen. (Neubert/ Brandstetter 1996: 98)
Unter der Herrschaft Habyarimanas konnten zwar die ethnischen Konflikte im Zaum gehalten werden, stattdessen traten aber wirtschaftliche Probleme immer stärker in den Vordergrund.
Die Entwicklungspolitik setzte voll auf die Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors, was auch zu einer gewissen Wohlstandszunahme in den 70iger Jahren führte. Mitte der 80iger war diese Entwicklung jedoch an einer Grenze angekommen, da das Land knapp und der Boden ausgelaugt wurde. Wegen der ständigen ethnischen Spannungen floh zudem ständig eine recht hohe Zahl von Tutsi aus dem Land. Die Zahl der Flüchtlinge schwankt zwischen 400.000 und 550.000 bis zum Jahr 1990.
Das politische System in Ruanda funktionierte in diesen Jahren nach dem Patron-Klientel- Prinzip, dem zufolge man politische Folgsamkeit von wirtschaftlichen Gegenleistungen abhängig macht. Dieses System ist wenig leistungsfähig und erfordert zudem einen immer höheren finanziellen Input. Gerade als die westlichen Geberländer ihre finanzielle Unterstützung nach dem Ende des Kalten Krieges zunehmend von Demokratisierungsbemühungen abhängig machten, ging dem Staatsapparat immer mehr die Fähigkeit verloren, eben diesen finanziellen Input aufzubringen. Ein weiterer ungünstiger Aspekt dieses Verteilungssystems lag in der Bevorzugung bestimmter Regionen sowie der Benachteiligung anderer, je nach persönlicher Zuneigung oder Abneigung zwischen Patron und Klientel. (Neubert/ Brandstetter 1996: 98-100)
Zusätzlich zu diesen internen Problemen kam dann noch der Angriff der FPR (Front Patriotique Rwandais) am 1. Oktober 1990. Die FPR war eine stark militärisch geprägte Organisation von Exiltutsi aus Uganda, welche hauptsächlich die Forderung nach Rückkehr der Flüchtlinge stellten, welche sich zum Teil bereits seit Jahrzehnten in den Nachbarländern aufhielten. Es gab zu diesem Thema zwar bereits seit Jahren Verhandlungen mit dem ruandischen Staatschef, diese waren aber immer ergebnislos geblieben. (Reiff 1996: 88)
Anfang der neunziger Jahre findet sich also in Ruanda ein Konfliktpotential, welches sich in sechs Punkten umreißen lässt:
(1) soziale Probleme auf dem Lande
(2) regionale Spannungen
(3) Kämpfe innerhalb der Machtelite
(4) erzwungene Demokratisierung von außen
(5) Druck zur Wiederaufnahme der Flüchtlinge
(6) militärische Bedrohung durch die FPR (zit. n.: Neubert/ Brandstetter 1996: 100)
Die einzig positiven Aspekte sind zum einen die mit der Aufrüstung verbundene Möglichkeit der Integration junger Männer in die Armee und somit in den Staatsapparat sowie zum anderen die Tatsache, dass der Angriff von der Bevölkerung mehrheitlich nicht als Befreiungsversuch sondern als Bedrohung wahrgenommen wurde.
Diese Tatsachen begründen zwar einen Bürgerkrieg, scheinen aber nicht ausreichend zu erklären warum es 1994 zu einem derartigen Massaker kommen konnte. Hierbei spielt ein weiterer Erklärungsansatz eine Rolle, welcher der Frage nachgeht wie die entstandene Gewalt organisiert war. Habyarimana hatte bereits 1990 unter dem Einfluss des Frankophoniegipfels in La Baule, wo der damalige französische Präsident Mitterand Demokratie gefordert hatte, eine recht weitgehende Pressefreiheit eingeführt. Da dies erstmalig in Ruanda der Fall war, wurde die Medienlandschaft vor allem durch Hetze und Radikalität bestimmt. Gemäßigte Stimmen gingen schlicht unter. Zugleich mit der Pressefreiheit war die Organisationsfreiheit etabliert worden. Deren wichtigstes Resultat war die Gründung der CDR (Coalition pour la Défense de la République) einer radikalen Hutupartei, welche als Reaktion auf den Angriff der FPR im Norden unter zu Hilfenahme der neuen Presse eine radikale Anti-Tutsi-Stimmung heraufbeschwor. Da diese Terminologie auch vom alten Regime benutzt worden war, fand diese Meinungsmache bei weiten Teilen der Bevölkerung ein offenes Ohr.
Als dann am 6. April 1994 das Flugzeug des Präsidenten, wahrscheinlich durch einen Abschuss, abstürzte und dieser dabei zu Tode kam, war das von radikaler politischer Propaganda aufgeheizte und von tiefen sozialen Spannungen zerrüttete Land plötzlich führungslos. Dieses Machtvakuum führte in die Katastrophe. (Reiff 1996: 90)
Bereits seit 1991 verzeichnete Ruanda eine Zunahme der politischen Gewalt ohne dass es eine juristische Verfolgung gab. Die Hemmschwelle für politisch motivierte Verbrechen war also bereits weit herabgesunken. Während sich die zahlreichen gemäßigteren politischen Parteien noch über die zu ergreifenden Schritte stritten, schritten CDR und MRND zur Tat. Bereits im Vorfeld waren unter Ausnutzung der landesweiten Infrastruktur der ehemaligen Einheitspartei gewaltbereite Parteimilizen gegründet worden. Diese schreiten zur Tat und töten wahllos Tutsi und solche Hutu, die für Gegner des Regimes gehalten wurden. Neben diesen Parteimilizen zogen sowohl reguläre Armeetruppen Mordlisten abarbeitend durchs Land, als auch Jugendbanden, die im entstandenen Chaos morden und plündern.
Die Übergriffe waren von absoluter Risikolosigkeit gekennzeichnet, da es keine Ordnungsmacht gab und die Opfer zu keiner einheitlichen Gegenwehr in der Lage waren, weil sie sich schlicht nicht als zusammengehörige Gruppe empfanden.
Die Zahl der Opfer dieser Ausschreitungen wird unterschiedlich angegeben, dürfte aber wohl zwischen 500.000 und 1.000.000 liegen. Hinzu kommen noch etwa 2.500.000 Flüchtlinge. Beides ist in Relation zu 7.500.000 Einwohnern, die Ruanda vor dem Konflikt hatte doch als sehr beträchtlich einzuschätzen. (Neubert/ Brandstetter 1996: 96, 101-3)
Sie töteten, töteten und töteten, bis sie vom Töten müde geworden. Das Blut spritzte, floss am Boden als rote Schlammasse. Es waren so viele Leichen, dass du die deines eigenen Sohnes nicht hättest herausangeln können. Am Abend gingen sie dann nach Hause.
- Zayasi Kanamugere, Überlebender des Massakers in der Kirche von Gishamvu am 16. Mai 1994 (zit. nach: Marx 1997: 3)
Im Verlauf der Massaker erringt aber die FPR einen militärischen Sieg und errichtet ein tutsidominiertes Regime. Die Gewalttaten können nur durch eine französische Militärintervention zumindestens eingedämmt werden, in deren Verlauf ab dem 5. Juli 1994 im Süden des Landes eine Sicherheitszone errichtet wird. Trotzdem bleiben zahlreiche Flüchtlinge in Zaïre zurück und mit ihnen die Hutumilizen sowie große Teile der geschlagenen ruandischen Armee. Diese Truppenteile bleiben in Verbindung mit sehr unstabilen politischen Verhältnissen in Ruanda ein enormes Konfliktpotential, welches eine bedeutende Rolle im kommenden kongolesischen Bürgerkrieg spielen wird.
Im Zuge der vollständigen Eroberung Ruandas durch die FPR gibt es einen weiteren Massenexodus nach Zaïre. Zwischen dem 14. und 18. Juli verlassen 1.200.000 Menschen Ruanda in Richtung Goma, wo zu einem schwerwiegenden Flüchtlingselend kommt. In Ruanda bildet die siegreiche FPR eine Regierung unter Pasteur Bizimungu. Unter den Regierungsmitgliedern kommt dem Verteidigungsminister Paul Kagame eine herausgehobene Rolle zu. Indem er gleichzeitig Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Vizepräsident wird, erwächst ihm die Rolle des „starken Mannes“ im Hintergrund. (Marx 1997: 167-8)
3 Kongo-Kinshasa
Die belgische Kolonie Zaïre wurde am 1. Juli 1960 unabhängig. Es sollte, so entschied das neugewählte Parlament, von einer Doppelspitze aus Präsident Kasavubu und Premierminister Lumumba regiert werden. Beide vertraten unterschiedliche politische Richtungen; so stand der erstere eher für einen föderalistischen Kurs, während der letztere eher zentralistische Ambitionen verfolgte. Bereits an diesem Punkt kommt Joseph-Désiré Mobutu eine wichtige Rolle in der Staatsführung als Parteigänger Lumumbas zu. Als es zu Streitigkeiten mit der belgischen Regierung kam, welche militärisch immer noch vor Ort präsent war, riefen Kasavubu und Lumumba die Vereinten Nationen zur Hilfe. (Gaud 1997: 68)
Die UNO verabschiedete eine Resolution, derzufolge die belgischen Truppen das Land zu verlassen hätten und sandten Blauhelmtruppen zur Überprüfung ihrer Durchführung. Im Zuge der Unabhängigkeit kam es zu zahlreichen lokalen militärischen Konflikten, in denen lokale Machtansprüche diverser Volksgruppen zum Ausdruck kamen. Diese Konflikte sollten ebenfalls die Blauhelme zugunsten der Zentralregierung lösen, was diese aber mit dem Hinweis auf den Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten ablehnten. Eine Region des Landes, Katanga, hatte die eigene Unabhängigkeit erklärt, die die UNO zwar nicht anerkannte, welche sie aber zu unterbinden militärisch nicht in der Lage war. So versuchte sie einerseits als Puffer zu wirken, führte aber andererseits auch Verhandlungen mit dem Präsidenten der abtrünnigen Region Moise Tschombé. In dieser Phase kam es zu einer aktiven Intervention der Sowjetunion auf Seiten Lumumbas, um die belgischen Truppen aus dem Kongo zu vertreiben und den ihr nahestehenden Lumumba an der Macht zu halten. Die Krise eskalierte bis schließlich Kasavubu am 1. August 1961 eine neue Regierung ernannte und sich mit allen Konfliktparteien traf. So wurde eine Entspannung erreicht, welche die Fortsetzung der UN-Mission bis zum 30. Juni 1964 ermöglichte. (Keil/ Lobner 1994: 31-40)
Etwas mehr als ein Jahr später stürzte Mobutu am 24. November 1965 den Präsidenten Kasavubu und ernannte sich selbst zum Präsidenten auf Zeit (5 Jahre) sowie den Offizier Mulamba zum Regierungschef. Dies stellte den Beginn der zweiten kongolesischen Republik dar. (Gaud 1997: 70)
Mit diesem Tag begann die jahrzehntelange Schreckensherrschaft Mobutus über Zaïre, welches durch ihn zugunsten der finanziellen Bereicherung einer kleinen Regierungsclique wirtschaftlich ausgebeutet wurde. Das Land ist an sich reich an Bodenschätzen und hatte somit einige strategische Bedeutung während des Kalten Krieges. Mobutu war in den Augen des Westens ein Stabilitätsfaktor, der im großen und ganzen der roten Versuchung des Ostens widerstand und somit gestützt wurde, trotz der doch sehr zweifelhaften Menschenrechtspolitik im eigenen Land. Zusätzlich zu seiner Bedeutung als Rohstofflieferant, schon das Uran für die erste Atombombe stammte aus Belgisch-Kongo, erlangte das neue Zaïre einige Bedeutung durch seine strategische Lage, die es dem Westen ermöglichte von hier aus den sowjetischen Einfluss in Angola und Mosambik zu bekämpfen. Mobutu wurde also feste Größe der amerikanischen Containmentpolitik. (Strizek 1999: 57)
Mit dem Ende des Kalten Krieges begann nun auch Mobutu, wie sein ruandischer Kollege, die neue Politik des Westens zu spüren, welcher nun frei von geostrategischen Zwängen seine Entwicklungshilfepolitik neu überdachte und von Demokratisierung abhängig machte. So sah sich der Autokrat gezwungen zumindest einige halbherzige Demokratisierungsschritte zu unternehmen, allerdings immer unter der Prämisse, das Heft des Handelns nicht allzu sehr aus der Hand zu geben. So führte er am 24. April 1990 das Mehrparteiensystem ein und versammelte am 7. August des selben Jahres eine Nationalkonferenz nicht ohne allerdings vorher virtuelle Oppositionsparteien zu gründen, welche in Wahrheit durch ihn selbst ferngesteuert wurden. Trotzdem wählte die Nationalkonferenz einen echten Oppositionellen zum Premierminister: Etienne Tshisekedi, welcher aber durch den wahren Herrn Mobutu sogleich unter Hausarrest gestellt wurde. Der resultierende Machtkampf war besonders für die Zivilbevölkerung überaus blutig. (Ansprenger 1999: 165-6)
Trotz aller Bemühungen seine Machtposition zu erhalten, schmolz der Einfluss Mobutus zusehends dahin, als im Laufe der 90iger Jahre die finanziellen Mittel des Westens mehr und mehr ausblieben. So ist es bereits in der ersten Hälfte der 90iger Jahre fraglich inwieweit Zaïre überhaupt noch als homogener Staat mit zentraler Entscheidungsinstanz zu betrachten ist. Mobutu und sein Regime kontrollierten zwar noch die Hauptstadt Kinshasa im Westen des Landes, inwieweit sie aber noch eine Ordnungsgewalt im riesigen Rest des Landes innehatten war fraglich. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass der überwiegende Teil des Staates unter einer Art administrativen Vakuums litt. (Weiss 1995: 157-9)
Staatliche Institutionen funktionieren kaum mehr. Gehälter werden schon lange nicht mehr gezahlt, oder sie sind so niedrig, dass ein Monatsgehalt für den Lebensunterhalt von zwei bis drei Tagen reicht. So holte sich die zairische Armee ihren Sold bei der Bevölkerung ab. „Ausschütteln“ wird dies genannt: Es ist so, als würdest Du auf den Kopf gestellt und alles, was sich in den Taschen befindet, fällt heraus. (Schürings 1997: 77)
Zusätzlich zu diesen großen internen Belastungen kommt noch die enorme Zahl der Flüchtlinge, welche sich als Folge des ruandischen Genozids im Sommer 1994 im Osten des Landes aufhält. Unter diesen befanden sich viele immer noch oder wieder strukturierte militärische Hutueinheiten, welche ebenfalls nach ihrer Niederlage in diesem Gebiet Zuflucht gefunden hatten.
In dieser instabilen Gesamtsituation formiert Laurent-Désiré Kabila in der östlichen Provinz Kivu im Oktober 1996 die Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo- Zaïre (AFDL), welche aus verschiedenen Gruppen besteht, die das gemeinsame Ziel eint Mobutu zu stürzen. In etwa einem halben Jahr besetzt die Allianz den gesamten Kongo und übernimmt am 17. Mai 1997 die Macht in Kinshasa. Trotz mehrerer Ankündigungen Mobutus und seiner Mitstreiter, dass es zu einer Entscheidungsschlacht kommen wird, werden die meisten großen Städte kampflos eingenommen. Nur vor der Hauptstadt kommt es zu einigen Zusammenstößen zwischen den Rebellen Kabilas und der Präsidentengarde Mobutus, welche durch angolanische UNITA-Einheiten unterstützt werden. Aber auch dadurch kann der Vormarsch nicht gestoppt werden und Mobutu muss ins Exil nach Marokko fliehen, wo er am 7. September 1997 an seiner fortgeschrittenen Krebskrankheit verstirbt.
Kabila wurde vor allem von den Nachbarstaaten Ruanda und Uganda unterstützt, aber auch von den USA, welche sich durch ihn eine Wende hin zur Demokratie in Zaïre erhofften, ohne dessen Zerfall zu riskieren. Von den lokalen Mächten unterstützte vor allem die ruandische Führung, die FPR, Kabila. Sie sah sich, nachdem sie 1994 an die Macht gelangt war, mit dem Problem der Hutumilizen sowie der Hutuexilregierung konfrontiert, die beide von ostzaïrischem Territorium aus gegen Ruanda operierten, dabei die dortigen zivilen Flüchtlinge als Schutzschild benutzten und sich auch noch Mobutus Unterstützung erfreuten. Von Kabila erhoffte man sich auf ruandischer Seite eine Klärung dieser Probleme.
Weitere Unterstützung erhielt er durch die Volksgruppe der Banyamulenge, welche aus ruandischen Tutsi bestand, die bereits seit längerer Zeit in Zaïre heimisch waren. Mobutu hatte sie zum Ziel rassischer Propaganda gemacht, und ihnen sogar Anfang der 90iger Jahre die Staatsbürgerschaft entzogen, was bei ihnen natürlicherweise für Unmut sorgte. (Wegemund 1998: 381-2)
Neben Ruanda unterstützten auch Uganda, Angola und Burundi Kabila, wobei sich beide Staaten ebenfalls von Rebellen befreien wollten, die vom Territorium Zaïres aus gegen die jeweiligen Machthaber operierten. Besonders die Region Kivu stellt in diesem Zusammenhang einen Tummelplatz für die verschiedensten Rebellenformationen dar. (zum Kivu vgl.: Willame 1998) Eine weitere nicht unbedeutende Hoffnung auch der Nachbarstaaten bestand darin, dass ein demokratisiertes Zaïre die gesamte Region stabilisieren könnte. (Stroux 1998: 832)
Kabila versuchte zwar durch eine neue Fahne, eine neue Hymne sowie die Rückbenennung des Landes in Kongo eine neue nationale Identität zu schaffen und war trotzdem mit zahlreichen Problemen konfrontiert, als er die Macht übernommen hatte. Ein Problem war sein Bündnis, welches zum einen aus langjährigen Mobutugegnern wie ihm bestand, dem zum anderen aber auch nationale Kräfte aus dem Osten des Landes, die Banyamulenge, angehörten, denen eher ihre eigenen Minderheitenrechte im Mittelpunkt standen. Dieser ethnische Aspekt in Verbindung mit der starken Unterstützung des Auslandes, besonders Ruandas, ohne die Kabilas militärischer Sieg wohl undenkbar gewesen wäre, bringt ihn nun in Kinshasa in ein Legitimationsproblem. Die Tutsi waren, nicht zuletzt wegen der Anti- Tutsi-Propaganda Mobutus, wie überhaupt die Menschen aus dem Osten des Landes, in der Hauptstadt Kinshasa und bei den dort ansässigen Eliten nicht besonders beliebt. Da sie aber den Kern der Armee Kabilas, der selber aus dem Osten stammt, stellten, gerieten sie in zahlreiche einflussreiche Positionen und erweckten den Einfluss einer Machtübernahme. Zudem gab es im gesamten Land eine starke Präsenz ruandischer und ugandischer Tutsi in der Armee, was von einem Großteil der Bevölkerung als Fremdherrschaft wahrgenommen wurde. (Stroux 1998: 832-3; Wegemund 1998: 382)
Ihm Interesse seines Machterhaltes, Macht bedarf immer einer Legitimation, war Kabila nunmehr gezwungen auf Distanz zu den Tutsi und zu Ruanda zu gehen. Dies wurde um so nötiger, da die politische Klasse in Kinshasa in Person von Etienne Tshisekedi immer noch eine Führungsfigur besaß, die somit einen direkten Gegner für Kabila darstellte. Ein weiterer Grund für diesen Bruch ist in der Tatsache zu sehen, dass von Seiten der UNO der Menschenrechtsvorwurf gemacht wurde, demzufolge die vorrückende ADFL und die ruandische Armee Zivilisten in großem Maße ermordet haben sollen. So spricht der UN- Botschafter Garretons von 150-180.000 Ermordeten Zivilisten während Kabilas Vormarsch. Kabila sowie die ruandische Regierung bestreiten die Vorwürfe natürlich. Trotzdem werden Tutsi aus verantwortlichen Positionen wieder entfernt und zum einen durch Angehörige der Volksgruppe Kabilas und zum anderen seit Anfang 1998 sogar wieder durch Mitglieder der Mobuturegierung ersetzt, welche zu diesem Zweck aus dem Gefängnis oder dem Hausarrest entlassen werden. (Wegemund 1998: 383-4)
Offensichtlich wurde der Bruch der Achse Kongo-Uganda-Ruanda dann aber am 17. Mai 1998. Kabila hatte geplant in Kinshasa am Jahrestag seiner Machtübernahme eine große Konferenz über die Sicherheitslage in Zentralafrika abzuhalten. Dazu wollte er alle Regierungschefs der Region in seiner Hauptstadt versammeln. Was als große Geste gedacht war, schlug gründlich fehl. Es erschienen gerade mal zwei unwichtigere Staatsoberhäupter; die Staatschefs von Uganda und Ruanda, immerhin die noch vor kurzem engsten Verbündeten Kabilas, tagten stattdessen mit dem eritreischen Staatschef in Ruanda. Dieser Gegengipfel war ein klarer Affront gegen Kabila, der neben einigem diplomatischen Gezänk eine grundlegende Verschiebung der Fronten in Zentralafrika mit sich brachte. Kabila orientiert sich nun wieder mehr an seinen frankophonen Nachbarn Kongo-Brazzaville, Gabun und Zentralafrikanische Republik. (Stroux 1998: 831)
Innenpolitisch besteht das primäre Ziel Kabilas in der Machterhaltung. Zu diesem Zweck hat er eine Verfassung in Arbeit gegeben, welche ein Präsidialsystem mit Zweikammerparlament vorsieht, wobei die Amtszeiten sowohl des Präsidenten als auch des Ministerpräsidenten auf zwei mal fünf Jahre begrenzt werden sollen. Zudem sollte Englisch neben Französisch zur Landessprache werden. Parallel dazu baut Kabila seine Organisation AFDL zu einer landesweit operierenden politischen Partei aus, um auf diesem Wege seine Macht zu legitimieren. (Wegemund 1998: 384-5) Ob dies wirklicher politischer Wille ist oder bloß eine Art Anbiederung an den Westen darstellt soll an dieser Stelle offen bleiben.
Während sich Anfang bis Mitte 1998 eine gewisse Entspannung in sicherheitspolitischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht abzeichnete, wird die Lage gegen Ende des Jahres im Osten des Landes wieder deutlich schlechter. Es findet eine regelrechte ethnische Säuberung durch die Tutsi statt, welche in Massenmorden und Deportationen ihren Ausdruck findet. (Nour 1999: 68-73)
4 Kongo-Brazzaville
Der Staat Kongo-Brazzaville wurde vor allem durch die „kongolesische Revolution“ im Jahre 1963 geprägt, welche eine sowjetisch orientierte Einparteienherrschaft nach sich zog. Im Jahre 1968 fand dann ein Militärputsch statt, welcher aber die Verhältnisse nicht grundlegend änderte. Es blieb ein autoritäres System bestehen, welches der Zivilgesellschaft keinerlei Entfaltungsraum bot. Die marxistisch-leninistische Propaganda ist hierbei eher als Alibi denn als Herzensangelegenheit der Herrschenden zu sehen. Trotz der restriktiven Oppositionspolitik gab es seit 1963 eine ständige auch spürbare Widerstandsbewegung. Diese konnte sich aber wegen eines ständig bestehenden hohen Verfolgungsdrucks seitens der Staatsmacht nie richtig organisieren. Herauszuheben wäre an dieser Stelle Bernard Kolelas der eine Symbolfigur der Opposition in den 80iger Jahren darstellte. Dieser schrieb 1989 und 1990 offene Briefe an die Staatsführung in welchen er zum Dialog mit anderen politischen Kräften aufforderte. Eine weitere Oppositionsbewegung stellte die Kirche dar, welche sich natürlicherweise in einer gewissen Distanz zu einem linksautoritären Staat befand. Sie versuchte einerseits durch Predigten und andererseits durch die Herausgabe der einzigen unabhängigen Zeitung eine Gegenstimme zum Staatsapparat darzustellen. Allerdings unterlag auch sie einer ständigen Repression, welche sogar in Verhaftungen und Folterungen von Priestern ihren Ausdruck fanden. Der Höhepunkt dieser Verfolgung ist in der Ermordung des Kardinals von Brazzaville Emile Biayenda im Jahre 1977 zu sehen. (Koudissa 1996: 29-34)
Eine zunehmende interne Unzufriedenheit, welche auch in abnehmender materieller Lebensqualität ihre Ursache fand, in Verbindung mit Demokratisierungsdruck von außen, das leuchtende Vorbild und der potente Geldgeber Sowjetunion war ja 1991 von der politischen Landkarte verschwunden, zwangen den Präsidenten Sassou-Nguesso in eben diesem Jahr, vom 10. Juni bis zum 31. August, zur Einberufung einer Nationalkonferenz, nach dem Vorbild Benins, um das Volk über das weitere Schicksal des Landes entscheiden zu lassen. Diese Art von Konferenz steht in der afrikanischen Tradition des Palavers, welches ein altes Instrument zur gewaltfreien konsensualen Entscheidungsfindung zu Fragen des sozialen Zusammenlebens darstellt. (Koudissa 1996: 35)
Bei der Wahl des Vorsitzenden der Nationalkonferenz waren zahlreiche Kriterien zu beachten. So sollte es sich um einen politisch interessenlosen Kandidaten handeln, der auch gewissen ethnischen Kriterien genügen musste. Man einigte sich schließlich ebenfalls nach dem Vorbild Benins auf einen Vertreter der Kirche, welche ja seit jeher die Oppositionsfahne im Lande hochgehalten hatte. Die Wahl fiel auf den, aus dem Süden stammenden, Bischof von Owando, was hingegen im Norden lag, den Jesuiten Ernest Kombo.
Die Bilanz der vergangenen Jahrzehnte fiel recht düster aus. Man konstatierte eine marode Wirtschaft, die Republik Kongo war das erste Schwarzafrikanische Land in dem die Wirtschaft verstaatlicht worden war, einen bürokratischen Wasserkopf, ein Beamter für 25 Einwohner stellt einen absoluten Spitzenwert im internationalen Vergleich dar, sowie eine ungewöhnlich hohe Auslandsverschuldung, so war der Kongolese im Jahr 1991 der weltweit am höchsten verschuldete Mensch. (Koudissa 1996: 38)
Die nach vorn gerichteten Beschlüsse der Konferenz blieben halbherzig, nachdem sich in einem internen Machtkampf die „Alten“, Konservativen, gegen die „Jungen“, Progressiven, durchgesetzt hatten. Es wurde eine Verfassung verabschiedet, welche nach Maßgabe des Präsidenten Sassou-Nguesso ausgearbeitet worden war und darüber hinaus verblieb dieser sogar auf seinem Posten, obwohl man ihm die Hauptverantwortung für die maroden Zustände im Land zugesprochen hatte. Lediglich seine Kompetenzen unterlagen einer Beschneidung, sie wurden quasi auf interne und externe Repräsentationsaufgaben beschränkt. Damit glaubte man den ehemals starken Mann ungefährlich gemacht zu haben, was sich später noch als Irrtum erweisen sollte. Zur Wahl des einflussreichen Premierministers trat dann auch noch Pascal Lissouba an, welcher in den 60iger Jahren für zahlreiche politische Morde die Verantwortung getragen hatte. Allein durch diese Kandidatur war jegliche Möglichkeit des Neuanfangs durch die Nationalkonferenz entscheidend unterminiert. Allerdings musste sich Lissouba im letzten Wahlgang André Milongo geschlagen geben, welcher ein Vertreter der progressiven Partei war (Forces du Changement, F. C) während er selbst für die Konservativen (Alliance Nationale pour la Démocratie, A. N. D.) antrat. (Koudissa 1996: 40)
Die Nationalkonferenz beendete ihre Tätigkeit durch die Herausgabe zahlreicher Beschlüsse, welche eine vorwärtsgewandte Politik, vor allem Demokratisierung und Neuordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse, beinhalteten. Mit dem alten Präsidenten an der Spitze sowie weiteren Überbliebenen des vormaligen politischen Systems in der Entscheidungselite war die Umsetzung dieser Ansätze aber von vorneherein schwierig. Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur Demokratie stellten eigene politische Interessen der einzelnen Akteure dar. So wusste der Präsident, dass die Umsetzung der Vorschläge die Macht in die Hände des Premierministers legen würde, während dieser es vermied im Interesse seiner Wiederwahl die notwendigen unpopulären politischen Entscheidungen zu treffen. Dies führte zu einer Lähmung des politischen Systems. (Koudissa 1996: 43)
Als weiteres entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur Demokratie sollte sich ein Konflikt zwischen den USA und Frankreich um das kongolesische Erdöl erweisen. Der Nationalkongress hatte einen bestimmten Anteil der Fördermenge an amerikanische Unternehmen verkauft, was Frankreich nicht gefiel und es dazu bewegte dem neuen Premierminister den ihm eigentlich zustehenden Demokratiebonus zu verweigern. Zudem kam es am 15. Januar 1992 infolge einer Streitigkeit um einen Kabinettsposten zu einem Militärputschversuch, der durch Elf-Congo, einem Ableger des französischen Elf-Konzerns, unterstützt wurde. Man forderte von der Nationalkonferenz die Wahl eines neuen Premierministers. Der Putsch schlug fehl, was zum einen durch Demonstrationen und Barrikadenbau der Bevölkerung erreicht wurde, zum anderen aber auch durch Einmischung der USA auf politischer Ebene bedingt wurde.
Zudem brach im November 1993 ein Milizenkrieg zwischen der Opposition und Präsidententreuen (Mouvance Présidentielle, MP) aus, der auch als Kampf zwischen Elf- Congo und dem mittlerweile zum Präsidenten gewählten Lissouba zu begreifen ist. Dieser hatte nämlich weitere Schürfrechte an amerikanische Unternehmen verkauft, was sowohl direkte wirtschaftliche Interessen Frankreichs berührte, als auch die Sorge heraufbeschwor, dass man prinzipiell an Einfluss in der Region verlieren könne. Die bestehenden innenpolitischen Gegensätze wurden also von Elf gezielt instrumentalisiert, um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Diese Strategie war auch erfolgreich und resultierte in einem Ende des Bürgerkrieges durch die Akzeptanz der Elf-Bedingungen durch den Präsidenten. (Koudissa 1996: 44-5)
Der Demokratisierungsprozess kann an diesem Punkt also aus externen und internen Gründen als gescheitert angesehen werden. Zwar hat das alte System keinen Bestand mehr, aber das neue ist auch irgendwo auf dem Weg zur Demokratie steckengeblieben.
In der folgenden Zeit destabilisierte sich die Lage im Kongo auch zunehmend und endete schließlich im offenen Bürgerkrieg zwischen Lissouba und Sassou-Nguesso.
Den Anfang nahm diese Entwicklung mit einer Revolte der Armee vom 13. bis zum 19. 2. 1996, welche vor allem durch die Forderung geprägt war, die ausstehenden Soldzahlungen zu vollziehen. Diese Revolte bot Sassou-Nguesso den Anlass, eine am 19. 12. 1995 gefundene überparteiliche Übereinkunft zur Reorganisierung der Armee für ungültig zu erklären. Zweck dieser Übereinkunft war es die Wiedereingliederung der Milizen in eine einheitliche Armee zu gewährleisten. (IAF 1996)
Die Lage bleibt instabil bis ins Jahr 1997, in welchem Ende Juli Wahlen stattfinden sollen. Der Wahlkampf wird zusätzlich durch die instabile Lage im Nachbarland Kongo-Zaïre erschwert. (IAF 1997a) Im Vorfeld der Wahlen kommt es dann am 5. Juni auch zu ersten Kampfhandlungen. Hierbei schlägt der Versuch des amtierenden Präsidenten Lissouba fehl, die Residenz seines Hauptkonkurrenten und Amtsvorgängers Sassou-Nguesso zu erobern. Bei ethnischen Säuberungen in der Hauptstadt Brazzaville kommt es zu mehreren tausend Toten. Am 14. 7. einigt man sich auf einen Waffenstillstand, welcher aber nicht strikt eingehalten wurde. (IAF 1997b) Die wiederaufflammenden Kämpfe enden vorerst am 16. 10. mit der Niederlage Lissoubas, welche letztendlich auf eine Intervention Angolas in den letzten Kriegstagen auf Seite Sassou-Nguessos zurückzuführen ist. Der angolanische Staatschef dos Santos wollte auf diesem Wege die Probleme mit den durch Lissouba unterstützten UNITA- Rebellen in den Griff bekommen. Eine Unterstützung Frankreichs kann ebenfalls angenommen werden. Allerdings konnte Lissouba im gleichen Zeitraum eine Übereinkunft zwischen 40 Parteien und Gruppierungen erreichen, welche den militärischen Sieger politisch völlig isoliert dastehen ließ.
Im Zuge des Militärputsches kommt es zu einem Beschuss Kinshasas, welcher sowohl durch Sassou-Nguessos hätte initiiert sein können, da auf seiner Seite einerseits Einheiten der ruandischen und andererseits der ehemals zaïrischen Armee kämpften, als auch durch Lissouba, dessen Motiv in der Erzwingung des Kriegseintritts Kabilas auf seiner Seite liegen könnte.
Das Einzigartige dieser Entwicklung besteht in der Tatsache, dass es hiermit erstmalig einem demokratisch abgewählten Autokraten gelungen ist, sich mit militärischen Mitteln wieder an die Macht zu bringen, was zudem im Ausland nur leise Proteste hervorrief. (IAF 1997c)
Nach diesem Sieg normalisierten sich die Verhältnisse vorübergehend. Es war vorgesehen an der Regierungsbildung sämtliche politische Strömungen zu beteiligen, obwohl natürlich die Dominanz der Partei des neuen Präsidenten nicht in Frage gestellt werden sollte. Im Mittelpunkt des Interesses von Sassou-Nguessos stand allerdings zunächst die internationale Anerkennung, welche er durch seine Teilnahme am AKP-Gipfel in Libreville und am Frankophoniegipfel in Hanoi sichern wollte. Sein erster Auslandsbesuch führte ihn am 15. 11. 1997 nach Frankreich, welches sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht sein wichtigster Partner war.
Innenpolitisch rief er das Ziel der Rückkehr zur Demokratie aus und versuchte dies durch die Einberufung eines zehntägigen „Forums für Einheit und Demokratie“ am 5. 1. 1998 in die Wege zu leiten. Dieses über tausendköpfige Gremium beschloss eine dreijährige Übergangszeit sowie die Schaffung eines Übergangsparlamentes. Zudem drohte er dem gestürzten Präsidenten Lissouba mit Strafverfolgung wegen angeblicher Veruntreuung von Einnahmen aus Erdölgeschäften. (IAF 1998a) In der Folge blieb es relativ ruhig im Land obwohl von völliger Kontrolle durch den Regierungsapparat keine Rede sein konnte, was die Besetzung des Staudamms von Moukoukoulou über die Dauer von einem Monat hinweg belegt, welche zu Stromausfall in einer Region führte. (IAF 1998b) Im September 1998 flammten die Kämpfe hingegen wieder auf. Als Folge wurde eine wichtige Eisenbahnlinie unterbrochen. Anlass der Kampfhandlungen waren laut Oppositionellen Exekutionen durch die Regierung. Die Kämpfe erreichen eine Heftigkeit, die den Präsidenten zwingt sich wiederum durch die immer noch in der Hauptstadt stationierten angolanischen Truppen helfen zu lassen, welche in den Süden geschickt werden, wo die Rebellen am 16. Januar 1999 abermals den Moukoukoulou-Staudamm besetzt haben. (IAF 1999a) Im Verlaufe des Jahres 1999 verschärft sich der Konflikt zunehmend. Neben angolanischen Truppen sind jetzt auch kubanische Einheiten an den Gefechtshandlungen beteiligt. Trotzdem kann sich die Regierung nicht vollständig durchsetzen, die Lage bleibt ungeklärt. (IAF 1999b)
5 Ausblick
Die gegenwärtige Lage im Gebiet der großen Seen stellt sich als höchst verfahren dar. Gewalt ist an der Tagesordnung. Opfer werden in der Regel in Tausend angegeben. In keinem der drei Länder ist eine demokratisch gewählte Regierung an der Macht. Alle drei Staatschefs haben ihren Posten militärischen Erfolgen zu verdanken und legitimieren sich somit lediglich durch die Tatsache der momentan Stärkste zu sein. Dazu kommt, dass in keinem Land die entsprechende Staatsführung über das Gewaltmonopol verfügt, was ein Mindestkriterium für Staatlichkeit darstellt. Die Politik wird von komplexen ethnischen Verstrickungen dominiert. Die daraus entstehenden Feindschaften sind somit natürlich vor allem irrational und dadurch nur sehr schwer politisch zu bearbeiten.
Ein weiteres konfliktverschärfendes Moment ist aber auch unbedingt in der Einwirkung von außen zu sehen. So ist das Verhalten Frankreichs in Kongo-Brazzaville doch sehr kritikwürdig, wo zugunsten wirtschaftlicher Interessen die Unterstützung der Demokratisierung vernachlässigt worden ist. Doch recht vielversprechende Ansätze, zumindest für zentralafrikanische Verhältnisse, sind auf diesem Weg im Keim erstickt worden. Zugleich hat auch eine gegensätzliche Politik Frankreichs und der USA einiges Unheil angerichtet. Das dieser Gegensatz nicht unbedingt auf gegensätzlichen Interessen beruht, der Fall Kongo-Brazzaville mit seiner Ölproblematik stellt hier wohl die Ausnahme dar, sondern vielmehr auf mangelhafte Abstimmung zurückzuführen ist (Strizek 1999: 57-60), macht die Versäumnisse um so ärgerlicher.
Die Diskussion um die Ursächlichkeit von Kolonialismus und Kaltem Krieg für die gegenwärtige Situation mag ethisch angebracht sein, wird aber zur konkreten Konfliktbearbeitung keinen Beitrag leisten können.
Was also ist zu tun in Zentralafrika?
Die Hoffnung auf eine selbstständige Lösung der Probleme vor Ort scheint aus der heutigen Sicht doch recht utopisch. Zu viele der gegenwärtigen Entscheidungsträger sind Kriegsgewinnler, für welche eine Demokratisierung in erster Linie das Risiko des Machtverlustes mit sich brächte. Gerade durch die gegebenen Möglichkeiten der persönlichen materiellen Bereicherung können sie dadurch selbst eigentlich nur verlieren.
Hoffnungen auf eine Art friedlicher Revolution, wie etwa 1989 in Osteuropa, dürften nach zehn Jahren Bürgerkrieg verbunden mit hunderttausenden Toten und ohne jegliche demokratische Tradition schlicht vermessen sein.
Somit scheint nur noch Druck von außen zu bleiben um die Situation wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen und zumindest das Sterben zu stoppen. Unerlässlich für einen effektiven Druck ist aber eine Verständigung aller westlichen Industrienationen auf eine gemeinsame Afrikapolitik, deren Nukleus in der bedingungslosen Unterstützung von Demokratisierung liegen sollte. Gerade die westlichen Staaten sollten in der Lage sein und bereit sein auf, für sie eher marginale, ökonomische Interessen zu verzichten. Stattdessen einen Betrag zur Stabilisierung der Region zu leisten, welcher vielleicht auch für sie mit Kosten, ganz sicher aber mit tragbaren, verbunden ist, stellt eine klare Verantwortung, gerade im Hinblick auf den Kolonialismus, dar. Ebenfalls sollten erfolgreiche und stolze Demokratien, wie Frankreich oder die USA, der pubertären Phase des Interessensphärendenkens mittlerweile entwachsen sein. Obwohl diese Hoffnung wohl zurecht als etwas naiv kritisiert werden könnte.
Wie aber sollte dann dieser Druck konkret aussehen? Zum ersten müssten Entwicklungshilfegelder, auf welche alle Länder der Region mittelfristig angewiesen sind, strikt an Demokratisierung gebunden werden, welche auch durch westliche Beobachter kontrolliert werden müsste. Ein weiteres Mittel könnte die Verhängung eines notfalls auch militärisch durchgesetzten Waffenembargos sein. Auch wenn gerade dieser Schritt besonders für die westliche Rüstungsindustrie recht schmerzhaft sein könnte.
Konkrete Katastrophen, wie z. B. der Genozid 1994 in Ruanda, lassen sich aber wohl nur durch militärisches Eingreifen verhindern. Um dies im Krisenfall schnell und effektiv durchführen zu können, müssen aber im Vorfeld strukturelle Maßnahmen getroffen werden. Ob der politische Wille für so einen zugegebenermaßen weitreichenden Schritt vorhanden ist, muss allerdings vorher in einer möglichst breit angelegten öffentlichen Diskussion geklärt werden.
Die Option eines Rückzugs aus der Afrikapolitik scheint mir aus zwei Gründen unmöglich. Zum einen können, wie das Beispiel des Sudan zeigt, echte oder vermeintliche Sicherheitsinteressen des Westens durchaus von Staaten dieser Region bedroht werden und somit eine politische Auseinandersetzung erzwingen. Den zweiten Grund gegen einen Rückzug aus Afrika sehe ich in der Mediendemokratie, welche die westlichen Staaten zur Zeit prägt. Wenn der Öffentlichkeit Bilder von Grausamkeiten in unvorstellbarem Ausmaß vorgeführt werden, entsteht einfach der Wunsch zu handeln. Die auf die öffentliche Zustimmung angewiesenen Politiker kommen dann einfach in die Zwangslage handeln zu müssen ohne dass reale Interessen ihres Staates tangiert sein müssen.
Abschließend soll noch die zugegebenermaßen pessimistische Prognose gestellt werden, dass eine wie auch immer geartete Konfliktbearbeitung durch wen auch immer kurzfristig wohl kaum Erfolgschancen haben dürfte. Auch in absehbarer Zeit wird die Region instabil bleiben, der Zerfall des Kongo-Zaïre ist eine nicht unrealistische Perspektive.
Trotzdem dieser düsteren Aussichten kann der schwarze Kontinent eine Zukunft haben und wir haben die Verpflichtung das uns mögliche dazu beizutragen ohne allerdings dabei paternalistisch den Weg weisen zu wollen.
6 Literaturverzeichnis
6. 1 Monographien, Aufsätze in Sammelbänden und Fachzeitschriften
Ansprenger, Franz (1999): Politische Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert, München
Gaud, Michel (1997): Chronologie politique du Congo-Zaïre-Congo, in: Afrique contemporaine, Dossier special : Du Zaïre au Congo, Nr. 183, 3e trimestre 1997, S. 67-87
Keil, Imke/ Lobner, Sabine (1994): UNO - Die Weltpolizei auf dem Prüfstand: 38 Jahre Friedensmissionen vom Suez bis Kambodscha, Münster
Koudissa, Jonas (1996): Verlorene Hoffnungen: Demokratisierung in der Republik Kongo, in: Kevenhörster, Paul/ Boom, Dirk van den: Afrika: Stagnation oder Neubeginn, Münster, S. 29- 52
Marx, Jörg (1997): Völkermord in Ruanda: Zur Geneologie einer unheilvollen Kulturwirkung, eine diskurshistorische Untersuchung, Hamburg
Neubert, Dieter/ Brandstetter Anna-Maria (1996): Völkermord in Ruanda: Die falsche These vom „Stammeskrieg“, in: Sozialwissenschaftliche Information, H. 2, Jg. 25, S. 96-103
Nour, Salua (1999): Prinzip Hoffnungslosigkeit - Der Krieg im Kongo als Beispiel für das Schicksal schwacher Entwicklungsländer im Verteilungskampf des auslaufenden 20. Jahrhunderts, in: Internationales Afrikaforum, H. 1, Jg. 35, S. 65-74
Reif, Susanne (1996): Ruanda: Der Orkan von Krieg und Völkermord gegen den demokratischen Wind des Wandels, in: Kevenhörster, Paul/ Boom, Dirk van den: Afrika: Stagnation oder Neubeginn, Münster, S. 81-99
Schlichte, Klaus (1996): Krieg und Vergesellschaftung in Afrika - Ein Beitrag zur Theorie des Krieges, Münster
Schürings, Hildegard (1997): Verdeckte Fronten - Hintergründe des Konflikts in Ostzaire, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, H. 1, Jg. 42, S. 74-82
Strizek, Helmut (1996): Ruanda und Burundi - Von der Unabhängigkeit zum Staatszerfall. Studie über eine gescheiterte Demokratie im Zwischenseengebiet, München, Köln, London
Strizek, Helmut (1999): Die Lage im Gebiet der großen Seen Afrikas fünf Jahre nach der Machtübernahme der Front Patriotique Rwandais (FPR) in Ruanda, in: Internationales Afrikaforum, H. 1, Jg. 35, S. 57-64
Stroux, Daniel (1998): Neue Fronten in Zentralafrika, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, H. 7, Jg. 43, S. 831-40
Waltz, Kenneth N. (1979): Theory of International Politics, Reading 22
Wegemund, Regina (1998): Demokratische Republik Kongo: Ein gescheiterter Neuanfang?, in: Internationales Afrikaforum, H. 4, Jg. 34, S. 381-93
Weiss, Herbert (1995): Zaire: Collapsed Society, Surviving State, Future Polity, in: Zartmann, I. William: Collapsed States - The Desintegration and Restoration of Legitimate Authority, London, S. 157-70
Willame, Jean-Claude (1998): Kivu: la poudrière, in : Adam, Bernard (Hg.) : Kabila prend le pouvoir, Brüssel
6. 2 Zeitungsartikel (ohne Autorenangabe)
FAZ 1998a: Hunderte Ausländer verlassen Kinshasa - mehrere Rettungsflüge / Rebellen setzen Vormarsch fort, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 189, 17. August, Jg. 1998, S. 4
FAZ 1998b: Hoffnung auf Waffenstillstand im Kongo - Kongolesische und angolanische Truppen vertreiben Rebellen nach Osten / Lage in Kinshasa ruhiger, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 203, 2. September, Jg. 1998, S. 6
IAF 1996: Chronik: Kongo, in: Internationales Afrikaforum, H. 2, Jg. 32, S. 152
IAF 1997a: Chronik: Kongo, in: Internationales Afrikaforum, H. 1, Jg. 33, S. 34
IAF 1997b: Chronik: Kongo (Brazzaville), in: Internationales Afrikaforum, H. 3, Jg. 33, S. 233
IAF 1997c: Chronik: Kongo (Brazzaville), in: Internationales Afrikaforum, H. 4, Jg. 33, S. 333-4
IAF 1998a: Chronik: Kongo (Brazzaville), in: Internationales Afrikaforum, H. 1, Jg. 34, S.35 IAF
1998b: Chronik: Republik Kongo, in: Internationales Afrikaforum, H. 3, Jg. 34, S. 231 IAF
1999a: Chronik: Republik Kongo, in: Internationales Afrikaforum, H. 1, Jg. 35, S. 33 IAF
1999b: Chronik: Republik Kongo, in: Internationales Afrikaforum, H. 3, Jg. 35, S. 231
NZZ 1998a: Offensive der Regierungstruppen in Kongo-Zaire - Vorstoss im Osten des Landes, in: Neue Züricher Zeitung, Nr. 203, 3. September, Jg. 1998, S.4
NZZ 1998b: Kongo-Zaire Rebellen kündigen Guerillakrieg an - Verlust von Positionen im Westen des Landes zugegeben, in: Neue Züricher Zeitung, Nr. 201, 1. September, Jg. 1998, S. 4
NZZ 1998c: Afrikas Kriege überschatten Blockfreien-Gipfel - Friedens- und Solidaritätsappelle in Durban, in: Neue Züricher Zeitung, Nr. 203, 3. September, Jg. 1998, S.4
[...]
1 Ergebnis der Volkszählung im Jahr 1956: 82,74% Hutu, 16,59% Tutsi, 0,67% Twa (diese stellen ein unbedeutendes Pygmäenvolk dar, dass in den Wäldern von der Jagd lebt) (Strizek 1996: 38)
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2000, Kongo, Ruanda, Zaire - Gibt es einen Ausweg aus dem Bürgerkrieg?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95075
Kostenlos Autor werden





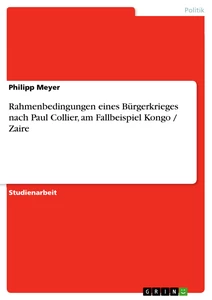


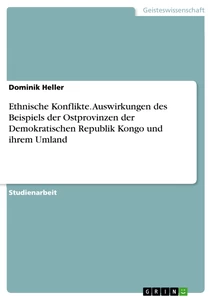
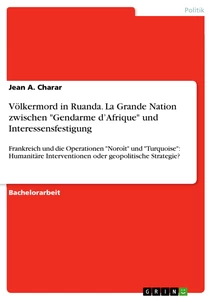







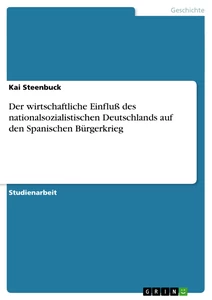




Kommentare