Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Abstract
2. Einleitung
2.1 Forschungsfrage
2.2 Entdeckungs- und Verwendungszusammenhang
2.3 Hypothesenbildung
2.4 Präzisierung der Hypothese
3. Theoretische Grundlagen
3.1 Klassentheorie
3.1.1 Habitus
3.1.2 Distinktion
3.1.3 Kritik
3.2 Milieutheorie
3.2.1 Stil
3.2.2 Alltagsästhetische Schemata
3.2.3 Milieutypen
3.2.4 Kritik
3.3 Szenen
4. Methodik
4.1 Forschungsparadigma
4.2 Gegenstandsbereich
4.3 Triangulation
4.3.1 Datentriangulation
4.3.2 Methodentriangulation
4.4 Experteninterview
4.4.1 Analyse
4.5 Teilnehmende Beobachtung
4.5.1 Analyse
5. Durchführung
5.1 Feldzugang
5.2 Theoretisches Sampling
5.3 Experteninterview
5.3.1 Interviewleitfaden
5.3.2 Gewinnung von Interviewpartnern
5.3.3 Forschungsethik
5.3.4 Auswahlkriterien
5.3.5 Analyse
5.4 Teilnehmende Beobachtungen
5.4.1 Beobachtungsstandorte
5.4.2 Verhalten im Feld
5.4.3 Operationalisierung
5.4.4 Analyse
6. Ergebnisse
6.1 Experteninterview
6.1.1 Genussschema
6.1.2 Distinktion
6.1.3 Lebensphilosophie
6.1.4 Sozialstatus
6.2 Teilnehmende Beobachtung
6.2.1 Altersstruktur
6.2.2 Genussschema
6.2.3 Kleidungsstil
6.3 Induktion Milieutheorie
6.3.1 Sozialstatus
6.3.2 Genussschema
6.3.3 Distinktion
6.3.4 Lebensphilosophie
7. Zusammenfassung
7.1 Fazit
7.2 Kritik
Anhang
Bibliographie
HONOURS WORK
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
SAE Institute Zürich
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Theoriemodel und Herleitung der Variablen
Abbildung 2 Altersstruktur Gesamt
Abbildung 3 Altersstruktur Veranstaltungsorte
Abbildung 4 Altersstruktur etablierte Veranstaltungsorte
Abbildung 5 Genussschema während der Veranstaltung
Abbildung 6 Kleidungsstil
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Überblick Alltagsästhetische Schemata
Tabelle 2 Überblick Zeichenkonfiguration der Milieus
Tabelle 3 Überblick Alltagsästhetik der Milieus
Tabelle 4 Variablen im Leitfaden
Tabelle 5 Institutionen und Rolle der Experten
Tabelle 6 Variable 1 Genuss
Tabelle 7 Variable 2 Distinktion
Tabelle 8 Variable 3 Lebensphilosophie
Tabelle 9 Variable 4 Sozialstatus
Tabelle 10 Zusammenfassung Experteninterviews
Tabelle 11 Zusammenfassung teilnehmende Beobachtung
1. Abstract
Ziel dieser Arbeit ist es, empirisch zu untersuchen, ob Jazz heute der „Hochkultur“ angehört. Um dies zu überprüfen, wird das Forschungsfeld auf die Jazzszene in der deutschsprachigen Schweiz (der Deutschschweiz) begrenzt und die Gesellschaftstheorie von Gerhard Schulze und sein Begriff des Hochkulturschemas inklusive der entsprechenden Milieus herangezogen. Auf Grundlage dieser Theorie werden zwei Erhebungsinstrumente entworfen. Primär stützt sich diese Forschungsarbeit auf die Ergebnisse von Experteninterviews. Es werden sieben Experten in insgesamt sechs Interviews mit einer durchschnittlichen Interviewlänge von 70 Minuten befragt. Für das halbstandardisierte Interview wird ein Leitfaden, der offene Fragen enthält, entwickelt. Die Experten, die zu Wort kommen, sind ausschließlich Personen, die eine leitende Position in verschiedenen Institutionen der Jazzszene innehaben. Das zweite Erhebungsinstrument, das als Kontrollinstrument gedacht ist, ist die teilnehmende Beobachtung. Um die Aussagen der Experten direkt im Feld zu überprüfen, werden acht Beobachtungen an verschiedenen relevanten Standorten getätigt. 527 Einzeleinheiten werden untersucht.
Die Experteninterviews sind wortwörtlich transkribiert. Verwendet wird die variablenorientierte qualitative Inhaltsanalyse nach Glässer und Laudel, welche sich an der Inhaltsanalyse von Philipp A. E. Mayring orientiert. Die Daten der teilnehmenden Beobachtung werden mithilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet.
Die Daten zeigen eine relative Nähe zum Hochkulturschema, die sich in einem kontemplativen Genussschema, in einer antibarbarischer Distinktion, einer perfektionistischen Lebensphilosophie und in einem hohen Bildungsgrad äußern. Eine relative Nähe zum Spannungsschema kann ebenfalls aus den Daten abgelesen werden. Eine antikonventionelle Distinktion, ein legerer Kleidungsstil und eine narzisstische Lebensphilosophie deuten darauf hin.
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass drei Milieus in der Deutschschweizer Jazzszene vertreten sind. Niveaumilieu, Integrationsmilieu und Selbstverwirklichungsmilieu. Die Jazzszene ist ein Gemisch aus den alltagsästhetischen Zeichengruppen, die diesen Milieus zugeordnet werden können.
2. Einleitung
Jazzmusik gehört zweifelsfrei zu den Musikarten, die im Laufe der Zeit eine gewaltige Entwicklung erlebt haben und deren Bedeutung als Kulturgut kaum abzustreiten ist. Das wird deutlich, wenn man den Begriff des Jazz in seine Dimensionen zerlegen und vollständig erfassen möchte. Es scheint unmöglich. Das liegt daran, dass der Jazz in jeder Epoche seiner Geschichte eine andere Bedeutung hatte. Man denke nur an die Anfänge in New Orleans, als man Jazz vorrangig mit Rotlicht und Nachtleben in Verbindung brachte. Oder an die Swing-Ära, in der Jazz zur Popmusik einer ganzen Generation wurde (Polillo & Schaal 2003, S.144, Trültzsch 2010, S.92).
Genau wie jeder andere Musikstil verändert sich natürlich auch der Jazz. Der Bebop, der 1944 aufkam und von Zeitzeugen als Revolution empfunden wurde, ist nur eine Entwicklungsstufe, die rückblickend das Verständnis dieses Musikstils grundlegend veränderte (Bollenbeck & Bleek, 2002, S.211, Polillo & Schaal 2003, S.161ff). In diesem Zusammenhang ist es jedoch sinnvoller, von einer Erweiterung zu sprechenden; der Jazz hat sein altes Storyville-Image nie ganz abgelegt. Jedoch sind in der Geschichte einige Kontraste entstanden, die Jazz als Forschungsgebiet interessant machen. Auf der einen Seite steht die von körperlichen Genüssen geprägte Zeit des frühen Jazz und auf der anderen Seite die von Perfektion und „Kälte“ geprägte Zeit des Bebop (Polillo & Schaal 2003, S.181). Diese Eigenschaften sorgten nicht nur für die Erweiterung des Jazz-Begriffes, sondern auch für eine Erweiterung seines Publikums.
Doch wo steht Jazz heute? Und welches Publikum hat er? Wenn man heute einen Jazzclub besucht, findet man eine Ansammlung von verschiedenen Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick völlig selbstverständlich erscheinen: beispielsweise die Improvisation, die den Künstler in Ekstase versetzt und ihm körperliche Hochleistungen abverlangt, und eine disziplinierte Zuhörerschaft, die geduldig auf das Ende des Solos wartet, um den verdienten Applaus zu spenden. Erst durch den Vergleich mit anderen Musikstilen wird deutlich, dass dieses Verhalten in dieser Kombination für den Jazz speziell ist. Wenn man beispielsweise an ein Rockkonzert denkt, ist die somatische Verbindung zur Musik selbstverständlich. Man will sich bewegen, tanzen, sich der Musik hingeben. Bei einer Aufführung von Beethovens Neunter Sinfonie ist eine körperliche Hingabe des Publikums kaum zu beobachten. Kein Tanzen, kein Kopfnicken im Takt. Man sitzt still, spricht nicht und selbst ein schwaches Husten wird als Störung empfunden. In einem klassischen Konzert wird der einzelne Musiker zu einem Zahnrädchen in der perfekt geschmierten Maschinerie des Orchesters, weisungsgebunden, eingegliedert und der Autorität des Dirigenten unterstellt. An diesen Beispielen wird deutlich, dass jede Kultur ihre eigenen normativen Verhaltensstrukturen besitzt. Der Jazz vereint hier verschiedenartige Strukturen, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen: beispielsweise das disziplinierte meist sitzende Publikum, das aufmerksam zuhört und genau weiß, wann applaudiert werden darf (ähnlich dem klassisches Konzert), der Künstler, dessen Solo Ausdruck seiner Individualität und seines persönlichen Stils ist und dessen Aufführung ein körperlich höchst anstrengendes Ereignis ist (ähnlich dem Rockkonzert).
Doch nicht nur das habituelle Verhalten deutet auf eine Patchwork-Kultur hin, sondern auch die Zusammensetzung des Publikums. Studenten, Angestellte, Lehrer, ältere Damen wie Herren. Doch damit nicht genug; der Jazz vereint auch kulturübergreifend. Das Publikum ist – das zeigte der erste Kontakt mit dem Forschungsfeld zu Beginn dieser Arbeit – äußerst heterogen. Dennoch zeigten sich im Rahmen der Recherchen des Öfteren stereotype Assoziationen mit dem Begriff des Jazz und seinem Publikum. Besonders auffällig ist die Verbindung mit dem Begriff der „Hochkultur“.
2.1 Forschungsfrage
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit eben dieser Verbindung. Es wird untersucht, inwiefern die Jazzszene in der Deutschschweiz dem Hochkulturbegriff zugeordnet werden kann. Das Forschungsfeld selbst legt nahe, den Begriff der Hochkultur auf seine kultursoziologische Dimension zu beschränken. Um der Untersuchung ein theoretisches Fundament zu geben, wird die Gesellschaftstheorie des Kultursoziologen Gerhard Schulze und sein Begriff des Hochkulturschemas als Grundlage herangezogen.
2.2 Entdeckungs- und Verwendungszusammenhang
Abgesehen davon, dass jeder, der sich für Jazz begeistern kann – schon um seine eigene musikalische Prägung zu verstehen und sein Wissen über Jazz zu erweitern –, grundsätzlich eine interessierte Grundhaltung gegenüber derlei Forschungsfragen haben wird, können noch einige andere Gründe angeführt werden, um die theoretische Relevanz zu unterstreichen. Ein Interesse kann aus Sicht eines Musikers oder Musikproduzenten beispielsweise rein ökonomisch begründet werden. Die Musikbranche steht momentan besonderen Herausforderungen gegenüber. Das Internet hat die Rezeption und Distribution stark verändert. Wenn man die Entwicklung der Musikbrache in den letzten Jahren betrachtet, so kann man feststellen, dass der Zugang zum Marktsegment auf herkömmliche Weise immer schwieriger wird. Die Konsumenten weichen auf alternative Formate und Quellen aus, entweder aus Kostengründen oder weil die Alternativen zweckmäßiger sind. Es gilt also die Segmenteigenschaften des Marktes neu zu definieren, um das Produktinteresse erneut zu wecken, neue Produkte zu entwickeln oder generell einen vielversprechenden Zugang zum Markt zu erhalten. Im Rahmen einer Marktsegmentierung sind demografische, psychologische und sozioökonomische Merkmale von entscheidender Bedeutung (Bruhn, 2007, S.208). Unter die letzte Kategorie fällt auch das soziale Milieu.
Milieutheorien wie die von Gerhard Schulze, welche mittlerweile in einer Vielzahl von Varianten vorliegen, sind für die Marktforschung besonders interessant, weil sie den Erlebniswert und die damit verbundenen subjektiven Komponenten in den Mittelpunkt stellen.
Die Milieutheorie geht davon aus, dass die Gesellschaft nicht nur vertikal über Schichten mit unterschiedlichen Arten von Kapital (wie bei Bourdieu) organisiert ist, sondern auch horizontal in Form von Lebensstilgemeinschaften (Diaz-Bohne, 2004, S.2). Auch greift sie aktuelle sozioökonomische Veränderungen auf und verarbeitet diese zu einer zeitnahen Theorie.
Aber auch wenn die Ökonomisierung der Gesellschaft vor der wissenschaftlichen Forschung nicht halt macht und die vorliegende Arbeit unter Marketing-gesichtspunkten einen geeigneten Verwendungszusammenhang finden kann, soll doch das Erkenntnisinteresse nicht darauf beschränkt bleiben.
Ein weiterer Verwendungszusammenhang der Arbeit stützt sich auf einen Aspekt, dessen Relevanz erst im Laufe der Datenerhebung in Erscheinung trat. Gemeint ist die Kulturförderung in der Schweiz. Auch wenn die Schweizer Jazzlandschaft im Vergleich zur deutschen – welche auf staatliche Unterstützung verzichten muss – relativ gut aufgestellt ist, wurde von den Befragten sehr oft dieses Thema angeführt. Auch hier kann mit Forschung ein wichtiger Beitrag zum Diskurs geleistet werden, wenn diese dazu dient, neue Erkenntnisse über die Struktur der Kulturlandschaft zu gewinnen.
2.3 Hypothesenbildung
Wie weiter oben bereits angedeutet, beschäftigt sich diese Arbeit mit Jazz und dessen Zugehörigkeit zur „Hochkultur“.
Das Theoriemodell der Hochkultur definiert sich nach einer spezifischen kulturellen Praxis, einer bestimmten Gesellschaftsgruppe (Gebesmair, 2010, S.85, Junge, 2006, S.38ff), die sich von der Popkultur oder der sogenannten Massenkultur abgrenzt. Außerdem dient Hochkultur als „Ausweis moralischer Überlegenheit“ (Gebesmair, 2010, S.86). Die Strukturen des hochkulturellen Kulturbetriebs entziehen sich weitgehend kommerziellen Verwertungsketten (ebd. S.86). „Das eingeschränkte kulturelle Produktionsfeld des hochkulturellen Kunstbetriebs stellt mit seinen Akteuren und Institutionen (z.B. Künstler, Museen, Galerien, Kunstkritiker, Feuilletons) seinen eigenen Markt da“ (Calmbach, 2007, S.135), wohingegen sich die Musikindustrie, am Prinzip von Angebot und Nachfrage orientiert und eine ausreichende Wertschätzung des Werkes, im kleinen exklusiven Kreis auserwählter Experten, verunmöglicht (ebd.). Bei Gerhard Schulze drückt sich Hochkultur durch die relative Nähe zum Hochkulturschema aus. Im Hochkulturschema findet man eine bestimmte Art von Menschen mit speziellen Vorlieben und Verhaltensmustern, die intersubjektiv erkannt und klassifiziert werden können (Stolz, 2000, S.226). Der Begriff des Hochkulturschemas wird weiter unten noch genauer betrachtet.
Als Grundlage der Hypothese dient ein Beitrag von Heinz Steinert mit dem Titel „Musik und Lebensweise“. Steinert schreibt über die Möglichkeit, mithilfe von Musik eine soziale Position zu beziehen.
„Klassik und Jazz haben mit Bildung und Oberschicht zu tun [...]. Moderner Jazz – vom Bebop aufwärts – entspricht in Europa eher der super-hochgebildeten bis versnobten Klassik-Fraktion, die (nach hundert Jahren) schon gelernt hat, Schönberg zu hören. [...]“ (Knauer & Darmstadt, 2002, S.105).
Das Zitat spiegelt etwas wider, was auch zu Beginn dieser Arbeit der Wahrnehmung des Autors entsprochen hat, nämlich dass Jazzmusik seinem subjektiven Empfinden nach zur Hochkultur gehört.
2.4 Präzisierung der Hypothese
Eine erste Modifizierung muss bei dem Begriff „Oberschicht“ getroffen werden. Auch wenn es umgangssprachlich üblich ist, von Schichten zu sprechen, ist es angesichts aktueller Gesellschaftstheorien sinnvoll, die Milieubegriffe von Schulze einzusetzen. Um die Hypothese weiter zu vereinfachen, soll auf eine weitere Einflussgröße vorerst verzichtet werden: Gute Bildung ist eine Eigenschaft, die nach Schulze dem Niveaumilieu und dem Selbstverwirklichungsmilieu zugeordnet werden kann. Deswegen soll sie in der Hypothese nicht ausdrücklich genannt werden. Die Hypothese gestaltet sich nach der Reduzierung wie folgt:
Mitglieder der Deutschschweizer Jazzszene gehören zum Niveaumilieu bzw. zum Selbstverwirklichungsmilieu.
Die hier hinzugekommenen Begriffe des Niveau- bzw. Selbstverwirklichungsmilieus spiegeln bereits einen Aspekt der Milieubeschreibung von Schulze wider, die weiter unten noch genauer beschrieben werden. Es handelt sich hierbei um die zwei Milieus, die dem Hochkulturschema besonders nahestehen.
3. Theoretische Grundlagen
Wie kann man vorgehen, wenn man die sozialen Merkmale einer Kulturszene erforschen möchte? Hier sind zunächst relevante Theoriemodelle ausfindig zu machen und der Begriff der Hochkultur in seiner kultursoziologischen Dimension noch genauer zu definieren.
3.1 Klassentheorie
Pierre Bourdieu hat sich in einem seiner Werke (La Distinction) mit dem Phänomen der Hochkultur empirisch auseinandergesetzt. Der sehr stark von marxistischen Begriffen geprägte klassentheoretische Ansatz, den Pierre Bourdieu verfolgte, beschreibt Geschmack und Lebensstil im direkten Zusammenhang mit sozialem Status und Kapitalausstattung.
Im Gegensatz zu Marx sieht Bourdieu die Gesellschaft nicht zweidimensional –unterteilt in Bourgeois und Proletarier –, sondern er unterteilt den sozialen Raum in drei Kapitalsorten (kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital). Die gesellschaftliche Position des Individuums bestimmt sich über die Menge und das Verhältnis dieser Kapitalsorten. Die Unterschiede unserer Gesellschaft sind laut Bourdieu auf diese relativen Verhältnisse zurückzuführen. Hochkultur definiert sich bei Bourdieu demnach durch die Menge des kulturellen Kapitals (Schwiegel, 1995, S.102ff).
Kulturelles Kapital: Bourdieu unterteilt das kulturelle Kapital in inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes Kapital.
Ersteres kann man als Bildung bezeichnen. Es muss vom Einzelnen erworben werden, erfordert Zeit und Anstrengung und kann nicht delegiert werden. Beispiele sind das Erlernen eines Instruments, das Lesen von Partituren oder das Verstehen einer Fremdsprache.
Objektiviertes kulturelles Kapital liegt – wie der Name schon sagt – in objektiver Form vor, etwa in Form von Büchern, Gemälden, Skulpturen, CDs etc. Eine Eigenart der objektiven Form ist, dass es zwar mit ökonomischem Kapital vergleichbar besessen werden kann, jedoch das Individuum inkorporiertes Kapital benötigt, um es sich vollständig anzueignen. Beispielsweise kann man einen Tonträger mit Kompositionen von Karlheinz Stockhausen besitzen, aber man wird erst mit steigendem Verständnis für Kompositionstechnik und der Geschichte diese Musik wirklich verstehen können.
Institutionalisiertes kulturelles Kapital sind beispielsweise akademische Abschlüsse, demnach von Institutionen legitimiertes inkorporiertes Kapital. Auch hier findet sich eine Verknüpfung zum ökonomischen Kapital.
Ökonomisches Kapital: Diese Kapitalform lässt sich in materielle Güter wie Grundstücke, Möbel, Autos und Geld unterteilen.
Soziales Kapital: Würde Bourdieu heute noch leben, könnte er eine starke Veränderung dieser Kapitalsorte ausmachen. Soziales Kapital, also die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und die Stärke der sozialen Vernetzung sind hier ausschlaggebend. Jedoch stellt Bourdieu die Bedingung, dass diese sozialen Kontakte mobilisierbar sein müssen, eine Eigenschaft, die nur von einem Bruchteil der Kontakte erfüllt werden, die wir über soziale Netzwerke wie Facebook aufrechterhalten. Aber nicht nur die Verfügbarkeit von sozialen Kontakten ist entscheidend, sondern auch die Kapitalmenge und die Kapitalzusammensetzung der Kontakte selbst (Kreckel, 1983, S.191).
Personen oder Gruppen die in diesem dreidimensionalen Raum eng beieinander liegen weisen folglich eine geringe Heterogenität auf. Verhalten, Geschmack, Lebensstil, Problemlösungsstrategien etc. sind ähnlich und spiegeln das soziale Umfeld wieder (Kubisch, 2008, S.63).
3.1.1 Habitus
Der Habitus ist ein den Lebensstil gestaltendes theoretisches Konstrukt, das im Mittelpunkt des klassentheoretischen Modells von Bourdieu steht. Unbewusst begleitet er uns in jeder Lebenslage, bestimmt, was wir schön finden und was nicht. Er ist ein „Erzeugerprinzip objektiver klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen“ (Bourdieu, 1982, S.279) Der Habitus ist demnach für unser Handeln und das Bewerten von Handlungen anderer verantwortlich. Er bildet sich jedoch nicht aus heiterem Himmel, sondern er ist das Ergebnis der Lebensbedingungen, der Möglichkeiten, die diese bieten, unserer Position im sozialen Raum und unserer persönlichen Disposition (Müller, 1992, S.255). Unter diesem Gesichtspunkten ist die These des Individualismus nach Bourdieu fragwürdig, denn der Habitus bestimmt Verhalten, Denkweise und die Klassifikation der Umwelt. Die getroffenen Entscheidungen wirken zwar für uns individuell und selbstgetroffen, sind aber Ergebnis der Übereinstimmung des Habitus mit der Position im sozialen Raum (Spitz, 2013, S.62ff).
3.1.2 Distinktion
Ein dem Habitus entsprungenes Verhalten ist das der Distinktion. In den Unterschieden zwischen den Individuen manifestiert und reproduziert sich nach Bourdieu der gesellschaftliche Status und somit auch die gesellschaftliche Struktur. Einen Menschen wahrnehmen heißt auch, seine Unterschiede wahrnehmen und ihn zu klassifizieren (Bourdieu, 1993, S.204). Ein plastisches Beispiel wäre hier, „Verschwiegene Liebe“ von Franz Bummerl auf der einen und ein Gemälde von Gustav Schönleber auf der anderen Seite. Beides kann als Merkmal genutzt werden, um die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht zu symbolisieren und sich von einer anderen zu distinguieren.
Der Grund, warum Distinktion für die vorliegende Studie wichtig ist, erklärt sich darin, dass Kultur – und damit natürlich auch Musik – in der Soziologie eine besonders wichtige Rolle einnimmt, denn kulturelle Systeme entwerfen selbstständig eine beobachtende Perspektive die vor allem auf Differenzen ausgerichtet ist (Kühne, 2008, S.228).
Auch erfüllt Distinktion heute in der Musikszene noch eine wichtige Funktion, wie sich später zeigen wird.
3.1.3 Kritik
Der aus Sicht des Autors wohl bedeutendste Kritikpunkt an der Gesellschaftstheorie Bourdieus ist, dass sie stellenweise an Aktualität verloren hat. Längst beherrschen Begriffe wie Pluralisierung, Individualisierung und Differenzierung die Debatte über neue Gesellschaftsstrukturen. Schlagwörter wie „Risikogesellschaft“ (Beck, 1986) oder „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze, 2005) weisen auf einen Wandel hin, der nicht mehr in das soziologische Modell von Bourdieu passt. Der zu wenig subjektorientierte Ansatz vernachlässigt die Kreativität und Individualität (Kramer, 2011, S.19, Treibel, 2006, S.233).
Aber auch wenn sich die Durchlässigkeit der Gesellschaft seit der Entstehung von Bourdieus Arbeit verändert hat, so zeigt bspw. Pisa, dass Bildung und soziale Herkunft noch immer eng miteinander verknüpft sind (Baumert and Deutsches PISA-Konsortium, 2002, S.12). Das heißt, dass dennoch Teile dieser Theorie noch Relevanz besitzen.
Ein weiterer Punkt wäre, dass die Klassenstrukturen Frankreichs die Bourdieu untersuchte nicht ohne Weiteres auf andere Länder übertragbar sind (Treibel, 2006, S.232). Eine weitere Frage ist, ob sich kulturelle Güter überhaupt noch zur Distinktion eignen. Die Theorie des Omnivores, die vorrangig von Paul Dimaggio, Richard A. Peterson, Roger Kern und Albert Smikus geprägt wurde (Polaschegg, 2005, S.250), geht davon aus, dass es nicht mehr ausreicht, in einer spezifischen Gruppe anerkannte Kunstwerke zu rezipieren, um sich abzugrenzen, sondern vielmehr ein breites Verständnis der Kultur ein geeignetes Mittel zur Distinktion darstellt (Bauernfeind, 2008, S.15). Das Modell Omnivores geht davon aus, dass auch verschiedenartige Kunst, von einem Individuum rezipiert werden kann. Volksmusik schließt demnach den Konsum von klassischer Musik nicht aus. Das man dieses Modell nicht problemlos auf Europa übertragen kann, zeigt eine Studie von Hans Neuenhoff (2001). Die Studie bestätigt Bourdieus These über den legitimen Kulturgeschmack (Polaschegg, 2005, S.251).
3.2 Milieutheorie
Schulze geht davon aus, dass sich die Wahlmöglichkeiten des Individuums vervielfacht haben. Das differenziert ihn von Bourdieu insofern, dass er von einer psychophysischen Semantik ausgeht, Bourdieu jedoch noch von einer rein ökonomischen, welche dem Individuum seine Möglichkeiten vorgibt. Schulze stützt sich auf eine Erweiterung der Möglichkeiten, die breiteren Bevölkerungsgruppen ermöglicht, ihr Leben nach anderen Kriterien zu gestallten. Menschen haben demnach die freie Wahl, wie sie ihr Leben führen möchten. Das geht mit einer Entscheidungsschwierigkeit einher, die sich nicht mehr um existenzielle, ökonomische Probleme dreht, sondern um einen philosophischen Sinn im Leben (Was will ich eigentlich?). Schulze betrachtet diesen Anstieg von Wahl-möglichkeiten unabhängig von der sozialen Lage des Individuums. Der entscheidende Prozess, welcher das Subjekt näher in den Fokus rückt, ist der Wechsel von der Außenorientierung zur Innenorientierung (Schulze, 2005, S.35).
Außenorientierung : Diese Orientierung hat ihren Ursprung in der Geschichte. Bis vor einigen Jahrzehnten stand das Überleben im Vordergrund und kaum ein Gedanke konnte an ein schönes Leben verschwendet werden. Es galt sich mit den Umständen zu arrangieren.
Ein Beispiel für eine Außenorientierung ist die Anschaffung eines Autos. Wenn das Auto angeschafft ist und es seinen praktischen Zweck erfüllt, sind die äußeren Kriterien erfüllt. Anders bei der Innenorientierung.
Innenorientierung: Hier erfüllt das Auto erst seinen Zweck, wenn es über den Notwendigkeitsaspekt (Transport) hinaus auch den erhofften Erlebniswert (bspw. Fahrgefühl) erfüllt oder übertrifft. Dass der Erlebniswert von Produkten jeglicher Art in den letzten Jahren steigende Bedeutung bekam, kann man an zahlreichen Beispielen festmachen.
Durch die Innenorientierung rückt das Selbst stärker in den Mittelpunkt und das Subjekt wird zum Gestalter seiner Umgebung. Das konstruktivistische Paradigma ist die Grundlage für die Erlebnisgesellschaft. Man wird nicht mehr von außen gelenkt und beeindruckt, sondern man legt Bedeutungen in die Dinge hinein.
Wenn man diese innenorientierte Sichtweise zugrunde legt, stellt sich die Frage; wie kann das Subjekt seine Umgebung bzw. deren Bedeutungen so beeinflussen, dass das Leben als schön und lebenswert wahrgenommen werden kann? Schulze führt hier den Begriff der Erlebnisrationalität an. „Erlebnisrationalität ist der Versuch, durch Beeinflussung äußerer Bedingungen gewünschte subjektive Prozesse auszulösen.“ (Schulze, 2005, S.38)
Handeln ist folglich vor allem auf das Erlebnis gerichtet, welches Prozesse im Subjekt auslöst. Reflexion wird hier zu einem wichtigen Prozess bei der Bildung von subjektiver Wirklichkeit. Das spätere Bewerten des Erlebnisses macht nicht nur ein erneutes Erleben möglich, es festigt auch Handlungstendenzen. Die Umstände werden vom Individuum so manipuliert, dass es die Ereignisse als möglichst schön reflektieren kann (Schulze, 2005, S.55ff). Diese Grundannahmen sind das Fundament der Milieutheorie und damit auch dieser Forschungsarbeit.
3.2.1 Stil
Der persönliche Stil, bezeichnet eine zeitlich stabile Komponente, in der sich das Subjekt selbst erkennt, aber auch von außen erkannt wird (Schulze, 2005, S.102ff). Aus Sicht einer Gesellschaftstheorie ist damit jedoch mehr gemeint als eine bestimmte Art, sein Instrument zu spielen. Lebensstil beinhaltet die Wahl der Möbel, den Haarschnitt, die Art zu sprechen, das Verhalten und vieles mehr. Stil, bezeichnet den symbolischen Ausdruck der Lebenslage im sozialen Raum, nicht nur bei Individuen, sondern auch ganzer Gesellschaftsgruppen die sich symbolisch von anderen Gesellschaftsgruppen abgrenzen (Diaz-Bone, 2010, S.30). Schulze unterscheidet drei Dimensionen des Stils: Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie. Genuss ist körperliches Erleben in Verbindung mit der entsprechenden kognitiven Repräsentation, die positiv wahrgenommen wird (Schulze, 2005, S.105ff).
Stillvoll, in der umgangssprachlichen Bedeutung heißt, ein Gefühl für den guten Geschmack zu haben. Wobei der gute Geschmack aus der „alltäglichen Daseinsgestaltung bestimmter Personen, sozialer Einheiten, Bevölkerungsteile und ggf. ganzer Gesellschaften“ resultiert (Hillmann und Hartfiel, 1994, S.489). Doch um das Prädikat „stilvoll zu sein“ von anderen zugeschrieben zu bekommen, muss man nicht nur eine bestimmte Art des Genusses pflegen, sondern auch eine Art, die möglichst einzigartig ist, um sich von anderen zu unterscheiden. Distinktion als zweite Dimension des Stils beschreibt die Abgrenzung von anderen. Man macht deutlich, wer man ist und zu wem man nicht gehören möchte. Die Lebensphilosophie ist die Grundgesamtheit der Lebenseinstellung und die dritte Dimension des Stils. Porsche 911 oder Bioladen? Dies ist sicher auch eine Frage der Distinktion, aber mehr noch der Lebensphilosophie. Da sich aber Menschen im Zusammenleben an anderen Menschen orientieren, entsteht der Stil nicht aus dem Nichts, sondern er überschneidet sich mit dem Lebensstil anderer Menschen und orientiert sich an ihnen. Die Komponenten, aus denen sich der Lebensstil zusammensetzt, werden später für Erhebungsinstrumente relevant sein und deswegen jetzt noch näher beschrieben.
Genuss: Genuss bezeichnet einen „psychophysischen Zustand positiver Valenz, körperlicher Reaktion und kognitiver Repräsentation“ (Schulze, 2005, S.105). So weit die Definition von Schulze. Relevant für diese Arbeit ist, dass sich Genuss kategorisieren lässt in somatischen und geistigen Genuss. Wobei man eine klare Trennung der beiden nicht vollziehen kann. Ein Buch zu lesen ist ein körperlicher wie auch geistiger Genuss, jedoch spielt der Körper hier eine untergeordnete Rolle. Der Genuss ist folglich tendenziell geistig. Einen Aspekt der alltagsästhetischen Schemata bildet das Genussschema ab. Jedes Schema und damit auch jedes Milieu hat eine Tendenz zur Kontemplation oder Körperlichkeit.
Distinktion: Distinktion spielte schon bei Bourdieu eine große Rolle, jedoch resultiert distinktives Verhalten bei Schulze nicht aus einem unbewussten Habitus, sondern aus bewussten Entscheidungen gegen ästhetische Zeichen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Unterschieden werden drei Arten von Distinktion: antibarbarisch, antiexzentrisch und antikonventionell.
Barbarisch – ein Begriff aus Bourdieus Terminologie – bezeichnet den Geschmack der Beherrschten. Es geht um reines Vergnügen bei dem der ästhetischen Anspruch nicht im Vordergrund steht, um Quantität statt Qualität. Antibarbarisch bezeichnet folglich, die Ablehnung dieses Geschmacks und der entsprechenden Zeichengruppen.
Antiexzentrische Distinktion hingegen kann als Ablehnung gegen das Andersartige verstanden werden. Das Außergewöhnliche, das Besondere, das Merkwürdige wird gemieden.
Antikonventionell bezeichnet eine Ablehnung von festen Strukturen. Gewöhnliches und Herkömmliches wie Tradition bspw. gilt als borniert, veraltet und wird infrage gestellt.
Lebensphilosophie: Wie oben schon kurz erwähnt, soll in dieser Arbeit unter Lebensphilosophie die Grundgesamtheit der Lebenseinstellung verstanden werden. Ähnlich wie Distinktion bildet sich die Lebensphilosophie in der Wahl von alltagsästhetischen Zeichen ab. So wird der Gang durch ein Lebensmittelgeschäft und die dort gewählten Güter zur Frage der Lebensphilosophie. Auch hier unterscheidet Schulze drei Kategorien, die noch genauer definiert werden müssen: Perfektion, Harmonie und Narzissmus.
Perfektion als Lebensphilosophie spiegelt den Hang zur Vollkommenheit wider. Ein Erlebnis muss möglichst unübertrefflich sein. Dass dieses Ideal nur schwer erreicht werden kann, macht das Erlebnis zu etwas Besonderem, zu etwas Seltenem.
Harmonie hingegen ist eine Lebensphilosophie der schönen Welt. Negative Seiten werden ausgeblendet, Ungewöhnliches, Nonkonformistisches wird gemieden, Ordnung ist das vorherrschende Paradigma.
Narzissmus beschreibt eine Philosophie, die das Subjekt in den Mittelpunkt rückt. Die Inszenierung des Ichs wird in zahlreichen Medien propagiert. Formate, die darauf abzielen, den einen besonderen Menschen aus einer großen Masse anderer Menschen zu suchen, sind metaphorisch für die narzisstische Lebensphilosophie.
3.2.2 Alltagsästhetische Schemata
Bei Alltagsästhetischen Schemata handelt es sich um intersubjektive Verbindungen zwischen Zeichen und Bedeutung. Beispielsweise kann man dem Trinken von Champagner eine intersubjektive Bedeutung von Glamour und Prestige abgewinnen. In den verschiedenen Schemata finden sich verschiedene Kombinationen dieser Zeichen-Bedeutungs-Verbindungen. Sie bilden einen „kleinsten gemeinsamen Nenner [...]“ (Schulze, 2005, S. 125). Diese Verbindungen lassen sich in Gruppen zusammenfassen, die erstens kulturelles Allgemeingut sind, zweitens gemeinsame Bedeutungskomponenten besitzen und drittens von den Mitgliedern der Deutungsgemeinschaften mit Bedeutungen verbunden werden, welche sich ähneln (Schulze, 2005, S.128).
Hochkulturschema: Die älteste und damit auch bekannteste Zeichengruppe ist das Hochkulturschema. Es definiert sich über ein kontemplatives Genussschema, eine antibarbarische Distinktion und eine perfektionistische Lebensphilosophie.
Hochkultur möchte als exklusiv, selten, elitär und vergeistigt verstanden werden. Evident ist, dass die Genüsse selten körperlicher Natur sind. Konzentration und Kontemplation gehören zum Konsumverhalten. Auch sind Darbietungen formal strukturiert und historisch aufgeladen. Der hohe ästhetische Anspruch ist ein weiteres Merkmal des Hochkulturschemas. Man konsumiert bei Weitem nicht alles und vor allem nicht vorrangig zum Vergnügen. Distinktion richtet sich gegen das Einfache, das leicht zu Erlernende und das Triviale. Genuss ist im Hochkulturschema eine Form der Disziplin.
Trivialschema: Im Gegensatz zum Hochkulturschema ist das Genussschema hier tendenziell körperlich. Hausmannskost, gemütliche Polsterecken, Volksmusik, Dorffeste und Geselligkeit gehören zur Zeichengruppe des Trivialschemas. Distinktiv verhält man sich gegenüber dem Exzentrischen. Man möchte nicht aus dem Rahmen fallen, Querdenker sind nicht gerne gesehen und konservative Werte dominieren das Bild. Lebensphilosophisch herrscht das Prinzip der Harmonie.
Spannungsschema: Ähnlich dem Trivialschema herrscht ein körperliches Genussschema vor, jedoch ein wesentlich aktiveres. Unternehmungen, laute Musik, Aktivität, Abwechslung zeichnen das Spannungsschema aus. Distinktiv verhält man sich gegenüber alteingesessenen Strukturen, Biedermännern, Langweilern und Konventionalität. Narzissmus ist hier das vorherrschende Prinzip der Lebensphilosophie.
Tabelle 1 Überblick Alltagsästhetische Schemata (Schulze, 2005, S.163)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2.3 Milieutypen
Die oben beschriebenen alltagsästhetischen Schemata, die Schulze als Kombinationsmöglichkeiten verstanden wissen möchte, bilden das Fundament der Milieutypen. Jeder Typ zeichnet sich durch die Nähe bzw. Distanz zu einen oder mehreren Schemata aus. Ähnlich wie Bourdieu mithilfe der Kapitalsorten, konstruiert Schulze einen dreidimensionalen Raum aus den alltagsästhetischen Schemata und je nach Position in diesem Raum lässt sich die Zugehörigkeit oder Nähe eines Individuum zu einem Milieu beschreiben (Schulze, 2005, S.157-158).
Soziale Milieus definiert Schulze als Gruppen die spezifische Existenzformen pflegen und eine erhöhte Binnenkommunikation aufweisen. Sie unterscheiden sich durch die Binnenkommunikation von zufälligen Ähnlichkeitsgruppen.
Niveaumilieu: Das Niveaumilieu ist eine soziale Gruppe, die sich durch hohe Bildung und ein Alter über 40 auszeichnet. Man hört klassische Musik, liest qualitativ hochwertige Tageszeitungen, Museumsbesuche stehen auf der Tagesordnung zusammen mit Oper und Theater. Im Mittelpunkt steht der kritisch intellektuelle Kulturkonsum. Distinktiv verhält sich das Niveaumilieu gegenüber anderen Milieus. Einfache Unterhaltungsmusik wie Volksmusik oder Popmusik werden gemieden. Kitschromane, Trachtenkleidung gehören nicht zum guten Geschmack. Das Niveaumilieu zeichnet sich durch eine besondere Nähe zum Hochkulturschema aus. Der Bildungsgrad spielt eine überdurchschnittliche Rolle und man versteht sich als etwas Besseres. Dieses Muster zieht sich durch alle Lebensbereiche. Im Niveaudenken spielt auch die Rangordnung der Hierarchie eine große Rolle. Auch im Genuss spiegeln sich niveautypische Zeichen wider. „Alle Bedeutungsebenen der alltagsästhetischen Praxis des Hochkulturschemas sind auf Niveaustreben ausgerichtet. Kontemplation ist das Genussschema konzentrierter Hingabe an das Höhere“ (Schulze, 2005, S.285). Das Niveaumilieu ist noch am stärksten geprägt durch das Prinzip des außenorientierten Handelns.
Harmoniemilieu: Wie im Niveaumilieu findet man im Harmoniemilieu vorwiegend Menschen im Alter über 40 Jahren. Die Schulbildung ist relativ niedrig und überschreitet selten die mittlere Reife. Es zeichnet sich durch distinktives Verhalten gegenüber dem Hochkulturschema und durch Nähe zum Trivialschema aus. Im Allgemeinen ist das Harmoniemilieu eher zurückhaltend. Man fällt nicht gerne auf und sucht das Konventionelle und das Praktische. Daher auch der Name dieses Milieus; Harmonie und Einheit als Lebensphilosophie. Man hält sich gerne zurück, versucht sich mit den äußeren Umständen zu engagieren und ist eher skeptisch gegenüber Veränderungen. Das Konzept der Harmonie spiegelt sich auch im Medienkonsum wieder. Heimatfilme, Groschenromane und Musikantenstadel gehören zu den bevorzugten Formaten.
Integrationsmilieu: Das Integrationsmilieu ist das Milieu des Durchschnitts. Es vereint Zeichen des Trivial- und Hochkulturschemas. Beide Schemata werden aber nur in verminderter leichter Form angewendet. Besonders evident ist, dass dieses Milieu keine eigenen Zeichen hervorbringt, sondern die Zeichen anderer Milieus übernimmt und mischt. Ähnlich dem Harmoniemilieu ist Konformität eine wichtige Eigenschaft. Schulze spricht hier vom Normalsein als Glücksstrategie (Schulze, 2005, S.302) .
Selbstverwirklichungsmilieu: Das Selbstverwirklichungsmilieu grenzt sich besonders deutlich durch sein Alter ab. Im Gegensatz zu den oben genannten Milieus finden sich hier Menschen unterhalb von 40 Jahren wieder. Das alltagsästhetische Schema ist eine Mischform aus Spannungsschema und Hochkulturschema. Ablehnend verhält man sich gegenüber dem Trivialschema. Der Student ist ein typischer Vertreter dieses Milieus. Man ist weltoffen, karriereorientiert, gesellig, und originell. In seiner Freizeit trifft man diesen Milieutyp in Studentenkneipen, in der Kulturszene aber auch im Kino, bei Yoga-Kursen und bei Weiterbildungsveranstaltungen. Die treibende Kraft bei der Wahl des Jobs oder der Freizeitangebote ist die Selbstverwirklichung. Auch die berufliche Karriere wird stark unter diesem Aspekt betrachtet.
Unterhaltungsmilieu: Das Unterhaltungsmilieu ist dem Spannungsschema am nächsten. Wie beim Selbstverwirklichungsmilieu ist ein Alter unter 40 Jahren typisch. Bildungsgrad sowie berufliche Stellung sind unterhalb des Selbstverwirklichungs-milieus einzuordnen. Der Medienkonsum ist auf Action ausgerichtet. Auch informative Inhalte werden am liebsten mit emotionalem Beiwerk konsumiert. Es handelt sich hier um ein Milieu, das wie das Selbstverwirklichungsmilieu hoch mobil ist. Immer auf der Suche nach neuen Erlebnissen empfindet man das Zuhausebleiben als unerträglich. Elementar ist die Nähe zum Harmoniemilieu, auch wenn hier nur einzelne Eigenschaften aufgegriffen werden.
Tabelle 2 Überblick Zeichenkonfiguration der Milieus (Schulze, 2005, 291ff)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2.4 Kritik
Ein Kritikpunkt an der Erlebnisgesellschaft setzt an dem Fundament der Theorie an; die psychophysische Semantik, die Ausgangspunkt für die freie Wahl des Individuums im Dschungel der alltagsästhetischen Schemata ist, scheitert genau dort, wo ökonomische Zwänge nach wie vor regieren. Die unter 3.1.6 erwähnte Pisa-Studie bspw. zeigt, dass ökonomischen Umstände durchaus noch einen Einfluss haben. Auch wenn der Übergang von der Knappheits- zur Überflussgesellschaft vorrangeschritten ist, gilt das nicht für alle Gesellschaftsmitglieder. Der Lebensstil ist folglich nicht für alle frei wählbar (Kohl, 2006, S.40, Strasser und Nollmann, 2007, S116, Wurm, 2006, S.66).
3.3 Szenen
Wie der Titel dieser Arbeit schon verrät, dreht sie sich um die Deutschschweizer Jazzszene. Doch wie definiert sich eine Szene?
Zunächst umfasst eine Szene weit mehr als jenen Teil, welcher mit dieser Untersuchung erfasst werden kann. Musikschulen, Klubs, Festivals und Musiker sind nur ein Teil dessen, was eine Szene ausmacht. Kritiker, Kulturzeitschriften, Labels, Rezipienten, Stiftungen gehören auch dazu. Ähnlich den Milieus ist eine klare Abgrenzung nicht möglich. Vielmehr bestimmt auch hier die Binnenkommunikation darüber, wo die Szene eine besonders hohe Dichte aufweist und ab wann die Grenzen verwischen. Eine Szene zeichnet sich durch einen ständigen personellen Wechsel aus (Esser, 1999, S.95). Auch muss das Objekt, um das sich die Szene bildet, nicht konstant sein. Immanent ist jedoch ein gemeinsames Interesse, ähnliche Persönlichkeiten, soziales Milieu und die daraus entstehende Selektivität (Schulze, 2005, S.496).
4. Methodik
Wenn man eine Forschungsarbeit wie die von Schulze als Grundlage heranzieht, scheint es naheliegend, eine ähnliche Methode anzuwenden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Da die vorliegende Arbeit Einschränkungen unterliegt, muss die Methodik modifiziert werden. Schulzes Untersuchung basiert auf zwei standardisierten Fragebögen (der Hauptfragebogen wurde in einem Interview mündlich erfasst, der zweite schriftlich) und einem Interviewprotokoll, in dem der Befragte nach seinem Habitus beurteilt wurde. Die Fragebögen beinhalten Skalen mit unterschiedlichen Einteilungen.
Grundsätzlich steht hier die Frage zur Debatte, inwiefern es möglich ist, mit standardisierten Verfahren subjektive Wirklichkeit zu erfassen, wo doch in diesen Verfahren das Individuum nicht zu Wort kommt. Jedoch stößt man bei Massenbefragungen wie bei Schulze (n= 1014) mit un- oder teilstrukturierten qualitativen Methoden an die Grenzen der Machbarkeit.
Wie ist also bei der Erforschung einer Musikszene zu verfahren? Das Verfahren richtet sich generell nach der Forschungsfrage bzw. der Hypothese und dem Forschungsfeld. Die Hypothese wurde bereits erwähnt:
Mitglieder der Deutschschweizer Jazzszene gehören zum Niveaumilieu bzw. zum Selbstverwirklichungsmilieu.
Naheliegend wäre eine Methodik welche die Szene in der Breite erfasst bspw. ein Fragebogen. Das hieße aber, dass die Strukturen der Szene vorher klar definieren werden müssten, um auf die Grundgesamtheit schließen zu können und Repräsentativität zu gewährleisten. Allein das sollte aufgrund der Unschärfe, die theoretische Interpretationen von sozialer Wirklichkeit mit sich bringen, zu Schwierigkeiten führen (Schulze, 2005, S. 213 ff). „Soziale Wirklichkeit meint dabei jenen Teil der erfahrbaren Wirklichkeit , der sich im Zusammenleben der Menschen ausdrückt oder durch dieses Zusammenleben und Zusammenhandeln hervorgebracht wird“ (Korte, 2010, S.12).
Eine weitere Variante wäre eine starke Einzelfallbezogenheit und eine tiefensoziologische Forschung, welche die Generalisierung jedoch erschweren würde.
Die Methode, die für diese Arbeit gewählt wurde, bewegt sich zwischen diesen beiden Extremen. Der Gesamtüberblick wird gewährleistet durch die Wahl der Befragten, die als Experten über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügen, um die Szene adäquat, in den für die Hypothese relevanten Aspekten zu beschreiben. Gleichzeitig wird die Generalisierbarkeit durch Position und Erfahrung, welche die Befragten in der Szene haben, sichergestellt. Die nötige Einzelfallbezogenheit, um subjektive Bedeutungszusammenhänge zu untersuchen, ist durch die gewählten teilstrukturierten Erhebungsinstrumente ebenfalls hinreichend gewährleistet.
4.1 Forschungsparadigma
Um den Eindruck eines Methodenpotpourris zu vermeiden, sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich diese Forschungsarbeit am qualitativen Paradigma orientiert. Auch wenn in der qualitativen Forschung das Erstellen einer strengen Hypothese unüblich ist und dem Postulat der Offenheit entgegensteht (Mayring, 2002, S.28, Reiders, 2012, S.34), dient sie hier der Strukturierung und der Orientierung während des Forschungsprozesses. Ein offener Forschungsansatz wäre zwar durchaus denkbar und aufgrund des Mangels an kultursoziologischen Untersuchungen der Deutschschweizer Jazzszene auch wünschenswert gewesen, jedoch setzt er Erfahrung voraus, ohne die eine ergebnisoffene schnell zur ergebnislosen Forschung wird. Die teilnehmende Beobachtung, die auf quantitative Daten und statistische Analysemethoden zurückgreift, ist als Ergänzungs- und Kontrollinstrument zu den Experteninterviews zu sehen. Es ist sinnvoll, sich nicht ganz auf die subjektive Wirklichkeit der Befragten zu verlassen und ihr Daten direkt aus dem Feld gegenüberzustellen.
4.2 Gegenstandsbereich
Diese Arbeit untersucht die Deutschschweizer Jazzszene bzw. deren Mitglieder. Wodurch sich eine Szene definiert, wurde bereits unter Punkt 3.3 geklärt. Der Teil der Szene, welcher untersucht wurde, bestand aus Personen und Orten, die eine große Relevanz für die Szene haben. Wobei unter Personen; Musiker, Veranstalter, Publikum und Vertreter von Institutionen zu verstehen sind. Anzumerken wäre hier, dass alle Befragten mehrere Rollen gleichzeitig in der Szene übernehmen, was der Generalisierbarkeit zuträglich war. Auch waren die Experten schon in verschiedenen Positionen in der Szene tätig.
Die teilnehmende Beobachtung befasst sich ihrerseits ausschließlich mit dem Publikum.
4.3 Triangulation
4.3.1 Datentriangulation
Triangulation ermöglicht einen breiten Blickwickel, erweiterte Erkenntnis-möglichkeiten und unterschiedliche Zugänge zum Feld (Bleuß, 2011, S.1). In dieser Forschungsarbeit wurden verschiedene Formen von Daten erhoben.
1. Qualitative Daten (Leitfadeninterview)
2. Quantitative Daten (teilnehmende Beobachtung)
Diese Daten stammen konsequent aus verschiedenen Quellen auf der personellen und örtlichen Ebene.
4.3.2 Methodentriangulation
Methodologisch stützen sich die Ergebnisse auf zwei Erhebungsmethoden (Experteninterview und teilnehmende Beobachtung) die im Folgenden noch genauer beschrieben werden.
4.4 Experteninterview
Warum wurde ein Leitfadeninterview als Erhebungsmethode gewählt? Diese Methode, erfüllt in erster Linie das Postulat der Offenheit, welche ein grundlegendes Element der qualitativen Sozialforschung ist (Lamnek, 2010, S. 322). Es wurde zwar zu Orientierungszwecken ein Leitfaden erstellt, der spezielle Informationen abfragt, jedoch ist das nicht zu vergleichen mit einem standardisierten Verfahren, in dem der Forscher vor der Erhebung festlegt, welche Informationen relevant sind. „Im Zentrumqualitativer Interviews steht die Frage, was die befragte Person für relevant erachtet, wie sie die Welt beobachtet und was ihre Lebenswelt charakterisiert“ (Froschauer und Lueger, 2003, S. 16).
Ein weiterer Punkt ist die Ganzheit, in dem die soziale Wirklichkeit erfasst werden soll. Forschern, die sich aufgrund allzu standardisierter Erhebungsmethoden auf Teilaspekte konzentrieren, wird der Blick auf umfassende Bedeutungsstrukturen verwehrt bleiben (Zelewski und Akca, 2006, S.194). Auch können durch ein offenes Erhebungsinstrument Aspekte in Erscheinung treten, die bisher unbekannt waren (wie beispielsweise das Thema der Subvention, was vor der Datenerhebung noch unbekannt war). Sollte sich die Realität als komplexer darstellen als bisher gedacht, bietet das Leitfadeninterview die Möglichkeit, diese neue Komplexität abzubilden.
Der nächste Gedanke, mit dem sich diese Methode begründen lässt, ist, dass sie die Möglichkeit bietet, auf die Befragten einzugehen und nachzufragen (Gläser und Laudel, 2010, S.42). Eine Eigenschaft, die vor allem in Forschungsfeldern nützlich ist, über die wenige Informationen vorliegen. Ein weiterer Vorteil, der auch eine Rolle spielt, ist, dass durch die große Informationsmenge die hypothesen-generierende Funktion von qualitativer Sozialforschung dazu beiträgt, Anschluss-forschung zu erleichtern und nicht nur Vorwegnahmen zu überprüfen.
4.4.1 Analyse
Die Inhaltsanalyse nach Mayring ist ein Hybridmodell aus qualitativen und quantitativen Methoden. Sie versucht, zwei Gegensätze zu vereinen. Das strukturierte Vorgehen der quantitativen Methoden mit der Offenheit der qualitativen Methoden. Mit einem vorher festgelegten Kategoriesystem ist freilich der Blick auf das Material eigeschränkt (Gläser und Laudel, S.198). Abhilfe kann hier das ständige Anpassen der Kategorien während der Analyse schaffen. Eine abgewandelte Form der mayringschen Inhaltsanalyse fand in dieser Arbeit Anwendung: die variablenorientierte qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel. Im Gegensatz zur Inhaltanalyse von Mayring bietet diese Variante die Möglichkeit, die Variablen permanent während der Analyse anzupassen, wohingegen Mayring vorschlägt, 30-50 % des Materials zu analysieren, das vorher entworfene Kategoriensystem anzupassen und anschließend das Material erneut durchzuarbeiten (Gläser und Laudel, S.199). Abgesehen davon, dass sich dieses Vorgehen aufgrund der Geschlossenheit des Kategoriensystems nur beschränkt als offen bezeichnen lässt, ist es zeitintensiver als die variablenorientierte Inhaltsanalyse. Ein weiterer Vorteil ist, die computergestützte Analyse, welche von Gläser und Laudel angeboten wird und die Bearbeitungszeiten beträchtlich reduziert. Es wurden hier mithilfe von Word-Makros Variablen erstellt, mit denen der Text markiert, eingeordnet und paraphrasiert werden konnte. Quellverweise werden automatisch erstellt und erleichtern das Wiederfinden. Auch macht dieses Verfahren die Analyse durch diese Quellenverweise intersubjektiv nachvollziehbar.
4.5 Teilnehmende Beobachtung
Wie bereits unter 4.1 erwähnt nimmt diese Methode eine sekundäre Rolle ein. Die Teilnehmende Beobachtung hat auch wie das Interview eine lange Tradition in der Sozialforschung und wird als Methode „par excellence“ bezeichnet (Lamnek, 2010, S.498 ff). Nicht ohne Grund, wenn man bedenkt, dass sie der einzige Weg ist, unsere Umwelt überhaupt wahrzunehmen. Der wesentliche Unterschied zur wissenschaftlichen Beobachtung ist die „planmäßige Schärfung der Sinneswahrnehmung“ (Grümer , 1974, S.11).
Einer der wichtigsten Gründe, die zur Entscheidung für diese Methode führte, ist der enge Kontakt zum Feld. Literaturrecherche und auch Experteninterviews erlauben nur einen Blick aus der Ferne. Auch wenn die subjektive Sinneswahrnehmung des Beobachters Grundlage der Daten ist, so liefern die teilnehmende Beobachtung am ehesten ein Abbild der sozialen Wirklichkeit. Kein anderes Erhebungsinstrument bietet mehr Nähe zum Feld. Die Beobachtung konnte aus ökonomischen und zeitlichen Gründen nur in Form einer Teilerhebung stattfinden. Das bringt den Nachteil mit sich, dass die Repräsentativität unsicher ist, da die Grundgesamtheit und deren Merkmalsausprägung unbekannt sind.
4.5.1 Analyse
Für die Analyse von Beobachtungsprotokollen wird häufig die Inhaltsanalyse angewandt, jedoch muss dafür das Datenmaterial in Textform vorliegen, was für diese Arbeit nicht zutrifft. Alle Daten wurden mithilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet.
5. Durchführung
5.1 Feldzugang
Der Zugang zum Feld ist in jeder Forschungsarbeit entscheidend und beeinflusst die Ergebnisse (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2008, S.39ff). Der Weg in die Jazzszene steht prinzipiell für jeden offen, jedoch musste ein Zugang gewählt werden, welcher dem Forschungsinteresse diente und die Rahmenbedingungen dieser Arbeit gerecht wurde.
Möglichkeiten, eine Szene zu erforschen, gibt es viele, jedoch müssen die Eigenschaften von Szenen beachtet werden. Gemeint ist damit der personelle Wechsel (vgl. 3.3). Günstig für die Gewinnung valider Daten sind Quellen, die sich zeitlich und räumlich möglichst weit erstrecken und eine hohe Kontinuität aufweisen. Experten sind aus diesem Grunde vorzuziehen.
5.2 Theoretisches Sampling
Um Merkmalsausprägungen empirisch zu untersuchen, müssen Datenquellen ausgewählt werden. Die Fallauswahl in dieser Forschungsarbeit basiert in erster Linie auf einem einfachen Prinzip. Es wurden bei den Interviews, wie auch bei den Beobachtungen Personen und Orte ausgesucht, ohne die die Deutschschweizer Jazzszene – in der Form wie sie zum Zeitpunkt der Erhebung vorzufinden war – nicht existieren würde. Das bedeutete für die Auswahl, dass ein höchstmögliches Maß an Relevanz angestrebt werden musste. Relevanz manifestiert sich in der unmittelbaren Erkennbarkeit von Strukturen. Das heißt, auch ein Laie, der sich noch nie mit der Deutschschweizer Jazzszene auseinandergesetzt hat, kann diese Strukturen ohne großen Aufwand erkennen. Des Weiteren wurde eine möglichst heterogene Fallauswahl getroffen, um der Maximierung von Unterschieden Rechnung zutragen (Przyborski and Wohlrab-Sahr, 2008, S. 177ff).
5.3 Experteninterview
5.3.1 Interviewleitfaden
Bevor man Experten aufsucht, muss die Fragestellung klar sein. Ausgehend von der Hypothese wurden Variablen entwickelt, auf deren Basis Leitfragen erstellt wurden. Die Variablen, die im Experteninterview zur Anwendung kamen, sind qualitativer Natur. Es ging hier nicht darum, die Experten zu fragen, wie viele Besucher sich unauffällig kleiden oder Ähnliches. Vielmehr ist die Erfahrung des Experten im Forschungsfeld von Bedeutung. Die Variablen wurden so gewählt, dass sie sich inhaltlich überschneiden. Das sollte ermöglichen, dass die Experten auf Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven antworten konnten. Prinzipiell folgte auch der Interviewleitfaden (Anhang C: Interviewleitfaden) dem Postulat der Offenheit. Das bedeutet, dass die Experten offene Fragen gestellt bekamen und in ihren Antwortmöglichkeiten weitgehend unbeschränkt waren. Wurde die Frage nicht ausreichend beantwortet, wurden Detailfragen gestellt. Die Rolle des Interviewers war in jedem Fall eine passive, um den Gesprächsfluss nicht zu unterbrechen.
Grundsätzlich wurden die Fragen auf vier Variablen aufgebaut.
1. Genussschema
2. Distinktion
3. Lebensphilosophie
4. Sozialstatus
Diese vier Variablen mussten im Interviewleitfaden verarbeitet werden und bildeten die theorierelevanten Komponenten. Die ersten drei Variablen wurden bereits unter Punkt 3.2.1 erläutert. Die vierte Variable erfasst den Bildungsgrad und das Alter. Die folgende Matrix gibt Aufschluss darüber, welche Variable(n) in den einzelnen Fragen vorkommen und welche Inhalte von den Befragten voraussichtlich zu erwarten waren.
Tabelle 4 Variablen im Leitfaden1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fragen 3 bis 13 waren der Kern des Leitfadens. Frage 1 und 2 bildeten den Intervieweinstieg und erfüllten den Zweck des Erzählstimulus. Natürlich wurden auch hier Informationen gewonnen, jedoch blieben diese, unter anderem aus Gründen der Anonymität, in der Analyse unberücksichtigt. Fragen 14 und 15 dienen dazu, Ideen für Anschlussforschungen zu sammeln. Frage 16 ist als Feedback für den Interviewer gedacht, um Fehler zu eliminieren.
Nach jedem Interview wurde ein Gedächtnisprotokoll (Anhang E: Protokolle und Transskripte) angefertigt, in dem formelle Eindrücke, die Umstände des Interviews und Erinnerungsfragmente des Interviewers notiert wurden.
5.3.2 Gewinnung von Interviewpartnern
In der vorliegenden Untersuchung wurden alle Befragten per E-Mail kontaktiert (Anhang A: Kontakt Email). In dieser Email befanden sich alle nötigen Informationen über den Forscher und das Vorhaben. Im Falle der Befragten 3 und 4 wurde auf Wunsch ein Telefongespräch geführt. Eine Woche vor jedem Interview wurden den Befragten einige ausgewählte Fragen zugesendet, um ihnen die Gelegenheit zu geben, sich eine Vorstellung vom Interview zu machen und eventuell einige Vorüberlegungen anzustellen.
5.3.3 Forschungsethik
Um den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Arbeit zu genügen, wurde den Befragten mitgeteilt, dass die Befragung anonym und absolut freiwillig ist. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass ein Mitschnitt angefertigt wird und erläutert, wie mit den Daten weiter verfahren wird.
Zusätzlich wurde den Experten vor dem Interview eine Einverständniserklärung (Anhang B: Einverständniserklärung) vorgelegt, in der Anonymität zugesichert, die Freiwilligkeit erneut erwähnt und das weitere Verfahren mit den Daten nochmals erläutert wurde. Diese Erklärung war von den Befragten vor dem Interview zu unterzeichnen. Auch konnte das Interview jederzeit abgebrochen werden, ohne dass für den Befragten Nachteile entstehen konnten.
5.3.4 Auswahlkriterien
Die Auswahl der Experten erfolgte zuerst nach dem Kriterium der Erreichbarkeit. In Bezug auf Experten ist es desto schwieriger, einen Experten für ein Interview zu gewinnen, je größer die Fachkenntnis und Autorität des Betroffenen ist. Aus diesem Grunde konnte ein Sampling im herkömmlichen Sinn – also dem Suchen von Interviewpartnern und dem Auswählen aus der Gesamtsumme nach bestimmten Kriterien – nicht umgesetzt werden. Vielmehr wurden Recherchen über wichtige Strukturen der Szene angestellt und den Personen, die leitende Positionen in Institutionen innehaben, eine Anfrage zugesendet. Da die Zahl der relevanten Institutionen der Szene relativ übersichtlich ist, schlägt sich das in der Menge der Untersuchungseinheiten nieder. Nicht zuletzt ist die Zahl der Experten aus methodischen Gründen begrenzt. Transkription und Analyse von Interviews sind aufwendige Verfahren. Für eine Bearbeitungszeit von sechs Monaten sind max. 6 bis 7 Interviews à 70 Minuten durchführbar (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2008, S.186). Qualitative Sozialforschung erfordert außerdem eine tiefgehende Analyse, die nur wenige Untersuchungseinheiten zulässt (Gläser and Laudel, 2010, S.37).
Per Definition sind Experten Personen, die über eine spezifische Art von Rollenwissen verfügen (Przyborski and Wohlrab-Sahr, 2008, S.132). Um sicherzustellen, dass dieses Rollenwissen hinreichend vorhanden ist, war Bedingung, dass die Experten länger als fünf Jahre in ihrer Institution tätig waren. Die folgende Tabelle gibt darüber Aufschluss, welcher Institution die einzelnen Befragten zuzuordnen sind und welche Funktion sie dort erfüllen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass alle Experten in ihren Biografien mehrere Positionen in der Szene innehatten und die Tabelle nur den aktuellen Stand wiedergibt.
Tabelle 5 Institutionen und Rolle der Experten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 ++ Antwort enthält höchstwahrscheinlich für die Variable relevante Information + Antwort enthält wahrscheinlich für die Variable relevante Information - Antwort enthält wahrscheinlich keine für die Variable relevante Information
- Quote paper
- Andre Fritzsche (Author), 2014, Die Jazzszene und ihre Zugehörigkeit zum Hochkulturschema, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935449
Publish now - it's free






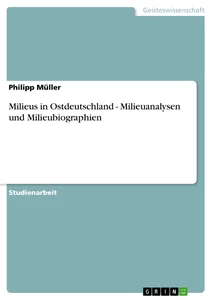




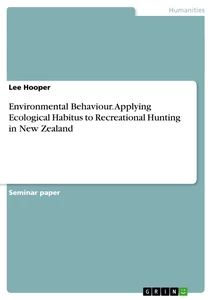










Comments