Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Situation der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Stand 31.12.2002)
3. Theorie
3.1. Die Posttraumatische Belastungsstörung aus historischer Sicht
3.2 Gegenwärtige Nosologie
3.2.1 Diagnosekriterien der PTBS
3.2.1.1 Das Ereigniskriterium
3.2.1.2 Die Hauptsymptomgruppen (B, C und D)
3.2.1.3 Das Zeitkriterium E
3.2.1.4 Das Kriterium F
3.2.2 Auswirkungen der Unterschiede zwischen DSM-IV und ICD-10 auf die erhobenen Prävalenzen
3.2.3 Subsyndromale PTBS
3.3 Verlauf
3.4 Komorbidität
3.5 Epidemiologie
3.5.1 Prävalenz traumatischer Ereignisse und der PTBS in der Normalbevölkerung
3.5.2 Prävalenz der PTBS in Risikopopulationen
3.5.3 Prävalenz der PTBS bei der Berufsfeuerwehr
3.5.4 Prävalenz der PTBS bei der Freiwilligen Feuerwehr
3.6 Ätiologie
3.6.1 Lerntheoretische Ansätze
3.6.2 Das Modell der chronischen PTBS von Ehlers und Clark (1999)
3.6.3 Das biopsychosoziale Modell nach Barlow (1988)
3.6.4 Psychobiologische Ansätze
3.6.5 Die Dual Representation Theory
3.7 Prädiktoren der PTBS
3.7.1 Definition von Stress aus kognitiver Perspektive
3.7.2 Das Stressverarbeitungsmodell von Lazarus
3.7.3 Prädiktoren
3.7.3.1 Kontrollüberzeugungen
3.7.3.2 Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung
3.7.3.3 Soziale Unterstützung
3.7.3.4 Coping-Strategien
3.7.3.5 Coping als Mediatorvariable
3.7.3.6 Kritische Lebensereignisse und Alltagsbelastungen
3.7.3.7 Peritraumatische Dissoziationen
3.8 Zusammenfassung
4. Fragestellungen und Hypothesen
4.1 Epidemiologische Fragestellungen zur Traumaexposition und PTBS-Prävalenz
4.2 Fragestellungen und Hypothesen zu den einzelnen Prädiktoren
4.3 Fragestellungen zum Zusammenwirken der einzelnen Prädiktoren
5. Methoden
5.1 Durchführung
5.2 Beschreibung der Stichprobe
5.3 Untersuchungsverfahren
5.3.1 Allgemeine Angaben zur Person und Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr
5.3.2 Die Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS)
5.3.3 Der Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (RAND PDEQ)
5.3.4 Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)
5.3.5 Der Fragebogen zur Sozialen Unterstützung – eine eigene Entwicklung
5.3.6 Der Fragebogen zum Umgang mit traumatischen Erlebnissen (FUTE)
5.3.7 Die „Social Readjustment Rating Scale“ (SRRS)
5.3.8 Fragebogen zur Erfassung emotional relevanter Alltagsereignisse (ATE 36)
5.3.9 Das Brief Symptom Inventory (BSI)
5.4 Statistische Verfahren
5.5 Datenanalyse
6. Ergebnisse
6.1 Ergebnisse zur Fragestellung 1
6.1.1 Potentiell traumatisierende Einsätze
6.1.2 Potentiell traumatische Ereignisse aus anderen Bereichen
6.1.3 Das belastendste Ereignis
6.1.4 Traumaprävalenz
6.1.4.1 Konservatives DSM-IV-Kriterium
6.1.4.2 Liberales Traumakriterium
6.1.4.3 Sehr liberales Traumakriterium
6.2 Ergebnisse zur Fragestellung 2
6.3 Testtheoretische Ergebnisse
6.4 Ergebnisse zu den Fragestellungen 3 bis 10
6.5 Ergebnisse zu den Fragestellungen 11 bis 16
6.5.1 Puffermodell (Moderatorhypothese)
6.5.2 Potenzierungsmodell
6.5.3 Mediatorhypothese
6.5.4 Soziale-Unterstützungs-Aktivierungs-Hypothese
6.5.5 Schutzschildmodell
6.5.6 Coping-Aktivierungs-Hypothese
6.6 Zusatzauswertung
6.6.1 Komorbiditäten
6.6.2 Allgemeine Beschwerden als abhängige Variable
6.7 Zusammensfassung der Ergebnisse
7. Diskussion
7.1 Epidemiologische Ergebnisse
7.2 Ergebnisse zu den Prädiktoren
7.3 Methodische Einschränkungen
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Psychische Belastungen in Folge traumatischer Ereignisse sind, im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, erst seit relativ kurzer Zeit Gegenstand klinisch-psychologischer Forschung. In Anbetracht der Tatsache, dass schon seit Jahrhunderten in der Literatur und in Augenzeugenberichten über Leid und Schrecken, die durch Naturkatastrophen, Kriegserlebnisse und Folter bei Menschen verursacht wurden, berichtet wurde, erscheint die langjährige Ignorierung dieses Phänomens in der Klinischen Psychologie schwer nachvollziehbar. Erst die extrem belastenden Kriegserfahrungen und die dadurch ausgelösten starken psychischen Beeinträchtigungen vieler Vietnamveteranen führten erstmalig zur Aufnahme der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS bzw. posttraumatic stress disorder, PTSD) als eigenständige psychiatrische Diagnose in die Nomenklatur des DSM-III (APA, 1980), was mit einem wachsenden Interesse an diesem Forschungsgebiet koinzidierte. Die Posttraumatische Belastungsstörung als extremste Form posttraumatischer psychischer Belastung ist durch die Kernsymptome des ungewollten Wiedererlebens des Traumas, des Vermeidungsverhaltens, der emotionalen Taubheit und des erhöhten Erregungsniveaus gekennzeichnet, was sich in dieser Form allerdings erst in den operationalisierten Kriterien der revidierten Fassung des DSM-III (DSM-III-R, 1987) niederschlug. Die Revision der DSM-III-Taxonomie ging gleichzeitig mit einer Unterscheidung zwischen Traumata, mit denen Menschen direkt konfrontiert sind und solchen, die beobachtet werden, einher. Dennoch richten die Forscher nach wie vor ihr Hauptaugenmerk auf die Opfer traumatischer Ereignisse, während Personen, die als Angehörige, Zeugen von Unglücken oder professionelle Helfer1 das Trauma indirekt miterlebt haben, bis heute vernachlässigt werden. Analog zur eben geschilderten Differenzierung traumatischer Ereignisse, wurde von Figley (1995) eine Unterteilung der PTBS in eine primäre und eine sekundäre traumatische Belastungsstörung vorgenommen. Während eine primäre traumatische Belastungsstörung mit dem direkten Erleben traumatischen Stress verbunden ist, stellt die sekundäre traumatische Belastungsstörung ein Konzept dar, das durch das Wissen über ein traumatisches Ereignis, das einer anderen Person widerfährt oder widerfahren ist, definiert ist.
Gerade Feuerwehreinsätze bergen das Risiko, mit multiplen, potentiell traumatischen Stressoren, ob direkter oder indirekter Natur, konfrontiert zu werden und so die Entwicklung
1In der vorliegenden Arbeit wird aus praktischen Gründen durchgehend die männliche Form verwendet.
einer primären wie einer sekundären traumatischen Belastungsstörung auszulösen.
Feuerwehrleute stehen häufig im Rahmen ihrer Tätigkeit, z.B. bei der Brandbekämpfung, die nicht selten mit Explosionen, plötzlicher Ausbreitung von Bränden oder Gebäudeeinstürzen verbunden sind, akut lebensgefährlichen Situationen gegenüber. Darüber hinaus zieht der Anblick leidender, verstümmelter und toter Menschen, die in Unfälle verwickelt waren, häufig gravierende psychische Folgen nach sich. Somit müssen Feuerwehrleute bei jedem Einsatz damit rechnen, primärem und sekundärem traumatischen Stress ausgesetzt zu werden.
Seit Ende der achtziger Jahre wurden die ersten epidemiologischen Studien zur Stressbelastung und PTBS-Prävalenz bei der Berufsfeuerwehr durchgeführt. Hierbei handelte es sich allerdings ausschließlich um Untersuchungen, die direkt nach traumatischen Ereignissen in Form von Großbränden durchgeführt wurden (z.B. Mc Farlane, 1987), wodurch die Prävalenzen überschätzt wurden und somit für die Berufsfeuerwehr nicht repräsentativ sind.
Ende der neunziger Jahre wurde vermehrt auch in Deutschland die Verbreitung posttraumatischer Symptome in dieser Population untersucht. Obwohl die Studien unabhängig von vorausgehenden traumatischen Ereignissen durchgeführt wurden, ergaben sich Prävalenzen, die bedeutend höher lagen als die, die in der Allgemeinbevölkerung vorgefunden wurden (siehe Kapitel 3.5.3). Somit muss die Berufsgruppe der professionellen Feuerwehrleute nach diesen empirischen Erkenntnissen in Bezug auf die Verbreitung der PTBS als Risikopopulation angesehen werden.
Im Vergleich zur Berufsfeuerwehr fand die Population der Freiwilligen Feuerwehr in der Literatur bis heute so gut wie keine Beachtung. In der Literatur konnte diesbezüglich lediglich eine Studie gefunden werden (Bryant & Harvey, 1996a), im deutschsprachigen Raum existieren dagegen nur unveröffentlichte Arbeiten. Über die Gründe dieser Vernachlässigung kann nur spekuliert werden. Ein Grund liegt wohl in der Natur des Ehrenamtes. Durch die freiwillige Tätigkeit bei der Feuerwehr fällt es leichter, bei auftretender Belastung den Dienst zu beenden, wodurch die untersuchte Stichprobe durch die Selbstselektion die Realität nur verzerrt widerspiegelt. Es könnte zum anderen daran liegen, dass ehrenamtliche Feuerwehrleute im Vergleich zu ihren professionellen Kollegen weniger Einsätze leisten, wodurch die Gefahr einer Traumatisierung geringer ausfällt und folglich geringere PTBS-Prävalenzen zu erwarten sind. Diese Annahme konnte in den unveröffentlichten Arbeiten empirisch bestätigt werden, wobei auch hier die PTBS weiter verbreitet war, als in der Allgemeinbevölkerung (siehe Kapitel 3.5.4).
Die vorliegende Arbeit befasst sich zum einen mit der Frage, in welchem Ausmaß Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durch die Einsätze belastet sind und wie sich diese Belastung auf ihr psychisches Wohlbefinden auswirkt. Dabei sollen epidemiologische Daten zu Art und Anzahl traumatischer Ereignisse im Rahmen dieser Einsätze erhoben, sowie das Ausmaß von Stressreaktionen bzw. die Verbreitung der PTBS in subklinischer Ausprägung oder als Vollbild untersucht werden. Die untersuchte Stichprobe besteht dabei ausschließlich aus Feuerwehrleuten, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf ehrenamtlich tätig sind. Ein seit einigen Jahren bestehender Trend macht die Untersuchung dieser Stichprobe interessant: Die traditionelle Aufgabe der Brandbekämpfung gerät zugunsten der Hilfeleistung in Not- und Unglücksfällen immer mehr in den Hintergrund (Kreisausschuß des Landkreises Marburg-Biedenkopf - Brandschutzamt, 1995). Ob letztere bei der Pathogenese posttraumatischer Belastungsstörungen bei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtigere Rolle spielen, ist bis dato nicht geklärt. Die Brisanz bei der Untersuchung traumatischer Erlebnisse und deren noxische Auswirkungen liegt auch an dem eher ländlichen Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr. Dadurch erhöht sich im Vergleich zur professionellen Tätigkeit, die überwiegend in städtische Gebiete fällt, zwangsläufig das Risiko, das Opfer persönlich zu kennen (Wagner, Heinrichs, Hellhammer & Ehlert, 2000), was sich zusätzlich pathogen auswirken kann.
Der eigentliche Schwerpunkt besteht allerdings in der Überprüfung möglicher Risikofaktoren, die die Entwicklung einer PTBS begünstigen. In der Traumaforschung konnte durchweg gezeigt werden, das Trauma- und PTBS-Prävalenzen deutlich auseinanderklaffen. Das bedeutet, dass nicht jede Person, der ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, notwendigerweise auch an einer PTBS erkranken muss. Es herrscht vielmehr Konsens darüber, dass neben Traumamerkmalen substantielle Unterschiede in den Betroffenen selbst oder deren Umwelt vorliegen, die unabhängig von der Art und der Intensität der Traumatisierung zu einer erhöhten Vulnerabilität führen. Die Überprüfung solcher Prädiktoren, deren pathogene Relevanz in anderen Risikopopulationen bestätigt werden konnte und in einigen ätiologischen Modellen Berücksichtigung finden, sowie deren Zusammenwirken steht dabei im Fokus der vorliegenden Studie.
2. Die Situation der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Stand 31.12.2002)
Der Brandschutz im Landkreis Marburg-Biedenkopf im Bundesland Hessen wird derzeit von 4519 aktiven Feuerwehrleuten aus 174 Freiwilligen Feuerwehren, worunter fünf Werksfeuerwehren zu finden sind, gewährleistet. Die Berufsfeuerwehr, wie sie vor allem in Ballungsgebieten wie Frankfurt vorzufinden sind, sind in solch ländlichen Regionen wie dieser Landkreis überhaupt nicht vertreten, so dass die Brandbekämpfung und Hilfeleitungen in Not- und Unglücksfällen ausschließlich von der Freiwilligen Feuerwehr getragen wird.
Die Mehrheit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute sind erwartungsgemäß männlichen Geschlechts, lediglich 251 Frauen (5,6%) engagieren sich aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, wobei sich allerdings seit einigen Jahren ein Trend abzeichnet, wonach der Anteil weiblicher Feuerwehrleute steigt.
Obwohl die Bezeichnung der Freiwilligen Feuerwehr impliziert, dass die Brandbekämpfung die zentrale Aufgabe des Tätigkeitsfeldes darstellt, spielen Einsätze im Rahmen des Brandschutzes in der Realität jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Von den im Jahre 2002 insgesamt 1508 geleisteten Einsätzen (ausgenommen sind hier die Feuerwehren der Stadt Marburg, die eigene Statistiken führen und in dieser Studie unberücksichtigt bleiben) im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Kreisfeuerwehrverband Landkreis Marburg-Biedenkopf) entfielen nur 388 (26%) Einsätze direkt auf die Brandbekämpfung. Das Gros der Einsätze machen technische Hilfeleistungen (706/47%) aus, worunter vor allem die Rettung oder Bergung von Unfallopfern fallen. Der Rest des Aufgabengebietes besteht aus Fehlalarmierungen (183/12%), die teilweise mutwillig, in der Mehrheit aber aufgrund technischen Versagens ausgelöst wurden und sonstigen Einsätzen (231/15%). In diesem Zeitraum wurden sieben Feuerwehrleute ernsthaft verletzt, was angesichts der vielen Einsätze und der großen Anzahl an Feuerwehrleuten doch eher gering erscheint.
Die relativen und absoluten Zahlen der verschiedenartigen Einsätze variieren in Abhängigkeit zur Lage der jeweiligen Feuerwehr teilweise erheblich. Gerade Feuerwehren, die in der Nähe von Autobahnen und Bundesstraßen liegen, leisten viel häufiger technische Hilfe bei Verkehrsunfällen, als Feuerwehren, die sich in abgeschiedenen Regionen befinden. Auch die Bevölkerungsdichte hängt mit der Anzahl der Feuerwehreinsätze zusammen.
3. Theorie
3.1. Die Posttraumatische Belastungsstörung aus historischer Sicht
Schon seit vielen Jahrhunderten gibt es Berichte über die psychischen Folgen traumatischer Ereignisse. Dabei wurden häufig Symptome beschrieben, die heute als charakteristisch für eine Posttraumatische Belastungsstörung angesehen werden und mit den Kriterien übereinstimmen, die gegenwärtig bei der Vergabe einer solchen Diagnose vorhanden sein müssen. So berichtete Samuel Pepys, der im Jahre 1666 Zeuge des Großbrandes in London war, in seinem Tagebuch sechs Monate später, dass er „bis zum heutigen Tag keine Nacht schlafen kann, ohne von großer Angst vor dem Feuer erfasst zu werden“ und dass ihn nachts „die Gedanken an das Feuer nicht losließen“ (Daly, 1983, S. 66). In dieser Schilderung werden ganz klar die für die PTBS typischen Schlafstörungen und das ungewollte Wiedererleben von bestimmten Traumaaspekten deutlich.
Einige Zeit später wurden vom Psychiater Emil Kraeplin (1899) ähnliche Symptome unter den Begriff „Schreckneurose“ subsumiert, der „ein aus mannigfaltigen nervösen und psychischen Erscheinungen zusammengesetztes Krankheitsbild [darstellt], welches sich in Folge von heftigen Gemüthserschütterungen [sic], plötzlichem Schreck, grosser [sic] Angst ausbildet und daher nach schweren Unfällen und Verletzungen, besonders nach Feuersbrünsten, Explosionen, Entgleisungen oder Zusammenstößen auf der Eisenbahn u. dergl. beobachtet wird“ (S. 520, zitiert nach Saigh, P.A., 1995, S.11).
Im Gefolge der beiden Weltkriege kamen mit „shell shock“ (Southard, 1919), „Kriegsneurose“ (Jones, 1919) und „Gefechtsneurose“ (Grinker & Spiegel, 1945) weitere Begriffe hinzu, die dieselbe Störung bezeichneten. Zurückgekehrte Kriegsteilnehmer, die an einer „Gefechtsneurose“ oder „Kampfstressreaktion“ (`combat stress reaction`) litten, wiesen dabei folgende Symptome auf: Unruhe, Aggressionen, Depressionen, Verwirrungen, Überaktivität des sympathischen Nervensystems, Konzentrationsstörungen, Stottern, Alpträume, Übelkeit und Misstrauen. Überlebende von Konzentrationslagern der Nazis klagten über ein ähnliches Störungsbild. Hier konnten noch über 15 Jahre später Symptome wie chronische Müdigkeit, Konzentrationsmangel und erhöhte Reizbarkeit festgestellt werden (Eitinger, 1962, zitiert nach Saigh, P.A., 1995, S.14).
Aufgrund der Häufigkeit dieses kriegsbedingten psychiatrischen Krankheitsbildes wurde es mit Beginn des Koreakrieges 1952 vom Nomenklatur- und Statistikausschuss der amerikanischen Psychiater unter dem Begriff „schwere Belastungsreaktion“ (`gross stress reaction`) kategorisiert und in das „Diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen“ (DSM-I; APA, 1952) aufgenommen, wobei allerdings auf operationale Kriterien für die Vergabe dieser Diagnose verzichtet wurde. Das DSM-I beschreibt diese Reaktion vage als eine flüchtige Antwort auf schweren physischen oder emotionalen Stress, d.h. wenn es zu „starken physischen Anforderungen oder extremen Belastungssituationen wie etwa bei Kriegsgefechten oder Naturkatastrophen“ (ebd., S.40) gekommen war.
In den 50 er und 60er Jahren wurden die psychischen Folgen von Natur- und Industriekatastrophen (Brandkatastrophen, Gasexplosionen, Erdbeben, Tornados u.a.) untersucht. In dieser Zeit begann man mit der systematischen Untersuchung von Belastungsreaktionen nach solchen Ereignissen, um, aufgrund der im Vergleich zu den Reaktionen auf Kriegseinsätze ähnlichen Symptome, Erkenntnisse über die Auswirkungen kriegsbedingter Katastrophen zu gewinnen.
Im DSM-II (APA, 1968) fand diese Kategorie hingegen keine Berücksichtigung mehr. In den 70er Jahren wurden in den USA vermehrt Opfer sexueller Gewalt untersucht, woraufhin der Begriff „Vergewaltigungssyndrom“ (Burgess & Holmstrom, 1974) Einzug in die Forschung hielt. Unterteilt wurde diese Störung in zwei Phasen: in eine akute und in eine langfristige Phase. Die akute Phase zeichnete sich u.a. durch Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, urogenitale und gastrointestinale Beschwerden sowie Wut und Schuldgefühle aus, während die langfristige Phase mit vergewaltigungsbezogenen Alpträumen, Vermeidungsverhalten und sexuellen Störungen einherging.
Erst 1980 wurden angesichts der unzähligen traumatisierten Vietnam-Soldaten, die in ihre Heimat zurückgekehrt waren, von der American Psychiatric Association operationale Kriterien für die Störung formuliert, die seither als Posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet wird. Nach der DSM-III-Taxonomie liegt dann eine PTBS vor, wenn sich „in der Folge eines traumatischen Ereignisses, das im allgemeinen außerhalb des menschlichen Erfahrungsbereiches liegt, bestimmte charakteristische Symptome entwickeln“, wobei „der Stressor, der das Syndrom auslöst, bei den meisten Menschen schwere Belastungssymptome hervorrufen würde“ (APA, 1980 S. 236-237) (zur Kritik an diesem Kriterium sei auf das Kapitel 4.2.1.1 verwiesen). Es wurde also hier durch die fehlende Spezifizierung des auslösenden Ereignisses erstmalig dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass völlig verschiedene Stressoren oder Traumata sehr ähnliche Störungsmuster hervorrufen. Sieben Jahre später folgte dann mit dem DSM-III-R (APA, 1987) eine revidierte Fassung des DSM-III, das sich von seinem Vorgänger dadurch unterschied, das verschiedene Klassen von Traumata, die die PTBS hervorrufen können, vorgegeben wurden (Angaben zu den aktuellen diagnostischen Kriterien siehe Kapitel 4.2.1). Die Unterscheidungsdimension dieser Klassen stellt die Nähe der Person mit einer PTBS und dem traumatischen Ereignis, nicht die Art des Traumas dar. Zur ersten Klasse der Traumata gehören schwere Belastungssituationen, mit denen die Person direkt konfrontiert war und „das eigene Leben oder die körperliche Integrität“ (ebd., S. 247) bedroht hatten. Die zweite Klasse ist charakterisiert durch die Beobachtung dieses Ereignisses, wie etwa den „Anblick eines anderen Menschen, der bei einem Unfall (…) ernsthaft verletzt oder getötet wird bzw. wurde“ (ebd., S. 247). Die dritte Klasse stellt Traumata dar, die nicht direkt erlebt sondern verbal vermittelt wurden (z.B. wenn jemand erfährt, dass einer engen Bezugsperson etwas Schlimmes zugestoßen ist).
Die Reihenfolge der genannten Klassen drückt gleichzeitig die steigende Distanz zwischen betroffener Person und Trauma aus, was nicht unbedingt auch mit einer abnehmenden Intensität einhergehen muss.
Im Jahre 1991 wurde schließlich die Störung auch in das Internationale Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10, WHO) in die Kategorie „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ aufgenommen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich die Einstellung zu diesem Krankheitsbild im Laufe des 20. Jahrhunderts grundlegend verändert hat. Es ist dabei viel Zeit vergangen von der Annahme Sigmund Freuds, die traumatisierenden Erfahrungen seiner „hysterischen“ Patientinnen seien nicht Folge sexuellen Missbrauchs sondern sexuelle Wunschphantasien (Morschitzky, 2002) bis zur Erkenntnis von Herman (1993): „Weibliche Hysterie und Kriegsneurose sind das gleiche“.
3.2. Gegenwärtige Nosologie
Der in der Forschung am häufigsten verwendete diagnostische Leitfaden ist das DSM-IV (APA, 1994), an das sich auch die vorliegende Untersuchung orientiert. Dadurch ist eine gewisse Vergleichbarkeit der hier erhobenen Daten gewährleistet. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel auch auf die DSM-IV-Kriterien eingegangen und im gegebenen Fall auf Unterschiede zum ICD-10 hingewiesen.
3.2.1 Diagnosekriterien der PTBS
Nach DSM-IV müssen folgende Kriterien für eine Diagnose erfüllt sein: das Ereigniskriterium A, die Hauptsymptome B, C und D, das Zeitkriterium E und das Kriterium (F), das sich auf den durch die PTBS hervorgerufenen Leidensdruck bezieht. Diese werden im Folgenden näher erläutert.
3.2.1.1 Das Ereigniskriterium
Die PTBS ist eine der wenigen psychischen Störungen, die schon in ihrer Bezeichnung ein Kriterium angibt, welches zum Stellen einer solchen Diagnose erfüllt sein muss: das Trauma. Die Relevanz eines traumatischen Ereignisses bei der Ausbildung der PTBS wurde lange Zeit angezweifelt; oft wurden organische Faktoren für entscheidend gehalten oder Gehirnschädigungen, die durch winzige Granatsplitter hervorgerufen wurden und so zum „Granatenschock“ geführt hatten. Das Trauma bildet heute das erste der oben genannten Kriterien, in dem festgelegt ist, welchen Voraussetzungen ein Ereignis genügen muss, damit es als „traumatisch“ bezeichnet werden darf. Laut DSM-IV beinhaltet ein Trauma
„ das direkte persönliche Erleben einer Situation, die mit dem Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu tun hat oder
die Beobachtung eines Ereignisses, das mit dem Tod, der Verletzung oder der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit einer anderen Person zu tun hat oder
das Miterleben eines unerwarteten oder gewaltsamen Todes oder einer Verletzung eines Familienmitglieds oder einer nahestehenden Person“ (Kriterium A1) (APA, 1994, S. 487)
Darauf muss die Person mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken reagieren (Kriterium A2).
Dabei muss der traumatische Stressor nicht „außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung“ liegen, wie es noch das DSM-III-R verlangte. Dieser Definitionszusatz erwies sich als zu streng, da viele epidemiologische Studien zeigen konnten, dass einige Stressoren, die eine PTBS hervorrufen können, weitverbreitet sind, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle (z.B. Ehlers, Mayou, & Bryant, 1998; Mayou, Ehlers & Bryant, 2002; Norris, 1992) oder sexuelle Gewalt (z.B. Herman, 1993; Valentiner, Foa, Riggs, & Gershuny, 1996).
Das ICD-10 verwendet hierbei eine breitere Definition, die gleichzeitig einen größeren Interpretationsspielraum zulässt. Bei einem Trauma handelt es sich danach um „kurz- oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde“ (WHO, 1991), wodurch es viel stärker der Traumadefinition nach DSM-III-R ähnelt. Im Gegensatz zum DSM-IV findet hier das subjektive Erleben des Individuums bei der Traumatisierung keine Berücksichtigung (vgl. Kriterium A2).
Beide Diagnosesysteme sehen die Bedrohung der körperlichen Integrität als zentrale Dimension des Traumas an. Neuerdings wird der Verlust der Wahrnehmung der eigenen Autonomie, wie es oft von Vergewaltigungsopfern und politischen Häftlingen berichtet wird, als weiterer wichtiger Aspekt angenommen.
Es wurden verschiedene Versuche unternommen, traumatische Ereignisse nach bestimmten Gesichtspunkten zu kategorisieren. Mehrere Forscher (z.B. Maercker, 1997) halten die zweidimensionale Einteilung nach Typ I (kurzanhaltend, wie Unfälle und kriminelle Gewalttaten) versus Typ II (langanhaltend, wie Geiselhaft und wiederholte Vergewaltigung) sowie nach der Verursachung für angemessen. Auf letztgenannter Dimension wird zwischen menschlicher, wie Folter oder Massenvernichtung in KZs versus zufälliger Verursachung wie Naturkatastrophen unterschieden. Somit kann jedes Ereignis - wenn auch nicht immer problemlos – nach zwei Aspekten typisiert werden (z.B. die Geiselhaft als von Menschen verursachtes Typ II-Trauma). Bei der Feuerwehr ist das Individuum in der Regel Typ I-Traumata ausgesetzt, die entweder von Menschen verursacht werden oder zufällig entstehen (Beaton, Murphy, Johnson, Pike & Corneil, 1998, zit. in Wagner et al, 2000).
Wie im DSM-III-R wird im DSM-IV zwischen Traumata unterschieden, die direkt und solchen, die indirekt durch Beobachtung oder durch die Erzählung einer anderen Person erlebt wurde. Das bedeutet, dass seit dem DSM-III-R erstmals neben den Opfern auch professionelle Helfer (wie Feuerwehrleute), Augenzeugen und Angehörige als potentiell Traumatisierte berücksichtigt werden. Daraus ergab sich die Konsequenz, das Konzept der PTBS weiter zu differenzieren. Figley (1995) schlug vor, die PTBS in primäre und sekundäre PTBS zu unterteilen. Im ersten Fall bedeutet dies, dass der Betroffene direkt mit dem traumatischen Stressor konfrontiert war, im zweiten Fall resultiert die psychische Beeinträchtigung aus dem durch Beobachtung oder Erzählung erworbenem Wissen über ein traumatisches Ereignis, das einer anderen Person widerfahren ist. Im DSM-IV wird, im Gegensatz zur ICD-10, diese Unterscheidung implizit gemacht, da hiernach ein Ereignis auch durch Beobachtung oder „Miterleben … schweren Leids … einer nahestehenden Person“ traumatisch sein kann. Andere Autoren differenzieren die sekundäre Traumatisierung weiter aus. So wird auch unterschieden zwischen Helfern, die direkt vor Ort sind (sekundäre Traumatisierung) und Angehörigen oder Therapeuten, die später, wenn die Gefahrsituation beendet ist, mit dem Leid des Opfers konfrontiert sind (tertiäre Traumatisierung). Es muss betont werden, dass mit dieser Einteilung keine Annahmen über Unterschiede in der Intensität oder Phänomenologie des Traumas verbunden sind, lediglich die Nähe zum traumatischen Stressor stellt das Kriterium dar, anhand dessen die betroffene Person in eine dieser Kategorien eingeteilt wird.
Problematisch ist allerdings bei dieser Konzeptualisierung schon allein der Versuch, in manchen Fällen Betroffene in eine dieser PTBS-Kategorien einzuteilen. Die Grenzen sind dabei relativ unscharf und unpräzise. Primäre PTBS bedeutet, dass das eigene Leben oder die eigene körperliche Unversehrtheit bedroht war. Bei einem Helfer in einer Gefahrensituation kann nun eine sekundäre PTBS vorliegen; wird diese Situation aber gleichzeitig als lebensbedrohlich interpretiert, fällt er zugleich in die Kategorie „primäre PTBS“. Eine eindeutige Einteilung ist also in manchen Fällen nicht möglich.
3.2.1.2 Die Hauptsymptomgruppen (B, C und D)
Die PTBS ist gemäß der beiden gebräuchlichen Diagnoseschemata durch drei Symptomcluster gekennzeichnet, die wiederum, in Abhängigkeit vom Individuum und der Art des Traumas, durch verschiedene Einzelsymptome charakterisiert sein können.
Ein typisches Symptom stellen sogenannte Intrusionen dar (Kriterium B). Hierbei handelt es sich um ungewollt wiederkehrende und belastende Erinnerungen an Aspekte der traumatischen Situation, die alle sensorischen Modalitäten (visuell, akustisch usw.) umfassen können. Dabei entsprechen die sensorischen Eindrücke (aufdrängende Bilder, Geräusche u.ä.) denen, die die Person während der eigentlichen traumatischen Situation durchlebt hat. Diese Erinnerungen treten oft spontan auf oder werden durch Schlüsselreize, die mit dem Trauma assoziiert sind (wie bestimmte Gegenstände oder Stimmen), ausgelöst. Die Intrusionen können im Wachzustand in Form von Flashbacks (= Erinnerungsattacken), die plötzlich und sehr lebendig ins Bewusstsein drängen, oder während des Schlafs als Alpträume, in denen die Erinnerungen oft sehr verzerrt sind, auftreten. Dem unkontrollierbaren Wiedererleben fehlt dabei jeglicher zeitlicher Bezug; die Person hat den Eindruck, als ob sie das Ereignis im „Hier-und-Jetzt“ (Ehlers, 1999) wiedererlebt. Diese ständig wiederkehrende Konfrontation mit den traumatischen Schlüsselreizen und die dadurch ausgelösten Erinnerungen gehen mit intensiver psychologischer Belastung einher und lösen physiologische Reaktionen, wie Herzrasen, Zittern und Übelkeit sowie emotionale Reaktionen, wie starke Angst, aus.
Damit dieses Kriterium im DSM-IV erfüllt ist, muss mindestens eins von den dort genannten Symptomen vorhanden sein.
Durch die starke Belastung versucht die betroffene Person die Reize, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, zu vermeiden. Diese Reize können bestimmte Gedanken, Gefühle oder Orte sein, die die Erinnerung an das Trauma fördern könnten. Andererseits grübeln aber auch viele Patienten über das Trauma nach, z.B. darüber, wie es zu diesem Ereignis kommen konnte und wie man es hätte verhindern können. Dadurch entstehen häufig, besonders bei Vergewaltigungsopfern, Schuld- und Schamgefühle. Das Vermeidungsverhalten (`avoidance`) gehört neben einer emotionalen Taubheit (`emotional numbing`) zum Kriterium C. Die betroffene Person fühlt sich von ihren Mitmenschen, die das Trauma nicht erlebt haben, entfremdet, wodurch Kontakte zu Anderen aufgegeben werden und es so zu völligem sozialen Rückzug kommen kann. Auch vor dem Trauma bestehende Interessen (Hobbies u.ä.) sowie für wichtig empfundene Aktivitäten und Zukunftsperspektiven werden aufgegeben. Neben der Affektverflachung besteht auch eine Einschränkung der Gefühlsbandbreite (z.B. Verlust der Fähigkeit, Freude oder Liebe zu empfinden).
Für die Diagnose müssen drei der im DSM-IV aufgeführten Symptome bei der betroffenen Person vorkommen. Gerade das Kriterium C wurde in der Traumaforschung vielfach kritisiert. Da dieses Kriterium insgesamt sieben Symptome umfasst, ist es für eine betroffene Person möglich eine PTBS-Diagnose zu erhalten, ohne Vermeidungsverhalten zu zeigen, was aber für Angststörungen ein Kernsymptom darstellt. Auch aus statistischer Sicht ließ sich die Zusammenfassung von Symptomen emotionaler Taubheit und des Vermeidungsverhalten in einigen Studien nicht rechtfertigen. Hier konnten Foa, Riggs und Gershuny (1995) sowie King, Leskin, King und Weathers (1998) zeigen, dass die Symptome beider posttraumatischer Reaktionen auf separaten Faktoren luden.
Gerade im Hinblick auf das Kriterium C besteht zwischen beiden Manualen ein bedeutsamer Dissens. Im ICD-10 gilt dieses Kriterium bereits als erfüllt, wenn ein Vemeidungssymptom vorliegt; Symptome der emotionalen Taubheit gelten hier zwar ebenfalls als typische Merkmale einer PTBS, ihr Auftreten ist aber keine notwendige Voraussetzung für die Diagnosestellung.
Im Kriterium D sind die Symptome des erhöhten Erregungsniveaus (`hyperarousal`) zusammengefasst. Die Senkung der Erregungsschwelle des autonomen Nervensystems nach dem Trauma führt dazu, dass Belastungen früher und intensiver erlebt werden als vor dem Trauma. Dadurch ist die Person reizbarer und reagiert häufig mit inadäquaten Wutausbrüchen. Das erhöhte Erregungsniveau resultiert auch in Konzentrations- und Ein- bzw. Durchschlafschwierigkeiten (geringere Schlafeffizienz, weniger REM-Phasen; Mikulincer, Glaubman, Wasserman & Porat, 1989). Die Erregungssteigerung führt auch oft zu starken Schreckreaktionen, die schon durch schwache Reize ausgelöst werden und zu dem ständigen Gefühl der Gefährdung der eigenen Person.
Das Kriterium D gilt als erfüllt, wenn zwei der im DSM-IV genannten Symptome vorliegen.
Zum Kriterium D gehört gemäß ICD-10 das Symptom, sich an Aspekte des traumatischen Ereignisses nicht mehr zu erinnern, was nach DSM-IV Bestandteil des Kriteriums C ist. Kriterium D gilt laut ICD-10 schon als erfüllt, wenn dieses Symptom oder mindestens zwei der nach DSM-IV verlangten Symptome vorliegen.
3.2.1.3 Das Zeitkriterium E
Die oben genannten Hauptsymptome müssen über einen gewissen Zeitraum andauern, damit man eine PTBS diagnostizieren darf. Das DSM-IV verlangt, dass die Beeinträchtigung mindestens einen Monat bestehen muss, ansonsten handelt es sich um eine akute Belastungsstörung. Das ICD-10 setzt keine bestimmte Dauer der Symptome voraus, allerdings müssen diese innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Auftreten des Traumas aufgetreten sein.
3.2.1.4 Das Kriterium F
Das letzte Kriterium bezieht sich auf das unmittelbare soziale und berufliche Umfeld des Betroffenen. Die Störung muss demnach klinisch bedeutsame Belastungen oder Beeinträchtigungen verursachen, was nach ICD-10 keine notwendige Voraussetzung für die Diagnosestellung darstellt.
3.2.2 Auswirkungen der Unterschiede zwischen DSM-IV und ICD-10 auf die erhobenen Prävalenzen
Neben dem unterschiedlichen Spezifizierungsgrad des Traumas (s.o.) wirkt sich die unterschiedliche Anzahl nötiger Symptome entschieden auf die epidemiologischen Daten aus.
Die DSM-IV-Kriterien sind strenger; nach ICD-10 gelten das Vorliegen des traumatischen Ereignisses und die „wiederholte unausweichliche Erinnerung oder Wiederinszenierung des Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen und Träumen“ (WHO, 1991) als hinreichend, bestehende Reaktionen des Opfers werden dagegen nicht voraus gesetzt . Im ICD-10 wird also das Symptom des Wiedererlebens viel stärker gewichtet als im DSM-IV. Alle übrigen Symptome, die das DSM-IV verlangt, dienen im ICD-10 lediglich als Beschreibung und werden nicht zwingend verlangt. Dadurch, und aufgrund der liberaleren Trauma- und Kriterium-C-definition wird eine PTBS-Diagnose anhand des DSM-IV bei gleichem Störungsbild unwahrscheinlicher, wodurch die Prävalenzraten zwangsläufig niedriger ausfallen. Aufgrund dieser Differenzen beträgt die Übereinstimmung zwischen den beiden diagnostischen Leitlinien nur 35% (Ehlers, 1999), eine Studie aus demselben Jahr kam auf einen Kappa-Koeffizienten von κ = .50 (Peters, Slade & Andrews, 1999). Somit ist die Konkordanz der Diagnosen beider Manuale im Vergleich zu anderen Störungen (im Durchschnitt 68%) sehr niedrig (Andrews, Slade & Peters, 1999).
3.2.3 Subsyndromale PTBS
In der PTBS-Forschung, besonders in Untersuchungen zu Prädiktoren dieses Krankheitsbildes wie in vorliegender Arbeit, ist man mit dem Problem konfrontiert, dass die Prävalenz der PTBS in der Normalbevölkerung im Vergleich zu anderen psychischen Störungen relativ gering ist. Aus diesem Grund haben einige Forscher auch Traumatisierte untersucht, die keine vollständige PTBS ausgebildet haben, das heißt nicht alle Kriterien des DSM-IV erfüllen. Gleichzeitig wurden verschiedene Begriffe für dieses Krankheitsbild geprägt; in manchen Studien kursiert die Bezeichnung „partial PTSD“ (z.B. Kulka et al., 1990; Stein, Walker, Hazen & Forde, 1997), „subthreshold PTSD“ (z.B. Marshall et al., 2001) oder „teilweise PTBS“ (z.B. Teegen, Domnick & Heerdegen, 1997). Hinsichtlich der Definition dieser subklinischen Ausprägungen herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Der gängigste Begriff in der wissenschaftlichen Diskussion stellt wohl die „subsyndromale PTBS“ (z.B. Blanchard et al., 1996; Wagner, Heinrichs & Ehlert, 1998, 1999) dar. Diese liegt vor, wenn neben dem Eingangskriterium A und dem Zeitkriterium E das Intrusionskriterium B sowie entweder das Kriterium des Vermeidungsverhaltens (C) oder das Kriterium des erhöhten Erregungsniveaus (D) erfüllt ist (Blanchard, Hickling, Taylor & Loos, 1995).
Es existieren jedoch auch Untersuchungen, in denen zusätzlich Fälle berücksichtigt werden, die neben dem Ereigniskriterium lediglich ein weiteres Kriterium erfüllen (z.B. Rudolph, 2002; Schraub, 2002; Teegen et al., 1997; Wagner et al., 1999).
Die Berücksichtigung von traumatisierten Personen mit subsyndromaler PTBS-Ausprägung wird der Tatsache gerecht, dass diese Betroffenen ebenso unter einer starken Belastung leiden können. So konnten Marshall et al (2001) zeigen, dass Personen mit subsyndromaler Symptomatik unter signifikant mehr komorbiden Störungen leiden und das Suizidalitätsrisiko deutlich erhöht ist. Mit dem Vergleich zwischen Personen mit subsyndromaler und Personen mit einer vollausgeprägten PTBS können außerdem neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwieweit sich diese Personengruppen in bestimmten Merkmalen unterscheiden und welche Risikofaktoren oder Ressourcen bei den Personen bestehen, die die Herausbildung einer Vollsymptomatik begünstigen oder behindern.
Gerade bei der Untersuchung ehrenamtlich tätiger Helfer, wie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sieht man sich mit dem Problem niedriger PTBS-Prävalenzen konfrontiert, die sich alle im einstelligen Bereich bewegen (vgl. Rösch, 1998, zitiert nach Rudolph, 2002, S. 14; Schraub, 2002) und somit deutlich unter den Befunden bei professionellen Mitarbeitern liegen. Dieser Sachverhalt kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden. Zum einen bestreiten ehrenamtliche Helfer weitaus seltener Einsätze, wodurch die Traumaexpositionsrate zwangsläufig niedriger ausfällt. Zum anderen können die unterschiedlich hohen Prävalenzen durch die Selbstselektion erklärt werden, die bei ehrenamtlich Tätigen weiter verbreitet und leichter realisierbar sein dürfte als bei professionellen. Da zu vermuten ist, dass beim Auftreten posttraumatischer Belastungssymptome nach traumatischen Einsätzen eine nicht unerhebliche Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern ihre Tätigkeit aufgibt, können bei solchen Untersuchungen nur weniger belastete Personen berücksichtigt werden. Dadurch ist eine Unterschätzung der PTBS-Prävalenz in solchen Populationen kaum zu vermeiden, es sei denn man untersucht auch die aus dem Dienst geschiedenen Personen, was mit einem großen Aufwand verbunden wäre.
Auch aus methodischen Gründen ist es sinnvoll, sich bei der Untersuchung von Prädiktoren der PTBS nicht nur auf den Vergleich PTBS-Vollbild/Keine PTBS zu konzentrieren, sondern auch auf das Ausmaß der Symptombelastung. Durch diese Dichotomisierung würden zwei zahlenmäßig stark divergierende Gruppen resultieren, was eine Interpretation der Ergebnisse erschweren würde.
3.3 Verlauf
Nach DSM-IV werden je nach Beginn und Verlauf drei Formen posttraumatischer Belastungsreaktionen unterschieden. Nach traumatischen Ereignissen werden von fast allen Menschen Beschwerden entwickelt, die sich jedoch meistens nach kurzer Zeit (nach Stunden oder wenigen Tagen) wieder spontan zurückbilden. Diese akuten Belastungsreaktionen oder auch „akute katastrophische Stress-Reaktion“ (Horowitz, 1986, zitiert nach Flatten et al., 2001, S. 27) sind vor allem durch dissoziative Symptome wie emotionaler Taubheit, kognitiver Desorientiertheit und Losgelöstsein gekennzeichnet. Ob dieser Reaktion ein psychiatrischer Status zugeschrieben werden kann oder es sich hierbei lediglich um eine „normale psychologische und vorübergehende Antwort“ (Teegen, 2003, S. 18) auf extreme Erfahrungen handelt, mit der das Individuum sich vor den extremen Eindrücken schützt und die die Erlebnisse ertragen helfen, wird in der Traumaforschung kontrovers diskutiert.
Dauern diese Reaktionen mindestens zwei Tage und höchstens vier Wochen (APA, 1994) an, wird von einer Akuten Belastungsstörung (ASB) gesprochen, über deren Erscheinungsbild zwischen den beiden Diagnosesystemen Uneinigkeit besteht. Während das DSM-IV dissoziative Symptome wie Depersonalisations- und realisationserleben in den Mittelpunkt rückt, betont das ICD-10 die polymorphe Art der Symptome und deren schnellen Wechsel. Außerdem soll die Symptomatik nach wenigen Tagen abgeklungen sein (ebd.), wodurch offen bleibt, welche ICD-10-Diagnose gestellt werden muss, wenn die Beschwerden wenige Wochen andauern. Um eine chronische Form, also die eigentliche PTBS, handelt es sich, wenn die Symptome mehr als vier Wochen bestehen, und von einer PTBS mit verzögertem Beginn spricht man, wenn zwischen Trauma und Beginn der Symptome mindestens sechs Monate liegen. Diese Form kommt allerdings eher selten vor. So berichten Ehlers et al. (1998) bei einer Feldstudie an Verkehrsunfallopfern, dass nur 6,2% derjenigen, die drei Monate nach dem Unfall die DSM-IV Kriterien nicht erfüllt hatten, ein Jahr nach dem Ereignis eine PTBS Diagnose gestellt werden konnte. Umgekehrt ist das Risiko, dass sich akute Belastungssymptome zu einer PTBS verfestigen können, recht hoch. 78% bzw. 63% von untersuchten Unfallopfern entwickelten nach einer ASD sechs Monate respektive zwei Jahre später eine PTBS (Harvey & Bryant, 1999), wobei sich besonders dissoziative Symptome als Vulnerabilitätsfaktoren herausstellten (vgl. auch Bremner & Brett, 1997). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine andere Studie, die gleichermaßen Unfallopfer befragte. Hier lag die Wahrscheinlichkeit, drei Jahre nach dem Trauma unter einer PTBS zu leiden, bei Vorliegen einer PTBS-Diagnose nach einem Jahr, bei 47% (Mayou et al., 2002).
Bei Betrachtung der Gegenwahrscheinlichkeiten fällt auf, dass es bei der PTBS häufig zu Spontanremissionen kommt. So remittieren die Symptome zwischen dem ersten und dritten Jahr dementsprechend bei etwa jedem zweiten Betroffenen (ebd.) Andererseits kann sich die PTBS auch negativ auf die Persönlichkeit auswirken. In manchen Fällen kann die Chronifizierung der PTBS so gravierende Folgen haben, dass es zu „tiefgreifenden Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur“ (Morschitzky, 2002) kommen kann. Das ICD-10 spricht dann von einer „andauernden Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung“ (WHO, 1991), bei der die Symptome mindestens zwei Jahre vorliegen müssen. Charakteristisch für diese chronifizierte Form ist eine feindliche und misstrauische Haltung gegenüber der Welt, sozialer Rückzug und ein andauerndes Gefühl der Leere und/oder Hoffnungslosigkeit.
Die Gesamtdauer einer PTBS ist sehr unterschiedlich. Diejenigen, die professionelle Hilfe aufsuchten, litten durchschnittlich 36 Monate, die Anderen 64 Monate unter der PTBS (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995). Es gibt jedoch auch Berichte von Überlebenden aus KZ`s, bei denen noch über 50 Jahre später traumatische Bilder unverändert lebendig und belastend auftraten (Joffe, Brodaty, Luscombe & Ehrlich, 2003); sogar bei Überlebenden, die als Kinder in Konzentrationslagern interniert waren, lagen signifikant mehr posttraumatische Belastungssymptome vor als bei einer Kontrollgruppe (Amir & Wiesel, 2003).
3.4 Komorbidität
Die PTBS ist eine psychische Störung mit einer bemerkenswert hohen Komorbiditätsrate. Das bedeutet, dass neben der PTBS eine Reihe weiterer Störungen auftreten können. Über viele Studien hinweg konnte gezeigt werden, dass bei 50 bis 100% der PTBS-Patienten noch mindestens ein weiteres Krankheitsbild vorliegt. So konnten Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes und Nelson (1995) in der National Comorbidity Survey anhand retrospektiver Daten zeigen, dass 88,3% der Männer und 79% der Frauen mit PTBS über die Lebenszeit hinweg mindestens eine komorbide Störung aufwiesen. Auch Breslau, Davis und Andreski (1991) kamen bei einer Stichprobe mit jungen Erwachsenen zu ähnlichen Ergebnissen. Hiernach hatten 82,8% der PTBS-Betroffenen noch eine weitere psychische Störung ausgebildet. Beide Forschungsgruppen gehen dabei davon aus, dass die PTBS die primäre, die komorbide Störung die sekundäre Störung ist, also als Folge einer PTBS auftritt. In beiden Studien waren es vor allem affektive Störungen (wie Major Depression oder Dysthymie), Angststörungen und substanzinduzierte Störungen, die komorbid auftraten.
Eine neuere epidemiologische Studie aus Australien konnte dies bestätigen. Nach Creamer, Burgess und Mc Farlane (2001) lagen bei 85,2% der Männer und 79,7% der Frauen in den letzten zwölf Monaten eine, bei über 60% der Männer und knapp der Hälfte der Frauen zwei oder mehr Störungen neben der PTBS vor. Die häufigste komorbide Störung war die Major Depression, die bei 51,6% der Männer und 65,1% der Frauen bestand, gefolgt von der Generalisierten Angststörung (40,2% bzw. 22%) (vgl. auch Mayou, 1992) und Alkoholmissbrauch (37,6% bei den Männern) sowie Panikstörung oder Agoraphobie (16,9% der Frauen).
Nicht ganz konform mit den Ergebnissen der obigen Studien sind die Resultate der Untersuchung von Mc Farlane und Kollegen (1998), die sogar eine Komorbiditätsrate von 100% nachweisen konnten, dass heißt, dass alle PTBS-Patienten noch über mindestens eine weitere Störung klagten.
Betont werden muss hier allerdings, dass es sich bei den erwähnten Daten meist um Lebenszeitprävalenzen handelt; hätte man die Komorbidität zum Untersuchungszeitpunkt erhoben, wären die Zahlen deutlich niedriger.
Es wurden auch Untersuchungen zur Komorbidität der PTBS bei Risikopopulationen durchgeführt. Hier ergab sich ein ähnliches Bild wie in der Normalbevölkerung. Mc Farlane und Papay (1992) erfassten komorbide Störungen bei Feuerwehrleuten, die unter PTBS litten. Sie konnten zeigen, dass von den Betroffenen 77% eine weitere Störung, vor allem eine Depression ausgebildet hatten. Auch Wagner et al. (1999) erhoben psychische Störungen und soziale Komplikationen, die neben der PTBS bei Mitgliedern der Feuerwehr in Rheinland-Pfalz auftraten. Am häufigsten lagen soziale Dysfunktionen (60,3%) vor, gefolgt von Depressionen (39,4%) und Substanzmissbrauch (19,6%), wobei Alkohol die größte Rolle spielte. Auch körperliche Beschwerden (Herz-Kreislauf-Probleme, Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Anspannung oder Schmerzen) wurden bei der Datenerhebung berücksichtigt, worunter 46,6% der Berufsfeuerwehrleute mit PTBS klagten. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Mc Farlane, Atchison, Rafalowicz und Papay (1994), die bei australischen Feuerwehrleuten mit PTBS neben kardiovaskulären Beschwerden auch Atembeschwerden und neurologische Symptome feststellen konnten.
Das Ausmaß an Substanzmissbrauch und –abhängigkeit war auch Gegenstand in anderen epidemiologischen Studien. Ein Grund dafür war die von vielen Forschern vertretene Ansicht, dass Substanzmissbrauch für viele Betroffene der PTBS eine Bewältigungsstrategie darstellt, mit deren Hilfe sie glauben, besser mit dem posttraumatischen Stress klarzukommen. Bei israelischen Kriegsveteranen konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass mit einer PTBS gleichzeitig eine signifikante Erhöhung des Alkohol- und Nikotinkonsums einherging (Shalev, Bleich & Ursano, 1990). Beckham et al. (1995) konnte dies bei einer Stichprobe mit Vietnam-Veteranen bestätigen. So gaben 60% der Soldaten, die unter einer PTBS litten, an, zu rauchen. Außerdem beklagten diejenigen, die rauchten über stärkere PTBS-Symptome, stärkere Depressionen und höhrerer Ängstlichkeit als PTBS-Patienten, die nicht rauchten.
Ein weiteres Problem, dass parallel zur PTBS auftritt, ist die erhöhte Suizidalität. So konnten Kilpatrick, Best und Veronen (1985) bei Vergewaltigungsopfern feststellen, dass beinahe jedes fünfte Opfer (19,2%) einen Selbstmordversuch verübt hatte, im Vergleich zu 2,2% der Personen, die nicht vergewaltigt wurden.
Die oben aufgeführten hohen Komorbiditätsraten sind genauer betrachtet nicht sehr verwunderlich, da es zwischen der PTBS und den genannten komorbiden Störungen zum Teil nicht unerhebliche Symptomüberlappungen gibt. Laut DSM-IV stimmen einige Kriterien der verschiedenen Störungen überein. So findet man das Symptom des Vermeidungsverhaltens nicht nur bei der PTBS sondern auch bei den meisten anderen Angststörungen. Person, die unter einer Generalisierten Angststörung (GAS) leiden, klagen genauso wie PTBS-Patienten über ein erhöhtes Erregungsniveau, und Schlaflosigkeit findet sich auch bei Menschen mit Depressionen.
3.5 Epidemiologie
Mit der Operationalisierung der PTBS-Kriterien im DSM-III (APA, 1980) wurden die ersten zuverlässigen epidemiologischen Feldstudien durchgeführt, die die Verbreitung dieser Störung in der Allgemeinbevölkerung und in Risikopopulationen untersuchten. Die erzielten Befunde bieten allerdings ein sehr uneinheitliches Bild, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Die Gründe liegen zum einen in der unterschiedlichen Untersuchungsmethodik (z.B. Fragebogen oder klinisches Interview, unterschiedliche Strenge des verwendeten Traumakriteriums). Zum anderen hängt die PTBS-Prävalenz von der Häufigkeit potentiell traumatischer Erlebnisse ab, die wiederum stark mit geographischen und kulturellen Rahmenbedingungen variiert: „…it is clear that cultural factors have an important role to play in the genesis and presentation of PTSD, …“ (de Silva, 1999, S. 117). So waren zum Beispiel in den Jahren 1967 bis 1991 in den Entwicklungsländern jährlich 117 Millionen Menschen von Kriegen oder Naturkatastrophen betroffen, in den Industrienationen dagegen lediglich 700000 (McFarlane & deGirolamo, 1996, zitiert nach Flatten et al., 2001, S. 41). Daher darf wohl davon ausgegangen werden, dass die Resultate epidemiologischer Studien, die fast ausschließlich aus Nordamerika und Europa stammen, wohl eine Unterschätzung der weltweiten Verbreitung der PTSD darstellen. Die folgenden Forschungsergebnisse sollten auch vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass hier ausschließlich DSM-Kriterien, die im Vergleich zu den Kriterien des ICD strenger sind, für die Diagnosestellung verwendet wurden. Eine Replizierung der Untersuchungen nach ICD-10-Kriterien hätte wohl höhere Prävalenzraten zur Folge.
3.5.1 Prävalenz traumatischer Ereignisse und der PTBS in der Normalbevölkerung
Die wohl erste epidemiologische Studie, die die Prävalenz der PTBS in der Allgemeinbevölkerung erfasste, wurde Ende der 80er Jahre durchgeführt (Helzer, Robins & Mc Evoy, 1987). Die Lebenszeitprävalenz betrug hier bei einer Stichprobe aus St. Louis (N=2493) 1%. Diese Studie wurde jedoch kritisiert, da das verwandte diagnostische Instrumentarium, das Diagnostic Interview Schedule (DIS), das auf dem DSM-III basiert, keine genügende Sensitivität aufwies (Bengel & Landji, 1996). Deshalb wurde eine zweite Untersuchung an derselben Stichprobe durchgeführt, die eine Lebenszeitprävalenz von 1,35% ergab (Cottler, Compton, Mager, Spitznagel & Janca, 1992). In einer weiteren US-amerikanischen Studie an 1000 Erwachsenen berichteten 69% der untersuchten Personen, mindestens ein traumatisches Ereignis in ihrem Leben, jede fünfte Person (21%) im zurückliegenden Jahr erlebt zu haben (Norris, 1992). Das häufigste traumatische Ereignis war das Miterleben eines tragischen Todesfalls. Die PTBS-Lebenszeitprävalenz lag bei 7,3%, die Punktprävalenz bei 5,1%.
In einer sehr großen repräsentativen Stichprobe (N=5877) aus den USA im Rahmen der National Comorbidity Survey (Kessler et al., 1995) berichteten 60,7% der Männer und 51,2% der Frauen, mindestens ein traumatisches Erlebnis in ihrem Leben gehabt zu haben. Dabei wurden am häufigsten „Zeuge von schwerer Körperverletzung oder Mord“ (35,6% der Männer, 14,5% der Frauen) und „Opfer eines Unfalls“ (25% der Männer, 13,8% der Frauen) zu sein genannt. Die Lebenszeitprävalenz für eine PTBS lag nach DSM-III-R Kriterien bei 7,8%. Bei 2181 Personen aus Detroit im Alter von 18 bis 45 Jahren ermittelten Breslau et al. (1998) in einem Telefoninterview eine Lebenszeitprävalenz von 89,6%, wobei der „plötzliche unerwartete Tod eines engen Verwandten oder Freundes“ mit 60% am häufigsten vorkam. Die Wahrscheinlichkeit, nach einem Trauma eine PTBS zu entwickeln, lag bei 9,2% (13% der Frauen und 6,2% der Männer). Der Unterschied zwischen den Prävalenzraten beider Studien ist darauf zurückzuführen, dass in der neueren Untersuchung das Trauma-Kriterium nach DSM-IV verwendet wurde, nach dem, im Gegensatz zum DSM-III-R-Kriterium, der traumatische Stressor nicht mehr außerhalb des normalen Rahmens menschlicher Erfahrungen liegen musste. Auch könnte die durch ein Telefoninterview garantierte Anonymität dazu beigetragen haben, dass bereitwilliger über erlebte traumatische Ereignisse berichtet wurde.
Aufgrund nicht unerheblicher Diskrepanzen hinsichtlich der PTBS-Kriterien zwischen den Diagnosesystemen DSM-IV und ICD-10 wurde 1999 (Peters et al.) eine Untersuchung durchgeführt, die die Prävalenzen, die mittels beider Systeme erhoben wurden, gegenüberstellten. Hier wurden die Symptome mit Hilfe eines voll strukturierten Interviews erhoben, wobei hier die 12-Monats-Prävalenz nach DSM-IV 3% betrug, nach ICD-10 dagegen mit 6,9% mehr als doppelt so hoch ausfiel. Die Ergebnisdivergenz wurde von den Autoren empirisch auf die Notwendigkeit der Erfüllung des Traumakriteriums A2 („das Trauma ist verbunden mit empfundener Hilflosigkeit und/oder starker Angst oder Entsetzen“) zurückgeführt sowie auf das strengere C-Kriterium des DSM-IV, wonach mindestens drei Symptome anstatt eines nach ICD-10 bestehen müssen. Nach ICD-10 muss dies ein Vermeidungssymptom sein, bei der DSM-IV muss im Gegensatz zum ICD-10 noch mindestens ein Symptom „emotionaler Taubheit“ vorliegen, damit Kriterium C als erfüllt gilt.
Aktuelle Informationen zur Verbreitung der PTBS liefert die „Australian National Survey of Mental Health and Well-being“, die mit über 10000 teilnehmenden Personen bis dato größte epidemiologische Untersuchung auf diesem Gebiet. Creamer, Burgess und Mc Farlane (2001) erhoben mittels dem Composite International Diagnostic Interview (CIDI, WHO, 1997) und einer aus dem DSM-IV-Kriterium A1 abgeleiteten Liste von Ereignissen, die normalerweise als extrem belastend erlebt werden, die 12-Monats-Prävalenz traumatischer Ereignisse und der PTBS. 64,6% der Männer und 49,5% der Frauen berichteten von mindestens einem erlebten Trauma, wobei sich bei 1,2% der Männer und 1,4% der Frauen innerhalb des letzten Jahres eine PTBS herausgebildet hatte. Auffällig ist hier die fehlende geschlechtsspezifische Differenz bezogen auf die Häufigkeit der PTBS, die der in der Literatur weitverbreiteten Annahme einer erhöhten Vulnerabilität bei Frauen klar widerspricht (vgl. Breslau et al., 1998; Kessler et al., 1995).
Zur Untermauerung der oben angeführten Aussage, dass soziokulturelle Faktoren einen Einfluss auf die Genese einer PTBS haben, seien hier noch zwei weitere Untersuchungsergebnisse angeführt. In Island (Lindal & Stefansson, 1993) und Hongkong (Chen, Wong, Lee & Chan, 1993) lagen die Lebenszeitprävalenzen mit jeweils 0,6% deutlich niedriger als in anderen Ländern.
Studien zur Verbreitung subklinischer Ausprägungen der PTBS in der Allgemeinbevölkerung sind rar und erst in neuerer Zeit durchgeführt worden. So fanden Stein et al. (1997) in einer kanadischen Stichprobe (N=1002), dass 5,7% der Frauen und 2,2% der Männer zum Untersuchungszeitpunkt eine subsyndromale PTBS entwickelt hatten. Die Punktprävalenz eines PTBS-Vollbildes lag bei 5% bzw. 1,7%. Eine subklinische (`partial`-) PTBS wurde dabei so definiert, dass mindestens ein Symptom aus jeder DSM-IV-Kategorie vorliegen muss. In einer neuen Untersuchung aus den USA (Marshall et al., 2001) an 9358 Personen wurde ebenfalls die Lebenszeitprävalenz subklinischer (`subthreshold`) Ausprägungen und Vollbild-PTBS erfasst. Unter einer `subthreshold PTSD` verstanden die Autoren das Vorliegen eines, zweier oder dreier PTBS-Symptome, wobei mindestens ein Symptom mindestens einen Monat andauern muss. 844 (9%) Personen erfüllten die DSM-IV-Kriterien eines PTBS-Vollbildes und 1764 (18,9%) die von den Untersuchern festgelegte Definition einer subklinischen PTBS.
In Tabelle 1 sind die vorliegenden Untersuchungsergebnisse synoptisch dargestellt. Bei der Interpretation der Daten muss, wie bereits erwähnt, berücksichtigt werden, dass im Laufe der Jahre mit der Ablösung des DSM-III-R durch das DSM-IV die Kriterien für eine PTBS-Diagnose liberaler wurden (siehe auch Kapitel 3.2), was somit in neueren Untersuchungen zwangsläufig zu höheren Prävalenzraten führte. Auch die Verwendung unterschiedlicher Erhebungsinstrumentarien schränkt die Vergleichbarkeit ein. Schließlich sei hier auch noch darauf hingewiesen, dass aus vielen Studien nicht hervorgeht, inwieweit die Traumakriterien A1 und A2 bei der Diagnosestellung berücksichtigt wurden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1. Prävalenzen für Traumaexposition und PTBS. Prävalenzen beziehen sich, wenn nicht anders durch Exponenten bezeichnet, auf die Lebenszeit. 12=12-Monats-Prävalenz, P=Punktprävalenz, *=subsyndromale PTBS. In den Studien nach 1995 wurden die DSM-IV-Kriterien verwendet.
3.5.2 Prävalenz der PTBS in Risikopopulationen
Es existiert in der Literatur eine Vielzahl epidemiologischer Studien, die die Verbreitung der PTBS bei Menschen untersuchten, die Opfer traumatischer Ereignisse geworden sind. Die Prävalenzen über die verschiedenen Risikopopulationen hinweg sind sehr heterogen, was unter anderem auf die Art des Stressors, die ethnische Zugehörigkeit und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung (Saigh, 1995) zurückzuführen ist, die alle einzeln oder als interagierendes Wirkungsgefüge die voneinander abweichenden Resultate hervorrufen können.
Das Trauma, nach dem mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eine PTBS entwickelt wird, sind Vergewaltigungen. Valentiner, Foa, Riggs und Gershuny (1996) untersuchten unter Verwendung der Post Traumatic Stress Disorder Symptom Scale (PSS, Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993) Opfer sexueller und nicht- sexueller Übergriffe (N=215) zwei und vierzehn Wochen nach dem Vorfall. Hier betrugen die Inzidenzen 74% bzw. 35%, wobei die Symptomschwere bei den Opfern sexueller Gewalt signifikant höher war (t=3,75, p<.01). In den bereits erwähnten Studien von Kessler et al. (1995) und Breslau et al. (1998) wurden die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die Entstehung einer PTBS nach spezifischen Traumata errechnet. Hier waren es vor allem Vergewaltigungen, die, neben nicht-sexuellen Übergriffen, die höchsten Werte aufwiesen (49% in der erstgenannten, 65% bei Männern und 45,9% bei Frauen in der letzt genannten Untersuchung).
Die Verbreitung der Störung wurde auch an Kriegsveteranen untersucht. Gerade dank solcher Studien wurde die Stabilität über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder deutlich. Noch 40 bis 50 Jahre nach der Traumaexposition konnte bei Teilnehmern des 2. Weltkrieg und des Korea-Krieg zum Untersuchungszeitpunkt hohe Prävalenzraten gefunden werden. Diese betrugen im ersten Fall 43%, im zweiten 29% (Mc Cranie et al., 2000). Bei Vietnam-Veteranen war die Häufigkeit niedriger. Hier lagen die Punktprävalenzen zwischen 15,2% (Kulka et al., 1990) und 29% (Green, Grace, Lindy, Gleser & Leonard, 1990). Wolfe, Erickson, Sharkansky, King und King (1999) setzten die Mississippi Scale for Combat-Related PTSD (Keane, Caddell & Taylor, 1988) ein, um die PTBS bei Golf-Kriegs-Veteranen (N=2949) zu diagnostizieren. Es wurde von den Autoren ein schon in der früheren Literatur bewährter Cut-off Wert festgelegt, ab dem von einer klinisch relevanten PTBS-Ausprägung gesprochen werden kann. Diesen Wert überschritten kurz nach dem Krieg 3%, 18 bis 24 Monate später 8% der Population, womit die Prävalenzraten deutlich niedriger lagen als beispielsweise bei Vietnam-Veteranen. Die Autoren gehen davon aus, dass dies u.a. an dem viel kürzeren Aufenthalt in dem Kriegsgebiet und der geringeren Zahl von Kriegeinsätzen liegt. In einem ähnlichen Bereich liegt die Verbreitung der PTBS bei Überlebenden von Konzentrationslagern der Nazis. Hier lag die Prävalenz trotz eines Intervalls von über 50 Jahren zwischen der Internierung und dem Untersuchungszeitpunkt bei 39% (Joffe et al., 2003).
Berücksichtigt man gleichzeitig Häufigkeit und Schwere der Symptomatik, so stellen mit Verletzungen verbundene Autounfälle wohl die bedeutsamste Ursache der PTBS in westlichen Gesellschaften dar: „…it emerged as perhaps the single most significant event…“ (Norris, 1992, S. 416). So berichten 23,4% einer großen Stichprobe, mindestens einmal in ihrem Leben einen schweren Autounfall erlitten zu haben (Norris, 1992). Die PTBS-Prävalenzen sind über die Studien hinweg, besonders direkt nach dem Ereignis sehr hoch. 39% der untersuchten Unfallopfer (N=158) erfüllten ein bis vier Monate nach dem Unfall die DSM-III-R-Kriterien (Blanchard et al., 1996), bei einer großen Stichprobe (N=967) waren es drei Monate danach 23,1% und ein Jahr später 16,5% (Ehlers et al., 1998). Gerade der Anteil akuter Belastungsreaktionen scheint bei Unfallopfern sehr hoch zu sein (Siol, Flatten & Wöller, 2001), die Hälfte der PTBS remittierte innerhalb von sechs Monaten zumindest partiell (Blanchard et al., 1996), was auch durch die relativ niedrige Prävalenz von 11% drei Jahre nach dem Unfall unterstreicht, die in einer prospektiven Längsschnittstudie gefunden werden konnte (Mayou et al., 2002).
Zu eher seltenen, dafür aber sehr virulenten Stressoren gehören Terroranschläge. In einer aktuellen Metaanalyse (Gidron, 2002), in der u.a. terroristisch motivierte Übergriffe in Nord-Irland und Israel Berücksichtigung fanden, zeigte sich eine Punktprävalenz von 28,2%. Dieses Resultat ist jedoch nur begrenzt interpretierbar, da sich die Stichproben in ihrer Zusammensetzung und die Zeiträume nach dem Trauma voneinander unterschieden. Im gleichen Jahr wurde die Verbreitung akuter Belastungsreaktionen fünf bis acht Wochen nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 bei 1008 Anwohnern des mittleren und südlichen Teils Manhattans erfasst. Hier waren es 7,5%, die die Kriterien einer PTBS nach DSM-IV erfüllten, bei Personen, die in unmittelbarer Nähe (Canal Street) wohnten, lag die Inzidenz sogar bei 20% (Galea et al., 2002).
Abschließend soll noch auf die Auswirkung von Naturkatastrophen eingegangen werden, die bei vielen Menschen intensive Stressreaktionen auslöst. Hier wird klar deutlich, dass Prävalenzen auch eine Funktion der Art des auslösenden Ereignisses sind. So berichten Perilla, Norris und Larizzo (2002), dass sechs Monate nach dem Wüten des Hurricane Andrew im Süden Floridas 15% der weißen Personen, die in unmittelbarer Nähe wohnten, eine PTBS entwickelt hatten, bei anderen Ethnien waren es signifikant mehr Betroffene. Nach einem schweren Erdbeben im Norden Chinas erfüllten 18,8% drei Monate und 24,2% neun Monate später die DSM-IV-Kriterien (Zhao et al., 2000).
3.5.3 Prävalenz der PTBS bei der Berufsfeuerwehr
In der Fachliteratur stehen, wenn es um die Untersuchung der Verbreitung der PTBS in Risikopopulationen geht, vorwiegend die Opfer mit einer primären Belastungsstörung im Fokus der Aufmerksamkeit, wohingegen professionelle und freiwillige Helfer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zwangsläufig der Gefahr einer sekundären Traumatisierung ausgesetzt sind, lange Zeit ignoriert wurden. Mit der definitorischen Abgrenzung primärer und sekundärer PTBS durch Figley (1995) und deren erstmaliger Berücksichtigung im Traumakriterium A1 des DSM-IV richtete sich das Interesse auch an Risikopopulationen, die in erheblichem Maße durch primäre und sekundäre Traumaexposition belastet sind und der Gefahr unterliegen, selbst eine PTBS zu entwickeln. Zu der Population der professionellen und freiwilligen Helfer gehören Einsatzkräfte der Rettungsdienste, der Polizei und der Feuerwehr, wobei letzterer Gruppe in der Forschung bislang die größte Beachtung geschenkt wurde. Die Traumaprävalenz ist bei professionellen Feuerwehrleuten ausgesprochen hoch. In einer Studie an einer deutschen Stichprobe berichteten alle (100%) Teilnehmer über berufliche Einsätze, in denen sie mehrfach mit Toten, Sterbenden und Schwerverletzten konfrontiert waren (Teegen et al., 1997). Die traumatischen Stressoren, denen Feuerwehrleute ausgesetzt sind, sind sehr vielfältig. Die am häufigsten geschilderten potentiell traumatisierenden Situationen waren Situationen extremer Handlungsunfähigkeit (96%), lebensbedrohliche Einsätze (93%) und bizarre Selbstmordfälle (91%). Daneben gehören die Konfrontation mit dem Tod von Kollegen und Kindern sowie mit einer großen Anzahl Verletzter und Toter durch Großlagen wie Großbrände oder Flugzeugabstürze zu den möglichen Stressoren im Arbeitsalltag von Feuerwehrleuten. Im Mittel schilderten die Feuerwehrleute, 30 hochbelastende Einsätze in ihrer Feuerwehrkarriere erlebt zu haben. Das Ziel dieser Untersuchung war es auch, die PTBS-Prävalenz beim Feuerwehrpersonal (N=198) und bei der Polizei (N=155) in Hamburg festzustellen. Bei 9% der Feuerwehrleute und bei 5% der Polizisten wurde eine vollausgeprägte chronische PTBS, die zum Zeitpunkt der Untersuchung noch bestand, diagnostiziert. Eine teilweise PTBS, die gemäß der Definition der Autoren bei der Erfüllung von zwei der Kriterien B, C und D vorliegt, zeigte sich bei 13% bzw. 15%. Der Unterschied bezüglich der Häufigkeit chronischer PTBS zwischen beiden Gruppen war statistisch nicht signifikant, jedoch berichteten die Feuerwehrleute häufiger über intrusive Symptome (56% versus 39%, p<.001) und über ein erhöhtes Erregungsniveau (21% versus 16%, p<.05).
In einer weiteren deutschen Studie wurde die PTBS-Prävalenz bei Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Rheinland-Pfalz (N=402) und Variablen, die einen negativen Einfluss auf das Ausmaß einer PTBS haben können, erhoben (Wagner et al., 1998, 1999). Als Erhebungsinstrumente zur Diagnosestellung einer PTBS dienten die deutschen Versionen des General-Health-Questionnaire (GHQ-28; Goldberg & Hillier, 1979) und der PTSD-Symptom-Scale (PSS; Clohessy & Ehlers, 1999). Beim GHQ-28 handelt es sich um einen international anerkannten Screening-Fragebogen für psychiatrische Auffälligkeiten, der anhand von vier Subskalen körperliche Symptome, Angst und Schlaflosigkeit, soziale Dysfunktion und schwere Depression und somit Einschränkungen in wichtigen Funktionsbereichen gemäß DSM-IV erfasst. Die PSS dient der Erhebung des Auftretens und der Intensität posttraumatischer Belastungssymptome, wobei aber lediglich die Hauptkriterien B-D nach DSM-IV mittels jeweils 5, 7 und 5 Items überprüft werden können. In dem Fragebogen werden 4-fach abgestufte Antwortskalen verwendet; bei einem Wert von ≥ 1 (d.h. „einmal pro Woche oder seltener/manchmal“ oder häufiger) gilt ein Symptom als bestätigt. Zur Erfüllung der Diagnosekriterien müssen ein Symptom des Hauptkriteriums B, drei des Hauptkriteriums C und zwei des Hauptkriteriums D vorhanden sein. Das Traumakriterium (A1 und A2) kann mit diesem Verfahren nicht abgefragt werden. Die Autoren gingen allerdings, in Anlehnung an die Untersuchung von Teegen et al. (1997), davon aus, dass die Berufsfeuerwehrleute während ihrer Einsätze zumindest ein Ereignis erlebt haben, das der Traumadefinition nach DSM-IV genügt. Auch subklinische Ausprägungen der PTBS wurden in dieser Studie berücksichtigt. So kann man nach der Definition der Autoren von einer subsyndromalen PTBS sprechen, wenn das Kriterium B (Intrusionen) sowie entweder Kriterium C (Vermeidung und emotionale Taubheit) oder D (erhöhtes Erregungsniveau) erfüllt sind. Bei der Errechnung der PTBS-Prävalenz gingen die Autoren in zweierlei Weise vor. Zum einen konnten sie feststellen, dass 18,2% der Einsatzkräfte die PTBS-Kriterien nach DSM-IV und psychische Auffälligkeiten nach GHQ-28 erfüllten, wurden lediglich die Resultate des PSS als Grundlage für eine PTBS-Diagnose verwendet, lagen bei 24,5% der Feuerwehrleute ein PTBS-Vollbild vor (die Werte reichten von 8 bis 38, M = 17,8, SD = 6,7). Nach der ersten Herangehensweise hat sich bei 23,9%, nach der zweiten bei 46,2% eine subsyndromale PTBS herausgebildet. Als Vulnerabilitätsfaktoren konnte die Anzahl belastender Einsätze im letzten Monat und die Berufserfahrung extrahiert werden.
In einer weiteren Studie wurden kanadische (N=625) und US-amerikanische Feuerwehrleute (N=203) hinsichtlich der Verbreitung der PTBS untersucht, sowie beide Stichproben in bezug auf Art und Häufigkeit traumatischer Stressoren miteinander verglichen (Corneil, Beaton, Murphy, Johnson & Pike, 1999). Als Untersuchungsverfahren wurde die Impact of Events Scale (IES, Horowitz, Wilder & Alvarez, 1979) verwandt, die mit Hilfe von 15 Items verteilt auf den Subskalen `Intrusion` und `avoidance` die Errechnung eines Gesamtscores zur Erfassung von Auftreten und Häufigkeit posttraumatischer Stresssymptome zulässt. Ein Item-Cluster für das nach DSM-IV notwendige Hyperarousal-Kriterium sieht der Fragebogen nicht vor. Die Probanden gaben auf einer 4-Punkte-Skala (Gewichtung gemäß der Testautoren: `not at all`= 0, `rarely`= 1, `sometimes`= 3 und `often`= 5) die Häufigkeit der in der letzten Woche erlebten Symptome an, woraus sich durch Addition der Gesamtscore errechnen lässt. Die Autoren legten den Cut-off-Wert für eine positive Diagnose bei einem Gesamtwert von ≥26 fest, wonach 22,2% der US-amerikanischen und 17,3% der kanadischen Feuerwehrleute eine PTBS entwickelt hatten. Der Unterschied zwischen beiden Stichproben war nicht signifikant (Χ2 = 2,55, ns), obwohl die Art der Traumata stark voneinander abwichen. So stellte die Versorgung und Bergung von Verbrechensopfern bei den US-amerikanischen Einsatzkräften mit 40% den häufigsten Stressor der Tätigkeit dar, bei den kanadischen Feuerwehrleuten war der Anteil mit 3% bedeutend geringer (z = 25,8, p<.001). Im Gegensatz dazu gehört die Bergung von durch Feuer zu Tode gekommenen Zivilisten eher in den Arbeitsalltag der kanadischen als der US-amerikanischen Feuerwehr (12% versus 0,3%, z = 14,5, p<.001). Auch hinsichtlich der Häufigkeit traumatischer Ereignisse differierten beide Gruppen. Die US-Amerikaner gaben an, im Durchschnitt 6,74, die Kanadier im Durchschnitt 3,19 Traumata im letzten Jahr erlebt zu haben (t = 8,33, p<.001).
Ein weiteres Ziel war es, Prädiktoren zu finden, die den Ausbruch einer PTBS fördern können. Mittels logistischer Regressionsanalyse wurde das Risiko bei Feuerwehrleuten mit bzw. ohne Traumaexposition errechnet, an einer PTBS zu erkranken. Hier war lediglich der aus dem Regressionskoeffizient errechnete odds ratio2 in der kanadischen Stichprobe signifikant (ψ = 2,18, 95%-CI = 1,26-3,77, p<.001). Ein hohes Ausmaß an sozialer Unterstützung im familiären Kontext erwies sich als Schutzfaktor gegen den Ausbruch einer PTBS, ein geringes Maß demnach als Risikofaktor. Die Wahrscheinlichkeit, im Rahmen der
2odds ratio (ψ) = schätzt die Wahrscheinlichkeitserhöhung (gemessen in odds) der Zugehörigkeit in der Zielgruppe (Personen mit einer positiven PTBS-Diagnose) bei einer Erhöhung des Wertes der Prädiktorvariable um eine Einheit bei Kontrolle aller anderen Variablen. Odds sind gleich der Wahrscheinlichkeit, in der Zielgruppe zu sein geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, nicht in der Zielgruppe zu sein und reichen von 0 bis ∞ (für ausführlichere Erläuterungen s. Wright, 1995).
Einsätze eine PTBS zu entwickeln, war deutlich reduziert. Die odds ratios lagen bei 0,40 (95%CI = 0,26-0,61, p<.001) bei der kanadischen, bei 0,22 (95%CI = 0,11-0,44, p<.001) bei der US-amerikanischen Stichprobe.
In einer Untersuchung an 108 kuwaitischen Feuerwehrleuten mit dem gleichen Erhebungsinstrument und demselben Grenzwert, wie die zuletzt beschriebene Studie wurde eine Punktprävalenz von 18,5% gefunden (Al-Naser & Everly, 1999). Die Personen, die
schon während der irakischen Invasion tätig waren unterschieden sich dabei nicht von denen,
die damals noch nicht als Feuerwehrleute arbeiteten.
3.5.4 Prävalenz der PTBS bei der Freiwilligen Feuerwehr
Studien zur Verbreitung der PTBS bei Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr sind in der Fachliteratur so gut wie gar nicht zu finden. Lediglich eine australische Untersuchung von Bryant und Harvey (1996a), eine Studie aus den USA (North et al., 2002) sowie zwei unveröffentlichte Arbeiten waren zu diesem Thema auffindbar. Bei den australischen freiwilligen Feuerwehrleuten (N=751) wurde wiederum die IES angewandt und nach australischen Standards der kritische Wert bei >19, für eine extreme Ausprägung bei >29 festgelegt. Demnach konnten bei 17% eine klinisch bedeutsame, bei 9,2% eine extreme Form der PTBS diagnostiziert werden, wobei die Stressoren Hilflosigkeit und Leichenbergung mit den höchsten IES-Gesamtscores verbunden war.
In einer aktuellen Studie zu den psychologischen Folgen des Bombenanschlags in Oklahoma City 1995 konnte bei 13% der Feuerwehrleute (N=181) eine PTBS festgestellt werden. Die trotz des extrem intensiven Stressors und der langen Traumaexposition (die Feuerwehrleute waren im Schnitt 8,2 Tage bei der Bergung im Einsatz) niedrige Prävalenz führten die Autoren auf Tendenzen der Versuchsteilnehmer zurück, ein „Macho“-Image aufrechtzuerhalten und somit Probleme runterzuspielen oder zu verdrängen (North et al., 2002).
In einer Diplomarbeit (Rösch, 1998, zitiert in Rudolph, 2002, S. 14) an einer süddeutschen Stichprobe (N=119) erfüllten, bei einer eher niedrigen Traumaexpositionsrate von 39,1% zum Untersuchungszeitpunkt 6,4% der teilnehmenden freiwilligen Feuerwehrleute die DSM-IV Kriterien einer PTBS.
Im Rahmen einer Dissertation (Schraub, 2002) wurden Trauma- und PTBS-Prävalenzen bei Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr im mittelhessischen Raum erfasst. Hier ist das Risiko, einem traumatischen Stressor ausgesetzt zu sein, viel höher als in der süddeutschen Stichprobe (82,1%), die PTBS-Punktprävalenzen beider Gruppen hingegen vergleichbar hoch. 5,2% der Teilnehmer erfüllten die DSM-IV Kriterien eines PTBS-Vollbilds, bei 7,3% hatte sich eine subsyndromale PTBS herausgebildet.
[...]
- Arbeit zitieren
- Sven Palapies (Autor:in), 2004, Prädiktoren der posttraumatischen Belastungsstörung in der freiwilligen Feuerwehr, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93078
Kostenlos Autor werden















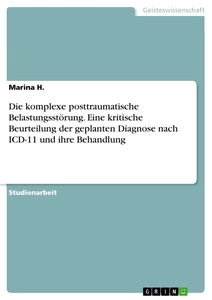




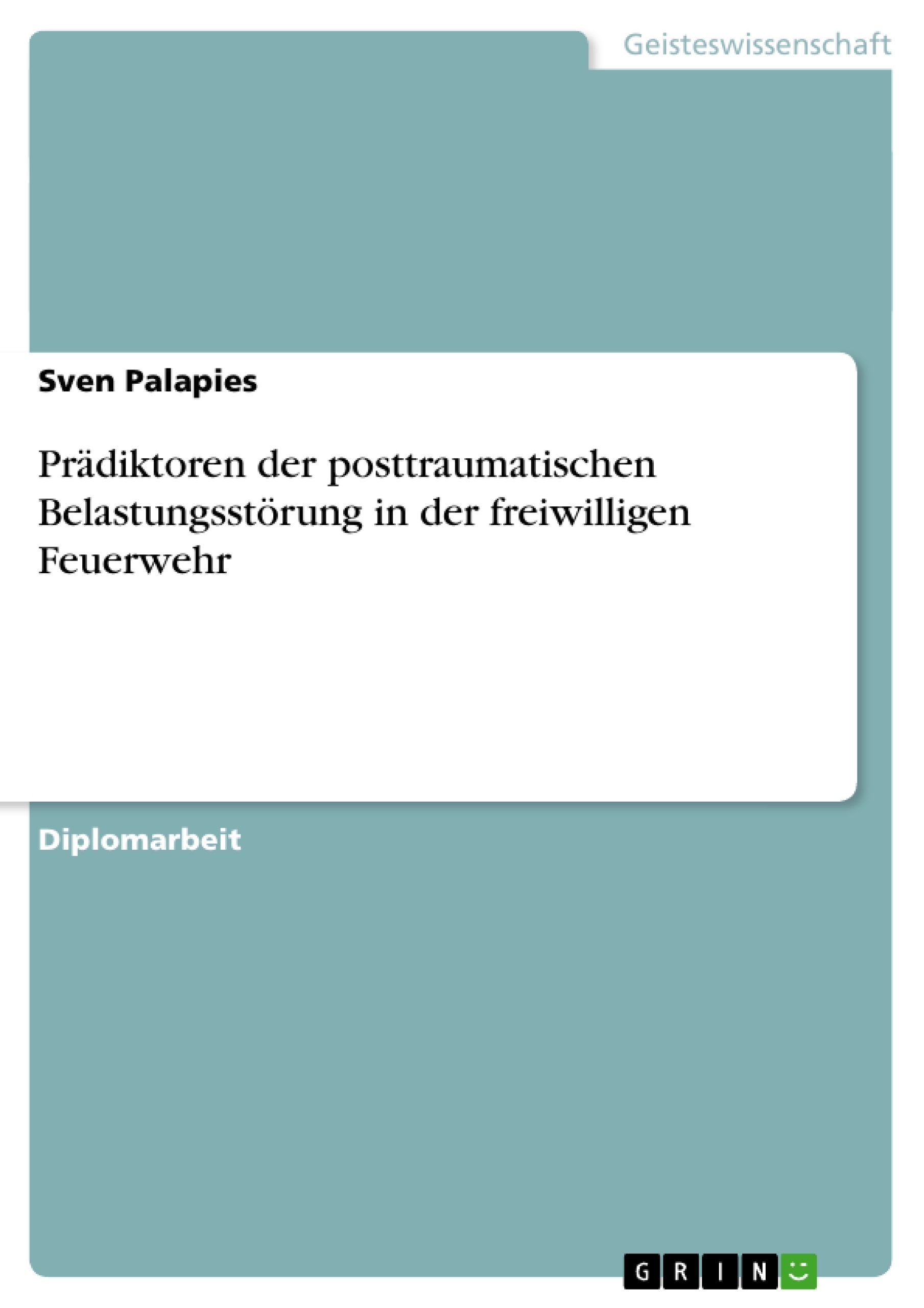

Kommentare