Leseprobe
Inhalt
Vorwort
1. Was hinter den Entscheidungen steckt
Die alten Griechen und die „geistigen Übungen“
Entscheidungen: Vernünftig, mutig, unbewusst, demokratisch, hierarchisch
Das Menschenbild hat sich verändert
Taylorismus
Emotionale Intelligenz
Die glücklichen Mitarbeiter
Selbstverwirklichung
Flow im Beruf
Spaß bei der Arbeit
Authentisch kommunizieren
Beispiel: Ich-Botschaften
Einfühlsam kommunizieren - Beispiel
2. Intuition und Entscheidung
Was ist Intuition?
Intuition beruht auf Erfahrungswissen
Das Bauchgefühl: Wie funktioniert es?
Wann können wir unserem Bauch vertrauen?
Faustregeln
Das evolvierte Gehirn
Evolvierte Fähigkeiten
Intuitive Urteile: Ein einziger Grund reicht
Entscheidungen treffen
3. Intuitiv und rational entscheiden
Gefühle nicht ausblenden
Fair und gerecht entscheiden
Faire Bezahlung
Mut
Regeln missachten?
Führen heißt: Mitarbeiter beteiligen
Peter Drucker: Effizient führen
Rationale Entscheidungsmodelle
Rationale Analyse
Balanced Scorecard
SWOT-Analyse
Spieltheorie
Kollektive Entscheidungsfindung
Der Glaube an die Weisheit der Gruppe
Gruppendenken
Entscheidungsprozess
Ablauf Entscheidungsfindung
Die japanische Art zu entscheiden
Verantwortung für Entscheidungen
Überprüfung der Entscheidung
Entscheidungsfehler: Zeichen von Schwäche?
Angst vor Fehlern
Vertrauen schaffen, offen über Fehler reden
Scheitern als sinnvoll betrachten
4. Entscheidungen vermitteln: Die Sprache
Verständlich und präzise formulieren
Wie sollte ein Text formuliert sein?
Sprache ist nicht logisch
Sprachgefühl
Testen Sie ihr Sprachgefühl
Bullshit
Informationen für Entscheidungen
Moden
5. Personalentscheidung: Einstellung
Entscheidungen:
Grundsätze und Regeln
Das Menschenbild des Interviewers
Beispiel: Führungskraft gesucht
Wer wird gesucht?
Übersicht Entscheidungsablauf:
Anforderungen
Aufgaben
Vorauswahl
Interviewvorbereitung
Organisation
Interviewbogen erstellen (Fragenkatalog siehe Anhang)
Gute Gesprächsatmosphäre schaffen
Eignungsbeurteilung
Zusammenfassende Beurteilung
Einstellungsentscheidung
Zusammenfassung: Faustregeln Bewerberauswahl
Anhang: Fragen, Aufgaben und Rollenspiele
6. Personalentscheidung Beförderung
Entscheidungen:
Regeln für Beförderung und finanzielle Belohnung
Zufriedene Mitarbeiter = leistungsstarke Mitarbeiter?
Beispiel Beförderung
Entscheidungsablauf
Kompetenz- und Leistungsprofil
Eignungsbeurteilung
Entscheidung
„Kotzbrocken“ werden nicht befördert
Verbindliche Grundsätze
Entscheidung über Gehaltserhöhungen, Bonus und Prämien
Leistungsschwache Mitarbeiter
ABC-Rating – ein brauchbares Beurteilungsverfahren?
Innere Kündigung
7. Personalentscheidung: Kündigung
Entscheidungen:
Gründe
Beispiel: Verhaltensbedingte Kündigung
Kündigung in der Probezeit
Betriebsbedingte Kündigungsgründe
Soziale Auswahl
Interessenausgleich und Sozialplan
Nachteilsausgleich
Sozialplan
Kündigung oder Aufhebungsvertrag?
Entscheidung übermitteln: Das Kündigungsgespräch
Die Angst der Führungskraft vor dem Kündigungsgespräch
Das Selbstbild
Verantwortung
Wenn es den Chef selbst trifft
Das Kündigungsgespräch mit dem Mitarbeiter
Checkliste zur Gesprächsvorbereitung
Gesprächskonzept
Visualisierung
Beispiel: Gesprächseinstieg
Umgang mit emotionalen Reaktionen
Fehler vermeiden
Es gibt kein Patentrezept
Was man sonst noch falsch machen kann
Positiver Gesprächsabschluss?
Nach der Kündigung: Unterstützung bei der Neuorientierung
Von der Angst der Verbleibenden
Zu guter Letzt: Die wichtigen Entscheidungen im Leben
Literatur
Vorwort
Der Bauch kommt in Mode. Gemeint ist nicht seine Existenz an sich, sondern das Gefühl, das nicht nur Bauchmenschen, sondern auch Kopfmenschen kennen. Klaus Kleber, Chef der ZDF-Nachrichtensendung „Heute-Journal“ hatte das Angebot, Chefredakteur des Spiegels zu werden. Er lehnte ab und begründete seine Entscheidung damit, dass er auf seinen Bauch gehört habe. Eine persönliche Entscheidung, bei der die Intuition den Ausschlag gab.
Wenn von Intuition die Rede ist, denken viele an Esoterik, aber nicht an die Wissenschaft. Neurologen, Hirnforscher und Psychologen erforschen die neuronalen Vorgänge, die sich bei Entscheidungen vollziehen. Der amerikanische Neurologe Antonio Damasio ist davon überzeugt, dass jede Entscheidung einen „emotionalen Anstoß“ brauche, weil aus purem Verstand heraus ein Mensch nicht handeln könne. Er ersetzt den Satz des französischen Philosophen Decartes´ „Ich denke, also bin ich“ so: „Ich fühle, also bin ich.“
Doch im Management hat sich diese Sichtweise offenbar noch nicht durchgesetzt. Der Vorstandsvorsitzende eines großen Energieunternehmens diskutierte mit einer Bischöfin über die Frage, wie Entscheidungen fallen und sagte: „ Man analysiert die Faktenlage. Welches sind die Alternativen? Wo liegen die Chancen und Risiken? Welches sind die Vor- und Nachteile einer Entscheidung, und wie bewerte ich diese?“ Von Intuition ist keine Rede. Doch der Glaube an die Macht der Vernunft bröckelt. Viele Führungskräfte wissen, dass auch auf den Verstand nicht immer Verlass ist und komplexe Situationen rational nicht vollständig zu erfassen sind.
Fehleinschätzungen beim Personal sind teuer, schaffen Konflikte und können verheerende Folgen für das Arbeitsklima haben.
Wer Personalentscheidungen trifft, muss auf die Bedürfnisse und Interessen der Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Was erwarten sie vom Unternehmen?
- Sie erwarten, dass sie fair und gerecht behandelt werden.
- Sie möchten als Person geachtet und respektiert werden.
- Sie wollen Anerkennung und erwarten eine Rückmeldung über ihre Leistung.
In diesem Buch geht es um Personalentscheidungen: Wie sie vorbereitet werden (Beschreibung und Analyse), wie Lösungen gesucht werden und die Entscheidung zwischen echten Möglichkeiten rational und intuitiv getroffen und dann umgesetzt wird. Dies wird an folgenden Beispielen erläutert:
- Personalauswahl: Wer wird eingestellt?
- Personaleinsatz: Wer leitet die Projektgruppe? Wer wird gefördert?
- Wer wird Führungskraft? Wer befördert?
- Wer bekommt eine Gehaltserhöhung oder eine Prämie?
- Wer wird entlassen?
Die Leser erhalten Informationen darüber, welche Eigenschaften und Fähigkeiten für die Urteilsfindung bei Personalentscheidungen erforderlich sind:
- Urteilsvermögen (Situation richtig einschätzen, Entscheidung und Folgen verantworten)
- Emotionale Kompetenz, vor allem Einfühlungsvermögen
- Wissen: Methoden, Verfahren, Erfahrungswissen (Intuition)
- Sprachliches Ausdrucksvermögen
Entscheidungen aus dem Bauch heraus können mutig sein. Intuitives Entscheiden ist ein Zeichen von Zuversicht. Es wäre ein Fehler, nicht auf den Bauch zu hören
Der Autor
1. Was hinter den Entscheidungen steckt
Der angebornen Farbe der Entschließung
Wird des Gedankens Blässe angekränkelt
(Shakespeare: Hamlet, Sein oder Nichtsein)
Die alten Griechen und die „geistigen Übungen“
Die alten Griechen waren davon überzeugt, dass man durch „geistige Übungen“ zu einer totalen Umwandlung des inneren Lebens kommen könne, zu einer radikalen Veränderung der Sicht aller Dinge. Wie konnte man das erreichen? Man muss in einen Dialog mit sich selbst treten, seinen Standpunkt und sein Weltbild in Frage stellen, um dann für sich selbst zu einer Entscheidung zu kommen, seine Weltsicht und seine Persönlichkeit zu verändern. Man muss mit sich ringen und kämpfen.
Ist diese Methode heute noch wirksam, trotz Psychoanalyse, Gentechnik, Neurolinguistisches Programmieren, Verhaltenstherapie und Erfolgsintelligenz? Die Griechen glaubten an die Willensfreiheit und an die Vernunft. Der Mensch kann sich verändern, wenn er nur will. Das glauben wir auch heute noch.
Die Philosophie im alten Griechenland verstand sich als Lebensweise, als eine Übung des Denkens und der Willenskraft, die einen Zustand der Weisheit zu erreichen versuchte. Durch das Selbstgespräch, den inneren Dialog wollte man seine Ziele erreichen: Innere Ruhe, Selbstvertrauen, Unabhängigkeit und innere Freiheit. Als Methode der Selbsterkenntnis und Veränderung: kannten sie die „geistige Übung“.
Die alten Griechen waren davon überzeugt, dass man durch „geistige Übungen“ zu einer totalen Umwandlung des inneren Lebens kommen könne, zu einer radikalen Veränderung der Sicht aller Dinge. Wie konnte man das erreichen? Man muss mit sich selbst in einen Dialog treten, seinen Standpunkt und sein Weltbild in Frage stellen, um dann für sich selbst zu einer Entscheidung zu kommen, seine Weltsicht und seine Persönlichkeit zu verändern. Man muss mit sich ringen und kämpfen.
Ist diese Methode heute noch wirksam, trotz Psychoanalyse, Gentechnik, Neurolinguistisches Programmieren, Verhaltenstherapie und Erfolgsintelligenz? Die Griechen glaubten an die Willensfreiheit und an Vernunft. Der Mensch kann sich verändern, wenn er nur will, kann sich bessern, kann sich selbst verwirklichen. Das glauben wir auch heute noch.
Entscheidungen: Vernünftig, mutig, unbewusst, demokratisch, hierarchisch
Der französische Philosoph Rene´ Decartes hat bei Entscheidungen der Vernunft den Vorzug gegeben („Ich denke, also bin ich“), Alexander durchschlägt den Gordischen Knoten mit seinem Schwert, Julius Caesar trifft die unwiderrufliche Entscheidung, den Rubikon zu überschreiten, Kolumbus fand eine verblüffend einfache Lösung für ein unlösbar scheinendes Problem, ein Ei zum Stehen zu bringen und Sigmund Freud war der Auffassung, dass Handlungen und Entscheidungen durch das Unterbewusstsein beeinflusst würden.
Bei der Entscheidung, wer amerikanischer Präsident wird, spielen Gefühle eine große Rolle. Viele Amerikaner entscheiden sich für den einen oder anderen Kandidaten aus dem Bauch heraus. Wer für eine unserer demokratischen Parteien auf einem Listenplatz in den Bundestag gewählt wird, bestimmen Delegierte der betreffenden Partei. Gewerkschaften, Fußballvereine oder gemeinnützige Einrichtungen bestimmen ihre Vorstände und Vorsitzende durch Mehrheitsentscheid. Das sind demokratische Entscheidungen, die Mehrheit fällt das Urteil.
Von Mehrheitsentscheidungen soll hier nicht die Rede sein, sonder vielmehr von Personalentscheidungen in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und Organisationen, wo es Hierarchien gibt, also von Entscheidungen von oben nach unten. Dort entscheidet in der Regel derjenige, der die Verantwortung hat. In Ausnahmefällen bestimmt ein Gremium, der Vorstand oder das Team, in der Regel nicht per Mehrheitsbeschluss, sondern im Konsens.
Das Menschenbild hat sich verändert
Aristoteles war der Auffassung, dass einige Menschen von Natur aus zum Befehlen, andere zum Dienen geschaffen wären. Schon Thomas Hobbes ("Leviathan") widersprach heftig. Die Bereitschaft, sich unterzuordnen hat seit dem Bau der Pyramiden, wo es bekanntlich streng hierarchisch zuging, stark abgenommen.
Martin Luther betrachtete den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit als unbedingte Pflicht des Christen. Und der Antichrist Friedrich Nietzsche hielt den Gehorsam für ein angeborenes Bedürfnis.
Zu Zeiten Luthers galt Arbeit als eine arge Last. Es kam wenig Freude auf. Von Selbstverwirklichung durch Arbeit konnte keine Rede sein. Wer es sich leisten konnte, arbeitete nicht. Die Arbeitgeber hatten ein schwieriges Problem zu lösen: Wie bekommen wir die Leute dazu, für einen Hungerlohn harte Arbeit zu machen? Martin Luther hatte eine geniale Idee: Er machte die Arbeit zum "Beruf" und zur Christenpflicht.
Die Fabrikherren des 19. Jahrhunderts waren Patriarchen. Sie forderten Strenge, wie Eltern sie von ihren Kindern verlangten. Ordnung , Pünktlichkeit, Sauberkeit und Disziplin waren Tugenden, die auch in der Erziehung und beim Militär hochgehalten wurden. Für Führungspositionen und Vertrauensstellungen bevorzugten die Fabrikbesitzer ehemalige Unteroffiziere. „Befehl und Gehorsam“ war auch in den Fabriken das Führungsprinzip.
Für das hierarchische Denken stand die katholische Kirche Pate. Bei den Rängen (Bischof, Pfarrer, Kaplan, Diakon) nehmen die Herrschaftsbefugnisse mit der Heiligkeit ab (Hierarchie = Herrschaft der Heiligen). Von diesem Prinzip leiteten auch die Eigentümer in den Fabriken, die Prokuristen und Meister ihre Legitimation ab: „Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand.“
Fabrikherren hatten eine absolute Stellung, wie Fürsten und Könige. In dem Gefüge Herrscher - Untertan konnten sie ihren Willen durchsetzen. Daraus resultierte der Herr-im-Hause-Standpunkt, wie ihn etwa der Industrielle Friedrich Krupp 1872 vertrat. Er forderte von seinen Arbeitern Gehorsam, Dank, Treue, Fleiß und einen sittlichen Lebenswandel. Aber er sorgte auch für seine Arbeiter: Er baute Werkswohnungen und richtete eine Krankenstube, Kantine und Pensionskasse ein.
Taylorismus
Wie ging es in der „neuen Welt“ zu? Der amerikanische Ingenieur Frederick W. Taylor hat Anfang des 20. Jahrhunderts das hierarchische Menschenbild zur Grundlage seiner "wissenschaftlichen Betriebsführung" gemacht. Taylor setzte auf Arbeitsteilung. Wer tagein, tagaus dieselben Handgriffe macht, beherrscht seine Arbeit im Schlaf und schafft mehr, vor allem dann, wenn es finanzielle Anreize gibt.
Das Menschenbild, das dem Taylorismus zugrunde liegt, hat sich verändert. Ging Taylor noch davon aus, dass man die meisten Menschen zur Arbeit antreiben müsse und nur durch Geld zu höheren Leistungen motivieren könne, setzen die Unternehmen heute auf Mitarbeiter, die selbständig arbeiten, Verantwortung übernehmen und ihre Fähigkeiten entfalten wollen.
Der Taylorismus war bis zur Einführung von Gruppenarbeit in den 80er Jahren das alles beherrschende Prinzip.
Nur wenige hatten das Sagen, und die vielen anderen hatten die Anordnungen auszuführen. Man war davon überzeugt, dass auch nur wenige das Zeug dazu hätten, Führungsaufgaben zu übernehmen. Ausführende Arbeiten zu verrichten hatte demnach etwas mit einer minderen geistigen Verfassung zu tun.
Das Menschenbild des Taylorismus hat sich lange gehalten. Die Japaner sind zuerst darauf gekommen, dass die "Ressource Mensch" als Produktionsfaktor noch lange nicht ausgeschöpft sei und sich daraus ungeahnte Rationalisierungsreserven ergeben. Toyota führte als erster Autohersteller die Gruppenarbeit ein. Die Firmen profitierten davon, dass auch Arbeiter bereit waren, nicht nur ihre Arbeitskraft der Firma zur Verfügung zu stellen, sondern auch ihren Kopf und ihre Ideen.
In den 20er Jahren kam eine interessante Variante in Amerika auf, die sich "Human-Relations-Bewegung" nannte. Man müsse nur nett und freundlich zu den Mitarbeitern sein, eine menschliche Atmosphäre schaffen, dazu helle Arbeitsräume, dann steige auch die Produktivität, sinke die Fluktuation und die Chefs hätten weniger Ärger mit ihren Leuten. In Deutschland wurde dieser Ansatz erst nach dem zweiten Weltkrieg bekannt, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Der deutsche Verleger Axel Springer hat dafür gesorgt, dass dieser Kelch nicht spurlos an uns vorüberging. Er prägte den Slogan: "Seid nett zueinander!"
Emotionale Intelligenz
Was ist damit gemeint? Erfolg hänge nicht nur von der Begabung ab, sondern auch von der Fähigkeit, eine Niederlage zu ertragen, schreibt der amerikanische Psychologe Daniel Goleman in seinem Buch "Emotionale Intelligenz" (1996).
Goleman behauptet, dass der Intelligenz-Quotient (IQ) höchstens 20%, die emotionale Intelligenz dagegen 80% des Lebenserfolgs ausmache.
Nach Goleman bedeutet emotionale Intelligenz: Empathie, also die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen, mit den eigenen und fremden Emotionen umgehen und die Kunst, Niederlagen zu verkraften.
Goleman vertritt die Auffassung, dass Führungskräfte mit hoher emotionaler Kompetenz sehr viel erfolgreicher sind als die eher rational und kopfgesteuerten Manager: Der Vorgesetzte hat die Gefühle der Mitarbeiter zu respektieren und sie in den Prozess intelligenter Entscheidungsfindung einzubauen. Teams gleichen oft einem Hexenkessel, so Goleman, voller versteckter Emotionen. Wer ein Team führen will, muss dafür sorgen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
Was macht nach Goleman emotionale Intelligenz aus?
- Die eigenen Emotionen kennen, seine eigenen Gefühle laufend beobachten, um sich besser zu verstehen.
- Mit den eigenen Gefühlen so umgehen, dass sie angemessen sind. Wer eine hohe emotionale Intelligenz besitzt, erholt sich schnell von seinen Rückschlägen.
- Emotionen in den Dienst eines Ziels stellen, emotionale Selbstbeherrschung: Belohnungen aufschieben und die Impulsivität unterdrücken ist die Grundlage jeder Art von Erfolg.
- Empathie: Die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen. Die Unfähigkeit, die Gefühle anderer wahrzunehmen, ist ein großer Mangel an emotionaler Intelligenz.
- Umgang mit Beziehungen: Die Kunst der Beziehung besteht zum großen Teil darin, mit den Emotionen anderer umzugehen.
Was ist neu daran? Eigentlich nichts. Früher nannte man das gesunder Menschenverstand oder Herzensbildung, heute ist auch die Rede von der sozialen Kompetenz eines Mitarbeiters. Wer Menschen für sich einnehmen, sie für die Ziele der Firma begeistern kann, besitzt Führungseigenschaften, die wenig mit rationaler Intelligenz zu tun haben: Mit anderen zurechtkommen, kooperativ arbeiten, Konflikte fair austragen.
Hermann Hesses Steppenwolf Harry Haller könnte als der Prototyp eines Menschen mit geringer emotionaler Intelligenz gelten. Er war hochgebildet, aber seelisch unterentwickelt. Hermine, eine einfache Frau, war ihm emotional weit überlegen. Von Hermine lernte Harry Haller erst den Umgang mit Gefühlen, lernte er, was Leben ist.
Zur emotionalen Intelligenz gehört auch ein realistischer Optimismus. Optimisten führen eine Niederlage auf etwas zurück, was sich ändern lässt, so dass sie beim nächsten Mal Erfolg haben werden. Mit dem "positiven Denken" eines Carnegie oder Murphy hat das nichts zu tun. Positive Denker glauben nur an den Erfolg und vermeiden Konflikte: "Lächeln Sie, achten Sie die Meinung der anderen und sagen Sie nie, dass Sie sich irren.." (Dale Carnegie).
Bleibt die Frage: Kann man „emotionale Intelligenz“ lernen? Auch emotionale Intelligenz hat einen hohen genetischen Anteil, aber emotionale Fähigkeiten können gelernt und verbessert werden. Nehmen wir als realistisches Beispiel einen Manager, der nicht zuhört, andere ständig unterbricht und sich nicht wirklich dafür interessiert, was andere zu sagen haben. Hat er eine Chance, sein Verhalten zu ändern oder ist er ein Opfer seiner Gene? Wenn der Manager den Willen hat, ein besserer Zuhörer zu werden und sein Verhalten zu ändern, kann es gelingen. Ein guter Freund, ein Kollege oder ein professioneller Coach könnte ihm dabei helfen. Oder man bringt den Manager dazu, dem Beispiel eines guten Zuhörers zu folgen, als Modell (mit Videoaufzeichnung) zum Nachahmen.
Die glücklichen Mitarbeiter
Als man die Arbeit am Fließband erfand, waren die Unternehmer noch der Meinung, dass die Arbeiter eine natürliche Abneigung gegen Arbeit hätten und nur durch finanzielle Anreize etwas leisten. Außerdem war man der Überzeugung, dass nur wenige das Zeug hätten, Führungsaufgaben zu übernehmen. Anders ausgedrückt: Wer einfache, immer wiederkehrende Arbeiten verrichtet, ist auch geistig einfach gestrickt.
Das Menschenbild „Zuckerbrot und Peitsche“ hat sich lange gehallten. Unternehmer denken ständig darüber nach, wie sie die Produktivität steigern und die Kosten senken können. Erst mit der Einführung der Gruppenarbeit bei der Herstellung von Autos bei Toyota in Japan hat sich das geändert. Die Unternehmer wollten jetzt nicht nur die Muskelkraft nutzen, sondern auch die kreativen Kräfte der Mitarbeiter. Auch Montagearbeiter sollten jetzt mitdenken, und Vorschläge machen, wie man die Arbeit noch rationeller und kostensparender machen könne. Außerdem sollte der Mitarbeiter auch die Verantwortung für seine Arbeit übernehmen.
Die amerikanischen Arbeitgeber erfanden die Unternehmenskultur. Man wollte im Betrieb den ganzen Menschen, mit Herz und Verstand. Von nun an sollten sie ihre Arbeit gerne tun, mit Engagement und sich mit den Zielen der Firma identifizieren. Selbstverwirklichung durch Arbeit, sie sollten bei der Arbeit glücklich sein. Wer zufrieden ist mit seiner Arbeit und der Firma, wird auch sein Bestes geben und erfolgreich arbeiten.
Selbstverwirklichung
Die Wurzeln liegen im 17./18. Jahrhundert, der Epoche der Aufklärung. Kants Theorie der Autonomie steht für die Möglichkeiten, sich als Vernunftwesen zu bestimmen. Doch populär hat den Begriff erst die „Humanistische Psychologie“ gemacht, eine Bewegung, die Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von der Annahme ausgeht, dass es im Menschen angelegt sei, zu wachsen (Rogers), sich zu entfalten und das Bedürfnis zu haben, die eigenen Potenziale auszuschöpfen, „um alles zu sein, was man haben kann“ (Maslow). Das höchste Ziel des menschlichen Lebens sei die volle Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit, schreibt Erich Fromm (Haben oder Sein).
In einer Leistungsgesellschaft setzen sich Menschen oft unter einen starken Erwartungsdruck: Ich muss tüchtig sein und Erfolg haben. Ich muss alles erreichen, wozu ich fähig bin, sonst bin ich ein Versager.
Es gilt als Sünde, nicht das Beste aus seinen Anlagen zu machen.
Flow im Beruf
Eine populäre Variante der Selbstverwirklichung ist Flow. Wenn ein Mensch ganz in seiner Tätigkeit aufgeht, sich selbst und die Welt um sich herum vergisst; das nennt der amerikanische Sozialpsychologe Mihaly Czikzentmihalyi „Flow“. (vom englischen flow = fließen). Fühlen, Denken und Wollen befinden sich im Einklang. In der Regel entsteht ein Flow, so Czikzentmihalyi, wenn wir unsere Fähigkeit voll einsetzen, wenn wir eine große Herausforderung gerade noch bewältigen können. Zum optimalen Erleben gehöre ein „feines Gleichgewicht“ zwischen der eigenen Handlungsfähigkeit und den verfügbaren Gelegenheiten zum Handeln. Überfordert uns eine Aufgabe, reagieren wir erst frustriert, dann besorgt und schließlich ängstlich. Ist die Anforderung zu leicht, ist man erst entspannt und dann gelangweilt. Entspricht eine schwierige Aufgabe einem großen Können, kann es zu einem völligen Aufgehen in der Tätigkeit kommen.
Der Zweck des Fließens ist, im Fließen zu bleiben, nicht Höhepunkte oder utopische Ziele zu suchen. Es gibt keine Aufwärtsbewegung, sondern ein kontinuierliches Fließen. Aufwärts klettert man nur, um den Flow in Gang zu halten. Es gibt keine andere Begründung für das Klettern als das Klettern selbst. Das ist eine Art Autokommunikation.
Czikszentmihayi hat von Nietzsche die Idee des Dionysischen übernommen. Er spricht von einem erfüllten und guten Leben. Wir Wir sollten keine Zeit verschwenden und keine Möglichkeit ungenutzt lassen, um unsere Einzigartigkeit und Individualität zum Ausdruck zu bringen. Ein gutes Leben macht ein Leben heiter, gelassen, produktiv und lebenswert.
Klingt gut. Das gefiele auch den Bewohnern in den Slums von Rio oder Bangkok. Entscheidend sei, so Czikszentmihayi, dass man glücklich ist, während man etwas tut, das unsere Fähigkeiten erweitert und uns dabei hilft, uns weiterzuentwickeln und unser Potenzial auszuschöpfen. Besonders schöne Augenblicke, das völlige Aufgehen in einer Tätigkeit nennt er Flow. Das kann Ekstase, ästhetische Verzückung oder etwas anderes sein. Bei der Arbeit, so Czikszentmihayi erleben wir Flow häufiger als in unserer Freizeit. Passivität erzeuge eben kein Flow. Die Erfolgreichen sind aktiv, auch in ihrer Freizeit. Sie töpfern, arbeiten im Garten oder joggen durch den Stadtpark. Sie kennen das (oder den) Flow. Es ist nicht unmittelbar der Erfolg selbst, sagt er. Es ist die Anstrengung, der Gedanke und die Zuversicht, dass man es schafft.
In seinem Buch „Flow im Beruf“ stellt Csikszentmihayi die These auf: Nur glückliche Mitarbeiter engagieren sich und arbeiten gerne. Deshalb fordert er die Unternehmer auf, darüber nachzudenken, wie sie das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter steigern könnten. Zufriedene Mitarbeiter wünscht sich wohl jeder Unternehmer. Doch sinnvoll ist es für ein Unternehmen erst dann, wenn auch die Leistung stimmt. Welcher Unternehmer, so muss man wohl fragen, gründet eine Firma, um seine Angestellten glücklich zu machen?
Spaß bei der Arbeit
Ein bisschen Spaß muss sein, auch bei der Arbeit. Das ist eine Frage der inneren Einstellung. Das jedenfalls behaupten die Autoren des Buches „Fish“, Stephen C. Lundin, Harry Paul, und John Christensen.
Die Autoren haben sich den Pike Place Fischmarkt in Seattle als Vorbild genommen. Die Verkäufer dort würden ihre Arbeit mit Begeisterung machen:
„Ein Lachs auf dem Flug nach Minnesota“, ruft ein Fischverkäuferund schleudert ihn zum fünf Meter entfernten Ladentisch. Alle anderen Verkäufer im Chor: „Ein Lachs auf dem Flug nach Minnesota.“
Die Abteilungsleiterin Mary Jane Ramirez, die eine Abteilung mit lustlosen Mitarbeitern leitet, die nicht effizient arbeiten, hat ihr Konzept gefunden: „Die Leute auf dem Fischmarkt sind Künstler, sie müssen Tag für Tag bewusst kreativ sein. Auch ich kann eine Künstlerin sein.“
Sie kommt zu der Erkenntnis, dass die Einstellung zur Arbeit das Wichtigste sei. Man habe immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen könne, auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen könne. Sie macht ihren Mitarbeitern bewusst, dass deren negative Einstellung falsch sei und überzeugt sie, dass ihnen die Arbeit mit einer positiven und „künstlerischen“ Einstellung sehr viel mehr Freude bereite.
Es ist eine Binsenweisheit, dass Mitarbeiter dann mehr leisten, wenn sie Freude an ihrer Arbeit haben. Aber das ist nicht nur eine Frage der Einstellung zur Arbeit. Das hat auch etwas mit der Qualität der Arbeit zu tun, mit den Freiräumen, ob man seine Fähigkeiten einsetzen und sich entfalten kann. Auch das Fröhliche-Fische-Verkaufen wird einmal zur Routine und ist bestimmt nicht immer spaßig. Das Buch „Fish“ vermittelt den Eindruck, als ob jeder Tag der Fischverkäufer die reinste Freude wäre. Immer nur Spaß ist doch auf Dauer auch langweilig. Und bei dieser Arbeit riecht man auch noch nach Fisch, auch dann noch, wenn die Arbeit längst vorbei ist. Fragen Sie einmal einen Fischverkäufer.
Authentisch kommunizieren
„Meine Schwäche besteht darin, dass ich offen spreche.
(Moliere: Der Menschenfeind)
Der Hamburger Psychologie-Professor Reinhard Tausch (Gesprächspsychotherapie, 1981) plädiert für einen offenen Umgang miteinander: Ehrlich, ohne Fassade, aufrichtig und durchschaubar sollen Menschen sein. Er fordert auch die Politiker auf, so mit den Wählern umzugehen. Das klingt ein wenig naiv und weltfremd. Oder hat der Mann Recht? Gibt es nicht auch Politiker, die offen sind und sich zu ihren Gefühlen bekennen? Richard Nixon zeigte in seiner Checker-Rede der Öffentlichkeit seine innere Welt, er zeigte Gefühle und brach in Tränen aus. Tony Blair und Bill Clinton beherrschen die Kunst, ihre Gefühle zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen. Das kommt bei manchen Leuten gut an. Aber "authentisch" ist das nicht. Diese Politiker spielen Glaubwürdigkeit.
Das Prinzip, seine Gefühle ohne Hemmungen herauszulassen, war in den 60er Jahren hoch im Schwange. Das war die Zeit, als Selbsterfahrungs- und Encountergruppen entstanden (Letting hang out: Alles rauslassen, sich fallen lassen). Dem Einzelnen brachte das sicher zeitweise Erleichterung bei der Lösung seiner persönlichen Probleme, doch als Extrem dürfte es wohl genau so schädlich sein wie die vollständige Unterdrückung seiner Gefühle.
Bei Carl Rogers, dem Begründer der Gesprächstherapie, gehört "Echtsein" neben dem "einfühlenden Verstehen" und der „Wertschätzung“ zur Grundhaltung, die jeder Kommunikation förderlich sei und zwischenmenschliche Beziehungen positiv beeinflusse. Carl Rogers spricht von "Kongruenz" und meint damit die Übereinstimmung zwischen drei Bereichen der Persönlichkeit: Was ich fühle (Erleben), was ich davon bewusst mitbekomme (Bewusstheit), und was ich davon mitteile (Kommunikation).
Das klingt faszinierend: Jeder sagt die Wahrheit, jeder ist durchschaubar und einschätzbar. Der Mensch als offenes Buch. Biblische Verhältnisse, paradiesische Zustände brechen aus. Die Menschen sind gut und ehrlich bis auf die Knochen. Der gläserne Mensch. Auch die Bösen sagen dann endlich die Wahrheit, denn sie fühlen sich dann besser. Sie fühlen sich erleichtert, wenn sie offen sagen, dass sie schlechte Gedanken haben oder böse Taten planen. Da sie es offen und ehrlich sagen, können die Guten sich darauf einstellen. Sie verhindern dann, dass Atombomben gebaut, Menschen vertrieben und Kriege geführt werden.
Die Offenheit, wie sie auch Rogers propagierte, ist ganz tief in der puritanischen Tradition verwurzelt. Die Dialektik des Lebens hat mit dem Idealismus des guten Menschen Rogers nichts zu tun. Die Menschen sind nun einmal nicht so, wie Carl Rogers sie gerne hätte. Und Kongruenz steht ihm Widerspruch zur Realität: Die Menschen müssen mit ihren Spannungen und Widersprüchen leben, auch wenn sie sich manchmal nach mehr Kongruenz sehnen. Das erst macht ein Leben farbig und spannend.
Wer kommuniziert, will andere beeinflussen, für sich gewinnen, sie überzeugen. Das wird ihm nicht immer gelingen, auch dann nicht, wenn er im Sinne von Carl Rogers „echt“ ist.
Ruth Cohn, die Begründerin der „Themenzentrierten Interaktion“, ist etwas vorsichtiger als Rogers und Tausch. Sie spricht von „selektiver Authentizität“. „Nicht alles, was echt ist, will ich sagen, doch was ich sage, soll echt sein.“
Der Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun weiß offenbar, woran es liegt, warum ein authentischer Umgang im Betrieb schwierig ist:
„. ist der Karrierewettbewerb in der Arbeitswelt wenig geeignet, einen authentischen, fassadenfreien Umgangsstil zu fördern (...). Wem es gelingt, sich selbst herauszustellen und womöglich den anderen schlecht aussehen zu lassen, erhöht seine Chance auf eine Karriereprämie“ (Miteinander reden, 1981)
Rücksichtsloses Konkurrenzverhalten im Betrieb ist sehr viel weniger verbreitet, als viele vermuten. Das Bild, jeder sei des anderen Wolf (homo homini lupus), wie Thomas Hobbes es formulierte, hat noch nie gestimmt. Die Regeln für den Umgang und den Aufstieg im Unternehmen werden von den meisten Mitarbeitern akzeptiert. Im übrigen verhalten sich die Menschen im Betrieb wie anderswo auch: Sie mögen sich, unterstützen sich, verabscheuen sich, spinnen Intrigen, denken sich Gemeinheiten aus (Mobbing), gehen aber manchmal auch sehr lieb miteinander um.
Die Sehnsucht bleibt. Die Sehnsucht nach dem Echten, dem Unverfälschten. Das hat nicht nur im Land der Puritaner Hochkonjunktur, sondern auch bei uns. Also spielen wir die Rolle des Ehrlichen, des Aufrichtigen, des Authentischen. Wer offen seine Meinung sagt, schadet sich selbst. („Der Ehrliche ist der Dumme“.) Solange es ein Oben und Unten , Chefs und Untergebe gibt, solange wird es Heuchelei, Schmeichelei, Lug und Trug geben.
Der amerikanische Drehbuchautor Robert Mc Kee sagt in einem Interview (Harvard Business Manager 10/2003):
Was das Leben so lebenswert macht, kommt nicht
von der Sonnenseite...Das Leben zieht seine Energie
aus allem, was uns leiden lässt. Indem wir gegen
diese negativen Kräfte kämpfen, sind wir gezwungen,
intensiver zu leben.“
„Würde man das Böse im Menschen beseitigen“, schreibt Montaigne in seinen Essais, zerstörte man die Grundbedingung des Lebens.“
Beispiel: Ich-Botschaften
Ein wichtiges Instrument in der Kommunikationswissenschaft ist die Verbalisierung von Gefühlen mit Ich-Botschaften.
Ein Fall aus dem wirklichen Leben:
Jens Diepholz macht Karriere. Er wurde vor zwei Monaten zum Abteilungsleiter ernannt und hat gerade ein Kommunikations-Seminar besucht. In diesen Seminaren lernen Fach- und Führungskräfte etwas über die Kommunikation in Projektgruppen, Qualitätszirkeln und Mitarbeitergesprächen (Einstellungs-, Beurteilungs- und Kündigungsgespräche).
Beim Mittagessen mit Kollegen in der Kantine erzählt er, dass er jetzt die „Gefühlssprache“ besser beherrsche und sich bei diesem Seminar „voll eingebracht“ habe. „Das sag´ ich jetzt mal so“ ist jetzt einer seiner Lieblingssätze. Sein Kollege Jan Kunze, der die Verkaufsabteilung leitet, hält das alles für ein alten Hut: „Beim Verkaufen kam es immer schon darauf an, die Gefühle der potenziellen Käufer anzusprechen. Und der Kollege vom Einkauf, der mit Diepholz in der Volleyball-Mannschaft der Betriebssportgruppe spielt, sagt unverblümt, was er davon hält: Humbug.
D. ist froh, dass er das Gelernte auch gleich in der Praxis anwenden kann. Er hat für morgen früh seine Mitarbeiterin, Frau Krause, zu einem Gespräch eingeladen.
Hier ein Auszug:
Chef:
Sie haben es sicher schon gehört, Frau Krause. Die Aufträge gehen zurück, der polnische Markt ist weggebrochen, die Firma muss Mitarbeiter entlassen. Leider gehören sie auch dazu, was ich persönlich sehr bedaure.
Krause:
(erschrocken) Warum ausgerechnet ich? Ich habe immer geglaubt, dass Sie mich mögen und meine Arbeit schätzen (Pause, fängt an zu weinen). Ich bin doch eine alleinerziehende Mutter, das wissen Sie doch.
Chef:
Ich verstehe Sie ja. Diese Nachricht hat sich jetzt wie ein Schlag getroffen (Frau Krause nickt zustimmend). Sie fühlen sich schlecht, hilflos und ohnmächtig. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll.
Krause:
Genau. Ich bin traurig und enttäuscht. Warum ich? Was habe ich falsch gemacht?
Chef:
Sie fühlen sich gedemütigt durch die Kündigung, weil wir Ihre Leistung ignoriert haben und
Krause:
Richtig. Ich glaube, Sie verstehen, wie ich mich fühle. Aber was soll ich jetzt machen?
Chef: Ich werde mit der Geschäftsleitung über Ihren Fall sprechen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, sie in einer anderen Abteilung unterzubringen.
Krause:
(freudig erregt) Würden Sie das für mich Tun? Danke, Sie sind ein guter Mensch
Diese Haltung, die Ich-Botschaften, die der Chef hier zeigt, mag menschlich verständlich sein, bleibt aber trotzdem ein Irrweg. Der Chef erweckt bei seiner Mitarbeiterin Hoffnungen, die der Chef bzw. das Unternehmen nie und nimmer erfüllen können. Das Verhalten des Vorgesetzten ist fahrlässig, da die Entscheidung, wer entlassen wird, längst gefallen ist.
Einfühlsam kommunizieren - Beispiel
Unter Überschrift „Bitten bewusst formulieren“ erzählt der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg (Gewaltfreie Kommunikation, 2004) von einer Unterhaltung zwischen einem Ehepaar in der Bahn, die Fluggäste zum Terminal bringt:
Ehemann:
Noch nie in meinem Leben bin ich mit so einem langsamen Zug gefahren. (Ehefrau schweigt)
Der Mann wiederholt seinen Satz: „Noch nie bin ich “
Jetzt reagiert seine Frau:
„Das Tempo wird elektronisch gesteuert.“
Ihr Mann zum dritten Mal: „Ich bin noch nie in meinem Leben mit so einem langsamen Zug gefahren.“
Darauf die Ehefrau (wütend): „Ja, was soll ich denn tun? Aussteigen und schieben?
Rosenbergs Kommentar zu diesem Dialog: „Und schon hatten wir zwei leidende Menschen.“
Welche Reaktion, fragt Rosenberg, hätte der Mann gewollt? Seine Antwort: Ich meine, dass er Verständnis für sein Leid haben wollte. Hätte seine Frau das gewusst, dann hätte sie zum Beispiel antworten können: „Das klingt so, als machst du dir Sorgen, dass wir vielleicht unser Flugzeug nicht mehr erwischen, und empört bist, weil du gerne schnellere Züge zwischen diesen Terminals hättest.“
Rosenberg meint, dass die Frau die Frustration des Mannes zwar wahrgenommen, aber sie keine Ahnung hatte, was er von ich wollte.
Mein Kommentar als Ehemann: Wenn ich das zu meiner Frau gesagt hätte, dass ich noch nie mit einem so langsamen Zug gefahren sei, hätte sie wahrscheinlich schon beim ersten Mal lächelnd gesagt: „Hoffen wir, dass das Flugzeug schneller ist.“
Rosenbergs Sprache ist geprägt von Verbalisierung von Gefühlen und Paraphrasieren, wie es eben Therapeuten tun. Das mag für seine Arbeit als Trainer und Mediator nützlich sein, aber um ein Gespräch über eine alltägliche Situation zu beschreiben, klingt sie eher weltfremd.
2. Intuition und Entscheidung
Was ist Intuition?
Der amerikanische Hirnforscher Antonio Damasio weist nach, dass Intuition eine biologische Grundlage hat. Er hat Hirngeschädigte mit einer Gruppe normaler Versuchspersonen verglichen. Den Hirngeschädigten mangelte es an Intuition, einer emotionalen Reaktion auf die antizipierten Konsequenzen guter und schlechter Entscheidungen (Decartes´Irrtum, 1998).
In einem Interview (Gehirn&Geist 1/2007) erläutert Damasio seine Grundposition:
„Decartes` Position, wonach Körper und Geist vollkommen getrennte Substanzen darstellen, halte ich für falsch. Körper und Geist sind für mich unterschiedliche Aspekte bestimmter biologischer Prozesse. Ähnliche Ansichten zum Leib-Seele-Problem vertrat nur wenige Jahre nach Decartes der Philosoph Spinoza: „Der Gegenstand der Idee, die den menschlichen Geist ausmacht, ist der Körper.“
Damit nahm Spinoza Erkenntnisse der modernen Neurobiologie vorweg.
Für die Führungskräfte in den Unternehmen und Organisationen heute lautet die Frage: Wie kann man das Wissen der Hirnforschung für Personalentscheidungen nutzen?
Der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel (Zum Entscheiden geboren, 2008) unterscheidet drei Formen des Wissens. Neben dem sprachlichen und bildlichen Wissen nennt er das „intuitive Wissen“ oder das „stumme Wissen“, das sprachlich nicht verfügbar, aber deshalb nicht irrational sei, sondern mit einer eigenen Logik. Das intuitive Wissen, so Pöppel, funktioniere um so besser, „je reicher die Arbeitsplattform unseres Geistes ist, die mit Wissen aus frühesten Zeiten ausgestattet wird.“
Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth wurde in einem Interview (Gehirn&Geist 11/2007) nach dem intuitiven Wissen gefragt:
Ein hilfreicher Ansatz, das wurde auch empirisch nachgewiesen, besagt: Wäge zunächst ausgiebig rational ab und lass die Sache dann einige Zeit ruhen. Fühlt sich die gewählte Option immer noch gut an, tu es! Die Wahl, die wir am Ende treffen, ist immer emotional – es gibt ja eigentlich gar keine rationale Entscheidungen, nur rationale Erwägungen.
Gerd Gigerenzer hat am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung viele Jahrre über Intuition geforscht und seine Ergebnisse in dem Buch „Bauchentscheidungen“ in einer verständlichen Sprache veröffentlicht. Er schreibt, dass ein Großteil unseres geistigen Lebens sich unbewusst vollziehe und auf Prozessen beruhe, die nichts mit Logik zu tun haben. Er spricht von Bauchgefühlen, Intuitionen und der „Intelligenz des Unbewussten: Ohne zu denken wissen wir, welche Regel in welcher Situation vermutlich funktioniert.“
Intelligenz kann man sich als eine bewusste Tätigkeit vorstellen, die von den Gesetzen der Logik bestimmt wird. Benjamin Franklin soll seinem Neffen, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden konnte, die Pro-und-Kontra- Methode empfohlen haben, bei der das Für und Wider abzuwägen und zu gewichten ist. Ausgerechnet bei einer Entscheidung, bei der es nur auf Intuition ankommt. Die Franklin-Methode, bei der das Ziel ist, den höchsten Wert und den größten Nutzen zu ermitteln, sei nicht immer der beste Weg, meint Gigerenzer.
Wir wissen mehr als wir zu sagen wissen. Beispiel Sprachgefühl: Muttersprachler sind in der Lage spontan zu sagen, ob ein Satz grammatisch korrekt und idiomatisch richtig ist, aber nur wenige können erklären, warum das so ist.
Intuition beruht auf Erfahrungswissen
Der amerikanische Neurologe Antonio Damasio ist davon überzeugt, dass jede Entscheidung einen „emotionalen Anstoß“ brauche, weil aus purem Verstand heraus ein Mensch nicht handeln könne. Er ersetzt den Satz des französischen Philosophen Decartes´ „Ich denke, also bin ich“ so: „Ich fühle, also bin ich.“
Entscheidungen müssen rational sein. Davon sind auch heute viele Kinder der Aufklärung überzeugt, allen voran Wissenschaftler. Sie glauben an die mathematische Logik. Der Psychologe Gerd Gigerenzer in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (25.8.07) meint dazu: „Man weiß, was zu tun ist, ohne die Gründe dafür zu kennen. Ihnen liegen aber nicht nur Erfahrung, sondern auch einfache Faustregeln zugrunde, etwa Wähle, was du kennst, imitiere den Erfolgreichen, vertraue einem einzigen Grund und ignoriere alle anderen“.
Dass Logik ein nützliches Werkzeug ist, bestreitet Gigerenzer nicht. Aber es sei eben nur eines unter vielen nützlichen Werkzeugen. Einen Gegensatz zwischen Vernunft und Bauchentscheidung gebe es nicht, „Logik und Intuition sind zwei Werkzeuge aus der gleichen Kiste.“ Und wenn es um Liebe gehe, handeln alle Menschen intuitiv.
Kommen wir mit unseren Bauchgefühle zu besseren Entscheidungen? Das erscheint und auf den ersten Blick naiv. Die Wirtschaftswissenschaften haben den homo ökonomicus erfunden und die Unternehmen arbeiten nach dem ökonomischen Prinzip, mit geringstem Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielen.
Wie andere Ansätze der Sozialwissenschaften versucht die Wissenschaft von der Intuition menschliches Verhalten zu erklären und vorherzusagen. Gigerenzer räumt ein, dass seine wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Intuition in der Welt der Wissenschaft umstritten sind. Was er in seinem Buch „Bauchentscheidungen“ vorlegt, bezeichnet er als „Werkzeugkasten mit Werkzeugen für ein ganzes Spektrum von menschlichen Problemen.“
Für ein Unternehmen, wo Führungskräfte Personalentscheidungen zu treffen haben, ist das Modell des Psychologen Gerd Gigerenzer nach vollziehbar und kann nach meiner Einschätzung auch angewendet werden.
Gigerenzers Werkzeugkasten hat drei Ebenen:
1. Evolvierte (entwickelte) Fähigkeiten (z.B. nachahmen)
2. Bausteine, die sich Fähigkeiten zu nutze machen. Beispiel Blickheuristik mit den Bausteinen:
a) Fähigkeit, Objekte mit dem Auge zu verfolgen
b) Beim Laufen das Gleichgewicht halten
c) Die Fähigkeit zu einer fein abgestimmten visuell-motorischen Koordination
3. Faustregeln, die aus Bausteinen bestehen.
Das Bauchgefühl: Wie funktioniert es?
Faustregeln sind im evolvierten (= entwickelten) Gehirn und in der Umwelt verankert.
Faustregeln (der wissenschaftliche Ausdruck heißt „Heuristik“) liefern uns die Antwort. Sie sind gewöhnlich unbewusst, können aber auf die Bewusstseinsebene gehoben werden. . Wichtig vor allem: Faustregeln sind im evolvierten Gehirn und in der Umwelt verankert. Durch Nutzung sowohl der evolvierten Fähigkeiten in unserem Gehirn als auch der Umweltstrukturen können Faustregeln und ihr Produkt- die Bauchgefühle – äußerst erfolgreich sein.
In einer ungewissen Welt können einfache Faustregeln komplexe Phänomene ebenso gut oder besser vorhersagen als komplexe Regeln.
Eine Faustregel unterscheidet sich grundlegend von der Bilanzmethode mit Pro und Kontra. Sie greift wichtige Informationen heraus und lässt den Rest außer Acht.
Beispiel: Für das Fangen eines Balls haben wir die Blickheuristik identifiziert, die alle für die Berechnung der Wurfbahn erforderlichen Informationen beiseite lässt: Entfernung, Geschwindigkeit, Winkel der Flugbahn, Luftwiderstand, Wind. Sie folgt vielmehr dieser Reihenfolge, die das Ergebnis von Forschungsarbeiten des Max-Plank-Instituts für Bildungsforschung ist:
(1) Fixiere den Ball,
(2) beginne zu laufen und
(3) passe deine Laufgeschwindigkeit so an, dass der Blickwinkel konstant bleibt.
Wann können wir unserem Bauch vertrauen?
Kontra:
Intuition ist untauglich, weil sie Informationen missachtet, gegen die Gesetze der Logik verstoße und die Ursache menschlicher Katastrophen sei.
Unser Bildungssystem misst zu Recht der Kunst der Intuition so gut wie keine Bedeutung zu.
Pro:
Menschen vertrauen ihrer Intuition im Alltag und preisen die Wunder rascher Einsicht.
Gigerenzer ist der Auffassung, dass Intuition nicht nur ein Impuls oder eine Laune ist, sondern ihre eigene Gesetzmäßigkeit hat.
Faustregeln
Nach Gigerenzer sind Faustregeln für die Entstehung von Bauchgefühlen verantwortlich. Beispielsweise teilt uns die Gedankenlesenheuristik mit, was andere wünschen, die Rekognitionsheuristik löst ein Gefühl aus, das uns verrät, welchem Produkt wir trauen können, und die Blickheuristik erzeugt eine Intuition, die uns sagt, wohin wir laufen sollen.
Bauchgefühle mögen ziemlich simpel erscheinen, doch ihre tiefere Intelligenz äußert sich in der Auswahl der richtigen Faustregel für die richtige Situation.
Bauchgefühle machen sich die evolvierten Fähigkeiten des Gehirns zunutze und beruhen auf Faustregeln, die es uns ermöglichen, rasch und mit verblüffender Genauigkeit zu handeln. Ihre Qualität gewinnt die Intuition aus der Intelligenz des Unbewussten: der Fähigkeit, ohne Nachdenken zu erkennen, auf welche Regel wir uns in welcher Situation verlassen haben.
Bauchentscheidungen können Denk- und Computerstrategien in den Schatten stellen. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass sie uns fehlleiten. An der Intuition führt kein Weg vorbei; ohne sie brächten wir wenig zustande.
Das evolvierte Gehirn
Es stellt uns Fähigkeiten zur Verfügung, die wir im Laufe von Jahrtausenden entwickelt haben, die aber von der Entscheidungstheorie weitgehend außer Acht gelassen werden. Ihm verdanken wir auch die menschliche Kultur, die sich weit schneller entwickelt als dies unsere Gene tun.
Diese evolvierten Fähigkeiten sind unentbehrlich für viele Entscheidungen und können uns grobe Fehler in wichtigen Angelegenheiten ersparen. Dazu gehört die Fähigkeit zu vertrauen, nachzuahmen und Emotionen zu empfinden.
Um menschliches Verhalten zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass es ein evolviertes Gehirn gibt, das es uns ermöglicht, Probleme auf unsere besondere Weise zu lösen, anders als Tiere das tun. Unsere Säuglinge brauchen sich nach der Geburt nicht zu verstecken wie Reptilien (die sonst von der Mutter gefressen werden), sondern machen sich für ihre Entwicklung andere Fähigkeiten zunutze: Lächeln, nachahmen, niedliches Aussehen und die Fähigkeit, zuzuhören und sprechen zu lernen.
Evolvierte Fähigkeiten
Sie sind das Baumaterial für Faustregeln: Sprache, Verfolgen von Objekten mit den Augen, Emotionen und – ganz wichtig – Nachahmen. Das bedeutet: Bedingung für die Entwicklung von Kultur, lernen aus der eigenen Erfahrung, alle nachahmen, die klüger sind.
Die Fähigkeiten des Gehirns hängen sowohl von unseren Genen als auch von unserer Lernumgebung ab.
So macht sich die Blickheuristik unsere Fähigkeit zunutze, bewegte Objekte vor einem unruhigen Hintergrund mit den Augen zu verfolgen. Im Gegensatz zu Robotern fällt dies den Menschen leicht; mit drei Monaten sind Säuglinge bereits in der Lage, bewegte Ziele im Auge zu behalten. Die Blickheuristik ist also für Menschen eine einfache Angelegenheit, jedoch nicht für Roboter auf dem heutigen Entwicklungsstand.
Umweltstrukturen bestimmen, wie gut oder schlecht eine Faustregel funktioniert. Ein Bauchgefühl ist nicht gut oder schlecht, rational oder irrational an sich. Sein Wert hängt von dem Kontext ab, in dem die Faustregel verwendet wird.
Intuitive Urteile: Ein einziger Grund reicht
Im Gegensatz zur rationalen Urteilsfindung, wo man alle relevanten Informationen sammelt und abwägt, reicht ein einziger Grund. Ein einziger Grund ist schon eine praktikable Strategie. Beispiel Werbung: „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“.
Wir sollten auf unsere Intuition vertrauen, wenn wir über Dinge nachdenken, die schwer vorauszusagen sind ( die Leistung des Mitarbeiters bei der Einstellung) und wenn wir wenig Informationen haben.
Wir sollten einer einfachen Regel folgen, die sich auf den besten Grund beschränkt und den Rest vernachlässigen, vor allem dann, wenn nicht genügend brauchbare Informationen zur Verfügung stehen.
Entscheidungen treffen
Kein Mensch sollte angesichts der begrenzten Zeit und Information, die zur Verfügung steht, den Versuch machen, alle Entscheidungen selbst zu treffen. Kooperation verlangt ein hohes Maß an Vertrauen.
Oft ist es vernünftig, andere um Rat oder gar nicht zu fragen und einfach ihr Verhalten nachzuahmen. Es gibt zwei grundlegende Arten der Nachahmung:
1. Tue das, was die Mehrheit deiner Bezugsgruppe tut
2. Tue das, was der Erfolgreiche tut.
Keine Form der Nachahmung ist gut oder schlecht an sich.
Als Heuristik (vom griechischen Verb für „finden“ abgeleitet) bezeichnet Gigerenzer eine Methode, komplexe Probleme, die sich nicht vollständig lösen lassen, mit Hilfe einfacher Regeln und unter Zuhilfenahme nur weniger Informationen zu entwirren. „Es gibt keinen Gegensatz zwischen Vernunft und Bauchentscheidung, sondern sie ergänzen sich. Logik und Intuition sind zwei Werkzeuge aus der gleichen Kiste.“
Wenn es um die Liebe gehe, so Gigerenzer, handeln alle Menschen völlig intuitiv.
Von Blaise Pascal stammt der Satz: „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.“ Gigerenzer aber will gerade die Gründe des Herzens mit dem Verstand erkunden.
3. Intuitiv und rational entscheiden
Gefühle nicht ausblenden
Wenn es darum geht, Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen, halten manche Gefühle für hinderlich und irrational. Wissenschaftler und Manager setzen mehr auf die Ratio, den Verstand und die Vernunft. Der Management-Professor Fredmund Malik konstruiert für Entscheidungen die Alternative Kopf oder Bauch (DIE WELT 11.1.2003) und polemisiert gegen die „Emotionsgurus“, die nach seiner Einschätzung für die Überlegenheit des Bauches einträten, ausschließlich von positiven Gefühlen sprechen und die destruktiven Gefühle unterschlagen würden. Hier irrt Malik. Der amerikanische Psychologe Daniel Goleman rechnet die Bewältigung von Niederlagen und Frust und den Umgang mit negativen Gefühlen ausdrücklich zur „emotionalen Intelligenz“. Sein Kollege Seymour Epstein, der schon viele Jahre vor ihm diese Gedanken formuliert hat, spricht von „konstruktivem Denken“ und postuliert das Hin- und Herschalten zwischen Erfahrung und Intellekt und zählt beispielsweise befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen dazu.
Das Führen von Mitarbeitern hat viel mit Kommunikation zu tun. Wer kommuniziert, macht das bekanntlich auf zwei Ebenen: Der Sach- und Beziehungsebene. Wer als Führungskraft das Vertrauen seiner Mitarbeiter gewinnen will, muss einen guten Draht zu seinen Leuten haben. Wer seine Mitarbeiter begeistern will, muss ihre Gefühle ansprechen. Wer Widerstand gegen Veränderungen überwinden will, muss Angst abbauen. Das geht nur auf der Gefühlsebene. Wer Mitarbeiter einstellt, muss eine Entscheidung treffen, die auf Glauben und Hoffnung beruht. Ob der künftige Mitarbeiter erfolgreich arbeiten wird, weiß bei der Einstellung niemand. Bei einem Kündigungsgespräch muss der Vorgesetzte mit Gefühlsäußerungen rechnen und einen Weg finden, damit umzugehen. Außerdem muss er mit seiner eigenen Angst zurechtkommen.
Unternehmen beschäftigen Menschen mit Herz und Verstand. Entscheidungen können deshalb nicht nur rational sein. Sie sollten mit Herz und Verstand getroffen werden.
Fair und gerecht entscheiden
Fair bedeutet integer sein, loyal, anständig, ehrlich, aufrichtig, zuverlässig, aufmerksam, Regeln beachten, Rücksicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nehmen und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern mit Worten und Taten zeigen. Verträge und Versprechen werden eingehalten und Konflikte fair gelöst, das heißt, dass man die Interessen und Bedürfnisse der Mitarbeiter achtet.
Faire Bezahlung
Im Neuen Testament steht die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20: Sie handelt von einem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen einige Arbeiter anheuerte für die Arbeit im seinem Weinberg. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Um neun ging er wider auf den Marktplatz und sah wieder ein paar Arbeitslose herumstehen. Auch zu ihnen sagte er: „Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten; ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und nachmittags noch einmal, um drei und ein letztes Mal um fünf Uhr. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter. „Ruf´ die Leute zusammen und zahle allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den letzten auf.
Die Männer, die zuletzt um fünf Uhr gekommen waren, bekamen einen Schilling. Die früher mit ihrer Arbeit begonnen hatten, erwarteten einen höheren Lohn und beschwerten sich, schließlich hätten sie den „ganzen Tag in der Hitze geschuftet.“ Darauf sagte der Weinbergbesitzer: „Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das habt ihr bekommen, und nun geht. Ich will dem letzten so viel geben wie dem ersten. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Geld mache? Oder seid ihr neidisch, weil ich so großzügig bin?“
Wäre der Weinbergbesitzer ein Unternehmer im Deutschland des 21. Jahrhunderts hätte er schlechte Karten. Er hätte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz unserer Verfassung verstoßen. Gleiches wird gleich, Ungleiches ungleich behandelt werden. Eine Differenzierung nach Fähigkeiten und Leistung ist zulässig. Sympathie- oder Barmherzigkeitsprämien sind unzulässig. Außerdem besteht ein Willkürverbot.
Gerechtigkeit ist die Tugend des Stärkeren, die Tugend dessen, der über Macht verfügt. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen möchte gerecht behandelt werden. Max Weber spricht von einem Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit.
Mut
Gerade im mittleren Management fehlt Führungskräften oft das unternehmerische Denken und der Mut zum Risiko und zum entschlossenen Handeln. Sie sind ängstlich, sichern sich nach allen Seiten ab, haben Bedenken und fragen bei jeder Kleinigkeit ihren Chef, als Rückversicherung, weil es ihnen am Mut fehlt, die Verantwortung zu tragen und für die Folgen einzutreten.
Der nette Chef: Vorsicht! Wer als Chef immer nur nett ist, ist deshalb nachgiebig, weil er beliebt sein will oder Konflikte scheut, die er unweigerlich damit erzeugt, dass sein Verhalten Friktionen hervorruft, weil man es eben nicht allen Recht machen kann.
Nach Aristoteles ist Mut zwischen den Extremen Feigheit und Tollkühnheit angesiedelt. Mut heißt, seinen eigenen Weg zu gehen, auch gegen Widerstände sein Ziel verfolgen, nicht fundamentalistisch, nicht dogmatisch, aber geradlinig, zu dem stehen, was man für richtig hält und keine faulen Kompromisse eingehen. Es gehört Mut dazu, seine eigene Meinung gegen Mehrheiten zu vertreten oder gegen seinen Chef, wenn man überzeugt ist, dass dies der richtige Weg ist.
Der Niederlassungsleiter eines Telekommunikations-Unternehmens hatte auf Empfehlung eines Mitarbeiters eine Verkaufssachbearbeiterin eingestellt, die neben Berufs- auch Branchenerfahrung hatte. Schon in der Probezeit war zu erkennen, dass die neue Mitarbeiterin den Anforderungen nicht gewachsen war. Sie innerhalb der Probezeit zu entlassen wäre das Eingeständnis des Niederlassungsleiters gewesen, der auch erst seit einem Jahr für die Firma tätig war, dass er einen Fehler gemacht hat. Auch seine Mitarbeiterin machte Fehler über Fehler. Sie musste täglich viel Zeit aufwenden, um ihre Fehler auszumerzen. Beschwerden von Kunden und Hinweise des Außendienstes über Schlampigkeiten oder Terminüberschreitungen ignorierte der Niederlassungsleiter. Er hat nie ein Gespräch darüber mit seiner Mitarbeiterin geführt. Die „Rettung“ kam für den Niederlassungsleiter, als die Zentrale wegen sinkender Umsatzzahlen und schlechtem Jahresergebnis beschlossen hatte, Personal abzubauen. Nach einem Jahr erhielt sie eine betriebsbedingte Kündigung und ein gutes Zeugnis: „Sie arbeitete stets zu unserer vollen Zufriedenheit“.
[...]
- Arbeit zitieren
- Karl-Heinz List (Autor:in), 2008, Personalentscheidungen. Warum das Bauchgefühl ein guter Ratgeber sein kann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92825
Kostenlos Autor werden


















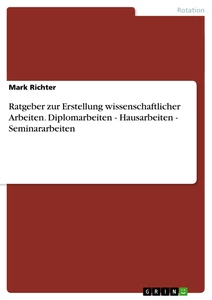



Kommentare