Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Die Innovation der Innovation
2 Offene Innovationsprozesse – Innovation im 21. Jahrhundert
2.1 Innovationsprozesse – Gestern, heute, morgen
2.2 Der offene Innovationsprozess
2.2.1 Organisation
2.2.2 Koordination
2.3 Kritische Würdigung der Innovationsprozessentwicklung
3 Offene Innovationsprozesse in der Praxis
3.1 Instrumente
3.1.1 Toolkits for User Innovation
3.1.2 Ideenwettbewerbe
3.1.3 Communities
3.1.4 Intermediäre Märkte
3.2 Analyse vorhandener Fallstudien
3.2.1 The Procter & Gamble Company
3.2.2 Intel Corporation
3.2.3 International Business Machines Corporation
4 Ergebnisse der Fallstudienanalyse
5 Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Anzahl „kluger“ Mitarbeiter in einem Unternehmen
Abb. 2: Zeit/Kosten-Zusammenhänge bei der Produktentwicklung
Abb. 3: Innovationsprozessmodellgenerationen
Abb. 4: Die Open Innovation Wissenslandschaft
Abb. 5: Manufacturer-Active vs. Customer-Active
Abb. 6: Modularitätszyklus
Abb. 7: Organisationsformen nach Chesbrough/Teece
Abb. 8: Network-Centric Innovation Typen
Abb. 9: Vergleich der verschiedenen Autoren
Abb. 10: Herstellerinnovator vs. Nutzer Co-Creator
Abb. 11: Das externe Wissensbeschaffungskontinuum
Abb. 12: Best-Practice Open Innovation
Abb. 13: P&G’s offene Netzwerke
Abb. 14: Explorative Forschung bei der Intel Corporation
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Die Innovation der Innovation
smart(employees) = logn(employees)
Diese Gleichung wird auch als Joy’s Law[1] bezeichnet und soll exemplarisch die Entwicklung der Anzahl der „klugen“ Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens bei insgesamt steigender Mitarbeiterzahl ausdrücken. Die Basis des Logarithmus ist variabel und Ausdruck von Managementstil, Kultur und Belohungsstruktur eines Unternehmens. Je geringer die Basis, desto besser. Auch wenn die Basis klein ist, weil jeder reich wird und unglaublich gute Belohnungen erhält, ist die Anzahl der „klugen“ Mitarbeiter als Ergebnis der Gleichung immer noch alles andere als aufbauend. Dies wird aus der folgenden Abbildung ersichtlich.[2]
Abb. 1: Anzahl „kluger“ Mitarbeiter in einem Unternehmen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: o.V. (2005).
Selbst bei optimalen Bedingungen liegt die Zahl der „klugen“ Mitarbeiter bei einer Gesamtmitarbeiterzahl von 100.000 Personen gerade mal bei 120. Somit kann als Quintessenz der obigen Gleichung von Joy’s Law festgehalten werden, dass „there are always more smart people outside your company than within.“[3]
Gerade heutzutage, mit immer kürzer werdenden Produktlebens- und Innovationszyklen, gewinnt diese Gesetzmäßigkeit immer mehr an Bedeutung. Es wird für Unternehmen zunehmend schwerer wirkliche Innovationen auf den Markt zu bringen und nicht in Inkrementalismus zu verfallen. Die Fähigkeit zu innovieren wird vor allem durch zwei Faktoren behindert – die Innovationsgeschwindigkeit, welche für steigende Profite benötigt wird, ist am steigen und die Produktivität intern angetriebener Innovationsbemühungen ist am sinken.[4] An dieser Problematik setzt das Modell offener Innovationsprozesse an, welches durch Integration der Ideen der „klugen“ Menschen außerhalb des Unternehmens die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken soll. Es könnte eine mögliche Antwort auf die Notwendigkeit zur Innovation der eigenen Innovationsprozesse sein, mit der Unternehmen zunehmend konfrontiert sind.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Bestandsaufnahme der bisherigen Entwicklungen zum Thema offene Innovationsprozesse bzw. Open Innovation zu machen und einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen zu geben. Dies wird als notwendig erachtet, da sich seit Veröffentlichung des Buches „Open Innovation“ von Henry Chesbrough im Jahr 2003, welches diese Diskussion erst richtig entfachte, sehr viel auf diesem Gebiet bewegt hat. Darüber hinaus soll der Leser die Bedeutung von Joy’s Law für offene Innovationsprozesse und deren Verbreitung verstehen.
Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert. Im folgenden, zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des Innovationsprozessverständnisses betrachtet, um anschließend auf die aktuelle Diskussion um offene Innovationsprozesse, worum es sich dabei handelt und wie damit umzugehen ist, einzugehen. Im Anschluss daran werden im dritten Kapitel Instrumente der offenen Innovationsprozesse vorgestellt, sowie drei Fallstudien von Unternehmen, die ihre Innovationsprozesse geöffnet haben, dargestellt und analysiert. Im vierten Kapitel werden die Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Vergleich der Fallstudien diskutiert, sowie mögliche allgemeine Hinweise zu Vorgehensweisen zur offenen Innovation abgeleitet. Abschließend erfolgt im fünften Kapitel eine kritische Würdigung der Ergebnisse dieser Arbeit.
2 Offene Innovationsprozesse – Innovation im 21. Jahrhundert
2.1 Innovationsprozesse – Gestern, heute, morgen
Der offene Innovationsprozess bzw. Open Innovation ist kein von Grund auf neuer Ansatz, wie so mancher Titel eines Aufsatzes oder Buches auf den ersten Blick vermuten lässt. Open Innovation ist vielmehr eine Entwicklung des Verständnisses und der Handhabung von Innovationsprozessen über die Zeit. Sozusagen eine inkrementelle Innovation des Innovationsprozesses. Um diese Entwicklung besser darstellen zu können, ist es zweckmäßig die historische Entwicklung des Innovationsprozessverständnisses kurz darzustellen. Der britische Innovationsforscher Rothwell hat sich mit der Analyse der Entwicklung von Innovationsprozessmodellen über die Zeit von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre beschäftigt. Innerhalb dieser Zeitspanne von rund 50 Jahren identifiziert Rothwell fünf Generationen von Innovationsprozessmodellen. Von den einfachen, linearen technology push und market/need pull Modellen der 1950er, 60er und frühen 1970er, über die interaktiven/gekoppelten Modelle der 1970er und frühen 1980er, sowie den integrativen/parallelen Modellen der 1980er und frühen 1990er, bis hin zu den heutigen Modellen der Systemintegration und des Networking.[5]
Während den 1950er Jahren, kurz nach dem zweiten Weltkrieg, ist die Nachfrage nach Gütern jeglicher Art enorm. Der Markt ist ein passiver Auffangbehälter für die Früchte der Forschung und Entwicklung (F&E) – es wird gekauft was angeboten wird. Innovation wird als linearer Prozess verstanden, bei dem mehr Input in F&E mit mehr Output an erfolgreichen neuen Produkten gleichgesetzt wird (Technology Push). Dieses Verständnis einer ersten Generation von Innovationsprozessmodellen hält bis zur Mitte der 1960er Jahre an. Die darauf folgende Periode von Mitte der 1960er bis zur Mitte der 1970er Jahre ist durch relativen Wohlstand gekennzeichnet. Die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage ist marginal und führt zu wachsendem Wettbewerb. Auch in dieser zweiten betrachteten Zeitperiode laufen Innovationsprozesse noch linear ab. Die Prozessverständnisse unterscheiden sich darin, dass Innovationen das Resultat von wahrgenommenen bzw. manchmal sogar genau artikulierten Kundenbedürfnissen sind, die z.B. über Marktforschung gewonnen werden, (Market/Need Pull). Die Markt- bzw. Nachfragerbedürfnisse geben den Forschungs- & Entwicklungsabteilungen der Unternehmen (F&E) die Richtung für ihre Aktivitäten vor. Diese machen die Ideen dann markttauglich und werden somit auf eine rein reaktive Rolle reduziert. Diese Sichtweise führt jedoch zu einer Vernachlässigung von Langzeitforschung, zu Gunsten der kurzfristigen Reaktion auf Marktbedürfnisse.[6]
Die dritte Generation der Innovationsprozessmodelle ist laut Rothwell von Mitte der 1970er bis zur Mitte der 1980er Jahre anzusetzen. Ölkrise und Inflation führen zu einer Nachfragestagnation. Schlagworte dieser Zeit sind Konsolidierung, Rationalisierung, Kostenkontrolle und Kostenreduzierung. Dies führt zu einem Umdenken im Verständnis des Innovationsprozesses um kostspielige Fehlschläge möglichst zu minimieren. Die Modelle der ersten und zweiten Generation werden als zu extrem und unpraktikabel verstanden. Sich hieraus ergebend, wird ein allgemeingültigeres Modell adaptiert, welches eine Kombination aus Technology-Push und Market-Pull darstellt. Im Grunde immer noch ein sequentielles Modell, wird es durch Feedbackschleifen ergänzt und ist als interaktives bzw. gekoppeltes Modell von technologischen Möglichkeiten und Marktbedürfnissen zu verstehen.[7] Es wird von Rothwell/Zegveld folgendermaßen beschrieben:
„[A] logically sequential, though not necessarily continuous process, that can be divided into a series of functionally distinct but interacting and interdependent stages. The overall pattern of the innovation process can be thought of as a complex net of communication paths, both intra-organizational and extra-organizational, linking together the various in-house functions and linking the firm to the broader scientific and technological community and to the marketplace. In other words the process of innovation represents the confluence of technological capabilities and market-needs within the framework of the innovating firm.“[8]
Von Anfang der 1980er Jahre bis zur Mitte der 1990er Jahre erholt sich die Weltwirtschaft und das Innovationsprozessverständnis ändert sich erneut. Aufgrund von immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen steht diese Periode ganz im Zeichen der time-based strategy. Durch die notwendige Verkürzung der Innovationszeit, wird Innovation als paralleler Prozess, anstelle eines rein sequentiellen Prozesses, gesehen. Externe Quellen von Ideen gewinnen zunehmend an Bedeutung[9] und werden bereits früh in den Innovationsprozess integriert, um sich neue Perspektiven und Ideen anzugeignen. Parallel zur Integration der externen Quellen, werden die Aktivitäten verschiedener interner Abteilungen im zeitlichen Ablauf der Produktentwicklung mit in das Innovationsprojekt integriert. Dies führt zu hohen Überlappungen verschiedener Aufgaben und Funktionen, wie F&E und Prototypenentwicklung und Herstellung (design for manufacturability), aber vor allem zu großer Zeitersparnis im Vergleich zum vorigen, sequentiellen Verständnis von Innovationsprozessen.[10]
Die letzte von Rothwell beschriebene Generation dauert seit Mitte der 1990er Jahre an. Die strategischen Trends aus der vierten Generation werden in einer intensivierten und verbesserten Form beibehalten, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf Qualität und Leistung. Insbesondere vor dem Hintergrund des stetig wachsenden globalen Wettbewerbs, der sich weiterhin verkürzenden Produktlebenszyklen, sowie dem rasanten technologischen Wandel, nimmt vor allem die Bedeutung der time-based strategies in der fünften Generation stetig zu. Auch wenn es nicht unbedingt das Ziel ist das erste Unternehmen mit einer Innovation am Markt zu sein, so ist es von großem Vorteil schnell und rechtzeitig dort als Anbieter präsent zu sein. In diesem Verständnis kann die Kontrolle über die Produktentwicklungsgeschwindigkeit durchaus als Kernkompetenz angesehen werden.[11] Dennoch ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass eine Reduktion der Entwicklungszeiten gleichzeitig zu einer Steigerung der Entwicklungskosten führt. Gupta/Brockhoff/Weisenfeld stellen diesen Zusammenhang anhand einer U-förmig verlaufenden Kurve dar, wie aus Abbildung 2 ersichtlich. Wird die Entwicklungszeit bis unter das Minimum der Funktion verkürzt (eine Bewegung entlang der Kurve nach links), steigen die Kosten aufgrund von zusätzlichen Koordinationskosten. Ähnlich wirkt sich die Verlängerung der Entwicklungszeit über das Minimum der Funktion hinaus aus (eine Bewegung entlang der Kurve nach rechts). Zusätzliche Kosten entstehen hier insb. aufgrund von vergeudeten Lerneffekten, sinkender Motivation und höheren variablen Kosten (z.B. zusätzliche Arbeitszeit).[12]
Abb. 2: Zeit/Kosten-Zusammenhänge bei der Produktentwicklung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Rothwell, Roy (1994), S. 15 in Anlehnung an: Gupta, Ashok/ Brockhoff, Klaus/ Weisenfeld, Ursula (1992), S. 12.
Durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Innovationsprozesses ist es möglich von einer höheren auf eine niedrigere Zeit/Kosten-Kurve zu gelangen. Eine derartige Parallelverschiebung der Kurve bedeutet, im Vergleich zur vorhergehenden Generation, eine Verringerung der Entwicklungskosten bei gleicher Entwicklungszeit bzw. eine Verringerung der Entwicklungszeit bei gleich bleibenden Entwicklungskosten. Das Minimum der neuen Funktion liegt im Vergleich zur vorigen Generation in einem Punkt mit verringerten Entwicklungskosten und gleichzeitig verringerter Entwicklungszeit. Abbildung 2 illustriert diesen Zusammenhang anhand der letzten drei von Rothwell beschriebenen Innovationsprozessmodellgenerationen, wobei jede Generation eine Effizienzsteigerung, insb. im Sinne einer Kostenreduktion, des Innovationsprozesses gegenüber der vorigen Generation darstellt. Im Falle der fünften Generation sind die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vor allem intra-[13] und interorganisationale[14] Systemintegration, extensives Networking, flexible und flache Organisationsstrukturen, ausgereifte interne Datenbanken, sowie elektronisch unterstützte Produktentwicklung.[15] Vor allem die zügige Weiterentwicklung der verschiedenen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) trägt zu großen Effizienzsteigerungen in den Bereichen des Networking und der Produktentwicklung bei.[16] Hierbei erweitert vor allem das Internet die Grenzen der unternehmerischen F&E-Aktivitäten und erleichtert es so, im Licht des wachsenden globalen Wettbewerbs, mit der Unternehmensumwelt (Wettbewerber, Händler, Kunden, Zulieferer, etc.) zu interagieren. Diese ständige technologische Weiterentwicklung stellt die wohl wichtigste Veränderung der fünften Generation im Vergleich zur vierten dar, da die Technologie des technologischen Wandels sich selbst verändert.[17] In der fünften Generation entwickelt sich der Innovationsprozess immer mehr hin zu einem Netzwerkprozess, bei dem es neben Effektivität vor allem auf Effizienz (lean innovation) ankommt. Diese Denkweise gilt vor allem für Unternehmen, die potentielle Partner auch über die Grenzen der eigenen Industrie/Branche hinweg suchen, um mit kombinierten Methoden Lösungen für bestehende Probleme und darüber hinaus radikale Neuerungen finden wollen.[18] Rothwell fasst den Innovationsprozess der fünften Generation mit den folgenden vier Merkmalen zusammen: Integration, Flexibilität, Networking und parallele Informationsverarbeitung in Echtzeit.[19]
Auch wenn die fünfte Generation von Innovationsprozessmodellen weiterhin als aktuell angesehen wird, spricht Nobelius bereits von einer nahenden sechsten Generation und entwickelt das von Rothwell beschriebene Modell fort.[20] Laut Nobelius wird diese Weiterentwicklung vor allem von drei Faktoren beeinflusst. Der erste Aspekt ist die wachsende Komplexität von Produkten und Technologien durch die steigende Anzahl zu integrierender Aspekte, insb. im Hinblick auf Kompatibilität, Umwelt, Herstellbarkeit, etc. Der Zweite ist die Notwendigkeit zur Kooperationen mit immer mehr externen Akteuren aus den verschiedensten Bereichen, um die Kosten technologischer Investitionen zu teilen und diese gemeinsam zu nutzen sowie Spezialisierungsvorteile realisieren zu können. Schließlich bedarf es einer effizienten Kommerzialisierung neuer Technologien, wie sie bereits im Zusammenhang mit Abbildung 2 erläutert wurde (dritter Aspekt). Letzteres ergibt sich aus der Nachfrage nach einer möglichst hohen Rate-of-Return und den Kosten eines zu späten Markteintritts.[21]
Die eigentliche Weiterentwicklung von der fünften zur sechsten Generation ist laut Nobelius eine Rückbesinnung hin zu vermehrter radikaler Innovation, wie es bereits in der ersten Generation der Fall war. Jedoch bedeutet dies nicht gleichzeitig auch eine Rückbesinnung auf zentralisierte F&E. Neue Technologien werden über neue Wege beschafft oder entwickelt. Darunter fallen u.a. interne Forschungslaboratorien und interne Wagniskapitalprogramme, aber auch Übernahme von Unternehmen, Erwerb von Patenten, Wagniskapitalbeteiligungen im Konzerninteresse, Joint Ventures sowie unabhängige Forschungsgruppen oder ‑netzwerke.[22]
Während sich in der fünften Generation der Innovationsprozess erst zu einem Netzwerkprozess entwickelt, dominiert diese Sicht die sechste Generation. Allianzen und Kooperationen beschränken sich immer weniger auf die eigene Industrie/Branche und gehen vermehrt über deren Grenzen hinweg. Die Innovationskraft einzelner Laboratorien verliert an Bedeutung, da Durchbrüche vermehrt aus lose miteinander verbundenen (loosely tied) Netzwerken vieler kleinerer Unternehmen/Laboratorien kommen. Darüber hinaus steigt die Notwendigkeit, auf dem aktuellsten Stand der weltweiten wissenschaftlichen Entwicklungen zu sein und dieses Wissen verwerten zu können. Als logische Folge führt dies zu einem Bedeutungsgewinn von Akteuren wie Universitäten, unabhängigen Freelancern und temporären Interessengruppen als Partner für Allianzen oder Kooperationen.[23]
Mit der steigenden Zahl an Akteuren im Innovationsprozess der sechsten Generation steigen auch die Koordinationskosten eines Unternehmens, wie bereits erläutert. Hieraus eröffnen sich neue Möglichkeiten für Unternehmen, die als Intermediäre fungieren, um zwischen den Forschungsvorhaben eines Unternehmens und potentiellen Nutzern und/oder Entwicklern zu vermitteln und so einen Teil der Koordination zu übernehmen. Nobelius fasst den Innovationsprozess der sechsten Generation zusammen als Rückbesinnung auf die Forschungstätigkeit der F&E, unter Einbezug der Verbesserungsmöglichkeiten durch die Teilnahme an lose miteinander verbundenen Multi-Technologie-Forschungsnetzwerken.[24] Die Entwicklung der verschiedenen Generationen ist exemplarisch in folgender Abbildung dargestellt.
Abb. 3: Innovationsprozessmodellgenerationen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung, in Anlehnung an: Nobelius, Dennis (2003), S. 370ff.
Über die Entwicklung hin zur vorausgesagten sechsten Generationen von Innovationsprozessmodellen lässt sich eine „Öffnung“ des Innovationsprozesses beobachten. Während die frühen Generationen noch eine starke Unternehmenszentriertheit aufweisen, sind spätestens ab der vierten Generation mit Bedeutungsgewinn der Lead User bereits Ansätze eines offeneren Innovationsprozesses erkennbar. Schließlich, seit Mitte der 1990er und mit dem Aufkommen des Internets in der fünften Generation vollzieht sich der Wandel des Innovationsprozesses von der Unternehmenszentriertheit hin zu einem Netzwerkprozess und somit größerer Offenheit. Ob es sich bei der von Nobelius beschriebenen sechsten Generation um eine Generation der „Open Innovation“ handelt, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit geklärt werden.
2.2 Der offene Innovationsprozess
„Open Innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. Open Innovation assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology. [...] The business model utilizes both external and internal ideas to create value, while defining internal mechanisms to claim some portion of that value. Open Innovation assumes that internal ideas can also be taken to market through external channels, outside the current businesses of the firm, to generate additional value.“[25]
Drei Aspekte machen das Konzept der Open Innovation nach Chesbrough aus. Zum einen ist die Nutzung von internen, wie auch externen Quellen für ihn ein Treiber der Innovationsprozessgeschwindigkeit, zum anderen legt er besonderen Wert darauf, dass Innovationen intern aber auch extern vermarktet werden können. Für die Verwertung bedeutet dies, dass Unternehmen die Open Innovation praktizieren, interne Forschung mit externen Ideen verbinden müssen, um dann diese Ideen in ihrem eigenen Geschäft und/oder durch die Geschäfte anderer Unternehmen auf den Markt zu bringen. Die externe Verwertung kann dabei zu jedem Zeitpunkt im Innovationsprozess geschehen, z.B. durch Lizenzierung oder Spin-Off. Wissen kann aber auch durch Abwanderung eines Mitarbeiters zu einem Wettbewerber nach außen gelangen. Wird Wissen von einer Partei externalisiert wird es von einer anderen Partei internalisiert, demzufolge gelten die verschiedenen Wege auf denen Wissen ein Unternehmen verlassen kann vice versa für die Internalisierung, also die Wege auf denen Wissen in ein Unternehmen gelangen kann. Bei der Internalisierung von Wissen muss jedoch besondere Rücksicht auf das Not-Invented-Here (NIH) Syndrom[26] genommen werden. Dieses spiegelt das Misstrauen der internen Mitarbeiter gegenüber externen, nicht von ihnen selbst entwickeltem Wissen wider. Ziel für eine Reibungslose Internalisierung und vor allem auch als Ansporn für die Suche nach externem Wissen, ist es dieses Misstrauen abzubauen. Internalisierung und Externalisierung tragen so zu einer Abundanz von Wissen bei. Aus der Annahme, dass nützliches Wissen von generell hoher Qualität weit verteilt ist, leitet Chesbrough die Open Innovation Wissenslandschaft ab, welche in Abbildung 4 dargestellt ist. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, kann Wissen in Form von Forschungsprojekten in den verschiedenen Phasen der F&E in ein Unternehmen gelangen bzw. dieses verlassen. Dabei kann dieses Wissen von jedweder externen Quelle kommen, in der Abbildung beispielhaft von einem anderen Unternehmen. Darüber hinaus wird auch angedeutet, dass das Wissen bzw. Forschungsprojekt nicht durch das ursprünglich entwickelnde Unternehmen auf den Markt gebracht werden muss. Es kann auch als Spin-Off oder durch ein anderes Unternehmen auf einen Markt gelangen. Beide oben genannten Aspekte können jedoch nur innerhalb eines passenden Geschäftsmodells, dem dritten Aspekt, realisiert werden. Das Geschäftsmodell hat allgemein zwei wichtige Funktionen – einen Wert schaffen (im Sinne der Wertkette nach Porter)[27] und einen Teil dieses Wertes für das Unternehmen realisieren. Offene Geschäftsmodelle (Open Business Models) schaffen Wert indem sie effektiv, durch den Einbezug einer Vielzahl externer Konzepte, interne wie externe Ideen nutzen. Laut Chesbrough können sie sogar mehr Wert realisieren, da sie wichtige Ressourcen oder Positionen im eigenen Geschäft (business), aber auch im Geschäft von anderen Unternehmen, nutzen können.[28] Der besondere Fokus von Chesbroughs Arbeit liegt auf den Aspekten der externen Verwertung internen Wissens, sowie der Entwicklung offener Geschäftsmodelle.[29]
Abb. 4: Die Open Innovation Wissenslandschaft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an: Chesbrough, Henry W. (2003), S. 44.
Die Prozesse der Internalisierung und Externalisierung, wie sie aus der obigen Abbildung ersichtlich sind, werden von Gassmann/Enkel in drei Typen von Prozesse aufgeteilt: Outside-In, Inside-Out und Coupled. Ein Unternehmen, welches hauptsächlich den Outside-In Prozess nutzt, hat sich zur Kooperation mit Zulieferern und Kunden entschieden um das aus der Kooperation gewonnene externe Wissen in die eigenen Prozesse zu integrieren. Dies kann bspw. durch die Integration von Kunden und/oder Zulieferern, Horchposten an Innovationsclustern, den Kauf von geistigem Eigentum (Patente) und Investitionen in die globale Wissensschaffung erreicht werden. Unternehmen, die hauptsächlich den Inside-Out Prozess praktizieren, sind vor allem an der Externalisierung ihres Wissens interessiert, um dieses schneller auf den Markt zu bringen als dies intern möglich wäre. Die Entscheidung den Ort der Vermarktung außerhalb der Unternehmensgrenzen zu verlagern, bedeutet Profitgenerierung durch Transfer von Ideen an andere Unternehmen via Lizenzierung geistigen Eigentums. Schließlich nutzen Unternehmen, die sich für den Coupled Prozess entscheiden eine Kombination aus Outside-In, um an externes Wissen zu gelangen, und Inside-Out, um internes Wissen extern zu vermarkten. Dies geschieht vor allem durch Kooperationen mit anderen Unternehmen in strategischen Netzwerken. Kooperation bedeutet hier die gemeinsame Entwicklung von Wissen durch Beziehungen zu bestimmten Partnern, wie z.B. Konsortien von Wettbewerbern, Zulieferer, Kunden, Joint-Ventures und Allianzen, oder Universitäten und Forschungslaboratorien.[30]
In einem offenen Innovationsprozess gibt es verschiedene Akteure, welche sowohl innerhalb der Wert- und Wertschöpfungskette, als auch außerhalb der Wertschöpfungskette gefunden werden können. Innerhalb der Wert- und Wertschöpfungskette sind dies Kunden bzw. Nutzer, Zulieferer, sowie die eigenen Mitarbeiter. Außerhalb der Wertschöpfungskette befinden sich alle anderen möglichen Akteure. Hier sind u.a. Universitäten zu finden, welche einem Unternehmen bspw. über Professoren und Studenten Zugang zu aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der Wissenschaft verschaffen. Aber auch die verschiedenen Geschäftsnetzwerke (business networks), in denen ein Unternehmen präsent ist, fallen in diese Kategorie.[31] Diese können im Sinne eines Unternehmensökosystems nach Moore verstanden werden. „In a business ecosystem, companies co-evolve capabilities around a new innovation: they work cooperatively and competitively to support new products, satisfy customer needs, and eventually incorporate the next round of innovations.“[32]
Neben dieser umfassenden Sichtweise eines offenen Innovationsprozesses (insb. mit Hinblick auf die Akteure) hat sich eine Gruppe um den Amerikaner von Hippel herausgebildet. Diese stimmen wohl mit der Grundannahme der Nutzung externer Akteure überein, ihr Fokus liegt dabei jedoch auf dem Nutzer, als ihrer Meinung nach, wichtigster Quelle externer Informationen.[33] Von Hippel ist der Hauptvertreter und Begründer dieser nutzerfokussierten Sichtweise. In seinen frühen Arbeiten nannte er neben dem Nutzer[34] zwar auch Zulieferer und informellen Know-how Austausch als mögliche Quellen externen Wissens für den Innovationsprozess,[35] hat seinen Fokus inzwischen aber auf dem Nutzer (insb. Lead User und User Communities) als wichtigste Quelle externen Wissens.[36] Dieser agiert bei von Hippel im Rahmen des von ihm aufgestellten Customer-Active Paradigm (for industrial product idea generation). Das Customer-Active Paradigm steht im Kontrast zum, von von Hippel als traditionell bezeichneten, Manufacturer-Active Paradigm. In letzterem hat der Nutzer lediglich die Rolle einer Auskunftsperson, „speaking only when spoken to.“[37] Seine Aufgabe ist es Bedürfnisse zu haben, welche durch das Unternehmen identifiziert und durch neue Produkte erfüllt werden. Im Customer-Active Paradigm hingegen ist es die Rolle des „would-be customer“[38], selbst eine Idee zu entwickeln, einen passenden Hersteller dafür zu suchen und die Initiative zu ergreifen, indem er eine Anfrage an diesen zur Herstellung der Idee stellt. Die Rolle des Herstellers ist hier lediglich passiv. Er soll darauf warten eine Herstellungsanfrage von einem potentiellen Kunden übermittelt zu bekommen, nach Ideen und nicht nach Bedürfnissen suchen und jene Ideen für eine Weiterentwicklung auswählen, die am besten zu seinen Zielen passen.[39] Eine Gegenüberstellung der Veränderung von Manufacturer-Active hin zum Customer-Active Paradigm ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.
Abb. 5: Manufacturer-Active vs. Customer-Active
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: von Hippel, Eric (1978b), S. 242.
Dennoch ist in von Hippels Verständnis, bzgl. des Customer Active Paradigm, ein Trend hin zu mehr Interaktion zwischen Herstellerunternehmen und Nutzer zu erkennen, was insb. durch seine Arbeiten im Bereich der Toolkits for User Innovation[40] deutlich wird.[41]
Zwei weitere Vertreter dieser Sichtweise aus der Forschungsgruppe um von Hippel, aber mit einem leicht abweichenden Verständnis, sind Reichwald/Piller. Sie verstehen in ihrem Konzept der interaktiven Wertschöpfung, ähnlich wie von Hippel, den „Nutzer und Kunden als Quelle und Co-Produzent von Innovationen“.[42] Im Gegensatz zu von Hippels Customer Active Paradigm treffen Reichwald/Piller jedoch die Annahme einer Aktivierbarkeit und (partiellen) Steuerbarkeit von Kundeninnovation durch Herstellerunternehmen.[43] Darüber hinaus sehen sie hierin auch eine Erweiterung des von Chesbrough propagierten offenen Innovationsprozesses (siehe oben). Nach Meinung von Reichwald/Piller kommt dabei der Einbezug von Kunden/Nutzern als Quelle für innovative Lösungen zu kurz. „[E]rst wenn Herstellerunternehmen gerade auch aktiv ihre Kunden und Nutzer in die Produktentwicklung mit einbeziehen (und nicht nur externe “Experten”), kann [nach Meinung von Reichwald/Piller] das wahre Potenzial eines verteilten, offenen Innovationsprozess genutzt werden.“[44] Kern der interaktiven Wertschöpfung ist daher, die aktive, gezielte Integration von Kundenaktivitäten und Kundenwissen innerhalb des gesamten Innovationsprozesses, von der ersten Idee, über die Entwicklung von Prototypen, bis hin zur Vermarktung.[45]
2.2.1 Organisation
Die Organisation offener Innovationsprozesse wird über eine modulare Herangehensweise bzw. Aufgabenteilung gehandhabt. Zu Beginn der Entwicklung einer Technologie herrschen noch große technologische Ungewissheiten. Das Zusammenwirken der verschiedenen Elemente ist noch nicht verstanden. Es herrscht insofern eine technologische Interdependenz, dass die Veränderung eines Teils eine weitere, notwendige Veränderung eines anderen Teils nach sich ziehen kann. Erst mit der Weiterentwicklung ergibt sich ein Verständnis von möglichen anderen in Betracht kommenden Anwendungen der Technologie. Da es für die Ingenieure eines Unternehmens nicht möglich ist alle denkbaren Kombinationen auszuprobieren, wird die Entwicklung einer Technologie der Einfachheit halber in Teilaufgaben aufgegliedert.[46] Diese Teilaufgaben bzw. Module können daraufhin von verschiedenen Teilnehmern (interne wie externe) bearbeitet werden und über eine Architektur[47] bzw. Partizipationsarchitektur (architecture of participation)[48] wieder zu Systemen zusammengefügt werden. Die Partizipationsarchitektur bietet hierbei Mechanismen und Methoden um die Beiträge der Teilnehmer zu koordinieren, integrieren und synchronisieren.[49] Dabei sind vor allem Modularität und Granularität der Innovationstätigkeit von besonderer Bedeutung, da hierdurch einer heterogenen Gruppe[50] ermöglicht wird je nach Neigung und Fähigkeiten selbst eine geeignete Teilaufgabe zu wählen. Die Modularität ist hierbei Voraussetzung der generellen Aufteilung und Koordination des Innovationsprozesses unter den Teilnehmern. Die Granularität bezieht sich auf die Größe, das Ausmaß, eines Moduls und gibt somit den kleinsten, nötigen Beitrag zur Teilnahme vor. Sie stellt so sicher, dass verschiedene Teilnehmer, unterschiedliche Typen von Ressourcen, Kompetenzen und Zeiteinsatz, zur Innovation beitragen können.[51]
Chesbrough beobachtet einen zyklischen Zusammenhang von Modularisierung und vertikal integrierter Technologie. Dies hängt damit zusammen, dass jede Architektur irgendwann an ihre Leistungsgrenze stößt und einen Flaschenhals für die Weiterentwicklung eines Systems darstellt. Um diese Grenzen einer gegebenen Architektur zu überwinden, muss jedoch eine neue Architektur etabliert werden. Die früheren Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems brechen zusammen und es muss eine neue Aufteilung eines neuen Systems entwickelt werden. Nach Chesbrough muss sich für die Entwicklung einer neuen Architektur bzw. Nachfolgearchitektur das Muster der Weiterentwicklung einer Industrie von dem erreichten, elaborierten und modularen Zustand zurück zu einem interdependenten Zustand, wie er zu Beginn der Entwicklung einer Technologie vorherrscht, entwickeln. Der Kreislauf zwischen für den Fortschritt eines Systems notwendiger „Rückbesinnung“ auf den interdependenten Anfangszustand und einem neuen, vorläufigen, modularen Endzustand, ist exemplarisch in Abbildung 6 dargestellt.[52]
Abb. 6: Modularitätszyklus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung.
Nach Brown/Durchslag/Hagel ist darauf zu achten, dass die Module lose miteinander gekoppelt (loosely coupled) sind. Lose Kopplung ist hierbei ein Merkmal des Systems, „referring to an approach to designing interfaces across modules to reduce the interdependencies across modules or components – in particular, reducing the risk that changes within one module will create unanticipated changes within other modules. This approach specifically seeks to increase flexibility in adding modules, replacing modules and changing operations within individual modules.“[53] Ein Vorteil der losen Kopplung bei der modularen Herangehensweise ist die Möglichkeit der Koordination einer großen Zahl an Teilnehmern in einem Netzwerk. Darüber hinaus kann durch festgelegte Standards für das Verhalten an den Schnittstellen zwischen den Modulen, die Freiheit für die Teilnehmer in dem von ihnen ausgewählten Modul mit ihren Fertigkeiten innovieren zu können, sichergestellt werden. Die Definition von Standards an den Schnittstellen ermöglicht somit mehr Experimente durch die Teilnehmer innerhalb der Module, da aufgrund der losen Kopplung nicht zu befürchten ist mit Änderungen in einem Modul auch andere Module zu betreffen. Die Möglichkeit mehr zu experimentieren erhöht wiederum die Möglichkeit zu lernen. Neue Herangehensweisen zur Steigerung der Effizienz eines Moduls können ausprobiert werden und führen dazu, dass die Leistung innerhalb eines Moduls schneller zunimmt. Die kumulierten Ergebnisse aller Module haben wiederum einen signifikanten Effekt auf die Effizienz des gesamten Systems. Darüber hinaus ist einer der wohl größten Vorteile von Modulen die Möglichkeit parallel an einer Innovation arbeiten und simultan eine Auswahl verschiedener Herangehensweisen verfolgen zu können.[54]
Nach von Hippel hat Modularität neben den bereits erwähnten Vorteilen noch einen weiteren im Hinblick auf sticky information. Sticky Information ist definiert als „the incremental expenditure required to transfer [a] unit of information to a specified locus in a form usable by a given information seeker. When this cost is low, information stickiness is low; when it is high, stickiness is high.“[55] Dieses Prinzip basiert auf der Annahme, dass manches Wissen nur implizit bei einem Träger vorhanden ist, also in nicht kodifizierter Form vorliegt und meist auch nicht kodifiziert werden kann. Aus diesem Grund ist das unsticking dieser Information zumeist mit erheblichem Aufwand verbunden.[56] Die Transferkosten der sticky information werden durch eine Aufteilung der Innovationsaufgabe in Teile, die auf die sticky information angewiesen sind und jene, die es nicht sind, reduziert. Durch diese Aufteilung können die sticky information- Module direkt vom Träger dieser Information bearbeitet werden, ohne das ihr direkter Transfer erforderlich ist.[57]
2.2.2 Koordination
Aus der modularen Organisation des offenen Innovationsprozesses heraus ergibt sich die Notwendigkeit eine passende Koordination zur gegenseitigen Abstimmung der Aktivitäten unter den verschiedenen Teilnehmern zu finden. Der Grad der notwendigen Koordination kann mit Hilfe der Transaktionskostentheorie bestimmt und erklärt werden. Die Transaktionskostentheorie bezieht sich zwar ursprünglich auf die Produktion von Gütern, kann hier aber angewendet werden, da, wie Nambisan/Sawhney anmerken, es sich bei offenen Innovationsprozessen um die Produktion von neuen Ideen bzw. neuem Wissen handelt.[58] Als Untersuchungseinheit der Transaktionskostentheorie dient die einzelne Transaktion, welche die Übertragung von Verfügungsrechten an Gütern und Dienstleistungen über Verträge zwischen mindestens zwei Akteuren ist.[59] Die während einer Transaktion anfallenden Kosten sind die Transaktionskosten. Sie können vor (ex ante) und/oder nach (ex post) Vertragsabschluss auftreten und sind auf Informationsasymmetrien und mögliches, daraus resultierendes, opportunistisches Verhalten zurückzuführen. Ex ante Kosten sind Informations-, Verhandlungs- und Vertragskosten (Anbahnung und Vereinbarung). Ex post Kosten sind vor allem Kosten der Überwachung, Durchsetzung und nachträglichen Anpassung der Vertragskonditionen.[60] Ziel ist es, Transaktionen so effizient wie möglich zu gestalten. Dies wird versucht über diejenige Organisationsform zu erreichen, die bei gegebenen Produktionskosten minimale Transaktionskosten verursacht.[61] Dabei hängt die Höhe der Transaktionskosten vor allem von „asset specificity, uncertainty and frequency“[62] ab. Wichtigstes Kriterium und die Organisationsform hauptsächlich bestimmende Variable ist die Faktorspezifität der ausgetauschten Güter. Eine hohe Faktorspezifität führt zu hohen Transaktionskosten und steigert die Attraktivität der internen Produktion für ein Unternehmen (organisationsinterne Hierarchie). Bei geringer Faktorspezifität wird es für das Unternehmen jedoch günstiger diese Leistungen über den Markt zu beziehen. In der klassischen Transaktionskostentheorie mit den beiden extremen Ausprägungen Markt und Hierarchie ist die Grenze der Organisation an dem Punkt anzusetzen, in dem die Kosten für interne oder externe Herstellung identisch sind.[63] Diese theoretische Grenze zwischen Markt und Hierarchie lässt sich jedoch nicht immer eindeutig ziehen, da bspw. Kooperationen und Netzwerke weder als Markt noch als Hierarchie einzuordnen sind. Sie stellen sog. hybride Organisationsformen dar, die zwischen den beiden Extremen liegt. Diese Formen der Organisation versuchen durch die gemeinsame Wertschöpfung mehrerer Unternehmen die Vorteile von Markt und Hierarchie zu kombinieren. Ziel ist es dabei, die Effizienz einer hierarchischen Organisation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Flexibilität und Autonomie der einzelnen Unternehmen zu erlangen. Dies soll anhand einer losen Verbindung unter den Unternehmen durch marktliche Arrangements.[64]
Mit Aufkommen der Open Source Software Community hat sich nach Benkler noch eine weitere Organisationsform, welche weder Markt noch Hierarchie ist, etabliert – die Commons-based Peer Production.[65] „Commons-based peer production, [...] relies on decentralized information gathering and exchange to reduce the uncertainty of participants. [...] It depends on very large aggregations of individuals independently scouring their information environment in search of opportunities to be creative in small or large increments. These individuals then self-identify for tasks and perform them for a variety of motivational reasons.”[66] Hybride Organisationsform und Commons-based Peer Production scheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch maßgeblich in einem für die Höhe der Transaktionskosten ausschlaggebenden Punkt, dem des Eigentums. Im Gegensatz zur hybriden Organisationsform, gibt es in der Modellwelt der Commons-based Peer Production kein Eigentum. Dass es
[...]
[1] Diese Gesetzmäßigkeit geht auf Bill Joy zurück, einen der Gründer von Sun Microsystems.
[2] Vgl. o.V. (2005).
[3] Brown, John S./ Hagel, John (2006a), S.4.
[4] Vgl. Nambisan, Satish/ Sawhney, Mohanbir (2007c), S.14.
[5] Siehe hierzu Rothwell, Roy (1992); Derselbe (1994).
[6] Vgl. Rothwell, Roy (1992), S.221f.; Derselbe (1994), S.8f.; Nobelius, Dennis (2004), S.370.
[7] Vgl. Rothwell, Roy (1992), S.222; Derselbe (1994), S.9; Nobelius, Dennis (2004), S.370.
[8] Rothwell, Roy/ Zegveld, Walter (1985), S.50.
[9] Siehe hierzu bspw. von Hippel, Eric (1986) zur Einführung des Lead User Konzeptes.
[10] Vgl. Rothwell, Roy (1992), S.233ff.; Derselbe (1994), S.11f.; Nobelius, Dennis (2004), S.370.
[11] Vgl. Rothwell, Roy (1994), S.12f.
[12] Vgl. Gupta, Ashok K./ Brockhoff, Klaus/ Weisenfeld, Ursula (1992), S.12.
[13] Integrierte, parallele Entwicklung durch interne Abteilungen.
[14] Kooperationen mit Lead Usern, strategische Integration von Zulieferern inkl. co-development.
[15] Vgl. Rothwell, Roy (1994), S.24f.
[16] CAD/CAM, Virtual und Rapid Prototyping, Produktdatenmanagement, Internet- und Intranetanwendungen, etc.
[17] Vgl. Rothwell, Roy (1994), S.15ff.; Arora, Ashish/ Gambardella, Alfonso (1994), S.525f.; Nobelius, Dennis (2004), S.371f.
[18] Eine Gruppe japanischer Unternehmen, darunter Nippon Telephone and Telegraph, NEC, Nippon Sheet Glass und Sumitomo Electric Industries, entwickelten bspw. in den späten 1960er Jahren aus der Fusion von Glas-, Kabel- und Elektrotechnologien heraus Japans erste Glasfaserkabel (fibre optics) (Kodama, Fumio (1992), S.71).
[19] Vgl. Rothwell, Roy (1994), S.22ff.
[20] Vgl. Nobelius, Dennis (2004).
[21] Vgl. Nobelius, Dennis (2004), S.373f.
[22] Vgl. Ebenda, S.374.
[23] Vgl. Ebenda.
[24] Vgl. Nobelius, Dennis (2004), S.375.
[25] Chesbrough, Henry W. (2006a), S.1.
[26] Siehe hierzu Katz, Ralph/ Allen, Thomas J. (1982).
[27] Siehe hierzu Porter, Michael E. (2000), S.67ff.
[28] Vgl. Chesbrough, Henry W. (2006c), S.2f.
[29] Vgl. Derselbe (2003a), S.xxiv; Ebenda, S.43; Ebenda, S.63; Derselbe (2006a), S.1ff.; Ebenda, S.21ff.
[30] Vgl. Gassmann, Oliver/ Enkel, Ellen (2004), S.7ff.
[31] Vgl. Chesbrough, Henry W. (2006c), S.69ff.
[32] Moore, James F. (1993), S.76.
[33] Siehe hierzu bspw. die Definition von Open Innovation bei Piller, Frank T. (2005), der einer der Hauptvertreter dieser Sichtweise im deutschsprachigen Raum ist.
[34] „Users [...] are firms or individual consumers that expect to benefit from using a product or a service. In contrast, manufacturers expect to benefit from selling a product or a service. A firm or an individual can have different relationships to different products or innovations. [...] Thus, in order to profit, inventors must sell or license knowledge related to innovations, and manufacturers must sell products or services incorporating innovations. Similarly, suppliers of innovation related materials or services – unless they have direct use for the innovations – must sell the materials or services in order to profit from the innovations.“ (von Hippel, Eric (2005), S.3).
[35] Vgl. von Hippel, Eric (1978b), passim; Derselbe (1988), S.11ff.; Ebenda, S.35ff.; Ebenda, S.76ff.; Derselbe (1987), passim.
[36] Siehe hierzu bspw. von Hippel, Eric (2005).
[37] Von Hippel, Eric (1978a), S.40.
[38] Ebenda (Im Original teilweise kursiv).
[39] Vgl. von Hippel, Eric (1978a), S.40; Derselbe (1978b), passim; Derselbe (2005), S.2; Ebenda, S.19ff.; Zur passiven Unternehmensrolle siehe auch: von Hippel, Eric/ Thomke, Stefan/ Sonnack, Mary (1999).
[40] Zu Toolkits for User Innovation siehe auch Kapitel 3.1.1.
[41] Vgl. Thomke, Stefan/ von Hippel, Eric (2002), passim; von Hippel, Eric/ Katz, Ralph (2002), passim; von Hippel, Eric (2005), S.147ff.
[42] Reichwald, Ralf/ Piller, Frank T. (2006), S.95 (Hervorhebung im Original).
[43] Vgl. Ebenda, S.131.
[44] Ebenda, S.127.
[45] Vgl. Ebenda, S.132.
[46] Vgl. Chesbrough, Henry W. (2003a), S.58ff.; Derselbe (2003b), S.175ff.; Siehe zur Aufgliederung in Teilaufgaben u.a. von Hippel, Eric (1990); Derselbe (1994); Kogut, Bruce/ Zander, Udo (1992).
[47] „Die Architektur eines Systems beschreibt seinen grundlegenden inneren Aufbau: die einzelnen Komponenten und Unterfunktionen des Systems, die auf die Komponenten verteilt werden, und die Art, wie die Komponenten zusammenarbeiten, um die Funktionalität des Gesamtsystems zu erzeugen.“ (van Schewick, Barbara (2006), S.50).
[48] Vgl. O’Reilly, Tim (2004); Nambisan, Satish/ Sawhney, Mohanbir (2007c), S.38.
[49] Vgl. Chesbrough, Henry W. (2003a), S.58; Derselbe (2006a), S.1; O’Reilly, Tim (2004).
[50] Dies bezieht sich auf mögliche Unterschiede in Qualität, Quantität, Fokus, zeitlicher Koordination und geographischer Lage der Beiträge der verschiedenen Teilnehmer.
[51] Vgl. Benkler, Yochai (2006), S.100f.; Reichwald, Ralf/ Piller, Frank T. (2006), S.45f.; Nambisan, Satish/ Sawhney, Mohanbir (2007c), S.38.
[52] Vgl. Chesbrough, Henry W. (2003b), S.180ff.
[53] Hagel, John (2002).
[54] Vgl. Brown, John S./ Durchslag, Scott/ Hagel, John (2002), passim; Hagel, John (2002); Brown, John S./ Hagel, John (2006a), S.7.
[55] Von Hippel, Eric (1994), S.430.
[56] Vgl. Ebenda, S.430ff.; Derselbe (2005), S.67ff.
[57] Vgl. von Hippel, Eric/ Katz, Ralph (2002), S.822f.
[58] Vgl. Nambisan, Satish/ Sawhney, Mohanbir (2007c), S.30.
[59] Vgl. Picot, Arnold/ Dietl, Helmut (1990), S.178.
[60] Vgl. Williamson, Oliver E. (1985), S.20ff.; Picot, Arnold (1982), S.270.
[61] Vgl. Williamson, Oliver E. (1985), S.22.
[62] Ebenda, S.52.
[63] Vgl. Ebenda, S.54ff.; Ebenda, S.73ff.; Reichwald, Ralf (2004), Sp.1001.
[64] Vgl. Picot, Arnold/ Reichwald, Ralf/ Wigand, Rolf T. (2003), S.52f.
[65] Vgl. Benkler, Yochai (2002), S.381.
[66] Ebenda, S.375f.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Kfm. Joachim Jardin (Autor:in), 2008, Open Innovation. Innovationsprozess der nächsten Generation?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92533
Kostenlos Autor werden




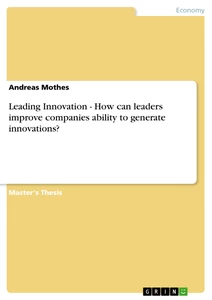

















Kommentare