Leseprobe
Einleitung
Teil I: Theoretische Grundlagen
1. Geborgenheit und Ungeborgenh
1.1 Der Begriff der Geborgenheit
1.2 Geborgenheit als universelles Bedürfnis
1.3 Geborgenheitsgewichtung in verschiedenen Lebensabschnitten
1.4 Ungeborgenheit
1.5 Überwindung von Ungeborgenheit
2. Grundbedingungenfür Geborgenh
2.1 Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth
2.2 Die„fördernde Umwelt" nach Donald Winnicott
2.2.1Von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit
2.2.2 Übergangsobjekte
2.2.3 Die Entwicklung eines Glaubens nach Winnicott
2.3 Modifikation frühkindlicher Erfahrung
3. Zwischenfa
4 Spirituali
4.1 Blick aus der Wissenschaft auf die Spiritualität
4.2 Relevante Definitionen von Spiritualität für diese Arbeit
4.3 Spiritualität und Religion in Deutschland
4.3.1Spiritualität und Religion im Wandel der Zeit
4.3.2 Spiritualität und Religiosität in Deutschland heute - Statistische Erhebungen
4.4 Spirituelle Wege aus der Ungeborgenheit
4.4.1Geborgenheit durch den Glauben
4.4.2 Christlicher Ansatz zum Umgang mit Leid als Form der Ungeborgenheit
4.4.3 Buddhistischer Ansatz zum Umgang mit Leid, als Form der Ungeborgenheit
4.4.4Spirituelle Praxis: Geborgenheitdurch Meditation
4.4.5 Spiritualität und Gesundheit/Resilienz als ein Weg aus der Ungeborgenheit
4.4.6 Spiritualität und der Einfluss der Psychologie
5. Zusammenfassung und Vorbereitungfür die qualitative Forsch
6 Untersuch
6.1 Ziel der Untersuchung
6.2 Methode: Qualitative Inhaltsanalyse
6.3. Das leitfadengestützte Interview
6.3.1 Erstellung des Leitfadens
6.3.2 Auswahl der lnterviewpartner*innen
6.3.3 Teilnehmendenbeschreibung
6.3.4 Durchführung und Setting
6.4 Vorbereitung derAuswertung: Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
6.5 Kategorienbasierte Auswertung
6.5.1 Selbstbeschreibung
6.5.2 Assoziationen Geborgenheit
6.5.3 Geborgenheit Kindheit
6.5.4 Innere Geborgenheit
6.5.5 Methoden Selbstwirksamkeit
6.5.6 Faktoren für das erfolgreiche Zurückgreifen auf Innere Geborgenheit
6.5.7 Herausforderungen für das erfolgreiche Zurückgreifen auf Innere Geborgenheit
6.5.8 Quelle: Spiritualität oder Psychologie?
6.5.9 Bezug zur Bindungstheorie?
7. Zusammenfassung und Ausblic
7.1. Zusammenfassung
7.2 Reflexion der Methodologie
7.3 Ausblick
8. Literaturverzeich
9. Anh
Anhang A: Fehlende fördernde Umwelt
Anhang B: Einverständniserklärungsbrieffürdie Interviewten
Anhang C: Interviewleitfaden
Anhang D: Auswertungsdefinitionen von Kategorien
Anhang E: Kategorien und Fallzusammenfassungen
Anhang F: Ausschnitt: ExcelTabelle „Auswertung"
Mein Dank gilt:
Den Menschen, durch die ich in meinem Leben Pole der Geborgenheit erfahren durfte und die mich auf meinem Weg begleitet haben:
Meinen Eltern: Martina Kreis und Reinhard Bogdan
Geschwistern: Simon Bogdan, Louisa Marleen Bogdan, Ansas Bogdan, Samuel Kreis, Luisa und Paul Schmidt
Meiner Nichte: Kassidy Paola Bogdan Jiménez
Sowie: Keilys Jiménez, Jenny Dorfelder, Anne Thielecke, Florian, Noa Goren, Benjamin Greifenberg, Isa Musiol, Tobias Klette, Kristina Röhl, Elli Pomm, Vera Hansen, Hanna Jo, Jule und Anne vom Hofe, Anne Löhr, Kai Büchner, Miriam Zeidtler, Michael Barsuhn, Leonie Friedrich Jan Peters, Lena Toepler, Assaf Nachum, Zafer Celikiz, Felix Hansen, Hamed Shalizi, Iman, Oved Serfaty, Patricio Molina Reed, Lenssa Mohammed, Gregor Theus, Yaniv Amir, Mehdi Choury, David BenShimol, Ido Nahmias, Benjamin Bank, Christian Eichfeld, Markus Kip, Caglar Ygitogullari, Micha Wischnewski, Clara Debour, Matina Bogdan und Gerhard Kreis, Ava Houshmand, Ketan Bhatti, Charlotta Sippel, Amer Kat- beh, Marc- André Allers, Sebastiao Pembele, Rena Greifenberg, Marcus Andreas und Lisa Lemke!
Und den Dozentinnen der SFU, die mir während meines Studiums freundlicherweise immer wieder beratend zur Seite standen:
Christina Ayazi, Prof. Dr. Becker, Kates Sheese, Lenssa Mohammed, Nimisha Patel und Meike Watzlawik, 'I have arrived, lam home' is the shortest Dharma Talk I ever have given. 'I have arrived, I am home' means 'I don’t want to run anymore'. You need that insight in order to be truly established in the here and now, and to embrace life 'with all its wonders.
Thich Nhat Hanh
Abstract Deutsch:
Während Geborgenheit mit dem Gefühl von Sicherheit, Wärme, Vertrauen, Liebe und Wertschätzung einhergeht, steht Ungeborgenheit für äußere sowie innere Beeinträchtigungen, die ein Gefühl von Unsicherheit, Angst und Schmerz auslösen können. Im Mutterleib haben wir-auch wenn die Mutter mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatte - die Wärme und Sicherheit von Geborgenheit schon einmal erfahren. Wenn im Kleinkindalter die Bezugsperson des Kindes den Raum verlässt, entsteht im Kind ein Gefühl der Ungeborgenheit. Der Mensch strebt in der Regel sein Leben lang nach Geborgenheit und findet unterschiedliche Wege dafür in denen ervon Nöten und Ängsten losgelöst ist und sich vertrauensvoll dem Moment hingeben kann. Dies kann im Zusammenhang mit anderen Menschen erfahren werden. Der Mensch kann diese Geborgenheit aber auch unabhängig von anderen Menschen in sich spüren, wenn er sich in sich geborgen fühlt. Damit geht in der Regel ein Vertrauen in sich und in das Leben einher. Bisherige Forschungen in der Entwicklungspsychologie (u.a. von Entwicklungspsychologien, wie Bowlby, Ainsworth, Winnicott, Erikson) haben lediglich die Grundvoraussetzungen zum (Ur-) Vertrauen genannt, die eng mit dem Geborgenheitsbegriffverknüpft sind. Weitere Studien zeigen u.a. was gläubigen Personen Geborgenheitgibt. Dabei wurden Religion, Freundschaft, Familie, Wärme, innere Ruhe und Arbeit genannt. Wie aber genau diese Geborgenheit unabhängig von anderen Menschen erfahren wird, wurde bisher nicht untersucht.
Diese Arbeit widmet sich der Forschungsfrage, wie spirituelle Menschen in Momenten der Ungeborgenheit auf ihre innere Geborgenheit zurückgreifen.
Der theoretische Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Herleitung von Geborgenheit und Ungeborgenheit, den Voraussetzungen von Geborgenheit sowie der Spiritualität. Um der Forschungsfrage nachzugehen, wurden leitfadengestütze Interviews mit vier spirituellen Menschen geführt, von denen zwei protestanisch-christlich und zwei buddhistisch geprägt sind. Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte mit Hilfe der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz. In derAnalyse wurden die unterschiedlichen Zugänge zur inneren
Geborgenheit herausgearbeitet. Es wurde deutlich, dass den Interviewten eine spirituelle Praxis, der christliche Glaube und damit einhergehend ein (Ur-) Vertrauen sowie begleitende Therapie und Erlebnisse in der Natur dabei helfen können, innere Geborgenheit zu erfahren, die mit Wärme und Liebe verbunden ist. Die beiden protestantisch-christlich geprägten Menschen erleben eine konstante Form von Vertrauen und Sicherheit, die sich durch den Glauben generiert. Die beiden buddhistisch geprägten Befragten greifen in erster Linie mittels ihrer spirituellen Praxis - der Meditation - aufdie innere Geborgenheit zurück. Es zeigte sich auch, dass es sich ferner um ein dynamisches Geschehen handelt, das sich bei emotionalen Herausforderungen durch Therapie und Meditation weiterentwickelt.
Abstract English:
In English there is no direct translation for the german word 'Geborgenheit'. There are some terms that describe the term of 'Geborgenheit', like 'safety'or 'comfort' and 'security'.
In the context ofthis abstract I will use the term „comfort." And ,,discomfort"forthe Opposite.
While comfort goes hand in hand with feelings of safety, warmth, trust, love and appreciation, discomfort stands for external as well as internal impairments that can trigger feelings of fear and pain. Already in the womb - even if the mother had to struggle with difficult conditions - we have experienced comfort, warmth and security. In infancy, when the child's parent leaves the room, a feeling of insecurity and discomfort arises in the child. As a rule, a person strives for comfort throughout his or her life and finds different ways to achieve it, in which he or she is free from needs and fears and can surrenderto the present moment with confidence. This can be clearly experienced in connection with other people, however, a person can also experience comfort and security independently of other people if he feels sheltered within himself. This is usually accompanied by a trust in oneselfand in life. Previous research in developmental psychology (including developmental psychologies such as Bowlby, Ainsworth, Winnicott, Erikson) has only mentioned the basic requirements for (primal) trust, which are closely linked to the concept of comfort and security. Further studies show that religion, friendship, family, warmth, inner peace and work are among the factors which donate to a feeling of security and comfort.
However, how exactly such comfort is experienced independently of other people has not yet been investigated. This work is dedicated to the research question of how spiritual people fall back on their inner comfort and security in moments of uncertainty and discomfort.
The theoretical part of this work deals with the derivation of comfort and discomfort, the preconditions ofcomfort and spirituality.
In order to pursue the research question, guideline-based interviews were conducted with four spiritual people, two of whom are Protestant-Christian and two whom are Buddhist. The evaluation of the transcribed interviews was carried out with the help of Kuckartz's qualitative content structuring analysis. In the analysis the different approaches to inner comfort were worked out. It became clearthat a spiritual practice, the Christian faith and the accompanying (primal) trust as well as accompanying therapy and experiences in nature can help the interviewees to experience inner security, which is connected with warmth and love. The two Protestant-Christian people experience a constant form of trust and safety which is generated by faith. The two Buddhist interviewees access inner comfort primarily through their spiritual practice - meditation. It became clearthat this is also a dynamic process that develops further when emotional challenges arise through therapy and meditation.
Einleitung
„In dir innen ist eine Stille und Zuflucht, in welche du zu jeder Stunde eingehen und bei dir daheim sein kannst...Wenige Menschen haben das, und doch könnten alle es haben."(Hermann Hesse 1969)
Wenn wir uns geborgen fühlen, fühlen wir uns sicher und erleben ein Wohlgefühl. Nach dem Psychologieprofessor Dr. Mogel (Universität Passau), der über zwei Jahrzehnte zur „Geborgenheit" forschte, streben Menschen ihr Leben lang nach dieser Geborgenheit und erfahren diese auf unterschiedlichen Wegen. In seinen Studien fand er heraus, dass Aspekte wie Sicherheit und Wärme, Vertrauen, Liebe, Verständnis und das Anerkanntsein von den Befragten am häufigsten mit Geborgenheit assoziiert werden (vgl. Mogel 1995).
Viele Menschen sehnen sich danach, das Gefühl der Geborgenheit immer wieder neu herzustellen. Einigen gibt der Glaube Sicherheit, welcher dabei unterstützen kann, Geborgenheit in sich selbst zu finden. Nach den bisherigen Forschungsergebnissen „stärkt die Geborgenheit im Glauben das Vertrauen in sich selbst und seine Umgebung genau und wachsam anzuschauen sowie wahr- und anzunehmen, was ist" (Utsch 2008, S. 87). „Geborgenheit im Glauben", das ist ein Aspekt von Geborgenheit, der für mich mit vielen Fragen verknüpft ist.
Auch wenn meine beiden Eltern Pfarrer*in sind, war der Glaube für mich immer sehr abstrakt. Als Kind erklärte ich meiner Mutter einmal, dass ich versucht hätte, mit Gott zu sprechen, ich dann aber bemerkte, dass ich mir selber die Antworten gegeben hätte. Für mich war nicht wirklich verständlich, wie der Mensch dazu kommt, diese sogenannten Gotteshäuser zu errichten, an deren hinteren Wänden ein Mann am Kreuz hängt, und wie es dazu kommt, dass sich Gläubige an den Geschichten über Jesus oder auch Buddha Über jahrtausende hinweg mit diesen verbunden fühlen. Was ist der Grund dafür, dass ausgerechnet dieses Buch, die Bibel, solch eine Kraft auf die Menschheit ausübt? Was oder wer ist dieser Gott, zu dem wir jeden Abend beteten und über dessen sogenannten Sohn Geschichten der Nächstenliebe erzählt werden? Und wo findet man ihn? „Have I got it in me to have the idea of god?" fragte sich Winnicott 1989 (S. 205). Während der allabendlichen Rituale erlebte ich dennoch eine Art von Geborgenheit. Und trotzdem: es erschien mir all das, was ich sah und hörte abstrakt, und ich verstand nie wirklich, was das mit mir zu tun haben sollte.
In meiner Jugend regte sich auch durch den Konfirmandenunterricht, in dem wir im Nachgang gefühlt mehr über Sekten und Drogenmissbrauch als über Gott sprachen, kein Interesse, mich mit dem Glauben weiter auseinander setzen zu wollen.
Nach dem Abitur kam eine Zeit der Unsicherheit und damit einhergehenden Ungeborgenheit, in der ich nicht wusste, wohin ich mit meinem Leben wollte. Ich fühlte mich ein wenig verloren in dieser Welt. Der Bezug zu einer Geborgenheit, die mir Sicherheit und Vertrauen unabhängig von äußeren Begebenheiten und anderen Menschen geben konnte, also eine Form von innerer Geborgenheit fehlte mir in dieser Zeit gänzlich. Und so begann ich, Bücher zu lesen, die sich mit den existentiellen Fragen und dem Buddhismus beschäftigten, wie u.a. das „Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben" (Rinpoche 2019), reiste in asiatische Länder und fühlte in den dortigen Tempelanlagen für einen kurzen Moment innere Geborgenheit. Florian, den ich neben drei anderen mir nahestehenden Personen für diese Arbeit befragte, riet mir damals aufgrund eigener Erfahrung zur Meditation. Sich von allem äußeren abzuwenden und in die innere Einkehr zu gehen, kam für mich nicht in Frage.
Ich erinnere mich an ein Gespräch aus dieser Zeit mit einer damaligen Freundin, die berichtete, ich müsse es mir nur in mir selbst häuslich einrichten. Aufdie Frage hin, wie genau das aussehen könne, antwortete sie: „Na ja, ich habe es mir in mir selbst gemütlich gemacht: es gibt ein Bett, eine Couch, einen Tisch und ich gehe dorthin, wo ich mich am liebsten aufhalte." Ich konnte es mir förmlich vorstellen, wie sie es sich mit einer Wolldecke auf ihrem Sofa innerlich bequem machte und dabei ein Gefühl von Wärme, Sicherheit und innerer Geborgenheit erspüren konnte. Aber auch diese Vorstellung war mir zu abstrakt. Es schien eine Bilder-und Vorstellungswelt zu sein, zu der ich keinen Zugang hatte.
In meiner Studienzeit fiel mir immer wieder auf, wie geradezu glückselig Menschen um mich herum auf mich wirkten, die an Gott glaubten. Sie strahlten eine innere Ruhe, Gewissheit und Freude aus.
Viele Jahre später entschied ich mich in einer Krisenzeit, Weihnachten alleine zu feiern. Ich besuchte einen unkonventionellen Gottesdienst in einer Markthalle. Das gemeinsame Singen und herzhafte Lachen, die miteinander vertraut wirkenden Menschen gaben mir überraschenderweise ein Gefühl der Geborgenheit.
Und langsam keimte ein Gefühl in mir auf, dass die Form, der sich mir vermittelnden warmherzigen tiefgehenden existentiellen Auseinandersetzung im Glauben vielleicht doch mehr mit mir zu tun hatte, als mir bis dahin bewusst war. In unterschiedlichen buddhistischen Zentren lernte ich die Meditation sowie die Mindfulness - Based Stress Reduction (MBSR) kennen, in Deutschland auch unter Achtsamkeitsprogramm bekannt, und schätzen.
Nach sechs Monaten langer Auseinandersetzung mit einem möglichen Thema für diese Arbeit, dem Formulieren und wieder Verwerfen von anderen Themen, dem Niederschreiben, Lesen und Diskutieren, drängten sich mir immer mehr die existentiellen Fragen auf: Wie kam es dazu, dass spirituelle Menschen aus meinem näheren Umfeld - ob protestantisch-christlich oder buddhistisch geprägt eine innere Sicherheit, einen Raum der Geborgenheit in sich tragen, der sie weniger zweifeln und gelassener werden lässt im Leben, der ihnen Sicherheit gibt, Vertrauen schenkt und ihnen die Angst vor vielem nimmt oder sie in eine Gelassenheit verwandelt.
Was mich aus meiner eigenen Biographie heraus interessiert und mich motiviert diese Arbeit zu verfassen, ist die Forschungsfrage nach der Herstellung dieser inneren Geborgenheit: Wie ist sie im spirituellen Menschen verankert und wie kann dieser in Momenten der Ungeborgenheit, in denen sie zunächst nicht spürbar ist, auf sie zurückgreifen? Ferner interessiert mich, ob es eine Grundvoraussetzung für diese Art des Vertrauens gibt.
Wenn ich von spirituellen Menschen spreche, klingt es so, als gäbe es spirituelle und nicht spirituelle Menschen. Innerhalb dieser Arbeit sind damit vier Menschen gemeint, die sich bewusst als spirituell bezeichnen was sowohl ihre spirituelle Praxis, als auch ihren Bezug zum Glauben mit einschließt (siehe mehr dazu in Kapitel 4.2): Nach Stangl ist mit Spiritualität „eine Form von Geistigkeit als Gegensatz zum rein rationalen Denken und einer materiellen Körperlichkeit" gemeint und „bezeichnet nicht zuletzt den subjektiv erlebten Sinnhorizont, der sowohl innerhalb als auch außerhalb traditioneller Religiosität verortet sein kann und damit allen Menschen zu eigen ist" (Stangl, 2020a).
Auf meinen Recherchen zu Geborgenheit stieß ich u.a. auf den Professorder Psychologie Dr. Hans Mogel, der in seinen Studien untersuchte, wie gläubige Personen Geborgenheit erfahren. Dabei werden Aspekte, wie Religion, Freundschaft, Familie, Wärme, innere Ruhe und Arbeit genannt. Wie aber spirituelle Menschen die Geborgenheit in sich selbst erleben und herstellen, wurde von ihm nicht untersucht. Vor dem Hintergrund dieser Forschungslücke legt diese Arbeit das Augenmerk auf die persönlichen Erfahrungen spiritueller Menschen in Bezug auf das Erleben und Zurückgreifen auf ihre innere Geborgenheit. Ich entschied mich exemplarisch vier Menschen aus meinem nahen Umfeld zu befragen, von denen sich zwei dem protestantischen Christentum und zwei dem Buddhismus nahe fühlen und von sich behaupten die innere Geborgenheit in sich zu tragen. Unter protestantisch-christlich sind Menschen zu verstehen die sich einer der aus der Reformation hervorgegangenen evangelischen Kirchen verbunden fühlen (Pfeifer et al. 1993f). Unter „buddhistisch geprägt", sind Menschen gemeint, die sich auf die Lehre von Siddharta Gautama beziehen (mehr dazu in Kapitel 4.4.3)1.
Das Ziel dieser Arbeit ist es mittels qualitativer Interviews herauszufinden, wie sie diesen Raum der inneren Geborgenheit konkret erfahren und wie sie auf diese - gerade auch in Momenten, in denen sie sich nicht sicher und somit ungeborgen fühlen, zurückgreifen, ob es Momente gibt, in denen es ihnen dies leichter bzw. schwerer fällt, und ob sie dabei auf ihren Glauben und/oder ihre Spiritualität zurückgreifen und/oder auf psychologische Herangehensweisen, wie z.B. therapeutische Ansätze.
Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Der erste Teil umfasst die theoretischen Ausführungen zur Geborgenheit und Spiritualität. Kapitel 1 Teil erläutert den Begriff der Geborgenheit und Ungeborgenheit, Kapitel 2 ihre Grundvoraussetzung anhand der Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth sowie der „fördernden Umwelt" nach Winnicott und im Kapitel 3 werden die Ausführungen aus den ersten beiden Kapiteln zusammengefasst. Das Kapitel 4 widmet sich dem Thema der Spiritualität und zeigt auf, wie sich die Spiritualität in Deutschland entwickelt hat (siehe 4.3.1 und 4.3.2), um den gesellschaftlichen Kontext dieser Dimension in Bezug auf die Befragten einordnen zu können. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel Ansätze zum Umgang mit der Ungeborgenheit, u.a. aus dem Christentum (siehe 4.4.2) und dem Buddhismus (siehe 4.4.3) aufgeführt, um den spirituellen Hintergrund der Befragten besser nachvollziehen zu können. Anschließend wird der Blick auf die Spiritualität und die Psychologie gerichtet (siehe 4.4.6). Das Kapitel 5 stellt eine Zusammenfassung des ersten Theorieteils dar. Der zweite Teil dieser Arbeit umfasst den empirischen Teil und zeigt die Ergebnisse der Interviews auf. Dafür wird in Kapitel 6 zunächst die wissenschaftliche Herangehensweise dargestellt: es umfasst eine kurze Einführung in die empirische Sozialforschung und die Methode (siehe 6.2), lnterviewpartner*innen werden vorgestellt (siehe 6.3.3) sowie die Schritte zur Vorbereitung der Analyse der Interviews erläutert (siehe 6.4). Anschließend erfolgt die kategorienbasierte Auswertung, welche die Hauptkategorien und Subkategorien genauer beschreibt (siehe 6.5). Für das Ergebnis werden in Kapitel 7 die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Fazit gezogen (siehe 7.1). In Kapitel 7.2 wird die Methodologie dieser Arbeit reflektiert und in Kapitel 7.3 der weitere Forschungsbedarf dargelegt.
Teil I: Theoretische Grundlagen
1. Geborgenheit und Ungeborgenheit
Um einordnen zu können, was mit der Geborgenheit gemeint ist, befasst sich das Kapitel
1.1 mit der Begriffserklärung von Geborgenheit und Kapitel 1.2 mit dem universellen Bedürfnis. Das Kapitel 1.3 eröffnet den Blick auf die Gewichtung von Bezügen zu Geborgenheit in verschiedenen Lebensabschnitten. Kapitel 1.4 stellt heraus, was unter „Ungeborgenheit" zu verstehen ist. Kapitel 1.5 zeigt einige Wege auf, wie Menschen aus der Ungeborgenheit in die Geborgenheit finden.
1.1 Der Begriff der Geborgenheit
Auf der Suche nach dem Ursprung des Begriffes Geborgenheit fällt auf, dass dieses Wort von Autorinnen (Mogel 1995/2016; Baer/Frick-Baer 2012; Reuter 2013; Wahrig 2017) in erster Linie umschrieben wird und kaum etwas zur Etymologie und zum Ursprungs dieses Wortes zu finden ist. Nach meinen Recherchen haben lediglich Ahlborn und in Ansätzen auch Mogel etwas zur Etymologie des Wortes geschrieben. Laut Ahlborn (1986, S. 11) lässt sich das Wort auf das vorgermanische „bherg" zurückführen, das bedeute „sich irgendwo in Sicherheit niederlegen". Zudem bezieht es sich auf das gotische „bairgan", was „bewahren" meint, sowie auf das althochdeutsche „bergan" und das mittelhochdeutsche „bergen", dessen germanische Wurzeln im „berg" und in der„burg" liegen. Mogel greift die Worte „borgen" und „bürgen" heraus und verweist auf den Sicherheitsbezug dieser Begriffe (vgl. Mogel 1995, S.28). Auch der Berg beinhaltet nach Mogel einerseits einen bergenden Moment. Zum anderen kann dieser allerdings auch Gefahren und somit ein Gefühl der Ungeborgenheit auslösen (vgl. Mogel 2016, S. 3; mehr dazu in Kapitel 1.4). Das Adjektiv 'geborgen' kann ebenso mit einem Gefühl der Sicherheit einhergehen, wird aber auch verwendet, wenn Menschen z.B. nach einem Unfall sicher „geborgen" werden.
Laut dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) beschreibt Geborgenheit „ein Gefühl, sicher und gut aufgehoben zu sein in einem Umfeld enger Verbundenheit." (Wahrig 2017), die Pyscholog*innen Baer/Frick-Baer erläutern die Schwierigkeit das Wort wissenschaftlich zu benennen, indem sie sagen: „Geborgenheit ist nicht messbar, aber wir erleben sie [...]. Wir würden sie am ehesten als eine emotionale Befindlichkeit beschreiben, an der maßgebliche Erfahrungen mit anderen Menschen beteiligt sind" (2012, S. 11). Nach Mogel handelt es sich bei dem Gefühl der Geborgenheit um ein „positives, förderliches Grundgefühl", das ganzheitlich, also psychisch und körperlich erlebt wird, existentiell das Überleben sichert und somit bereits in der Evolutionsgeschichte des Homo Sapiens verankert ist (vgl. Mogel 2016, S.3/S. 80ff.; Mogel 1996 S.6). Im angelsächsischen Sprachraum wird „Geborgenheit" mit „safety" und „security" übersetzt, was so viel wie Sicherheit bedeutet und mit „comfort", was auch mit Gemütlichkeit gleichgesetzt wird (Linguee 2020).
1.2 Geborgenheit als universelles Bedürfnis
Zur Geborgenheit gibt es kaum wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Bei meinen Recherchen bin ich in erster Linie auf den Psychologieprofessor Dr. Hans Mogel von der Universiät Passau gestoßen, der 20 Jahre lang über die Geborgenheit forschte, auf das Psychologenpaar Gabriele und Udo Baer-Frick, die Ratgeber zum Thema Geborgenheit herausgegeben haben (siehe u.a.: Baer- Frick 2012) und den Sozialpädagogen Professor Dr. Hans-Ulrich Ahlborn, der Geborgenheit in Bezug auf Erziehung beleuchtete. Die folgenden Ausführungen zur Geborgenheit stützen sich in erster Linie aufdie Studien und Ausführungen von Prof. Dr. Mogel und Dr. Ahlborn. Baer - Frick, werden nicht näher zu diesem Thema hinzugezogen, da sie lediglich populär wissenschaftliche Ratgeber zu dem Thema veröffentlicht haben.
Nach Mogel erfährt der Mensch das Gefühl der Geborgenheit zum ersten Mal im Mutterleib und strebt ein Leben lang nach dieser Geborgenheit und dem damit verbundenen Gefühl von Sicherheit, Aufgehoben sein, Wärme, Akzeptanz und Zuneigung (vgl. ebd. S. 2; Mogel 1995, S. 45). Auch die Evolutionsgeschichte des Homo Sapiens macht deutlich, dass uns ebendiese Aspekte wie Sicherheit, Wärme und Liebe unser Fortbestehen sichern und als Grundbedingungen für das Entstehen von Sicherheit und Vertrauen gelten (vgl. Mogel 2016, S. 87; Mogel 1996, S.116ff.).
Mogel fand in Studien heraus, dass das Gefühl von Geborgenheit individuell erfahren wird und jede*r Mensch seine/ihre eigene Vorstellung hat, was in ihm/ihr das Gefühl der Geborgenheit auslöst, da das Erleben eng mit der Person und ihren Lebensumständen verknüpft ist (vgl. Mogel 1995, S.85). Nach Mogel scheint Geborgenheit „ein höchst zentraler Lebensinhalt eines Individuums zu sein, auch wenn er nichtjederzeit bewusst ist und nicht von jedem Menschen in gleicher Weise, gleich intensiv und gleich häufig erlebt wird" (ebd. S. 6). Die Studien, die zwischen 1996 und 2016 durchgeführt wurden, ergaben, dass es neben dem individuellen Verständnis von Geborgenheit auch kulturübergreifende und universelle Gemeinsamkeiten gibt, die mit dem Begriff einhergehen und überlebenswichtig sind wie das soziale Beziehungsgefüge und die damit einhergehende (soziale) Sicherheit, Nähe, Liebe, Wärme, Akzeptanz und positive Wertschätzung (vgl. Mogel 2016 S. 86ff). Dazu gehört auch die körperliche Nähe zum/zur Partnerin, Freund*in und Familienmitgliedern, ebenso wie Treue, Verständnis und Zugehörigkeit (vgl. Mogel 2016 ebd. S. 69). Die damit verbundene Liebe kann sich durch die Herzlichkeit einer emotionalen Hinwendung und Offenheit zeigen und dem Gegenüber ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln (vgl. ebd. S. 72). Durch das dadurch entstehende Vertrauen entwickelt der Mensch ein Selbstvertrauen, was unterstützend dabei wirkt, den eigenen Wert zu erkennen und damit einhergehend sich anzunehmen und sich selbst wertzuschätzen. Laut Mogel ist diese „Selbstliebe" die verlässlichste Grundlage der Nächstenliebe, denn wer sich selbst vertraut und sich akzeptiert, kann dieses auch anderen Menschen entgegenbringen (ebd. S. 100). Die Wertschätzung ist also ein fundamentales Bedürfnis des Menschen. Carl Rogers brachte dies 1989 auf den Punkt, indem er sagte, dass „das Bedürfnis nach Wertschätzung [...] ein Wesenszug des Menschen" ist (Rogers 1989, S. 245ff). Ist die Beachtung eines Kindes durch die Bezugspersonen von Zuwendung, Mitgefühl und Zuneigung geprägt, entstehen gute Bedingungen für ein stabilisierendes Urvertrauen (vgl. Mogel 2016, S. 66; siehe mehr dazu in Kapitel 2). Da die Geborgenheit das Leben mit der individuellen „Erlebenswelt" und den Emotionen verbindet, spricht Mogel von einem „fundamentalen Lebenssystem" als ein lebensförderndes, existenzsicherndes System, dessen Bestandteile „förderliche Selbstaktivierung des Individuums und seines zielbezogenen Handelns" beinhaltet (vgl. ebd. S. 3f). Er versteht darunter fördernde Vorgänge, die zu einer Persönlichkeitsentwicklung führen können, wie z.B. das Selbstwertgefühl, das Spielen und das Erleben selbst, da sie eine wichtige Rolle für erfolgreiches Handeln und positives Erleben einnehmen (vgl. ebd.).
Ahlborn, der sich 1986 mit der Geborgenheit in der Pädagogik beschäftigte, spricht von drei Grundformen der Geborgenheit: der „räumlichen", „sozialen" und „selbstischen" Geborgenheit. Unter der „räumlichen Geborgenheit" versteht er das der Mensch sich an bestimmten Orten beheimatet fühlt. Diese örtliche Beheimatung kann sich auf eine Kultur ausdehnen. Mit der „sozialen Geborgenheit" verknüpft er die Beziehungen zu Bezugspersonen, bei denen sich das Individuum „fallen lassen" kann. Unter der „selbstischen Geborgenheit" versteht er zum einen das Selbstvertrauen, die Ich-Stärke, das Sich-Annehmen und zum anderen die „Fähigkeit des selbst Gestaltens" und der „emotionalen Reife" (vgl. Ahlborn 1986, S. 15f.).
Neben dem positiv konnotierten Begriffsteht dem Gefühl von Geborgenheit immer auch ein Gefühl der Ungeborgenheit gegenüber (vgl. Mogel 2016, S.2f.). Ahlborn (1986) spricht von den „Polen der Geborgenheit" und stellt heraus, dass zu dem Gefühl von Geborgenheit auch immer ein „Wissen von dem gegenteiligen Zustand" gehöre (Ahlborn 1986, S. 14). Das bedeutet, dass mit der Geborgenheit auch ein Bewusstsein von Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit mit einher geht. Erfährt sich der Mensch in einer unsicheren Situation als schutzlos und verletzlich, kann dies zu einem Gefühl von Ungeborgenheit führen. Das Gefühl der Geborgenheit geht also mit dem Wissen der Ungeborgenheit einher (mehr dazu in Kapitel 1.4).
1.3 Geborgenheitsgewichtungin verschiedenen Lebensabschnitten
Aus Mogels Studien geht ebenfalls hervor, dass sich die individuellen Akzentuierungen, die im Individuum Geborgenheit auslösen, im Laufe des Lebens je nach Lebensabschnitt und nach Wichtigkeit bestimmterThemen verändern. In einer nicht repräsentativen Studie Mogels aus den 90 er Jahren, wird deutlich, dass die Aspekte, die in einer bestimmten Lebensphase mit Geborgenheit in Verbindung gebracht werden, außerdem zwischen den Geschlechtern unterschiedlich gelagert sind (vgl. Mogel 1995, S. 48). Auch wenn diese Studie von Mogel nicht repräsentativ ist, ist dennoch ein Trend erkennbar. Im Folgenden werden zur Ergänzung der Ausführungen einige Ergebnisse herausgegriffen, um die Gewichtung der Geborgenheitsaspekte im Verlauf des Lebens greifbar zu machen.
In der Studie wurden 80 Menschen in Deutschland zwischen 10 und 90 Jahren an unterschiedlichen Orten befragt, was sie mit Geborgenheit verbinden. Während „Sicherheit" vor allem von weiblichen Jugendlichen in Verbindung mit Geborgenheit gebracht wird, wird dieser Aspekt von Männern im Alter zwischen 30 bis 40 und (80%) herausgestellt. Auch Die Geborgenheitsaspekte „Anlehnung" und „Bindung" werden vonjungen Frauen hervorgehoben. Von Männern wird dieser Faktor hingegen erst zwischen ihrem 40. und 50. Lebensjahr herausgestellt. Dies habe nach Mogels Interpretation damit zu tun, dass die Männer in diesem Lebensalter einem erhöhten gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind und sie in der Regel ihr Berufsziel erreicht haben2. Auch die „bedingungslose Akzeptanz" wird von jungen Frauen im Jugendalter mit der Geborgenheit in Verbindung gebracht, während die Männer diesen Aspekt zwischen ihrem 40. - 60. Lebensjahr benennen. Familie hingegen wird für beide Geschlechter ab dem 30. Lebensjahr wichtig und mit Geborgenheit in Verbindung gebracht. Bei den Frauen steigt diese Form der Assoziation bis ins Alter und bei den Männern nimmt es zur Pensionierung hin ab (vgl. ebd. S. 74-80).
Je nach Lebensabschnitt scheint sich das Geborgenheitsverständnis zu verändern. So gibt es keinen mit der Geborgenheit assoziierten Begriff, der von allen Altersgruppen und beiden Geschlechtern dauerhaft benannt wird.
Es ist zu vermuten, dass für einige Menschen bestimmte Aspekte ihr Leben lang mit Geborgenheit assoziiert werden und sich andere Aspekte im Laufe des Lebens verschieben. Ob sich diese Aspekte für die jeweiligen Interviewten im Laufe ihres Lebens verändert haben, bleibt unbeantwortet. Auch die persönlichen, gesamtgesellschaftlichen Bedingungen und Einflüsse, wie z.B. Faktoren, die die Existenz positiv wie negativ beeinflussen, können das Geborgenheitsempfinden im Laufe eines Lebens maßgeblich bestimmen. Somit ist das Geborgenheitserleben als dynamisch zu betrachten.
1.4 Ungeborgenheit
„Auch die glücklichsten Momente wandeln sich, nichts können wir wirklich festhalten. Bestenfalls können wir ähnlich glückliche Erfahrungen anstreben. Ob uns dies gelingt, ist ungewiss."(Reuter 2013, S. 19).
Da ich mit meiner Forschungsfrage u.a. auch untersuchen will, wie Menschen aus der Ungeborgenheit in die Geborgenheit finden, werden im Folgenden Faktoren aufgeführt, die zu einer Ungeborgenheit führen können.
Nach Ahlborn geht mit der positiven Erfahrung von Geborgenheit in der Regel auch ein Wissen von Ungeborgenheit mit einher (vgl. Ahlborn 1986, S. 14). So ist das Kind, welches durch die Mutter zum ersten Mal ein Gefühl der Geborgenheit erfährt, mit einem Gefühl von „Ungeborgenheit" konfrontiert, sobald die Mutter für eine kurze Zeit den Raum verlässt (ebd., siehe Kapitel 2.1). Dies hat mit der starken Bindung und dem WunÜberlebensdrang zu tun (siehe Kapitel 2). Laut Mogel ist Geborgenheit kein „ruhendes System", sondern ein „ständig aktives System der Lebenserhaltung und Lebensgestaltung", welches durch Unterbrechungen zu einer leidvollen „Ungeborgenheit" führen kann (vgl. Mogel 2016, S. 88). Unter Ungeborgenheit versteht Mogel im Kontrast zu den „Geborgenheitsassoziationen" wie Sicherheit, Aufgehoben sein, Wärme, Akzeptanz und Zuneigung, die Einsamkeit, das Misstrauen, den kritischen Blick durch Andere sowie „zwischenmenschliche Kälte" (Mogel 2016, S. 87). Ungeborgenheit beschreibt also auch ein Gefühl der Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit. Darüber hinaus unterscheidet Mogel Ungeborgenheitserfahrungen, die zum einen durch seelische zum anderen durch äußere Beeinträchtigungen erlebt werden (vgl. ebd. S.5).
Seelische Beeinträchtigungen können durch traumatische Erfahrungen sowie durch Nichterfüllung von Bedürfnissen in der Kindheit ausgelöst werden und sich u.a. in Form von Ängsten, Trauer, geringem Selbstwertgefühl, überhöhten Ansprüchen an das Leben, Stress, seelischen Schmerz und psychischen Krankheiten bemerkbar machen (vgl. Mogel 2016, S.5/87f.; Becker/Weyermann 2006). Darüber hinaus können weitere Auslöser für seelische Beeinträchtigungen Diskriminierungserfahrungen, wie: Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Mobbing usw. darstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Durch äußere Beeinträchtigungen und existentielle Bedrohungen wie Pandemien, Verluste (Tod, Trennungen), körperliche Bedrohungen, Krankheit, Hunger, Terror, Krieg, Unfälle, Naturkatastrophen, politische Konstellationen wie z.B. Diktaturen und Regime, diedie Freiheit einschränken, können Trauer, Schmerz und diverse andere Leiden ausgelöst werden (vgl. ebd.). Erfahrungen von körperlichen oder seelischen Belastungen können zu psychischen Leid führen. Unter „Leid" wird laut dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache „großer Kummer und seelischer Schmerz" beschrieben, der durch „Schädigung" hervorgerufen werden kann und als Ungeborgenheit erlebt wird (vgl. Pfeifer, 1993b). In der Regel strebt der Mensch danach, das Gefühl von Ungeborgenheit zu überwinden und wieder in die Geborgenheit zu finden.
1.5 Überwindungvon Ungeborgenheit
Die Ungeborgenheit ist ein ständiger Begleiter unseres Lebens. „Sie kennzeichnet unser Leiden an uns selbst und der Welt und da sie uns beeinträchtigt, wirkt sie zugleich als Motor unserer Geborgenheitssehnsucht", sofern dies die psychische und physische Verfassung zulässt (vgl. Mogel 2016, S. 12).
Um das Gefühl von Ungeborgenheit zu überwinden, kann nach Mogel je nach Betroffenheit das Aufsuchen von Sozialkontakten, der Ausübung eines Berufes und einer lieb gewonnenen Freizeitbeschäftigung, das Naturerlebnis, dem Ausleben der eigenen Spiritualität oder des eigenen Glaubens unterstützend wirken (vgl. Mogel 2016). Erfährt sich der Mensch in dem Moment dieser Beschäftigung erfüllt und ist losgelöst von Nöten und Änsgten, so kann er sich geborgen fühlen, (vg. Mogel 2016, S. 130).
Eine Form der selbstischen Geborgenheit nach Ahlborn meint auch die „Fähigkeit des selbst Gestaltens" (vgl. Ahlborn 1986, S. 15f.). Damit geht die Selbstwirksamkeit einher, was meint, aus eigener Kraft „schwierige Situationen und Herausforderungen [...] erfolgreich bewältigen zu können" und somit in eine Geborgenheit zu finden (vgl. Bandura 1977). Wenn es die psychische und physische Verfassung ermöglicht, gibt es nach Mogel unterschiedliche Wege der Selbstwirksamkeit, bei denen immer die eigene Aktivität eine wichtige Rolle spielt. Sie trägt dazu bei, aus eigener Motivation in die Geborgenheit zu finden (vgl. Kapitel 1.5). Die Relevanz von Selbstwirksamkeit stellen u.a. wissenschaftliche Studien von Schwarzer und Jerusalem mit Übersiedlern von Ostdeutschland nach Westdeutschland nach dem Mauerfall heraus (Schwarzer/Jerusalem 1994). Laut ihrer Studien stellen Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit „stärker ihre stabilen und guten Selbsteinschätzungen" heraus, anstatt negative Signale, wie z.B. ihren Misserfolg. Diese Menschen haben die Erfahrung gemacht, durch eigene Selbstanstrengung ein Ziel zu erreichen. Menschen mit geringer Kompetenzüberzeugung tun sich hingegen schwerer, ihre eigenen Ziele umzusetzen. Sie sehen „in erster Linie ihre schlechten Leistungen und negativen Selbstbewertungen, [...] was zu selbstwertschädigenden Inkompetenzurteilen und einem insgesamt negativen Motivationsprozess führt"(vgl. Schwarzer/Jerusalem 2002, S. 36-39). U.a. dies kann ein Gefühl von Ungeborgenheit auslösen. Werden selbstgesteckte Ziele so gelegt, dass sie auch erreicht werden oder alltägliche Situationen bewältigt, „die das Leben und die existentielle Sicherheit abverlangen", kann dies zu einem Selbstvertrauen führen. Die Humanwissenschaftler wie Maslow und Rogers (Allport 1955, Maslow 1954, 1973, 1977, Rogers 1989) erkennen darin eine Form der Selbstverwirklichung und stellen sie in den Mittelpunkt des Lebensweges (vgl. Mogel 2016, S. 132). Wenn selbstgesteckte Ziele mehrfach nicht erreicht werden, vermag dies zu einer wiederholten Enttäuschung und somit auch zu einer Ungeborgenheit führen (vgl. Mogel 2016, S.133, vgl. Kapitel 1.4).
Mogel macht deutlich, dass das Geborgenheitsempfinden, neben den sozialen Bindungen, der positiven Beachtung durch andere, und dem Selbstvertrauen auch von existentiellen Faktoren abhängt (vgl. Mogel 2016, S.86ff). Mittels seiner weltweiten Studien wird deutlich, dass für Menschen, die wirtschaftlich schlechter aufgestellt sind, die materiell- existentielle Sicherheit als ein zentraler Faktor von Geborgenheit angesehen wird (vgl. Mogel 2006, S. 3).
Neben materiell- existentieller Sicherheit können Schicksalsschläge und Krankheitsbilder dazu führen, dass der Mensch sich nicht auf eigene Kräfte stützen kann und Unterstützung durch Andere, wie z.B. die Familie, Therapeutinnen, Sozialpädagoginnen benötigt (vgl. Kapitel 4.4.6). In bestimmten Fällen kann es für den Menschen dann unterstützend wirken, auf den Einsatz von Medikamenten zurückzugreifen. Darüber hinaus kann das Gefühl von Ungeborgenheit fürdie Person so schwer auszuhalten sein, dass sie sich für den Suizid entscheidet (vgl. Grün 2005, S. 19). Wie der Mensch der Ungeborgenheit und damit einhergehend der Erfahrung von Leid begegnet ist somit individuell unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
2. Grundbedingungen für Geborgenheit
Aufgrund der bisherigen Ausführungen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass „Sicherheit, Wärme und Liebe" unserem Fortbestehen dienen und somit als Grundbedingungen für das Entstehen von Vertrauen, Selbstvertrauen und Geborgenheit gelten können (Mogel 2016, S. 87; Mogel 1996, S 116ff.).
Mit den Voraussetzungen für das Entstehen von Vertrauen, als ein wesentlicher Aspekt von Geborgenheit, befasste sich die Bindungstheorie durch die Forscherinnen John Mostyn Bowlby und Mary Ainsworth (Grossmann 2012, S. 34f.), die in Kapitel 2.1 dargelegt wird. Das Kapitel 2.2 führt den Ansatz der „fördernden Umwelt" nach Donald Winnicott auf.
2.1 Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth
Dieses Kapitel stellt eine kurze Übersicht über die historischen Entwicklungen der Bindungstheorie vor und umreißt die Theorien der beiden Pioniere aus der Bindungsforschung nach Bowlby und Ainsworth, um den Ursprung des Gefühls von Geborgenheit genauerzu untersuchen.
Auf der Grundlage von Sigmund FreudsTriebtheorie gingen Psychoanalytikerinnen bis zur Mitte der 1950er Jahre, davon aus, dass sich Bindungen zwischen Menschen deshalb entwickeln, weil der Mensch spürt, dass er andere braucht, um seine Triebe zu befriedigen. Dabei wird zwischen zwei Triebarten unterschieden: der primären wie z.B. der Nahrungsaufnahme im Kleinkindalter und den geschlechtlichen Bedürfnisse im Erwachsenenalter einerseits (vgl. Freud, 1915) und der sekundären wie z.B. Beziehungen zu anderen Menschen andererseits (vgl. Grossmann 2009, S.22 und 41). In den 1950er Jahren ermöglichten die Arbeiten des Verhaltensforschers Konrad Lorenz (1903 - 1989) eine Alternative zur Theorie der Psychoanalytikerinnen. Mittels seiner ethologischen Verhaltensforschung fand Lorenz heraus, dass bestimmte Vogelarten eine intensive Bindung zum Muttertier aufbauen, ohne dass dabei die Nahrung eine Rolle spielen musste. Es genügte die Anwesenheit des Muttertiers, auf dass das Küken geprägt ist (ebd.). Entgegen der Annahme Freuds, dass der Mensch andere brauche, um seine „Triebe zu befriedigen" zeigen die Erkenntnisse von Lorenz, dass es also in erster Linie auf die erste Verbindung ankommt. Der britische Psychoanalytiker und Kinderpsychiater John Mostyn Bowlby (1907-1990), der in seiner Kindheit selbst auf seine Mutter verzichten musste und in einem Internat aufwuchs (vgl. Keller 2019, S.23; Grossmann 2009, S. 35; Renn 2012, S. 57), beobachtete in seiner klinischen Praxis die Folgen von Trennungen und Traumata bei Kindern. Analog zu Lorenz betont Bowlby den Aspekt der Prägung, bzw. des Instinktes. Er macht deutlich, dass Bindung genetisch bereits angelegt sind (vgl. Keller2019, S. 21f.).
Für die Entwicklung der Bindungstheorie war ebenso der Psychologe und Verhaltensforscher Harry Harlow entscheidend, der das Sozialverhalten von jungen Rhesusaffen untersuchte. Er beobachtete, dass junge Rhesusaffen, die von Mutterattrappen aufgezogen wurden, nur kurz zu der nahrungsgebenden Attrappe gingen, um dann Nähe bei der wärmegebenden Mutterattrappe zu suchen. Zeitgleich veröffentlichte Bowlby 1958 seine Theorie über Bindung. Nicht der Sexualtrieb, sondern die Sicherheit sei entscheidend für die Bindung (Grossmann 2009, S.22; Gloger-Tippelt, König 2009, S. 5; Godde- meier 2015, S. 459). Nach Bowlby gehen Verhaltenswissenschaftler davon aus, dass affektive Bindungen - wie bei den Rhesusaffen beobachtet - durch die Bindungtheorien besser verstanden werden können. Ein „affektives Band"wird „als Folge von vorprogrammierten Verhaltensmustern verstanden, die auf eine andere Person konzentriert werden" (Grossmann 2009, S.23). Dies umschreibt nach Bowlby das Bindungsverhalten (vgl. Grossmann 2009, S. 23).
In seiner Bindungstheorie erläutert Bowlby die Beziehung zwischen Mutter und Kind, da diese Bindung seiner Meinung nach entscheidend ist für eine „spätere seelische Gesundheit" (Bowlby 2016, S. 11), da die Mutter nach Bowlby diejenige ist, die das Kind „füttert und pflegt, die es wärmt und tröstet." (Bowlby 2010 b, S. 13). Bowlby, der später für diese einseitige Mutter-Kind Beschreibung häufig kritisiert wurde (Keller 2019, S.55), machte in einer Fußnote deutlich, dass er in seiner Theorie zwar von der „Mutter" als Bindungsperson ausgeht, dass aber auch andere Bezugspersonen gemeint sein können, zu denen sich das Kind hingezogen fühlt (vgl. Bowlby 1982, S. 177 f). Gloger-Tippelt und König erweitern das Verständnis der Mutter-Kind - Beziehung und beschreiben die Bindung als ein emotionales Band, „zwischen Kleinkindern und ihren Fürsorgepersonen". Sie machen außerdem deutlich, dass Kinder sich an mehrere Bezugspersonen binden können (vgl. Gloger-Tippelt, König 2009, S. 4).
Der Ursprung einer Bindung zwischen einem Kind und seiner Bezugsperson hängt evolutionsbedingt mit dem Überlebensdrang zusammen, betont die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy: „Die Aufrechterhaltung mütterlicher Zuwendung war einst für das Überleben eines Säuglings genauso wichtig wie die Luft zum Atmen und daran hat sich bis heute wenig geändert" (Hrdy, 2000, S. 436).
Auch der deutsche Bindungsforscher Brisch beschreibt das Bindungssystem nach Bowlby zusammenfassend als „(...) ein primäres, genetisch verankertes motivationales System (...), das in gewisser biologischer Präformiertheit nach der Geburt aktiviert wird und überlebenssichernde Funktionen hat." (Brisch 2011, S. 36). Auf der Grundlage dieses angelegten Verhaltens baut der Säugling „eine starke emotionale Bindung zu einer Hauptbezugsperson" auf, die „durch Trennung von der Bindungsperson sowie durch das Erleben von Angst aktiviert wird, etwa durch Äußere oder innere Bedrohung und Gefahr" (Brisch 2008, S. 90).
Das Bindungsverhalten des Säuglings bzw. des Kleinkindes umfasst Weinen und Rufen, um Zuwendung zu bekommen sowie Folgen, Festhalten und Protest, wenn ein Kind allein gelassen wird (vgl. Grossmann 2009, S. 23).
Im Laufe des Heranwachsens nimmt die Intensität und die Häufigkeit dieses Verhaltens ab. Als Teil der Verhaltensausstattung bleiben die Verhaltensweisen dem Menschen jedoch erhalten. Das Bindungsverhalten, das ein Mensch dabei entwickelt, hängt nach Bowlby von den Altersstufen des Kleinkindes, dem Geschlecht, den Lebensumständen und von den Erfahrungen ab, die es im Kindesalter mit Bezugspersonen gemacht hat (vgl. ebd.)
Bowlby unterteilt die Entstehung von Bindung in vier aufeinander aufbauende Phasen: Die erste Phase, die sog. „Vorbindungsphase", umfasst die Zeit nach der Geburt bis zum Ende des ersten Lebensmonats. In dieser Phase erkennt der Säugling keine Bezugspersonen und ist ausschließlich von seinen „angeborenen Regulationsmöglichkeiten" bestimmt (vgl. Keller 2019, S. 22). In der zweiten Phase, „Bindung im Entstehen", die bis zum sechsten Lebensmonat andauert, können die Kinder bereits vertraute Personen erkennen. In der dritten Phase, „klare Bindung", entwickelt sich bis zum 18. Lebensmonat eine Bindung zu einer bestimmten Person, die in der Regel die Mutter oder eine andere Bezugsperson ist und zu der das Kind die Nähe sucht (vgl. Grossmann 2009, S. 23). In der vierten Phase, „zielkorrigierte Partnerschaft", die vom 2. bis zum 3. Lebensjahr andauert, lernt das Kind innere Befindlichkeiten und Motive besser zu verstehen. Ab dem 3.-4. Lebensjahr wird das interne Arbeitsmodell entwickelt, das die bisherigen Erfahrungen abspeichert und die zukünftigen Beziehungen formt (vgl. Keller 2019, S. 23; Jungmann 2019).
Bowlby beschreibt die Kontinuität in der Versorgung des Kindes mit Intimität, Wärme, Zuwendung, Liebe und Nahrung sowie das Einfühlen der Mutter gegenüber den Signalen des Säuglings als die Grundlage für die Entstehung von Bindung und psychischer Gesundheit, die später von Ainsworth durch ihre empirischen Forschung qualifiziert wurde (vgl. Keller 2019 S. 23; Grossmann 2012, S. 36). Wenn das Kind die Erfahrung macht, dass es jederzeit zur Mutter zurückkehren kann, stellt dies eine sichere Basis dar, die dem Kind ermöglicht, in Ruhe die Welt für sich zu erkunden (Grossmann 2009, S. 25). Auf der Grundlage einer solchen sicheren Beziehung kann sich Selbstvertrauen entwickeln. Der Psychoanalytiker Erik Erikson spricht in diesem Zusammenhang von einem „Urvertrauen", das durch eine zuverlässige Person entsteht, die sich umfassend um den Säugling kümmert, (vgl. Bowlby 1982, S. 272f.; Grossmann 2012, S. 36; Erikson 1970, S. 108).
Jeder, der eine solche Basis nicht hat, ist laut Bowlby ohne Wurzeln: „Wenn die Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung verschlossen ist, bleibt sie unzugänglich. Dann richtet sich Ärger auf die falschen Ziele, Angst tritt in unangemessenen Situationen auf, und Feindseligkeit wird von falscher Seite erwartet." (Bowlby 2008, S. 117).
Bowlby geht davon aus, dass die frühkindlichen Bindungserfahrungen das Bindungsverhalten im späteren Verlauf des Lebens prägen und sich schwerlich verändern lassen:
Findings from this and other studies (see Rutter, 1981) support the hypothesis that there is a sensitive phase in early life after which development of the capacity to make secure and discriminating attachments becomes progressively more difficult; or, put another way, that the pattern in which a child's attachment behaviour is already organised tends to persist and as he grows older to be modified less and less easily and less and less completely by his current experience. (Bowlby 1982, S. 366)
Bowlbys Theorien wurden von Mary Ainsworth (1913- 1999) weiterentwickelt, indem sie sich in ihren Feldforschungsstudien auf die Mutter- Kind Interaktion konzentrierte und somit BowlbysTheorie empirisch erforschte.
Mit Hilfe eines sogenannten standardisierten Fremde-Situation-Tests untersuchte sie in den 1970er Jahren die Qualität einer Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind (vgl. Dreyer 2017, S. 24; Grossmann 2009, S. 169). In diesem Test wird in einem Laborraum eine Situation geschaffen, in der die Mutter des beobachteten Kindes zweimal den Raum verlässt und eine fremde Person den Raum betritt und auf das Kind eingeht. Es wurde untersucht, in welcher Weise das Kind nach der Trennung von seiner Mutter reagiert (vgl. Grossmann 2012, S.140). Ainsworth entdeckte drei Muster, die bei den Kindern zu beobachten waren und benannte sie „sichere Bindung", „unsicher-vermeidende Bindung" und „unsicher-ambivalente Bindung":
Bei der „sicheren Bindung" spielen die Kinder, wenn die Mutter im Raum ist und zeigen bei derTrennung durch Weinen oder Schreien den dringenden Wunsch mit dieser wieder in Beziehung zu treten. Sobald die Mutter sie auf den Arm nimmt, beruhigen sie sich wieder. Die elterliche Verhaltensweise ist direkt, freundlich und verlässlich.
Liegt eine „unsicher- vermeidende Bindung" vor, zeigen Kinder kaum Reaktionen, sie wirken entspannt, sind physiologisch jedoch gestresst. Das elterliche Verhalten erwartet eine Selbstregulation vom Kind, die Mutter vermeidet Körperkontakt.
In einer „unsicher-ambivalenten Bindung" sind Kinder von Beginn sehr ängstlich, reagieren ambivalent auf die Rückkehr der Mutter, indem sie z.B. einerseits auf den Arm genommen werden, diesen aber sogleich auch wieder verlassen wollen. Das elterliche Verhalten ist in einem Moment herzlich und im nächsten Moment desinteressiert (vgl. Dreyer, S. 24f.; Entwicklungspsychologie o.D.).
Die US - amerikanische Entwicklungspsychologin Mary Main (geb. 1943) entdeckte später noch ein viertes Muster: Bei der „unsicher-desorganisierten Bindung" reagieren die Kinder bei der Rückkehr der Mutter mit Angst, suchen erst Nähe und wenden sich dann wieder ab. Diese Kinder haben häufig Gewalt und Missbrauchserfahrungen gemacht (vgl. Rauh 2008, S. 217; Entwicklungspsychologie o.D.). Langzeitstudien belegen, dass die Bindungserfahrungen im Kleinkindalter Auswirkungen auf das Bindungsverhalten im Erwachsenenalter haben (vgl. Grossmann 2012).
Ainsworths und Mains Beobachtungen belegen Bowlbys Theorie zur frühkindlichen Bindung mit empirischen Befunden, so das man insgesamt Bowlbys Erkenntnisse als gesichert ansehen darf.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine sichere Bindung, die durch eine Kontinuität in der Versorgung des Kindes mit Intimität, Wärme, Zuwendung, Liebe und Nahrung ausdrückt zu Selbstvertrauen führen kann. Das Selbstvertrauen wiederum kann als eine Grundlage von innerer Geborgenheit gewertet werden.
2.2 Die „fordernde Umwelt" nach Donald Winnicott
Gemeinsam mit Bowlby machte der Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott (1896 - 1971) im British Medical Journal im Jahre 1939 auf die schwerwiegenden psychologischen Folgen bei Kindern aufmerksam, welche durch die Trennung von ihren Familien durch die Städteevakuierung ausgelöst wurden (Caidwell, L./Jocye, A. o.D., S. 7). Neben der geteilten Einschätzung war Winnicott jedoch der Meinung, dass in der Bindungstheorie Bowlbys wichtige Faktoren, die zur Entwicklung von Unabhängigkeit führen können, fehlen.
Winnicott sammelte seine Erkenntnisse in seiner Tätigkeit als Kinderarzt, bei der er Mütter und ihre Kinder erlebte und die Mütter bat, die Lebensweise ihrer Säuglinge in den Frühstadien zu beschreiben. Später absolvierte er eine Psychoanalyseausbildung und arbeitete als Psychoanalytiker, woraus er weitere Erkenntnisse zog, die in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt werden (vgl. Sesink 2001, S.21). Anders als der Psychoanalytiker, Sigmund Freud (1856 - 1939), der die Ursache von Ängsten auf den Ödipuskomplex im Kleinkindalter (der Vier - Fünfjährigen) zurückführte, stellte Winnicott fest, dass einige der psychotischen und psychoneurotischen Störungen von Kindern bereits vor der ödipalen Phase sichtbar werden: „Paranoide, überempfindliche Kinder konnten schon in den ersten Wochen oder sogarTagen des Lebens diese Erscheinungen zeigen" (Winnicott 2006, S. 225). Winnicott bezieht sich in seinen
Aufsätzen zwar auf die Ansätze Sigmund Freuds, geht aber anstatt vom „Prägenitalem Triebleben", von einer Art „Abhängigkeit des Individuums" aus (vgl. ebd. S. 176). Im anschließenden Kapitel soll der Ansatz Winnicotts vorgestellt werden, der deutlich macht, wie das Individuum zu einer Unabhängigkeit gelangt, die wiederum für das Erleben von innerer Geborgenheit essentiell ist. Erfährt sich der Mensch in ständiger Abhängigkeit, kann sich dieser schwerlich in sich selbst geborgen fühlen. Zusätzlich zur Bindungstheorie beschreibt Winnicotts Ansatz die Entwicklung des Vertrauens durch Übergangsobjekte, die Fähigkeit zum Alleinsein und die Voraussetzung an etwas zu glauben.
2.2.1 Von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit
Nach Winnicott sind für die emotionale Entwicklung drei wesentliche Faktoren entscheidend: das Erbgut, die Umwelt und das Individuum, das darin lebt, abwehrt und wächst (vgl. Winnicott 2006, S. 178). „Das Merkmal des Reifungsprozesses ist der Drang zur Integration" (ebd. S.315). Diese kann zunächst mittels einer guten Ich-Stützung durch die Umwelt (wie den Bezugspersonen) erfolgen und im Laufe der Entwicklung zureigenständigen Leistung werden (vgl. ebd.). Winnicott geht davon aus, dass eine gesunde Entwicklung in erster Linie durch „angeborene Tendenzen" erfolgt, die zum Wachstum führen. Diese hängen wiederum von einer guten Versorgung durch die Bezugspersonen für das Kleinkind ab (vgl. S. 87). Der Psychoanalytiker spricht von den Phasen einer absoluten Abhängigkeit, der relativen Abhängigkeit und der Annäherung an eine Unabhängigkeit und macht zugleich deutlich, dass die Trennung dieser Phasen etwas künstliches darstellen, da diese in der Realität nicht so klar voneinander zu trennen sind (vgl. ebd. S. 56 und S. 108). Nach Winnicott existiert bereits der Säugling in einer Art Wechselwirkung aus Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Winnicott geht davon aus, dass der Säugling bereits ererbtes Potential in sich trägt, was ihn prägt und zum anderen wird das Kind im besten Fall durch die Umwelt in seinem Reifungsprozess unterstützt, so dass das Kind sein Potential entfalten kann (vgl. ebd.). Mit Reifungsprozess meint Winnicott die Entfaltung des Selbst und damit einhergehend der Triebe und Abwehrmechanismen dieser durch das Ich (vgl. ebd.). Die Eltern bringen somit nicht ein fertig geformtes Kind zur Welt, sondern ermöglichen dem Kind, dass sein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt wird. Hierfür ist es nach Winnicott wesentlich, dass sich die Eltern an die Bedürfnisse des Kindes anpassen, um die Reifungsprozesse nicht zu blockieren, sondern diesen Raum zur Entfaltung zu geben (vgl. ebd. S. 109). In der Phase der „absoluten Abhängigkeit" versteht Winnicott die Mutter als die erste fördernde Umwelt für das Kind, die durch die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt in der Regel auf das Kind eingestimmt ist, sich mit ihm identifiziert und verletzlich ist (vgl. Winnicott, 2006, S.109). Der Vater und die Familie wirken in dieser Phase nach Winnicott als Unterstützung (vgl. ebd. S. 89)3. Das Kind ist auf die Fürsorge seiner Mutter angewiesen, da sich diese um die Versorgung des Kindes kümmert und das Kind beschützt. Mit Fürsorge ist zum einen „das Befrieden von physiologischen Bedürfnissen", also die Pflege, das Einfühlungsvermögen, das physische Halten als eine Form der Liebe und das Schützen vor Gefahren gemeint (vgl. S. 62), als auch das Zusammenleben von Mutter- Kind, Vater- Kind und Vater- Mutter-Kind (vgl. ebd. S. 55). Im „Zusammenleben" löst sich das Kind aus der„Verschmolzenheit" mit der Mutter und nimmt Objekte außerhalb seines Selbst wahr (vgl. ebd. S. 56, siehe Kapitel 2.2.2). Unter„Verschmolzenheit"versteht Winnicott, dassderSäuglingzu Beginn eine Art „Allmachtsillusion" hat, was meint, dass er davon ausgeht, mit seiner Mutter eins zu sein und die Welt selbst erschafft. Diese wird ausgelöst, durch ein vages Bedürfnis des Kindes, das durch die Mutter befriedigt wird, indem sie dem Kind ein Objekt, wie z.B. die Brust, Flasche, Schnuller etc. gibt. Es fängt an zu brauchen, was die Mutter anbietet und entwickelt somit ein Vertrauen, diese Objekte und somit die Welt selbst zu erschaffen. Aus einer „befriedigenden Brustfütterung wird ein Ich-Erlebnis" (ebd. S. 80). Die Mutter stärkt somit das schwache Baby-Ich und verhindert das Gefühl der Angst (vgl. S. 89/S. 105).
Das Selbst des Säuglings hat sich nach Auffassung von Winnicott in diesem Stadium noch nicht ausgebildet (vgl. Winnicott 1984, S. 31):
In diesem Zustand hat der Säugling keine Möglichkeit, etwas von der mütterlichen Fürsorge zu wissen [...] Er kann nicht steuern, was gut und was schlecht getan wird, er ist nur in der Lage, Nutzen zu haben oder Störungen zu erleiden. (Winnicott 2006, S 58)
Können Übergriffe nicht abgewehrt werden oder durchbrechen sie die Stützung der Mutter, kann dies im Kind Angst und Verzweiflung auslösen, was zu einer Ich-Schwä- chung führen und zum Kern einer „psychotischen Angst" werden kann (vgl. ebd. S. 60, S.67,S.78 und S.237).
Die „relative Abhängigkeit" beschreibt die Phase zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem zweiten Lebensjahr in der das Kind versteht, das es ein Innen-Ich gibt, dass durch die Haut begrenzt ist und eine äußere Realität, mit der es im fortlaufenden Dialog steht (vgl. ebd. S. 117). Das Kind beginnt sich als ein „Innen"- und die Mutter als ein „Außen" zu begreifen, die als „Objekt" zum einen Bedürfnisse befriedigt und zum anderen Nähe und Wärme durch Zärtlichkeiten erzeugt (vgl. ebd. S. 96). Anstelle der Verschmelzungseinheit mit der Mutter, tritt das „unbequeme 'Ich bin' (vgl. Winnicott 1990, S. 70). Das Kind spürt, dass die Mutter auch eigenen Impulsen folgt, die nicht immer den Bedürfnissen des Kindes entsprechen (vgl. ebd. S. 55) und dass es keine Allmachtstellung mehr hat. Dies kann nach Sesink zu verschiedenen Reaktionen führen: das Kind verschließt sich der Realität und bleibt in seiner eigenen Welt allmächtig, es opfert sich den Umständen und „funktioniert nur" oder es erkennt die Realität als diese an, die sie ist (vgl. Sesink 2002, S. 45). Erkennt es die Realität an, bewahrt sich das Kind das Vertrauen in die eigene Kraft und die Aufnahme von Objektbeziehungen wird möglich (ebd. S. 46). Das Kind wird zum potentiellen Schöpfer der Welt und ist auch fähig, „die Welt mit Mustern seines eigenen Innenlebens zu bevölkern" (Winnicott 2006, S. 117). Ist das Kind gesund, wird es „allmählich fähig, der Welt und all ihren Komplexitäten zu begegnen, weil es dort immer mehrvon dem sieht, was in seinem Selbst schon vorhanden ist" (ebd.). Erfährt das Kind eine Unterbrechung seiner Versorgung und Verlässlichkeit durch die Bezugsperson, wird die Entwicklung des Kindes nach Winnicott aufgehalten und Besorgnis des Kindes kann zu einer Angst werden (vgl. ebd. S. 91, S. 105 und S. 135). Wenn z.B. die Familie aus unterschiedlichen Gründen weder für den Säugling noch für das Kleinkind eine gute Versorgung bereithalten kann und dadurch die Fähigkeit des Kindes überschritten wird, eine Abwehr aufzubauen, kann es nach Winnicott zu psychoneurotischen, psychotischen- oder zu sogenannten „Charakterstörungen" kommen (vgl. ebd. 271f.; mehr dazu in: Anhang A). Leidet die Mutter z.B. an Depressionen, übernimmt der Säugling die Rolle „lebendig" auszusehen und „Lebendigsein" zu kommunizieren. Diese Kommunikationsform ist „unnatürlich und eine unerträgliche Belastung für das unreife Ich" in seiner Funktion, sich zu integrieren und gemäß dem ererbten Vorgang allgemein zu reifen (vgl.ebd.).
Die Unabhängigkeit entwickelt sich im Kind, indem es sich im Laufe der Zeit auch mit anderen Menschen identifiziert, denen es begegnet. Und die zum einen die „personale Welt des Selbst" und zum anderen die „äußeren Phänomene" repräsentieren. Das Kind erfährt eine Art Selbstständigkeit, wenn es das Vertrauen hat, das ihm hilft, die Zeit der Abwesenheit seiner Mutter z.B. durch sogenannte Übergangsobjekte zu überbrücken, bis es selbst autonom wird (Sesnik 2002, S. 47; vgl. Kapitel 2.2.2). Zur Unabhängigkeit kommt es, wenn der Säugling Möglichkeiten entdeckt ohne wirkliche Fürsorge durch die Bezugsperson auszukommen.
Dies wird durch die Anhäufung von Erinnerungen an Fürsorge, die Projektion persönlicher Bedürfnisse und die Introjektion von Fürsorge-Details bewerkstelligt, zusammen mit der Entwicklung von Vertrauen in die Umwelt. Hier muss noch das Element des intellektuellen Verstehens mit seinen ungeheuren Folgen hinzugefügt werden. (Winnicott, 2006, S. 59)
Wie man an diesen Ausführungen sehen kann, ist das Erleben von verlässlichen Bindungen für Individuen zentral, um eine für sich selbst stehende Persönlichkeit zu entwickeln und um auch alleine ohne die primären Bezugspersonen Sicherheit zu empfinden, was wiederum das innere Geborgenheitsempfinden stärkt.
2.2.2 Übergangsobjekte
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Übergangsobjekten nach Winnicott, die zur Autonomie eines Individuums wesentlich beitragen können und das Indiviuum somit in seinem inneren Geborgenheitserleben unterstützen können. Nach Winnicott stellen sogenannte „Übergangsobjekte" in der Entwicklung eines Kleinkindes eine wichtige Rolle dar. Diese können ab dem vierten bis zwölften Monat laut Winnicott für das Kind wichtig werden und bis in die Kindheit erhalten bleiben (vgl. Winnicott 1976, S.293). Unter „Übergangsobjekten" versteht Winnicott Objekte, die dem Säugling während des Abnabelungsprozesses von der Mutter dienen. Sie sind nicht Teil des Säuglingskörpers, werden aber vom Säugling noch nicht als äußere Objekte erkannt (vgl. Winnicott 1976, S. 294). Somit wird die Mutterbrust durch ihre „hundertprozentige Anpassung an die Bedürfnisse des Säuglings" für den Säugling zu einer Form der Allmachtsillusion, „ihre Brust sei ein Teil seiner selbst" (ebd. S. 306). Die Illusion schreibt Winnicott einem Zwischenbereich zu, der neben der inneren und äußeren Realität besteht. Die Übergangsobjekte sowie das kindliche „Spiel" stellen eine solche Form der „Illusion" dar. Zu dieser Illusion gehört auch die Erfahrung, dass Aggression sein darf. So leistet nach Winnicott die Aggression für das Individuum einen entscheidenden Beitrag sich von seiner Umwelt abzugrenzen und das Gegenüber oder ein Objekt als „Nicht-Ich" anzuerkennen (vgl. ebd S. 293/308). Winnicott verdeutlicht die Beziehung zwischen Kind und Objekt wie folgt:
Das Subjekt sagt gewissermaßen zum Objekt: >lch habe dich zerstört^ und das Objekt nimmt diese Aussage an. Von nun an sagt das Subjekt: >Hallo, Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist für mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe! Obwohl ich dich liebe, zerstöre ich dich in meiner (unbewussten) Phantasie. (Winnicott 2010, S. 105)
Somit steht das Objekt dem Kind zur Verfügung. Das Objekt hält aus, was ihm angetan wird. Dies kann ein weicher Gegenstand sein (wie ein Kuscheltier oder ein Tuch), der für das Kind eine essentielle Bedeutung trägt (vgl. Winnicott 1976, S.293). In Situationen, in denen sich das Kind einsam fühlt, kann es dem Kind Halt geben (vgl. ebd. S. 297). Winnicott formuliert verschiedene Qualitäten, die solch ein Übergangsobjekt ausmachen. So soll dieses Übergangsobjekt meist nicht verändert werden, (z.B. gewaschen werden) und muss unterschiedlichen Gefühlsausbrüchen wie Wut und Freude standhalten. Für ein „gesundes Kind", verliert das Übergangsobjekt im Laufe der Zeit seine Bedeutung. Winnicott beobachtete, dass Kinder, die sich allein aufdie Mutter fixierten und kein Übergangsobjekt hatten, im Verlauf ihres Lebens Schwierigkeiten hatten, Beziehungen einzugehen (vgl. ebd. S. 303). Erstellte heraus, dass Erwachsene die Illusion auch als sogenannten Zwischenraum innerhalb der Kunst, „schöpferischer Wissenschaft" und Religion erfahren (vgl. ebd. S. 295/S. 311). Damit meint er den „Zwischenbereich zwischen dem Subjektiven und dem, was objektiv wahrgenommen werden kann" (ebd.). Da auch der Glaube nach Winnicott als ein Übergangsobjekt angesehen werden kann, wird dieserAspekt im Folgenden beschrieben.
2.2.3 Die Entwicklung eines Glaubens nach Winnicott
„Darf ich sagen, dass das was man gewöhnlich als Religion bezeichnet, in meiner Sicht aus der menschlichen Natur erwächst?" (Winnicott 1986, S. 143).
Winnicott war in seiner Kindheit durch den Wesleyschen Protestantismus, einer nonkonformistischen Glaubenshaltung geprägt. Später besuchte er ein christliches Internat, in dem z.B. das Beten und Gottesdienste dazu gehörten. Erselbst betrachtete sich „religiös" (zit. n Parker 2011, S. 43). Mit „religiös" gemeint, dass man in seinem Denken und Handeln vom Glauben an eine göttliche Macht geprägt ist und sich auf eine Religion bezieht (vgl. eWDG 1974b). Glaube leitet sich vom lateinischen//des ab, was so viel heißt wie „Vertrauen, Glaube, Zutrauen" und steht im Kontext religisöser Überzeugungen für die Grundhaltung des Vertrauens (Tobler 2003). Winnicott geht davon aus, dass Kinder kulturell unabhängig und über alle Ländergrenzen hinweg moralisch erzogen werden können. Wenn Kinder an etwas glauben, können sie dies weitergeben und wenn sie ohne den „Glauben an etwas" aufwachsen, zeugt dies meist von dem Misstrauen der Eltern gegenüber den „Prozessen der menschlichen Natur" (vgl. Winnicott 2006, S. 121). Um Wertevorstellungen und Glauben vermitteln zu können, bedarf es nach Winnicott der Bereitstellung von Bedingungen, die das Kind bei der Entwicklung von Vertrauen und dem „Glauben an etwas" sowie der Vorstellung von Recht und Unrecht unterstützen. Dies bezeichnet Winnicott als „die Entfaltung des Über-Ichs" (ebd. S. 121.). Er geht davon aus, dass die Grundvoraussetzungen für den Glauben bereits in der Kindheit verankert sind. Wenn der Säugling und das Kind gut umsorgt wurde, baut sich der Glaube an eine Zuverlässigkeit auf. „Für ein Kind, das sein Leben auf diese Weise begonnen hat, ist die Vorstellung vom Guten und die von einem verlässlichen und personenhaften Elternteil oder Gott eine natürliche Folge" (Winnicott, 1965, S. 97). Die Idee eines persönlichen Gottes könne kein Ersatz für gute Säuglingspflege darstellen. Er ist der Meinung, dass die moralischen Organisationen dem einzelnen Individuum die Kreativität nehmen können. Und dass diese in erster Linie Menschen bekehren wollen, die sie nicht bekehren können, wenn sie in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, an etwas zu glauben (vgl. ebd. S. 123). Winnicott macht deutlich, dass die moralische Erziehung kein Ersatz für die Liebe ist (vgl. Winnicott 2006, S. 123) und sich mit Liebe immer mehr erreichen lässt, als durch Erziehung (Winnicott 1965, S. 100). Die Liebe geht mit einem Vertrauen einher. Die Bedingungen für einen solchen Vertrauensaufbau wurden in den vorangegangenen Kapiteln (siehe 2.1; 2.2.1; 2.2.2) beschrieben.
Winnicott nimmt an, dass der Glaube dem Menschen dabei helfen könne, den Zweifel durch Gewissheit zu ersetzen (vgl. Winnicott 1984, S.14). Wurde das Kind mit Liebe versorgt und fühlt es sich innerlich sicher, wird es aus dieser Haltung heraus die Welt weiter entdecken wollen (vgl. S. 130):
Für mich gewähren eine hinreichend gute Mutter, hinreichend gute Eltern und ein hinreichend gutes Zuhause den meisten Babys und Kleinkindern die Erfahrung, dass sie niemals in einer entscheidenden Weise fallengelassen werden. (Winnicott 1986, S. 149)
Anders als bei Rousseaus Idee vom „Gutmenschen", gehört für Winnicott neben dem Gefühl des Liebens die Aggression genauso zum Menschsein dazu (vgl. Auchter 2013 S. 9). So ermöglicht die Aggression durch strampeln o.ä. dass sich das Kind in Abgrenzung zum Nicht-Ich erfährt (vgl. ebd.). Das Übergangsobjekt, wie der Glaube, hält allen Gefühlen stand und kann somit für den Menschen konstant wirken.
2.3 Modifikation frühkindlicher Erfahrung
Dieses Kapitel erläutert, inwiefern Übergangsobjekte und andere positiv erlebte Erfahrungen unsichere Bindungserfahrungen im Laufe eines Lebens korrigieren können. Trotz seines Ansatzes ist Winnicott der Meinung, dass Prozesse, die in der Kindheit angefangen haben, selten abgeschlossen sind und durch spätere Entwicklung bis ins Erwachsenenalterverstärkt werden können (vgl. Winnicott 2016, S.94). Eltern haben die Möglichkeit Verhaltensfehler aus früheren Tagen zu korrigieren und ihre Kinder im Laufe der Kindheit positiv aufzubauen (vgl. ebd. S. 271). Winnicott geht davon aus, dass die Eltern das Kind nicht „machen" müssen, sondern dass die Prozesse derVersorgung und des Reifungsprozesses auf natürliche Weise erfolgen (vgl. ebd. S. 125.). Die Mutter, insofern sie nicht selber krank ist, wird intuitiv das Kind richtig versorgen. Eine zu starke Bemutterung hingegen kann dazu führen, dass sich das Kind erst später oder gar nicht lösen kann (vgl. ebd. S. 69 und S. 89). Auch wenn die frühen Erfahrungen mit den Bezugspersonen das Kind vorrangig prägen, können sich diese im Laufe des Lebens durch positiv oder negativ erlebte Beziehungen oder durch die Gestaltung korrigierender emotionaler Erfahrungen, wie z.B. auch durch eine Psychotherapie, verändern (vgl. Fröhlich-Gildhoff2017, S. 5). Petra Evanschitzky(Prozessbegleiterin und Fortbilderin im Arbeitsfeld Frühpädagogik) und Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildoff (ev. Hochschule Freiburg) machen deutlich, dass in den frühen Jahren durch die Bindungserfahrungen zwar neuronale Spuren und damit einhergehend ein innerseelisches Schema angelegt wird, diese inneren Arbeitsmodelle/Muster aber durch andere wiederholte Beziehungserfahrungen das Bindungsverhalten verändern können. (TPS S. 2ff.; vgl. Kapitel 2.1).
3. Zwischenfazit
In den vorangegangenen Ausführungen wird ersichtlich, dass Geborgenheit ein positives Grundgefühl ist, das mit einem Gefühl einher geht, sich sicher und gut aufgehoben zu wissen. Evolutionsbedingt strebt der Mensch sein Leben lang nach dem Gefühl der Geborgenheit. Diese wird einerseits individuell erlebt und andererseits zeigen weltweite Studien, dass Gefühle, die damit assoziiert werden, wie u.a. Wärme, Sicherheit, Liebe und Anerkennung, universell gültig sind (vgl. Kapitel 1.2). Das Gefühl der Geborgenheit kann zum einen durch das Außen, und zum anderen in einem selbst erfahren werden. Die Geborgenheit, die der Mensch in sich selbst erfährt, wird im Kontext dieser Arbeit innere Geborgenheit genannt. Diese innere Geborgenheit geht mit einer inneren Sicherheit und einem Selbstvertrauen einher (vgl. ebd.). Und meint somit auch das Vertrauen in das eigene Leben. Anschließend wurde aufgezeigt, dass Aspekte welche, im Menschen Geborgenheit erzeugen, je nach Alter und Lebensphase variieren können (vgl. Kapitel 1.3). Das zeigt, dass biographisch und individuell unterschiedliche Relevanzen für das Gefühl von Geborgenheit eine Rolle spielen. Außerdem wurde deutlich, dass mitderGeborgenheitauch immerdas Wissenvon Ungeborgenheit einhergeht, die zum einen durch seelische, zum anderen durch äußere Beeinträchtigungen erlebt werden kann (vgl. 1.4). Erfährt der Mensch Momente der Ungeborgenheit, kann dies zu einem seelischen Schmerz führen, der als Leid bezeichnet wird. Neben ökonomischen spielen in diesem Zusammenhang auch familäre, gesellschaftspolitische, vererbte und innerseelische Bedingungen eine große Rolle im Erleben von Geborgenheit.
Die Entwicklung von Geborgenheit ist somit nicht linear zu betrachten. Da der Mensch in der Regel danach strebt, sich geborgen zu fühlen, sucht er- sofern es seine psychische und physische Verfassung zulässt, verschiedene Wege in die Geborgenheit zu finden (vgl. 1.5). Eine Form stelltt der Glaube und die Spiritualität dar. Eine weitere das Selbstvertrauen.
Die Grundlage dafür legt eine vertrauensvolle Bindung zu Bezugspersonen, die nach der Geburt auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, und sich das Kind dadurch gut und sicher aufgehoben fühlt (siehe Kapitel 2.1). Aus dieser Sicherheit heraus traut sich das Kind die Welt um sich herum zu entdecken und sich langsam von seinen Bezugspersonen unabhängiger zu machen, wodurch es Selbstvertrauen entwickeln kann. Nach Winnicott sucht sich das Kind Übergangsobjekte, die es in dem Prozess zur Unabhängigkeit unterstützen. Auch der Glaube kann so ein Übergangsobjekt darstellen und schafft dann eine Form des Halts, der zu einer inneren Geborgenheit führen kann (vgl. Kapitel 2.2.2).
Wenn im Laufe des Lebens das Kind also von einer herzlichen und liebenden Umwelt bestärkt wird, in der seine Gefühle beachtet werden, ist dies die beste Voraussetzung für ein „Leben in Geborgenheit" (vgl. Mogel 2016). Wie ein Mensch Geborgenheit erlebt und erfährt, unterliegt verschiedenen Bedingungen und ist ein dynamischer Prozess (vgl. Kapitel 1.3). So prägen die frühen Bindungserfahrungen den Menschen (vgl. 2.1 und 2.2). Kinder, die in ihrer Kindheit wenig Geborgenheit erfahren haben, können aber dennoch im Laufe ihres Lebens ein Gefühl der inneren Stabilität, des Selbstvertrauens und damit verbundenen (inneren) Geborgenheit entwickeln (vgl. 2.3).
[...]
1 Diese Personen sind weiße Akademikerinnen, die in Deutschland sozialisiert sind.
2 Hierbei sei angemerkt, dass die Studie aus den 1990 er Jahren ist und einen Trend und eine Interpretation aus der damaligen Zeit widerspiegelt. Interessant wäre es, würde die Studie heutzutage durchgeführt werden, könnten Tendenzen gegenwärtig anders gewichtet werden, da sich gesellschaftlich in Bezug auf das Rollenverständnis seit den 1990er einiges verändert hat.
3 Der Vater oder eine andere Bezugsperson können nach Winnicott ebenso die Rolle der fürsorglichen Person einnehmen.
- Arbeit zitieren
- Indre Bogdan (Autor:in), 2020, Eine qualitative Studie zur Geborgenheit von spirituellen Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924075
Kostenlos Autor werden



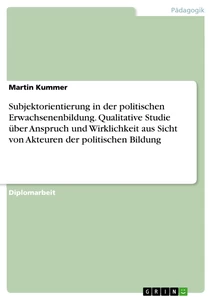
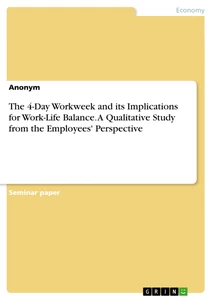









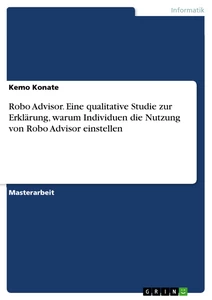



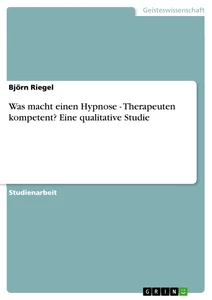
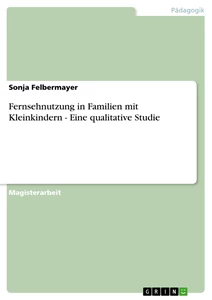


Kommentare