Leseprobe
1 Einleitung
2 Einführung und Begriffsklärung
3 Was ist unter einer traumatischen Erfahrung zu verstehen?
3.1 Klassifikation von Traumaformen
3.2 Neurowissenschafliche Befunde zur Entstehung von Traumafolgestörungen
3.2.1 „Fight or Flight“
3.2.2 „Freeze and Fragment“
4 Traumafolgestörungen: Bewältigungsstrategie des Gehirns
4.1 Störungsbildung
4.2 Übererregung
4.3 Intrusionen
4.3.1 Trigger
4.3.2 Traumatisches Spiel
4.4 Vermeidungsverhalten und Dissoziation
4.5 Weitere typische Entwicklungsbeeinträchtigungen
5 Trauma und Bindung
5.1 Effekte von Bindungssicherheit: Emotionsregulation und Mentalisierung
5.2 Desorganisiertes Bindungsmodell
5.3 Beziehungstraumata: Die Bindungsperson als Täter
6 Einflussfaktoren bei der Ausbildung von Traumafolgestörungen
6.1 Peritraumatische Situationsfaktoren
6.2 Risikofaktoren und Vulnerabilitäten
6.3 Schutzfaktoren
7 Pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern
7.1 Ermittlung des pädagogischen Bedarfs
7.1.1 Verstehensorientierte Grundhaltung bei Fachkräften
7.1.2 Erkennen der Symptome einer Traumafolgestörung
7.1.3 Einbeziehung der Eltern
7.2 Implementierung traumapädagogischen Wissens
7.2.1 Strukturelle Sicherheit
7.2.2 Pädagogische Fachkraft als „sicherer Hafen“
7.2.3 Reflexionsbedarf
7.2.4 Qualifizierung der Fachkräfte
7.3 Entwicklungsförderung traumatisierter Kinder
7.3.1 Förderbedarf und Empowerment
7.3.2 Förder- und Interventionsmaßnahmen
7.4 Traumapädagogik als Gruppenpädagogik
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
I Phasen normaler und pathologischer Reaktion auf belastende Lebensereignisse
II Gegenüberstellung der Diagnosekriterien des DSM-IV und der ICD-10
III Folgen komplexer Traumatisierung für die Pädagogik
IV Die Relevanz der traumapädagogischen Erkenntnisse als Grundlage für die pädagogische Arbeit mit traumatisierten Kindern
Ihr sagt: „Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.“ Ihr habt recht. Ihr sagt: „Denn wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen. Hinuntersteigen, uns herabneigen, beugen, kleiner machen.“ Ihr irrt euch. Nicht das ermüdet uns. Sondern – daß wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. Emporklimmen, uns ausstrecken, auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen. Um nicht zu verletzen.
Janusz Korczak (1973, S. 7)
1 Einleitung
Korczaks Worte machen aufmerksam. Aufmerksam darauf, dass die Gefühle von Kindern und die Facetten ihres Verhaltens, ihre Beweggründe und ihre Absichten häufig wesentlich komplexer sind als sie auf den ersten Blick anmuten. Der Umfang dieser Komplexität kann wohl nie gänzlich, aber zumindest vom Grunde her ausgelotet und erfasst werden, wenn versucht wird, sich der Perspektive und der erlebten Wahrheit des Kindes anzunähern. Vor diesem Hintergrund ist auch diese Arbeit zu verstehen. Sie soll für Traumatisierungen bei Kindern sensibilisieren und den Blick für ihre Folgestörungen sowie für die besondere vielschichtige Beschaffenheit ihrer inneren Welt(en) und ihre einzigartigen Gefühle und Denkmuster schärfen.
Die Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist vielfältig und Kinder werden auf unterschiedlichste Art und Weise gefördert. Für eine optimale Begleitung ihrer Entwicklungsprozesse werden Beobachtungen angestellt, Dokumentationsbögen ausgefüllt sowie Grenz- und Meilensteine kindlicher Entwicklung berücksichtigt und auf Grundlage dieser Erkenntnisse werden Schlüsse dahingehend gezogen, in welchen Bereichen erhöhter Handlungsbedarf besteht. Unzählige Publikationen erläutern ausführlich die Relevanz von Förderbereichen und die Auswirkungen von Entwicklungsdefiziten auf den weiteren Lebenslauf. Zudem wird den Chancen und Risiken frühkindlicher institutioneller Erziehung und ihrer Komplexität inzwischen in immer mehr Studiengängen Rechnung getragen, welche die angehenden KindheitspädagogInnen auf ihren Einsatz in der Praxis vorbereiten sollen. Dafür wird Grundlagenwissen aus diversen Fachbereichen vermittelt, wie z.B. der Bewegungs-, Musik-, Medien- oder Religionspädagogik. Des Weiteren werden mögliche Entwicklungsverzögerungen und -beeinträchtigungen thematisiert, welche zu einem speziellen pädagogischen Bedarf führen und es werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, um diesen Bedarf zu decken und langfristige Folgen zu verhindern.
Ein Themenbereich, welcher die Persönlichkeitsbildung der Kinder und die Entwicklung auf allen Ebenen stark beeinträchtigt, wird momentan jedoch bei der Qualifizierung von Fachkräften noch mehrheitlich ausgeklammert, entweder weil dieser als unwesentlich erachtet oder hier die Zuständigkeit und Verantwortung nicht in der pädagogischen Praxis gesehen werden. Gemeint sind Störungen und Defizite, welche sich in Folge traumatischer Erfahrungen ausbilden können und das Kind, wenn es keine adäquate und vor allem frühzeitige Unterstützung erhält, zum Teil ein Leben lang in seinem Denken und Handeln negativ beeinflussen können (vgl. Huber 2012, S. 68). Im pädagogischen Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtungen scheint das Wissen über Traumafolgestörungen noch zu wenig verbreitet, obgleich bei einer Betreuungsquote von 96% aller 4-Jährigen im Jahr 2010 davon ausgegangen werden muss, dass sich in fast jeder Einrichtung traumatisierte Kinder befinden (vgl. StBA 2012, S. 1).
Diese Arbeit befasst sich daher mit kindlichen Traumafolgestörungen und versucht die Frage zu klären, welche Anforderungen sich für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen in der Folge ergeben. Dafür werden unter Einbeziehung psychotraumatologischen Basiswissens zunächst die Auslöser und die komplexen Wirkungsweisen kindlicher Traumaexposition erläutert und die weitläufigen Folgen für die kindliche Gesamtentwicklung beschrieben. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Auswirkungen von Traumatisierungen durch körperliche, psychische und sexuelle Misshandlung sowie Vernachlässigung gelegt. Auf dieser Grundlage kann der Blick sich den Anforderungen an die Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zuwenden, um zu klären, was diese bei der Arbeit mit Kindern mit Traumafolgestörungen besonders beachten müssen, welchem pädagogischen Bedarf sie gerecht werden müssen und wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann.
2 Einführung und Begriffsklärung
Dass traumatische Erfahrungen Menschen prägen und verändern und bestimmte Störungsbilder auftreten können, ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Seit Jahrhunderten treten immer wieder Beschreibungen solcher Symptome auf. Im Zuge der Industrialisierung beispielsweise wurde für die Reaktionen auf traumatisierende Arbeitsunfälle die Diagnose „Railway Spine“ oder „Railway Brain“ eingeführt und bereits Pierre Janet und Siegmund Freud war bewusst, dass es zu traumabasierten Störungen nach sexuellem Missbrauch kommen kann (vgl. Sack et al. 2013, S. 2). Der Begriff „Störung“ wird im Klassifikationssystem der WHO, der ICD-10 („Internationale Klassifikation psychischer Störungen“), als nicht exakt zu definierender Begriff beschrieben. Er umfasst eher einen Komplex von Symptomen und Verhaltensauffälligkeiten, welche für das Individuum beträchtliche Einschränkungen mit sich bringen. Diese können sich auf der persönlichen kognitiven, emotionalen und neuronalen Ebene zeigen, gehen aber meist auch einher mit schweren Belastungen auf der sozialen Ebene. Die Symptome müssen dabei immer im Kontext der aktuellen Situation, des individuellen Verlaufs und der persönlichen Beeinträchtigungen gesehen werden. Eine Störung gilt daher nicht nur als Auffälligkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenslauf, sondern tritt vielmehr als natürliche Folge von Entwicklungsphasen auf, deren sichtbare Auswirkungen gesellschaftlich als unnormal und unangepasst gelten (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2007, S. 17 ff.). Um einschätzen zu können, wie stark die Abweichung von dieser gesellschaftlichen Norm ist, müssen Aspekte wie das Alter und das Geschlecht des Kindes, die Dauer des auffälligen oder unangepassten Verhaltens, die persönlichen Lebensumstände, die kulturelle Zugehörigkeit sowie die Art und Ausprägung der Symptome einbezogen werden. Des Weiteren muss überprüft werden, wie sehr das Verhalten von üblichen, früheren Verhaltensweisen des Kindes abweicht und wie viele Bereiche seines Lebens durch die Störung tatsächlich beeinträchtigt werden (vgl. ebd., S. 15 ff.). Eine Traumafolgestörung muss also als eine komplexe Symptomatik von Verhaltensauffälligkeiten verstanden werden, welche nach bestimmten Kriterien von der gesellschaftlichen Norm abweicht, für das Kind erhebliche Einschränkungen und Entwicklungsproblematiken mit sich bringt und – wie der Name bereits impliziert – speziell in Folge eines Traumas auftritt.
Der Begriff „Trauma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Wunde“ oder „Verletzung“. Während dieser aus der Medizin stammende Begriff ursprünglich Verletzungen des Körpers beschreibt, welche durch Gewalteinwirkung oder Unfälle entstanden sind, ist im Kontext dieser Arbeit lediglich das „Psychotrauma“ von Bedeutung, also Verletzungen der psychischen Gesundheit eines Menschen. Erstaunlicherweise wurde, obwohl bereits vor Jahrhunderten von Traumafolgestörungen bei Erwachsenen berichtet wurde, wenngleich andere Begriffe verwendet wurden, lange Zeit angenommen, dass starke Belastungen von Kindern besser verkraftet werden und diese nur mit kurzfristigen Symptomen reagieren bzw. keine oder nur kaum seelische Verletzungen davontragen. Lange Zeit wurde sich auf Untersuchungsmethoden verlassen, die nicht für die Erfassung kindlicher Störungen ausgelegt waren und zudem wurde sich lediglich auf Beobachtungen von Eltern und Lehrern gestützt. Auf diese Weise konnte kein realistisches und aussagekräftiges Bild entstehen, so dass den Folgen von traumatischen Erfahrungen und den potentiell psychopathogenen Auswirkungen speziell auf die kindliche Entwicklung lange recht wenig Beachtung geschenkt wurde. Inzwischen genießt dieses Thema jedoch eine immer größere Aufmerksamkeit, welche sich in der einschlägigen Fachliteratur und in der steigenden Zahl von Forschungsbeiträgen niederschlägt (vgl. Landolt 2012, S. 14). Dies ist maßgeblich auf die Aufnahme der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) in das medizinische Diagnosemanual DSM-III der American Psychiatric Association zurückzuführen, wodurch 1987 erstmalig von Fachkreisen ausdrücklich anerkannt wurde, dass auch Kinder und Jugendliche durch belastende Lebensereignisse gravierende psychische Störungen davontragen können (vgl. Hensel 2007, S. 179). Weiter wurde 1991 mit Eröffnung des Deutschen Instituts für Psychotraumatologie ein neuer Fachbereich gegründet, welcher sich seither eingehend mit der Erforschung der Ursachen und Wirkzusammenhänge bei Psychotraumata beschäftigt und sich der Evaluation von Psychotherapien sowie der Prävention psychotraumatischer Störungen widmet.
Die Relevanz der Thematik wurde also erkannt, jedoch richtet sich ein Großteil der Publikationen weiterhin lediglich an Kinderpsychologen und –psychiater bzw. an Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Somit wird das breitgefächerte Wissen, das in diesem Fachbereich bisher zusammengetragen werden konnte, noch zu selten auf andere Arbeitsfelder übertragen (vgl. Landolt 2012, S. 14). Insbesondere für pädagogisch praktisch tätige Arbeitsfelder wie beispielsweise Kindertageseinrichtungen, welche nicht primär für die Versorgung von traumatisierten Kindern ausgelegt sind, gibt es bisher keine einschlägige zielgruppenorientierte Fachliteratur. Diese jedoch könnte die Fachkräfte für die Kausalitäten zwischen früheren Stresserfahrungen und kindlichem Verhalten sensibilisieren und Handlungsleitlinien zur Verfügung stellen. Denn bereits in der Kindheit gibt es eine immense Vielfalt an potentiell traumatisierenden Situationen und dementsprechend viele gefährdete oder betroffene Kinder, welche eine angemessene pädagogische Betreuung brauchen. Die Bandbreite reicht von jeglichen Missbrauchsszenarien, wobei diese sich emotional, körperlich oder sexuell vollziehen können, über Vernachlässigung bis hin zu beziehungsunabhängigen Auslösern wie schweren Unfällen, Kriegen oder Naturkatastrophen. Insbesondere die Misshandlungsformen lassen sich dabei nur schwer voneinander abgrenzen, da die Übergänge teils fließend sind und häufig eine Kombination verschiedener Formen auftritt. Auch bei anderen Auslösern lässt sich nicht generell klären, welche exakten Umstände für ein Kind traumatisierend sind. Der Fokus wird in dieser Arbeit daher zunächst nicht auf die einzelnen Situationen gelegt, sondern lediglich auf das, was sie alle gemeinsam haben und was das Trauma erst zu diesem macht, nämlich die traumatische Erfahrung selbst.
3 Was ist unter einer traumatischen Erfahrung zu verstehen?
In der Fachliteratur wird zur Klärung dieser Frage immer wieder auf die Diagnosekriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung in der ICD-10 und dem DSM-IV zurückgegriffen. Die WHO geht dabei im ICD-10 nicht konkret auf die Erfahrung des Kindes ein, sondern beschreibt lediglich die traumatische Situation als „…Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß […], das nahezu bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde“ (WHO 2006, S. 123). Näher wird hier auf die individuelle Erfahrung nicht eingegangen, somit steht also das auslösende Ereignis im Vordergrund. Die Definition des DSM-IV hingegen geht deutlicher auf die Auswirkungen der traumatischen Situation auf den Betroffenen ein. Denn ein traumatisches Ereignis liegt laut DSM-IV vor, wenn eine Person mit einem drohenden oder realen Tod bzw. einer schwerwiegenden Verletzung konfrontiert wird oder aber eine Bedrohung der „körperlichen Unversehrtheit“ bei sich oder anderen besteht. Weiter wird zudem die Reaktion auf dieses Ereignis beschrieben, welche vornehmlich „intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen“ beinhaltet (APA 1998, S. 189 f.). Hierbei kann jedoch wiederum kritisiert werden, dass diese Definition nicht alle Ereignisse umfasst. Denn vor allem in der Kindheit gibt es Umstände (z.B. Vernachlässigung, Operationen, psychische Misshandlung), welche bei Kindern nicht zwangsläufig auch mit Todesangst einhergehen oder Gefühle von intensiver Furcht und Entsetzen auslösen, obgleich das Erlebnis schwer traumatisierend sein kann (vgl. Landolt 2012, S. 16). Etwas treffender kann hier die Definition von Fischer und Riedesser gesehen werden, welche das Individuum in den Mittelpunkt rücken. Sie beschreiben ein psychisches Trauma als „vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer/Riedesser 2009, S.84).
Der Fokus liegt also hier auf dem Coping-Prozess, aus dessen Konsequenz sich dieses Diskrepanzerleben ergibt. Als Coping werden alle Bemühungen eines Individuums verstanden, welche dazu beitragen eine herausfordernde Situation zu bewältigen. Dabei kommt es zum einen zu einer Einschätzung der Situation bzw. einem Vergleich mit eventuell vorherigen Ereignissen und zum anderen zu einer Bewertung der eigenen Ressourcen, also den individuellen zur Verfügung stehenden Fähigkeiten des Kindes, diese Situation zu bewältigen (vgl. Wustmann Seiler 2012, S. 76 f.). Der Kern einer traumatischen Erfahrung liegt also darin, dass das Kind das Ereignis als zu bedrohlich einschätzt, als dass es dieses in irgendeiner Weise kontrollieren könnte. Dies verdeutlicht, dass die Intensität der Erfahrung vor allem davon abhängt, wie (in)effektiv das Kind seine Handlungsmöglichkeiten einschätzt und somit nicht nur von den objektiven, situativen Umständen bestimmt wird. Dementsprechend muss nicht jedes belastende Lebensereignis zu einer Traumatisierung führen. Erst durch die persönliche Reaktion auf die Situation, welche durch intensive Gefühle der Hoffnungs- und Hilflosigkeit gekennzeichnet ist, kann eine traumatische Erfahrung entstehen.
Die Umstände, welche zu einem solchen Erleben führen, können sehr unterschiedlich sein, da die individuelle Reaktion auf den Stressor maßgeblich davon abhängt, wie das Kind auf der Basis seiner Vorerfahrungen und seines Selbstbildes seine Bewältigungsmöglichkeiten einschätzt. Die bisherigen Erfahrungen und daraus resultierende bzw. erlernte Strategien haben also unter anderem einen wesentlichen Einfluss darauf, ob die Stresssituation als unkontrollierbar erfahren wird und dadurch eine psychopathogene Wirkung entfaltet.
3.1 Klassifikation von Traumaformen
Um einen Überblick über die Ereignisse zu erhalten, welche gegebenenfalls eine traumatische Erfahrung bewirken, wird im Folgenden eine Möglichkeit aufgezeigt, diese grob nach ihren Ursachen zu klassifizieren. In den beiden Diagnosemanualen der ICD-10 und des DSM V wird die traumatische Situation zwar definiert, es wird jedoch nicht zwischen den Verursachern des Traumas unterschieden. In der Fachliteratur wurde deshalb, in Anlehnung an die Arbeit der amerikanischen Trauma- und Gedächtnisforscherin Lenore Terr, eine Kategorisierung von Traumata vorgenommen. Dabei kann zwischen Erfahrungen bzw. Traumata des Typs I und Typs II differenziert werden. Erfahrungen nach Typ I sind Monotraumatisierungen („one single blow“), also einmalige Umstände, welche meist unerwartet eintreten und welche eine Angst um das eigene Leben oder einer nahestehenden Person auslösen. Hierzu zählen neben Unfällen und Naturkatastrophen auch Ereignisse, bei welchen das Kind den Tod eines Angehörigen miterleben muss, aber auch schmerzhafte Operationen können eine solche traumatische Situation darstellen (vgl. Wöller 2006, S. 12 f.). Traumatisierungen nach Typ II hingegen umfassen multiple bzw. chronische Traumata. Anhand der Definition wird bereits deutlich, dass es sich hier, in Abgrenzung zum Trauma Typ I, um andauernde oder sich wiederholende Ereignisse handelt. Es besteht also eine Häufung von belastenden Erfahrungen, welche, jede für sich, eventuell kaum bzw. nicht zwangsläufig traumatisierenden Charakter haben. Durch die Kumulation jedoch und die langfristig belastenden Umstände, birgt ein Trauma nach Typ II ein höheres Belastungspotential als ein Trauma des Typs I (vgl. Fischer/Riedesser 2009, S. 151). Wenn Kinder nicht gerade in Kriegsgebieten leben und dadurch in chronisch traumatisierenden Umständen aufwachsen müssen, beschreiben Traumata nach Typ II vor allem Beziehungstraumatisierungen. Dies sind Umstände, in denen das Kind durch Misshandlungs- oder Vernachlässigungssituationen dauerhaft von einer oder mehreren Beziehungspersonen traumatisiert wird. In diesem Zusammenhang ist es zudem wichtig zu erwähnen, dass traumatische Erfahrungen, welche durch Menschen verursacht werden, insgesamt schwerwiegendere Auswirkungen haben und dass die Traumatisierung hier nochmal umso stärker ausfällt, desto näher das Kind dem Täter steht (vgl. Simons/Herpertz-Dahlmann 2008, S. 387). Dies lässt die stark traumatisierende Wirkung von systematischer Kindesmisshandlung durch die Eltern erahnen, wodurch es bei betroffenen Kindern meist zu komplexen Traumafolgestörungen kommt, welche die gesamte kognitive, emotionale und soziale Entwicklung negativ beeinflussen (vgl. Ziegenhain 2010, S. 28 f.). Allerdings können auch Traumatisierungen des Typs I schwerwiegende Folgen haben, je nachdem, wie stark die mit der traumatischen Erfahrung einhergehende neurobiologische Stressreaktion ist. Diese ist von biochemischen und psychologischen Vorgängen im Gehirn gezeichnet, welche den sensorischen Eindrücken erst den bedrohlichen und traumatisierenden Charakter verleihen und bei ungenügenden Bewältigungsmöglichkeiten das Kind nachhaltig beeinflussen.
3.2 Neurowissenschafliche Befunde zur Entstehung von Traumafolgestörungen
In einer Stresssituation setzt das kindliche Gehirn eine Fülle an Prozessen in Gang, welche, je nach Dauer und Ausmaß der traumatischen Erfahrung, Auswirkungen auf die Hirnstruktur und damit auch auf kindliche Denk- und Verhaltensstrukturen haben können. Wenngleich diese Abläufe in ihrer Komplexität hier nicht bis ins Detail erläutert werden können und auch die Forschung noch nicht alle Zusammenhänge eindeutig klären konnte, ist es für das Verständnis von Traumafolgestörungen und den damit einhergehenden Verhaltensveränderungen der Kinder doch unumgänglich, einen Überblick der Funktionsabläufe eines traumabelasteten Gehirns zu geben (vgl. Krüger 2008, S. 34 f.). Zu Beginn der Reaktionskette steht eine einfache Wahrnehmung. Das kindliche Gehirn empfängt also Sinneseindrücke, welche über das Tor zum Bewusstsein, den Thalamus, auf das Gehirn einwirken. Diese bisher unspezifischen Informationen werden vom Thalamus an die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns, weitergeleitet (vgl. Krüger 2012, S. 52). Als Angstzentrum hat die Amygdala die Aufgabe, die erhaltenen Wahrnehmungseindrücke zu bewerten. Wie die Reaktion bei einem Kind verläuft, ist dabei wesentlich abhängig von seinen Vorerfahrungen mit dem Stressor und ggf. vorhandenen Copingstrategien. So können Umstände, welche die Amygdala von einigen Kindern als unkontrollierbare Bedrohung bewertet, bei anderen Kindern kaum eine Reaktion auslösen. In Situationen, welche die Amygdala als bedrohlich einstuft und dem Kind zunächst keine einfache Lösungs- bzw. Bewältigungsstrategie zur Verfügung steht, schlägt die Amygdala Alarm und es werden Mechanismen ausgelöst, welche dem Gehirn beim Umgang mit dem Stress als hilfreich erscheinen (vgl. Hüther 2004, S. 36 ff.).
3.2.1 „Fight or Flight“
In Sekundenbruchteilen prüft das Gehirn, ob sich eine seiner Milliarden Verschaltungen dazu eignet, den wahrgenommenen Stressor zu eliminieren. Es kann vorkommen, dass sich Verschaltungen mit Bewältigungsstrategien im Gehirn befinden, welche zwar geeignet sind, den Stressor zu bewältigen, diese jedoch noch nicht ausreichend oft genutzt wurden und damit noch nicht effizient genug sind, um die Situation routinemäßig zu beantworten und eine Stressreaktion zu vermeiden (vgl. ebd., S. 36 ff.). Während das Gehirn also weiter nach Lösungsmöglichkeiten sucht, wird der gesamte Körper vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzt, für den Fall, dass sich kein anderer Ausweg findet. Dabei greift das Gehirn auf evolutionär angelegte Notfallprogramme zurück, welche auch bei höchster Erregung zur Verfügung stehen. Diese Programme sind darauf ausgelegt, den Körper durch Hormonausschüttungen auf eine Flucht- oder Kampfreaktion vorzubereiten. Das Gehirn bewertet die Situation in diesem Augenblick als unausweichlich und sieht die einzige Lösung in einer Flucht, also darin, sich aktiv der Situation zu entziehen oder in einem Kampf, bei welchem sich das Kind körperlich zur Wehr setzt (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 19 f.). Im Zuge dessen wird die Herz- und Atemfrequenz erhöht und das Blut wird aus der Haut und den Verdauungsorganen in die Muskulatur geleitet (vgl. Levine/Kline 2008, S. 23). Dieses Phänomen ist objektiv beobachtbar, denn durch die Verengung der Blutgefäße in der Haut, wird das gestresste Kind ganz blass, als „hätte es einen Geist gesehen“. Des Weiteren nässen manche Kindern ein, was im Rahmen der Stressreaktion als sinnvolle Funktion gewertet werden kann, da sie den Körper vor einem Kampf oder einer Flucht erleichtert.
Die Veränderungen des Körperzustandes stellen also sicher, dass alle Ressourcen für die Fight or Flight Reaktion zu Verfügung stehen. Sollte das Gehirn jetzt noch eine Anpassungs- oder Vermeidungsstrategie finden, ausprobieren und sollte diese funktionieren, baut der Körper den Stresszustand wieder ab. Das Erlebte wird dann als „kontrollierbare Stresssituation“ bezeichnet (Hüther 2004, S. 33f.).
3.2.2 „Freeze and Fragment“
Findet sich im Rahmen der kontrollierten Stressreaktion keine Lösungsmöglichkeit, ist der kindliche Organismus noch größerem Stress ausgeliefert. Dies führt zu einer unkontrollierbaren Stressreaktion, wobei Verschaltungen im Gehirn aktiviert werden, welche im alltäglichen Denken und Handeln nie zum Einsatz kommen (vgl. ebd., S. 36). Alle dem Kind zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien, inklusive einer Flucht oder eines Kampfes, bieten keine Möglichkeit den Stressor zu eliminieren und es entsteht die für eine traumatische Erfahrung charakteristische Situation – no fight, no flight. Die für eine traumatische Erfahrung typischen Gefühle breiten sich aus – Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Das Kind gerät in die „traumatische Zange“, das Gehirn sieht also keine Möglichkeit mehr, sich der Situation irgendwie zu entziehen, die Bedrohung hingegen ist noch omnipräsent. Der Körper sieht sich gezwungen, in einen Unterwerfungszustand (Submission) zu wechseln. Dabei versucht das Gehirn das psychische Überleben zu sichern und sieht dabei keinen anderen Ausweg, als sich durch eine Veränderung der Wahrnehmungsprozesse von der Situation zu distanzieren. Dabei wird durch die „Freeze and Fragment“-Reaktion zunächst eine Art Lähmung und Betäubung des Organismus eingeleitet (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 20). Dieser Zustand wird durch eine enorm hohe Ausschüttung von Endorphinen erreicht, welche bewirken, dass sich das Angst- und Schmerzempfinden des Kindes deutlich verringert oder komplett aussetzt (vgl. Rothschild 2002, S. 29). Diese Reaktion, so sehr sie die Psyche situativ zu schützen vermag, hat jedoch weitreichende Folgen. Denn während der unkontrollierbaren Stressreaktion steigt die Aktivität der Amygdala weiter an, was dazu führt, dass sie mehr und mehr die Kontrolle im Gehirn übernimmt. Dies hat zur Folge, dass andere Hirnbereiche ihre Aktivität verringern, bis sie diese gänzlich einstellen. So lässt bei einer Übererregung der Amygdala beispielsweise auch der Hippocampus in seiner Funktion drastisch nach (s. Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Hippocampusaktivität bei steigendem Stresslevel (Ruf et al. 2012, S. 125)
Dieses Hirnareal ist zuständig für das Einordnen von Ereignissen in einen zeitlichen und räumlichen Kontext, was es dem Kind ermöglicht Erinnerungen an Geschehnisse in der Vergangenheit richtig einzuordnen (vgl. Rothschild 2002, S. 29). Wenn also das Amygdala-System die Hirnprozesse steuert, der Hippocampus nur noch phasenweise oder gar nicht mehr arbeitet und auch das Frontalhirn sowie das Sprachzentrum ihre Arbeit zeitweise einstellen und nicht mehr an der Reaktion auf das Geschehen beteiligt sind, wird von einer „primären“ oder „peritraumatischen“ Dissoziation gesprochen (vgl. Huber 2012, S. 51). Dies führt zu Symptomen wie Depersonalisierung und Derealisation, bei denen das Kind seinen eigenen Körper nicht mehr spürt, es sich an der Situation unbeteiligt fühlt und das Gehirn die kindliche Wahrnehmung so verändert, dass die Umgebung als fremd und surreal wahrgenommen wird (vgl. Scherwath/Friedrich, S. 20). Des Weiteren kommt es aufgrund der stark verringerten Leistung des Hippocampus und dem damit einhergehenden Unfunktionalität der regulären ordnenden Aufgaben des Gehirns zur Bildung eines speziellen Traumagedächtnisses. Das peritraumatisch wahrgenommene Geschehen kann nicht in einen sinnvollen Kontext gebracht werden und im Gehirn später nicht in Form einer ohne Weiteres abrufbaren und unverfälschten Erinnerung gespeichert werden. Das Sprachzentrum ist durch die Hormonflut im Körper ebenfalls blockiert, so dass eine Versprachlichung des Geschehens kaum möglich ist. Dadurch kommt es zu einer für die Freeze and Fragment-Reaktion typischen zerstückelten, fragmentierten Speicherung raumzeitlicher Umstände, sogenannter kalter Gedächtnisinhalte (vgl. Besser 2011, S.47). Die Amygdala hingegen ist zuständig für das Abspeichern heißer Gedächtnisinhalte, also Emotionen, Kognitionen und sensorische Wahrnehmungen. Da sie im Gegensatz zum Hippocampus überaktiv ist, kommt es zu einer sehr detaillierten Speicherung dieser heißen, emotionsbeladenen Inhalte. Das Traumagedächtnis ist somit der Grund für die Diskrepanz zwischen den unterschiedlich intensiven Erinnerungen, welche in Bezug auf das Trauma bestehen. Während Fragen zum situativen Kontext, also zum Wo, Wie und Was, nur unzureichend beantwortet werden können, haben sich die Emotionen regelrecht ins Gedächtnis eingebrannt und werden detailliert erinnert (vgl. Ruf et al. 2012, S. 125).
Diese biologische Freeze and Fragment-Funktion bietet der Psyche also einerseits Schutz vor unabwendbaren und überwältigenden Sinneseindrücken, andererseits bildet sie gleichzeitig das Potential für tiefgreifende Störungen, da dem Kind die Grundlage für eine effektive Aufarbeitung entzogen wird. Vor allem kleinere Kinder müssen sich vermehrt der Situation „ergeben“, da sie weder über ausreichend kognitive Bewältigungsstrategien noch über die körperlichen Möglichkeiten verfügen, sich aktiv durch Bewegung der Situation zu entziehen, wodurch eine Flucht oder Kampf unmöglich sind oder zumindest als unmöglich empfunden werden. Zudem hat die Freeze and Fragment-Reaktion neben der Bildung des fragmentierten Traumagedächtnisses noch ein weiteres Manko, welches entscheidend zur Bildung von Traumafolgestörungen beiträgt. Bei Traumatisierungen wird auch von „unterbrochenen Handlungen“ gesprochen. Gemeint ist, dass die Fight-or-Flight-Reaktion, also die Handlungsimpulse, der Situation etwas entgegenzusetzen, nicht möglich sind und durch die Erstarrung und Dissoziation unterbrochen werden. Die Energie, welche für Flucht oder Kampf zur Verfügung gestellt wurde und nicht entsprechend genutzt werden konnte, baut sich jedoch nicht einfach ab. Es bildet sich ein „Traumaschema“, welches diese Handlungsansätze speichert und wie alle sensomotorischen Schemata zur Wiederholung drängt. Der Körper strebt also danach, die unterbrochenen Handlungsimpulse wieder aufzunehmen, um diese zu vollenden (vgl. Schmitz/Peichl 2009, S. 176 f.). Dieses Vollendungsstreben kann sich in Kombination mit der spezifischen Speicherung des Erlebten im Traumagedächtnis im Laufe des traumatischen Prozesses in schwerwiegenden Folgestörungen niederschlagen und somit nicht mehr nur auf neurobiologischer Ebene, sondern auch auf der Verhaltensebene zu Veränderungen führen.
4 Traumafolgestörungen: Bewältigungsstrategie des Gehirns
Kinder, deren Gehirn durch traumatisches Situationserleben geprägt wurde, nutzen bereits erlernte und entwickeln neue, individuelle Bewältigungsstrategien, um mit diesen Erfahrungen umzugehen. Die Plastizität des Gehirn sorgt dafür dass, je häufiger die peritraumatischen Überlebensstrategien genutzt werden, synaptische Verknüpfungen verstärkt werden, welche nach und nach diese Strategien in das Verhaltensrepertoire des Kindes übergehen lassen (vgl. Hüther 2002, S. 67 f.). So werden nicht nur neue Denkwege gebahnt und effizienter gemacht, sondern durch die langanhaltenden Stresszustände werden auch alte Verknüpfungen aufgelöst, wenn diese sich in der Stresssituation als unbrauchbar erweisen. Dies führt dazu, dass es bei den Kindern zu völlig unbekannten Denk- und Verhaltensschemata kommen kann (vgl. Schwerwath/Friedrich 2012, S. 22). Diese Schemata, welche vorwiegend intuitiv angewendet werden, nützen dem Kind jedoch fast ausschließlich in Situationen, in welcher es dem initialen Stressor ausgesetzt ist. Diese Kinder sind häufig außerstande, angemessene Lösungsstrategien zu finden, wenn sie sich in einer unbekannten Situation wiederfinden und greifen daher automatisch auf ihre „bewährte“ traumatisch geprägten Stressbewältigungsstrategien zurück (vgl. Hüther 2002, S. 81). Dies kann bei sozialen Kontakten mit Peers oder Erwachsenen zu Einschränkungen und Problemen führen, da diesen der Entstehungskontext dieser Verhaltensmuster nicht bewusst ist. Berücksichtigt man jedoch die neurobiologischen Abläufe bei einer unkontrollierbaren Stressreaktion, so wird deutlich, dass die Regulations- und Veränderungsprozesse im Gehirn einen für das psychische Überleben notwendigen Ablauf darstellen. Sie sind also aus der Angst und Hilflosigkeit entstandene Bewältigungsstrategien, welche nun in anderen Kontexten krankhaft und vermeintlich unangepasst wirken (vgl. Krüger 2012, S. 55). Traumafolgestörungen sollten jedoch ganz im Gegenteil als eine komplexe Adaption und normale Reaktion auf in hohem Maße überfordernde Umstände gewertet werden, welche dem Zweck dienen, kindliche Stressregulationsdefizite auszugleichen, um größeren Schaden zu verhindern.
4.1 Störungsbildung
Wie das Gehirn auf stark belastende Situationen reagiert, wurde im Rahmen der neurobiologischen Abläufe erläutert. Dadurch wurde deutlich, dass die Abläufe im Gehirn auch bei unterschiedlichen Stressoren grundsätzlich einem bestimmten Ablauf folgen. Ebenso kann für die Zeit nach der Traumaexposition ein Schema beschrieben werden, wie sich der Mensch mit solchen Erfahrungen umgeht. Zwar hat jedes Kind seine individuellen Anpassungsstrategien und Verhaltensweisen, es konnte von Horowitz jedoch ein Modell entwickelt werden, welches ganz basal die Reaktionsphasen nach einer traumatischen Situation beschreibt. Bei der „Horowitz-Kaskade“ kann dabei unterschieden werden zwischen einer normalen Stressreaktion, welche nach Durchlaufen der Phasen zu einer gelungenen Verarbeitung und Integration des Geschehenen führt und einer pathologischen Variante, bei welcher dieses Ziel nicht erreicht wird und sich stattdessen langfristige Traumafolgestörungen bilden können1 (vgl. Horowitz/Kaltreider 1995, S. 232). Ob sich nun eine positive Bewältigung der Erfahrung vollzieht, hängt wesentlich davon ab, wie Bezugspersonen auf das verstörte Kind reagieren. Dabei sollte von diesen die Situation realistisch anerkannt werden und dem Kind einerseits nicht das Gefühl gegeben werden, es sei nicht so schlimm gewesen („Indianer kennt keinen Schmerz“, „Stell dich nicht so an“), andererseits sollte die Situation auch nicht dramatisiert werden (Huber 2012, S. 114). Den Kindern sollte also stets das Gefühl vermittelt werden, dass sie mit ihren Emotionen und Affekten respektiert werden, damit sie diese als normales Bewältigungsverhalten verstehen. Bei Verlusten stellt beispielsweise Weinen häufig die erste Reaktion dar, durch welche unter anderem Stresshormone mit der Tränenflüssigkeit aus dem Körper gespült werden. Diese sonst recht entlastende Körperreaktion, bleibt bei traumatisierten Kindern teilweise zunächst einmal aus, denn um zu trauern, muss der Verlust erst einmal realisierst werden (vgl. Krüger 2012, S. 23). Direkt nach der Exposition ist das kindliche Gehirn jedoch zunächst noch in einem Schockzustand. Die Kinder sind völlig überwältigt von den Emotionen und im Zuge der unkontrollierbaren Stressreaktion können sie verstört und durcheinander auftreten. Dies hängt eng mit der Hirnreaktion zusammen, bei der die Amygdala die primäre Steuerung übernimmt und die ordnenden und raumzeitlichen Einordnungs- und Speicherungsfunktionen des Hippocampus vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Auch können als Folge der peritraumatischen Dissoziation Taubheitsgefühle des Körpers sowie Emotionslosigkeit fortbestehen (vgl. Huber 2012, S. 68). Nach dem ersten Schock tritt eine Phase der Verleugnung auf, bei welcher das Ereignis nicht anerkannt und traumaspezifische Reize gemieden werden. Darauf folgt eine Phase, in der das Gehirn die peritraumatische Dissoziation zu überwinden sucht, wobei es zu einem Wiedererleben peritraumatischer Sinneseindrücke kommt. Die dissoziierten Teile sollen durch das erneute Erleben im Bewusstsein integriert werden. Ein Wechsel zwischen Phasen der Erinnerung und anschließenden Vermeidungsphasen tritt im Rahmen dieses Bewältigungsprozesses häufig auf, es ist also kein linear voranschreitender Prozess (vgl. Wöller 2006, S. 14). Diese Verarbeitung des erlebten braucht Zeit, wobei diese posttraumatische Belastungsreaktionen zugleich sehr aufwühlend für das Kind sein können, da traumatische Inhalte wiedererlebt werden müssen (vgl. Huber 2012, S. 68). Im Rahmen einer gesunden Verarbeitung kommt es schließlich zu einer Phase des Durcharbeitens, in der sich das Traumaopfer eingehend mit dem Geschehenen auseinandersetzt und sich schließlich davon erholt. In diesem Falle reichen die kindlichen Selbstheilungskräfte also aus, um die andauernde Stressbelastung des Traumas zu überwinden oder es greifen äußere Schutzfaktoren, welche dem Kind eine Aufarbeitung erleichtern und es so zu einem Abschluss kommen kann. Geschieht dies nicht, können sich die anfänglichen akuten Symptome zu einer für die kindliche Entwicklung wesentlich schwerwiegenderen posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 23). Im Rahmen einer pathologischen Reaktion kann es nach Horowitz zu intensiveren Gefühlen von Überwältigung und Panik kommen und anstatt eines letztlich hilfreichen Wiedererlebens von Erinnerungen, kommt es zu einer Überflutung mit Bildern und dadurch auch zu vermehrten Vermeidungsphasen und weiteren Dissoziationen. Einige Kinder können diesem Kreislauf nicht entkommen, so dass eine adäquate Verarbeitung komplett blockiert ist. Statt eines erfolgreichen Abschlusses, aus dem die Kinder gestärkt hervorgehen, entwickeln diese spezifische Strategien, um die Belastung des Traumas zu ertragen und es kommt zu einer Störungsbildung auf verschiedenen Ebenen (vgl. Horowitz/Kaltreider 1995, S. 232 ff.).
Obgleich es im Kontext der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen nicht um eine Diagnosestellung gehen kann und darf, lohnt sich für ein tiefgehendes Verständnis dieser möglichen Traumafolgestörungen doch der Blick auf die Kriterien einer PTBS, wie sie sowohl im ICD-10 als auch im DMS-IV aufgeführt werden. Diese versuchen, die Probleme und Beeinträchtigungen zu beschreiben, welche in Folge eines Traumas auftreten können. Die Kriterien sind jedoch vor allem für Kinder im Vorschulalter (noch) nicht genügend ausdifferenziert, um die Komplexität und die weitreichenden Störungsbilder zu erfassen. Denn Kinder bilden aufgrund ihres Alters und den damit einhergehenden Bewältigungsmöglichkeiten Verhaltensweisen aus, welche von denen erwachsener Menschen einerseits abweichen oder zusätzlich zu diesen auftreten. Im Gegensatz zur ICD-10 hat das DSM-IV versucht, diesen Umstand zu berücksichtigen und einige kindspezifische Symptome in seinen Kriterienkatalog aufgenommen.2
Die Symptombereiche der PTBS, welche Übererregung, wiederkehrende Erinnerungen und das Vermeidungsverhalten umfassen, werden, um in dieser Arbeit eine möglichst vollständige Übersicht zu geben, durch weitere typische Folgestörungen ergänzt, die insbesondere in der Kindheit auftreten können. Auch den Opfern von Beziehungstraumatisierungen wird ein eigenes Kapitel gewidmet, da bei ihnen durch die speziellen Umstände komplexere Folgeerscheinungen auftreten können. Generell gilt jedoch, so individuell wie jedes menschliche Verhalten ist, sind auch die Störungsbilder, so dass selbstverständlich nicht alle Beeinträchtigungen bei allen Kindern auftreten.
4.2 Übererregung
Die Übererregung stellt einen Symptomkomplex dar, welcher verschiedene Ausprägungen haben kann. Maßgeblich kennzeichnend ist hierbei, wie der Name schon erahnen lässt, ein Zustand erhöhter Errregung bzw. des Hyperarousals mit deutlichen Kennzeichen einer dauerhaften Hypervirgilanz, also einer erhöhten Wachsamkeit. Dem liegt zugrunde, dass der kindliche Organismus noch so eingestellt ist, dass in jedem Augenblick etwas passieren könnte. Die Amygdala meldet also dauerhaft Gefahr, was zu einem erhöhten Stresszustand führt und von einer Ausschüttung entsprechender Stresshormone begleitet wird. Dies sieht der Körper vor, um sich auf eine plötzlich eintretende Bedrohung vorzubereiten. Die Hypervirgilanz ist also als Vorsichtsmaßnahme des Körpers zu werten, welcher der Annahme ist, er müsse sich vorbereiten und schützen. Die zeitliche Einordnung des Erlebten wird nicht richtig in der Vergangenheit und als tatsächlich vergangenes Ereignis erfasst. Die dauerhafte Überflutung mit Stresshormonen führt jedoch dazu, dass ernsthafte Bedrohungen nicht mehr adäquat von bedenkenlosen Alltagssituationen unterschieden werden können, was das Kind überängstlich und unverhältnismäßig stresssensibel macht (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 24). Des Weiteren zeigt sich diese Übererregung im Schlafverhalten der traumatisierten Kinder. Diese haben häufig Ein- bzw. Durchschlafstörungen. Die Kinder haben zudem Angst ins Bett zu gehen, da dieser Prozess des Entspannens und des Augenschließens mit großer Unsicherheit verbunden ist. Die Kinder können daher in der Einschlafsituation offenes Angstverhalten zeigen und kämpfen gegen den Schlaf an. Außerdem treten verhäuft nächtliche Angstzustände auf, bei denen das Kind unvermittelt aus dem Schlaf aufschreckt. Bei diesem als „pavor nocturnus“ bekannten Phänomen, welches auch bei Kindern ohne Traumaerfahrung vorkommen kann, weinen oder schreien die Kinder panisch, ohne sich beruhigen zu lassen oder Blickkontakt aufzunehmen (vgl. Weinberg 2008, S. 98, 104). Weitere Folgestörungen im Rahmen der Übererregung sind motorische Hyperaktivität sowie Konzentrationsstörungen. Die Kinder haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und verlieren das Interesse, bevor eine Aufgabe zu Ende geführt werden kann. Dies kann solche Ausmaße annehmen, dass das Erscheinungsbild den Symptomen von Kindern mit ADHS ähnelt. In einer Studie wurde festgestellt, dass bei 46% der durch sexuellen Missbrauch traumatisierten Kinder die Diagnose ADHS gestellt wurde. Inwieweit hier Zusammenhänge bestehen, ist jedoch noch strittig. Es ist also bisher unklar, ob eine Traumatisierung die Wahrscheinlichkeit einer ADHS erhöht, ob ADHS als starke Ausprägung der Übererregungssymptomatik im Rahmen eines Traumas gewertet werden muss oder ob die Kausalität andersherum besteht und hyperaktive Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden (vgl. Streeck-Fischer 2006, S. 81). Eine weitere Ausprägung der traumainduzierten Übererregung sind Symptome der erhöhten Reizbarkeit, welche sich bis zu Wutausbrüchen steigern können. So können Kinder, welche über ein eher ruhiges Gemüt und eine effektive Emotionsregulation verfügten, plötzlich (auto-) aggressiv bzw. oppositionell auftreten. Die traumatische Erfahrung kann also auch negativen Einfluss auf die Impulskontrolle des Kindes haben. Schon objektiv betrachtete Kleinigkeiten können bei dem Kind große Panik auslösen, so wie beispielsweise ein unerwartetes Auftauchen im Blickfeld des Kindes eine überdurchschnittliche Schreckreaktion nach sich ziehen kann. Auch kann es beim Kind verstärkt zu Ängsten kommen, die zum einen traumaspezifisch zum anderen aber ohne ersichtlichen kausalen Zusammenhang auftreten können, wie beispielsweise eine plötzliche Angst vor Dunkelheit. Symptome der Übererregung sind für das Kind, wie auch für sein soziales Umfeld, nur schwer zu ertragen, da sie großen Einfluss auf das Beziehungsgefüge haben. Wutausbrüche und Hyperaktivität gelten vornehmlich als negatives und unerwünschtes Verhalten, wodurch die Kinder oft von ihrem sozialen Umfeld ausgegrenzt werden. Dadurch tritt bei dem Kind zusätzlich Stress auf, wodurch die Situation noch verstärkt wird (vgl. Krüger 2012, S. 35). Außerdem wird das kindliche Selbstwertgefühl, welches bei traumatisierten Kindern insgesamt häufig negativ eingestellt ist, durch die Ablehnung von Peers und Erwachsenen zusätzlich bestätigt, was sich wiederum negativ auf die Resilienz des Kindes und seine weiteren Bewältigungsmöglichkeiten auswirkt.
4.3 Intrusionen
Ein weit verbreitetes Symptom, welches bei traumatisierten Kindern auftreten kann, ist geprägt durch das ungewollte Wiedererleben der traumatischen Situation in Träumen oder in der Erinnerung. Diese bergen, wie auch die Übererregung, ein hohes Belastungspotential und das Auftreten liegt außerhalb jeglicher Kontrolle des Kindes. Die wiederkehrenden Erinnerungen, die Intrusionen oder auch Alpträume werden dabei als äußerst real empfunden und von intensiven Emotionen und körperlichen Stresszuständen begleitet (vgl. Bonekamp 2011, S. 464). Dabei haben die Alpträume bei Kindern meist keinen wiedererkennbaren traumatischen Inhalt. Im Gegensatz dazu sind Intrusionen deutlich geprägt von traumatischen Bildern und Erinnerungen, wobei hier noch zwischen sogenannten Intrusionen und Flashbacks differenziert wird. Bei Intrusionen werden die Betroffenen von ihren Erinnerungen eingeholt und es drängen sich Gedanken und Gefühle auf, während Flashbacks den Charakter haben, dass sich die Trauma-opfer für einen Moment so fühlen, als seien sie aktuell und real wieder inmitten der traumatischen Situation (vgl. Eckhardt 2005, S. 107). Wie auch bei der Übererregungssymptomatik besteht das Hauptproblem hier darin, dass das Gehirn nicht zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit unterscheiden kann, was auf die verminderte Aktivität des Hippocampus während der Traumasituation zurückzuführen ist. Flashbacks dieser Art sind bei Kindern jedoch noch äußerst selten (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 25; vgl. Simons/Herpertz-Dahlmann 2008, S. 387).
4.3.1 Trigger
Bei einer intrusiven Symptomatik werden die Erinnerungen mit einhergehenden intensiven Körpergefühlen meist durch Schlüsselreize ausgelöst. Diese Trigger werden nicht zwangsläufig bewusst wahrgenommen, sind jedoch im Gehirn eindeutig mit dem Trauma verknüpft und lösen deshalb die Alarmreaktion aus (vgl. Krüger 2012, S. 36). Vor allem bei chronischen Traumatisierungen des Typs II kommt es überdies zu einem Hypersensibilisierungsprozess bestimmter Hirnareale. Dieser als „Kindling-Phänomen“ bezeichnete Prozess hat weitreichende Folgen, da hier die Erregungsschwelle des Gehirns auf ein so niedriges Niveau sinkt, dass bereits kleinste, unbewusste Trigger genügen, um in den Betroffenen traumaspezifische Inhalte und Gefühle auszulösen (vgl. Wöller 2006, S. 51). Die Aufnahme eines solchen Triggers kann auf allen Ebenen der Wahrnehmung erfolgen, nicht nur visuell und auditiv, sondern auch gustatorisch, taktil, kinästhetisch oder olfaktorisch (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 25 f.). Behavioral gleicht dieses Reiz-Reaktions-Schema einer klassischen Konditionierung, ähnlich wie bei den Pawlowschen Hunden. Das kindliche Gehirn hat gelernt, auf bestimmte Stimuli mit einer Stressreaktion zu reagieren und diese Verknüpfung bleibt langfristig bestehen. So können traumaspezifische Verhaltensweisen und heiße Gedächtnisinhalte ausgelöst werden, auch wenn aktuell keine reale Bedrohung vorliegt. Bereits der Geruch eines bestimmten Parfums, eine Bewegung des Körpers oder eine Berührung auf der Haut können als unterschwellige Trigger dienen. Diese lösen im Kind starke körperliche oder emotionale Reaktionen aus, welche jedoch aufgrund der fragmentierten Speicherungsprozesse und der Splitterbildung im Gehirn während der Freeze and Fragment-Reaktion nicht in den Gesamtkontext eingeordnet werden können, sodass der Zusammenhang zur ursprünglichen traumatischen Situation nicht bewusst wird. Die Reaktion kann dabei Körperzustände wie Schwitzen und einen erhöhten Puls beinhalten, bis hin zu Zittern, Schwindel, Panikattacken sowie Übelkeit oder Taubheit. Auch können entsprechend des Vollendungsstrebens des Gehirns die intendierten und unterbrochenen Handlungsimpulse aus der traumatischen Situation abgerufen werden, wie beispielsweise Kampfhandlungen (vgl. ebd., S. 26). Diese werden durch den Schlüsselreiz augenblicklich aktiviert und vermitteln dem Kind das Gefühl, es müsse gegen eine Bedrohung ankämpfen bzw. fliehen. Die umfangreichen Folgen, die ein solcher Trigger auf das emotionale und neurobiologische Gleichgewicht hat, liegen in der Neustrukturierung des Gehirns während des Traumas begründet. Die heißen Gedächtnisinhalte des Kindes werden durch die emotionale Betroffenheit und die überaktive Amygdala eng mit den auslösenden Reizen verknüpft. Vor allem durch multiple und chronische Traumatisierungen werden diese synaptischen Verschaltungen verstärkt, da das Kind immer wieder auf die archaischen Überlebensreaktionen zurückgreifen muss. Durch die starke Verknüpfung und durch die Wiederholungen automatisiert das Kind die Reaktionen, auf die es dann später im Kontakt mit dem Trigger reflexartig zurückgreift (vgl. Besser 2011, S. 44). Dabei werden dann die tief verwurzelten heißen Gedächtnisinhalte abgerufen und die Kinder spüren erneut die hilflosen Gefühle und Ängste, welche sie bereits in der traumatischen Situation überfordert haben. All diese intrusiven Symptome sind zwar ein Versuch des Körpers, das Erlebte endlich zu Ende zu bringen und zu verarbeiten, jedoch ist dies für Kinder enorm belastend und aufwühlend. Daher kommt es im Rahmen dieses traumatischen Prozesses zu einem ständigen Wechsel zwischen Intrusionen und einer erneuten Verdrängung der Traumainhalte bzw. zu dissoziativen Zuständen, welche das Kind entlasten sollen (vgl. Wöller 2006, S. 14 f.).
4.3.2 Traumatisches Spiel
Ein für Kinder besonders typisches Verhalten ist das Wiedererleben und Erinnern des Traumas im Spiel. Dieses traumatische Spiel zeichnet sich durch besonders monotone, sich wiederholende Verhaltensweisen aus, welche oft auch rituellen Charakter haben können (vgl. Simons/Herpertz-Dahlmann 2008, S. 38). In dieser pathologischen Form des Als-Ob-Spiels reinszenieren die Kinder repetitiv Szenen der traumatischen Erfahrung. Dieses traumageprägte Spielverhalten ist jedoch wenig phantasievoll. Während sich das kindliche Als-Ob-Spiel für gewöhnlich langsam bis zu einem Höhepunkt oder mehreren Höhepunkten steigert, setzt das traumatische Spiel ohne Einleitung direkt am Konflikt an und wiederholt es ohne inhaltliche Entwicklung. Diese Spielform unterstützt die Kinder auch nicht in der Regulation und Bewältigung ihrer Angst, vielmehr kommt es im Verlauf sogar zu einer Steigerung von Angst und Verzweiflung. Diese kann ein solches Ausmaß annehmen, dass das Spiel abrupt abgebrochen wird und das Kind in einen dissoziativen Zustand wechselt, um sich vor den überwältigenden Empfindungen zu schützen (vgl. Weinberg/Hensel 2012, S. 152). Auch wenn das traumatische Spiel häufig dazu führt, dass das Kind sich mehr zurückzieht und einen abwesenden, unpartizipatorischen Eindruck macht, muss es doch als verzweifelter Versuch gesehen werden, sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen. Es kann also als ein positives Zeichen gewertet werden, da es den Kindern bis zu einem gewissen Grad gelingt, einen Teil des Traumas zu externalisieren und damit ein Verarbeitungsprozess beginnen kann (vgl. Riedesser 2012, S. 168 f.). Vor allem für jüngere Kinder, deren Sprachentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, bietet das traumatische Spiel eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Gefühle auszudrücken, weshalb in der Kindertraumatherapie diese Spielform oft aufgegriffen und in einer therapeutischen Form zur Verarbeitung und Integration des Erlebten genutzt wird.
Generell sind alle Arten des Wiedererlebens traumatischer Inhalte zunächst als normaler Verarbeitungsprozess anzusehen. Erst bei einem länger anhaltenden Störungsbild, wobei eine Aufarbeitung durch intensive Verdrängung verhindert wird, gilt es als pathologisch. Die Reinszenierungen im kindlichen Spiel können auf die „Theorie der Meisterung“ zurückgeführt werden, mit welcher bereits Freud sinngemäß die kindliche Neigung zum steten Wiederholen der traumatischen Erfahrungen begründet hat. Diese Theorie besagt, dass das Kind einem gewissen Wiederholungszwang unterliegt, bei welchem das Gehirn versucht, die durch die peritraumatische Dissoziation unverarbeiteten Wahrnehmungen nachträglich aufzuarbeiten und somit die Situation in der Wiederholung zu bewältigen. Horowitz zufolge gilt dieses Wiederholen bzw. Wiedererleben des Traumas durch Reinszenierungen und Intrusionen neben der dissoziativen Symptomatik als wichtigste Anpassungsreaktion auf überfordernde Belastungsereignisse (vgl. Freud 1926, S.39; vgl. Wöller 2006, S. 453).
4.4 Vermeidungsverhalten und Dissoziation
Als Gegenstück zu den eher stressbelasteten Zuständen der Übererregung und des Wiedererlebens kann die Vermeidung (Konstriktion) gesehen werden. Sie fungiert gewissermaßen als entlastender Gegenpol, zielt also auf eine Beruhigung des Kindes ab, indem sie das Gehirn vor der andauernden bzw. wiederkehrenden Überforderung schützt (vgl. Krüger 2012, S. 39). Dabei zeigen sich beim Kind Verhaltensweisen, durch die teils unbewusst, teils absichtlich Umstände vermieden oder zu vermeiden versucht werden, welche es an die traumatische Situation erinnern oder die mit dieser in Zusammenhang stehen. Dazu zählen unter anderem das Vermeiden von Orten oder Menschen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen und gegebenenfalls Stresszustände auslösen. Bei einem Kind, welches beispielsweise von einem Auto angefahren wurde, ist es möglich, dass es in Zukunft versucht, den Straßenverkehr zu meiden. Ein körperlich misshandeltes Kind hingegen könnte eine generelle Abwehrhaltung gegenüber Körperkontakt entwickeln. Auch ein genereller sozialer Rückzug kann eintreten, das Kind zieht sich also stark aus seinem Umfeld zurück. Des Weiteren beinhaltet der Symptombereich der Konstriktion auch das automatisierte Herbeiführen dissoziativer Zustände, also eine Wahrnehmungs- und Bewusstseinsveränderung, wie sie auch schon peritraumatisch auftreten kann (vgl. Scherwath/Friedrich 2012, S. 28). Grundsätzlich sind das Dissoziieren, ebenso wie das dazugehörige Pendant, das Assoziieren, ganz gewöhnliche Funktionen, welche vom Gehirn andauernd vorgenommen werden. Bei jedem Sinneseindruck, den der Körper registriert, assoziiert das Gehirn automatisch, fügt also Informationen oder Eindrücke zusammen und dissoziiert diese wieder, wobei bestimmte Eindrücke wieder aussortiert werden. Dies wird von Teilen des Gehirns übernommen, die darüber entscheiden, welcher Input zu unwichtig oder zu heikel ist. Es werden folglich zunächst alle Eindrücke der Umwelt aufgenommen und in Sekundenbruchteilen trennt das Gehirn die in diesem Moment signifikanten Elemente vom Rest, um sie mit bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten zu verknüpfen. Dieses unwillkürliche Dissoziieren ist überlebensnotwendig, damit das Informationsbearbeitungssystem durch die Reizüberflutung, die aufgrund der Mengen an Wahrnehmungseindrücken entsteht, welche sekündlich auf unser Nervensystem treffen, nicht überfordert wird (vgl. Huber 2012, S. 54). Im Kontext einer kindlichen Traumatisierung kann die Dissoziation es dem Kind ermöglichen, psychisch zu überleben. Wie zuvor beschrieben, kann durch die Freeze and Fragment-Reaktion eine Dissoziation in Form einer Depersonalisierung oder Derealisierung ausgelöst werden. Ebenso sorgt der Ausfall des Hippocampus zum Teil für eine dissoziative Amnesie, so dass dem Kind Teile kalter Gedächtnisinhalte oder gar die komplette Erinnerung an das Geschehen fehlen (vgl. Krüger 2012, S. 39). Neben diesem peritraumatischen Auftreten, kann eine Dissoziation aber auch postexpositorisch die Psyche des Kindes schützen. Durch Belastungen wie eine dauerhafte Übererregung, traumatisches Spiel, Intrusionen und das ständige Wiedererleben heißer Gedächtnisinhalte kann das Gehirn erneute Dissoziationen nutzen, um den Organismus zu entlasten. Dabei variiert das Ausmaß der dissoziativen Zustände individuell zwischen einer nur leichten Abwesenheit bis hin zu einer Art Trance, bei der das Kind auch auf Ansprache nicht reagiert. In jedem Fall bietet die Dissoziation dem Kind eine Möglichkeit belastende Emotionen und Intrusionen für den Moment zu bewältigen, indem das komplette Spektrum oder Teilbereiche seiner menschlichen Empfindungen und Wahrnehmungen gezielt abgespalten werden. Insbesondere bei Beziehungstraumata neigen Kinder dazu die intensiven Gefühle der Wut, Scham und Angst einzufrieren, so dass sie sich dieser nicht mehr bewusst sein müssen. Dies hilft der Psyche zunächst bei der Bewältigung der Überlastung, auf lange Sicht bergen diese dissoziativen Zustände jedoch eher eine Gefahr für die psychische Gesundheit. Beispielsweise können sich beim Kind Probleme ergeben sich und seinen Körper angemessen wahrzunehmen oder spontane Gefühle zu empfinden. Zudem wurde festgestellt, dass die Schwere der entwickelten Traumafolgestörungen unter anderem davon abhängig ist, wie stark die peritraumatische Dissoziation ausgeprägt war (vgl. Eckhardt-Henn/Hoffmann 2004, S. 268).
Eine hohe peritraumatische Dissoziationsneigung fördert also die Entwicklung von Folgestörungen und führt aufgrund des Vollendungsstrebens und des Drangs die Situation endgültig zu meistern vermehrt zu Intrusionen mit Wiederaufnahme von Kampfhandlungen und Reinszenierungen. Diese wiederum belasten das Kind so sehr, dass es sich erneut mit Hilfe von dissoziativen Zuständen schützen muss. Welche weiteren Folgen sich aus dieser Dissoziationsneigung ergeben können und wie sie die Grundlage für tiefgreifende Persönlichkeitsstörungen im Jugend- und Erwachsenenalter darstellt, wird in einem der folgenden Kapitel im Rahmen von Beziehungstraumatisierungen erläutert.
4.5 Weitere typische Entwicklungsbeeinträchtigungen
Neben den Symptomkomplexen des Wiederlebens, der Konstriktion inklusive Dissoziation sowie der Übererregung, gibt es weitere Traumafolgestörungen, welche insbesondere bzw. ausschließlich bei Kindern auftreten und die Gesamtheit kindlicher Entwicklungsprozesse negativ beeinflussen. Als eine für Kinder besonders typische Entwicklung ist hier zunächst die Regression zu nennen. Diese muss als unbewusster Versuch des Kindes verstanden werden, zu einer sicheren, prätraumatischen Entwicklungsphase zurückzukehren (vgl. Riedesser 2012, S. 169). Regression kann sich in verschiedenen Verhaltensweisen widerspiegeln, beispielsweise nuckeln die Kinder wieder am Daumen, nässen ein (Enuresis), vergessen bereits Gelerntes, verlieren soziale Kompetenzen, selbst die Sprachentwicklung kann auf ein früheres Niveau zurückfallen (vgl. Krüger 2008, S. 52). Dabei kann dieses Verhalten immer auch als Bemühung gesehen werden, die Fürsorge einer Bindungsperson zu erlangen. Dies erklärt sich ein Stück weit dadurch, dass das Bindungssystem durch die Traumatisierung und die wiederkehrenden Ängste und Belastungen übermäßig aktiv ist, während der Explorationsdrang dem Bedürfnis nach Sicherheit nachrangig ist. Durch regressives Verhalten soll dann die Aufmerksamkeit der Eltern erregt werden. Manche Kinder entwickeln aufgrund des großen Bindungsbedürfnisses nach einem Trauma eine intensive Trennungsangst und beginnen zu klammern. So sichern sie sich permanent die Beachtung ihrer Bindungsperson statt sich kindlicher Exploration hinzugeben. In diesem Zusammenhang ist bei Kindern auch zu beobachten, dass sich ihre Interessen nach einem Trauma verändern können. So kann es zu Einschränkungen und Veränderungen im Spielverhalten des Kindes kommen, sie gehen also Aktivitäten, welche sie früher favorisiert haben, nun nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr nach (vgl. Huber 2012, S. 104; vgl. Weinberg 2010, S. 15). Das veränderte Spielverhalten kann auch auf eine sensomotorische Entwicklungsretardierung hindeuten, welche bei schwer traumatisierten Kleinkindern vorkommen kann. Diese kann größtenteils auf die peritraumatische Dissoziation zurückgeführt werden, bei der die Kinder das Empfinden für ihren Körper verlieren. Bleibt dieser Zustand länger bestehen, kann es zu Gleichgewichtsstörungen sowie zu motorischen Problemen kommen, insbesondere bezüglich der Koordination und des Muskeltonus. Ebenso wird von visuellen und akustischen Wahrnehmungsdefiziten berichtet. All diese Einschränkungen können gleichwohl dazu führen, dass es den Kindern zusätzlich schwer fällt, ihr übliches Spielverhalten wieder aufzunehmen. Des Weiteren kann sich die extreme Belastung auf das kindliche Stressregulationsverhalten auswirken, welches bei gesunden Kindern auch viel im Spiel erfolgt. So finden traumatisierte Kinder teilweise keinen Weg sich und ihre Anspannung herunterzuregulieren und beginnen beispielsweise an ihren Nägeln oder Haaren zu kauen, sich diese auszureißen, kratzen sich stellenweise blutig oder sie zeigen anderes selbstverletzendes Verhalten, schlagen etwa den Kopf gegen die Wand, beißen sich oder aber versuchen, sich durch ein rhythmisches Wiegen ihres Körpers oder durch Kopfschaukeln selbst zu beruhigen. Diese Verhaltensweisen müssen allesamt als pathologische Selbstberuhigungstrategien gewertet werden, welche aus der Überlastung der Bewältigungsstrategien sowie dem Fehlen entlastender Einflüsse resultiert. Des Weiteren haben traumatisierte Kinder teilweise somatische Beschwerden, für die sich keine Ursache finden lässt. Diese können sich z.B. durch Magenschmerzen, Hautirritationen, Autoimmunreaktionen oder plötzlich neu auftretendes Asthma zeigen (vgl. Huber 2012, S. 104; vgl. Weinberg 2010, S. 15). Weitere Folgen einer traumatischen Erfahrung können außerdem intensive Schuldgefühle und der Verlust von Vertrauen in die Verlässlichkeit der Welt des Kindes sein, was wiederum Auswirkungen auf die emotionale und psychische Entwicklung hat. Bei Kindern, welche beispielsweise miterleben mussten, wie eine ihnen nahestehende Person verletzt wird oder diese gar stirbt, können mit der vermeintlichen Schuld kämpfen, das Ereignis nicht verhindert zu haben. Diese Schuldgefühle helfen dem Kind gewissermaßen, die Ausweglosigkeit und die Ohnmacht der unabwendbaren Situation zu ertragen. Selbst wenn kein erkennbarer Zusammenhang zwischen dem Handeln des Kindes und dem Unfall besteht, fühlen sich die Kinder oftmals verantwortlich. Indem sie sich einreden, der Unfall wäre gar nicht erst passiert, wenn sie sich selbst anders verhalten oder interveniert hätten, können sie die Angst vor einem erneuten traumatischen Ereignis eindämmen. So kommen sie zu der Überzeugung, dass sie, wenn sie das nächste Mal schneller oder anders reagieren, eine solche Katastrophe abwenden können und empfinden sich weniger machtlos (vgl. Krüger 2012, S. 44, 68 f.). Vor allem im Kindergartenalter, in welchem sich die Kinder in der präoperationalen Phase nach Piaget befinden, herrscht eine magische Denkweise vor, wodurch die Kinder der Überzeugung sind, sie könnten durch ihre Gedanken oder Wünsche Sachverhalte beeinflussen. So schreiben einige Kinder sich nicht nur Schuld zu, dass sie einen Unfall oder Tod nicht verhindert haben, sondern sie können sich ursächlich dafür verantwortlich halten, was gravierende Auswirkungen für das Selbstbild haben kann. Die Schuld kann auch anderen Personen zugeschrieben werden, wie den Bezugspersonen, welche das Unglück auch nicht aufhalten konnten. In dieser Hinsicht sind Traumatisierungen der frühesten Kindheit auch im gewissen Maße Beziehungstraumatisierungen, da den Kinder das Vertrauen verloren geht, dass die Eltern oder überhaupt Erwachsene Sicherheit und Schutz vermitteln können. Betroffenen Kinder begegnen ihren Eltern häufig zunächst nur zögerlich und unsicher, teilweise auch mit Abneigung oder gar Aggressionen, was als Folge des vermeintlichen Vertrauensbruches der Eltern eine normale Reaktion darstellt (vgl. Krüger 2008, S. 42 ff., 79).
An dieser Stelle müssten noch viele weitere Aspekte genannt werden, welche vor allem auf Opfer von Beziehungstraumata zutreffen. Kinder mit Erfahrungen von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung haben neben den bisher bereits genannten mit noch wesentlich komplexeren Störungsbildern und stärkeren Einschränkungen im sozial-emotionalen Bereich zu kämpfen. Um die vielfältigen Zusammenhänge dieser trauma-basierten Beeinträchtigungen verständlich darzustellen, wird im Folgenden zunächst auf das Thema Bindung eingegangen sowie auf kindliche Bedürfnisse und Beziehungserfahrungen. Erst auf dieser Grundlage können die speziellen beziehungsabhängigen Traumafolgestörungen dieser Kinder betrachtet werden.
5 Trauma und Bindung
Im Rahmen seiner Bindungstheorie hat John Bowlby das evolutionär angelegte menschliche Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit beschrieben, welches bei belastenden oder bedrohlichen Situationen auftritt. Die Bindung eines Kindes zu seiner Bezugsperson dient also einem bestimmten Zweck, nämlich dem Schutz des Kindes (vgl. Bowlby 2009, S. 21). Demzufolge darf im Rahmen dieser Arbeit das Thema Bindung nicht vernachlässigt werden, zumal eine traumatische Erfahrung für das Kind in höchstem Maße eine Situation darstellt, in welcher es durch die äußeren Umstände und die inneren Reaktionen stark belastet wird und es Sicherheit und Schutz benötigt, um seine Emotionen zu regulieren. Daher sind Traumata und Bindung thematisch eng miteinander verknüpft. Problematisch kann diese enge Verbindung dann werden, wenn die Bezugsperson selbst den Auslöser dieser Bedrohung darstellt. Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, werden im Folgenden zunächst kurz die Grundlagen der Bindungsentwicklung umrissen, um anschließend zu erläutern, wie sich eine Traumatisierung auf das Bindungsverhalten eines Kindes auswirken kann.
5.1 Effekte von Bindungssicherheit: Emotionsregulation und Mentalisierung
Das kindliche Bindungsverhalten entwickelt sich insbesondere in den ersten Lebensjahren, wobei dieses entscheidend durch die Interaktion und Erfahrungen mit seinem primären sozialen Umfeld geprägt ist. Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, ob bei seinen Bezugspersonen ein eher sicheres oder ein unsicheres oder gar desorganisiertes Bindungsverhalten vorliegt. Im Idealfall haben die Eltern aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ein sicheres internes Arbeitsmodell von Bindung entwickelt, was es ihnen nicht nur ermöglicht, eine stabile Partnerschaft mit gegenseitiger Wertschätzung und Respekt aufzubauen, sondern auch, sich dem Kind gegenüber feinfühlig zu verhalten. Feinfühlige Eltern erkennen die Signale ihres Säuglings schnell und reagieren darauf prompt und in adäquater Art und Weise (vgl. Brisch 2012a, S. 105). Die Signale des Kindes sind Ausdruck seines Bindungsverhaltens, welches unter Stressbedingungen aktiviert wird, also in Situationen, in welchen sich das Kind unsicher oder unwohl fühlt, in denen es sich erschreckt, es Schmerzen hat oder auch, wenn es ermüdet oder hungrig ist. Dieses Bindungssystem ist angeboren, ebenso wie erwachsene Menschen über ein entsprechendes angeborenes Verhalten verfügen, welches sie im Umgang mit Babys ein Stück weit steuert. Menschen sind biologisch darauf gepolt, sich einem Kind gegenüber in einer Art und Weise zu verhalten, dass sich eine Bindung aufbauen kann, beispielsweise Ammensprache gehört hier im Rahmen des „Bondings“ dazu. Zeigt das Kind Bindungsverhalten, besteht die Aufgabe der Bindungsperson dann darin, dem Kind, welches aktiv nach Nähe sucht, mit trostspendendem und rückversicherndem Verhalten zu begegnen (vgl. Bowlby 2009, S. 22; vgl. Huber 2012, S. 88). Konkret helfen die Eltern ihrem Kind durch ihr angemessenes und feinfühliges Verhalten also dabei, seine Erregungszustände wie Unsicherheit oder Angst zu regulieren und bringen dem Kind so auch langfristig bei, seine Erregungen selbst du regulieren (vgl. Van der Kolk 2000, S. 172). Mit dem kindlichen Bindungsverhalten ist jedoch nicht nur die Emotionsregulation stark verbunden. Auch das Explorationsverhalten steht dazu untrennbar in Relation. Ist das Kind sicher gebunden, geht es für gewöhnlich seinem Explorationsdrang nach, also dem lustvollen und neugierigen Erkunden und dem Auseinandersetzen mit seiner (sozialen) Umwelt. Dies kann es aufgrund seiner positiven Erfahrungen mit seinen Bezugspersonen, aus denen die Gewissheit resultiert, bei ihnen, wenn nötig, Rückhalt zu bekommen. Die feinfühligen Eltern übernehmen also die Rolle des „sicheren Hafens“, zu dem das Kind nach einer Explorationsphase zurückkehren kann (vgl. Brisch 2012a, S. 105 f.). Auf diesem Vertrauen, dass die Eltern verlässlich Halt und Sicherheit geben, baut sich bei Kindern für gewöhnlich ebenfalls ein positives inneres Bindungsarbeitsmodell und damit eine sichere emotionale Beziehung zu seinen Eltern auf. Zwar resultiert dieses Arbeitsmodell aus den Bindungserfahrungen mit der primären Bezugsperson, jedoch steuert es langfristig die Erwartungen und das Verhalten auch außerhalb des familiären Kontextes. Das vorliegende Bindungsmuster wird also auf andere Beziehungsgestaltungen übertragen (vgl. ebd., S. 106). Des Weiteren haben die Eltern eine tragende Rolle bei der Entwicklung der kindlichen Mentalisierungsfähigkeit. Zunächst kann das Kind noch nicht zwischen innerer und äußerer Realität unterscheiden sowie eigene psychische Vorgänge reflektieren, geschweige denn die Handlungen seines sozialen Umfeldes auf deren psychische und kognitive Prozesse zurückführen. Es ist also in dem Glauben, dass seine inneren Zustände der äußeren Realität entsprechen und umgekehrt. Im Alter von vier Jahren vollzieht sich dann eine Entwicklung und sicher gebundene Kinder erwerben den Reflexionsmodus, welcher es ihnen ermöglicht, Zusammenhänge zwischen ihrer inneren und der äußeren Realität zu erkennen, über die vermuteten mentalen Zustände anderer Menschen und vor allem auch über ihre eigenen nachzudenken (vgl. Leuzinger-Bohleber 2009, S. 114 f.). Eine bedeutsame These dazu postuliert, dass die Fähigkeit zur Mentalisierung aus der Bindungsbeziehung zu der Bezugsperson entsteht. Konkret geschieht dies unter anderem bei der Affektspiegelung, welche den meisten Müttern von Geburt ihres Kindes an als Kommunikationsmittel dient (vgl. Fonagy 2009, S. 109). In der Interaktion spiegelt die Mutter die emotionalen Zustände und Affekte des Kindes und macht ihm diese unter Nutzung von kindgerechter Sprache, Gestik und vor allem Mimik deutlich. Dadurch lernt das Kind, sich selber wahrzunehmen und sich als intentionales und unabhängiges Individuum zu begreifen (vgl. Fonagy et al. 2008, S. 350).
Aus einer solchen sicheren Eltern-Kind-Bindung ergeben sich dementsprechend immense sozial-emotionale und kognitive Entwicklungsvorteile für das Kind. Vor allem, da die Eltern als erste Sozialisationsinstanz fungieren und somit den Grundstein für alle weiteren Entwicklungsprozesse legen, ist eine sichere Bindung zu den Eltern für das Kind von elementarer Bedeutung. Durch die Interaktionen innerhalb dieser ersten sicheren Beziehung wird dem Kind vermittelt, dass es liebens- und beachtenswert ist. Es erfährt sich selbst als kompetent und selbstwirksam, was zu einem positiven Selbstbild beiträgt. Anders verhält es sich, wenn es der Bezugsperson z.B. aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen nicht möglich ist, die Bindungsbedürfnisse des Kindes richtig zu erkennen und intuitiv darauf zu reagieren. Stattdessen weisen einige Eltern diese wiederholt zurück oder reagieren gar nicht auf das aktivierte Bindungsverhalten des Kindes. Folglich erlebt das Kind, dass die Bindungsperson emotional nicht verfügbar ist und erfährt sich so als nicht beachtenswert und selbstunwirksam, woraufhin eine unsicher-vermeidende Bindungsstrategie ausgebildet wird. Vermeidend deshalb, da das Kind versucht, die Bezugsperson möglichst wenig zu beanspruchen, um so die elterliche Zurückweisung zu vermeiden. Stattdessen lernt es mit Belastungen mehr oder weniger gut alleine zurechtzukommen. Demgegenüber steht die sogenannte unsicher-ambivalente Bindungsstrategie, die sich beim Kind ausbildet, wenn es häufig feststellen muss, dass es sich nicht auf die Bindungsperson verlassen kann. Statt feinfühlig und responsiv verhält sich diese zeitweise auch abweisend und beantwortet das Bindungsbedürfnis des Kindes nicht immer in adäquater Art und Weise. Das Kind reagiert darauf mit übersteigerten Affekten, um sicherzugehen, die Aufmerksamkeit der Bindungsperson zu erlangen (vgl. König 2012, S. 61 f.). Die unsicher-vermeidende wie auch die unsicher-ambivalente Bindungsstrategie sind im Kontext der erlebten Interaktion mit der Bindungsperson für das Kind durchaus sinnvolle Adaptionen an die gegebenen Umstände. Neben diesen organisierten Strategien gibt es jedoch auch Kinder mit hochunsicherem Bindungsmodell, welches sich grundlegend von den vorher genannten Strategien unterscheidet. Dies trifft vornehmlich auf Kinder zu, deren Bindungserfahrungen so belastend und unverlässlich sind, dass sich daraus überhaupt keine organisierte Strategie ableiten lässt. Sie wird daher als desorganisiert bezeichnet (vgl. ebd., S. 62 f.)
5.2 Desorganisiertes Bindungsmodell
Der frühkindliche Bindungsaufbau wird zunehmend komplex, wenn sich die Interaktionsbedingungen für das Kind verschlechtern. Dies trifft vor allem dann zu, wenn es den Eltern selbst nicht möglich war, effektive und organisierte Bindungsstrategien zu entwickeln, beispielsweise aufgrund von unverarbeiteten Traumata in der eigenen Kindheit. Forschungen zur Interaktion zwischen Säuglingen und ihren Eltern haben in diesem Zusammenhang ergeben, dass ungelöste Traumata und Defizite im Bindungsverhalten seitens der Eltern Einfluss auf die Kommunikation mit ihrem Kind nehmen (vgl. Papoušek/Wollwerth de Chuquisengo 2012, S. 137). So hat beispielsweise eine Mutter, deren Bindungsmodell in der eigenen Kindheit durch ein Beziehungstraumata erschüttert wurde, oftmals Schwierigkeiten als sichere Bindungsperson aufzutreten und sich dem Kind gegenüber feinfühlig und angemessen zu verhalten. Traumatisierte Eltern tendieren dazu, ihren Kindern mit einer aggressiv-feindseligen Interaktion zu begegnen, welche das Kind verängstigt. Auch neigen solche Eltern eher zu Überforderung und fühlen sich zeitweise hilflos, wodurch das Kind keine konstanten Erfahrungen bezüglich ihrer Verlässlichkeit als Bindungsperson machen kann. Es treten bei diesen Eltern Abwehrmechanismen auf, welche von ihrem inneren Bindungsarbeitsmodell ausgelöst und gesteuert werden. Einige dieser Mechanismen sind unter anderem Verdrängung, Verleugnung, Projektionen eigener Erfahrungen auf das Kind bis hin zu dissoziativen Verhaltensweisen. Diese machen es beispielsweise der Mutter quasi unmöglich, das Kind, seine Affekte, Emotionen sowie sein Verhalten realistisch wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Denn das Interaktionsverhalten zwischen Mutter und Kind ist zwar biologisch angelegt, die praktische Umsetzung und der Erfolg dieser intuitiven Kommunikation, ist schlussendlich doch abhängig vom psychischen Zustand der Bezugsperson (vgl. Leuzinger-Bohleber 2009, S. 115 ff.). Des Weiteren tendieren traumatisierte Eltern dazu, im Rahmen ihrer eigenen Traumafolgestörung ihre Bindungserfahrungen zu reinszenieren, wodurch die eigentlich angelegte intuitive Feinfühligkeit in der Interaktion mit dem Kind gestört wird. Entsprechend wirkt sich diese dysfunktionale Kommunikation zwischen Eltern und Kind auf die Entwicklung seiner Mentalisierungsfähigkeit aus. Denn eine adäquate Affektregulation geschieht nicht nur durch körperliche Nähe, sondern größtenteils auch durch die feinfühlige Interaktion mit dem Kind und dem Ausdruck bzw. der Verdeutlichung seines emotionalen Zustandes durch die Bezugsperson. Wenn das Kind negative Affekte zeigt, kann es vorkommen, dass z.B. die Mutter diese nicht spiegeln kann. Das kann daran liegen, dass sie sich durch diese bedroht fühlt, wenn bei ihr selbst traumatische Erinnerungen getriggert werden. Komplementär dazu gibt es auch Mütter, welche die negativen Affekte ihres Kindes überdeutlich spiegeln, was durch eine Projektion bzw. Verwechslung mit eigenen Vorerfahrungen auftreten kann. Dieses Verhalten wirkt auf das Kind stark beängstigend und um dies in die kindliche Weltsicht integrieren zu können und weiterhin überhaupt noch Nähe zur Mutter aufrechterhalten zu können, muss das Kind seine Reflexionsfähigkeit opfern, damit es sich nicht mehr in die Mutter einfühlen muss (vgl. ebd., S. 115 f.). Dies kann also als Anpassungsstrategie des Kindes verstanden werden, da es zum Selbstschutz seine Reflexionsfähigkeit aufgibt, um die Bindungsperson nicht als tatsächliche Bedrohung erleben zu müssen. Allerdings hat dieses Kind dann in anderen Beziehungskontexten ebenfalls eine mangelhafte Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und deren Perspektiven einzunehmen. Auch die eigenen Gefühle können nur schlecht reflektiert, geschweige denn ausgedrückt werden (vgl. Weinberg 2010, S. 15). Ähnlich ergeht es Kindern, welche in Vernachlässigungsverhältnissen aufwachsen und kaum Interaktion erleben, in der die kindlichen Zustände gespiegelt werden könnten. Insgesamt haben die Kinder traumatisierter Eltern also kaum Möglichkeiten, eine sichere Bindung aufzubauen, da die Eltern ihnen mit ängstigendem, hilflosem oder widersprüchlichem Verhalten begegnen, wodurch keine verlässlichen Erfahrungen von ihnen als sichere Basis gemacht werden können. Ganz im Gegenteil, die Interaktion mit der Mutter und oder dem Vater wird für das Kind zu einer unberechenbaren Quelle von Angst und gleichzeitig von potentieller Sicherheit (vgl. Brisch 2012a, S. 108).
[...]
1 Anhang I zeigt die „Phasen normaler und pathologischer Reaktion auf belastende Lebensereignisse“ nach Horowitz/Kalkreider (1995)
2 Anhang II zeigt eine „Gegenüberstellung der Diagnosekriterien des DSM IV und der ICD-10“
- Arbeit zitieren
- Philippa Pohlmann (Autor:in), 2014, Traumafolgestörungen bei Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920629
Kostenlos Autor werden


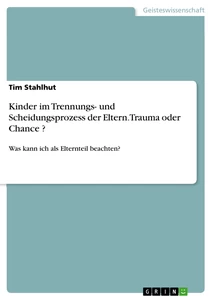



















Kommentare