Leseprobe
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1: Mathematik
1.1 Streit um das Wesen der Mathematik
1.1.1 Mathematik als Unterrichtsgegenstand
1.1.2 Erste Erkundungen
1.2 Die Wurzeln der Mathematik
1.2.1 Stochern im Nebel der Zeit
1.2.2 Zahlgefühl - Zählen - Zahl
1.2.2.1 Das Zahlgefühl
1.2.2.2 Paarweise Zuordnung
1.2.2.3 Herausbildung des Zahlbegriffs
1.2.3 Mystik - Magie - Religion
1.2.3.1 Zahlen und das Gesetz der Berührung
1.2.3.2 Geometrie und das Gesetz der Ähnlichkeit
1.2.3.3 Zwei Sichtweisen
1.3 Die Entwicklung der Mathematik
1.3.1 Algorithmische Mathematik
1.3.1.1 Die Entstehung der ersten Hochkulturen
1.3.1.2 Mathematik in Ägypten
1.3.1.3 Mathematik in Mesopotamien
1.3.1.4 Mathematik in Indien
1.3.1.5 Mathematik in China
1.3.1.6 Mathematik in Süd- und Mittelamerika
1.3.2 Axiomatische Mathematik
1.3.2.1 Ein entscheidender Schritt
1.3.2.2 Die ionische Periode
1.3.2.3 Die athenische Periode
1.3.2.4 Die hellenistisch / alexandrinische Periode
1.3.2.5 Die Periode des Niedergangs
1.3.2.6 Angewandte und „reine“ Mathematik bei den Griechen
1.3.2.7 Darstellung der axiomatischen Methode nach Aristoteles
1.3.3 Mathematik im Untergrund
1.3.4 Die Wiedergeburt der Mathematik
1.3.4.1 Die Umstände der Geburt
1.3.4.2 Vom Abakus zur Algebra
1.3.5 Mathematik in Bewegung
1.3.5.1 Gesellschaftliche Bewegung
1.3.5.2 Naturwissenschaftliche Bewegung
1.3.5.3 Mathematische Bewegung
1.3.6 Grundlegende Mathematik
1.3.6.1 Die industrielle Revolution
1.3.6.2 Die Spaltung der Mathematik
1.3.6.3 Grundlagenforschung in der Analysis
1.3.6.4 Grundlagenforschung im Bereich der Zahlsysteme
1.3.6.5 Grundlagenforschung in der Geometrie
1.3.6.6 Grundlagenforschung in der Logik
1.3.6.7 Die Mengenlehre
1.3.7 Mathematik in der Krise
1.3.7.1 Grundlagenkrise?
1.3.7.2 Die Antinomien der Mengenlehre
1.3.7.3 Logizismus
1.3.7.4 Formalismus
1.3.7.5 Die Strukturmathematik des Bourbakikreises
1.3.7.6 Intuitionismus
1.3.7.7 Welche Grundlagenkrise?
1.3.8 Auf dem Weg in die Zukunft
1.3.8.1 Computerisierung
1.3.8.2 Die Informationsgesellschaft
1.3.8.3 Entwicklungen in der Wissenschaft
1.3.8.4 Entwicklungen in der Mathematik
1.4 Mathematik und Anwendung
1.4.1 Angewandte und „reine“ Mathematik in der geschichtlichen Entwicklung
1.4.1.1 Vorgeschichtliche Zeit
1.4.1.2 Zeit der frühen Hochkulturen
1.4.1.3 Griechische Antike
1.4.1.4 Mittelalter und Renaissance
1.4.1.5 Barock und Aufklärung
1.4.1.6 Das Zeitalter der Industrialisierung
1.4.1.7 Industriezeitalter bis heute
1.4.2 Kampf um die Vorherrschaft
1.4.2.1 Die Argumente der „reinen“ Mathematiker
1.4.2.2 Die Argumente der anwendungsorientierten Mathematiker
1.4.2.3 Der ideologische Kern der Auseinandersetzung
1.4.3 Symbiose
1.4.4 Was für eine Wissenschaft ist die Mathematik?
1.5 Was ist Mathematik - Ansichten im Überblick
1.5.1 Im Dschungel philosophischer Sichtweisen
1.5.2 Schneisen im Dschungel
1.5.2.1 Logizismus, Formalismus, Bourbakismus und Intuitionismus
1.5.2.2 Platonismus, Empirismus, Konventionalismus und Konstruktivismus
1.5.2.3 Der Stellenwert mathematischer Wahrheit
1.5.2.4 Entdecker und Erschaffer
1.5.3 Schlingpflanzen
Kapitel 2: Wirklichkeit
2.1 Wirklichkeit in der Philosophie
2.1.1 Der Wirklichkeitsbegriff
2.1.2 Ontologische Wirklichkeitskonzeptionen
2.1.2.1 Materialismus
2.1.2.2 Idealismus
2.1.2.3 Dualismus
2.1.3 Epistemologische Wirklichkeitskonzeptionen
2.1.4 Die konstruktivistische Alternative
2.1.4.1 Wissen und Wirklichkeit
2.1.4.2 Metaphysischer Realismus
2.1.4.3 Radikaler Konstruktivismus
2.1.4.4 Konstruierte Wirklichkeit
2.1.4.5 Die biologische Argumentationslinie
2.1.4.6 Verschiedene Spielarten konstruktivistischen Denkens
2.1.4.7 Sozialer Konstruktivismus
2.1.4.8 Konstruktivistische Ansätze in Pädagogik und Didaktik
2.1.5 Konstruktivismus und Mathematik
2.2 Lebenswirklichkeit
2.2.1 Die Welt in der wir leben
2.2.2 Der Nutzen der Mathematik
2.2.2.1 Nutzen der Mathematik für den Einzelnen
2.2.2.2 Nutzen der Mathematik für die Gesellschaft
2.2.2.3 Sicherung und Weiterentwicklung der Mathematik
Kapitel 3: Didaktik
3.1 Vergangenheit
3.1.1 Die Weitergabe von Wissen
3.1.2 Die „Meraner Reformbewegung“
3.1.3 Das „traditionelle“ Sachrechnen
3.1.4 Kritik des „traditionellen“ Sachrechnens
3.1.5 Die „neue“ Mathematik
3.1.6 Kritik der „neuen“ Mathematik
3.1.7 Ausgewogener Mathematikunterricht
3.2 Gegenwart
3.2.1 TIMSS das Schreckgespenst
3.2.2 Der Bildungs- und Lehrplan für die Realschulen in Baden-Württemberg
3.2.2.1 Didaktische Grundsätze des Bildungsplans
3.2.2.2 Schwerpunktsetzungen im Lehrplan Mathematik
3.2.2.3 Der Inhalt des Lehrplans und die Probleme der Renaissance
3.3 Zukunft
3.3.1 Folgerungen aus der Untersuchung des Unterrichtsgegenstands
3.3.2 Folgerungen aus der Untersuchung der Bedürfnisse der Schüler
3.3.3 Folgerungen aus der Untersuchung des unterrichtlichen Kontextes
3.3.4 Schluß
Nachwort
Anhang I: Literaturverzeichnis
„Tatsächlich beruht, ob man das nun wahrhaben will oder nicht, alle mathematische Pädagogik ... auf einer Philosophie der Mathematik.“[1]
Rene Thoms
Einleitung
„Mathematik und Wirklichkeit. Von den Wurzeln der Mathematik zu einer Didaktik des Sachrechnens.“ - Der Titel dieser Arbeit gibt ein Thema vor, das einen weiten Bogen spannt; einen Bogen, den man im Blick behalten muß, will man sich nicht in den interessanten und reizvollen Einzelheiten verlieren, die sich entlang des Weges finden. Dieses Thema spannt aber nicht nur einen weiten Bogen, es läßt sich auch von vielen Seiten aus betrachten. Ein Mathematiker wird anders an das Thema herangehen als ein Naturwissenschaftler, ein Philosoph anders als ein Historiker. Mein eigener Zugang, als Student einer Pädagogischen Hochschule und zukünftiger Realschullehrer, wird nochmals ein anderer sein.
Die angewandte Mathematik übersetzt Probleme der wirklichen Welt in mathematische Probleme, löst die mathematischen Probleme und überträgt schließlich die Lösungen wieder auf die Wirklichkeit.[2] Das Sachrechnen bezeichnet die Umsetzung angewandter Mathematik in der Schule. Je nach didaktischer Konzeption bezieht es sich dabei nur auf einen relativ eng umgrenzten Bereich angewandter Mathematik oder auf die angewandte Mathematik ganz allgemein.[3] Es spielt seit jeher eine wichtige Rolle im Mathematikunterricht.
Stärker als ein Mathematikunterricht, der sich mit Bereichen der reinen Mathematik befaßt, steht der Sachrechenunterricht in ständiger Wechselwirkung mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten und muß sich mit der Gesellschaft ändern und weiterentwickeln. Das macht ihn besonders reizvoll und zu einer immer neuen Herausforderung für Mathematikdidaktiker und -lehrer. Das große Echo und die Diskussion, die die Veröffentlichung der TIMSS-Studie im letzten Jahr auslöste - eine breit angelegte empirischen Studie, die den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht in verschiedenen Ländern vergleicht - belegte dies eindrucksvoll. Deswegen habe ich mich entschieden, meine wissenschaftliche Hausarbeit dieser Thematik zu widmen.
Meine Verantwortung als zukünftiger Lehrer sehe ich darin, meinen Unterricht so zu gestalten, daß dadurch für die Schüler der größtmögliche Nutzen entsteht. Dadurch bin ich mit einer ganzen Reihe von Fragen konfrontiert:
Was ist wichtig für meine Schüler?
- Wie können die Inhalte des Faches Mathematik den Schülern helfen?
- Welches ist die günstige Weise, den Schülern diese Inhalte zu vermitteln?
Im Unterricht sind Objekt, Subjekt und Tat - der Unterrichtsgegenstand, die Schüler, die unterrichtet werden und die Tätigkeit des Unterrichtens selbst - eng miteinander verknüpft. Um die Fragen, die sich mir stellen, sinnvoll diskutieren zu können, sind deswegen verschiedene Informationen notwendig.
- Ich muß etwas über die Sache wissen, die ich unterrichte.
- Ich muß etwas über die Schüler und die Welt wissen, in der sie leben.
- Ich muß etwas darüber wissen, wie Mathematikunterricht normalerweise abläuft und in welchen Kontext er eingebettet ist.
Wenn ich Informationen zu diesen drei Bereichen habe, kann ich mir überlegen, was am Unterrichtsgegenstand für die Schüler vor dem Hintergrund des Unterrichtskontextes und der Welt, in der sie leben, bedeutsam ist. Ich kann also die Ziele festlegen, die ich mit meinem Unterricht verfolgen will. Schließlich muß ich mir überlegen, wie ich meinen Unterricht am besten gestalte, um diese Ziele erreichen zu können.[4]
Daraus ergibt sich die Struktur meiner Arbeit. Im ersten Kapitel will ich mich zunächst der Frage zuwenden, was Mathematik eigentlich ist. Schaut man sich an, was Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker zu dieser Frage zu sagen haben, so stellt man fest, daß ihre Ansichten zum Teil diametral entgegengesetzt sind. Manche sehen in der Mathematik eine Kunst, die höchste Blüte des menschlichen Geistes und wollen sie allein um des ästhetischen Genusses wegen betrieben sehen. Andere gestehen ihr nur deswegen eine Daseinsberechtigung zu, weil sie auf die Wirklichkeit anwendbar ist. So schreibt der Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851): „Es ist wahr, daß Herr Fourier der Meinung war, daß das Hauptziel der Mathematik im öffentlichen Nutzen und in der Erklärung der Naturvorgänge bestünde; aber ein solcher Philosoph wie er hätte wissen müssen, daß das einzige Ziel der Wissenschaft die Ehre des menschlichen Geistes ist und daß unter diesem Gesichtspunkt ein Problem der Zahlen genauso wertvoll ist wie eine Frage nach dem Bau der Welt.“[5] Um zu verdeutlichen, wie sich so unterschiedliche Standpunkte entwickeln konnten, will ich versuchen, in groben Zügen die Entwicklung der Mathematik von ihren Ursprüngen bis zur Gegenwart nachzuzeichnen. Bei dieser Darstellung soll im Vordergrund stehen, wie sich im Lauf der Geschichte der Mathematik das Spannungsverhältnis zwischen angewandter und „reiner“ Mathematik entwickelte.
Im zweiten Kapitel werde ich mich mit dem Begriff der Wirklichkeit beschäftigen und versuchen aufzuzeigen, in welcher Beziehung er zur Mathematik steht. Dabei möchte ich auch auf die Bedeutung der Mathematik für die Lebenswirklichkeit der Schüler heute eingehen und die Frage erörtern, welche mathematischen Fähigkeiten sie benötigen, um in der heutigen Gesellschaft zu bestehen und welche Fähigkeiten die Gesellschaft den Schülern abverlangen muß, um ihre eigene Existenz zu sichern.
Im dritten Kapitel untersuche ich auf welche Weise Mathematik in diesem Jahrhundert in Deutschland unterrichtet wurde, in welcher Weise man dabei die angewandte Mathematik in den Unterricht integrierte und welche Probleme dabei auftraten. Ausgehend von den Informationen die ich im Verlauf meiner Arbeit über die Mathematik, die Schüler mit ihren Bedürfnissen und den Mathematikunterricht gesammelt habe, werde ich schließlich Vorschläge zur Verbesserung der im Bildungs- und Lehrplan für die Realschulen in Baden-Württemberg fixierten Konzeption von Mathematikunterricht machen.
Ich hoffe, es ist mir mit meiner Arbeit gelungen, einen Überblick über Material zu geben, das sich normalerweise über viele Bücher verteilt findet: Bücher über Mathematikdidaktik, Mathematikgeschichte, Philosophie der Mathematik, Wissenschaftstheorie, Soziologie und so fort. - Material, das in Büchern über die Didaktik und Methodik des Sachrechnens häufig auf wenigen Seiten abgehandelt oder gar nicht erwähnt wird, das mir aber dennoch für die Planung von Sachrechenunterricht relevant zu sein scheint. Möge diese Arbeit den Leser erfreuen und ihm, so er Lehrer ist, bei der Gestaltung seines Unterrichts von Nutzen sein.
„Ohne die Mathematik dringt man niemals auf den Grund der Philosophie. Ohne die Philosophie dringt man niemals auf den Grund der Mathematik. Ohne beide kommt man auf den Grund von gar nichts.“[6]
Gottfried Wilhelm Leibniz
Kapitel 1: Mathematik
1.1 Streit um das Wesen der Mathematik
1.1.1 Mathematik als Unterrichtsgegenstand
Es wird wohl jeder zustimmen, daß ein Lehrer etwas von den Dingen verstehen sollte, die er unterrichtet. Nun unterrichtet ein Mathematiklehrer des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland Mathematik und nicht die Philosophie der Mathematik. Was sein Wissen über Mathematik betrifft, so ist er durch eine mehr oder weniger normierte Lehrerausbildung in aller Regel in ausreichendem Maße damit ausgestattet - zumal er ja nur das zu unterrichten braucht, was ihm Lehrplan und Schulbuch vorgeben, sich also über die Auswahl des Stoffes keine Gedanken machen muß. Welche Bedeutung soll da die Frage nach dem Wesen der Mathematik für den Mathematiklehrer noch haben?
Zuerst einmal ist der Lehrplan keineswegs statisch. In den letzten 50 Jahren erfuhr der Lehrplan im Fach Mathematik zweimal einschneidende Veränderungen. Einmal, als die sogenannte „neue“ Mathematik eingeführt und einmal, als sie größtenteils wieder aus dem Lehrplan entfernt wurde.[7]
Dem Lehrer bleiben außerdem, innerhalb des Rahmens, den ihm der aktuelle Lehrplan vorgibt, erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten. Er kann zur selben Thematik vollkommen unterschiedliche Unterrichtsgänge zusammenstellen, in denen er ganz verschiedene Schwerpunkte setzt. Er kann Wert darauf legen, daß die gemeinsamen mathematischen Strukturen, die hinter verschiedenen Aufgaben stehen, für die Schüler sichtbar werden. Er kann es aber auch vorziehen, den Schülern Rezepte an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie immer wiederkehrende Standardaufgaben lösen können. Er kann so unterrichten, daß immer wieder die Probleme oder die Möglichkeiten, die mit einer zunehmenden Mathematisierung der Welt verbunden sind, deutlich hervortreten. Oder, was leider immer wieder vorkommt, er kann einfach drauflos unterrichten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, warum er so unterrichtet und nicht anders. Welchem didaktischen Ansatz - oder Unansatz - ein Lehrer folgt, hängt von seinem Verständnis von Mathematik ab, auch wenn er sich dessen nicht bewußt ist. Er kann didaktische Entscheidungen aber erst dann wirklich zielgerichtet treffen, wenn er sich aktiv mit diesem Verständnis beschäftigt und es auf seine Angemessenheit hin prüft.
Es gibt also für den Mathematiklehrer zahlreiche Entscheidungen zu treffen, für die ein bloßes Wissen über die Verfahren der Mathematik, wie sie für gewöhnlich im Lehramtsstudium gelehrt werden, keinen ausreichenden Hintergrund liefert. Um diese Entscheidungen wirklich fundiert treffen zu können, muß er sich Fragen stellen wie: Was ist eigentlich Mathematik? Mit welchen Gegenständen befaßt sie sich? Mit welchem Ziel wird sie betrieben? In welchem Verhältnis steht sie zu anderen Wissenschaften; in welchem Verhältnis zu gesellschaftlichen Veränderungen?[8]
Daß diese Fragen selten, viel zu selten gestellt werden, scheint mir ein Zeichen dafür zu sein, daß mit der Mathematikdidaktik in Deutschland etwas im Argen liegt und ich möchte mich Dieter Volk anschließen, wenn er schreibt: „[...] daß didaktische Entscheidungen immer auch eine wissenschaftstheoretische Komponente enthalten; daß didaktische Entscheidungen ohne wissenschaftstheoretische Entscheidungen nicht möglich sind.“[9]
1.1.2 Erste Erkundungen
Bei dem Versuch, Antworten auf die Fragen zu finden, die, wie ich eben erörtert habe, Einfluß auf die Gestaltung des Unterrichts haben sollten, stößt man recht schnell auf Probleme, die John D. Barrow so beschreibt: „Halten Sie einen Biologen oder Historiker auf der Straße an und fragen ihn, was sein Fach ist; er wird keine Probleme haben, es zu erklären. Und wenn Sie keinen finden können, sehen Sie sich ein einführendes Lehrbuch zur Biologie oder Geschichte an; es wird Ihnen ungefähr auf der ersten Seite erklären, worum es dabei geht. Aber wenn sie einen Mathematiker auf der Straße fragen, wird er Ihnen nicht sagen können, was Mathematik ist. Nehmen Sie jedes beliebige Lehrbuch oder gehen Sie in eine beliebige Mathematikvorlesung - was Mathematik ist, werden sie nicht erfahren.“[10]
Nun ist die Situation nicht ganz so extrem, wie Barrow sie schildert; in der einschlägigen Literatur finden sich etliche Äußerungen von Mathematikern zu ihrem Fach, ja es finden sich sogar ganze Bücher mit Titeln wie: „Mathematiker über die Mathematik“[11] oder „Denkweisen großer Mathematiker“[12], allein sie helfen uns nicht viel weiter, eher im Gegenteil. Man muß bald erkennen: „Die Denkweisen der Großen in der Mathematik sind durchaus verschieden.“[13]
Da es mir, wie ich bereits erläutert habe für einen Mathematiklehrer durchaus relevant zu sein scheint, von der Mathematik mehr zu kennen, als einige Standardmethoden, und da es, wie ein erster Blick in die Literatur mir gezeigt hat, keine allgemein akzeptierten Antworten auf die oben umrissenen Fragen gibt, möchte ich versuchen, diese Antworten im ersten Kapitel meiner Arbeit selbst zu finden. Zu diesem Zweck werde ich die Mathematikgeschichte von der vorgeschichtlichen Zeit bis heute exzerpieren. Dabei möchte ich vor allem das Wechselspiel zwischen gesellschaftlicher, naturwissenschaftlicher und mathematischer Entwicklung aufzeigen; aber auch so weit als möglich darstellen, in welchem Bewußtsein die Mathematiker verschiedener Zeiten Mathematik betrieben. In diesem Zusammenhang will ich mich auch der Frage zuwenden, in wie fern eine Trennung in „reine“ und angewandte Mathematik von den Mathematikern verschiedener Zeiten tatsächlich durchgeführt wurde. Diese Frage scheint mir im Hinblick auf den Mathematikunterricht, in dem man stets gezwungen ist, die „richtige“ Balance zwischen Fachmathematik und Anwendungsbezug zu finden, von besonderer Bedeutung. Deswegen möchte ich ihn im Anschluß an den auszugshaften Durchlauf durch die Mathematikgeschichte nochmals gesondert diskutieren. Abrunden werde ich das erste Kapitel mit einer systematischen Darstellung der verschiedenen Sichtweisen von Mathematik, die zuvor in ihrem historischen Zusammenhang erörtert wurden.
1.2 Die Wurzeln der Mathematik
1.2.1 Stochern im Nebel der Zeit
„Die Ursprünge der Mathematik liegen im Dunkeln.“[14] Vermutlich lebten die ersten Hominiden[15] vor ungefähr 4 Millionen Jahren in Afrika. Die frühesten Schriftzeichen, die uns überliefert sind, haben ein Alter von circa 6000 Jahren.[16] „Wie die Sprache selbst entwickelte sich der Gebrauch der Zahlen vor der Schrift.“[17] Auf das, was vor dieser Zeit geschah, können wir nur schließen, weil uns Funden von Knochen, Gerätschaften, Waffen, Höhlenmalereien etc. vorliegen.[18] Versucht man, die Entwicklungsstränge der Mathematik so lange in die Vergangenheit zurück zu verfolgen, bis sie sich schließlich ganz im Dunkel der Zeit verlieren, so lassen sich auf Grund der Zeugnisse, die uns vorliegen, zwei Wurzeln vermuten: Das, was Georges Ifrah „Zahlgefühl“[19] nennt und eine mystische, religiöse Erfahrung der Welt, die ihren Ausdruck in der Anwendung von Ritualen fand, die teilweise mathematische Aspekte enthielten.
1.2.2 Zahlgefühl - Zählen - Zahl
1.2.2.1 Das Zahlgefühl
Georges Ifrah zeigt im ersten Kapitel seines Buches „Die Universalgeschichte der Zahlen“ detailliert auf, wie die Entwicklung eines abstrakten Zahlbegriffes vermutlich stattgefunden hat. Da es aus der Zeit, in der diese Entwicklung stattfand, kaum Zeugnisse gibt, beruhen diese Vermutungen auch „auf den Forschungen der Kinderpsychologie und anthropologischen Untersuchungen von Völkern, die sich noch heute auf einem relativ wenig entwickelten intellektuellen Stand befinden.“[20] Ich möchte die Darlegungen Ifrahs hier nur kurz zusammenfassen und gelegentlich mit den Ausführungen anderer Autoren ergänzen.[21]
Grundlage der ganzen Entwicklung ist das sogenannte „Zahlgefühl“, das man sowohl beim Menschen als auch bei einigen Tierarten findet. „Es besteht grob gesagt darin, zwei verschiedene, begrenzte Mengen von Lebewesen oder Objekten jeweils gleicher Art voneinander zu unterscheiden.“[22] Dieses Zahlgefühl kann man leicht an sich selbst erforschen, indem man Abbildungen betrachtet, auf denen verschiedene Anzahlen von Gegenständen willkürlich angeordnet sind. In der Regel ist man in der Lage, „die Zahl einer Ansammlung von Dingen auf einem Bild unmittelbar zu erfassen, wenn die Zahl nicht größer als etwa fünf ist. Ist sie aber größer, müssen wir bewußt zählen.“[23] Das Zahlgefühl war vermutlich „von der Natur der Gegenstände unablösbar“[24], d.h. es war dem damaligen Menschen nicht bewußt, „daß Gesamtheiten wie Tag und Nacht, ein Hasenpaar, die Flügel eines Vogels oder die Augen, die Ohren, die Arme oder die Beine eines Menschen eine gemeinsame Grundeigenschaft haben: das ‘Zweisein’.“[25] Ein Hinweis darauf findet sich in den Sprachen „primitiver“ menschlicher Gesellschaften, in denen oft verschiedene Wörter für die gleiche Anzahl von Dingen verwendet werden, wenn es sich um verschiedene Dinge handelt „- verschiedene Wörter für drei Fische, drei Kanus, drei Menschen, drei Steine, drei Speere.“[26] Auch im Englischen, wo es Ausdrücke gibt wie „a pair of shoes“, „a (musical) duet“, „a brace of pheasants“ und „a couple of lines“, die alle mit unterschiedlichen Worten eine Zweiheit bezeichnen, läßt sich das noch feststellen.[27]
1.2.2.2 Paarweise Zuordnung
Um auch Mengen bestimmen zu können, die mit dem „Zahlgefühl“ nicht mehr erfaßt werden können, „setzen die Völker, die nicht abstrakt zählen können Einheit mit Einheit in Beziehung. Dieser intellektuelle Kunstgriff [...] geht auf den Begriff des Paares zurück und besteht aus der Zuordnung der einzelnen Elemente zweier Mengen zueinander, so daß jedem Element der einen Menge ein Element der anderen entspricht.“[28] Dies war wahrscheinlich der nächste Schritt in der Entwicklung. Barrow nennt dieses Verfahren „Taillieren“ und führt aus: „Ein Schafhirte zum Beispiel kann eine Menge von Steinen in seiner Tasche tragen. Damit stellt er am Ende des Tages fest, ob keines fehlt, indem er für jedes Schaf, das in die Schafhürde geht, einen Stein aus der Tasche nimmt. Wenn kein Stein übrig ist, nachdem das letzte Schaf hineingegangen ist, dann ist alles in Ordnung.“[29] Andere Möglichkeiten zur Taillierung bieten das Kerbholz, auf dem verschiedene Anzahlen in Form von Kerben oder sonstigen Markierungen festgehalten werden und die Glieder des menschlichen Körpers, die wie die Kerben eines Kerbholzes durchgezählt werden können. „Das hat sichtlich den Vorteil, daß jeder das gleiche Bezugssystem hat. Ist die Zahl der Finger erschöpft, zählen manche Völker am Körper entlang weiter [...].“[30]
Durch die paarweise Zuordnung ist es also möglich festzustellen, ob zwei Mengen aus der gleichen Anzahl von Elementen bestehen oder nicht. „Außerdem wird bei der paarweisen Zuordnung ein abstrakter Begriff gebildet, der eine den beiden verglichenen Mengen gemeinsame Eigenschaft bezeichnet, ein Begriff , der von der Natur der gegebenen Gegenstände vollkommen unabhängig ist.“[31] Damit rückte man dem abstrakten Zahlbegriff wieder ein Stück näher. „Im nächsten Schritt kann jeder betrachteten Menge eine Menge zugeordnet werden, die man ‘Hilfsmenge’ nennen könnte. Mit einer solchen ‘Hilfsmenge’ wird es möglich sein, jede Menge von Gegenständen zu beschreiben, wenn sie die gleiche Anzahl von Elementen umfaßt. [...] die paarweise Zuordnung ist damit eine ‘konkrete Messung’ der Quantität einer Menge, unabhängig von der Qualität ihrer Elemente. Die intellektuelle Leistung dieser Abstraktion kann als die Geburtsstunde des abstrakten Zahlenbegriffs gelten.“[32] Ifrah vermutet, daß die Zahlwörter, die diese abstrakten Mengen bezeichneten, aus den Benennungen der Körperteile die zum Abzählen verwendet wurden entstanden und durch häufigen Gebrauch nach und nach ihre „körperliche“ Bedeutung verloren.[33]
1.2.2.3 Herausbildung des Zahlbegriffs
Aber damit war die Entwicklung noch nicht an ihrem Ende. Um das möglich zu machen, was wir heute als Mathematik kennen, mußte auch noch von eben erwähnter Hilfsmenge abstrahiert werden. Dazu war ein rekursives Zahlenverständnis notwendig, das Ifrah so beschreibt: „Jede Zahl der Reihe ganzer Zahlen, mit Ausnahme der Einheit selbst, entsteht dadurch, daß man der ganzen Zahl, die ihr vorangeht, eine weitere Einheit hinzufügt.“[34] Dadurch wird zusätzlich zum kardinalen[35] Aspekt der ganzen Zahlen, der sich auf der schon erwähnten paarweisen Zuordnung gründet, der ordinale[36] Aspekt erschlossen, der ein Verständnis der Folge der natürlichen Zahlen voraussetzt.[37] Dantzig faßt dies sehr schön zusammen: „Wir gehen so leicht von Kardinal- zu Ordinalzahlen über, daß wir diese beiden Aspekte der ganzen Zahl nicht mehr auseinanderhalten. Wenn wir die Anzahl der Gegenstände einer Menge, also ihre Kardinalzahl, bestimmen wollen, suchen wir nicht mehr nach einer Hilfsmenge, mit der wir sie vergleichen können, wir ‘zählen’ sie ganz einfach. Dieser Fähigkeit, die beiden Aspekte der Zahl gleichzusetzen, verdanken wir unsere Fortschritte in der Mathematik. Während uns in der Praxis nur die Kardinalzahl interessiert, kann diese Zahl doch nicht die Grundlage der Arithmetik bilden, da die Rechenarten auf der stillschweigenden Voraussetzung beruhen, daß wir stets von jeder Zahl auf die ihr nachfolgende übergehen können - die Zahl also als Ordinalzahl begriffen wird. Die paarweise Zuordnung allein reicht nicht aus, um zu rechnen; ohne unsere Fähigkeit, die Gegenstände durch die natürliche Zahlenfolge zu gliedern, wäre nur ein sehr geringer Fortschritt möglich geworden. Unser Zahlensystem beruht auf den beiden Prinzipien der Zuordnung und der Rangfolge, die das Gewebe der Mathematik und aller Bereiche der exakten Wissenschaften bilden.“[38] Dieser letzte Schritt der Abstraktion wurde wohl erst im fünften vorchristlichen Jahrhundert in Griechenland ganz vollzogen.[39]
Betrachtet man die Entwicklung des Zählens, so wird deutlich, daß sie ihren Anfang, soweit sich heute sagen läßt, mit einer sehr konkreten Wirklichkeit - mit sehr konkreten Dingen nahm, von denen dann immer mehr abstrahiert wurde, bis der Mensch schließlich den heutigen, abstrakten Zahlbegriff erreichte. Auch die Motivation zu dieser Entwicklung kam aus der Lebenswirklichkeit des Menschen, die dadurch, daß der Mensch fähig wurde zu zählen, besser beherrscht werden konnte. Schon in dieser vorgeschichtlichen Zeit finden sich also die entscheidenden Elemente einer angewandten Mathematik: die Abstraktion, bei der aus den Dingen um uns herum mathematische Strukturen abstrahiert werden und die Konkretisierung, bei der mathematische Strukturen „an speziellen Beispielen von Dingen und Ereignissen konkretisiert werden.“[40]
1.2.3 Mystik - Magie - Religion
Über die Wurzel der Mathematik in der mystischen Erfahrung des Menschen läßt sich noch weniger Sicheres sagen als über die Entwicklung vom Zahlgefühl zum heutigen, abstrakten Zahlbegriff. Dies liegt wohl daran, daß die Rückschlüsse aus der Entwicklungspsychologie und der Anthropologie, die uns halfen, die mutmaßliche Entwicklung des Zahlbegriffes zu rekonstruieren, hier kaum möglich sind. Es bleibt aber dennoch einiges Material, das dafür spricht, daß eine der Wurzeln der Mathematik in einem mystischen Weltverständnis und den damit verbundenen Ritualen zu suchen ist.
1.2.3.1 Zahlen und das Gesetz der Berührung
Es gibt Vermutungen, nach denen dieser mystische Aspekt nicht nur ebenso alt ist wie die ersten Anfänge des Zählens, sondern unter Umständen erst zu seiner Entwicklung geführt hat. „Bemerkenswert ist die Tatsache, daß sich in jenen Systemen, die mit Zahlwörtern für ‘eins’, ‘zwei’ oder auch ‘drei’ und deren Reihungen bis zu Ausdrücken für nicht mehr als ‘zehn’ arbeiten, keine Anzeichen dafür finden, daß sie vom Fingerzählen herkommen. Sie scheinen aus primären Intuitionen und der Erfahrung mit Paarungen zu stammen.“[41] So könnte sich das Zählen also aus Ritualhandlungen „primitiver“ Kulturen entwickelt haben. „Eine verbreitete Form von Fruchtbarkeitsritualen schließt die Paarung von männlichen und weiblichen Tieren oder auch Menschen ein. Dies könnte nicht nur der Ursprung elementarer Zahlenbegriffe sein, sondern auch die Wurzel einiger merkwürdiger, in verschiedenen Kulturen verbreiteter Traditionen wie dem Glauben, daß ungerade Zahlen männlich sind, gerade weiblich oder daß es gewisse Unglückszahlen gibt.“[42]
Auch von der nächsten Stufe des Zählens, dem paarweise Zuordnen, bei dem oft die Finger und weitere Körperglieder als Hilfsmenge verwendet wurden, lassen sich Verbindungen zu einer mystischen Weltsicht ziehen. „Indem die Zahlen bestimmten Körperteilen assoziiert werden, wird es unnötig, sie auszusprechen. Das könnte mit den weit verbreiteten Tabus in Zusammenhang stehen, die auf dem Zählen von Menschen liegen. In vielen alten und neuen Kulturen finden sich Spuren solcher Tabus, so etwa daß es Unglück bringt, seine Kinder zu zählen, sein Geld oder - als König - seine Untertanen.“[43] Möglich ist meiner Ansicht nach auch, daß sich gewisse Glücks- und Unglückszahlen dadurch ergaben, daß sie immer wieder mit Körperteilen in Bezug gesetzt wurden, die man mehr oder weniger hoch schätzte.
Für solche Zusammenhänge sprechen auch anthropologische Untersuchungen über das magische Weltbild „primitiver“ Kulturen. James G. Frazer, der als einer der ersten ausgiebig auf diesem Gebiet geforscht hat, stellt in seinem Buch „Der goldene Zweig“ verschiedene Prinzipien dar, die im magischen Denken immer wieder auftreten. Unter anderem spricht er vom „Gesetz der Berührung.“[44] „Der [...] große Zweig der sympathetischen Magie, den ich Übertragungsmagie genannt habe, geht über zu dem Gedanken, daß Dinge, die einmal verbunden waren, für alle Zeiten, selbst wenn sie völlig voneinander getrennt sind, in einer solchen sympathetischen Beziehung zueinander bleiben müssen, daß, was auch immer dem einen Teil geschieht, den anderen beeinflussen muß.“[45] Die Beispiele, die Frazer im folgenden anführt, beziehen sich zwar ausschließlich auf materielle Dinge, es scheint mir aber einleuchtend, daß diese Art zu denken, auch leicht auf abstrakte Vorstellungen übertragen wurde, z.B. auf Zahlen, die man mit bestimmten Körperteilen assoziierte.
1.2.3.2 Geometrie und das Gesetz der Ähnlichkeit
Auch im Bereich der Geometrie gibt es vieles, was für einen frühen rituellen Gebrauch spricht, der einer mystischen Weltsicht entspringt. Geometrische Strukturen lassen sich an Hand konkreter Quellen zeitlich viel weiter zurückverfolgen als die Zahlen, da sie schon vor der Erfindung der Schrift aufgezeichnet werden konnten. „An Quellen haben wir eine Fülle von verschiedenartigsten Ornamenten mit geometrischen Strukturen - Dreieck, Quadrat, Rechteck, Rhombus, Kreis, Zick-Zack-Linie, spitze und stumpfe Winkel - auf Tongefäßen, auf Waffen, in Flecht- und Webereierzeugnissen.“[46] Aus der hohen rituellen Bedeutung, die geometrischen Formen zu Beginn der geschichtlichen Zeit - vor allem in Indien - zukommt, läßt sich vermuten, daß sie auch in vorgeschichtlicher Zeit schon eine große rituelle Bedeutung besaßen.
„Die Fähigkeiten und Kenntnisse der alten Inder kommen aus religiös-rituellen Wurzeln; in ihrer Kultur boten die Rituale starke Motivationen und noch sehr viel komplexere Aufgaben für das mathematische Denken als die primitiven Fruchtbarkeitsrituale.“[47] So mußten zum Beispiel die Altäre insbesondere der vedischen Tradition nach sehr genauen geometrischen Vorschriften gebaut werden. „Die Vorschriften für die Konstruktion derartiger Altäre waren in den Sulva Sutra kodifiziert, einer Reihe von Büchern, in denen Traditionen zusammengefaßt sind, die zwischen 1000 und 5000 v. Chr. aufgekommen sind.“[48] War es schon schwierig genug, Altäre in der Form von Quadraten, Halbkreisen oder sogar in stilisierten Tierformen, wie der eines Falken zu bauen, so gab es noch größere Herausforderungen: unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. wenn die Götter aus irgendeinem Grund erzürnt schienen, sahen die Vorschriften die genaue Verdoppelung der Fläche des Altares vor.[49] „Um diese Aufgaben lösen zu können, mußten die Priester der Veda Lösungen für eine große Zahl geometrischer Konstruktionsprobleme finden.“[50]
Aber nicht nur die vedische Tradition verwendete in ihren religiösen Zeremonien geometrische Elemente, sondern auch der tantrische Kult, der auf den Tantras beruht. „Die Tantras, eine Reihe von Büchern in Sanskrit, stammen aus dem 6. Jahrhundert n. Chr., beruhen jedoch auf einer älteren Tradition. Teil der meditativen Übung ist die Kontemplation Komplexer Yantras, die den Geist vom Komplizierten zum Einfachen und umgekehrt führen soll.“[51]
Eines der ausgefeiltesten Yantras ist das Sriyantra, das auch den Titel meiner Arbeit schmückt. Der innere Teil, das „Siegel“ des Mantras, besteht aus neun gleichschenklichen Dreiecken, die durch Überschneidungen ein Netz von 43 Dreiecken bilden.[52] “Dieses zentrale ‘Siegel’ ist von konzentrischen Kreisen und Lotusblättern umgeben, die wiederum durch ein Quadrat eingerahmt sind, dessen vier ‘Türen’ in die Unterwelt des Chaos führen. Im Zentrum der Dreiecke befindet sich ein einzelner Punkt, von dem die Meditation ausgeht oder zu dem sie hingeht, je nach dem ob man über die Schöpfung der Ordnung aus dem Chaos meditiert oder über die Entwicklung der Welt vom einfachen Beginn zur großen Komplexität.“[53]
Ließen sich Parallelen vom rituellen Hintergrund der Zahlen und des Zählens zum magischen Gesetz der Berührung ziehen, so scheint die rituelle Verwendung geometrischer Strukturen mit dem magischen „Gesetz der Ähnlichkeit“[54] in Verbindung zu stehen. Dieses besagt nach Frazer, „daß Gleiches wieder Gleiches hervorbringt, oder daß eine Wirkung ihrer Ursache gleicht [...].“[55] Eine Geisteshaltung also, die durchaus unterstellt werden darf, wenn beispielsweise ein Altar vergrößert wird, um eine größere Gewogenheit der entsprechenden Gottheit zu erlangen. Auch bei der meditativen Arbeit mit Yantras, die vor einem sehr komplexen philosophischen Hintergrund stattfand, spielt diese Haltung vermutlich noch mit herein, stellen Yantras doch symbolische Abbilder des Universums dar.
1.2.3.3 Zwei Sichtweisen
Auch wenn eine Wurzel der Mathematik in einer mystischen oder magischen Weltsicht liegt, dürfen die Unterschiede zwischen Magiern und Mathematikern nicht vergessen werden und das, obwohl die Mathematik sicher manchem, dem sie verschlossen bleibt, mitunter wie Zauberei erscheinen mag. „Der Mathematiker unterscheidet sich vom Zahlenmystiker darin, daß er den Zahlen selbst keine tiefere Bedeutung beimißt und sich nur für ihre Beziehungen untereinander interessiert.“[56] Ähnliches kann über die Bedeutung geometrischer Strukturen in mathematischer und magischer Weltsicht gesagt werden. Im Lauf der Geschichte hat sich ein „nüchterner“ Umgang mit mathematischen Strukturen immer mehr durchgesetzt, trotzdem finden wir auch heute noch - in der Numerologie, Astrologie und dem Glauben an Glücks- und Unglückszahlen - die Vorstellung, daß sich hinter Zahlen und Figuren mehr verbirgt, daß sie „selbst eine Bedeutung haben, die nur durch ihre richtige Interpretation zu enthüllen ist.“[57]
Es gab im Laufe der Geschichte allerdings immer wieder bedeutende Naturwissenschaftler und Mathematiker, denen auch eine magische Weltsicht nicht fremd war. Als Beispiele aus verschiedenen Epochen möchte ich hier nur Pythagoras und Johannes Kepler anführen. Hans Wußing schreibt über die Pythagoräer, den politisch-religiösen Geheimbund, den Pythagoras (ca. 582-507 v. Chr.) gründete: „Das Spezifische dieses Bundes bestand darin, daß die Vereinigung mit dem Göttlichen durch Versenkung in die wunderbaren Gesetze der Zahlenwelt erreichbar sein sollte, da das Wesen der Welt in dieser Harmonie der Zahlen bestehe. [...] Nach pythagoreischer Ansicht sind Zahlen nicht das Ergebnis eines von Menschen vorgenommenen Abstraktionsprozesses von der objektiven Realität, sondern selber objektive Gegebenheiten, ausgestattet mit Eigenschaften wie Haß und Liebe, männlich und weiblich. [...] Übrigens galt die Eins den Pythagoräern nicht als Zahl, sondern als ‘aller Dinge Anfang’ als die ‘Quelle und Wurzel der ewigen Natur’“[58] Kepler (1571-1630) beschäftigte sich mit der Frage, warum es gerade sechs Planeten gab (so viele waren zu seiner Zeit bekannt) und kam zu dem Schluß, „daß der Grund für die Beschränkung der Planeten auf sechs in der Fünfzahl der regelmäßigen Körper[59] zu suchen sei, die, ineinandergepackt oder -gesteckt den Abstand der Planeten zur Sonne bestimmten. In diesen vollkommenen Formen glaubte er die unsichtbaren Träger der sechs Planetensphären erkannt zu haben. Diese
Offenbarung nannte er ‘Das Weltgeheimnis’ (mysterium Cosmographicum), hinter dem er die Hand Gottes, des Himmlischen Geometers zu entdecken vermeinte [...].“[60]
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Verwendung von mathematischen Strukturen in mystischen, magischen oder religiösen Ritualen auf der Vorstellung beruht, daß alle Dinge durch ein geheimes, das heißt nicht offen sichtbares Prinzip miteinander verbunden sind. Diese Verbindungen zeigen sich zwar in der Gleichartigkeit bzw. der Aufeinanderfolge mancher Dinge oder Geschehnisse, was zu den oben erwähnten Gesetzen der Berührung und der Ähnlichkeit führt - aber diese Gleichartigkeit bzw. Aufeinanderfolge ist verborgen, also nur dem Magier, der über ein bestimmtes Geheimwissen verfügt, ersichtlich.[61] Zu diesem Geheimwissen, mit dessen Hilfe der Magier nicht nur Verbindungen zwischen Dingen und Ereignissen zu erkennen, sondern auch zu beeinflussen hofft, gehören mitunter auch mathematische Kenntnisse. Auch hier, wie schon bei der Entwicklung des Zählens, finden wir die Schritte der Abstraktion und der Konkretisierung. Der Magier versucht aus den Dingen und Ereignissen der Welt - wie er sie wahrnimmt - bestimmte Zusammenhänge zu abstrahieren und konkrete Ergebnisse in der Welt zu erzielen, indem er sie mittels dieser Prinzipien manipuliert.
Dennoch findet bei der zunehmenden Kontrolle der Welt über das Zählen etwas vollkommen anderes statt, als bei einer magischen Kontrolle der Welt. Der Zählende bringt durch seine Tätigkeit Struktur in eine ungeordnete Welt, wohingegen der Magier Strukturen aufdeckt, die in der Welt schon vorhanden sind. Es ist interessant, wie sich in diesen beiden Verhaltensweisen, die eng mit den Wurzeln der Mathematik verbunden sind, zwei grundlegende philosophische Sichtweisen über das Wesen der Mathematik widerspiegeln: die Sichtweise derer, die glauben die Mathematik komme aus dem menschlichen Geist und die Sichtweise derer, die glauben, sie komme von außerhalb des Geistes. „Die ersten glauben, daß wir Mathematik als nützliche Beschreibung der Ereignisse um uns herum erfinden, daß sie einfach das ist, was Mathematiker produzieren. Die anderen glauben, daß wir die Mathematik entdecken, daß sie irgendwo ‘da draußen’ ist und daß sie dort auch wäre, wenn es keine Mathematiker gäbe.“[62] Im folgenden wird sich noch zeigen, daß die Vertreter der „reinen Mathematik“ eher den „Magiern“ zuzuordnen sind, wohingegen die Vertreter einer anwendungsorientierten Mathematik eher zu den „Zählern“ gehören.
1.3 Die Entwicklung der Mathematik
1.3.1 Algorithmische Mathematik
1.3.1.1 Die Entstehung der ersten Hochkulturen
In der frühen Jungsteinzeit[63] lebten die Menschen „in abgegrenzten sozialen Inseln von Dorfgemeinschaften.“[64] Im dritten Jahrtausend v. Chr. entstanden an verschiedenen Orten neue Gesellschaftsformen - die ersten Hochkulturen. Diese neuen Gesellschaften zeichneten sich dadurch aus, daß in ihnen sehr viel mehr Menschen zusammenlebten, als in den früheren Dorfgemeinschaften. Sie wurden meistens autoritär und zentral regiert und erstreckten sich über ein ansehnliches Gebiet, das sie noch auszudehnen suchten. Diese Gesellschaften boten viele neue Möglichkeiten, verlangten den Menschen aber auch neue Anforderungen ab. Sie erlaubten die Spezialisierung von Menschen auf bestimmte Tätigkeiten in einem Ausmaß, in dem diese zuvor nicht möglich war, machten diese Spezialisierung aber gleichzeitig notwendig, weil das Leben in einem Gemeinwesen dieser Größe sonst nicht mehr zu organisieren gewesen wäre.[65] “Mathematische Methoden ermöglichten das Funktionieren der frühen hierarchischen Königsherrschaften: Gerechtigkeit in der Besteuerung, Effizienz in der Versorgung großer Arbeiter- und Soldatenheere, Beweise der königlich-göttlichen Omnipotenz durch astronomische und meteorologische Vorhersagen und Standardisierung menschlicher Aktivität erforderten einen formal-bürokratischen Apparat, der auf die formale Kraft mathematischer Größen und deren Manipulation nicht verzichten konnte.“[66]
Die Mathematik in den ersten Hochkulturen blieb aber zunächst strikt algorithmisch orientiert. Mathematische Methoden wurden angewandt, aber ohne sie zu reflektieren oder gar den Versuch zu unternehmen, sie zu beweisen.[67] Kotzmann begründet dies so: „In einer strikt hierarchischen Gesellschaftsform ist die Frage nach dem ‘Warum’, nach einem Beweis sinnlos, da Wahrheit von der Spitze der Gesellschaftspyramide bestimmt wird und je nach Effizienz von den darunterliegenden Gesellschaftsschichten zu akzeptieren ist. Mathematik, die diese gut organisierten Staatsgebilde des alten Orients erst ermöglichte, erstarrte in einem beharrenden Dogmatismus, der zwar die bürokratischen Aufgaben im Staat erfüllen konnte, aber keine weitere Entwicklung zuließ.“[68] Aus den Hochkulturen von Ägypten, Mesopotamien, Indien, China und Mittelamerika liegen uns Zeugnisse für algorithmische Mathematik vor.
1.3.1.2 Mathematik in Ägypten
Die ägyptische Hochkultur entstand ca. 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Unser Wissen über die Mathematik der Ägypter stammt hauptsächlich aus drei überlieferten mathematischen Texten, die alle aus der Zeit des Mittleren Reiches (ca. 2040 - 1788 v. Chr.) stammen. Es handelt sich um den „Papyrus Rhind“, den „Papyrus Moskau“ und die sogenannte „Lederrolle“. Mathematik wurde in Ägypten hauptsächlich von Schreibern betrieben, einer Art von „Staatsbeamten“ die alle wichtigen Verwaltungsaufgaben wahrnahmen.[69] Die altägyptische Mathematik „verfügte über ein dezimales Zahlensystem, eine durchgefeilte Bruchrechnung, vermochte lineare Gleichungen aufzulösen, geometrische Reihen traten auf, es gab den Begriff des Winkels, man vermochte einfache Flächen (Quadrat, Rechteck, Dreieck) und Volumina (Würfel, Quader) zu berechnen.“[70] Der vergleichsweise hohe Entwicklungsstand der Geometrie steht vor allem im Zusammenhang mit dem Nilhochwasser, daß es notwendig machte, die Felder jedes Jahr neu zu vermessen.[71] Dabei war die Mathematik der Ägypter „noch keine ‘Wissenschaft’, sondern ein (freilich sehr geschätztes) Hilfsmittel für Verwaltung und Wirtschaft.“[72]
1.3.1.3 Mathematik in Mesopotamien
Um 3200 v. Chr. wanderten die Sumerer nach Mesopotamien, in den von den beiden Flüssen Euphrat und Tigris durchflossenen Landstrich ein und begründeten dort ab ca. 3000 v. Chr. die erste Hochkultur. Später lösten sich in diesem Landstrich Akkader, Babylonier, Assyrer, Hethiter und Perser mit der Herrschaft ab. Über die mesopotamische Mathematik ist uns ungleich mehr bekannt als über die ägyptische, wahrscheinlich, weil die Tontafeln, auf die man in diesem Gebiet zu schreiben pflegte, sich einfach besser hielten als die ägyptischen Papyri.[73] „Gemessen an der ägyptischen, stand die mesopotamische Mathematik auf einem wesentlich höheren Niveau. Aber auch hier war sie primär von gesellschaftlichen Anforderungen geprägt. Typisch für Mesopotamien war ein ausgebreitetes System künstlicher Bewässerung; folgerichtig nehmen Wasserbauprobleme wie Kanalbau, Dammbau, Feldvermessung einen hervorragenden Anteil in den mathematischen Texten ein. Hervorzuheben ist auch der außerordentlich hohe Stand der Rechentechnik, die [...] schon Züge echter algebraischer Verfahrensweisen enthält. Diese auffällige Erscheinung erklärt sich wohl auch daraus, daß Mesopotamien gezwungen war, einen ausgedehnten Handel - Holz, Steine, Erze - zu unterhalten, da es kaum entsprechende natürliche Reichtümer besaß.“[74] Die Babylonier entwickelten ein sexagesimales Positionssystem, dem im 6. Jh. v. Chr. sogar noch ein inneres Lückenzeichen, das Teile der Funktion des heutigen Nullzeichens übernehmen konnte, hinzugefügt wurde. Das Sechzigersystem der Babylonier hat bis heute, in unserer Aufteilung der Stunde in Minuten und Sekunden und in der Unterteilung der Winkel in Grad, Minuten und Sekunden überdauert.[75] Außerdem findet man in der mesopotamischen Mathematik „die Auflösung von speziellen Gleichungen bis zum Grade 4, lineare Gleichungssysteme, arithmetische und geometrische Reihen, Quadrat- und Kubikwurzeln, den pythagoreischen Lehrsatz (zeitlich weit vor Pythagoras), in der Geometrie den Thalessatz (weit vor Thales) und bei Dammbauten die Benutzung eines Böschungswertes, der dem trigonometrischen Kotangens äquivalent ist.“[76]
1.3.1.4 Mathematik in Indien
Bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. entstanden im Industal im Nordwesten Indiens, die ersten Kulturen städtischen Zuschnitts. Uns blieben aus dieser Zeit schriftliche Dokumente erhalten, die allerdings noch nicht entziffert werden konnten, aus denen sich jedoch einiges über die mathematischen Kenntnisse der Induskulturen entnehmen läßt.[77] „Das Zahlsystem war Dezimal. [...] An geometrischen Figuren waren Dreieck, Quadrat, Rechteck, Kreis, Kegel, Zylinder, Würfel u.a.m. bekannt. [...] Aus Verzierungen an Vasen, Reliefs u.ä. kann man schließen, daß die Menschen der Induszivilisationen gewisse Kenntnisse über Projektionen und Ähnlichkeiten gehabt haben [...].“[78] Im 2. Jahrtausend v. Chr. gingen die frühen Induskulturen unter. Einige Jahrhunderte später drangen arische Stämme aus Zentralasien in Indien ein. Mit ihrer Seßhaftwerdung entstand eine neue Hochkultur. In dieser Zeit entstanden vermutlich die schon zuvor erwähnten Sulva Sutra[79] mit ihren Vorschriften für den Altarbau.[80] „Die Hauptwerke der indischen Mathematik sind jedoch erst zwischen dem 2. (oder 5.) Jh. u. Z. und dem 16. Jh. entstanden, in einigen Teilen deutlich unter hellenistischem Einfluß, z.B. in der Trigonometrie.“[81] „Die Entdeckung der Null durch die Inder und damit das Gewinnen eines dezimalen Stellenwertsystems steht erst am Beginn des Mittelalters.“[82] „Die Haupttriebkräfte der Entwicklung der Mathematik im alten Indien hat man im Handel und in der engen Verbindung zur Astronomie zu suchen.“[83]
1.3.1.5 Mathematik in China
Ungefähr im 3. Jahrtausend v. Chr. entstand in China eine Hochkultur. Im Laufe der Chinesischen Geschichte lösten sich immer wieder verschiedene Herrschaftsdynastien ab.[84] „Mathematik war vorgeschriebener Ausbildungsgegenstand der Beamten des Riesenreiches. Rechenbretter dürften bereits im ersten Jahrhundert v. u. Z. in Gebrauch gewesen sein. Trotz unterschiedlicher Zahlenschreibweise - Stäbchen- oder Bambusziffern waren vom 2. Jh. v. u. Z. bis zum 12./13. Jh. in häufigem Gebrauch - war ein Positionssystem zur Basis 10 seit dem 3. Jh. v. u. Z. üblich. die noch fehlende ‘Null’ gelangte vermutlich aus Indien nach China.“[85] Als im 16. Jahrhundert der europäische Einfluß in China spürbar wurde, hatte die Mathematik schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Die Chinesen machten auch eine Reihe wichtiger Erfindungen, zu nennen sind hier unter anderem: Porzellan, Papier, Buchdruck, Schießpulver, Rakete und Kompaß.[86] „Allerdings besaß die chinesische Mathematik nicht jene innere Strenge wie die griechisch-hellenistische Mathematik; häufig fehlen die Beweise.“[87]
1.3.1.6 Mathematik in Süd- und Mittelamerika
In Süd- und Mittelamerika waren die Hochkulturen der Mayas (Halbinsel Yukatán), Inkas (Equador, Peru, Bolivien, Chile) und Azteken (Mexiko) beheimatet. Die Kultur der Mayas ist die älteste und hatte zwischen 300 und 900 n. Chr. ihre erste Hochperiode. 1492 entdeckten spanische Seefahrer den neuen Erdteil.[88] „Durch den fanatischen Zerstörungswillen der Eroberer sind bis auf wenige Ausnahmen die meisten Zeugnisse über die Wissenschaften im Inkareich, bei den Azteken und bei den Maya-Völkern systematisch vernichtet worden. Durch Zufall nur blieben drei Maya-Handschriften erhalten; die Entzifferung[89] bietet noch immer Schwierigkeiten.“[90] So wissen wir von der Mathematik der Mayas nicht viel. Sie benutzten ein Positionssystem zur Basis Zwanzig und kannten ein Nullzeichen.[91] „Mathematik stand - wie bei den Azteken - in engem Zusammenhang mit der Astronomie; diese war in Teilen - z.B. bei der Bestimmung der Dauer des Jahres - der damaligen europäischen Astronomie überlegen.“[92]
Wie wir gesehen haben, hat sich, zeitlich mehr oder weniger parallel, in verschiedenen Hochkulturen eine algorithmische Mathematik entwickelt. Dabei orientierte sich die Mathematik an den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Kultur, gleich ob diese jetzt materiell, wie bei der Feldvermessung nach den Nilhochwassern in Ägypten oder geistig, wie bei der rituellen Altarvergrößerung in Indien waren. Auch in Griechenland entwickelte sich zunächst eine algorithmische Mathematik, die Griechen waren aber „die ersten, die über mathematische Verfahren reflektierten, die mathematische Verfahren zu beweisen für notwendig hielten und die nicht mehr allein nach dem ‘Wie’, sondern auch nach dem ‘Warum’ fragten.“[93] Sie taten also den entscheidenden Schritt von der algorithmischen zur axiomatischen Mathematik und deswegen möchte ich mich ihnen im folgenden besonders zuwenden.
1.3.2 Axiomatische Mathematik
1.3.2.1 Ein entscheidender Schritt
Die entscheidenden Entwicklungen in der griechischen Mathematik fanden in der Zeit zwischen 600 v. Chr. und 500 n. Chr. statt. Schon ab ca. 2000 v. Chr., vielleicht auch etwas früher, hatte sich die kretisch-mykenische Kultur entwickelt, die sich um 1000 v. Chr. über den ganzen kleinasischen Raum auszubreiten begann. Aus dieser Zeit sind keine eigenständigen mathematischen Entwicklungen der Griechen bekannt.[94] Dann plötzlich fand ein Umbruch statt, nicht nur in der Mathematik, sondern im gesamten menschlichen Denken. Ein Umbruch, so einschneidend, daß er unsere Welt bis zum heutigen Tag entscheidend prägt. Wie konnte es dazu kommen?
Wir wissen darüber, wie in historischen Fragen oft der Fall, nichts Sicheres. Verschiedene Autoren haben verschiedene Anschauungen und es war wohl auch ein Zusammenspiel vieler Faktoren, das zu dieser einschneidenden Zäsur in der menschlichen Geistesgeschichte führte.[95] Damit sich jeder Leser selbst ein Urteil bilden kann, möchte ich die Faktoren, von denen angenommen wird, daß sie die Griechen bei diesem großen Sprung in der Entwicklung beeinflußt haben, hier kurz zusammenfassen:
- Die umliegenden Hochkulturen hatten ihren Zenit überschritten und die griechische Kultur breitete sich rasch aus.[96]
- Eisen ersetzte zunehmend Bronze als Gebrauchsmetall, wodurch die Produktivität erhöht werden konnte.[97]
- Mit den bei der Besiedlung des Mittelmeerraums gegründeten Stadtstaaten entstanden neue, zum Teil demokratische Staatsgebilde, in denen die Bürger ein großes Maß an Freiheit und Mitspracherecht genossen.[98]
- Die Menschen der eroberten Gebiete wurden oft als Sklaven gehalten, was den Sklavenhaltern die Möglichkeit gab, sich mit „Kunst, Kultur, Philosophie und Wissenschaft zu beschäftigen.“[99]
- In der griechischen Kultur erlangte der Handel einen neuen Stellenwert. Zuvor stand der Gebrauchswert einer Ware im Vordergrund, der für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich sein konnte. Bei den Griechen jedoch wurde der Tauschwert einer Ware zunehmend wichtig. „Ware zu tauschen, heißt nun ein Produkt gegen ein anderes zu geben, wobei real während des Tausches der Gebrauchswert der Ware völlig in den Hintergrund tritt und einzig allein auf die Gleichheit des abstrakten Tauschwertes der Güter geachtet wird.“[100] Diese Abstraktion, mit der die Menschen
zunehmend im täglichen Handeln konfrontiert waren, begünstigte vermutlich die Entwicklung hin zum Denken in abstrakten Begriffen.[101]
- Besonderheiten im Denken der Griechen: Rationalismus - der Glaube an die Kraft der menschlichen Vernunft, Kritizismus - ein kritisches Verhältnis zur Erkenntnis der Wirklichkeit und Dynamismus - die Bereitschaft zur Veränderung von Weltbildern.[102]
Die Entwicklung der griechischen Mathematik wird in der Regel in vier Perioden unterteilt. Die ionische Periode (ca. 600 - 450 v. Chr.), die athenische Periode (ca. 450 - 300 v. Chr.), die hellenistische oder alexandrinische Periode (ca. 300 v. Chr. - 150 n. Chr.) und eine Periode des Niederganges in der die Produktivität immer mehr abnahm, bis sie mit dem Zusammenbruch des römischen Imperiums schließlich ganz erlosch.[103]
1.3.2.2 Die ionische Periode
Die ionische Periode ist benannt nach den griechisch-ionischen Stadtstaaten an der Küste Kleinasiens. In diesen Stadtstaaten, wirkte eine Reihe von großen Philosophen, wie Anaximandros, Anaximenes und Thales, die versuchten, die Welt nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu erklären. Mit einer ganz entsprechenden Einstellung wandte man sich im folgenden auch der Mathematik zu:[104] „Es wird das Wesen der Definition erkannt. Beweise für Sätze werden geführt auf Grund der Einsicht in den mathematischen Sachverhalt. Der mathematische Sachverhalt, der zum Teil aus Mesopotamien und Ägypten übernommen werden konnte, erhielt nun eine logische Struktur, und es kam zu klaren begrifflichen Unterscheidungen von Voraussetzung, Satz und Beweis. Die Wissenschaft Mathematik wurde geboren.“[105] Herausragende Mathematiker der ionischen Periode waren Thales von Miletos, der auch als Philosoph von sich reden machte und schon in der Antike als einer der sieben Weltweisen galt, Demokritos von Abdera, der eine Atomtheorie entwickelte, Hippokrates von Chios, der schon vor Euklid eine Darstellung der Geometrie unter dem Titel „Elemente“ verfaßte und Pythagoras von Samos.
„Der Überlieferung nach hat Pythagoras nach längeren Aufenthalten in Ägypten und Mesopotamien, wo er mit verschiedenen Mysterienkulten in Verbindung kam, in Unteritalien einen politisch-religiösen Geheimbund gegründet, der zeitweise eine große politische Macht besaß [...]. Der Orden erlosch um die Mitte des 4. Jh.“[106] Die Pythagoräer waren motiviert durch den Glauben: „Daß die Bahnen der Sterne, aber auch die Gesetze der musikalischen Harmonie und der architektonischen Schönheit bestimmt waren durch einfache [...] Verhältnisse ganzer Zahlen: ‘Die ganze Welt ist Harmonie und Zahl’“[107] Aus dieser Motivation heraus untersuchten sie Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten im Bereich der Zahlen, formulierten abstrakte Sätze und bewiesen sie[108] - jedoch nicht, um die so gewonnenen Erkenntnisse zur Naturbeherrschung anzuwenden. „Die Philosophen und Mathematiker der späteren Zeit stellten sehr klar heraus, daß sich die ‘theoretischen Forschungen (der Pythagoräer) frei von materiellen Einflüssen im Bereich des reinen Denkens bewegten’, so heißt es etwa im sog. ‘Geometerkatalog’, einer Art Geschichte der Mathematiker der Antike, die von einem spätantiken Wissenschaftler verfaßt wurde.“[109] Die Pythagoräer trieben also schon das, was wir heute „reine“ Mathematik nennen würden. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung herum erlosch der Orden der Pythagoräer. Wahrscheinlich trug, neben politischen Gründen, die Entdeckung der irrationalen Zahlen in Form inkommensurabler Strecken[110] zum Ende des Ordens bei. Durch die konsequente Anwendung mathematischer Schlüsse kamen die Pythagoräer zur Grundidee ihrer eigenen Zahlenmystik in Widerspruch - der Behauptung, daß die Welt ausschließlich auf den einfachen Verhältnissen ganzer Zahlen aufgebaut sei.[111]
1.3.2.3 Die athenische Periode
Im fünften Jahrhundert wurde Athen zum politischen und kulturellen Zentrum Griechenlands und blieb es, bis der mazedonische König Philip im Jahr 338 v. Chr. die Stadt eroberte. In dieser Periode wirkten Bildhauer wie Praxiteles, Schriftsteller wie Aristophanes, Sophokles und Euripides und die großen Philosophen Sokrates und Platon. Aber auch die Mathematik entwickelte sich in dieser Zeit deutlich weiter.[112] Die athenische Mathematik sah sich vor allem mit dem Problem der Irrationalität konfrontiert, das durch die Pythagoräer aufgeworfen worden war: „Es existieren zueinander inkommensurable Strecken, man kann sie konstruieren. Aber es gibt keine natürliche Zahl und kein Verhältnis von Zahlen, das ein arithmetisches Äquivalent des geometrischen Objekts sein könnte [...].“[113] Seit der Zeit der Pythagoräer konnten noch an weiteren Strecken Inkommensurabilitäten gezeigt werden, insbesondere solche, die wir heute als Quadrat- und Kubikwurzeln bezeichnen würden. Mathematiker wie Theodoros von Kyrene und Theaitetos versuchten dieses Problem - das ja an geometrischen Konstruktionen entdeckt worden war - mit ebenfalls geometrischen Mitteln in den Griff zu bekommen. Sie entwickelten etwas, was man mit dem dänischen Mathematikhistoriker Zeuthen treffend als „geometrische Algebra“ bezeichnen könnte. Durch die Methode der ‘Flächenanlegung’ und andere geometrische Konstruktionen, konnten selbst Irrationalitäten dargestellt werden, die wir heute als verschachtelte Wurzelterme schreiben würden.[114] Einen anderen Weg wählte Eudoxos von Knidos. Bisher war der Begriff der Proportion an die Voraussetzung gebunden gewesen, daß sich die im Verhältnis stehenden Zahlen auf ein gemeinsames Maß zurückführen ließen. Eudoxos gelang es, eine neue Definition der Proportion zu entwickeln, die die Kommensurabilität der beteiligten Größen nicht mehr voraussetzte, mit deren Hilfe aber nach wie vor alle bekannten Sätze über Proportionen bewiesen werden konnten. Außerdem entwickelte er, bei dem Versuch krummlinig begrenzte Figuren durch ein- bzw. umbeschriebene Vielecke anzunähern, erste Ansätze einer Analysis. Bis zu einem wirklich exakten Begriff der irrationalen Zahl drang jedoch keiner dieser griechischen Mathematiker vor.[115]
Platon werden nur wenige konkrete Einzelergebnisse auf dem Gebiet der Mathematik zugeschrieben, er hat aber mit seiner Philosophie die Sichtweise damaliger und späterer Mathematiker entscheidend mitgeprägt. „Platons Bekanntschaft mit der Mathematik rührte aus der Zeit seines Aufenthaltes bei Archytas her. Seitdem betrachtete Platon die Mathematik als das Beispiel einer Wissenschaft, die ihre Ergebnisse durch bloßes Denken finden könne. Diese philosophische Grundhaltung bedeutet einerseits eine Verstärkung der methodischen Grundlage der Mathematik, die auf Definitionen und Voraussetzungen aufbauend deduktiv ihre Beweise führt. Sie bedeutet andererseits die Verstärkung des philosophischen objektiven Idealismus.“[116] Nach Platons Auffassung erkennt Wahrnehmung „nichts Dauerhaftes, gibt also nicht Gewißheit, sondern nur täuschende Meinung [...].“[117] Nur durch richtig gebildete Begriffe kann man zu wirklichem Wissen gelangen. Genau wie die Wahrnehmung ein Objekt hat, benötigen auch die Begriffe ein Objekt, das aber nicht mit dem Objekt der Wahrnehmung identisch sein kann. Diese Objekte der Begriffe sind die Ideen. Die Objekte unserer Wahrnehmung sind nur unvollkommene Abbilder der vollkommenen Ideen.[118] „Bei der Idee ‘Dreieck’ z.B. gilt der Satz über die Winkelsumme wirklich, bei jedem aufgezeichneten Dreieck aber, dem schlechten Abklatsch der Idee, wird die Nachprüfung Abweichungen ergeben.“[119] Luciano De Crescenzo verdeutlicht am Beispiel eines Huhnes, warum Platons Ideenlehre nicht nur eine logische, sondern auch eine metaphysische Theorie darstellt. „Wenn sich mir beim Anblick eines Huhns der Gedanke aufdrängt: ‘Dies ist ein Huhn’, so habe ich dabei folgende Überlegung angestellt: ‘Das Tier, das ich sehe, hat etwas gemeinsam mit allen Hühnern, also muß es ein Huhn sein.’ Wenn ich dagegen behaupte, daß alle Hühner der Welt die Eigenschaft haben, einem idealen Huhn zu gleichen, das einer übersinnlichen Welt entstammt, dann habe ich ein metaphysisches Konzept ausgesprochen. [...] Dieser Sprung von der logischen zur metaphysischen Theorie ist das neue an Platon, das ihn von den Philosophen vor ihm unterscheidet. Während wir mit der Logik nur das Konzept des Universalen aufstellen können, haben wir es bei der Ideenlehre zum ersten Mal in der Philosophiegeschichte mit etwas zu tun, das außerhalb des Universalen liegt.“[120] Im Laufe der Mathematikgeschichte gab es zahlreiche Mathematiker, die Idealisten im Sinne Platons waren, indem sie annahmen, die mathematischen Gegenstände beständen, unabhängig vom Menschen, in einem metaphysischen Reich der Ideen und die Tätigkeit der Mathematiker bestünde darin, einige dieser Ideen nach und nach zu entdecken.[121] Platon selbst, wie auch die meisten seiner geistigen Nachfolger, sprach einer „reinen Mathematik“ das Wort, die dem metaphysischen Erkenntnisstreben dient und sah Mathematik, die auf die Anwendung hin ausgerichtet war, als minderwertig an.[122]
1.3.2.4 Die hellenistisch / alexandrinische Periode
Im Jahr 338 v. Chr. eroberte der mazedonische König Philipp Athen. 336 v. Chr. übernahm sein Sohn Alexander die Herrschaft und begann sein Weltreich zu errichten, das Mazedonien, Griechenland, Klein- und Mittelasien, Süd- und Westeuropa, Nordafrika und Teile Indiens umfassen sollte. In diesem Umfeld bildete sich die Kultur und Wissenschaft des Hellenismus heraus.[123] „Sie entstand durch Verschmelzung und Durchdringung der kulturell-wissenschaftlichen Ergebnisse der Griechen (d.h. der Hellenen) mit den verschiedenen Kulturen der Völker jenes großen Territoriums [...].“[124] Im Rahmen seiner Eroberungen gründete Alexander zahlreiche Städte; in einer davon, Alexandria in Ägypten, entstand ca. 300 v. Chr. das sogenannte Museion. „Es handelte sich hierbei um das erste staatlich gegründete und unterhaltene Forschungs- und Lehrzentrum überhaupt, mit Hörsälen, Arbeits- und Speiseräumen, mit einer dazugehörigen ganz außergewöhnlichen Bibliothek von ca. 400000 Papyrusrollen (die in späteren kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Römern vernichtet wurden), mit Sternwarte, botanischen und zoologischen Gärten.“[125] Fast alle großen Wissenschaftler der hellenistischen Periode standen in Kontakt mit dem Museion, das bis ungefähr 150 n. Chr. Bestand hatte.
Ein mathematisches Standardwerk der hellenistischen Periode, das bis in die Neuzeit hinein seine Bedeutung behielt und zu Unterrichtszwecken verwendet wurde, waren die „Elemente“ des Euklid. Die „Elemente“ sind in über 1700 Ausgaben erschienen und nach der Bibel das am weitesten verbreitete Buch der Welt. Euklid hat darin fast das gesamte mathematische Wissen der damaligen Zeit zusammengestellt und durch Beweise gesichert - allerdings ohne jeden Anwendungsbezug. Als wollte sich das Leben dafür rächen, ist uns von Euklid außer seinen Büchern auch nichts geblieben - seine Lebensgeschichte liegt bis auf einige Anekdoten im Dunkeln. Auch diese zeigen, daß Euklids Mathematik auf reine Erkenntnis und nicht auf praktische Anwendung hin ausgerichtet war.[126] „Da wird von einem reichen Studenten erzählt, der nach dem ersten Unterricht den Meister gefragt habe, was man denn mit der Mathematik verdienen könne. Euklid forderte seinen Diener auf, dem Schüler ein paar Groschen zu geben, da er aus der Mathematik offenbar materiellen Gewinn erwarte.“[127] Auf Grund der Darstellungsweise, die Euklid in seinen Elementen wählt, gilt er als Begründer der Axiomatik. Er beginnt mit Definitionen, Postulaten und Axiomen. „Die Definitionen der Grundelemente der Geometrie - Punkt, Linie, Strecke, Fläche - sind anschaulicher, beschreibender Art.“[128] Dann folgen fünf geometrische Postulate und schließlich neun logische Axiome, wobei Postulate und Axiome heute nicht mehr unterschieden werden. Daraus werden nun alle Sätze, die Euklid aufstellt, zum Teil mit Hilfe bereits bewiesener anderer Sätze, ohne weiteren Rückgriff auf die Anschauung, logisch deduziert.[129]
Ein Zeitgenosse des Euklid war Archimedes. Wie Euklid mit seinen Elementen, so hat Archimedes mit seinen Forschungen das abendländische Denken mitgeprägt. Er beschäftigte sich mit Mathematik, Astronomie, Hydrostatik, Mechanik und Technik.[130] Eine Aufzählung seiner uns erhaltenen Werke gibt einen Einblick in die Vielfalt seiner Forschungen: „Über das Gleichgewicht ebener Flächen - Die Quadratur der Parabel - Die Methodenlehre - Über Kugel und Zylinder - Über Spiralen - Über Konoide und Sphäroide - Über schwimmende Körper - Die Kreisrechnung - Der Sandrechner.“[131] Dabei war, so weit sich heute sagen läßt, Archimedes Einstellung und Methodik eine ganz andere als die des Euklid (über Euklids Einstellung läßt sich nur über die Darstellungsform in seinen Büchern schlußfolgern). Für Euklid spielte wahrscheinlich der Anwendungsbezug eine untergeordnete Rolle, für Archimedes machte er, nach eigenen Aussagen, seine enormen Leistungen auf mathematischem Gebiet erst möglich. „Archimedes hat durch mechanisch-physikalische Überlegungen und Analogien den Inhalt der Sätze gefunden und dann erst den exakten mathematischen Beweis ausgearbeitet.“[132] Archimedes schreibt selbst: „Ich bin ... überzeugt, daß die Methode nicht weniger nützlich ist zum Beweis der Theoreme selbst. Denn Einiges von dem, was mir auf ‘mechanische’ Weise klar wurde, wurde später auf geometrische Art bewiesen, weil die Betrachtungsweise dieser (‘mechanischen’) Art der (strengen) Beweiskraft entbehrt. Denn es ist leichter, den Beweis zustande zu bringen, wenn man schon vorgreifend durch die ‘mechanische’ Weise einen Begriff von der Sache gewonnen hat, als ohne eine derartige Vorkenntnis. Deshalb wird man einen nicht geringen Verdienstteil an der Entdeckung jener Theoreme, für die Eudoxos zuerst den Beweis fand - über Kegel und Pyramiden, daß der Kegel der 3. Teil des Zylinders und die Pyramide der 3. Teil des Prismas mit der selben Basis und Höhe ist -, dem Demokritos zubilligen müssen, der die Sätze über diese Figuren aussprach, wenn auch ohne Beweis.“[133]
Ebenso wie Archimedes widmete sich einige Jahrhunderte später auch Heron von Alexandria vielen praktischen Belangen. Er beschäftigte sich mit der Konstruktion von Vermessungsinstrumenten, einfachen Maschinen, pneumatisch angetriebenen Automaten und mit Geschützkunde. Seine mathematischen Schriften, die zum Teil Probleme aus seiner „Ingenieurstätigkeit“ aufgriffen - so führte ihn die Kaliberberechnung eines Geschützes zur Behandlung von Gleichungen dritten Grades - weisen eine strenge, auf Definitionen, Sätzen und Beweisen beruhende Darstellungsweise auf. Bekannt ist auch seine Methode zur näherungsweisen Bestimmung von Wurzeln.[134] Beeindruckend sind Herons Gedanken über das Wesen der Mathematik. Er stimmt der platonischen Auffassung zu, wenn es um die Frage geht, wie Mathematik als Wissenschaft betrieben werden sollte: “Damit wir nicht gegen die Regeln verstoßen, ist es schicklich, die Definition der Geometrie anzugeben. Die Geometrie ist also die Wissenschaft von Figuren und Größen und ihren Veränderungen, und ihr Zweck ist, hiervon zu handeln; die Methode aber ihrer Darstellung ist synthetisch; sie fängt nämlich mit dem Punkte an, der ohne Ausdehnung ist, und erreicht über Linie und Fläche den Körper. Ihr Nutzen dient geradezu der Philosophie; das ist ja auch die Meinung des göttlichen Platon, wo er sagt: ob diese Lehre schwer oder leicht ist, durch sie geht der Weg.“[135] Bei der Frage nach dem Ursprung der Mathematik nimmt er aber einen, der platonischen Ideenlehre ganz entgegengesetzten Standpunkt ein: „Die Geometrie hat ihre Darstellung durch Abstraktion aufgebaut; sie nimmt nämlich den physischen Körper, der drei Dimensionen hat und Stofflichkeit, und durch Entfernung seiner Stofflichkeit hat sie den mathematischen Körper gebildet, der solide ist, und durch Abstraktion hat sie den Punkt erreicht.“[136] Danach führt er noch an, daß die Geometrie von den Ägyptern erfunden wurde, weil das Nilhochwasser die jährliche Neuvermessung der Felder notwendig machte.[137] Damit nimmt Heron einen empirizistischen Standpunkt zum Wesen der Mathematik ein, den er mit vielen Mathematikern teilt.[138] Während nach Platons Auffassung die mathematischen Ideen schon immer existieren und vom Menschen lediglich - mitunter mit Umweg über ihre unvollkommenen materiellen Abbilder - entdeckt werden, steht für Heron die materielle Welt am Anfang, aus der der Mensch durch Abstraktion die mathematischen Ideen entwickelt.
Es wirkten in dieser fruchtbaren Periode noch zahlreiche weitere Mathematiker, die ich hier nur zum Teil anführen kann. Appolonios von Perge, der eine achtbändige Abhandlung über Kegelschnitte verfaßte und ein mathematisches Modell entwickelte, das es ermöglichte Platons fehlerhafte Auffassung, daß sich die Planeten auf Kreisbahnen bewegten, mit den tatsächlich beobachteten Planetenbewegungen in Einklang zu bringen. Auch Ptolemaios, nach dem das gleichnamige Weltbild benannt ist, bei dem die Erde im Mittelpunkt gedacht wird, arbeitete über die Planetenbewegungen. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich mit ebener und sphärischer Trigonometrie, sowie mit der stereographischen Projektion der Kugel auf die Ebene.[139] Einer der letzten herausragenden Mathematiker der hellenistischen Periode war Diophantos von Alexandria. Einerseits stand er in der Tradition der vorgriechischen, algorithmischen Mathematik. Dies kann man daran erkennen, daß es sich bei seinem wichtigsten Werk, einem dreizehnbändigen Lehrbuch der Arithmetik, um eine vom Einfachen zum Schwierigen fortschreitende Aufgabensammlung handelt und daß sich bei einigen Aufgaben starke Ähnlichkeiten zu Aufgaben aus mesopotamischen Texten zeigen. Andererseits war er sehr innovativ; er entwickelte eine ausgefeilte Gleichungslehre die noch im 17. Jahrhundert wichtige Anstöße bei der Entwicklung der modernen Algebra und Arithmetik geliefert hat.[140]
1.3.2.5 Die Periode des Niedergangs
Nach und nach begann der Stern des alexandrinischen Reiches zu sinken, gleichzeitig begann sich von Italien ausgehend ein neues Weltreich auszubreiten, wobei es sich auch weite Teile des alexandrinischen Reiches einverleibte. Ab ca. 30 v. Chr. geriet Ägypten und damit auch Alexandria unter römische Herrschaft. Als die Unruhen im römischen Reich im ersten nachchristlichen Jahrhundert immer größer wurden, nahmen die wissenschaftlichen Leistungen immer mehr ab. Anstatt eigenständige Arbeiten zu erstellen, wurde es üblich, die Werke früherer Autoren zu kommentieren.[141] „Die Mathematikschule zu Alexandria erlosch 415 mit der Ermordung der Mathematikerin Hypatia während der Heidenverfolgung durch fanatische Christen. Die Akademie in Athen wurde 529 durch den christlichen oströmischen Kaiser Justinian als Stätte ‘heidnischer und verderbter Lehren’ geschlossen. Nach dem Zusammenbruch des römischen Weltreiches finden sich im weströmischen Teil nur relativ bescheidene mathematische Kenntnisse, ein wenig Feldmeßkunst, elementare Geometrie, Bruchrechnung und der Computus, d.i. die Berechnung der beweglichen kirchlichen Feiertage.“[142] Aber schon zuvor hatte bei den pragmatisch eingestellten Römern nur die Form von Mathematik gesellschaftliche Unterstützung gefunden, die sich im Messen und Rechnen praktisch anwenden ließ.[143]
Einer der letzten Mathematiker der Antike, die nicht nur kommentierten, sondern auch eigene Leistungen erbrachten, war Pappos von Alexandria, der auf dem Gebiet der projektiven Geometrie arbeitete. Danach folgten Kommentatoren wie Eudemos aus Rhodos, Theon aus Alexandria, Proklos aus Athen, Eutokios aus Askalon, Simplikos und andere, die für uns deswegen bedeutsam sind, weil ihre Kommentare oft die einzigen Quellen sind, aus denen wir Schlüsse über verlorengegangene Werke der griechischen Mathematik ziehen können.[144]
[...]
[1] Thoms, Rene. In: Howson, A.G. (Hg.): Developments in Mathematical Education. Cambridge 1973. S. 204. Z.n. Otte 1974: S. 5
[2] vgl. z.B. Winter 1994: S. 31f
[3] vgl. Glatfeld 1983 S. 40ff und den Abschnitt „3.1.3 Das ‘traditionelle’ Sachrechnen“ meiner Arbeit.
[4] Ich beziehe mich hier auf Überlegungen, die Jakob Ossner in seinem Aufsatz „Praktische Wissenschaft“ anstellt. Dort heißt es auf S. 192 über die Fachdidaktik Deutsch: „Es geht um die Bewältigung der Aufgabe, ein Können im Gegenstandsfeld Sprache [...] auszubilden. In dieser nicht weiter spezifizierten Beschreibung ist die Aufgabe immer dieselbe, inhaltlich aber ändert sie sich mit den Subjekten, die in die Zielformulierung eingehen. Es geht ja nicht um ein allgemeines Können, sondern um das Können von jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Daher ist es Aufgabe einer praktischen Wissenschaft Fachdidaktik, die Frage zu beantworten, wie dieses Können jeweils erreicht werden kann.“ Auf S. 197 heißt es weiter: „Eine Praktische Wissenschaft kann lehren: - Wissen im Handlungsfeld, also das didaktische Brauchtum; - Wissen über die Schüler auf der Basis einer gegenstandsorientierten psychologischen und soziologischen Forschung; - Wissen über das Gegenstandsfeld, also Funktion und genetische Struktur des Gegenstandsfeldes.“ Genauere Hintergründe zu diesen Überlegungen, die sich nicht nur auf die Fachdidaktik Deutsch, sondern auf die Fachdidaktik allgemein beziehen, können ebd. nachgelesen werden.
[5] C. G. J. Jacobi: Werke Bd. I, S. 454f. (Brief an Legendre vom 2.7.1830). Z. n. Volk 1980: S. 31. Dort z. n. Struik, D.: Abriß der Geschichte der Mathematik. Berlin 1967.
[6] z.n. Ruben 1979: S. 4
[7] vgl. Barrow 1993: S. 60f und Strehl 1979: S. 20
[8] vgl. dazu auch Brieskorn 1974: S. 221
[9] Volk 1980: S. 7
[10] Barrow 1993: S. 10
[11] vgl. Otte 1974
[12] vgl. Meschkowski 1990
[13] Meschkowski 1990: S. V
[14] Meschkowski 1990: S. 1
[15] Hominiden waren dem heutigen Menschen ähnliche Primaten. Der Homo Sapiens, der dem heutigen Menschen gleicht, trat erstmals vor ca. 100000 Jahren auf. (vgl. Wußing 1997: S. 15)
[16] vgl. Wußing 1997: S. 15
[17] Barrow 1993: S. 12
[18] vgl. Wußing 1997: S. 13
[19] Ifrah 1986: S. 21
[20] Ifrah 1986: S. 23 (Fußnote). Zu einem psychologischen Modell der Entwicklung des Zahlbegriffes vergleiche auch das Kapitel „Einheiten, Vielheit und Zahl“ bei Glasersfeld 1997: S. 259ff.
[21] Wer sich mit dieser Thematik näher befassen will, dem empfehle ich, bei Ifrah 1986: S. 21 - 52 nachzulesen.
[22] Ifrah 1986: S. 21
[23] Barrow 1993: S. 19f
[24] Ifrah 1986: S. 23
[25] Ifrah 1986: S. 23
[26] Barrow 1993: S. 21
[27] vgl. Barrow 1993: S. 21
[28] Ifrah 1986: S. 34f
[29] Barrow 1993: S. 21
[30] Barrow 1993: S. 27
[31] Ifrah 1986: S. 35. Hervorhebung dort.
[32] Ifrah 1986: S. 35f. Hervorhebung dort.
[33] vgl. Ifrah 1986: S. 40
[34] Ifrah 1986: S. 42. Hervorhebung dort.
[35] Der Kardinalzahlaspekt bezieht sich auf die Mächtigkeit einer Menge, wie „fünf“, wenn ich sage, ich habe fünf Äpfel.
[36] Der Ordinalzahlaspekt bezieht sich auf eine Rangfolge, wie „dritter“, wenn ich sage, er ging als dritter durchs Ziel.
[37] vgl. Ifrah 1986: S. 46
[38] Dantzig, T.: Le nombre, langage de la science. Paris: 1931. S. 16f. Z.n. Ifrah 1986: S. 47
[39] vgl. Barrow 1993: S. 28
[40] Barrow 1993: S. 15
[41] Barrow 1993: S. 25f
[42] Barrow 1993: S. 27
[43] Barrow 1993: S. 27
[44] vgl. Frazer 1968: S. 15
[45] Frazer 1968: S. 54
[46] Wußing 1997: S. 13
[47] Barrow 1993: S. 42
[48] Barrow 1993: S. 43. Hervorhebung dort.
[49] vgl. Barrow 1993: S. 43f
[50] Barrow 1993: S. 44
[51] Barrow 1993: S. 44. Hervorhebung dort.
[52] vgl. Barrow 1993: S. 47
[53] Barrow 1993: S. 47
[54] Frazer 1968: S. 15
[55] Frazer 1968: S. 15
[56] Barrow 1993: S. 13
[57] Barrow 1993: S. 13. Hervorhebung dort.
[58] Wußing 1989: S. 48f
[59] Die fünf regelmäßigen oder ‘platonischen’ Körper sind: Tetraeder, Oktaeder, Hexaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. (vgl. Jansen, Küpperbusch, Lordick 1995: S. 257f)
[60] Sagan 1980: S. 69
[61] vgl. Frazer S. 15ff
[62] Barrow 1993: S. 10f
[63] Als Jungsteinzeit wird die Zeit von ca. 4500 v. Chr. bis ca. 2000 v. Chr. betrachtet. (vgl. Wußing 1997)
[64] Kotzmann 1988: S. 5
[65] vgl. Kotzmann 1988: S. 5f
[66] Kotzmann 1988: S. 6
[67] vgl. Kotzmann 1988: S. 6
[68] Kotzmann 1988: S. 6
[69] vgl. Wußing 1997: S. 17f
[70] Wußing 1997: S. 17
[71] vgl. Kropp 1994: S. 10f
[72] Kropp 1994: S. 10
[73] vgl. Wußing 1997: S. 15
[74] Wußing 1989: S. 33
[75] vgl. Wußing 1997: S. 15f
[76] Wußing 1997: S. 16
[77] vgl. Wußing 1989: S. 87
[78] Wußing 1989: S. 87
[79] Von manchen Autoren auch ‘Sulba-Sûtra’ geschrieben, z.B. Wußing 1989 und 1997.
[80] vgl. Wußing 1989: S. 87
[81] Wußing 1997: S. 27
[82] Kropp 1994: S. 18
[83] Wußing 1997: S. 27
[84] vgl. Wußing 1997: S. 24
[85] Wußing 1997: S. 24f
[86] vgl. Wußing 1997: S. 24ff
[87] Wußing 1997: S. 26
[88] vgl. Wußing 1997: S. 36
[89] Der Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman beschreibt in seinem autobiographischen Buch „Sie belieben wohl zu scherzen Mr. Feynman!“ auf erfrischende Weise seine Entzifferungsversuche am sogennanten „Kodex Dresden“, einer der drei erhaltenen Maya Schriften. (vgl. Feynman 1991: S. 414-420)
[90] Wußing 1997: S. 36
[91] vgl. Wußing 1997: S. 36
[92] Wußing 1997: S. 36
[93] Kotzmann 1988: S. 6
[94] vgl. Wußing 1997: S. 19ff
[95] vgl. Wußing 1997: S. 20
[96] vgl. Wußing 1989: S. 42
[97] vgl. Wußing 1989: S. 42
[98] vgl. Wußing 1989: S. 42
[99] vgl. Wußing 1989: S. 42f
[100] Kotzmann 1988: S. 7
[101] vgl. Kotzmann 1988: S. 6f - Kotzmann bezieht sich in seinen Ausführungen auf: Sohn-Rethel, A.: Geistige und körperliche Arbeit. Frankfuhrt a. M.: Suhrkamp 1972.
[102] Kotzmann 1988: S. 6 - Kotzmann bezieht sich hierbei auf: Kredovskij, O.I.: Wechselbeziehungen von Philosophie und Mathematik im geschichtlichen Entwicklungsprozeß. Leipzig: Teubner 1984.
[103] vgl. Wußing: 1989: S. 43
[104] vgl. Wußing: 1989: S. 44f
[105] Wußing 1989: S. 45
[106] Wußing 1989: S. 48
[107] Meschkowski 1990: S. 2
[108] vgl. Wußing 1989: S. 48f
[109] Wußing 1989: S. 49
[110] Zwei Strecken sind inkommensurabel, wenn es keine Einheitstrecke gibt, von der beide Strecken ganzzahlige Vielfache darstellen. Vermutlich wurden inkommensurable Strecken zunächst von dem Pythagoräer Hippasos von Metapontum anhand des gleichseitigen Fünfecks und seiner Diagonalen nachgewiesen. (vgl. Wußing 1989: S. 52f) Laut Meschkowski ist bei dem Antiken Schriftsteller Jamblichos von Chalkis (ca. 283 - 330 n. Chr.) über Hippasos folgendes zu lesen: „Ferner habe er ‘als erster das Wesen der Meßbarkeit und der Unmeßbarkeit an Unwürdige verraten’. Deshalb sei er nicht nur aus dem pythagoräischen Bunde ausgestoßen worden, sondern ihm sei auch ein Grab bereitet worden wie einem, der gänzlich aus dem Kreise seiner früheren Gefährten verschwinden soll [...].“ (Meschkowski 1990: S. 7)
[111] vgl. Wußing 1989: S. 52f
[112] vgl. Wußing 1989: S. 53f
[113] Wußing 1989: S. 56
[114] vgl. Wußing 1989: S. 56ff
[115] vgl. Wußing 1989: S. 59f
[116] Wußing 1989: S. 54
[117] Schischkoff 1961: S. 449
[118] vgl. Schischkoff 1961: S. 449
[119] Wußing 1989: S. 54f
[120] Crescenzo 1990: S. 99f
[121] Ernest 1991: S. 29
[122] vgl. Wußing 1989: S. 55
[123] vgl. Wußing 1989: S. 54 und 64
[124] Wußing 1989: S. 64
[125] Wußing 1989: S. 64f
[126] vgl. Wußing 1989: S. 65ff und Kropp 1994: S. 31f
[127] Meschkowski 1990: S. 17
[128] Wußing 1989: S. 66
[129] vgl. Wußing 1989: S. 66ff und Kropp 1994: S. 32
[130] vgl. Wußing 1989: S. 68
[131] Kropp 1994: S. 37
[132] Wußing 1989: S. 69
[133] Becker, O.: Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung. Freiburg; München. S. 56. Z.n. Wußing 1989: S. 69
[134] vgl. Wußing 1989: S. 73f
[135] Heron von Alexandria: Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia. Griechisch-deutsch herausgegeben von W. Schmidt, L. Nix, H. Schöne, J. L. Heiberg. 5 Bde., Leipzig 1899-1914. S. 173. Z.n. Wußing 1989: S. 75.
[136] Heron von Alexandria: Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia. Griechisch-deutsch herausgegeben von W. Schmidt, L. Nix, H. Schöne, J. L. Heiberg. 5 Bde., Leipzig 1899-1914. S. 175. Z.n. Wußing 1989: S. 75.
[137] vgl. Wußing 1989: S. 75
[138] vgl. Ernest 1991: S. 34
[139] vgl. Wußing 1989: S. 71ff
[140] vgl. Wußing 1989: S. 75f und Kropp 1994: S. 48f
[141] vgl. Wußing 1989: S. 64 u. 77
[142] Wußing 1997: S. 22
[143] vgl. Beck 1979: S. 86
[144] vgl. Kropp 1994: S. 49f
- Arbeit zitieren
- Jörg Dieter (Autor:in), 1998, Mathematik und Wirklichkeit - Von den Wurzeln der Mathematik zu einer Didaktik des Sachrechnens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9111
Kostenlos Autor werden
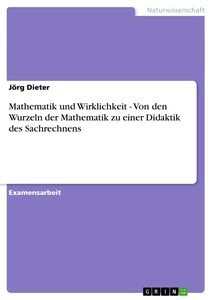
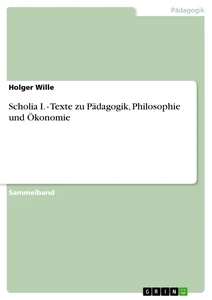











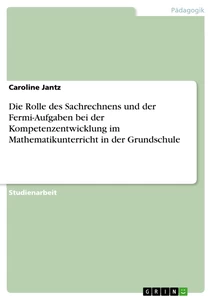






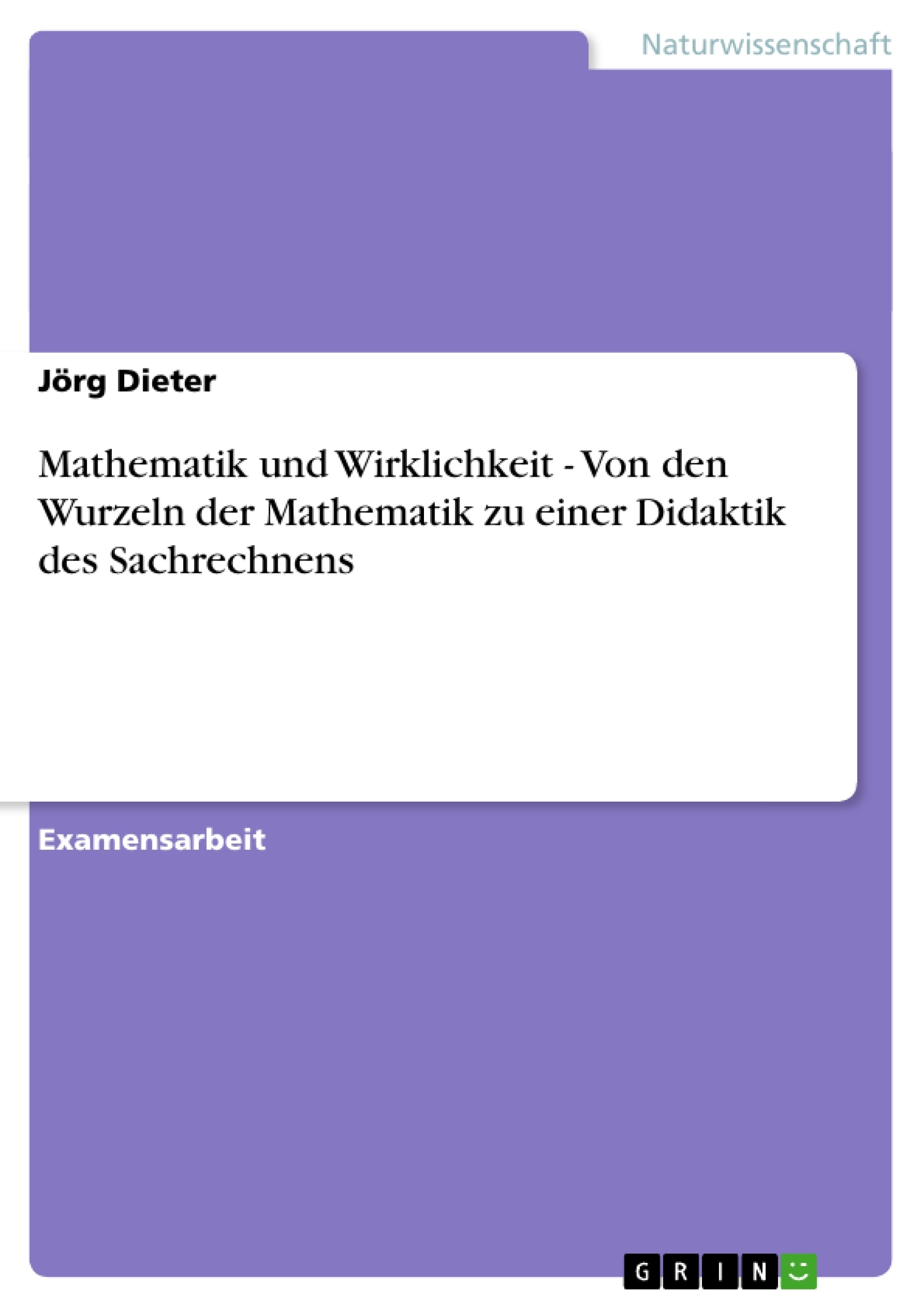

Kommentare