Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen des Wissensmanagements
2.1 Die Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen
2.2 Was ist Wissensmanagement?
2.3 Die Einbeziehung des Wissensmanagements
2.4 Wissensbilanzen
2.4.1 Wissen als Ressource?
2.4.2 Wie man Wissenskapital bilanzierbar machen könnte
3 Begriffe im Wissensmanagement
3.1 Der Begriff Wissen
3.1.1 Was ist Wissen?
3.1.2 Daten – Informationen – Wissen
3.1.3 Die Wissenstreppe
3.1.4 Und was ist relevantes Wissen?
3.1.5 Die Definitionen von Wissen
3.1.5.1 Der Wissensbegriff bei Gunnar Pautzke
3.1.5.2 Der Wissensbegriff bei Gilbert Probst et al.
3.1.5.3 Der Wissensbegriff bei Stefan Güldenberg
3.1.5.4 Der Wissensbegriff bei Jürgen Schüppel
3.1.5.5 Der Wissensbegriff bei Georg Schreyögg
3.1.5.6 Der Wissensbegriff von Michael Polanyi bei Nonaka Ikujiro und Hirotaka Takeuchi
3.1.6 Schlussfolgerungen
3.2 Der Begriff Lernen
3.2.1 Was ist Lernen?
3.2.2 Die Lernebenen
3.2.2.1 Lernen auf individueller Ebene
3.2.2.2 Lernen auf kollektiver Ebene oder organisationales Lernen
3.2.2.2.1 Der Begriff der lernenden Organisation
3.2.2.2.2 Die Arten des organisationalen Lernens bei Argyris und Schön
3.2.2.2.3 Die Arten des organisationalen Lernens bei Gunnar Pautzke
3.2.2.2.4 Die Arten organisationalen Lernens bei Stefan Güldenberg
3.2.2.2.5 Lernen bei Peter M. Senge
3.2.3 Lernbarrieren
3.2.3.1 Individuelle Lernbarrieren
3.2.3.2 Kollektive Lernbarrieren
3.2.3.3 Mentale Lernbarrieren
3.2.4 Schlussfolgerungen
4 Ein Vergleich von Wissensmanagementansätzen
4.1 Einleitung
4.2 Systemisches Wissensmanagement bei Helmut Willke
4.2.1 Voraussetzungen der Lernenden Organisation
4.2.2 Wissensmanagement
4.2.2.1 Wissensmanagement: ein Geschäftsprozess
4.2.2.2 Bewertung von Intellektuellem Kapital
4.2.2.3 Ein konkretes Instrument des Wissensmanagements: MikroArt
4.2.3 Kritische Analyse des Willkeschen Ansatzes
4.3 Der Ansatz von Gilbert Probst et al.
4.3.1 Die lernende Organisation nach Gilbert Probst und Bettina Büchel
4.3.2 Der Wissensmanagementansatz von Gilbert Probst, Stefan Raub und Kai Romardt
4.3.2.1 Wissensziele definieren
4.3.2.2 Wissen identifizieren
4.3.2.3 Wissen erwerben
4.3.2.4 Wissen entwickeln
4.3.2.5 Wissen (ver)teilen
4.3.2.6 Wissen nutzen
4.3.2.7 Wissen bewahren
4.3.3 Kritische Analyse des Probstschen Ansatzes
4.4 Der Ansatz von Jürgen Schüppel
4.4.1 Die lernende Organisation
4.4.2 Der Wissensmanagementansatz
4.4.2.1 Die vier Akte zum Wissensmanagement
4.4.2.2 Die Dimensionen des Wissensmanagements
4.4.2.2.1 Das Management von inneren und äußeren Wissenspotentialen
4.4.2.2.2 Das Management aktueller und zukünftiger Wissenspotentiale
4.4.2.2.3 Das Management von explizitem und implizitem Wissen
4.4.2.2.4 Das Management von Erfahrungs- und Rationalitätswissen
4.4.3 Kritische Analyse des Schüppelschen Ansatzes
4.5 Der Ansatz von Stefan Güldenberg
4.5.1 Die lernende Organisation
4.5.2 Der Wissensmanagementansatz
4.5.2.1 Wissensgenerierung
4.5.2.1.1 Vorhandenes internes Wissen nutzen
4.5.2.1.2 Neues Wissen gemeinsam entwickeln
4.5.2.1.3 Externes Wissen beschaffen
4.5.2.2 Wissensspeicherung
4.5.2.3 Wissenstransfer
4.5.2.4 Wissensanwendung
4.5.3 Wissenscontrolling
4.5.4 Kritische Analyse des Güldenbergschen Ansatzes
4.6 Der Ansatz von Peter M. Senge
4.6.1 Die lernende Organisation
4.6.1.1 Das Personal Mastery
4.6.1.2 Die Mentalen Modelle
4.6.1.3 Das Team-Lernen
4.6.1.4 Die gemeinsame Vision
4.6.1.5 Das Systemdenken
4.6.2 Kritische Analyse des Sengeschen Ansatzes
4.7 Der Ansatz von Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi
4.7.1 Die vier Akte der Wissensumwandlung
4.7.1.1 Sozialisation: von implizit zu implizit
4.7.1.2 Externalisierung: von implizit zu explizit
4.7.1.3 Kombination: von explizit zu explizit
4.7.1.4 Internalisierung: von explizit zu implizit
4.7.2 Die Wissensspirale
4.7.3 Voraussetzungen zur Wissensschaffung
4.7.3.1 Intention
4.7.3.2 Autonomie
4.7.3.3 Fluktuation und kreatives Chaos
4.7.3.4 Redundanz
4.7.4 Kritische Analyse des japanischen Ansatzes
4.8 Fazit
5 Kritische Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Die Begriffe post-industrielle Dienstleistungsgesellschaft, Informationsgesellschaft, ja Wissensgesellschaft stehen seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Zentrum mannigfaltiger sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Wissen und Lernen werden zu vermeintlich neuen Produktions- und Erfolgsfaktoren für Wirtschaft und gesellschaftliche Entwicklung erklärt. Aus volkswirtschaftlicher Sicht soll Wissen „semper et ubique“ verfügbar sein, sollen seine Kommerzialisierung und Kapitalisierung zur Optimierung der Ressourcennutzung und zur Generierung immer neuen Wohlstands dienen. Auf die Mikroebene heruntergebrochen soll die Disziplin „Wissensmanagement“ – ein Diskurs über die optimale Schaffung und Nutzung von Wissen im unternehmerischen Umfeld – Organisationen auf das Morgen vorbereiten und ihnen das Überleben in einer globalisierten und damit einhergehend immer wettbewerbsintensiveren Umwelt ermöglichen.
Doch was versteckt sich hinter dem viel strapazierten „Buzz word“ Wissensmanagement eigentlich wirklich? In wie weit sind die Zielgruppen dieses Ansatzes schon für seine Kernideen sensibilisiert? Kann er schon konkrete, belegbare Erfolge verzeichnen? Hält der euphemisch gepriesene Begriff Wissensmanagement was er verspricht, oder bleibt er trotz marktschreierisch hochstilisierter Verwertung in der Managementliteratur, in Seminaren, Vorträgen und in der Unternehmensberatung nur eine hohle Phrase ohne Tiefgang und überzeitliche Relevanz. Die zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema finden keine einheitliche Antwort auf all diese Fragen, einzig einigendes Vinkulum ist der offensichtlich unerschütterliche Glaube an die überragende Bedeutung des Wissensmanagements für die Unternehmen und die soziale Umwelt des 21. Jahrhunderts. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Gemeinsamkeiten ausgewählter Wissensmanagementströmungen herauszufiltern, Unterschiede zwischen ihnen klar zu machen und Defizite aufzudecken. Das kritische Hinterfragen der meist widerspruchslos akzeptierten „Denke“ Wissensmanagement ist der Anspruch der vorliegenden Analyse.
Dieser an sich betriebswirtschaftlichen Thematik habe ich mich als Soziologin aus mehreren Gründen angenommen. Einerseits galt und gilt mein wissenschaftliches Interesse soziologischen Fragestellungen mit einem ausgeprägten wirtschaftlichen Konnex, andererseits ist es die Neugier an soziologisch wenig erschlossenen aktuellen Begrifflichkeiten, die mich dem Thema Wissensmanagement in die Hände trieb.
Für das Gelingen dieser Arbeit und zum Abschluss meines Studiums möchte ich einigen lieben Menschen danken.
Mein Dank gilt Herrn ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Prisching, der mir mit seinen Vorträgen die Augen für die Wirtschaftssoziologie öffnete und maßgeblich dafür verantwortlich zeichnet, dass aus meiner Studienzeit hochinteressante und intellektuell herausfordernde Jahre wurden. Danken möchte ich ihm auch für die anregenden Gespräche im Rahmen der Diplomarbeitsbetreuung, die mir Motivation und Antrieb für die harte Arbeit waren.
Dank gilt auch meinen Eltern und meiner Schwester Katrin, die mir die Möglichkeit gaben, mein Studium in so kurzer Zeit abzuschließen. Herrn Mag. Leo Borchardt möchte ich für die vielen langen Gespräche danken, die mir Kraft spendeten, sowie für die Zeit, die er für das Korrekturlesen opferte.
Ein ganz besonderer Dank soll an dieser Stelle an meine Mutter und beste Freundin, Frau Stefanie Neuböck, ergehen. Sie hat mir mein ganzes Leben hindurch geholfen meinen Weg zu finden und mir die Möglichkeit gegeben, diesen auch zu beschreiten. Nur durch sie hatte ich letztendlich die Ausdauer, Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen. Ihr sei diese Arbeit gewidmet.
Kristina Neuböck
Obdach und Graz, im Mai 2005
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bedeutungszunahme von Wissen im Rahmen der Wertschöpfung
Abbildung 2 Die Beziehung zwischen den Ebenen der Begriffshierarchien
Abbildung 3: Daten – Informationen – Wissen
Abbildung 4: Die Wissenstreppe
Abbildung 5: Das 5-Schichtenmodell der organisationalen Wissensbasis
Abbildung 6: Wissensarten bei Georg Schreyögg
Abbildung 7: Implizites versus explizites Wissen
Abbildung 8: Anpassungslernen im Rahmen des single loop learning
Abbildung 9: Veränderungslernen im Rahmen des double loop learning
Abbildung 10: Die Wissensbausteine
Abbildung 11: Die vier Akte zum Aufbau eines Wissensmanagements
Abbildung 12: Die Wissensumwandlung
Abbildung 13: Die Wissensspirale
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Wissensmanagement gehört momentan zu den am meisten diskutierten Managementansätzen.[1] Dabei werden die Weiterbildung der Mitarbeiter und das Verwalten von Wissen als bedeutendste Wettbewerbsfaktoren angesehen, und „Wissen wird neben Kapital und Arbeit zum neuen zentralen Unternehmenswert“.[2] Die Diskussion um Wissensmanagement findet vor dem Hintergrund eines turbulenten Unternehmenskontexts mit explosionsartiger Vermehrung von Information und Wissen statt.[3] Ihre Notwendigkeit wird besonders durch Laßlebens Geschichte „Von schwitzenden Fröschen im Zeitalter des Lernens“ deutlich (vgl. Laßleben 2002: 2ff). In ihr hält Laßleben fest, dass Umweltveränderungen Organisationen bedrohen und ein Fortbestand nur durch eine Adaption an die sich rasant wandelnden Rahmenbedingungen gesichert ist. Eine Annäherung an veränderte Umweltbedingungen kann, wie beim Frosch, der aus dem Glas hüpft, wenn es ihm zu heiß wird, nur durch Lernen geschehen. (Vgl. Laßleben 2002: 2ff) Wissensmanagement wird nun als ein neues, Erfolg versprechendes Managementprinzip gefeiert. Die Zahl der einschlägigen Publikationen hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, und vor allem in den USA wurde die lernende Organisation zum vieldiskutierten Konzept (vgl. Dehnbostel et al. 1998: 7). Leider ist die Disziplin des Wissensmanagements bis heute für viele unklar geblieben, denn die Konzepte und Ideen sind ausgesprochen komplex und unterscheiden sich fundamental. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, einen eingehenden Vergleich unterschiedlicher Wissensmanagementansätze vorzunehmen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einflussreiche Wissensmanagementansätze vorzustellen und im Anschluss daran kritisch die Vor- und Nachteile der Modelle aufzuzeigen. Bei der Auswahl der Ansätze wurde auf eine große Bandbreite Wert gelegt, um dem Leser die Diversität des Begriffs und der einzelnen Konzepte darzulegen.
Am Ende soll der Leser einen kritischen Einblick in verschiedenste Wissensmanagementansätze erhalten haben. Dabei wird vor allem auf die Aufdeckung und das Hinterfragen von Schwachpunkten in den einzelnen Theorien Wert gelegt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus fünf Kapiteln zusammen. Nach einer Einführung werden in Kapitel 2 die Grundlagen des Wissensmanagements dargelegt und unterschiedliche Definitionen von Wissensmanagement analysiert. Im Anschluss daran werden die – oft Verwirrung stiftenden – Unterschiede in den Terminologien dieser Wissensmanagementideen erläutert. Im vierten Kapitel werden sechs einflussreiche und vielzitierte Wissensmanagementkonzepte vorgestellt und kritisch durchleuchtet. Im letzten Kapitel wird auf die Schwächen des Wissensmanagements und seiner Ansätze eingegangen und ein Resümee gezogen.
2 Grundlagen des Wissensmanagements
2.1 Die Wissensgesellschaft und ihre Auswirkungen
Wir befinden uns momentan in der sogenannten „post-kapitalistischen Gesellschaft“ oder in der „post-industriellen Gesellschaft“ (vgl. insbesondere Kmuche 2000: 3) und sind nun auf dem Weg in eine Dienstleistungs-, Informations- und Wissensgesellschaft (Schneider 1996: 13). Anders als in der kapitalistischen bzw. industriellen Gesellschaft treten heute die Faktoren Information und Wissen in den Vordergrund (vgl. Kmuche 2000: 5). In den letzten Jahren wurden neue wissensintensive Unternehmen geschaffen, die flexibler und fließender in ihren Strukturen sind und deren Merkmale Massenkundenspezifik, Kundeneinbindung in das Produktdesign und die -herstellung und die Verknüpfung von Lieferanten, Distributoren und strategischen Partnern sind (vgl Edvinsson 2000: 17). Durch die neue Rolle des Produktionsfaktors Wissen kommt es auch zu einer Veränderung der modernen Arbeits- und Wohlfahrtsgesellschaft (vgl. Willke 2001: 289). Im Jahr 2000 arbeitete bereits ein Drittel der Beschäftigten in „Nichtnorm-Arbeitsverhältnissen“. Manuelle Arbeit wird durch Automatisierung und Mechanisierung immer unbedeutender, es kommt zu einer Zunahme des Kapitaleinsatzes und Wissen wird zum vierten Produktionsfaktor. (Vgl. Edvinsson et al. 2000: 16) Die Arbeitskräfte-Verteilung 2004 im primären, sekundären und tertiären Sektor macht sichtbar, dass wir uns auf dem Wege weg von der Massenproduktion hin zur Dienstleistung bewegen. Wissen wird zur wichtigsten unternehmerischen Ressource, die gemanagt werden muss, um sie nützen zu können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Bedeutungszunahme von Wissen im Rahmen der Wertschöpfung (vgl. Güldenberg 1998: 244)
Aber dass Wissen Macht ist, weiß man nicht erst seit Francis Bacon. Bereits Sun Tsu schreibt in seinem 2500 Jahre alten Klassiker „Die Kunst des Krieges“, dass Wissen ein zentraler Punkt in der militärischen Führung sei. Denn „... der Schlüssel zum Sieg ... (ist die) genaue Kenntnis der aktuellen Situation...“ und „... derjenige (ist) nie in Gefahr ..., der sich selbst und den anderen kennt.“ (Sun Tsu 2002: 37). Trotzdem ist der Umgang mit Wissen innerhalb von Organisationen bis dato vielfach unzureichend. Zwar ist der Großteil der Unternehmen sich der Wichtigkeit der Ressource Wissen bewusst – circa 75 % der deutschen Unternehmen beschäftigen sich zumindest formal mit dem Thema Wissensmanagement – die Faktoren Zeitknappheit, fehlende Transparenz und die Einstellung „Wissen ist Macht“ stellen jedoch die größten Barrieren zur Umsetzung dar.[4] Einige Beispiele, die das Fehlen von Wissensmanagement kennzeichnen, nennt Lutz von Rosenstiel: Unternehmenskrisen, die durch den Tod eines Mitarbeiters hervorgerufen werden; Mitarbeiter, die einerseits im Wust der ankommenden E-Mails ersticken, jedoch über die mangelhafte Informationslage klagen; Schlüsselkräfte, die die Weitergabe von Informationen und Wissen verweigern, weil sie darin die Quelle ihrer Macht vermuten (vgl. von Rosenstiel 2000: 143). Die Lösung für diese Probleme soll die Implementierung eines strukturierten und zielorientierten Wissensmanagements sein, das die Unternehmen von heute fit für das Morgen machen soll.
2.2 Was ist Wissensmanagement?
„Die zielgerichtete Gestaltung organisationaler Lernprozesse wird auch als Wissensmanagement bezeichnet.“ (Staehle 1999: 920)
In der Organisations- und Managementlehre ist Wissensmanagement seit den 1980er Jahren zur geistigen Bewältigung der immer komplexer werdenden Lebenswelten und der damit verbunden Wissensexplosion ein Begriff (vgl. Petkoff 1998: 15). Im Jahr 1999 wurde eine Delphi-Studie zum Thema Wissensmanagement durchgeführt, an der Experten aus Wissenschaft und Praxis teilnahmen. Die Studie sollte einen ersten Diskurs und fruchtbare Ansätze für weitere Arbeiten einleiten. Die wichtigsten Ergebnisse: (Vgl. im Folgenden Mandl et al. 1999: 9)
- Lernen und Weiterbildung gehören zu den gesellschaftlichen Zielen des Wissensmanagements.
- Wissensmanagement ist bis dato in den Organisationen suboptimal realisiert.
- Informations- und Kommunikationstechnologien sind eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für das Verwirklichen eines Wissensmangementkonzepts.
- Für den einzelnen ist die Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Informationen und Wissen, Kommunikations- und Lernbereitschaft, interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie Offenheit und Selbstmotivation wichtig, um Wissensmanagement durchsetzen zu können.
Die Ergebnisse zeigten, dass Lernen und Weiterbildung – im Speziellen die Bereitschaft dazu – sowie Informations- und Kommunikationstechnologien wichtige Eckpfeiler im Diskurs über Wissensmanagement darstellen.
Die Definitionen von Wissensmanagement
In der Literatur findet man eine Reihe verschiedener Definitionen des Wissensmanagements.
Helmut Willke meint: „...Wissensmanagement meint die Gesamtheit kooperativer Strategien zur Schaffung einer ‘intelligenten’ Organisation“ (Willke 2002: 15; 2001: 39).
Kai Romhardt unterstreicht bei seiner Definition von Wissensmanagement die Entstehung eines „...neuen Unternehmenstyp(s) ..., welchen ... (Forscher) als knowledge-intensive oder intelligent beschreiben“ (Romhardt 1998: 2) und er thematisiert die Rolle des knowledge workers (vgl. Romhardt 1998: 4).
Jakob Rehäuser und Helmut Kremar setzen den Faktor Wissen und Information nicht an Stelle, sondern neben die klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Werkstoffe und Betriebsmittel. Für sie wird der Erfolg eines Unternehmens durch eine erfolgsträchtige Unternehmensstrategie erzielt, die sich vor allem aus der Ungleichverteilung von Information und Wissen in der Wirtschaft ergibt. Erfolgreiche Unternehmen sind demnach bestrebt, neue wirtschaftlich relevante Informationen und Wissensunterschiede aufzudecken, zu entwickeln und umzusetzen. (Vgl. Kehlenbeck 2000 : 38) Die Aufgabe des Wissensmanagement sehen sie darin, die „...infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine lernende Organisation zu schaffen, damit die organisatorische Wissensbasis genutzt, verändert und fortentwickelt werden kann.“ (Rehäuser et al. 1996: 20)
Für Stefan Güldenberg hat Wissensmanagement eine ganzheitliche und unternehmensübergreifende Funktion der Wissensgenerierung, der Wissensspeicherung, des Wissenstransfers und der Wissensanwendung (vgl. Güldenberg 1998: 246).
Für Jürgen Schüppel muss Wissensmanagement auf die zielgerichtete, geplante Wissensversorgung einer Organisation, auf die Handhabung der Ressource Wissen als knappes Gut, auf Kosten- und Leistungspotentiale von Wissen, auf Wissensquellen und die Nutzung von unterstützenden Systeme der Wissensproduktion, -reproduktion, -distribution, -verwertung und des Wissensflusses ausgerichtet sein (vgl. Schüppel 1996: 187).
Klaus Götz definiert hingegen Wissensmanagement so: „... (Es dient zur) Erreichung unternehmerischer Ziele, vor allem durch seinen Fokus auf die Strategieumsetzung.“ (Götz 2002: 267)
Für Thomas Davenport et al. muss sich Wissensmanagement zum Ziel setzen, Wissensspeicher zu erstellen, den Zugriff auf Wissen zu verbessern, ein wissensorientiertes Umfeld zu fördern und Wissen als Gut zu betrachten und zu behandeln (vgl. Kehlenbeck 2000: 96).
Klaus North sieht als Ziel des Wissensmanagements „...vorhandenes Wissen optimal zu nutzen, weiterzuentwickeln und in neue Produkte, Prozesse und Geschäftsfelder umzusetzen.“ (North 1999: 3) Wissenskapital soll nach North vermehrt und dadurch der Unternehmenswert gesteigert werden. Knowledge Management geht über die Grenzen des Unternehmens hinweg; es bezieht Kunden, Lieferanten, Partner und Know-how-Träger mit ein. (Vgl. North 1999: 3) Die Aufgaben und Ziele des Wissensmanagements sieht North in der Wissensbeschaffung, Wissensentwicklung, im Wissenstransfer, in der Wissensaneignung und in der Wissensweiterentwicklung (vgl. North 1999: 4).
Gilbert Probst et al. gehen davon aus, dass Wissensmanagement einen Überblick über Konzepte und Methoden zur Bewältigung der wissensintensiven Unternehmensumwelt gibt (vgl. Probst et al. 2003: 10).
Für Harald Ackerschott ist Wissensmanagement „...das Management des Unternehmenswissens mit dem Ziel der Kompetenzsteigerung, um im Wettbewerb zu gewinnen“ (vgl. Ackerschott 2001: 26).
Für Peter Pawlowsky beschäftigt sich erfolgreiches Wissensmanagement mit drei wesentlichen Gestaltungsdimensionen: (Vgl. Pawlowsky 2002: 113)
- mit strukturellen Aspekten, die insbesondere Fragen der Organisation von Geschäftsprozessen und der Arbeitsorganisation behandeln,
- mit sozialpsychologischen Aspekten, welche die Wahrnehmung und Einstellung der Mitarbeiter zu Kernkompetenzen des Unternehmens sowie die Schaffung einer Lernkultur und eines Vertrauensklimas in den Mittelpunkt stellen, und mit der
- technologischen Infrastruktur und ihren unterstützenden Instrumenten.
Bemerkenswert ist, dass Pawlowsky als einen der drei Grundpfeiler eines erfolgreichen Wissensmanagements den lernenden Mitarbeiter nennt. Struktur, Technik und Mensch ergänzen sich in Pawlowskys Konzept zu einer erfolgreichen betrieblichen Wissensarbeit.
Meines Erachtens ist eine weitere treffende Definition die folgende:
„Wissensmanagement ist ... der Kernprozess zur Bereitstellung und aktiven Nutzung von vernetzten Informationen sowie Fähigkeiten von Personen.“ [5]
Die Definitionen des Begriffs Wissensmanagement sind mannigfach. Die einen zielen auf unterschiedliche Strategien ab, die das Unternehmen zum Unternehmenserfolg leiten sollen, die anderen sehen den Sinn des Wissensmanagements in der Schaffung eines neuen wissensbasierten Unternehmens- und Organisationstyps. Augenscheinlich ist jedoch, dass eine wichtige Aufgabe des Wissensmanagements die sinnvolle Nutzung und der bedachte Umgang mit der Ressource Wissen ist.
Die besten Definitionen des Wissensmanagements bieten meines Erachtens Rehäuser et al. an , die Wissensmanagement als Voraussetzung zur Schaffung von lernenden Organisationen verstehen, sowie Klaus Götz, der Wissensmanagement als Strategie zur Erreichung von Unternehmenszielen versteht. Ein weiteres Plus an Rehäusers et al. Definition ist meines Erachtens, dass sie den Faktor Wissen neben die und nicht an Stelle der klassischen Produktionsfaktoren setzen.
Da Wissensmanagementansätze mit verschiedenen Wissensmanagementdefinitionen arbeiten, fallen die Konzepte sehr unterschiedlich aus, denn die Definitionen haben großen Einfluss auf die Grundkonzepte der Modelle. Zwar ist dem Wissensmanagement bis heute noch nicht der vollständige Durchbruch gelungen, sicher ist jedoch, dass es zur Erhöhung des Unternehmenserfolgs dienen sollte, indem es Wissen sowie Nicht-Wissen sichtbar macht bzw. neues Wissen generiert und bestehendes besser zu nutzen versucht.
2.3 Die Einbeziehung des Wissensmanagements
Welche Gründe bewegen Unternehmen, sich mit Wissensmanagement auseinander zu setzen? Die zwei häufigsten Faktoren sind:
1. Turbulenzen und Krisen: durch verschiedene Störeinflüsse wie Unzufriedenheit, Konflikte, Stress, Neugier, Umweltveränderungen oder Konkurrenzdruck kann sich im Betrieb ein Lernprozess formieren, wobei es wichtig ist, dass Handlungsnotwendigkeiten rechtzeitig erkannt werden (vgl. Probst et al. 1998: 49f).
2. Ressourcenreichtum: Es zeigt sich, dass nicht nur problembetroffene Unternehmen lernen können, sondern auch solche, die über freie Ressourcen verfügen. Zeit und Geld ist notwendig, um nach neuen innovativen Lösungen zu suchen. Brachliegende Mittel können für Kreativität und Lernprozesesse eingesetzt werden. (Vgl. Probst et al. 1998: 50)
3. Weitere Auslöser für Lernprozesse können divergierende Meinungen von Mitarbeitern, die betriebsinterne Störungen hervorrufen, sein, sowie die Neuorientierung des Unternehmens durch einen Führungswechsel oder die Neueinstellung von Wissensträgern. (Vgl. Probst et al. 1998: 52)
2.4 Wissensbilanzen
2.4.1 Wissen als Ressource?
Wenn es nach dem amerikanischen Management-Professor James Brian Quinn geht, dann werden in vielen Unternehmen bereits drei Viertel des Mehrwerts auf Wissen zurückgeführt (vgl. Probst et al. 2003: 3). Wissen wird also zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren erkoren. Da Wissen und Nicht-Wissen die Grundlage der Entscheidungen darstellen, werden sie zum bedeutendsten Bestandteil des Unternehmenserfolgs (vgl. Kmuche 2000: 7).[6]
Wenn es nach Experten geht, führt die Ressource Wissen zu einer Verbesserung des Kundennutzens durch die Einbeziehung von Kundenwissen zu einer Beschleunigung von Innovationsprozessen, zu einer Verbesserung der Unternehmensvitalität sowie zu einer erhöhten und schnelleren Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit (vgl. Augustin 2000: 159). Um beim schnelllebigen Wandel der Wissensgesellschaft mithalten zu können, müssen sich Unternehmen daher der Ressource Wissen bewusst werden und lernen, diese optimal zu nützen.
Die Begrifflichkeit „Wissen als Ressource“ findet man immer wieder in der einschlägigen Literatur zum Thema Wissensmanagement. Vor allem der Pionier auf dem Gebiet des Wissensmanagements Leif Edvinsson (vgl. Edvinsson 2000: 224) ist bekannt für diese Wortwahl. Wenn die Autoren auch zumeist seine Begrifflichkeit übernehmen, so gibt es doch kritische Auseinandersetzungen. Soukup ist der Meinung, man sollte nicht einfach von Wissensressourcen sprechen, denn „Wissen ist keine Tiefkühlkost, die nach Belieben gelagert, zerteilt und transportiert werden kann,“ (Soukop 2002: 197). Der DaimlerChrysler-Dissertant Christoph Soukup sieht in Wissen einen Konkurrenzbegriff zu Lernen und ist der Meinung: „Wer weiß, lernt nicht“ (Soukup 2002: 198f). Später wird auf das Problem „Wissen als Lernbehinderung“ noch näher eingegangen.[7]
2.4.2 Wie man Wissenskapital bilanzierbar machen könnte
„In zehn Jahren wird intellektuelles Kapital die am meisten beobachtete Größe im Jahresbericht sein...“ (vgl. Probst et al. 2003: 213)
Die Frage, ob Wissen als Ressource in der Bilanz genauso seinen Platz haben sollte wie Anlage- und Umlaufvermögen und Eigen- und Fremdkapital, hat speziell den Vorreiter in Sachen Wissensmanagement beschäftigt. Edvinsson[8] hat sich in seinem Buch „Aktivposten Wissenskapital: Unsichtbare Werte bilanzierbar machen“ mit dieser Problematik intensiv auseinander gesetzt. Für Edvinsson ist für Unternehmen, Organisationen und intelligente Anleger nur das Wissenskapital eines Unternehmens von Bedeutung. (Vgl. Edvinsson 2000: 18) Herkömmliche Bilanzierungsrichtlinien scheinen daher immer weniger aussagekräftig zu sein (vgl. Probst et al. 2003: 215).
Der wesentliche Unterschied zwischen einer Wissensbilanz und der herkömmlichen Finanzbilanz ist, dass nicht die Menge des Wissens über deren Wert bestimmt; Wissen kann niemals den Anspruch erheben, vollkommen vorhanden zu sein (vgl. Geyer et al. 2003: 146f). Zusätzlich arbeitet die Finanzbuchhaltung mit Zahlenmaterial aus der Vergangenheit, die Wissensbilanz ist jedoch in die Zukunft gerichtet (vgl. Geyer et al. 2003: 147).
Die Notwendigkeit einer solchen Bilanz wird gerade durch Leif Edvinssons Arbeit offensichtlich. Edvinsson verwendet in seiner Darstellung eine Metapher und vergleicht Organisationen mit einem Baum. Stamm, Äste, Zweige, Blätter – also alles Sichtbare – können als Jahresberichte, Quartalsberichte, Firmenprospekte etc. dargestellte werden. Doch der Baum (die Organisation) besteht nicht nur aus sichtbaren Elementen. Die Hälfte des Baums liegt im Wurzelsystem unter der Erde. Diese Wurzeln sagen uns, wie gesund der Baum in den nächsten Jahren sein wird (vgl. Edvinsson 2000: 18). Für Edvinsson sind gerade die verborgenen, dynamischen Faktoren, die unter den sichtbaren liegen, so wertvoll (vgl. Edvinsson 2000: 19). Um diese Fakten auch bewerten zu können, entwickelte Edvinsson daher das Modell des Skandia Navigators, das immaterielle Vermögenswerte misst und bewertet. Dadurch kann ein Unternehmen die Differenz zwischen seinem Marktwert und seinem Buchwert aufschlüsseln. Es wird dadurch möglich, den „wahren“ Wert eines Unternehmens und dadurch auch zukünftige Erfolgspotenziale zu erfassen. (Vgl. Eschenbach 2004: 61)
Als erstes Unternehmen der Welt hat Skandia im Jahr 1995 den ersten „Jahresbericht Intellectual Capital“ als Ergänzung zum Finanzbericht veröffentlicht (vgl. Edvinsson 2000: 22). Dieser fand internationale Beachtung und ist mittlerweile zur Standardlektüre für die Wissensbewertung geworden (vgl. Eschenbach 2004: 70).
Intellektuelles Kapital wird mit Blick auf Skandia definiert als
„... der Besitz von Wissen, angewandter Erfahrung, Organisationstechnik, Kundenbeziehung und professioneller Fertigkeit, der ... einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt gibt.“ (Edvinsson 2000: 38)
Intellektuelles Kapital setzt sich einerseits aus dem Humankapital, andererseits aus dem Strukturkapital zusammen. Humankapital besteht aus den individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen aller Mitarbeiter und der Kreativität und Innovationskraft der Organisation und ist somit das gesamte geistige und körperliche Potenzial der Mitarbeiter einer Organisation. (Vgl. Edvinsson 2000: 28f) Es entsteht durch Investitionen in die Personalentwicklung und in die Unternehmenskultur. Unternehmen können Humankapital jedoch nicht „besitzen“, weil es „abends nach Hause geht“. (Vgl. Eschenbach 2004: 64) Als Strukturkapital werden die Qualität und Reichweite von informationstechnologischen Systemen, Firmenimages, Datenbanken, Organisationskonzepten, Dokumentationen u.v.m. bezeichnet (vgl. Edvinsson 2000: 28f). Unternehmen können im Gegensatz zu Humankapital Strukturkapital besitzen. Es ist alles das, was übrig bleibt, wenn Beschäftigte abends nach Hause gehen. (Vgl. Eschenbach 2004: 64)
Als Formel dargestellt ist Intellektuelles Kapital (vgl. Edvinsson 2000: 39):
Intellektuelles Kapital = Humankapital + Strukturkapital
Edvinsson erwähnt drei fundamentale Merkmale von Intellektuellem Kapital: (Vgl. Edvinsson 2000: 37 und Eschenbach 2004: 65)
1. Intellektuelles Kapital ist eine Information, die Finanzinformationen ergänzt, ihnen aber nicht untergeordnet ist.
2. Intellektuelles Kapital ist nicht-finanzielles Kapital und repräsentiert die Lücke zwischen Buchwert und Marktwert.
3. Intellektuelles Kapital als buchhalterisches nicht-finanzielles Vermögen ist eine Verbindlichkeit.
Zur Messung von Wissenskapital entwickelte Skandia den Skandia Navigator. Er benutzt den weit verbreiteten Balanced-Scorecard-Ansatz[9] von Robert Kaplan und David Norton. Sie haben mit dieser Idee den Grundstein für die weitere Entwicklung der Wissensbilanz gelegt (vgl. Geyer et al. 2003: 143). Neben der Grundlage für Edvinssons Navigator wurde die Balanced Scorecard auch zur Basis des Modells „Intangible Assets Monitor“, das wiederum Kennzahlen zur Messung von immateriellen Vermögenswerten und Wissensströmen enthält (vgl. Geyer et al. 2003: 144).
Mittels der Balanced Scorecard werden finanzielle Kennzahlen der Vergangenheit mit treibenden Faktoren der Zukunft, wie z.B. finanzielle Perspektive, Kundenperspektive, Perspektive interner Geschäftsprozesse, Innovationsprozesse etc. ergänzt (vgl. Geyer et al. 2003: 144). Den Vorteil der Balanced Scorecard sieht North in der Verbindung langfristiger Unternehmensziele mit den notwendigen Veränderungen der organisationalen Wissensbasis (vgl. North 1999: 195).
Edvinssons Navigator verfügt, im Gegensatz zur Balanced Scorecard, zusätzlich über einen speziellen Teil für das Human-Resources-Management (vgl. Eschenbach 2004: 66). Der Navigator wird durch die Metapher eines Hauses erklärt, wobei das Haus für das Unternehmen steht, und es als Werkzeug zur Steuerung von Wissen, zur Kommunikation und zur Implementierung der Unternehmensvision dient.
Der Skandia Navigator macht aus fünf Blickwinkeln deutlich, wie sich intellektuelles Kapital einer Organisation entwickelt (vgl. Eschenbach 2004: 67ff) und dass übliche Messkriterien nur vergangene Leistungen messen, während erst durch die Evaluation von Lern- und Innovationsfähigkeit die zukünftige Leistungsfähigkeit messbar wird (vgl. Willke 2001: 80).
Im Folgenden werden die Teile des Navigators erklärt (Vgl. im Folgenden Eschenbach 2004: 67ff):
1. Der Finanzfokus: Der Finanzfokus bildet das Dach des Hauses und enthält Indikatoren aus der Finanzbuchhaltung, wie z.B. das Gesamtvermögen, den Umsatz etc. Diese Indikatoren messen Ergebnisse aus der Vergangenheit; im Gegensatz zu den restlichen Fokussen.
2. Der Kundenfokus: Der Kundenfokus bildet die erste Wand des Hauses, der der Kapitalform des Kundenkapitals entspricht. Die Indikatoren beziehen sich u.a. auf den Marktanteil, die Dauer von Kundenbeziehungen, die Anzahl verlorener Kunden etc..
3. Der Prozessfokus: Der Prozessfokus bezieht sich auf die zweite Wand des Hauses und beschäftigt sich mit Strukturkapital; wie z.B. mit Indikatoren für interne Abläufe, dem Zusammenhang von Einsatz von Informationstechnologie, Qualität und Effizienz.
Prozess- und Kundenfokus zusammen beschreiben die gegenwärtigen Aktivitäten der Organisation.
4. Der Humanfokus: Der Humanfokus steht im Zentrum des Hauses und beeinflusst als einziger alle anderen Fokusse. Er nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Wissenskapitals ein. Indikatoren sind u.a. Ausbildung, Motivation, Mitarbeiterfluktuation u.v.m.
5. Der Erneuerungs- und Entwicklungsfokus: Dieser Fokus bildet das Fundament des Hauses. Im Mittelpunkt steht die Bewertung des strategischen Erneuerungspotentials. Indikatoren können das Verhältnis von Kosten für Forschung und Entwicklung oder Informationstechnologie zu den Verwaltungskosten, der Anteil der Weiterbildung an den Gesamtkosten oder der Anteil der Patente etc. sein.
Insgesamt wurden von Skandia mehr als 150 Indikatoren für alle fünf Fokusse entwickelt; teilweise gehen diese auch sehr genau auf das Versicherungsgeschäft ein, wobei das Konzept auf keinen Fall starr ist, sondern den Rahmenbedingungen und Bedürfnissen jeder Organisation angepasst werden kann.
Die Effektivität des Navigators ergibt sich aus folgenden drei Punkten (Vgl. im Folgenden Eschenbach 2004: 69f):
- Der Navigator soll Position, Richtung und Geschwindigkeit der Entwicklung festhalten.
- Als Ergebnis können Unternehmen direkt mit dem Wissenskapital von Mitbewerbern verglichen werden.
- Die Nutzung eines solchen Navigators sollte eine Selbstverständlichkeit sein; die Praxis wird diesem Anspruch jedoch nicht gerecht, ist doch in der Umsetzung mit erheblichem Aufwand zu rechnen.
Für Leif Edvinsson und Skandia liegt der Wert eines Unternehmens in der Fähigkeit dauerhaft Werte zu schaffen, indem es eine Geschäftsvision und die daraus resultierende Strategie verfolgt (vgl. Edvinsson 2000: 23). Die Entwicklung der Wissensbilanzierung ist für Edvinsson längst nicht abgeschlossen und er lädt in Poppers Sinn zur Kritik, Veränderung und Ergänzung seines Konzeptes ein. Fest steht, dass Edvinssons Konzept des Skandia Navigators eine praxisnahe Wissensbewertung und ein strategisches Konzept zur Wissensnavigation darstellt; er wurde auch schon zur Bewertung nationaler Wettbewerbsfähigkeit und Performance herangezogen. (Vgl. Eschenbach 2004: 70)
3 Begriffe im Wissensmanagement
3.1 Der Begriff Wissen
3.1.1 Was ist Wissen?
„Wissen ist Standortfaktor und Lebens-Mittel“ (Mandl et al. 2002: 239).
Die Frage, was Wissen ist und wie es entsteht, ist seit Hunderten von Jahren eine Fragestellung der Philosophie (vgl. Mandl et al. 2000: 4f). In der Antike waren es Platon und Aristoteles, später Descartes und Locke, um 1800 Hegel, Kant und Marx und schließlich im 20. Jahrhundert die Vertreter des kartesianischen Dualismus, die eine Antwort auf diese Frage zu finden versuchten (vgl. Nonaka 1997: 32ff). Die Vielfalt an Wissensbegriffen ist groß, und den Grund dafür sieht Schüppel vor allem darin , dass Wissen bisher als eine „black box“ aufgefasst wurde, der sich keiner wirklich genähert hat (vgl. Schüppel 1996: 54f). Eine treffende Definition von Wissen zu finden, ist aber auch deshalb schwierig, weil Wissen eine gewisse Selbstbezüglichkeit aufweist, d.h. Wissen ist an einen bestehenden Kontext und immer an eine Person gebunden. Das Wissen der einen Person ist für eine andere aus verschiedenen Gründen niemals das gleiche und eventuell auch nur Information. (Vgl. Roehl 2002: 22) Daraus resultieren Definitionsschwierigkeiten, die auch im Wissensmanagementdiskurs bis dato nicht gelöst wurden. Daher bleibt der Begriff des Wissens auch im Wissensmanagement unklar.[10]
3.1.2 Daten – Informationen – Wissen
Ein wichtiger Aspekt, der bei der Definition von Wissen bedeutend ist, ist die Unterscheidung zwischen Daten, Informationen und Wissen.
Man unterscheidet: Zeichen, Daten, Informationen und Wissen, welche alle aufeinander aufbauen. Wissen ist immer eine knappe Ressource; im Gegensatz dazu gibt es Informationen und Daten im Überfluss (vgl. Roehl 2002: 22).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Die Beziehung zwischen den Ebenen der Begriffshierarchien (in Anlehnung an Probst et al. 2003: 16)
Der Wissensaufbau beginnt bei Zeichen, die durch Syntaxregeln zu Daten werden, die wiederum werden in einem gewissen Kontext interpretiert und damit für den Empfänger zu Informationen. Vernetzte Informationen ermöglichen deren Nutzung in einem bestimmten Handlungsfeld, welches schließlich als Wissen bezeichnet wird (vgl. Abbildung 2). Bedeutend ist, dass Daten und Informationen schlussendlich erst dann in Wissen umgewandelt werden, wenn sie innerhalb des bestehenden Wissens als relevant erachtet werden, d.h. neues Wissen muss sich mit bestehendem Wissen verbinden lassen (vgl. Roehl 2002: 20).
Kurz zusammengefasst werden Zeichen durch eine Syntax zu Daten, durch einen Kontext werden Daten zu Informationen und durch vernetzte Informationen erhält man Wissen. Ackerschott betont in seiner Darstellung, dass die Kommunikation ein Bindeglied zwischen Daten und Informationen ist. Erst durch die Interpretation des Empfängers werden die Daten des Senders zur Information. (Vgl. Ackerschott 2001: 11) Letztendlich ist Wissen mehr als die bloße Ansammlung von Informationen. Der Mensch muss, um Wissen zu erhalten, auswählen, vergleichen, bewerten, fähig sein, Konsequenzen zu ziehen und sich mit anderen austauschen (vgl. Mandl et al. 2000: 6). Wissen ist nicht statisch, hängt im Gegensatz zu Informationen stark von persönlichen Vorstellungen ab (ebenda) und entsteht erst, wenn neue Informationen mit bereits existierenden Informationen in einen Kontext gesetzt werden (vgl. Ackerschott 2001: 13). Nonaka et al. bringen es auf den Punkt, wenn sie die Meinung vertreten, dass Information einen Fluss von Botschaften darstellen, der im Zusammentreffen mit Vorstellungen und dem Engagement eines Menschen Wissen erzeugt (vgl. Nonaka et al. 1997: 71).
In Abbildung 3 wird deutlich, dass Wissen immer strukturiert, kontext-abhängig und verankert ist. Wissen sind somit sortierte und kontextabhängige Daten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Daten – Informationen – Wissen (vgl. Probst et al. 2003: 17)
3.1.3 Die Wissenstreppe
North hat das Daten-Informations-Wissenskonzept weiter ausgebaut und hat eine sogenannte „Wissenstreppe“ entworfen.
Daten, Informationen und Wissen werden von North ähnlich wie bereits von anderen Autoren interpretiert. Doch bei North ist Wissen nicht die letzte Stufe eines Erkenntnisprozesses: Wissen wird für das Unternehmen erst sichtbar, wenn Wissen (Wissen WAS) in ein Können (Wissen WIE) umgewandelt wird. Das Können manifestiert sich erst in Handlungen, wenn Motivation und Anreize dies ermöglichen. Wenn Handeln für Problemlösungen angewendet wird, dann nennt North dies Fähigkeit oder Kompetenz; dies stellt die siebente Stufe auf der Wissenstreppe dar. Als letzte Stufe der Wissenstreppe ist Wettbewerbsfähigkeit zu finden, welche nur durch Kernkompetenzen eines Unternehmens möglich wird. (Vgl. North 1999: 42)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Die Wissenstreppe (vgl. Thommen 2003: 972)
3.1.4 Und was ist relevantes Wissen?
Die Gretchenfrage im Zusammenhang mit Wissensmanagement hat Ursula Schneider gestellt. Es ist die Frage nach der Ermittlung von brauchbarem Wissen (vgl. Schneider 1996: 14). Kmuche bringt es auf den Punkt:
„Wir ertrinken in Daten und Informationen, aber uns dürstet nach Wissen“ (Kmuche 2000: 29).
Die betriebliche Informationsversorgung ist eine wichtige Grundlage des Wissensmanagements. Da das Informationsangebot drastisch zunimmt, wird die Informationsbeurteilung zur Voraussetzung des Unternehmenserfolgs. Bewertet werden Informationen grundsätzlich nach Inhalt, Relevanz, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit (vgl. Fank 2001: 56). Jedoch führt vor allem die Verfügbarkeit von Informationen in Unternehmen oft zu Problemen. Das Informationsmanagement sollte hier Abhilfe schaffen und zum unverzichtbaren Bestandteil betrieblichen Wissensmanagements werden. Wissensmanagement stellt damit auch eine Herausforderung für die Informatik dar, die informationsverarbeitende Software, die als Grundlage für Managemententscheidungen dienen kann, entwickeln muss. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stellen einen wichtigen betrieblichen Erfolgsfaktor dar (vgl. Fank 2001: 160), deren Bedeutung auf Managementebene nicht vernachlässigt werden darf. In Praxis und Theorie gibt es zwar eine ganze Reihe von Wissens- und Informationsmanagement-Ansätzen[11], die jedoch getrennt voneinander und nicht miteinander arbeiten.
Gerade im Bereich des Wissensmanagements wird meines Erachtens das Informationsmanagement viel zu sehr vernachlässigt. Keiner der für diese Arbeit ausgewählten Wissensmanagementansätze hat das Informationsmanagement in sein Wissensmanagementkonzept aufgenommen und keiner der Autoren definiert die Schwierigkeiten, die bei der Wahl relevanter Informationen und relevanten Wissens auftauchen könnten. Dies stellt ein erhebliches Manko in der bisherigen Wissensmanagementliteratur dar, denn bevor in Unternehmen Informationen nicht nach den richtigen Kriterien selektiert werden, kann Wissen nicht entstehen; dadurch wird auch jeder weiterer Diskurs zum Thema Management von Wissen irrelevant.
Um mit der externen Wissens- und Informationsflut der Wissensgesellschaft zurecht zu kommen, werden von den Autoren unter anderem Wissensbroker empfohlen. Diese Fachleute behalten den Überblick über spezielle Wissensfelder und bieten für Klein- und Mittelbetriebe Dienstleistungen in Form von Patentrecherchen und Kooperationsvermittlung an (vgl. Probst et al. 2003: 81). Eine weitere Möglichkeit, den Überblick zu bewahren, sind sogenannte Horchposten, die aus Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten bestehen und die immer wieder neue Informationen über aktuelle Trends liefern (vgl. Probst et al. 2003: 81f). Enge Kontakte zu think tanks sind genauso empfehlenswert wie das Kontaktieren von externen Beratern, die gerade in den 1980er und 1990er Jahren die Gewinner am Markt waren (vgl. Probst et al. 2003: 82).
Trotz einiger Empfehlungen der Autoren ist Informationsmanagement bis dato kein Bestandteil des Wissensmanagements. Die Unterscheidung Daten-Informationen-Wissen findet sich in nahezu allen Konzepten des Wissensmanagements. Interdisziplinarität wäre in diesem Fall nicht nur wünschenswert, sondern würde Wissensmanagement ergänzen und bereichern.
3.1.5 Die Definitionen von Wissen
„Wissen lässt sich nicht auf eine einzige Art minimieren; in der Literatur gibt es zahlreiche Abhandlungen über die Vielfalt der Arten und Merkmale von Wissen“ (vgl. Hartlieb 2002: 49).
Im folgenden Kapitel werden relevante Wissensdefinitionen von namhaften Wissensmanagementautoren vorgestellt, wobei deutlich wird, dass es zahlreiche unterschiedliche Interpretationen des Begriffs Wissen gibt. Die Zugrundelegung verschiedenster Wissensdefinitionen ist mitunter auch ein Grund, warum die einzelnen Wissensmanagementansätze von Kapitel 4 so unterschiedlich ausfallen.
3.1.5.1 Der Wissensbegriff bei Gunnar Pautzke
Gunnar Pautzke beschäftig sich in seinem Werk „Die Evolution der organisatorischen Wissensbasis: Bausteine zu einer Theorie des organisatorischen Lernens“ intensiv mit den verschiedenen Wissensbegriffen. Er hebt hervor, dass gerade auf der betriebswirtschaftlichen Seite eine Verbindung zwischen Wissen und Handeln besteht (vgl. Pautzke 1989: 65) und dadurch Fragen des Wissens, der Erkenntnis und der Informationsversorgung für die Betriebs- und Managementlehre von Bedeutung sind (vgl. Pautzke 1989: 65f). Als für die Betriebwirtschaftslehre bedeutend macht er auf Ryles Sprachspiel „knowing how“ und „knowing that“ aufmerksam, das den Unterschied zwischen sprachlichen Aussagen, die explizit Wissen ausdrücken („know-that“), und Handlungen, in denen immer implizites Wissen („know-how“) zum Tragen kommt, betonen (vgl. Pautzke 1989: 65).
Um die Weite des Spektrums von Wissensbegriffen deutlich zu machen, erwähnt Pautzke folgende Wissensbegriffe: Die fünf Wissensklassen von Machlup, den Wissensbegriff von Edmund Husserl und Alfred Schütz, die Wissenseinteilung von Max Scheler, das Wissensverständnis von Jürgen Habermas, die Unterscheidung von Michael Polanyi sowie die Formen des Wissens von Friedrich A. von Hayek (vgl. Pautzke 1989: 66ff). Pautzke macht darauf aufmerksam, dass man sich im Rahmen von „wissenschaftlicher Unternehmensführung“ nicht nur auf kognitiv-instrumentelles Wissen beschränken darf (vgl. Pautzke 1989: 70).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Das 5-Schichtenmodell der organisationalen Wissensbasis (vgl. Pautzke 1989: 79)
Im organisatorischen Rahmen steht für Pautzke kollektiv geteiltes Wissen im Mittelpunkt der Betrachtung, das auch als organisatorische Wissensbasis bezeichnet wird (vgl. Pautzke 1989: 76). Pautzke erläutert in diesem Kontext ein Schichtmodell der organisationalen Wissensbasis, welches „... Wissen nach seiner unterschiedlich hohen Wahrscheinlichkeit der Aktualisierung in organisatorischen Entscheidungsprozessen ordnet...“ (Pautzke 1989: 78). Die innerste Schicht (1) kann als Wissen der Organisation bezeichnet werden, weil es in Weltbildern, Regelsystemen und Artefakten verkörpert ist. Für Pautzke ist eine Begriffserfassung, die nur allein auf diese erste Schicht als organisatorische Wissensbasis ausgeht, zu eng, weil Organisationen für Pautzke auf individuelles Detailwissen der Mitglieder angewiesen sind. Daher umfasst die Wissensbasis einer Organisation immer auch das individuelle Wissen der Mitglieder (2), das der Organisation zur Verfügung steht. Schicht Nummer drei (3) verdeutlicht, dass die organisatorische Wissensbasis nicht mit der Summe individuellen Wissens der Mitglieder identisch ist. Organisationsmitglieder verfügen zum Einen über umfangreiches Wissen aus ihrer Lebensumwelt, das für die Organisation nicht nützlich ist. Zudem gibt es immer wieder Willensbarrieren, die verhindern, dass individuelles relevantes Wissen der Mitglieder der Organisation zur Verfügung gestellt wird. Daher wird durch die Trennung von Schicht zwei und drei die Organisation fähig zu lernen, ohne dass ihre Mitglieder lernen. Dies ist nach Pautzke dann der Fall, wenn individuelles Wissen ein Teil der aktuellen Wissensbasis der Organisation wird. Schicht vier der organisatorischen Wissensbasis (4) betont, dass die latente organisatorische Wissensbasis über das aktuelles Wissen der Organisation und ihrer Mitglieder hinausreicht. Akteure besitzen meist ein Meta-Wissen, das nicht Teil der organisatorischen Wissensbasis ist. Die letzte Schicht (5) beinhaltet den Hauptteil des im Kosmos vorhandenen Wissens. (Vgl. Pautzke 1989: 78ff)
Aufbauend auf dem 5-Schichtenmodell der organisationalen Wissensbasis kann Pautzke fünf grundlegende Lernarten definieren, die im Kapitel 3.3.4. erläutert werden (vgl. Schüppel 1997: 33).
3.1.5.2 Der Wissensbegriff bei Gilbert Probst et al.
Gilbert Probst et al. bezeichnen Wissen als die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen; dies inkludiert sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen (vgl. Kehlenbeck 2000: 80 und Eschenbach 2004: 118). Organisationales Wissen setzt sich aus individuellem und kollektivem Wissen zusammen und beinhaltet auch Daten und Informationen, die die Grundlage dieses Wissens bilden (vgl. Eschenbach 2004: 118). Folgende Wissensarten werden von Probst et al. im Rahmen ihrer Arbeit erwähnt:
- Dictionary Knowledge: Das Wörterbuchwissen umfasst allgemein geteilte Beschreibungen, demnach Beziehungen und Definitionen, die systemweit benutzt werden (vgl. Probst et al. 1998: 26). Güldenberg geht auf den Begriff näher ein und beschreibt Faktenwissen als schrittweise erworbene, kulturspezifische Terminologie der Organisation, die die Frage nach dem „Was“ innerhalb einer Organisation beantwortet (vgl. Güldenberg 1998: 183).
- Directory Knowledge: Das Beziehungswissen bezieht sich auf allgemein geteilte Praktiken und Kenntnisse über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. (Bspw.: die Beantwortung und Fragestellung: „Was führt zur Kundenzufriedenheit?“) (Vgl. Probst et al. 1998: 26)
- Recipe Knowledge: Das Rezept- oder Vorschriftenwissen beschreibt Vorschriften und Empfehlungen in Anlehnung an bestimmte geteilte Normen. (Bspw. Handlungsanweisungen [ISO 2000], Durchlaufzeiten etc.) (Vgl. Probst et al. 1998: 26) Für Güldenberg wird Rezeptwissen zur Lösung von Problemen herangezogen (vgl. Güldenberg 1998: 183).
- Axiomatic Knowledge: Das Normenwissen beinhaltet Prämissen des organisationalen Handelns. (Bspw. Zwecksetzungen, unternehmenspolitische Formeln, Grundwerte etc. (Vgl. Probst et al. 1998: 26) Grundsatzwissen beantwortet für Güldenberg die Frage nach dem „Warum“ und gibt Antworten für das Auftreten bestimmter Ereignisse (vgl. Güldenberg 1998: 184).
3.1.5.3 Der Wissensbegriff bei Stefan Güldenberg
Für Stefan Güldenberg entsteht Wissen durch die Verarbeitung und Verankerung wahrgenommener Informationen im Gehirn; er spricht hier vom Prozess des Lernens. Altes gespeichertes Wissen ist dabei der Anker, um aus neu aufgenommenen Informationen neues Wissen zu machen und in der Struktur des Gehirnes zu vernetzen. (Vgl. Kehlenbeck 2000: 68f)
Neben den auch von Probst et al. genannten Wissensarten des Dictionary Knowledge, des Directory Knowledge, des Recipe Knowledge und des Axiomatic Knowledge, nennt Güldenberg zusätzlich organisationales, kollektives, individuelles und sonstiges Wissen.
Organisationales Wissen ist von allen Organisationsmitgliedern geteiltes (sowie von allen akzeptiertes) Wissen (vgl. Güldenberg 1998: 192ff). Davon zu unterscheiden sind
- Kollektives Wissen, das nach Güldenberg im Gegensatz zu organisationalem Wissen nicht von allen Organisationsmitgliedern geteilt wird und auch nicht für jeden zugänglich sein muss (vgl. Güldenberg 1998: 194).
- Individuelles Wissen ist auf einzelne Mitglieder der Organisation beschränkt (vgl. Güldenberg 1998. 195f).
- Sonstiges irdisches Wissen ist der Hauptteil des gesamten auf unserem Planeten befindlichen Wissens und liegt außerhalb des Wahrnehmungsbereiches der Organisation (vgl. Güldenberg 1998: 196).
3.1.5.4 Der Wissensbegriff bei Jürgen Schüppel
Jürgen Schüppel unterscheidet:
- Deklaratives Wissen, Theoriewissen oder Kennen sind Kenntnisse eines Menschen über Fakten, Sachverhalte, Vorgänge, Objekte, Ereignisse u.v.m. (vgl. Hartlieb 2002: 46). Innerhalb dieser Kategorie kann man grundsätzlich noch zwischen episodischem Wissen (=selbsterfahrene Inhalte) und semantischem Wissen unterscheiden (vgl. Schüppel 1996: 55).
- Prozedurales Wissen, Praxiswissen oder Können ist Wissen, das zur Durchführung von Tätigkeiten notwendig ist; beispielsweise Schreiben, Radfahren, Multiplizieren (vgl. Hartlieb 2002: 47).
Beide Wissensarten werden von Schüppel zu wissenspsychologischen Wissensarten gezählt, da Fragen der Wissensrepräsentation, der Differenzierung von Wissen und Information, des Wissenserwerbs u.a. im Vordergrund stehen (vgl. Schüppel 1996: 55).
Schüppel unterscheidet zusätzlich noch betriebswirtschaftliche, pädagogische und organisationspsychologische Aspekte des Wissens. Dabei wird weitgehendst auf das Individuum als Produktivitätskraft eingegangen und daher zwischen Fertigkeiten und Fähigkeiten unterschieden. Fertigkeiten bilden aufgabenbezogenes Wissen und Leistungsvermögen ab; Fähigkeiten konzentrieren sich auf die Kompetenz, die man unabhängig von seinem Aufgabengebiet besitzt. (Vgl. Schüppel 1996: 59f)
Schüppel geht noch auf eine spezifischere Analyse des Wissens ein, in der er den effektiven und effizienten Einsatz menschlicher Arbeit in die Analyse mit einbezieht. Wissen wird dann zum kognitiven Element innerhalb der Begriffe Qualifikation und Kompetenz. Der kognitive Bereich des Wissens besteht für Schüppel aus Kenntnissen, Auffassungsgabe und Problemlösungspotential. Als Modell für die Unterscheidung von Kompetenzen geht Schüppel auf das „Zwiebelmodell“ der vier Kompetenzen von Fuchs und Besier ein: Persönlichkeits-Kompetenz (Werte, Einstellungen, Kreativität etc.), soziale Kompetenz (Kommunikations-, Kooperationsfähigkeit etc.), methodische Kompetenz (Problemlösungskompetenz, Konfliktfähigkeit etc.) und fachliche Kompetenz. Die erstgenannte Kompetenz ist dabei die Basis für die nächstgenannte, die wiederum die nächste umschließt etc.. (Vgl. Schüppel 1996: 60)
Wie bereits Autoren vor ihm geht auch Schüppel bei seiner Wissensdefinition auf die Unterscheidung von individuellem und kollektivem Wissen ein. Individuelles Wissen, das den menschlichen Kognitionen zugeordnet wird, liegt dabei in zwei Ausprägungen vor: Einerseits aus „Oberflächenwissen“, das die subjektive Speicherung der Realität und der darin vorkommenden Objekte, Fakten, Personen etc. sowie die physisch menschlichen Handlungsroutinen beinhaltet. Andererseits aus „Tiefenwissen“, welches die Realitätswahrnehmung auf einer mental-konzeptionellen Ebene steuert. Bei einer Veränderung der individuellen Wissensbasis bspw. durch einen Lernprozess ist diese wesentlich an die Struktur der alten Wissensbasis rückgebunden. Auch das Kollektive Wissen ist nach Schüppel zweigeteilt. So besteht „Oberflächenwissen“ aus Fakten- und Rezeptwissen sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kollektivs. Das „Tiefenwissen“ ist für die Prozessierung des Wissens insgesamt verantwortlich und kodeterminiert die mit der Wissensrepräsentation verbundenen Handlungen und Verhaltensweisen. Kollektives Wissen stellt für Schüppel das kollektive Handlungsvermögen dar und trägt daher die Problemlösungsfähigkeit von Gruppen und Organisationen. (Vgl. Kehlenbeck 2000:52f)
[...]
[1] Vgl. http://www.innopat.de/stuli/stu46/stu46.htm vom 10. August 2004.
[2] http://derstandard.at/?id=1343600 vom 5. August 2004.
[3] Vgl. http://www.innopat.de/stuli/stu46/stu46.htm vom 10. August 2004.
[4] Vgl. http://www.competence-site.de/wissensmanagement.nsf/0/497e5772f05ee450 c1256e7e002ca3a8?openDocument vom 11. 8. 2004.
[5] http://www.competence-site.de/wissensmanagement.nsf/0/497e5772f05ee450c1256 e7e002ca3a8?openDocument vom 11. 8. 2004.
[6] Nicht zu vergessen ist jedoch, dass vollständige Information und die richtige Analyse von Daten nicht automatisch zu richtigen Entscheidungen führen muss (vgl. Deiser 1996: 51)
[7] Vgl. Kapitel 3.2.3.
[8] Leif Edvinsson war erster Director of Intellectual Capital und Vizepräsident bei Skandia-Versicherungen in Schweden. Er ist MBA und arbeitet als Assistant Professor of Intellectual Capital an der Universität Lund/Schweden und ist der Gründer von Universal Networking Intellectual Capital (UNIC). Edvinsson ist Berater der schwedischen Außenministeriums und der Vereinten Nationen. (Vgl. Eschenbach 2004: 61)
[9] Die Balanced Scorecard ist ein umfassendes Managementinformationssystem, das finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zu einem System zusammenführt. Die Balanced Socrecard übersetzt die Vision und die daraus abgeleitet Unternehmensstrategie in Ziele und Kennzahlen. (Vgl. Thommen et al. 2003: 934)
[10] Vgl. http://vawi74.wi-inf.uni-essen.de/ws0405wm/Grundlagen.pdf vom 20. November 2004.
[11] Nach Petkoff (vgl. Petkoff 1998: 15) gibt es vier Wissensmanagement-Ansätze, wobei zwei davon sich mit Informatik befassen.
- Arbeit zitieren
- Mag. Dr. Kristina Neuböck (Autor:in), 2005, Die betriebliche Wissensarbeit als (neuer) Erfolgsfaktor?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90406
Kostenlos Autor werden




















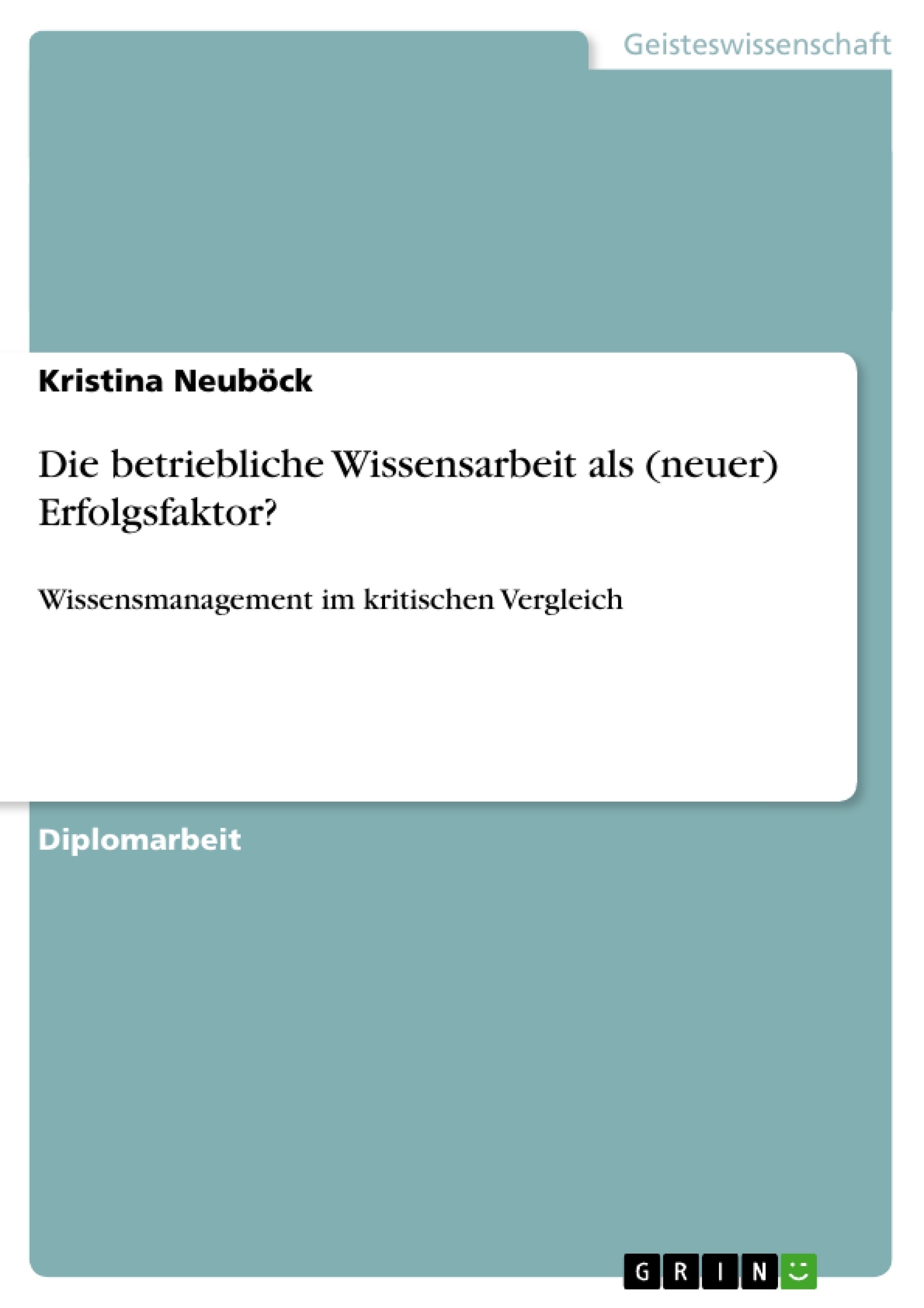

Kommentare