Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Motivation, Fragestellung und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Bedeutung der Selbstorganisation. im Kontext Lernen
2.1 Selbstorganisation durch Emotionen
2.2 Selbstorganisation durch Motivation
2.3 Selbstorganisation durch Anerkennung
2.4 Selbstorganisation im Lernprozess
3. Der Begriff des Lernen
3.1 Lernen früher und heute
3.2 Zugänge zum Gegenstand Lernen
3.3 Anthropologie und Lernen
3.4 Anatomie und Physiologie des Lernens
3.4.1 Das Gehirn
3.4.2 Limbisches System
3.4.3 Unser Gedächtnis
4. Verortung in der Erwachsenenbildun
4.1 Menschenbilder in der Erwachsenenbildung
4.2 Didaktisches Design einer Bildungseinrichtung
4.3 Berufsausbildung als Transition
4.4 Vorstellung der Ausbildung zum Notfallsanitäter
5 Empirische Datenerhebung im Berufsfeld Notfallsanitäte
5.1 Forschungsdesign des Fragebogens
5.2 Auswertung der Ergebnisse
5.2.1 Auswertung statistischer Merkmale
5.2.2 Auswertung phänomenologischer Merkmale
6 Konsequenzen für Lernumgebunge
7 Fazi
Literaturverzeichnis
A Anhang
»Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.«
Sokrates, 469-399 v. Chr.
Danksagung
Eine Forschungsarbeit zu schreiben schafft man meist nicht ganz alleine, deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben.
Zunächst gebührt mein Dank Herrn Prof. Müller-Commichau , der meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen und vor allem anerkennenden Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Ich danke ebenso meiner Gesamtschulleitung von der DRK-Landes- schule Baden-Württemberg Herrn Kuhnke und Herrn Hassel- wander , die mir das Lernen und Forschen während der Arbeitszeit ermöglicht haben.
Ein besonderer Dank gilt außerdem allen Teilnehmenden meiner Befragung, ohne die ein Großteil der Arbeit nicht hätte entstehen können.
Abschließend und am meisten möchte ich mich bei meinem Mann bedanken, der mir mein Studium durch seine Unterstützung erst ermöglicht hat, stets ein offenes Ohr für mich hatte und mir in allen möglichen Situationen uneingeschränkten Rückhalt geboten hat. 0
Kurzfassung
„Wie (gelernt wird, wissen wir nicht - nur, dass wir lernen und wann wir lernen.“ 1
Mit diesem Wissen um das ,Wann‘ und wissenschaftlichen Grundlagen aus den Bereichen Anatomie/Physiologie (des Gehirns), der Systemtheorie, der fraktalen Geometrie, des Konstruktivismus, der Psychologie und weiteren Fachdisziplinen lassen sich Lernumgebungen gestalten, in die Teilnehmende beruflicher (Aus-)Bildung in Situationen manövriert werden, in denen erfolgreiches, selbstorganisiertes Lernen (SOL) leicht fällt und somit nachhaltig stattfindet.
Lernumgebungen, hier als Didaktisches Design bezeichnet, umfassen aber nicht nur die theoretischen Konstrukte, sondern auch das pädagogische Personal und die jeweilige Haltung gegenüber den Lernenden. Ebenso wichtig für das Gelingen von Lernen ist die Einbeziehung der Lebenseinstellungen der Teilnehmenden. Der biographisch relevante Anteil für das selbstorganisierte Lernen aus dieser inneren Haltung wird in der vorliegenden Forschungsarbeit mittels empirischer Fragebögen dargestellt.
Schlüsselwörter: Didaktisches Design, Lernumgebungen, Selbstorganisiertes Lernen, SOL.
Abstract
“We do not know how we learn - only that we learn and when we learn.” 2
With this knowledge of ‘when' and scientific principles from the fields of anatomy/physiology (of the brain), systems theory, fractal geometry, constructivism, psychology and other disciplines, learning environments can be designed in which participants in vocational education and training are manoeuvred into situations in which successful, self-organised learning (SOL) is easy and therefore sustainable.
Learning environments, called instructional design, include not only the theoretical constructs but also the pedagogical staff and the respective attitude towards the learners. Equally important for the success of learning is the inclusion of the participants' attitudes to life. The biographically relevant part for self-organised learning from these attitudes is described in the present research work by means of empirical questionnaires.
Keywords: Didactic design, Learning environments, Self-organised learning, SOL.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Methodisches Vorgehen und Struktur der Arbeit
Abb. 2.1: Die vier Komponenten einer Emotion
Abb. 2.2: Hierarchische Ordnung von Motivation und Bedürfnis
Abb. 2.3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen
Abb. 2.4: Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens
Abb. 3.1: Sender-Empfänger-Modell des Kognitivismus
Abb. 3.2: Die Erziehungs-Trias
Abb. 4.1: Die Komponenten im Didaktischen Design
Abb. 5.1: Verteilung der bisherigen Erfahrungen mit SOL im 1. AJ
Abb. 5.2: Verteilung der bisherigen Erfahrungen mit SOL im 2. AJ
Abb. 5.3: Verteilung der bisherigen Erfahrungen mit SOL im 3. AJ
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1: Komponenten des Rahmenmodells: Block A
Tab. 2.2: Komponenten des Rahmenmodells: Block B
Tab. 2.3: Komponenten des Rahmenmodells: Block C
Tab. 2.4: Komponenten des Rahmenmodells: Block D
Tab. 2.5: Komponenten des Rahmenmodells: Block E
Tab. 6.1: Förderliche und hemmende Lernfaktoren in Bezug auf SOL
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Männlich, weiblich, divers - kaum ein Thema sorgt aktuell für so vielfältige Standpunkte, wie die gendergerechte Schreibweise. Phänomene wie Angst, Veränderung, Über- oder Unterlegenheit sowie Sprache spielen dabei eine gewichtige Rolle. Die Autorin ist sich diesem Spannungsverhältnis durchaus bewusst und hat sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit für folgende Vorgehensweisen entschieden: werden im Text geschlechterspezifische Formulierungen verwendet, so geschieht dies aus der gängigen Praxis heraus (z. B. der Notfallsanitäter bezieht in der gesprochenen Sprache und im Umfeld Rettungsdienst immer die Notfallsanitäterin mit ein). Scheint es sinnvoll und dem Lesefluss nicht schadend, wird eine geschlechterneutrale Schreibweise eingesetzt. In einigen Kapiteln finden sich vorab Hinweise zur jeweils eingesetzten Ausdrucksform mit entsprechendem Beweggrund.
1 Einleitung
Stühle, Tische, Bücher - um Lernumgebungen zu gestalten, die selbstorganisiertes Lernen nachhaltig ermöglichen, sind Lehrenden und Lernende nicht nur auf diese offensichtlichen Utensilien angewiesen. Sie benötigen auch Antworten auf übergeordnete Fragen, wie denen nach Menschen, Menschenbildern oder den zugehörigen historischen Entwicklungen. Die vorliegende Forschungsarbeit soll im Kontext der Berufsausbildung Notfallsanitäter Inspirationen für diese Antworten geben. Zunächst wird hier das erkenntnisleitende Interesse für das Thema erläutert, anschließend der Aufbau der Arbeit skizziert.
1.1 Motivation, Fragestellung und Zielsetzung
Erwachsene in Berufsausbildungen wie dem Notfallsanitäter sind auf komplexe Kompetenzen für die Ausübung ihres verantwortungsvollen Berufes angewiesen. Es wäre unmöglich, in drei Jahren das Faktenwissen an die angehenden Rettungsdienstmitarbeiter weiterzugeben, welches sie für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben benötigen. Sie müssen im Verlauf der dreijährigen Ausbildung allgemeingültige Befähigungen entwickeln, die es ihnen ermöglichen, jede Einsatzsituation zu bewältigen. Dazu bedürfen sie neben konkreten Handlungskompetenzen beispielsweise die Fähigkeit der Antizipation, Problemlösekompetenz, Empathie, Flexibilität und die Fähigkeit, sich (im Einsatz) nicht von anderen auftretenden Bedürfnissen aus der Ruhe bringen zu lassen. Das Problem: diese Kompetenzen lassen sich in traditioneller, meist lehrerzentrierter, Unterrichtsweise nur schwer vermitteln.
Pädagogen wie Arnold, Nuissl oder Siebert, ebenso wie die Philosophen Aristoteles, Sokrates und Comenius zu ihrer Zeit, suchen dafür eine Unterrichtsweise, mit der der Lehrende weniger lehren muss und die Lernenden trotzdem mehr lernen und so das oben beschriebene Problem gelöst werden kann. Selbstorganisiertes Lernen (SOL) scheint dazu das momentane Zauberwort unserer Zeit zu sein. Als natürlichste Sache der Welt deklariert, ist es ein visionäres Motto heutiger Wissensaneignung. Die Autorin leitet eine beruflich bildende Einrichtung im Bereich des Rettungsdienstes und ist mit ihrem Lehrteam genau diesen Herausforderungen ausgesetzt. Wagt es allerdings einer der Lehrenden, einen Unterricht in Richtung selbstorganisiertes Lernen durchzuführen, sind sowohl Lernende als auch Lehrende meist überfordert und unzufrieden, schnell fällt der Satz: „Wann machen wir endlich wieder richtigen Unterricht?“. Gründe dafür liegen häufig in der fehlenden Vorbereitung beider Parteien.
Für Lehrende gehört hierzu nicht nur die Planung der Lehr-Lernsituationen, sondern die Betrachtung aller Facetten, die die Lernumgebung beeinflussen. Die vorliegende Masterarbeit bietet einen Überblick über Faktoren, die im fachpraktischen Alltag meist nur unterbewusst Beachtung finden, allerdings für das selbstorganisierte Lernen elementar wichtig sind. Die leitenden Fragen in dieser Forschungsarbeit lauten deshalb:
- „Wie können Lernumgebungen konzipiert werden, um selbstorganisiertes Lernen in einer beruflichen Ausbildung (z. B. Notfallsanitäter) zu ermöglichen?“
- „Wie wird selbstorganisiertes Lernen in der Erwachsenenbildung definiert?“
- „Welchen Einfluss hat die Haltung der am jeweiligen Lernprozess Beteiligten (pädagogische Fachkräfte, Lernende etc.)?“
- „Welche hemmenden oder förderlichen Lernfaktoren definieren die Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung in Bezug auf SOL?“
- „Welche besondere Rolle spielt die Berufsausbildung im Kontext der Erwachsenenbildung?“
1.2 Aufbau der Arbeit
Neben der Selbstorganisation wird in der Pädagogik häufig der Begriff der Selbstregulation im Kontext Lernen diskutiert. Wissenschaftlich gesehen existieren für das selbstorganisierte Lernen weitere Begrifflichkeiten, die zum Teil gleichbedeutend definiert werden oder sich in Nuancen darin unterscheiden. Verwendet werden unter anderem selbstgesteuertes Lernen, selbstbestimmtes Lernen, selbstreguliertes Lernen, selbstkontrolliertes Lernen, selbsttätiges oder auch autonomes Lernen. Gemeinsam ist ihnen allen der Blick auf das selbstständige Lernen des Individuums. In der vorliegenden Masterarbeit wird synonym für alle oben genannten Begrifflichkeiten das selbstorganisierte Lernen beschrieben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.1: Methodisches Vorgehen und Struktur der Arbeit. [ Eigene Darstellung]
Dazu wird in Kapitel zwei zunächst die Bedeutung der Selbstorganisation betrachtet (vgl. nebenstehende Abb. 1.1). Anhand der Phänomene Emotion, Motivation und Anerkennung sowie einen Blick auf die Entwicklung der Selbstorganisation im Lernprozess sucht die Autorin Antworten auf die vorgestellten Forschungsfragen. Da im selbstorganisierten Lernen neben der soeben beschriebenen Selbstorganisation auch der Begriff Lernen im Fokus der Betrachtungen liegt, befasst sich das darauf folgende Kapitel drei damit. Im einleitenden Satz der Arbeit klingt der Vergleich von Lernen damals und heute bereits an, im Abschnitt „Lernen früher und heute“ wird er weiter vertieft, um die Begrifflichkeiten gegenwartsbezogen im Kontext Vergangenheit und Zukunft zu definieren. Unterschiedliche Perspektiven auf Lernen erwarten den Leser oder die Leserin in der Auseinandersetzung mit diversen theoretischen Zugängen und den Fragestellungen der Wissenschaftsdisziplin Anthropologie. Auch neurobiologische Erkenntnisse des Lernens und eine grundlegende Darstellung der Anatomie und Physiologie des Gehirns sind notwendig, um Lernumgebungen sinnstiftend gestalten zu können. Die Verortung in der Erwachsenenbildung in Kapitel vier dient zur Orientierung im weiten Feld der Pädagogik. Es werden relevante Menschenbilder dargestellt und das Didaktische Design beleuchtet. Die Berufsausbildung wird von den Lernenden als besondere Lebensphase empfunden, die einen sensiblen pädagogischen Umgang erfordert, um positiv bewältigt zu werden. In einer Zeit der Umbrüche und stetigen Veränderungen ist es allerdings auch notwendig, Berufsausbildung nicht nur als Transitionsprozess nach dem Besuch allgemeinbildender Schulen zu sehen, sondern auch als Veränderungsschritt, der jederzeit im Lebenslauf stattfinden kann. Notfallsanitäter sind hier in der Forschungsarbeit ein Thema, da die Autorin aus diesem fachpädagogischen Milieu stammt. Der Beruf des Notfallsanitäters ist relativ neu und bietet die faszinierende Gelegenheit, pädagogische Entwicklungen in einem Berufsfeld zeitgemäß und gegenwartsbezogen zu beobachten und zu bewerten. Eine Beschreibung dieses Berufsbildes hilft bei der Einordnung in die Erwachsenenbildung. Die bis hierher vorgestellten Kapitel werden mittels Literaturrecherche erforscht. Zum Einsatz kommt zugängliche Primär- und Sekundärliteratur zum jeweiligen Schwerpunkt.
Um die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse aus der Literaturrecherche mit Stimmen aus dem praktischen Schulalltag zu erhöhen, hat die Autorin im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine empirische Datenerhebung zum vorgestellten Thema der Forschungsarbeit an vier Bildungseinrichtungen durchgeführt. In Kapitel fünf werden das Forschungsdesign und die Ergebnisse der Befragung vorgestellt. Alle Fragebögen sowie die graphische Auswertung dieser sind im Anhang aufgeführt. Eine Zusammenführung der Literaturrecherche mit den empirischen Daten, um die tatsächlichen Konsequenzen für die Bildungseinrichtungen darzustellen und die Forschungsfragen zu beantworten, ist in Kapitel sechs beschrieben. Ein Ausblick auf notwendige zukünftige Forschungen in diesem Bereich und ein Resümee beenden schließlich die Arbeit im Schlusskapitel sieben.
Einen Überblick über die Verschriftlichung der Forschungsarbeit bietet das ebenfalls im Anhang befindliche Forschungstagebuch der Autorin. Es werden dort die einzelnen Phasen der Entstehung festgehalten. Zum einen dient dies als eine Art Lerntagebuch, um Wissensaneignungen besser zu verknüpfen. Zum anderen motiviert es während des Schreibprozesses, da es bereits Geschafftes visualisiert und anschaulich macht.
2 Bedeutung der Selbstorganisation im Kontext Lernen
Selbstorganisation wird wissenschaftlich relevant seit ungefähr 1900 diskutiert. Gelehrte vor dieser Zeit waren meist davon überzeugt, dass man unter Berücksichtigung aller Ausgangsdaten alles vorhersagen kann. Für Lehrende ein wahrer Traum: Sie bereiten unter Beachtung aller Einflüsse den Unterricht vor und wissen anschließend mit Sicherheit, dass die Lernenden all das auffassen und können, was vorher bestimmt wird. Zum Albtraum dagegen wird für Lehrende die weiterführende Entdeckung des „Schmetterlingseffektes“ durch den Franzosen Henri Poincaré (* 1854, f 1912): Er stellt in seiner These fest, dass bereits minimale Abweichungen von wenigen Faktoren maximal unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen können. Diese Erkenntnis ist insofern von großer Bedeutung, als das hier ein Grundstein für konstruktivistische Denkweisen hinsichtlich der individuellen Wirklichkeit eines Lerners beschrieben wird. Benoit Mandelbrot (* 1924, f 2010) definierte zu diesem Schmetterlingseffekt weitere Faktoren, die die Selbstorganisation erklären: Selbstähnlichkeit, Zielorientierung und Selbstoptimierung. Alle drei ebenfalls in der Natur beobachtbare Phänomene, die auf den Menschen, hier speziell den Erwachsenen, übertragen werden können. Selbstähnlichkeit bedeutet dabei die Analogie und damit die Verknüpfungen zu (Vor-)Erfahrungen, die erfolgreiches Lernen leichter stattfinden lassen, als gänzlich neue Erfahrungen. Zielorientierung ist insofern relevant für den Lernprozess, um Selbstähnlichkeit und Selbstoptimierung überhaupt zu ermöglichen. Nur der Lernende, der „sein“ Ziel kennt, kann auch (selbstorganisierte) Strategien zur Zielerreichung entwickeln. Selbstoptimierung ist eng verknüpft mit der Selbstähnlichkeit und der Zielorientierung und doch als eigenständiger Faktor für die Selbstorganisation bedeutend. Es beschreibt den individuellen Weg zur Lösung eines Problems und zur Erreichung der Ziele.3
Ein sehr anschauliches Beispiel dazu beschreiben Herold und Herold: Beobachtet man einen Flussverlauf eingehender, fällt auf, dass neben dem Hauptarm des Gewässers auch weitere kleinere Nebenarme existieren. Alle Flussverläufe haben das gleiche Ziel (Zielorientierung): den Ozean. Jeder Arm bestreitet allerdings seinen eigenen Weg dorthin. Gezwungen durch Steine, Bäume, Geröll oder andere Hindernisse kommen verschiedene Verläufe zustande, die vom Wasser je nach Bedarf selbst gestaltet werden (Selbstoptimierung). Selbstähnlichkeit ist hier in der Einfachheit der Grundstruktur zu suchen, ein Unterschied zum menschlichen Lernprozess. Die Begründung liegt darin, dass Einfachheit nur individuell definierbar ist und nicht pauschal als Wert angegeben werden kann.4
In den späten 1970er Jahren prägte der Begriff der „Autopoiesis“(altgriechisch: avroi (= selbst) und noieiv (= machen)) die Diskussionen rund um die Selbstorganisation in der Erwachsenenbildung. Maturana und Valera (* 1946, f 2001) definieren die Selbsterhaltung und Selbstorganisation zunächst von lebenden Systemen, LUHMANN (* 1927, f 1998) erläutert ihn zusätzlich im Kontext sozialer Systeme. Kritisch betrachtet werden muss in der Systemtheorie, dass der Faktor Veränderung kaum beachtet wird, dieser aber unabdingbar für selbstorganisierte Prozesse ist. Auch für eine erwachsenenpädagogische Betrachtung ist Veränderung bedeutsam, denn nur dann, wenn der Lernprozess (positive) Veränderungen für den Lernenden verheißt, findet er erfolgreich und nachhaltig statt. Selbstorganisation aus Sicht des Konstruktivismus ist geprägt von der Theorie, dass jeder Mensch die Wirklichkeit, in der er sich befindet, individuell und für ihn richtig wahrnimmt. Aufgrund der hohen Reflexionsfähigkeit der Menschen sind sie imstande, die Wirklichkeiten anderer Menschen zu erkennen und dadurch in der Lage, adäquate Interaktionen zu gestalten.5 Zusammen mit den vorher beschriebenen Theorien heißt das für pädagogisch Tätige vor allem, dass Selbstorganisation (von Lernprozessen) möglich ist, in vielen Punkten allerdings nicht fremdgesteuert planbar stattfinden kann. Diese fehlende Planbarkeit des Lernprozesses und -erfolges ist bis dato Gegenstand vieler wissenschaftlicher Forschungen der Pädagogik. Heckhausen H. (* 1926, f 1988) und Heckhausen J. beschreiben, dass aufgrund hoher Komplexität Selbstorganisati- on bei lebenden Systemen schwer nachvollziehbar ist und eher als „beschreibende Metapher“ 6 anzusehen ist. Sie erläutern außerdem, dass die Selbstorganisation auf Ebene der Wahrnehmung stattfindet und sowohl von externen Reizen als auch von der Persönlichkeit („Kräfte im Inneren des Systems“ 7 ) abhängig ist. Die Autoren Carver und Scheier verweisen in ihrem Modell der dynamischen Selbstregulation auf eine Selbstorganisation, die von Wahrnehmung und Verhalten geprägt ist. Das Modell besteht aus vier Komponenten, die dieses Muster zwischen Verhalten und Wahrnehmung beschreiben: dem sogenannten Komparator, er ist die Instanz, die den Sollwert mit dem Istwert vergleicht; der neuronalen Kapazität, die den Sollwert darstellt; einen Kanal, der Informationen zum Istwert liefert und einen Weg, der durch Handlung Einfluss auf den Istwert nimmt, um den Sollwert zu erreichen. Jedes Individuum zeigt in allen vier Elementen verschiedene Reaktionen: Komparatoren vergleichen auf unterschiedliche Weise, die neuronale Kapazität repräsentiert individuelle Ziele, verarbeitet Informationen anders und reguliert den Einfluss der jeweiligen Persönlichkeit entsprechend.8
Emotionen, Motivation und Anerkennung sowie eine Sensibilisierung gegenüber den gültigen Werten und Normen in der Erwachsenenbildung sind solide Grundpfeiler, auf denen die Selbstorganisation und das selbstorganisierte Lernen eines jeden Individuums aufgebaut sind. In den folgenden Kapiteln werden die oben genannten Phänomene vorgestellt und im Kontext (selbstorganisiertes) Lernen diskutiert. Die Konsequenzen auf die zu schaffenden Lernumgebungen werden nach der hier dargebotenen Literaturrecherche in Kapitel 6 (S. 78 ff.) so zusammengefasst, dass dies der Beantwortung der Forschungsfragen dienlich ist.
2.1 Selbstorganisation durch Emotionen
Unterschiede zwischen den Begrifflichkeiten Emotion und Gefühl werden in den wissenschaftlichen Fachschaften seit jeher kontrovers diskutiert. Forscher wie der Philosoph und Psychologe William James (* 1842, f 1910) verwenden beide Begriffe synonym. Er definiert beide Wörter als eine Art Bewusstseinszustand, die der Grundform „Erleben“ entspringen, welches nicht nur inhaltlich beschrieben wird, sondern vor allem in seiner Handlung. Weiter begründet James seine synonyme Verwendung auf einer inflationären und nicht immer bestimmungsgemäßen Nutzung beider Wörter, so dass er zu der Überzeugung kommt, „Emotion“ und „Gefühl“ als allgemein gültige Auslegungen für derartige Bewusstseinszustände zu verwenden und es dem entsprechenden Kontext anzupassen.9 Emotionstheoretiker wie Plutchik (* 1927, f 2006) oder Damasio definieren „Gefühl“ als wahrnehmbare Körperzustände und „Emotion“ als körperlichen Zustand. Beide sind abhängig von der kulturellen Verortung und der individuellen Lebensbiographie.10 Sich dem Spannungsverhältnis beider Möglichkeiten bewusst, entscheidet sich die Autorin, in der vorliegenden Forschungsarbeit „Emotion“ und „Gefühl“ synonym einzusetzen, da sowohl die wahrnehmbaren Körperzustände, als auch die erlebbaren Zustände beider Bewusstseinszustände gleichermaßen eine wichtige Rolle für das selbstorgansierte Lernen spielen.
„Jeder weiß genau, was eine Emotion ist - aber niemand kann sie definieren.“ 11 So beschreiben die Emotionsforscher Fehr und Russell im Jahre 1984 ihre Einschätzung zum Thema Emotionen. Der Versuch einer wissenschaftlichen Einordnung erfolgt über die Einteilung in Basisemotionen und Nicht-Basisemotionen. Ausgewählte Emotionstheorien definieren mindestens vier dieser Basisemotionen: Furcht, Ärger, Ekel und Kummer. Plutchik fügt dieser Liste Freude und Überraschung hinzu, Tomkins (* 1911, f 1991) ergänzt Verachtung, Interesse und Scham, Izard (* 1923, f 2017) erweitert um die Emotion Schuld. Einer der bekanntesten Emotionsforscher ist Paul Ekman, er definiert Wut, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst sowie Überraschung als die sieben Basisemotionen. Unterwürfigkeit, Staunen, Hochgefühl, Zärtlichkeit, Erwartung, Akzeptieren und Schüchternheit sind weitere Emotionen, die laut den Forschern als Basisemotionen definiert werden könnten. Es ist abschließend allerdings noch nicht allgemeingültig geklärt, welche dieser Emotionen tatsächlich universell für alle Menschen als Basisemotionen definiert werden können.12
Eine Beschreibung, die dem Phänomen Emotion nahe kommt, ist die folgende: „Emotionen sind mehrdimensionale Konstrukte, die aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten bestehen.“ 13 Das affektive Erleben einer Emotion ist das, was ein Mensch spürbar in einer bestimmten Situation erlebt oder fühlt. Es kommt zustande aus dem Zusammenspiel der in umseitiger Abbildung 2.1 dargestellten Komponenten.14 Die physiologische Komponente beschreibt die körperlich sichtbaren/messbaren Merkmale einer gerade erlebten Emotion: rot werden, schwitzen, erhöhter Herzschlag, Pupillen weiten sich etc. Physiologisch nachweisbar sind diese Vorgänge im Bereich der Amygdala und dem Kortex (Anm.: Bereiche des Gehirns, siehe dazu auch Abschnitt 3.4). Emotionen und Gedanken gehören zwingend zusammen: die kognitive Komponente. Zu jeder Emotion formulieren wir unterbewusst meist verstärkende Gedanken: Angst und Versagen gehören beispielsweise eng zusammen oder Liebe und grenzenloses Vertrauen. Mimik und Gestik werden unter den expressiven Komponenten eingeordnet und helfen, Emotionen auszudrücken und zu verstehen - für das Individuum selbst und auch für gegenüberstehende Interaktionspartner. Die motivationale Komponente impliziert eine intrinsische Motivation für die gerade aktuelle Situation, in der die Emotion entsteht, positiv wie negativ.15 Allen Komponenten gemeinsam ist eine zumeist unterbewusste und unbewusste Steuerung. Auch für das Lernen ist das Wissen um die Bedeutung der Emotionen und der dazugehörigen Einflussfaktoren sehr zentral. Zum einen um Lernumgebungen erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Zum anderen auch, um die Kompetenzen der einzelnen Lernenden hinsichtlich der Selbstorganisation und im weiteren Verlauf auch des selbstorganisierten Lernens einzuschätzen. Da Emotionen sehr schwer zu beschreiben und noch schwerer zu erfassen sind, erfordert dies eine hohe Reflexionsfähigkeit seitens der Lehrenden, um richtige Schlüsse aus dem Gesehenen zu ziehen. Hierbei ist es bedeutsam, neben den sichtbaren Anteilen einer Information (Sachebene) auch immer die unsichtbaren Anteile einer Information (Beziehungsebene) zu bewerten.16
Für die Einschätzung der Fähigkeit zur Selbstorganisation ist es ebenso von Bedeutung, Emotionen richtig einzuordnen: zeigt der Schüler eine aktuelle Emotion (ängstlich, weil er für die anstehende Klausur nicht ausreichend vorbereitet ist) beschreibt die Fachwelt dies als „State“. Persönlichkeitsdefinierende emotionale Reaktionen, wie zum Beispiel Schüchternheit oder Unterwürfigkeit, werden als „Traits“ bezeichnet.17 Für Lehrende ist diese Unterscheidung insofern wichtig, als das States eine andere Einschätzung in der Gestaltung der Lernumgebungen für Selbstorganisation haben, als Traits: States bedürfen einer Reflexion beider Seiten, um zukünftig je nach Emotion und Situation auf eine ähnliche Konstellation reagieren zu können. Traits als Identitätsmerkmal sind weitaus schwieriger anzugehen und erzwingen dagegen eine längerfristige Förderung, zum Beispiel in Form einer individuellen Lernberatung oder einer Umgestaltung der Lernumgebungen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1: Die vier Komponenten einer Emotion. [Quelle: Eigene Darstellung ]
Eng verbunden mit Emotionen, in ihrer Bedeutung doch differenziert, sind die Begrifflichkeiten Stimmung, Wohlbefinden und Stress.18 Alle drei haben direkte Auswirkungen auf die Selbstorganisation eines Individuums - positiv, negativ oder auch neutral.
Stimmungen sind durch ähnliche Komponenten geprägt wie Emotionen, halten aber zeitlich deutlich länger und intensiver an. Auch werden Stimmungen eher diffus und global („schlecht-drauf-heute“) erlebt, während Emotionen sehr zielgerichtet und objektorientiert (Angst vor der Mathearbeit, Freude auf die Englischklausur) entstehen und von kürzerer Dauer sind. Die Unterscheidung von Stimmungen sind meist sehr klar einzuordnen: positiv, negativ oder neutral. Die Differenzierungen von Emotionen dagegen sind vielfältiger und individueller.19 Stimmungen werden klassenweise erlebbar, beispielsweise eine sehr aufgeregte Stimmung bei den Schülern einer Examensklasse. Emotionen sind eher auf das Individuum bezogen - die eine Schülerin erlebt die aufgeregte Stimmung ängstlich, der andere Schüler eher wütend, der dritte freudig.
Wohlbefinden ist ein noch globalerer Ausdruck, als die eben beschriebene Stimmung. Es entsteht nicht nur aufgrund aktueller Situationen, sondern bezieht die momentane bzw. unter Umständen auch die vergangenen und zukünftigen Lebenslagen mit ein. Dazu gehören Faktoren wie Familie, Beruf, Gesundheit, Krankheit, Alter, finanzielle Situation und viele weitere vor allem das Umfeld definierende Einflüsse. Beispielsweise war das Wohlbefinden vieler Menschen nach den Anschlägen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 massiv gestört, auch wenn diese zu Hause oder in der Arbeit waren und nicht auf einem anderen Weihnachtsmarkt.
Als Stress wird im Fachkontext ein Zustand des Körpers bezeichnet, der mit erhöhter Alarmbereitschaft einhergeht. Ein für unser Überleben unabdingbarer Mechanismus - aufgrund unserer modernen Lebensweisen jedoch mehr schädlich als noch nützlich. Viel zitiert und erforscht wird der negative Stress (Distress), der uns auch vielfach negative Emotionen beschert.20 Unterschätzt, vor allem auch für das Lernen, wird die Beachtung und Bestärkung des positiven Stresses (vgl. Diskussion in Kapitel 3.4) und die Möglichkeiten eines jeden Individuums, negatives Stresserleben in Eustress mit Hilfe adäquater Coping-Strategien umzuwandeln. Menschen bewerten Lebenslagen oder -situationen laut Lazarus (* 1922, f 2002) in drei Phasen: Primäre Bewertung: Situation wird als irrelevant, positiv (günstig) oder negativ (belastend) eingeschätzt; Sekundäre Bewertung: Bewertung der eigenen Bewältigungsstrategien für diese Situation; Tertiäre Bewertung: erneute Bewertung der Situation unter Berücksichtigung der Bewältigungsstrategien in irrelevant, positiv oder negativ.21
Die individuelle Art der Bewältigung unterscheidet sich je nach Situation und Identität wie folgt:
- Problemorientiertes Coping: aktive Auseinandersetzung mit dem Stressor, z. B. gezielte Prüfungsvorbereitung;
- Kognitives Coping: Bewältigung der Situation durch Veränderung der Gedanken, z. B. statt sich darüber zu ärgern, dass der Weg zur Arbeitsstelle sehr weit ist, freut sich der Fahrer über zusätzliche Zeit für lange Hörbücher;
- Emotionales Coping: Bewältigung der Situation auf Emotionsebene, z. B. Wut auf die Lehrerin, die die Klausur durchführt;22
Für die Selbstorganisation ebenfalls wichtig sind die unterschiedlich ausgeprägten Fertigkeiten des Menschen in Hinblick auf die emotionale Kompetenz, die sich im Laufe der Lebenszeit entwickeln und verändern. Saarni (* 1945, f 2015) definiert sie folgendermaßen:
- Die „Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand“ 23 kennzeichnet die
Fähigkeit, die eigenen Emotionen differenziert wahrzunehmen;
- „Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen“ 24 erläutert die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen verbal und nonverbal zu deuten und dementsprechend zu interpretieren;
- „Die Fähigkeit zum Gebrauch des Emotionslexikons“ 25 beschreibt die Kenntnis der kulturell eigenen Sprache im Umgang mit Emotionen;
- „Die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme“ 26 bezeichnet die Fähigkeit, sich emotional in Mitmenschen hineinzuversetzen;
- „Die Fähigkeit zwischen internalem emotionalen Erleben und externalem Emotionsausdruck zu unterscheiden“ 27 beschreibt die Fähigkeit, individuelle Emotionsausdrücke Anderer zu bewerten und sich der Wirkung eigener Emotionen auf Andere bewusst zu werden und gezielt einzusetzen;
- „Die Fähigkeit zur adaptiven Bewältigung aversiver Emotionen und belastender Umstände“ 28 bezeichnet Strategien, um mit negativen Emotionen umzugehen;
- „Die Bewusstheit von emotionaler Kommunikation in Beziehungen“ 29 legt die Fähigkeit zur emotionsbezogenen und beziehungsaufbauenden Kommunikation mit den Mitmenschen dar;
- „Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit“ 30 beschreibt abschließend die Fähigkeit zum Umgang mit den eigenen Emotionen vor allem in herausfordernden Situationen;31
Selbstorganisation durch Emotionen setzt im Individuum in erster Linie die Kenntnis der eigenen kulturell geprägten Emotionen sowie den Umgang auch im Sinne der Begrifflichkeiten Stimmung, Wohlbefinden und Stress voraus. Damit die individuelle Selbstorganisation auch im gesellschaftlichen Umfeld gelingen kann, sind emotionale Kompetenzen notwendig, die nicht nur den Umgang mit den eigenen Emotionen voraussetzen, sondern auch das Wahrnehmen, Bewerten und Interpretieren der Emotionen anderer Interaktionspartner und -partnerinnen.
Neben der emotionalen Kompetenz spielen sowohl die intrinsische als auch die durch Lernsituationen meist hervorgerufene extrinsische Motivation eines Individuums eine entscheidende Rolle für den Lernprozess, so dass sich das nächste Kapitel ausführlich damit beschäftigen wird.
2.2 Selbstorganisation durch Motivation
„Motivation ist ein psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet.“ 32 33 34
Heckhausen umschreibt diese einleitende Definition mit den Verben „wünschen“, „wählen“ und „wollen“ und legt damit den Grundstein für sein Rubikon-Modell der Handlungsphasen (vgl. dazu Abbildung 2.3, Seite 16). Er stellt dort den Anteil der Motivation am Selbstregulationsprozess dar.33,34 Zunächst werden Heckhausens Gedanken zu den oben genannten Verben betrachtet. Die Wünsche oder das Wün schen sind das Lebenselixier der Selbstregulation und Grundlage der individuellen Motivation: jeder Mensch hat unzählige Wünsche, die ihn mehr oder weniger stark (selbstreguliert/selbstorganisiert) antreiben. Abhängig ist dies unter anderem von den subjektiven Interessen des Betreffenden. Diese wiederum sind je unterschiedlich von den jeweiligen Lebenssituationen, die sich ständig ändern können. Um Motive (Wünsche) zu erfüllen, ist zunächst das Wählen notwendig. Es geschieht individuell und sehr sorgsam im Abwägen von Wünschbarkeit und Realisierbarkeit, Fachleute sprechen von Wert und Erwartung.35 Nicht nur für Spielautomaten im Casino sind das Wünschen und das Wählen eine Grundlage, auch Glaubensfragen werden seit dem frühen 17. Jahrhundert so motiviert beantwortet: „[. . .] ob es sich lohne, an die Existenz Gottes zu glauben. Selbst wenn dessen Existenz und dessen Nichtexistenz gleich wahrscheinlich seien, so sei doch die Wünschbarkeit der Existenz Gottes so unendlich groß, daß (sic!) es sich auf jeden Fall lohne, auf ihn zu setzen.“ 36 Die Ergebnisse dieses Wählens sind sehr gut erforscht, nicht jedoch der eigentliche Prozess, der zu diesem Ergebnis führt. Überraschenderweise sind es primär nicht die positiven Gedanken, die die Menschen dazu bringen, sich einen Wunsch zu erfüllen. Zunächst beschäftigt sich die Mehrzahl der Probanden gedanklich mit der Unerfüllbarkeit ihres Wunsches, bevor sie sich damit auseinandersetzen, welche Folgen die Unterlassung haben könnte. Wählen geschieht in einer dem Individuum entsprechenden realitätsorientierten Unbestechlichkeit. Nach Abwägung des Für und Wider und der Entscheidung für einen konkreten Wunsch schließt sich das Wollen an. Nun hat der Mensch ein Ziel vor Augen und handelt dementsprechend entschlossen und lässt sich auch nicht mehr davon abbringen, bevor er den Wunsch erfüllt hat oder eben daran gescheitert ist. Hat er im Zustand des Wählens noch realitätsorientiert abgewogen, so handelt er im Zustand des Wollens mehr zielorientiert. Untersuchungen zeigen, dass der einzelne Mensch unterschiedliche Fähigkeiten zur Selbstregulation in den drei dargestellten Bereichen aufweist, der eine führt das Wählen, der andere das Wollen sorgfältiger aus. Außerdem ist zu beobachten, dass durchaus auch Wünsche (Motive) in Angriff genommen werden, deren Folgen durchaus als schwerwiegend bezeichnet werden können. Ein detaillierter Blick beispielsweise in die Welt der Kriegsführung gibt Aufschluss darüber; hier nun beispielhaft die Geschichte, die Heckhausens Modell seinen Namen gab: Gaius Julius Cäsar überquerte den Fluss Rubikon (49 v. Chr.) im vollen Bewusstsein darüber, damit einen blutigen Bürgerkrieg auszulösen. Der Wunsch, den Rubikon zu überqueren und damit die Aussicht darauf, die Schlacht zu gewinnen, war größer, als den Wunsch zugunsten des Friedens fallen zu lassen.37 CÄSARs eigene (egoistische) Motivation war hier größer als das Wohl vieler tausend Menschen.
Hilfreich für erfolgreiches Wählen und Wollen ist vor allem das Durchlaufen aller Teilprozesse, die damit verbunden sind. Tatsächlich zeigen die Forschungen aber auch, dass Menschen eher selten in die Prozesse Wählen und Wollen (wie sie hier beschrieben sind), als oberste Stufe der menschlichen Motivationssysteme, einsteigen. Auf der hierarchisch untersten Stufe stehen die Reflexe, darauf folgen die angeborenen Verhaltensweisen, Triebe und erlernte Bedürfnisse. Die nächste Stufe bilden die Reaktionen, die im Zusammenhang mit Emotionen wie Glück, Trauer oder Überraschung stehen. Sind all diese Reaktionsweisen rechtmäßig im Gange, beschäftigt sich der Mensch mit den höheren Motiven (Wünschen) und erfüllt diese hin und wieder auch.38 Ähnlich wie die Bedürfnispyramide nach Maslow (* 1908, f 1970), kann auch hier die „Hierarchie der Motivationssysteme“ pyramidenartig dargestellt werden (siehe Abbildung 2.2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.2: Hierarchische Ordnung von Motivation und Bedürfnis. (a) Motivationspyramide. (b) MASLOWsche Bedürfnispyramide.
[Quelle: Eigene Darstellungen ]
Einige Parallelen zwischen Wünschen und Bedürfnissen sind offensichtlich zu erkennen. So ist bei beiden Darstellungen beispielsweise identisch, dass die einzelnen Stufen jeweils nur dann abrufbar sind, wenn die hierarchisch untergeordneten Schritte zufriedenstellend erfüllt sind. Die beiden obersten Stufen - Wünsche und Selbstverwirklichung - sind, wie Heckhausen beschreibt: „[...] die höheren, sozialen und kulturellen Motive, aus denen die meisten unserer Wünsche entspringen [...]“ 39. Auch Maslow postuliert, dass die Selbstverwirklichung erst dann zum Bedürfnis wird, wenn die untergeordneten Bedürfnisse befriedigt sind.
All diese Überlegungen fließen in das bereits vorgestellte Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Abb. 2.340 ) ein. Es wird in vier Phasen gegliedert, die nachfolgend näher erläutert werden. Die prädezisionale Phase (= Wünschen) ist die Phase, in der die individuellen Motive, gelenkt von selbst- und fremdbestimmten Interessen, entstehen.41 Fällt die Bilanz positiv aus (für die Erfüllung des Wunsches), entsteht daraus ein konkretes Ziel. Diese Absicht wird in der präaktionalen Phase (= Wählen) realisiert. Unter anderem mit der Planung der Herangehensweise (Wünschbarkeit und Realisierbarkeit)42, dem idealen Zeitpunkt der Durchführung und dem Ignorieren weiterer Wünsche. Das konkrete Handeln bis zum Zielabschluss geschieht in der aktionalen Phase (= Wollen). Eine Evaluation des Prozesses und des Handelns findet in der postaktionalen Phase statt. Vor allem Faktoren für Erfolg und Misserfolg werden vom Individuum betrachtet und bewertet. Wichtig, gerade für den Lernprozess, ist nicht nur die Betrachtung der personenbezogenen, sondern auch der situationsbedingten Motivation.43
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen.
* Volition: „Überschreitung des Rubikon“ - Willentliche Umsetzung einer Intention in eine Handlung mit Planung und Ausführung.
Lena Lämmle und Markus Dresel beschreiben hierzu ein „Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation“ (vgl. nachfolgende Tabellen 2.1-2.5). Es besteht aus fünf Blöcken, die sich der Person selbst, der Person in der Lernsituation und dem Umfeld der Lernsituation zuordnen lassen. In Block B, den der Person zugeordneten Merkmalen, werden dazu die motivational wertbezogenen (Ziele, Interesse, Bedürfnisse) und erwartungsbezogenen (Selbstorganisation) Faktoren betrachtet. Die Blöcke A, D und E werden den entsprechenden Phasen des Rubikon-Modells zugeordnet44:
Tab. 2.1: Komponenten des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation: Block A.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2.2: Komponenten des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation: Block B.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Abwägephase“ (Block A) Entstehung aktueller Motivation in spezifischer Lehr- Lern-Situation: durch das Abwägen von Wert und Erwartung kristallisiert sich das aktuelle Motiv für die gewünschte Lernsituation heraus. Planungs- und Handlungsphase (Block D) Planung, Initiierung und Ausführung einer Lernsituation: diese Phasen finden vor allem vor und während der Lernsituation statt. Bewertungsphase (Block E) Bewertung der Handlungsergebnisse: hier findet eine hauptsächlich selbstreflexive Analyse der Lernsituation statt.45
Schließlich stellt Block C die Merkmale dar, die das Umfeld einer Lernsituation beschreiben. Dabei geht es zum einen um Werte und Normen, Beziehungen sowie Erwartungen von Bezugspersonen. Zum anderen werden die spezifischen Eigenheiten einer Lernsituation erläutert: zum Beispiel Vorgaben, Schwierigkeitsgrad, Unterstützung und soziale Interaktionen. Die Bewertung der Handlungsergebnisse (E) erfolgt immer in Verbindung mit der initialen Motivation (B).46 Dabei ist es nach Meinung der Autorin so, dass einerseits die motivationalen Tendenzen Einfluss auf die Analyse haben: diese Lernsituation ist mir nicht wichtig, deshalb fällt die Bewertung des Ergebnisses weniger relevant aus. Andererseits bewirkt eine zum Beispiel unerwartet positive Bewertung einer Lernsituation auch eine motivationale Veränderung. Ähnliche, wenn nicht identische, Auswirkung hat die individuelle Motivation auch im Zusammenspiel mit Werten und Erfahrungen (A), Planung und Durchführung der konkreten Handlung (B) und den Umweltfaktoren (C).
Tab. 2.3: Komponenten des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation: Block C.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um zu verstehen, wie sich Motivation individuell auf die Lernsituation auswirkt, sei hier auf die „Selbstbestimmungstheorie der Motivation“ von Edward L. Deci und Richard M. Ryan hingewiesen. Das Autorenteam definiert den Zusammenhang zwischen Lernen und Motivation, in dessen Mittelpunkt das Individuum steht. Dabei unterscheiden sie die intrinsische Motivation und diverse extrinsische Formen anhand des Grads der (erlebten) Selbstbestimmung. Intentionales Verhalten eines Menschen verfolgt in der Regel ein bestimmtes Ziel, welches erreicht werden will. Die damit nötigen Handlungen gehen von der betreffenden Person aus und gelten daher als motiviert. Verhaltensweisen, die keinem bestimmten Zweck dienen oder auch aus unkontrollierten Handlungsimpulsen resultieren, bezeichnen theoretische Konstrukte der Motivation - so auch die hier beschriebene - als nicht motiviert bzw. amotiviert47. Die Selbstbestimmungstheorie bewertet dabei nicht nur die Intentionen und die unterschiedlichen Motivationsstärken, sondern definiert sie auch anhand der Selbstbestimmung und Kontrolliertheit. Mit diesen beiden Begrifflichkeiten gelingt die nachfolgende Differenzierung der Motivation.48
Tab. 2.4: Komponenten des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation: Block D.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2.5: Komponenten des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation: Block E.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Intrinsische Motivation wird als autonome und interessensorientierte Handlung bestimmt, die keiner externen Gestaltung unterliegt. Mihaly Csikszentmihalyi definiert dafür den Begriff „autotelisch“, also unabhängig und dem Selbstzweck dienend. Die daraus entstehenden Handlungen sind geprägt von individueller Neugier, Spontanität und dem Interesse, die Sache zu beherrschen. Handlung und (Lebens-) Einstellung stimmen überein und der Mensch übt die intrinsisch motivierte Tätigkeit ohne Druck von außen und ohne innere Zwänge aus. Werden diese Handlungen nun von außen (extrinsisch) belohnt, kann das je nach erlebter Veränderung des Kontinuums zwischen „Selbstbestimmung“ und „heteronomer Kontrolle“ entweder die intrinsische Motivation verstärken oder aber auch in die extrinsische Motivation wechseln. Extrinsisch motivierte Handlungen werden meist von außen angestoßen und treten nicht spontan auf. In der Regel sind sie auch an eine (positive oder negative) Bewertung und damit an entsprechende Konsequenzen gebunden. Allerdings können auch extrinsisch motivierte Forderungen in intrinsisch motivierte Handlungen übergehen. Dies geschieht vor allem dort, wo die Gruppenzugehörigkeit in einem sozialen Milieu vorausgesetzt und vermittelt wird.49
Deci und Ryan unterscheiden dazu vier Formen der extrinsischen Motivation, die im bereits beschriebenen Kontinuum an unterschiedlichen Stellen stehen. Die Form der externalen Regulation reguliert Handlungen auf die das Individuum keinen Einfluss hat, um einer Bestrafung zu entgehen oder eine Belohnung zu erhalten. Es entspricht dabei weder den Axiomen Autonomie noch Freiwilligkeit und steht auf der Seite der heteronomen Kontrolle im Kontinuum. Die Art der introjizierten Regulation resultiert aus individuell definierten Werten und Normen im momentanen sozialen Milieu. Das Individuum benötigt keine äußeren Anstöße dazu, kann sich aber nicht gegen die (eigenen) inneren Zwänge auflehnen. Beispiel: ein Schüler macht seinen Abschluss nur deshalb, weil alle seine Freunde dies auch tun. Die identifizierte Regulation bedient sich den Werten und Normen der Gesellschaft, die allerdings das Individuum für sich selbst als wichtig oder unwichtig definiert hat, zum Beispiel absolviert eine Schülerin das Abitur, um danach das (intrinsisch motiviert) ausgewählte Studium aufzunehmen. Den höchsten Grad an Selbstbestimmung im Komplex extrinsischer Motivation hat die integrierte Regulation. Das Individuum integriert Werte, Normen, Ziele und Handlungen in den eigenen Lebensentwurf und schafft damit ein Selbstkonzept, in dem Selbstbestimmtheit und Kontrolliertheit miteinander harmonisieren.50
Grundlagen für selbstbestimmtes Handeln sind sowohl die intrinsische Motivation als auch die integrierte Regulation. Energie, um diese Motivation für eine Handlung aufzubringen, erhält das Individuum laut Deci und Ryan daraus, physiologische und psychologische Bedürfnisse sowie Emotionen zu befriedigen. Die wichtigste Energiequelle in der Selbstbestimmungstheorie ist die der psychologischen Bedürfnisse. Die größte Relevanz haben dabei die Wirksamkeit (Kompetenz), die Autonomie (Selbstbestimmung) und die soziale Zugehörigkeit (Eingebundenheit).51 Um Motivation individuell zu verstehen, sind auch die Motive, die als Teil der Persönlichkeit gelten, wichtig. Im Laufe der vielen Jahre der Motivationsforschung haben sich drei zentrale Motive herausgebildet: „Leistungsmotiv“ (meistern schwieriger Herausforderungen mit Hoffnung auf Erfolg und/oder Furcht vor Misserfolg; Brunstein & HeckhauSen), „Anschlussmotiv“ (Beziehungen eingehen mit Hoffnung auf Anschluss und/oder Furcht vor Zurückweisung; Sokolowski & Heckhausen) und das „Machtmotiv“ (Kontrolle der sozialen und gegenständlichen Umwelt mit Hoffnung auf Kontrolle und/oder Furcht vor Kontrolle; Schmalt & Heckhausen).52
Neben der Motivation ist nach Meinung der Autorin Anerkennung ein beachtenswertes Merkmal für die Selbstorganisation. Das weiterführende Kapitel befasst sich mit diesem Faktor, da das Erleben von Anerkennung nicht nur identitätsstiftend sein kann, sondern dadurch auch nachhaltig erfolgreiche Lernprozesse geprägt werden.
2.3 Selbstorganisation durch Anerkennung
Anerkennung als eminentes Phänomen in der Erwachsenenbildung erscheint zunächst befremdlich und gerade deshalb erwähnenswert und einer Erläuterung bedürftig. Seine unterschiedlichen wörtlichen Bedeutungen sind vielfältig, für die Forschung daher Fluch und Segen zugleich. Bedeutet es doch einerseits Konfusion in beispielsweise fachlichen Debatten, fördert es andererseits die Kreativität an die Herangehensweise im Umgang mit Anerkennung.53
Das Wort Anerkennung kann semantisch drei Wortfamilien zugeordnet werden. Anerkennung kann „identifizieren“ im Sinne eines Erkennungsprozesses bedeuten: das ist der Klaus, das ist ein Baum. Eine zweite Bedeutung des Wortes liegt im „Akzeptieren“ von gesellschaftlich gültigen Normen, Werten und Gesetzen, z. B. wird hierzulande zur Begrüßung die Hand geschüttelt. Die bei Ikäheimo beschriebene dritte Bedeutungsform der Anerkennung ist die Variante, die für die vorliegende Forschungsarbeit die wohl wichtigste Bedeutung aufweist: eine positive personenbezogene Verwendung, die in ihrer Versprachlichung „Wertschätzung“ und „Respekt“ gegenüber anderen Personen inkludiert: „Du hast einen sehr wertvollen Wortbeitrag zur Diskussion beigetragen“; „Gut, dass Du in der hitzigen Gesprächsrunde einen kühlen Kopf bewahrt hast“.54
Axel Honneth, Philosoph der Gegenwart und renommierter Anerkennungsforscher, beschreibt in seinen Ausführungen den Werdegang des Phänomens Anerkennung mit dem Versuch, einen Anfang in der Geschichte zu finden. Als ein Wegbereiter der Anerkennungsforschung wird von ihm Thomas Hobbes (* 1588, f 1679) diskutiert, der in seinen Arbeiten immer wieder davon spricht, dass es den Menschen förmlich danach drängt, Anerkennung zu erhalten55 „[...] als ehrenhaft und vorzüglich zu gelten [.. 56. Etwa zur gleichen Zeit lebte und wirkte Comenius, der in seinen Schriften Anerkennung vor allem ausgehend vom Lehrenden hin zum Lernenden formulierte:
„Nicht bloß die Kinder der Reichen oder Vornehmen, sondern alle in gleicher Weise, Adelige und Nichtadelige, Reiche und Arme, Knaben und Mädchen, müssen in allen Städten und Flecken, [...] zur Schule herangezogen werden [...] Zunächst sind alle, die als Menschen geboren sind, zu dem Hauptzweck geboren, Mensch zu sein, [...]. [...] so zu fördern, daß (sic!) sie, in die Wissenschaften, [...] recht eingeweiht [...]. Dem steht nicht entgegen, daß (sic!) einige von Natur stumpfsinnig oder dumm scheinen; denn das empfiehlt und verlangt diese allgemeine Pflege der Geister nur noch gebieterischer“ 57
Für Johann Gottlieb Fichte (* 1762, f 1814) ist Anerkennung ebenfalls ein zentraler Forschungsgegenstand. Er wirkt jedoch unschlüssig zwischen einem Verständnis von Anerkennung als theoretischem und praktischem Konstrukt einerseits und einem Konzept von Anerkennung als einem mentalen Akt und einer Handlung an sich andererseits.58 Verschiedene Perspektiven, die auch die (moderne) Literatur für die Differenzierung von Anerkennung benennt: Einstellungen, komplexe Gefüge zwischen Einstellungen und weiteren psychischen Zuständen, interpersonale Relationen und soziale sowie institutionelle Kontexte.59 Allerdings ist es aufgrund der unfassbar großen Fülle an Kombinationsmöglichkeiten und einer schier endlosen Menge an möglichen Veränderungen kaum möglich, Anerkennung explizit zu definieren. Die verschiedenen theoretischen Zugänge, die sich mit dem Phänomen Anerkennung beschäftigen, sind sich uneinig über die beschreibenden Dimensionen, vor allem Personen gegenüber. Die Denkweisen reichen von einer definierten Dimension bis hin zu einer Multidimensionalität dieses Begriffes.
Honneth diskutiert seine eigenen anerkennungstheoretischen Ausführungen anhand folgender vier Aspekte: die historische Entwicklung zwischen Mutter und Kind ist ausschlaggebend für die Anerkennungsbiografie eines Individuums; Identität entsteht prozesshaft aus Anerkennung: Identifizieren einer Wahrnehmung; einer Reflexion im Sich-Erkennen und dem Wieder-Erkennen von Anderen und der wechselseitigen Anerkennung im sozialen Miteinander. Ein weiterer Punkt ist soziale Identität, die durch Anerkennung veränderbar und in lernförderlichen Umgebungen positiv (um-)gestaltbar wird.60
Daraus entwickelt er drei verschiedene Dimensionen von Anerkennung: Liebe, entstehend aus Vergewaltigung und Folter als Form der Missachtung und Selbstvertrauen als Form der Selbstbeziehung. Recht, entstehend aus Entrechtung (Missachtung) und Selbstachtung (Selbstbeziehung). Die dritte Form der Anerkennung ist Solidarität, entstehend aus Beleidigung und Entwürdigung (Missachtung) und Selbstwertgefühl (Selbstbeziehung). Liebe beschreibt die Strukturen im Selbst des Individuums und in Beziehung mit anderen. Recht im Kontext Anerkennung bedeutet eine Sichtweise des Individuums und der anderen als „Träger von Rechten“ 61, welche durch die Normen und Gesetze der Gesellschaft bestimmt sind. Solidarität beschreibt Honneth mit Anteilnahme am Leben Anderer, das dann funktioniert, wenn die jeweils gültigen Werte und Normen bekannt sind, um einzuschätzen, ob Leistungen als gesellschaftlich wertvoll zu erachten sind.62
Die für uns Menschen so wichtige soziale Anerkennung ist immer auch von sozialen Interaktionen abhängig. Werner Nothdurft definiert dazu drei Termini, die den Zusammenhang Anerkennung und Interaktion schlüssig darstellen. Der Begriff Anerkennungsarena beschreibt dabei Situationen, in denen lebensweltabhängig Anerkennung gewährt wird. Personen, die diese Anerkennung zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine definierte Leistung an ausgewählte Menschen vergeben, werden als Anerkennungsordnung zusammengefasst. Das individuelle soziale Netzwerk, in welchem Anerkennung definiert wird, bezeichnet Nothdurft als Anerkennungsfiguration und erlaubt damit, die Emotionen Macht und Autorität in die Diskussion aufzunehmen.63
Anerkennung bedeutet im Kontext Erwachsenenbildung eine interessensgeleitete Haltung gegenüber Lernenden und die Bereitschaft, von ihnen zu lernen. Um anerkennend zu lehren (und zu lernen) benötigt es eine grundsätzlich positive Grundeinstellung - „Bejahung“ - zum Gegenüber, um ein, möglicherweise beiderseitiges, „entweder oder“ in der Problemlösung in ein sich gegenseitig befruchtendes „sowohl als auch“ umzuwandeln. Weiter ist der Versuch einer Gleichbehandlung von Individuen in einer Lerngruppe (synonym einer Schulklasse) wesentliches Merkmal einer anerkennenden und identitätsstiftenden Pädagogik. 64 Vor allem die Zugehörigkeit innerhalb dieser beschriebenen Gruppe spielt im Lernprozess eine gewichtige Rolle mit Auswirkungen auf alle Ebenen des Selbstorganisationsprozesses. Grund hierfür ist der Anpassungsdruck, dem das Individuum ausgesetzt ist, in der Gruppe zu bestehen. Durch die Gleichbehandlung der Gruppenangehörigen, dies zeigt sich vor allem in der Haltung und dem Verhalten den Lernenden gegenüber, vermindert sich die Gefahr der Exklusion einzelner Personen. Die Erfahrung von sozialem Handeln im Lehren und Lernen ist als Anerkennung so wertvoll, dass eine Benennung dieser ein drittes Axiom für die Anerkennungspädagogik, wie MÜller-Commichau sie beschreibt, darstellt.65 Ziel dieser die Selbstorganisation unterstützenden Handlungen sind zum einen die Förderung der eigenen Identität durch Wissenserwerb, zum anderen der Drang nach Anerkennung in einer Gesellschaft, in der Leistung immer wichtiger zu werden scheint als das soziale Handeln im Miteinander. Für Agierende im Weiterbildungssektor bedeutet dies, durch aufmerksames Zuhören und sensibles Interpretieren die wahren Motive der Teilnehmenden herauszufinden und diese in anerkennender Weise in das bestehende Kurskonzept einzuordnen und darzustellen. Daneben ist für die Anerkennung wichtig, auch das Individuum an sich und nicht nur die Lerngemeinschaft zu sehen. Der Blick auf den Einzelnen, ihn - auch sprachlich - zur Kenntnis zu nehmen, wird von diesem als bejahend und anerkennend wahrgenommen und bestärkt ihn in seiner individuellen Selbstorganisation. 66 Die Bejahung der bloßen Existenz eines Individuums beschreibt die „Anerkennung des Daseins“ 67. Für die Selbstorganisation von vielleicht sogar noch größerer Bedeutung, zumindest im Kontext der Erwachsenenbildung, erscheint die „Anerkennung des Soseins“ 68. Diese positive und authentische Anerkennung der jeweils individuellen Talente, Kompetenzen und Charaktereigenschaften ermöglicht Lernenden eine anerkennende und somit lernförderliche Haltung sich selbst gegenüber. 69 Die Anerkennungstheorie in der Erwachsenenbildung hat ihre Daseinsberechtigung vor allem auch in ihrer mahnenden Funktion als Sensibilisierungsinstrument für institutionell-zentrierte Interaktionen im Lernprozess zwischen Lehrenden und Lernenden. Vor allem die identitätsstiftenden Konsequenzen von Anerkennung - positiv wie negativ - müssen ihren Platz in der pädagogischen Praxis erhalten.
Bezugnehmend auf die Einführung in das Kapitel lässt sich sagen, dass Anerkennung Einfluss auf alle drei von Mandelbrot definierten Axiome der Selbstorganisation hat. Vorerfahrungen mit dem oben beschriebenen Phänomen wirken zusammen mit Emotionen und der jeweiligen Motivation auf die Fähigkeiten ein, eigene Ziele zu definieren (Zielorientierung) und einen individuellen Lösungsansatz (Selbstoptimierung) zu finden. Anerkennung kann dafür sorgen, dass diese Prozesse erfolgreich im Individuum ablaufen. Auf den Lernprozess spezifiziert heißt das, dass anerkennende soziale Interaktionen die Selbstorganisationsfähigkeit des Einzelnen stärken und so nachhaltig auf das selbstorganisierte Lernen, welches im nachfolgenden Kapitel erläutert wird, wirken.
2.4 Selbstorganisation im Lernprozess
Wissenschaftlichkeit, vor allem in der Disziplin Pädagogik und Psychologie, hat sich verändert: weg vom wahren und sicheren Wissen hin zu Beschreibungen von (menschlichen) Problemen und deren Lösungsansätze. Auch gesellschaftliche Phänomene machen ein solches Umdenken nötig: Freiheitsansprüche, erhöhte Risikobereitschaft in allen Bereichen, Neuordnung von Werten, Normen und Traditionen, Schnelllebigkeit und Veränderungen von Routinen, Praktiken und den bestehenden Lebenswelten. Die Pädagogik hat es dabei nicht einfach, muss sie doch die Theorie mit einer sehr komplexen Praxis, die auf die unterschiedlichsten Lernbiografien und Umstände eingehen soll, unter einen Hut bringen. „Pädagogische Professionalität setzt die Fähigkeit zur Einnahme unterschiedlicher Beobachterperspektiven voraus, weil sich die Wege stets verzweigen.“ 70 Die Komponenten der Pädagogik (einer Sozialwissenschaft) sind für alle Menschen von Bedeutung, ähnlich der Medizin. Lehrer benötigen „[...] Wissen über Erziehung, Lernen, Kommunikation [...]“ 71 und dem Gehirn (der Schüler), nur so sind sie in der Lage, Konzepte in die Praxis umzusetzen. Selbstorganisiertes Lernen hat den Anspruch, genau das zu leisten und dabei die theoretischen Konstrukte mit der Praxis zu verbinden.72
Die wissenschaftlich-historische Bedeutung des selbstorganisierten Lernens steigt seit den 1980er Jahren kontinuierlich an: in der Datenbank PsycINFO73 wurden zwischen 1980 und 1989 sechzehn Arbeiten unter dem Begriff des selbstregulierten Lernens veröffentlicht, in den Jahren 2000 bis 2009 bereits 540 Forschungsarbeiten. Auch im Kontext der Erwachsenenbildung steigt das wissenschaftliche Interesse seit den 90er Jahren kontinuierlich an, vorher lag der Fokus eher in der Psychologie.74 Allerdings lässt sich auch in weitaus früheren pädagogischen Strömungen die Idee zur Förderung dieser Selbstorganisation finden, zum Beispiel betont schon Johann Amos Comenius (* 1592, f 1670) dies: sein Menschenbild war geprägt vom Glauben an das ursprünglich Gute im Menschen und einer Erziehung im Sinne Gottes. Seine didaktischen Studien sind inspiriert von der Pflicht des Menschen, sich auf Erden auf ein Leben nach dem Tod vorzubereiten. Die von Comenius vorgegebenen Erziehungsziele in der „Didactica Magna“ verbinden theologische Motivation mit weltlicher Tätigkeit. Der Theologe beschreibt dazu drei Zustände des Menschseins: im Mutterleib, auf der Erde und im Himmel. Von Gott mit Vernunft ausgestattet ist der Mensch auf Erden sittlich-religiös handlungsfähig und daraus resultieren seiner Meinung nach drei Erziehungsziele: gelehrte Bildung, Sittlichkeit des Lebens und Religiosität.75 Methodisch und didaktisch spiegeln sich diese Ziele im Vorwort der „Didactica Magna“ wieder:
„[...] Sie sei die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren auf sichere und vorzügliche Art und Weise, in allen Gemeinden, Städten und Dörfern eines jeden christlichen Landes Schulen zu errichten, in denen die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne jede Ausnahme rasch, angenehm und gründlich in den Wissenschaften gebildet (eigene Anm.: gelehrte Bildung), zu guten Sitten geführt (Anm.: Sittlichkeit des Lebens), mit Frömmigkeit erfüllt (Anm.: Religiosität) und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses und das künftige Leben nötig ist, angeleitet werden kann [...]. Erstes und letztes Ziel der Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren, und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche [...].“76
Der Glaube an die Darstellbarkeit und Vermittelbarkeit eines Universalwissens verhilft Comenius zu einem unerschütterlichen und optimistischen Glauben: Alle alles auf umfassende Weise zu lehren (lat. omnes omnia omino). Neben der „verbalen Wissensaneignung“ beschreibt er in seiner Didaktik den notwendigen Bezug zum Lerngegenstand ebenso, wie die Selbsttätigkeit des „Zöglings“, um sich selbstständig zu bilden und gründliches Wissen zu erwerben.77 „Der Zögling soll sich durch eigene Anschauung entwickeln, er wirkt selbsttätig im Bildungsprozess und gerade hierdurch kann er sich selbst bilden und gründliches Wissen erwerben.“ 78 Comenius sieht in den Menschen ein „[...] lernbegieriges schaffendes, mit Hilfe seiner Sinne und ■seines Verstandes sich die Welt aneignendes Wesen.“ 79 Er verbindet in seiner Didaktik Lehre und Lernen, nicht nur die Lernenden werden optimistisch und motiviert dargestellt, sondern auch die Lehrenden. Comenius beachtet auch die Individualität seiner „Zöglinge“, wenn er davon spricht, „[.. .] bei manchen steht die Erziehung vor größerer Herausforderung als bei anderen. [...] Herausforderungen, die in der Erziehung übernommen werden müssen und können, um bei jedem Einzelnen Verbesserung herbeizuführen.“ 80 Der Pädagoge beschreibt die Erziehung des Individuums vergleichend mit formbarem Wachs - behutsam und vorsichtig und jedes Geschöpf erhält so seine eigene Form. Er definiert den außer Frage stehenden Schulweg eines Kindes seiner Zeit an vier Stufen, die jeweils sechs Jahre dauern. Dabei wird das Wissen nicht häppchenweise weitergegeben, sondern ganzheitlich an der jeweiligen Schulstufe orientiert. Neben den drei oben benannten Erziehungszielen ist darauf zu achten, dass der Lernstoff vom Naheliegenden zum Fernen und vom Einfachen zum Schweren aufgebaut ist und dass im Unterricht gemäß der pansophischen81 82 83 Ordnung stets die Sprachwelt parallel der Sachenwelt in der eigenen Muttersprache erschlossen werden muss.82,83 Comenius geht damals schon davon aus, dass das „[...] gesamte Leben ein Bildungsprozess sei.“ 84 Übertragen auf den Kontext des selbstorganisierten Lernens und den zentralen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit bedeutet dies, dass Comenius seinerzeit schon wusste, dass Sprache und Sache, Sache und Lehrgegenstand und daraus resultierende Grundkenntnisse vorhanden sein müssen, damit Kinder (wie auch Erwachsene) nachhaltig und erfolgreich selbstorganisiert zu lernen im Stande sind.
Weiter beschäftigt sich zum Beispiel auch Jean-Jacques Rousseau damit, den Lernenden durch Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung anzuleiten. Ebenso beziehen die Reformpädagogen dazu Stellung: Hugo Gaudig (* 1860, f 1923) beschreibt die freie geistige Schularbeit, Maria Montessori (* 1870, f 1952) erläutert in ihren Vorschlägen die Freiarbeit mit unterschiedlichen Materialien, Peter Petersen (* 1884, f 1952) Wochenpläne und John Dewey (* 1859, f 1952) den Projektunterricht85.
Piotr J. Galperin (*1902, f 1988) beschreibt die „Zauberformel Selbstregulation“ 86 anhand eines Etappenmodells. Dabei hält er es für notwendig, eine Orientierungsgrundlage zu schaffen, die aufgrund gesetzesmäßiger Beziehungen eine Handlung erfasst (nur dieser Orientierungstyp erlaubt den Lernern laut Galperin Selbstorganisation). Die Durchführung einer Arbeitshandlung besteht aus vier Abschnitten, die sich aus materiellen und sprachlichen Handlungen zusammensetzen. Die Durchführung der Kontrollhandlung ist dabei an keine der beiden vorherigen Etappen gebunden, sondern findet kontinuierlich als Abgleich zwischen Anforderung und Lösung in jedem Lernprozess selbstorganisiert statt.87 Wichtig für die Auseinandersetzung mit diesem Modell ist die Anmerkung, dies nicht als Unterrichtsplanungsinstrument zu verwenden, sondern als Hilfe für den „Prozess der Bewusstseinsbildung“ 88 der Lernenden. Hilbert Meyer definiert die für das selbstorganisierte bzw. selbstregulierte Lernen notwendige Fähigkeiten als „Kompetenzen zweiter Ordnung“ 89, da sie schwer fachgebunden zugeordnet werden können. Mit Selbstregulation bezeichnet er die Fähigkeiten, die eigenen Lernstrategien zu initiieren, zu kontrollieren und zu bewerten. Mit „Learning by doing“, Beobachtung des Lernfortschrittes, Entwicklung der Lernstrategien und förderlichen Lernumgebungen kann seiner Meinung nach selbstorganisiertes Lernen erfolgreich werden.90
Monique Boekaerts entwickelte 1999 das Drei-Schichten-Modell (siehe umseitige Abbildung 2.491 ) als ein Hierarchiemodell und einer Überarbeitung ihres vorherigen Sechs-Komponenten-Modells.
Sie unterscheidet drei einzelne Ebenen, die notwendig sind, um selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen. Die Regulation des Verarbeitungsmodus setzt voraus, dass Lernende auf individuelle Problemlösungs- und Lernstrategien (kognitive Prozesse) zurückgreifen können, um Lernergebnisse zu verarbeiten. Diese sind laut der belgischen Pädagogin die Grundlage selbstorganisierten Lernens und deshalb der zentrale Aspekt ihres Entwurfs. Um Fähigkeiten seitens Lernender für diese innerste Ebene zu definieren, empfiehlt die Autorin die „Was-Fragen“ zu stellen. Die Regulation des Lernprozesses beschreibt die notwendigen Kompetenzen eines Lernenden, mithilfe geeigneter metakognitiver Strategien Lernen zu initiieren, zu bewerten, zu überwachen und bei Bedarf zu regulieren. Um die notwendigen Kompetenzen beschreiben zu können, ist es sinnvoll, die „Wie-Fragen“ für diese mittlere Ebene zu erörtern. Die Regulation des Selbst im äußeren Kreis bezieht sich auf das Individuum und dessen Handeln im Kontext Lernen. Es geht dabei vor allem auch darum, intrinsisch motivierte Ziele („Warum-Fragen“) zu bestimmen und mit geeigneten Ressourcen zu erreichen.92 Alle drei Ebenen sind notwendigerweise miteinander verknüpft. Kritisch diskutiert werden kann hier sicherlich die hierarchische Aufteilung dieser drei Schichten. Vermutlich lassen sich in einem Lernprozess alle drei Regulationsprozesse extrahieren, allerdings ist der im Zentrum stehende Prozess abhängig vom jeweiligen Konstrukt des stattfindenden Prozesses, den der Lernende gerade durchläuft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.4: Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens nach Boekaerts.
Martin Herold beschreibt die Entstehung seines Ansatzes zum selbstorganisierten Lernen als Prozess aus verschiedenen Fachdisziplinen (vgl. dazu auch die Einführung in Kapitel 2). Er nutzt dazu die Systemtheorie, die Mathematik, die Chemie, die fraktale Geometrie, die Chaosforschung, die Neurowissenschaften und ein systemisch-konstruktivistisches Verständnis. Die fraktale Geometrie beispielsweise erklärt das selbstorganisierte Lernen anhand der bereits beschriebenen Faktoren Zielorientierung, Selbstähnlichkeit (Vorerfahrungen) und Selbstoptimierung. Die Sys temtheorie beschreibt das selbstorganisierte Lernen auf Grundlage der Autopoiesis, der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung, die letztendlich die Selbstorganisation und das selbstorganisierte Lernen definieren. Die von Herold angeführte Chaosforschung beschreibt, dass die Vorhersehbarkeit, auch von Lernprozessen, schlecht bis unmöglich ist. Der gemäßigte Konstruktivismus hält dagegen bzw. relativiert dies und begründet das mit der menschlichen Reflexionsfähigkeit, die es ermöglicht, gewisse Phänomene eben doch vorherzusagen. Bekannterweise gelingt dies nicht immer, aber mit jedem „Flügelschlag des Schmetterlings“ (Chaostheorie), der eine Vorhersage zunichtemacht, lernt der Mensch aufgrund seiner Reflexionsfähigkeit dazu und minimiert so die Fehlerquellen von Mal zu Mal und verbessert so die Vorhersehbarkeit bzw. den Umgang mit ähnlichen Problemen. Der Mensch lernt, auf Störungen zu reagieren. Da aber nun jedes Gehirn anders reagiert (Konstruktivismus), löst der „Flügelschlag“ bei jedem Lernenden eine eigene individuelle Reaktion aus, so ist eine Vorhersehbarkeit tatsächlich nahezu unmöglich.93 Selbstorganisiertes Lernen heißt keineswegs, dass Lernende selbst inhaltlich und formell ihr Lernen gestalten, sondern vielmehr, dass die Selbstorganisation in Bezug auf das Lernen gefördert wird. Herolds Fazit lautet deshalb: „Lernen ist die natürlichste Sache der Welt.“ 94 Dazu benötigt es eine gute Kombination aus Instruktion und Konstruktion im Kontext des jeweiligen Lernbereiches. Der systemische Konstruktivismus beschreibt, dass Schüler und Schülerinnen aktiv die eigene Wirklichkeit gestalten sollen, indem sie ihre Wirklichkeit erfinden (Konstruktion), entdecken (Rekonstruktion) und überprüfen (Dekonstruktion).95 Lehrende helfen mit ihrem Mehr an Wissen (wissen aber nicht besser!), um den Lernenden verschiedene Perspektiven zu eröffnen.
[...]
1 Herrmann (2009): Neurodidaktik, S. 12.
2 Vgl. Herrmann (2009): Neurodidaktik, S. 12.
3 Vgl. Herold und Herold (2013): Lernumgebungen, S. 36-39.
4 Vgl. Herold und Herold (2013): Lernumgebungen, S. 38.
5 Vgl. a.a.O., S.39-40.
6 Scheffer und Heckhausen (2018): Theorien der Motivation, S. 70.
7 A.a.O.
8 Vgl. a. a. O., S. 68.
9 Vgl. Linschoten (1961): William James, S. 21-23.
10 Vgl. Henn-Memmesheimer (2012): Beispiel Angst, S. 22-23.
11 Frenzel und Stephens (2011): Emotionen, S. 20.
12 Vgl. Faullant (2007): Psychologische Determinanten, S. 50.
13 Frenzel und Stephens (2011): Emotionen, S. 21.
14 Vgl. a.a.O., S.22.
15 Vgl. a. a. O., S. 21-22.
16 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2019): Vier Ohren und ein Eisberg.
17 Vgl. Frenzel und Stephens (2011): Emotionen, S. 22.
18 Vgl. a.a.O., S.24.
19 Vgl. Frenzel und Stephens (2011): Emotionen, S. 24.
20 Vgl. a.a.O., S.25.
21 Vgl. Dietz (2006): Grundlagen und Modelle, S. 26-27.
22 Vgl. Dietz (2006): Grundlagen und Modelle, S. 26-27.
23 Schell (2011): Emotionale Kompetenz, S. 70.
24 A.a.O., S.71.
25 A. a. O.
26 A. a. O.
27 A. a. O.
28 A. a. O.
29 Schell (2011): Emotionale Kompetenz, S. 71.
30 A. a. O.
31 Vgl. a.a.O., S.70-71.
32 Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 81.
33 Vgl. Heckhausen (1987): Wünschen, Wählen, Wollen, S. 3.
34 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 82.
35 Vgl. Heckhausen (1987): Wünschen, Wählen, Wollen, S. 4.
36 A. a. O.
37 Vgl. Heckhausen (1987): Wünschen, Wählen, Wollen, S. 4-6.
38 Vgl. a.a.O., S. 4-8.
39 Heckhausen (1987): Wünschen, Wählen, Wollen, S. 8.
40 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 83.
41 Vgl. a. a. O.
42 Vgl. Heckhausen (1987): Wünschen, Wählen, Wollen, S. 4.
43 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 82-83.
44 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 85-87.
45 Vgl. a.a.O., S.86-87.
46 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 85-88.
47 Unter Amotiviertheit versteht man einen Zustand ohne jegliche Lernmotivation. Symptomatisch hierfür ist Hilflosigkeit und Gleichgültigkeit. Als Gegensatz ist Interesse als höhere Motivationsform zu nennen.
48 Vgl. Deci und Ryan: Selbstbestimmungstheorie, S. 223-225.
49 Vgl. Deci und Ryan: Selbstbestimmungstheorie, S. 225-227.
50 Vgl. a.a.O., S.227-228.
51 Vgl. Deci und Ryan: Selbstbestimmungstheorie, S. 229.
52 Vgl. Dresel und Lämmle (2011): Motivation, S. 95.
53 Vgl. Ikäheimo (2014): Anerkennung, S. 7.
54 Vgl. Ikäheimo (2014): Anerkennung, S. 8-9.
55 Vgl. Honneth (2018): Anerkennung, S. 14.
56 A.a.O.
57 Schaller (2005): Comenius: Didaktik, S. 49.
58 Vgl. Ikäheimo (2014): Anerkennung, S.40.
59 Vgl. Ikäheimo (2014): Anerkennung, S. 11.
60 Vgl. Honneth (2018): Anerkennung, S. 173-174.
61 A.a.O., S. 175.
62 Vgl. a. a. O., S. 176.
63 Vgl. Honneth (2018): Anerkennung, S. 177-178.
64 Vgl. Müller-Commichau (2018): Souveränität d. Anerkennung, S. 10,14.
65 Vgl. a.a.O., S.10,20-24.
66 Vgl. Müller-Commichau (2018): Souveränität d. Anerkennung, S.31-37.
67 A.a.O., S.42.
68 A. a. O.
69 Vgl. a. a. O., S. 42-43.
70 Herold und Herold (2013): Lernumgebungen, S. 48.
71 A.a.O., S.49.
72 Vgl. a. a. O., S. 48-49.
73 Psychologie Datenbank, erstellt von der American Psychological Association.
74 Vgl. Götz und Nett (2011): Selbstreguliertes Lernen, S. 149.
75 Vgl. Raithel, Dollinger und Hörmann (2009): Einführung Pädagogik, S. 93.
76 A.a.O., S.93-94.
77 Vgl. a. a. O., S. 94-95.
78 A. a. O., S. 94.
79 A. a. O.
80 Raithel, Dollinger und Hörmann (2009): Einführung Pädagogik, S. 95.
81 Pansophie: Religiös-philosophische Lehre des 16.-18. Jhd. für ein alles umfassendes Wissen.
82 Vgl. Raithel, Dollinger und Hörmann (2009): Einführung Pädagogik, S. 95.
83 Vgl. Schaller (2004): Comenius: Porträt, S. 23.
84 Raithel, Dollinger und Hörmann (2009): Einführung Pädagogik, S. 95.
85 Vgl. Frenzel und Stephens (2011): Emotionen, S. 51.
86 Meyer (2011): Unterrichtsmethoden, S. 187.
87 Vgl. a. a. O., S. 186-189.
88 A.a.O., S.189.
89 Meyer (2014): Unterrichtsvorbereitung, S. 150.
90 Vgl. a.a.O., S.150-153.
91 Vgl. Götz und Nett (2011): Selbstreguliertes Lernen, S. 154.
92 Vgl. Götz und Nett (2011): Selbstreguliertes Lernen, S. 155.
93 Vgl. Herold und Herold (2013): Lernumgebungen, S. 37-40.
94 A.a.O., S. 15.
95 Vgl. a.a.O., S. 42-43.
- Arbeit zitieren
- Daniela Naß (Autor:in), 2020, Selbstorganisiertes Lernen in der Erwachsenenbildung. Gestaltung der Lernumgebungen am Beispiel des Ausbildungsberufes Notfallsanitäter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/903594
Kostenlos Autor werden










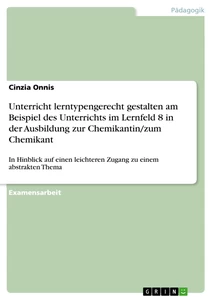









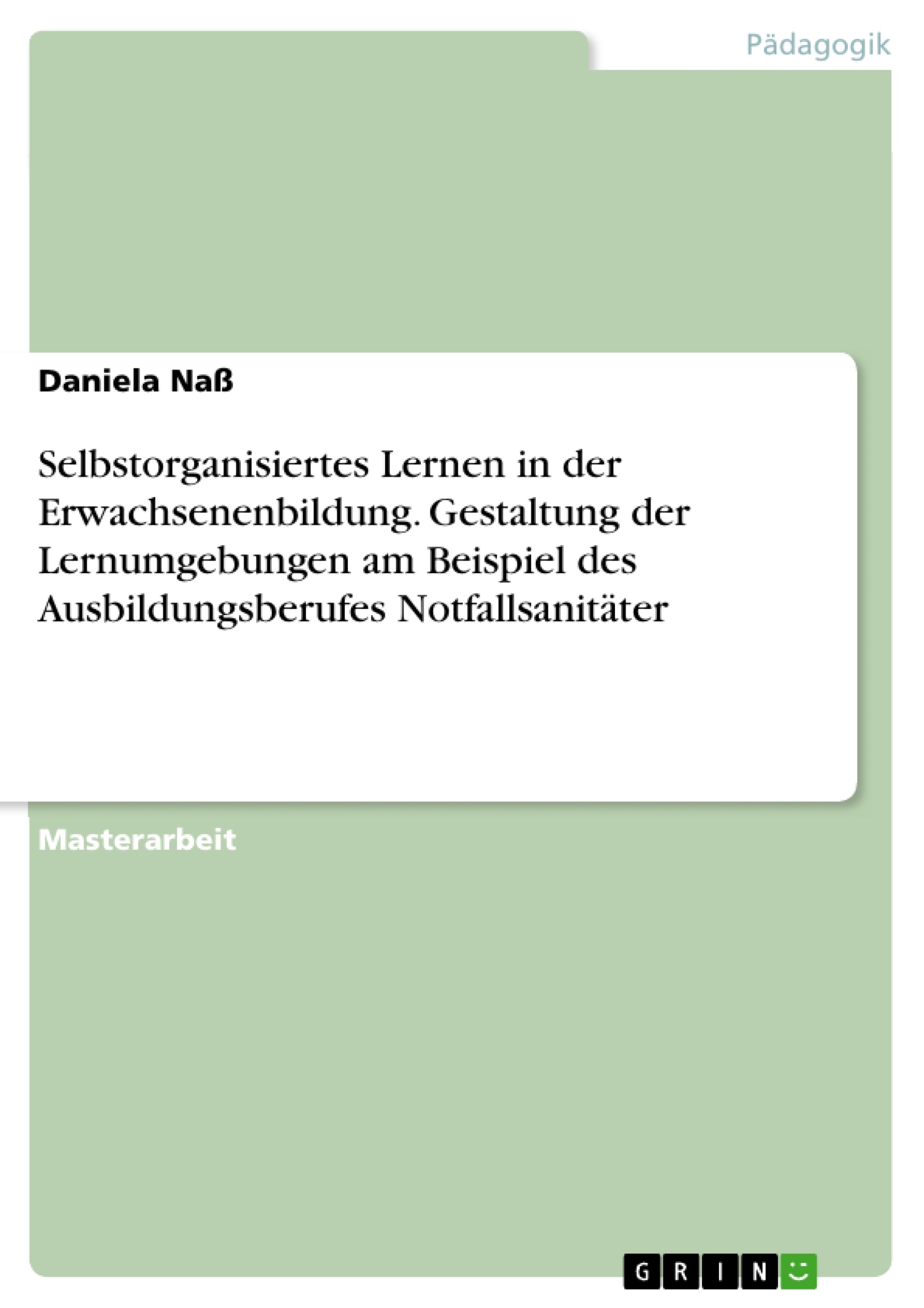

Kommentare