Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Geschlechtsspezifische Sozialisation
2.1.1 Zum Begriff der Sozialisation
2.1.2 Geschlechtsspezifische Sozialisation – Entwicklung und Stand der Forschung
2.1.3 Zum Zusammenhang von weiblicher Sozialisation und Sport
2.2 Entwicklung des Frauenfußballs
2.3 Organisation des Frauenfußballs
3 Darstellung der empirischen Untersuchung
3.1 Fragestellungen
3.2 Untersuchungsmethodik
3.2.1 Personenstichprobe
3.2.2 Ablauf der Untersuchung
4 Ergebnisse
4.1 Kindheit und Jugend der Fußballerinnen
4.1.1 Fußballspielen außerhalb von Vereinen
4.1.2 Mädchenfußball im Verein
4.2 Die Fußballzeit in Frauenmannschaften
4.2.1 Die fußballerische Laufbahn der Spielerinnen
4.2.2 Der Verein
4.2.3 Der Trainings- und Spielalltag
4.2.4 Mannschaft und Trainer/Trainerin
4.2.5 Engagement über die eigene Sporttreiben hinaus
4.2.6 Motive für das Fußballspielen
4.2.7 Familie, Freunde und Bekannte
4.2.8 Freizeitbeschäftigungen außer Fußball
4.2.9 Medien
4.2.10 Frauenfußball und seine Vorurteile
5 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ligabaum
Abbildung 2: Ligabaum mit Anzahl aktiver Spielerinnen
Abbildung 3: Weibliche Mitglieder des DFB im Zeitraum 2000 bis 2004
Abbildung 4: Mitgliederzahlen nach Regionalverbänden getrennt
Abbildung 5: Rücklaufquoten nach Ligen unterteilt
Abbildung 6: Verteilung der verschickten Fragebögen auf die Ligen
Abbildung 7: Verteilung des Alters der Befragten
Abbildung 8: Ablaufschema des Forschungsprozesses
Abbildung 9: Häufigkeit unorganisierten Fußballspielens im Kindesalter
Abbildung 10: Beziehung zwischen der Häufigkeit des Fußballspielens außerhalb von Vereinen und der aktuellen Liga der Befragten
Abbildung 11: Alter beim Eintritt in den Fußballverein
Abbildung 12: Beziehung zwischen dem Beginn des Vereinsfußballs und der Förderung durch die Eltern
Abbildung 13: Anteil der Spielerinnen, die aufgrund von Leistungsgesichtspunkten oder Talentförderung den Verein gewechselt haben
Abbildung 14: Ligen, in denen die Befragten insgesamt aktiv waren
Abbildung 15: Ligen, in denen die Befragten am längsten aktiv gespielt haben
Abbildung 16: Entfernungen zwischen Wohnorten und Vereinsorten
Abbildung 17: Vorbereitung auf das kommende Spiel am nächsten Tag
Abbildung 18: Probleme innerhalb der Mannschaft
Abbildung 19: Beschreibung der Trainer in drei Kategorien
Abbildung 20: Engagement im eigenen Verein
Abbildung 21: Leistung und Erfolg
Abbildung 22: Geselligkeit, Gemeinschaft und Freundschaft
Abbildung 23: Fitneß und Bewegung
Abbildung 24: Geld
Abbildung 25: Beschäftigt sein, Spannung und Unterhaltung
Abbildung 26: Selbstverwirklichung, Talent nutzen und eigene Möglichkeiten erfahren
Abbildung 27: Ausgleich zum Beruf
Abbildung 28: Karriere
Abbildung 29: Spaß, Leidenschaft und Emotion
Abbildung 30: Einflüsse auf die Persönlichkeit, die die Fußballerinnen ihrem Sport zuschreiben
Abbildung 31: Fußball als Gesprächsthema innerhalb der Familie
Abbildung 32: weitere betriebene Sportarten
Abbildung 33: Frauenfußball im Fernsehen
Abbildung 34: Einschätzung der Befragten, ob der Gewinn der Frauenfußballweltmeisterschaft einen Boom ausgelöst hat
Abbildung 35: Im Frauenfußball fallen mehr Tore als im Männerfußball
Abbildung 36: Frauen foulen weniger als Männer
Abbildung 37: Frauenfußball ist viel langsamer als Männerfußball
Abbildung 38: Die Weiblichkeit der fußballspielenden Frauen geht verloren
Abbildung 39: Frauenfußball ist unästhetisch, weil es ein harter Sport ist
Abbildung 40: Viele Frauen, die Fußball spielen wirken sehr männlich
Abbildung 41: Viele Lesben spielen Frauenfußball
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Angaben zum Beruf oder Ausbildung der Befragten
Tabelle 2: Angaben zur schulische Bildung der Befragten
Tabelle 3: Angaben zum Familienstand der Befragten
Tabelle 4: Angaben zum Wohnort der Befragten
Tabelle 5: Verteilung der Wohnorte auf die aktuellen Ligen der Befragten
Tabelle 6: Beziehung zwischen dem Beginn des Vereinsfußballs und der aktuellen Ligen der Befragten
Tabelle 7: Anzahl der Befragten, die aktiv in Jungenmannschaften gespielt haben, aufgeschlüsselt nach dem Alter beim Vereinseintritt
Tabelle 8: Ligen der Befragten
Tabelle 9: Liga im ersten Jahr als Seniorin, unterteilt nach den jeweiligen Ligen der Befragten
Tabelle 10: Gründe für die Unterbrechung der Fußballkarrieren
Tabelle 11: Gründe für das Ausschlagen eines höherklassigen Angebots
Tabelle 12: Heimat der Vereine
Tabelle 13: Häufigkeit geselliger Runden getrennt nach Ligen
Tabelle 14: Beschreibung der Mannschaft
Tabelle 15: Aktivitäten, die von Frauenfußballmannschaften durchgeführt werden, um ihre Mannschaftskasse aufzubessern
Tabelle 16: angegebene Berufe der Väter
Tabelle 17: angegebene Berufe der Mütter
Tabelle 18: Angaben zum Vorurteil „Viele Lesben spielen Frauenfußball" nach Ligen getrennt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Die kürzlich veröffentlichte Mitgliederstatistik des DFB für das Jahr 2004 macht es deutlich: Der Frauen- und Mädchenfußball erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit rund 6,27 Millionen Mitgliedern ist der DFB der größte Sportbund in Deutschland. 857 220 dieser Mitglieder sind Frauen und Mädchen (DFB, 2004a). Ein großer Teil von ihnen spielt regelmäßig Fußball und ist fasziniert von dieser Sportart, die jahrelang männliche Domäne war. Die Gemeinde der fußballspielenden Mädchen und Frauen wächst stetig. Nicht zuletzt auch wegen der jüngsten Erfolge der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, kurz Natio genannt. Der WM-Erfolg in den USA zeigte eindrucksvoll, daß auch Frauen in der Lage sind, mit dem runden Leder umzugehen. Nachdem sie im Halbfinale die USA besiegt hatten, schlugen sie im Finale Schweden in der Verlängerung durch Golden Goal. Der Auftritt der deutschen Fußballweltmeisterinnen bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 lieferte ähnlich spannende hart umkämpfte Matches, die die Gemeinde der Frauenfußballfans wohl noch weiter wachsen lassen. Die Begeisterung für den Frauenfußball kann sicherlich durch die Erfolge der Natio weitere Impulse bekommen, doch sind die wachsenden Mitgliederzahlen der Mädchen und Frauen nicht nur darauf begründet. Diese Examensarbeit befaßt sich unter anderem mit der Frage, was die Frauen an dieser Sportart fasziniert, wie ihr Trainingsalltag und der Verlauf ihrer fußballerischen Karriere aussehen.
Frauenfußball ist eine sehr junge Sportart, die praktisch noch in den Kinderschuhen steckt. Seit 1970 erst ist es auch Mädchen und Frauen in Deutschland erlaubt diesen Sport auszuüben. Es gab zwar vorher schon Bemühungen seitens der Frauen Fußball zu spielen, jedoch wurde dies durch die Verbände, allen voran dem DFB, verboten. Fußball war also eine sehr lange Zeit nur Männern vorbehalten. Bis der Frauenfußball wie heute zu Normalität wurde, mußten einige Barrieren gebrochen werden. Viele Frauen wurden für ihre Leidenschaft zum Fußball belächelt oder gar beschimpft. Dies ist zum Teil heute noch so, was die Vorurteile über Fußballerinnen klar erkennen lassen. Aber warum drängen Frauen in diese Sportart? Wieso lassen sie Beleidigungen über sich ergehen, um dem runden Leder nachzujagen? Mit welchen Problemen werden sie konfrontiert? Stimmt es, daß Fußballerinnen eine männliche Ausstrahlung haben und viele von ihnen homosexuell veranlagt sind? Dies sind Fragen, die diese Arbeit versucht zu durchleuchten.
Der Männerfußball, einst Elitesport, wandelte sich im Lauf der Jahre zum Massensport. Heute wird er vornehmlich von Mitgliedern der unteren Mittel- und Unterschicht ausgeübt (Heinemann, 1998, S. 201). Über die Schichtenzugehörigkeit von Fußballerinnen sind bisher noch keine empirischen Untersuchungen durchgeführt worden. Diese Staatsexamensarbeit geht auch der Frage nach der sozialen Herkunft der fußballspielenden Frauen auf den Grund.
Um die oben genannten Fragen zu analysieren, wurde ein Fragebogen speziell für Fußballerinnen entwickelt. Dieser wurde in drei thematische Blöcke unterteilt. Der erste Teil fragt nach der Kinder- und Jugendzeit der Sportlerin, der zweite Teil befaßt sich mit der Zeit als Seniorin[1] und in einem dritten Teil sollen demographische Fragen beantwortet werden. Die Auswertung dieses Fragebogens wird den größten Teil der Arbeit darstellen.
Doch bevor die empirische Studie dargelegt wird, sind einige Grundlagen zu erläutern. Zum einen die Sozialisation von Frauen im Sport, zum anderen die Geschichte des Frauenfußballs und dessen Organisation. Leider ist das Thema „Frau und Sport“ in der Literatur noch längst nicht ausreichend durchleuchtet worden. Auch zum „Frauenfußball“ findet man nicht besonders viele Autoren, die sich diesem Thema annehmen.
Nach den Grundlagen wird der Kern der Arbeit, die explorative Studie zum Frauenfußball, dargestellt und diskutiert.
2 Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Geschlechtsspezifische Sozialisation
Um geschlechtsspezifische Sozialisation zu erläutern, ist es angebracht, den Begriff der Sozialisation aufgrund seiner Komplexität vorher isoliert zu betrachten.
2.1.1 Zum Begriff der Sozialisation
Sucht man Definitionen von Sozialisation, findet man eine Vielzahl davon. Laut Hurrelmann und Ulich (2002, S. 3) wird Sozialisation als Gegenstand empirischer Untersuchungen als „Schlüsselkonzept für viele Theorien verwandt, die sich mit menschlicher Subjektwerdung im weitesten Sinne befassen“. Das „Mitgliedwerden in einer Gesellschaft“ (Hurrelmann & Ulich, 2002, S. 6) ist dabei das zentrale Element. Tillmann (1989, S. 10) ergänzt, daß Sozialisation sich damit befaßt „wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet“. Der Begriff Sozialisation ist schwer zu fassen, da es sich um ein wissenschaftliches Konstrukt handelt, „mit dessen Hilfe versucht wird, eine kaum übersehbare Fülle von Einflußfaktoren in vielfältigen sozialen Kontexten auf einen lange andauernden Prozeß der Entwicklung einer Vielzahl von Persönlichkeitsmerkmalen zu erfassen“ (Heinemann, 1998, S. 160). Folglich gibt es nicht die Sozialisation. Es sind vielmehr sozialisationstheoretische Fragestellungen, die aufgeworfen und erforscht werden. Solche Fragen tauchen auf, wenn „das Mitgliedwerden oder einzelne Aspekte desselben zum (Erkenntnis-)Problem wurden“ (Hurrelmann & Ulich, 2002, S. 7). Für diese Arbeit ist das ein wichtiger Aspekt. Denn Frauen, die sich in eine Männerdomäne, wie Fußball wagen, sind zwangsläufig Problemen ausgesetzt. Welche Probleme das sind und wie die Frauen damit umgehen, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Die Persönlichkeit ist in soziologischen Theorien und Definitionen ein wichtiger Bestandteil. Persönlichkeit ist nicht nur durch von außen beobachtbare Verhaltensweisen gekennzeichnet, sondern auch durch innerpsychische Prozesse und Zustände, Gefühle und Motivationen, Wissen, Sprache und Werthaltungen (Tillmann, 1989, S. 11). Heinemann (1998, S. 19) nennt dies die soziokulturelle Persönlichkeit, die „die Nahtstelle zwischen Individuum und Gesellschaft“ ist. Folglich kann ein Mensch seine Persönlichkeit nicht vollkommen frei entwickeln, denn sie ist in keiner ihrer Dimensionen frei von gesellschaftlichen Einflüssen (Brinkhoff, 1998, S. 45). Individuum und Gesellschaft dürfen also nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Aber der Mensch kann hier nicht als Opfer seiner Sozialisation gesehen werden. Er ist vielmehr aktiv an ihr beteiligt. Sozialisation findet lebenslang statt, dabei kann man sie in drei unterschiedliche Phasen einteilen. Mit der primären ist die frühe Sozialisation allein in der Familie gemeint. Die sekundäre Sozialisation ist geprägt von Familie, Schule und der Gruppe der Altersgleichen. Als tertiär wird die Sozialisation im Erwachsenenalter bezeichnet (Tillmann, 1989, S. 19). Für (fast) alle Menschen ist somit vorprogrammiert, wie und in welchen Bahnen ihr Leben ablaufen wird: Ein Kind kommt mit drei Jahren in den Kindergarten und geht mit sechs Jahren zur Schule. Nach der Sekundarstufe I wird bereits eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die das Leben des Kindes in gewisse Bahnen leitet: Abitur oder mittlere Reife und Lehre. Tillmann (1989, S. 19) folgert, „daß Lebensläufe in hohem Maß institutionell vorgeprägt werden“. Welche Erlebnisse und Erfahrungen sind es, die die Persönlichkeit des Menschen beeinflußt haben? Diese Frage ist, anders gestellt, sehr wichtig für diese Arbeit: Welche Erlebnisse und Erfahrungen haben die Fußballerinnen während ihrer Karriere gemacht? Haben diese ihre fußballerischen Karrieren beeinflußt? Haben die Fußballerinnen den Eindruck, daß sich auch ihre Persönlichkeit durch Fußball geändert hat? Wenn einmal eingeschlagene Lebensläufe sehr ähnlich ablaufen, müßte dies auch bei den untersuchten Frauen erkennbar sein.
Wie oben erwähnt, gibt es eine Vielzahl von Auffassungen, was Sozialisation ist, eine genaue allumfassende Definition gestaltet sich demnach als sehr schwierig. Es gibt allerdings verschiedene Akzentuierungen: „anthropologische, gesellschaftlich-institutionelle, kulturelle und psychische Inhalte bzw. Sichtweisen“ (Hurrelmann & Ulich, 2002, S. 7). Für die Diskussion des Begriffs der geschlechtsspezifischen Sozialisation sind alle Dimensionen von Bedeutung, wie nun im folgenden Kapitel erläutert werden soll.
2.1.2 Geschlechtsspezifische Sozialisation – Entwicklung und Stand der Forschung
Sozialisation befaßt sich, wie oben diskutiert, mit der Subjektwerdung des Menschen – der Bildung seiner Persönlichkeit. Ein wichtiger Teil dieser Persönlichkeit ist das Geschlecht einer Person. Das Geschlecht ist „nicht nur eine biologische, sondern zugleich auch eine soziale Kategorie – kein anderes menschliches Merkmal hat so grundsätzliche Auswirkungen auf Erleben und Verhalten, auf gesellschaftliche Chancen und soziale Erwartungen“ (Tillmann, 1989, S. 41). Unser Geschlecht begleitet uns ein Leben lang, das heißt, wir können es nicht wechseln wie z.B. unsere Nationalität oder unsere Berufsgruppe. Im Englischen gibt es für das deutsche Wort „Geschlecht“ zwei Übersetzungen: zum einen die biologisch determinierte Kategorie sex, zum anderen die soziale Kategorie gender. Diese Unterteilung gibt es im Deutschen nicht, Geschlecht ist per Definition beides, biologisch und soziologisch determiniert. Als sich Ende des vergangenen Jahrhunderts die Wissenschaft dem Unterschied der Geschlechter widmete, standen zunächst biologisch bedingte Faktoren im Vordergrund. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte man zur Klärung der Frage, ob der Grund für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen genetisch oder gesellschaftlich bedingt war, die kulturvergleichende Forschung. Die Wissenschaftler beschäftigten sich „mit vormodernen (<primitiven>) Gesellschaften, mit Südsee-, Eskimo- und Indianervölkern“ (Tillmann, 1989, S. 43). In diesen Gesellschaften untersuchten sie Formen der Arbeitsteilung und Verhaltensweisen in denen die Geschlechter sich unterschieden. Die Forscher versuchten zu belegen, daß „je weniger Gemeinsamkeiten sich zwischen den verschiedenen Kulturen finden, desto wahrscheinlicher wird die These vom biologisch vorgeprägten Geschlechtscharakter“ (Tillmann, 1989, S. 43). Die altbekannte Meinung, daß „typisch männlich“ und „typisch weiblich“ eine Folge der menschlichen Gene ist, konnte in den kulturvergleichenden Forschungen nicht nachgewiesen werden.
Wenn also nicht biologische Faktoren für Unterschiede im geschlechtstypischen Verhalten verantwortlich sind, müssen Erklärungen auf anderen Gebieten gesucht werden. Auch in der Psychologie wurden umfangreiche Untersuchungen angestellt, die Unterschiede aufzuklären. Hier sind vor allem drei Ansätze für die Entwicklung der Sozialisationsforschung von Bedeutung. Diese werden im folgenden genannt, aber nicht erschöpfend erklärt, da sie für die heutige Theorie der weiblichen Sozialisation nur partiell von Bedeutung sind. Wenn Aspekte aus diesen Theorien später aufgenommen werden, folgt eine detaillierte Erklärung. Eine der ersten Arbeiten war Freuds psychoanalytischer Ansatz, den er aus Beobachtungen seiner Patienten entwickelte (Tillmann, 1989, S. 55). Er unterteilt die Entwicklung der Persönlichkeit in drei Phasen (orale, anale, phallische). In der phallischen Phase „wird die Grundlage für die psychischen Geschlechtsunterschiede gelegt“ (Pfister, 1983, S. 155). Mädchen entdecken also, laut Freud, diese Geschlechtsunterschiede und entwickeln Penisneid. Erst wenden sie sich von der Mutter ab, weil sie sie für die Kastration verantwortlich machen, später identifizieren sie sich wieder mit ihrer Mutter aus Angst vor Zuwendungsverlust. Diese Theorie stößt bei Feministinnen auf energischen Widerspruch, „besonders die biopsychische Determiniertheit und die Universalität der Geschlechtsrolle“ (Pfister, 1983, S. 156) werden scharf kritisiert. Auch die Tatsache, daß Freud seine Theorie aus Beobachtungen seiner neurotischen Patienten gezogen hat, läßt die Frage nach der Universalität laut werden.
Freud versuchte die Persönlichkeitsbildung und somit auch die Entwicklung der Geschlechtsrolle aus innerpsychischer Sicht eines Individuums zu erklären. Watson richtete den Fokus nur auf äußere Einflüsse und entwickelte die behavioristische Lerntheorie, die u.a. von Guthrie, Skinner, Hull und Tolman weiterentwickelt wurde. „Die Lerntheorie beschreibt und erklärt relativ dauerhafte Verhaltensänderungen aufgrund bestimmter äußerer Ereignisse“ (Geulen, 2002, S. 28), teilt die Entwicklung dabei aber nicht in Phasen ein. Äußere Ereignisse sind hier durch „jede Form der Andersbehandlung von Jungen und Mädchen durch ihre Umwelt zu verstehen“ (Schenk, 1979, S. 85). Der Erwerb der Geschlechterrolle wird hier als instrumentelles Lernen beschrieben. Es steht außer Frage, daß Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden. Aber ob allein diese Unterschiede in den Erziehungspraktiken für das Entstehen geschlechtstypischen Verhaltens verantwortlich sind, ist fraglich.
Aus der behavioristischen Theorie entwickelte Bandura die Theorie des Modell-Lernens. Das Kind lernt, d.h. es beobachtet, wird angeregt und übernimmt bestimmte Verhaltensweisen von einer Bezugsperson (Modell). Lernen umfaßt hier „Teilprozesse wie Wahrnehmung, Bedeutungszuschreibung, kognitive Strukturierung, Gewichtung von Informationen, Extraktion von Informationen, Abstraktion, Regelbildung“ (Ulich, 2002, S. 69). Besonders wichtig sind bei diesem Ansatz die kognitiven Prozesse. Bandura ist somit kein typischer Behaviorist, der die inneren Abläufe des Menschen als black box bezeichnet und nicht weiter analysiert. Diese inneren Prozesse versuchte auch Piaget, Begründer der kognitiven Lerntheorie, zu erklären. Er betont „die primäre Rolle der Beobachtung, die Nachahmung, die strukturenbildende Abstraktionsfähigkeit des Lerners“ (Ulich, 2002, S. 70). Für das Verständnis von Sozialisationsvorgängen ist Banduras Theorie des Modell-Lernens von großer Bedeutung, da sie die Abhängigkeit des Lerners von sozialen Einflüssen und Beziehungen, die Eigenaktivität des Lerners und schließlich die Rolle kognitiver Prozesse erklärt.
Auch Kohlberg nimmt das Konzept Piagets auf und entwickelt ein kognitives Konzept des Geschlechtsrollenerwerbs. Kohlberg hat herausgefunden, daß Kinder zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr beginnen eine eigene Geschlechtszugehörigkeit zu erwerben. Sie fangen an, Eigenschaften, die zum eigenen Geschlecht gehören, als positiv zu bewerten und aktiv anzueignen (Kohlberg, 1974, S. 373). Die Einschätzung der Kinder, daß das männliche Geschlecht als positiver bewertet wird als das weibliche, liegt an der Tatsache, daß die männliche Erscheinung als groß empfunden und der Mann als aktiv erkannt wird. Außerdem besetzt der Mann in unserer Gesellschaft die für Kinder attraktiveren Berufe, wie z.B. Polizist. Die Frau ist eher zu Hause und wird somit als passiver bezeichnet. So erklärt Kohlberg auch die unterschiedlich starke Ausbildung des Selbstbewußtseins. Denn Mädchen sind „verpflichtet, in einer männlichen Welt eine feminine Rolle zu spielen“ (Kohlberg, 1974, S. 394). Inwieweit diese Theorie noch greift, ist fraglich, denn durch den gesellschaftlichen Wandel sind Frauen heute nicht mehr nur für Haushalt und Familie zuständig, sondern sind auch berufstätig und machen Karriere, zum Teil auch in „Männerberufen“. Der Ansatz, daß Männer allein durch ihre Konstitution den Eindruck erwecken, überlegen zu sein, würde bedeuten, daß der Rollenerwerb doch biologisch und nicht gesellschaftlich bedingt ist.
Die genannten Theorien haben eins gemeinsam: sie sind psychologische Ansätze. Sie erklären Entwicklung und Veränderung aus Sicht der Individuen und lassen institutionelle und gesellschaftliche Gegebenheiten weitgehend außer Acht. Eine verbesserte Theorie, die auch geschlechtsspezifische Sozialisation beinhaltet, müßte demnach sowohl innerpsychische Prozesse, als auch alle äußeren Rahmenbedingungen in Betracht ziehen. Dabei dürfen Individuum und Gesellschaft nicht getrennt voneinander analysiert werden. Außerdem ist noch zu betonen, daß das Kind sich seine Rolle aktiv aneignet und, daß Sozialisation lebenslang stattfindet.
Für eine moderne feministische Forschung ist es besonders wichtig, daß nicht nur die Unterschiede zwischen männlich und weiblich zu beschreiben und zu erklären sind. Also nicht von dem Geschlechterverhältnis zu sprechen, sondern von Geschlechterverhältnis sen. Das bedeutet, daß „die Differenzierungen zwischen den Frauen“ (Bilden, 2002, S. 280) deutlicher herausgearbeitet werden müssen, als dies noch in älteren Arbeiten zur geschlechtsspezifischen Sozialisation der Fall war. Einen solch neueren Ansatz hat Helga Bilden herausgearbeitet. Bilden begreift Sozialisation als sozial-psychologisch, wobei die Entwicklung des Individuums als Selbstbildung in sozialen Praktiken zu verstehen ist (2002, S. 280). Geschlechterverhältnisse sind somit das Produkt sozialer Konstruktionsprozesse und werden im gesellschaftlich-sozialen Leben unter den Individuen ausgehandelt. Dabei macht Bilden deutlich, daß die Wirklichkeit nicht ist, sondern gemacht wird, „sie entsteht im (sozialen) Handeln“ (2002, S.280). So nennt Bilden ihren Ansatz sozial-konstruktivistisch.
Die Sozialisation von Männern und Frauen wird stark durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung beeinflußt. Schon in Spielen eignen sich Kinder diese Unterschiede an, beispielsweise wählen Mädchen eher die Puppe als Spielzeug und Jungen eher das Auto. Dabei werden sie meist durch Erwachsene oder Peers, die Gruppe der Gleichaltrigen, dazu ermutigt bzw. entmutigt (Bilden, 2002, S. 283). Auch die Verkörperung von Männlichkeit und Weiblichkeit spielt für die Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit eine bedeutende Rolle. Der Körper des Mannes wird als mächtig beschrieben und dem der Frau überlegen. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Sport: Frauen suchen sich eher Sportarten die feinmotorisch, ästhetisch und attraktivitätsfördernd sind, wie beispielsweise Gymnastik. Männerkörper werden „grobmotorisch und bewegungsintensiv sozialisiert“ (Bilden, 2002, S.284). Wie lassen sich dann allerdings Veränderungstendenzen, wie die Tatsache, daß immer mehr Männer Kosmetika benutzen oder immer mehr Frauen in Männerdomänen drängen, erklären? Bilden (2002, S. 285) erklärt dies mit „Angleichungstendenzen“, räumt aber auch ein, daß dieses Phänomen widersprüchlich diskutiert wird.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß in der vorliegenden Arbeit Geschlecht als soziale Kategorie verstanden wird. Der Mensch bildet seine Persönlichkeit indem er sich geschlechtsbezogene gesellschaftliche Erfahrungen und Strukturen aneignet. All dies geschieht in einem „kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit, das durch die stets gegenwärtigen Zeichen und Signale des Geschlechts so selbstverständlich ist, daß dieses nicht bewußt wahrgenommen und reflektiert, sondern als natürlich und selbstverständlich betrachtet wird“ (Süßenbach, 2004, S. 24).
2.1.3 Zum Zusammenhang von weiblicher Sozialisation und Sport
Der Begriff der weiblichen Sozialisation im Sport ist in der Literatur bisher nicht annähernd so ausführlich behandelt worden wie die Sportsozialisation im allgemeinen, d.h. aus Sicht der männlichen Sporttreibenden. Die Zusammenhänge von Lebensbedingungen der Frauen, Körperkonzepten und Sport wurden bisher kaum untersucht (Pfister, 1999, S.20). Die Frauenforschung ist eine sehr junge Forschungsrichtung in der Sportwissenschaft, wobei zu bedenken ist, daß es die Sportwissenschaft selbst auch erst seit dem 19. Jahrhundert gibt. In den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren wird das Sporttreiben von Frauen auch von Verhaltens- und Sozialwissenschaftlern erforscht (Pfister, 1999, S. 15). Dies ist nicht zuletzt auf die wachsende Zahl sporttreibender Frauen in den Vereinen und Verbänden zurückzuführen. 38,6 % der Mitglieder im DSB sind weiblich. Dies entspricht einem Plus zum Vorjahr von 1,4 % (Landessportbund, 2004). Die Tendenz ist weiter steigend.
Auch in der Sportwissenschaft wird Geschlecht als soziale Kategorie gedeutet. „Gender als gesellschaftlich definiertes, soziales Konzept bezeichnet die Summe aller Vorstellungen und Erwartungen, die eine Gesellschaft jeweils mit „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ verbindet“ (Gieß-Stüber, 2000, S. 32). Um den Sozialisationsprozeß besser strukturieren zu können, hat es sich in der Sportwissenschaft wegen der Vielschichtigkeit der Zusammenhänge bewährt, den Prozeß der Sozialisation in verschiedene Phasen zu unterteilen. Heinemann (1998, S. 157) unterteilt in sechs Phasen, wobei die beiden ersten „Vorsozialisation“ und „Sozialisation in den Sport“ zusammengefaßt werden können. Denn hier geht es darum, wie der Sozialisant mit seinen persönlichen Attributen, wie beispielsweise Alter, Geschlecht, soziale Schicht oder - auf den Sport bezogen - die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und motorischen Grundeigenschaften (Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination) zum Sport geführt wird. Inwieweit eine Einbindung in den Sport erfolgt, hängt von den Einflüssen der Sozialisationsagenten ab. In diesem Stadium sind dies unter anderem die Eltern, die Gruppe der Gleichaltrigen, die Schule und/oder auch die Medien. Ob der Weg zum Sporttreiben erleichtert oder erschwert wird, hängt von den bestehenden Normen und Werten, von Bestätigung und von den gegebenen Gelegenheiten zum Sporttreiben ab. Für die Sportsozialisation in der Kindheit ist die Familie von entscheidender Bedeutung. Dieser Einfluß nimmt im Lauf des Älterwerdens wieder ab (McPherson, 1989, S. 38). Der Sozialisant beobachtet ein bestimmtes Verhalten bei einem seiner Sozialisationsagenten, z.B. der Mutter, und eignet sich dieses Verhalten an. Dabei ist es nicht wichtig das Verhalten sofort nachzuahmen, dies kann auch zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Außerdem ist zu betonen, daß die Rahmenbedingungen für die Ausübung einer Sportart auch geschaffen werden müssen (z.B. Sportstätte). Kinder kommen am häufigsten zuerst mit dem ausgeübten Sport der Eltern in Kontakt. Dabei lernen sie hauptsächlich vom gleichgeschlechtlichen Elternteil, d.h. Mädchen übernehmen die Motive und Einstellungen zum Sporttreiben von ihren Müttern (Kröner, 1976, 166). Da es aber häufig so ist, daß die Mütter die sportlich inaktiveren in der Familie sind, erklärt dies das geringere Sportinteresse der Mädchen im Vergleich zu Jungen. Die Fragen, die sich hieraus für die vorliegende Arbeit ergeben sind: Wie konnten sich die Frauen für den Fußball entscheiden? Genauer gefragt, an wem haben sie sich orientiert und von wem haben sie gelernt? Ist dies eventuell schichtabhängig? Wie sieht ihr Sportengagement aus (z.B. Anzahl der Trainingstage, Fragen zu Trainer/Trainerin und Mannschaft)? Haben die Fußballerinnen überhaupt Unterstützung seitens ihrer Eltern erfahren? Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen jungen und älteren Fußballerinnen?
Wenn Sozialisanten positiv von Bezugspersonen zum Sporttreiben angeregt wurden, vollzieht sich nun die „Sozialisation im Sport“ (Heinemann, 1998, S. 159). Viele Sportler und Sportlerinnen schreiben dem Sport wichtige Bedeutung für Körper und Geist zu. Es geht hier also um Sozialisationswirkungen, die der ausgeübte Sport auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Eigenschaften hat. Unbestritten ist die Tatsache, daß Sport die Gesundheit fördert und die Körperfunktionen des Menschen positiv beeinflußt. Inwieweit der Sport jedoch Einfluß auf psychische Eigenschaften hat, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Neuere Ansätze, wie oben schon erwähnt, gehen von der Tatsache aus, daß die Identität ein Konstrukt ist, d.h. das Individuum wird mit den Normen und Werten einer Gesellschaft konfrontiert und entscheidet selbst, welche es davon übernimmt, welche verändert und welche gar nicht übernommen werden. Oft wird Identität auch als Prozeß und reflektives Projekt bezeichnet, „das sich mit der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt, in Interaktionen konstituiert und eine Balance zwischen personalen Ansprüchen und sozialen Erwartungen erfordert“ (Pfister, 1999, S. 168). Die Identität besteht aus mehreren Aspekten, wovon einer das Selbst ist. Auch dieses Selbst ist als Konstrukt zu verstehen, das in Sozialisationsprozessen angeeignet und immer wieder überarbeitet und arrangiert wird. Pfister (1999, S. 170) unterteilt wiederum das Selbst in drei Dimensionen, die von besonderer Bedeutung sind: das Selbstkonzept (kognitives Selbstbild einer Person), das Selbstwertgefühl (die mit dem Selbstbild verbundenen Bewertungen und Gefühle), und die Kontrollüberzeugung (das Wissen, daß man eigene Handlungen kontrollieren kann). Das Körperkonzept ist Teil des Selbstkonzepts. Da Sport auf das Körperkonzept einer Person wirkt, wird folglich auch das Selbstkonzept durch Sport beeinflußt. Heinemann (1998, S. 167) bemängelt, daß es unmöglich ist von „der Sozialisationswirkung des Sports“ zu sprechen. Durch die Vielzahl an Sportarten ist allgemein nicht zu klären, ob es eine allgemeingültige sozialisierende Wirkung des Sports auf das Individuum gibt. Doch Alfermann, Lampert, Stoll und Wagner-Stoll (1993, S. 25) können in ihren Untersuchungen ein verbessertes Körper- und somit auch Selbstkonzept aufgrund regelmäßigen Sportreibens nachweisen. Die Frage die sich daraus für diese Arbeit ergibt ist, ob die Fußballerinnen ihrem Sport positive Einflüsse auf ihr Befinden und ihr Selbstwertgefühl zuschreiben.
2.2 Entwicklung des Frauenfußballs
Fußball ist heute im 21. Jahrhundert die Teamsportart Nummer eins in Deutschland. Dies gilt nicht nur für den Männer-, sondern auch für den Frauenfußball, wobei zu bedenken ist, daß der Frauenfußball eine noch sehr junge Sportart ist. Männerfußball ist hingegen bedeutend älter. In diesem Kapitel wird kurz auf die Entwicklung des Fußballs eingegangen. Danach soll die Geschichte des Frauenfußballs dargestellt werden.
Der Fußball fand seinen Weg von England nach Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn wurde in Engländerkolonien Fußball gespielt, bald aber versuchten sich auch deutsche Männer an dem Spiel (Eisenberg, 1997, S. 96). 1900 wurde dann der DFB gegründet. Wenn dem Fußball heute das Arbeiterimage nachgesagt wird, war dies in den Anfängen gegenteilig der Fall. Fußball war in seinen Anfängen ein Sport der Elite. Man(n) brauchte freie Zeit und Geld für spezielle Schuhe, Kleidung und Spielgerät. Diese Voraussetzungen konnten Arbeiter nicht erfüllen. Dies änderte sich jedoch bald und nach dem ersten Weltkrieg stiegen die Mitgliederzahlen des DFB stark an. Diese Tatsache lag aber vor allem an der Mittelschicht, die das Fußballspiel nun auch für sich entdeckt hatte. Nicht nur die Mitgliederzahlen, sondern auch die Zuschauerzahlen explodierten. Mit dem Aufstieg des Fußballs zum Massensport, entwickelten sich auch die unschönen Seiten: Zuschauerausschreitungen, Schiedsrichterbeleidigungen und unsportliches Verhalten waren keine Seltenheit (Eisenberg, 1997, S. 105).
Nach dem zweiten Weltkrieg hatte sich die soziale Basis im Spitzenfußball nicht verändert: noch immer bestanden die Mannschaften größtenteils aus Angestellten. Dies änderte sich erst in den 70ern. Auch die Professionalisierung entwickelte sich derart schleppend, daß, nach dem Beschluß des Halbprofessionalismus im Jahre 1949, der Profifußball erst 1972 eingeführt wurde. Der Staat zeigte sich nach der Professionalisierung der Bundesliga sehr kooperativ, und förderte sie wie noch nie. Im Zuge der WM 74 in Deutschland wurden auch die Stadien-Neubauten mit öffentlichen Mitteln finanziert. Durch den Umstand, daß sich die BRD zu einer Wohlstandsgesellschaft entwickelt hatte und die Bürger mehr Freizeit zur Verfügung hatten, boomte das Geschäft mit dem runden Leder. Der Durchbruch des Fernsehens forcierte die Kommerzialisierung noch in sehr hohem Maße. Heute sind Fußballvereine riesige Wirtschaftsunternehmen und Fußballer teuer bezahlte Millionäre. Fußballerinnen sind dagegen Amateurinnen, die von dem Geld, daß ihnen die Vereine zahlen nicht leben können. Die „Vertragsamateurinnen“ gehen tagsüber ihrem Beruf nach und abends zum Training. Bevor Frauen allerdings Fußball spielen durften, lag ein langer dorniger Weg vor ihnen.
Eine frühe Form des Frauenfußballs ist in Deutschland um 1900 zu finden: damals kickten sich die Frauen den Ball im Kreis stehend zu. Obwohl damals Ärzte forderten, daß Frauen sich körperlich ertüchtigen sollten, um Bleichsucht, Nervenschwäche und Haltungsschäden vorzubeugen, „gab es viele Gegner, die vor gesundheitlichen und sittlichen Gefährdungen, physischer und psychischer Vermännlichung sowie «Emancipation» der Frau warnten“ (Pfister, 1980, S. 17). Besonders Springen und Beinspreizen sollten vermieden werden, da als Folge befürchtet wurde, daß die Sexualorgane der Mädchen beschädigt werden könnten. Das Treten eines Balles galt zudem als nicht schicklich. Im Mutterland des Fußballs war man etwas fortschrittlicher: In England wurde das erste Fußballspiel 1895 zwischen Nord- und Südengland ausgetragen. Frauenfußball lockte damals auch die Zuschauer an. Bei einem Frauenfußballspiel in Newcastle sahen 8.000 Menschen zu. Leider befand der englische Verband, die FA, Frauenfußball nicht als positiv. „In 1902 the FA Council issued warnings to its member clubs not to play matches against ‘lady teams’, setting a separatist precedent which characterized relations between the male and female game in England for most of the century” (Woodhouse & Williams, 1999, S. 4).
Aufgrund des ersten Weltkriegs wurde der Männerfußball 1916 eingestellt. Da die Männer an der Front kämpften, mußten nun die Frauen die Produktionsarbeit in den Fabriken leisten. Um die Arbeiterinnen fit zu halten und ihren Zusammenhalt zu fördern, beschloß man Fabrikmannschaften zu gründen. Eine der berühmtesten waren die Dick Kerr’s Ladies, Arbeiterinnen einer Munitionsfabrik. Fußballspielende Frauen waren zu der Zeit eine Sensation und so verwundert es nicht, daß eine große Menge an Zuschauern in die Stadien drängte. Zu einem Spiel im Goodison Park in Everton erschienen 53.000 Zuschauer. Gespielt wurde gegen Frauenmannschaften, aber auch gegen Männer- und Mixedmannschaften (Fechtig, 1995, S. 17). Die Einnahmen wurden für wohltätige Zwecke (z.B. Kriegsheimkehrer) gespendet. 1921 existierten in England ungefähr 150 Frauenfußballmannschaften (Woodhouse & Williams, 1999, S. 8). Doch im Oktober desselben Jahres verbat der englische Verband seinen Mitgliedsvereinen ihre Stadien Frauenfußballmannschaften zur Verfügung zu stellen. Kritische Stimmen behaupten, dies geschah aus dem Grund, weil die FA befürchtete, daß die fußballspielenden Frauen zu einer ernsthaften Konkurrenz für den Männerfußball werden könnten (Woodhouse & Williams, 1999, S. 8).
In den 20er Jahren finden sich auch in Deutschland die ersten Versuche von Frauen, Fußball zu spielen. Wobei sich dies nicht so strukturiert entwickelte wie in England, d.h. es wurden keine Vereine oder Werksmannschaften gegründet. Es ging den Frauen in den 20ern um die Erfahrung, Sport zu erleben. Dabei drängten sie in Sportarten, die den Männern vorbehalten waren, wie z.B. Fußball, Skilauf, Reiten, Radeln und Rudern (Pfister, 1980, S. 33). Die Diskussion der richtigen Sportart für die Frau wurde zu dieser Zeit besonders stark geführt. Denn bisher war es Frauen nur gestattet Gymnastik zu betreiben, die „den bestehenden Geschlechterrollen entspreche und zur Verfestigung von Klischees beitrage“ (Pfister, 1980, S. 32). Als Folge des Krieges wurde den Frauen jedoch der „Zugang zum öffentlichen Leben ermöglicht, die traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter war in Frage gestellt“ (Fechtig, 1995, S. 22). So kam es, daß sich die Frauen auch für den Sport interessierten und viele Sportarten ausprobierten, obwohl die Stimmen der Kritiker immer lauter wurden. 1927 wurde in Frankfurt ein Fußballverein für Frauen gegründet, ein typischer Kommentar hierzu:
Endlich wieder einmal Frauenfußball!
Die Frage der sportlichen Möglichkeiten bei der Frau ist noch völlig ungeklärt. Sie greift heute zu manchem aus allgemein gesteigertem Kraftempfinden heraus, was früher als Entartung und Sensation erschien. Jetzt hört man, daß sich in Frankfurt a. M. aus Sportlerinnen und Turnerinnen ein Fußballklub bildete. Die Fußballerinnen wollen im stillen trainieren, ohne eine Ausschau auf Wettspielrunden. Sie wollen ein fröhliches Kampfspiel pflegen. Ob es schlimmer wird als das Hockeyspiel, muß abgewartet werden. Das Rad einer andersgearteten Entwicklung im Frauensport rollt. Man darf gespannt sein, wie dieser Versuch ausschlägt. (Pfister, 1980, S. 179)
Dieser Kommentar macht deutlich, wie sehr die Frauen mit Kritik und Vorurteilen gegen sie als sporttreibende Menschen erniedrigt wurden. Wenn die Sportlerinnen sich eine Zeit lang nicht um diese Diskriminierungen schoren, hatten diese doch zur Folge, daß die Frauensportbewegung bald abflachte und Frauen keinen Sport mehr betrieben. Besonders die Nationalsozialisten beendeten den Wunsch der Frauen nach Sport. Sie wurden zu dieser Zeit wieder in ihre herkömmliche Rolle als Hausfrau und Mutter zurückgedrängt. Es kam sogar soweit, daß Männersportarten, wie Fußball, für Frauen verboten wurden (Fechtig, 1995, S. 24).
Eine lange Zeit blieben Versuche Frauenfußballspiele zu verhindern erfolgreich. Psychologen und Sportmediziner erfanden viele schlecht nachzuvollziehende Gründe, warum es für das weibliche Geschlecht schädlich sei Fußball zu spielen. Ein Grund ist beispielsweise, daß die weibliche Kondition nicht ausreiche, um nach den international gültigen Regeln von Platzabmessung und Spielzeit ein Fußballspiel durchführen zu können. Auf diese „Expertenmeinungen“ berief sich der DFB 1955 und verbot den Frauenfußball schlechthin (Fechtig, 1995, S. 27). Die Frauen waren nun gezwungen unorganisiert auf Bolzplätzen und Hinterhöfen ihrem Sport nachzugehen.
Ende der 60er Jahre bildeten sich die ersten Frauenmannschaften. 1970 veranstaltete die Getränkefirma Martini & Rossi die erste inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft, an der auch ein deutsches Team, Bad Neuenahr/Illertissen, teilnahm. Dies ist sehr kurios, denn offiziell gab es ja keinen Frauenfußball in Deutschland. Der DFB beschloß daraufhin sein Verbot neu zu überdenken, denn die Zahl der Frauenfußballmannschaften stieg stetig. Am 30. Oktober 1970 wurde entschieden, das Frauenfußballverbot aufzuheben und einen geregelten Spielbetrieb durchzuführen. Die Frauenmannschaften sollten Mitglied im DFB werden und ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb sollte durch die Landesverbände organisiert werden (Ratzeburg, 1986, S. 86). Für die Durchführung der Spiele wurden nun eigene Spielregeln aufgesetzt, die folgendes beinhalteten: die Spielzeit wurde auf 2 x 30 Minuten verkürzt, das Spielgerät sollte der Größe des Jugend-Fußballs entsprechen (Größe 4), Stollenschuhe waren verboten, die Spielsaison wurde auf die Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober beschränkt, zum Schutz des eigenen Körpers war Handspiel erlaubt, jede Spielerin mußte eine gültige sportärztliche Untersuchung nachweisen können (Ratzeburg, 1986, S. 87). Dies sind nur die wichtigsten der damals aufgestellten Regelvorschriften. In der Folgezeit stellte sich heraus, daß die Durchführung dieser Spielregeln nicht machbar war. Schon in der Saison 72/73 „organisierten alle 16 Landesverbände Meisterschaftsspiele für Frauen in Doppelrunden, die vorgesehene halbjährige Winterpause mußte natürlich entfallen“ (Fechtig, 1995, S. 34). Mitte der 80er Jahre schrieb die UEFA einheitliche Regeln für den Frauenfußball vor, die nun den Spielregeln der Männer angepaßt worden waren, bis auf eine Ausnahme: gespielt wurde 2 x 40 Minuten. Diese Regel wurde erst 1993 geändert. Für die heutige Zeit gilt, daß Frauen unter den gleichen Bedingungen Fußball spielen wie ihre männlichen Kollegen. Wobei der bayerische Fußballverband hier eine Ausnahme darstellt. Auf der Homepage dieses Landesverbandes sind Auszüge aus den Richtlinien für den Frauenfußball dargestellt. Dort ist zu lesen: „3. Bei besonders ungünstiger Witterung, insbesondere bei strenger Kälte, sind Frauenspiele aus gesundheitlichen Gründen nicht auszutragen. Hierüber entscheidet der (die) Spielleiter(in) bzw. der (die) Schiedsrichter(in)“ (bfv, 2004). Solch eine Regel findet sich in den Richtlinien des Männerfußballs nicht. Hieran wird deutlich, daß der Frauenfußball auch heute noch mit argen Vorurteilen behaftet ist.
Zum ersten Mal wurde der deutsche Frauenfußballmeistertitel in der Saison 1973/74 vergeben. Damals wurde er noch in Turnierform ausgetragen. Seit den 70er Jahren stieg die Zahl der aktiven Fußballerinnen kontinuierlich an. „Zuschauer und Medienvertreter strömten neugierig in die Stadien, um die Sensation »Frauenfußball« zu erleben und zu verbreiten. Was sie allerdings sahen, erfüllte kaum ihre Erwartungen. [...] alles, was laufen konnte, versuchte Fußball zu spielen. Viele Leute haben sich totgelacht, was da alles über den Platz gestolpert ist, und sind danach nie wieder gekommen (Fechtig, 1995, S. 34). Im Laufe der Jahre verbesserte sich das Können der Fußballerinnen durch leistungsorientiertes Training natürlich. Ein Grund für die Popularität und Anerkennung des Frauenfußballs ist sicherlich die deutsche Nationalmannschaft. Diese wurde 1982 gegründet und Gero Bisanz war von den Anfängen bis 1996 ihr Trainer (Fechtig, 1995, S. 38). Durch die Erfolge der Nationalmannschaft (Europameisterinnen 1989, 1991, 1995, 1997, 2001; Weltmeisterinnen 2003 und Olympia-Dritte von Athen 2004) stieg auch das Ansehen in der Bevölkerung. Das Fernsehen überträgt mittlerweile die Spiele der Nationalmannschaft regelmäßig und erntet dabei gute Einschaltquoten. In Deutschland verfolgten das Bronze-Spiel von Athen 4,8 Millionen Menschen live im Fernsehen (DFB, 2004b). Durch die Berichte und Reportagen in den Massenmedien steigt die Zahl der fußballinteressierten weiblichen Sportlerinnen kontinuierlich. Frauenfußball ist unter den Sportlerinnen mittlerweile der beliebteste Mannschaftssport Deutschlands. Auch Eltern haben gegenwärtig weniger Probleme damit, ihren Töchtern das Fußballspielen zu erlauben.
Durch die höhere Dichte an Spielerinnen ist es heute möglich, mehrere Leistungsklassen zu bilden. Im folgenden Kapitel soll nun die Organisation des Frauenfußballs dargestellt werden.
2.3 Organisation des Frauenfußballs
Als der DFB 1970 den Frauenfußball offiziell erlaubte und Frauenfußballvereine dort Mitglied wurden, gab es noch nicht viele Frauen und Mädchen, die Fußball spielten. Wie oben erwähnt, probierten viele den neuen Sport aus. Es läßt sich nachvollziehen, daß Zuschauer und Medien, die gespannt in die Stadien zogen, enttäuscht wurden von dem fußballerischen Niveau was sie sahen. Aber der Frauenfußball entwickelte sich stetig weiter. Heute spielen die meisten höherklassigen Mannschaften moderne ballorientierte Spielsysteme und ihr Spiel ist geprägt von Technik und Taktik auf höchstem Niveau. Diese Entwicklung ist natürlich auf die Förderung und das Training der Frauen zurückzuführen. Einen großen Anteil hat aber auch die Tatsache, daß die Zahl der Mädchen- und Frauenmannschaften stark gestiegen ist. Durch die Menge an Vereinen wurde es möglich, ein viel dichteres Netz von Ligen aufzubauen. Bemängelte Nationaltrainer Gero Bisanz die mangelnde Leistungsbereitschaft seiner Mannschaft noch als er diese 1982 übernahm, änderte sich die Situation, als für die Saison 1985/86 die Regional- und Oberligen eingeführt wurden. „Jetzt waren die Fußballerinnen auch in ihren Meisterschaftsbegegnungen mehr gefordert, Frauenfußball vor allem in den führenden Clubs der höchsten Spielklasse hatte mehr und mehr leistungssportlichen Charakter“ (Fechtig, 1995, S. 38). Die führenden Vereine waren damals SSG Bergisch Gladbach, KBC Duisburg, FSV Frankfurt und TSV Siegen.
In der Saison 1990/91 wurde die zweigeteilte Bundesliga, Gruppe Nord und Süd, eingeführt. 1997/98 dann wurde die Bundesliga eingleisig (DFB, 2004a). Gespielt wird seitdem in dem gleichen Modus wie bei den Männern „jeder gegen jeden“ in einer Hin- und Rückrunde, mit jeweils einmal Heimrecht. Auch die Drei-Punkte-Regelung trat ab 1995 in Kraft. Eine weitere Angleichung an das Liga-System der Männer ist ab dieser Saison 2004/05 eingeführt worden: die 2. Bundesliga. Diese ist zweigleisig, d.h. in Gruppe Nord und Süd unterteilt, da die Anfahrtswege zu den Spielen zu weit und die damit entstehenden Kosten zu hoch wären um eine eingleisige Liga durchzuführen (DFB, 2004a). Die Vereine finanzieren die Fahrten größtenteils selbst und so wären weite Anfahrten zu den Auswärtsspielen und Übernachtungen dort zu kostspielig.
[...]
[1] Gemeint sind hier Spielerinnen ab 17 Jahren, die in Frauenmannschaften spielen.
- Arbeit zitieren
- Melanie Rother (Autor:in), 2004, Frauenfußball. Weibliche Sozialisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90350
Kostenlos Autor werden
















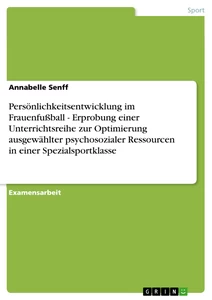





Kommentare