Leseprobe
Inhalt
Einleitung
Teil I „Die Familie ist der größte Pflegedienst der Nation“ –
Wer sind die Leistungserbringer häuslicher Alten- und Krankenpflege und wen pflegen sie?
1 „Pflegende Angehörige“
1.1 Begriffsklärung
1.2 Profil der Pflegenden
2 „Pflegebedürftige“
2.1. Begriffsklärung
2.2 Profil der Pflegebedüftigen
Teil II Anlage und Methodik der empirischen Untersuchung
3 Fragestellung
4 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse
5 Feldzugang
6 Datenerhebung: Leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview
7 Leitfaden
8 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse auf der Basis der kommentierten Transkription
9 Darstellung der Interviewergebnisse
Teil III Der Umzug des Pflegebedürftigen ins Pflegeheim im
Spannungsfeld zwischen Verlusterfahrung und Chance:
Erfahrungen von pflegenden Angehörigen Darstellung
der Untersuchungsergebnisse
10 Die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger in häuslichen
Pflegearrangements
10.1 Pflegealltag, Belastungserleben
10.1.1 Erfahrungen aus der Alltagssituation pflegender Angehöriger
10.1.2. Belastungserleben im Zusammenhang mit der häuslichen Pflegesituation
10.1.2.1. Gesundheitliche Situation
10.1.2.2. Finanzielle Situation
10.1.2.3. Soziale Situation
10.1.2.4. Psychische Situation
10.1.2.5. Positive Aspekte der Pflege
10.1.3. Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
10.1.3.1. Nutzung von professionellen Unterstützungs- und Hilfsangeboten
10.1.3.2. Informelle Entlastungfaktoren und Ressourcen
10.2. Motive für die Betreuungsübernahme und Pflege
10.2.1. Sozial-normative Verpflichtung
10.2.2. Emotionale Bindung
10.2.3. Mangelnde Alternativen
10.2.4. Materielle Motive
10.2.5. Familiärer Druck
10.2.6. Sinnstiftung und Glaubensüberzeugung
10.3. Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation
10.3.1. Beziehungsqualität zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen
10.3.2. Beziehungsqualität innerhalb des Familiensystems
10.4. Zusammenfassung
11. Entscheidung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform
11.1. Beweggründe für die Beendigung der häuslichen Versorgung
11.2. Akteure des Entscheidungsprozesses
11.2.1. Pflegebedürftige
11.2.2. Soziales Umfeld
11.2.3. Hausärzte
11.2.4. Nichtmedizinische professionelle Beratungsinstanzen
11.3. Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung
11.3.1. Gefühle bei den Angehörigen
11.3.1.1. Verdrängung
11.3.1.2. Trauer
11.3.1.3. Schuldgefühle
11.3.1.4. Kontrollverlust und Hilflosigkeit
11.3.1.5. Versagensgefühle
11.3.1.6. Druck
11.3.1.7. Unsicherheit/Zweifel
11.3.1.8. Hoffnung auf Entlastung
11.3.2. Gefühle bei den Pflegebedürftigen
11.4. Gründe für die Auswahl der konkreten Einrichtung
11.5. Alternative Lösungsoptionen
11.6. Zusammenfassung
12. Umstellungsphase von der häuslichen Pflege auf die stationäre Versorgung
12.1. Aufnahmesituation
12.1.1. Ansprechpartner beim Einzug
12.2. Subjektives Erleben des Einzugstags
12.2.1. Atmosphäre und Emotionen beim Umzug
12.2.2. Entlastende Faktoren am Einzugstag
12.3. Umstellungsphase und Neuorientierung des Pflegenden Angehörigen
12.3.1. Emotionen in der ersten Zeit nach Beendigung der häuslichen Pflegesituation
12.3.2. Integration des Pflegebedürftigen ins Heim
12.3.3. Entlastende Faktoren und Unterstützung während der Umstellungsphase
12.4. Zusammenfassung
13. Die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger
13.1. Konsequenzen des Umzugs ins Pflegeheim für das Alltagserleben
des Pflegenden Angehörigen
13.1.1. Kontakt zum Pflegebedürftigen – Besuchsgewohnheiten
13.1.2. Emotionen im Zusammenhang mit aktueller Pflegesituation
13.1.3. Entlastung in der aktuellen Lebenssituation
13.2. Beziehungsqualität pflegender Angehöriger/Pflegebedürftiger im Kontext
der stationären Versorgung
13.3. Kontakt und Beziehungsqualität pflegender Angehöriger – Mitarbeiter im Heim/ Integration des Pflegenden Angehörigen in den Wohnbereichsalltag
13.3.1. Zufriedenheit mit Pflegequalität und Atmosphäre in der Einrichtung
13.3.2. Kommunikation und Beziehungsqualität mit Mitarbeitern
13.3.3. Integration in den Wohnbereichsalltag und Übernahme von Aufgaben
13.5. Partizipationsmöglichkeiten für Angehörige
13.5.1. Bereitstellung von Angeboten für Angehörige und deren Nutzung
13.5.2. Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Angehörige
13.6. Kontakt zum Sozialdienst und Inanspruchnahme entsprechenderAngebote
13.7. Ideen, Visionen, Anregungen
13.8. Zusammenfassung
Teil IV Angehörigenarbeit als Auftrag der Sozialen Arbeit in
Pflegeheimen
14. Verortung der Sozialen Arbeit innerhalb der Angehörigenarbeit
15. Ziele und Handlungsangebote des Sozialdienstes in der Angehörigenarbeit
als Konsequenz aus der Untersuchung
Schlussfolgerungen und Ausblick
Literatur
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Einleitung
„Ambulant vor stationär“ - so lautet eines der Grundprinzipien der 1995 als fünfte Säule des Sozialversicherungssystems eingeführten Pflegeversicherung. Unter diesem Leitsatz werden verschiedene Instrumente zur Förderung ambulanter Versorgungskonzepte subsumiert.
Der mit der aktuellen Altersentwicklung verbundene Anstieg von Multimorbidität und demenziellen Erkrankungsbildern wird inzwischen von zahlreichen Teilsystemen der Gesellschaft als eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte realisiert. Dabei hat sich im Diskurs um die Versorgung der wachsenden Anzahl alter und hochaltriger pflegebedürftiger Menschen eine deutliche Stärkung ambulanter Strukturen durchgesetzt. Ein Motiv für die Präferenz ambulanter Konzepte ist die Suche nach Lösungen für den steigenden Kostendruck, der aus der rasanten Zunahme der Lebenslage „Pflegebedürftigkeit“ resultiert. Dabei wird seitens der Entscheidungsträger der Institution „Familie“ als Ressource für häusliche Versorgung und Betreuungsleistungen die größte Bedeutung zugeschrieben. Familienangehörige sind innerhalb der Pflegelandschaft nach wie vor die wichtigsten Leistungserbringer. Trotz sich wandelnder Familienstrukturen und veränderten weiblichen Erwerbsbiografien steigt infolge des demografischen Trends die absolute Anzahl der häuslichen Pflegearrangements seit Jahren kontinuierlich an.
Oftmals investieren Angehörige über Jahre hinweg ein enormes Maß an Zeit, Kraft und Energie für die Versorgung des Pflegebedürftigen. Eigene Bedürfnisse und Interessen werden nur noch reduziert bzw. gar nicht mehr gelebt und die Sorge um den Pflegebedürftigen kann sich zum alltagsbestimmenden Thema entwickeln. Bisweilen kann die Diskrepanz zwischen Pflegeaufwand und eigenen Ressourcen für pflegende Angehörige so groß werden, dass trotz Ausschöpfung ambulanter Hilfsangebote ein Umzug des Pflegebedürftigen in eine vollstationäre Einrichtung als Lösungsoption angebracht erscheint.
Insgesamt hat die stationäre Betreuung in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. In der jüngeren Vergangenheit sind unterschiedliche alternative stationäre Betreuungsformen für pflegebedürftige Menschen entstanden. Innerhalb der mittlerweile stetig bunter werdenden Palette an Angeboten kommt dabei der traditionellen Wohnform „Pflegeheim“ in Deutschland derzeit noch nach wie vor die größte Bedeutung zu.
Dass der Wechsel vom häuslichen Umfeld in eine stationäre Wohnform für den Pflegebedürftigen eine gravierende Risikosituation darstellt, ist allgemein bekannt. Die Frage, wie die verschiedenen Phasen der Integration ins Pflegeheim von Bewohnern erlebt werden, ist bereits in zahlreichen Forschungsprojekten analysiert worden.
Wie sich der Übergang von der ambulanten zur stationären Versorgung jedoch auf die pflegenden Angehörigen auswirkt und von welchen Gefühlen der Entscheidungsprozess sowie der Umzug des Pflegebedürftigen ins Heim begleitet wird, ist bislang nur marginal untersucht worden.
Die forschungsleitende Frage in der vorliegenden Diplomarbeit ist die Frage nach der Erlebensperspektive der pflegenden Angehörigen bei der Umstellung eines ambulanten auf ein stationäres Pflegesetting sowie nach den Konsequenzen, die sich daraus für den Auftrag der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen ergeben.
Zunächst wird geklärt werden, welche Akteure in der häuslichen Kranken- und Altenpflege beteiligt sind, d.h. wer die pflegebedürftigen Familienmitglieder a priori versorgt und wer Pflegeleistungen empfängt.
Grundlage der weiteren Arbeit bildet eine qualitative Untersuchung anhand eines leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews mit betroffenen Angehörigen. Nach der Darstellung der Forschungsmethode werden im dritten Teil der Arbeit die entsprechenden Untersuchungsergebnisse dargestellt.
Dabei wird zunächst die Lebenswirklichkeit von pflegenden Angehörigen vor dem Umzug ins Heim beleuchtet. Um die Auswirkungen des Wechsels ins Pflegeheim wirklich nachvollziehen zu können, wird dieser Bereich bewusst ausführlich dargestellt. Als relevante Aspekte werden neben Erfahrungen aus dem Alltagserleben und den Motiven für die Pflegeübernahme auch die Beziehungsqualität zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen näher erläutert. Im nächsten Schritt werden Faktoren des Entscheidungsprozesses aufgezeigt wie z.B. Grenzen innerhalb der häuslichen Versorgung, Akteure der Entscheidung und die Diskussion alternativer Lösungsoptionen. Die Umstellungsphase nach dem Einzug ins Heim und die damit verbundenen Erfahrungen sind ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Abschließende Themenkomplexe innerhalb der Angehörigeninterviews sind der Umgang mit der aktuellen Pflegesituation sowie die Verortung des Angehörigen innerhalb des Pflegeheimalltags.
Im letzten Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Soziale Arbeit innerhalb von stationären Einrichtungen Angehörigen bei der Bewältigung der Statuspassage „Umzug ins Pflegeheim“ Unterstützung anbieten kann. Als Konsequenz aus den Untersuchungsergebnissen werden Ziele und Forderungen für die Angehörigenarbeit formuliert, die anhand von Beispielen für Handlungsangebote der Sozialen Arbeit in Pflegeheimen konkretisiert werden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Form eines Begriffs vezichtet. Wenn aus dem Kontext nichts Gegenteiliges hervorgeht, impliziert die jeweils gewählte Version stets beide Bedeutungen.
Teil I „Die Familie ist der größte Pflegedienst der Nation“ – Wer sind die Leistungserbringer häuslicher Alten- und Krankenpflege und wen pflegen sie?
Nach wie vor setzen Politiker und Entscheidungsträger auf Werte wie familialer Zusammenhalt und intergeneratives Verantwortungsbewusstsein, wenn es um die Frage nach Lösungskonzepten für die Bewältigung der Herausforderungen geht, welche der erwartete Anstieg der pflegebedürftigen Älteren um das Anderthalbfache bis zum Jahr 2020 mit sich bringt: „Die Bedeutung von Familie und weiteren privaten Netzen für die Unterstützung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen ist unbestritten Es sind nach wie vor die näheren Angehörigen, die Unterstützung und Betreuung leisten.“ beschreibt der Fünfte deutsche Altenbericht die Situation bzgl. der Versorgung pflegebedürftiger Menschen (s. Fünfter Altenbericht, 2005, 314).
Auf welchen Fakten der inzwischen in der öffentlichen Diskussion etablierte Begriff der „Familie“ als „größtem Pflegedienst der Nation“ tatsächlich gründet, soll im Folgenden näher erläutert werden.
1 „Pflegende Angehörige“
1.1 Begriffsklärung
Innerhalb der jüngeren Fachliteratur werden unter dem Begriff „pflegender Angehöriger“ nicht nur Familienangehörige bzw. enge Bezugspersonen verstanden sondern auch Nachbarn, Freunde und andere Personen, die in die Pflege involviert sind. Entgegen dieser Entwicklung wird im Folgenden der Begriff des „pflegenden Angehörigen“ jedoch nur auf Menschen bezogen, die in einer engeren emotionalen Verbindung mit dem Pflegebedürftigen stehen. Diese Eingrenzung erfolgt auf dem Hintergrund der Forschungsfrage nach den Konsequenzen eines Eintritts ins Heim für die Angehörigen, die den Betreffenden zuvor zuhause versorgt haben. Hier ist eine Differenzierung zwischen Personen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen und Personen, die lediglich marginal am Pflegearrangement beteiligt sind, obligat. Aus der Begriffsdefinition aufgrund der emotionalen Verbindung mit dem Pflegebedürftigen resultiert, dass diese Bezeichnung auch für Betroffene verwendet wird, deren Angehörige in einer stationären Einrichtung wohnen. Dies geschieht auch aus einem Verständnis des Pflegebegriffs heraus, der Pflege nicht ausschließlich als reduziert auf grund- und behandlungspflegerische Tätigkeiten begreift, sondern Aufgabenbereiche wie Beziehungspflege, Aufrechterhaltung von Kontakten, Vertretung von Interessen und Anliegen etc. bewusst impliziert. Wenn im Zusammenhang mit Untersuchungen bzw. Studien die Bezeichnung „pflegende Angehörige“ verwendet wird, folgt die Eingrenzung des Begriffs den Definitionskriterien der jeweils zitierten Erhebung. Diese basiert in vielen Fällen, wie z.B. in den MuG-Untersuchungen, auf einer Selbsteinschätzung der Befragten.
1.2 Profil der Pflegenden
Derzeit haben ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland die Verantwortung für eine pflegebedürftige Person übernommen. Von ihnen betreuen etwa 36 % den Pflegebedürftigen als einzige Hauptpflegeperson. 29 % der Pflegenden teilen sich ihre Aufgabe mit einer weiteren Person und 27 % der Unterstützungsbedürftigen werden von drei oder mehr Personen versorgt (vgl. Meyer, 2006, 21).
Die Dauer einer Pflegebeziehung ist mit durchschnittlich 8,2 Jahren ab Beginn der ersten relevanten Unterstützungsleistungen relativ hoch. Das bedeutet, dass Pflegende häufig über einen langen Zeitraum die Belastungen der Pflegesituation bewältigen.
Oftmals befinden sich die Pflegenden selbst schon im höheren Lebensalter. Über 32 % der pflegenden Angehörigen haben das 65. Lebensjahr überschritten. Das bedeutet, dass viele Menschen in einem Alter die Verantwortung für einen Pflegebedürftigen übernehmen, in dem sie selbst schon ein erhöhtes Erkrankungs- bzw. Pflegerisiko tragen.
Die größte Gruppe unter den Pflegenden ist die mittlere Generation der 45-64-Jährigen mit einem Anteil von 48 %. Lediglich ca. 16% der Pflegepersonen sind jünger als 45 (vgl. Meyer, 2006, 21).
Eine Generationenzuordnung der pflegenden Angehörigen lässt sich auch hinsichtlich des Lebensalters der Gepflegten vornehmen: Während bei 60-79-Jährigen vorwiegend die Ehepartner im Bedarfsfall tätig werden, sind es bei den über 80-Jährigen vorwiegend Töchter und Schwiegertöchter, die Pflege leisten (Hagen, 2001, 96-97).
Die Rolle des pflegenden Angehörigen setzt nicht unbedingt voraus, im gleichen Haushalt mit dem Pflegebedürftigen zu leben. Viele Pflegende leisten Unterstützung und Betreuung trotz räumlicher Distanz, was spezifische Vor- und Nachteile impliziert. Allerdings lässt sich feststellen, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Pflegebeziehungen eine gewisse räumliche Nähe gegeben ist: Ca. 70 % der pflegenden Angehörigen leben in häuslicher Gemeinschaft mit dem Pflegebedürftigen. Weitere 14 % leben bis zu 10 Minuten entfernt und lediglich 16 % nehmen ihre Pflege- und Unterstützungsaufgaben aus größerer Entfernung wahr (MuG III, 2005, 76). Die Anzahl der Pflegebeziehungen mit einer größeren räumlichen Distanz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der steigenden Mobilität innerhalb unserer Gesellschaft künftig weiter zunehmen.
Ein interessanter Aspekt bezüglich familialer Pflege stellt ihre Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit dar: „In der Unterschicht ist die Pflegebereitschaft noch weit verbreitet. Im liberal-bürgerlichen Milieu hingegen nimmt sie allmählich ab.“ (s. Fröhlingsdorf, 2005, 88). Pflegende mit einer niedrigeren Schichtzugehörigkeit nehmen auch weniger außerhäusliche Hilfe bei ihrer Pflegetätigkeit in Anspruch als Angehörige höhergestellter Milieus (vgl. Hagen, 2001, S. 103). Als eine mögliche Ursache hierfür werden neben schichtspezifischen Wertvorstellungen auch materielle Aspekte vermutet. So haben z.B. Geringverdiener weniger finanzielle Einbußen als Besserverdienende, wenn sie zugunsten der Pflegetätigkeit ihren Arbeitsplatz aufgeben. Auch zeitliche Kriterien spielen hierbei eine Rolle, da z.B. ein arbeitsloser Angehöriger über größere zeitliche Ressourcen verfügt und die Pflegetätigkeit zudem evtl. auch als sinnstiftende, tagesstrukturierende Aufgabe begreift. Die höhere Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern wird auch als Begründung für das Phänomen herangezogen, dass dort vergleichsweise mehr Männer in häuslichen Pflegesituationen aktiv sind (vgl. Niejahr, 2007, 22).
Obwohl sich der Männeranteil unter den pflegenden Angehörigen insgesamt von 17 % zu Beginn der 90er Jahre auf 27 % merklich erhöht hat, sind Frauen innerhalb der Pflege immer noch deutlich überrepräsentiert (vgl. MuG III, 2005, 90). Manche Studien beobachten die Tendenz, dass infolge der Zunahme weiblicher Erwerbstätigkeit die Pflege durch Töchter und Schwiegertöchter leicht rückläufig ist. Ihre Position wird dann häufig durch Personen ausgeglichen, die in ihrer fehlenden bzw. geringen Beschäftigung einen Anreiz für die Pflegeübernahme sehen (vgl. Meyer, 2006, 23). Allerdings rangieren Töchter bei den Hauptpflegepersonen nach den Ehepartnern mit 25 % immer noch auf dem zweiten Platz, so dass ihre Präsenz in häuslichen Pflegesettings nach wie vor erheblich ist (vgl. MuG III, 2005, 77). Bei der Betreuung von Angehörigen mit Demenz ist die ungleiche Verteilung der Geschlechter in Bezug auf die Pflegeaufgaben sogar noch signifikanter. Wenn Männer in der häuslichen Pflege aktiv werden, sind es vorwiegend ihre Ehefrauen, deren Pflege sie übernehmen (vgl. Meyer, 2006, 22). Auch die Form, wie Männer sich an Pflege beteiligen, unterscheidet sich deutlich von den Aufgaben, die Frauen übernehmen. Während Frauen überwiegend in die „direkte“ Pflege, also auch Körperpflege und Hauswirtschaft involviert sind, übernehmen Männer häufiger Funktionen des „Pflegemanagements“, d.h. die Organisation von Pflege. Als Hintergrund dieses Phänomens wird das traditionelle Rollenverständnis vermutet, das in Pflegesituationen noch besonders evident ist: „In kaum einem anderen Lebensbereich wirken klassische Rollenerwartungen an Männer und Frauen so unwidersprochen fort wie bei der Pflege.“ (s. Niejahr, 2007, 22).
Zusammenfassend lässt sich aus den o.g. Zahlen schließen, dass infolge des demografischen Trends sich das Lebensrisiko „Pflegebedürftigkeit“ zunehmend zum „erwartbaren Regelfall im Familienzyklus“ entwickelt, der jeden betreffen kann (vgl. Fröhlingsdorf u.a., 2005, 87). Pflegebedürftigkeit innerhalb der Familie verliert seinen Ausnahmestatus und wandelt sich vermehrt zu einer Entwicklungsaufgabe, die es gemeinsam zu bewältigen gilt. Obwohl sich inzwischen auch Veränderungen abzeichnen, werden die Herausforderungen, welche dieses Lebensereignis mit sich bringt, nach wie vor überwiegend mit z.T. großem Engagement innerhalb des familialen Netzwerks bewältigt. Angesichts dieser deutlichen Pflege- und Unterstützungsbereitschaft erweist sich der Begriff der Familie als „größtem Pflegedienst der Nation“ als durchaus adäquates Bild in Bezug auf die aktuelle Pflegesituation in Deutschland.
2 „Pflegebedürftige“
2.1. Begriffsklärung
Wenn im folgenden Abschnitt die Rede von „Pflegebedürftigen“ sein wird, sind ausschließlich Menschen gemeint, die im Sinne des SGB XI pflegebedürftig und in eine Pflegestufe eingruppiert sind. Menschen, die noch keiner Pflegestufe angehören, werden hier als „hilfs- bzw. unterstützungsbedürftig“ bezeichnet. Damit sollen die Definitionskriterien der diesem Abschnitt zugrunde liegenden Untersuchungsergebnisse übernommen und Missverständnissen vorgebeugt werden.
Im empirischen Teil der Arbeit wird auf diese Unterscheidung bewusst verzichtet und der Begriff „pflegebedürftig“ auf alle Personen angewandt, die auf Betreuungs- und Versorgungsleistungen angewiesen sind. Dies resultiert aus der Überlegung, dass es aus der Perspektive pflegender Angehöriger, um die es an dieser Stelle primär geht, abgesehen von finanziellen Aspekten irrelevant ist, ob der hilfebedürftige Angehörige die Kriterien für Pflegebedürftigkeit i.S.d. SGB XI erfüllt. Insbesondere in Bezug auf Menschen mit Demenz hat sich die Untauglichkeit dieses Definitionsinstruments inzwischen hinreichend bestätigt.
2.2 Profil der Pflegebedüftigen
In seinem Sonderbericht zur Lebenslage der Pflegebedürftigen ermittelte das Statistische Bundesamt, dass von den in Deutschland lebenden rund 2 Millionen pflegebedürftigen Menschen ca. drei Viertel innerhalb ihrer eigenen Häuslichkeit versorgt werden. Wurden zu Beginn der 90er-Jahre noch 1,12 Millionen pflegebedürftige Menschen zu Hause gepflegt, ist ihre Zahl mittlerweile auf 1,4 Millionen gestiegen (vgl. MuG III, 2005, 228). Gleichzeitig hat die stationäre Betreuung in den vergangenen Jahren einen noch deutlicheren Zuwachs zu verzeichnen: Zwischen 1996 und 2004 ist die Zahl der stationär betreuten Menschen um 69 % auf ca. 650 000 angestiegen (vgl. Föhlingsdorf, 2005, 87).
Etwa 75 % aller hilfebedürftigen Personen sind über 65 Jahre alt. Das Pflegerisiko steigt mit höherem Alter überproportional an: Während 2002 von den 65-74-Jährigen lediglich ca. 3% pflegebedürftig waren, sind von den über 75-84-Jährigen bereits 8,2% betroffen. Bei den über 85-Jährigen liegt der Anteil pflegebedürftiger Menschen schon bei ca. 30 % (vgl. MuG III, 2005, 228).
Von den in Privathaushalten lebenden Pflegebedürftigen werden 92 % von Angehörigen aus der Kernfamilie bzw. dem erweiterten Familienkreis unterstützt (vgl. Meyer, 2006, 12).
Ein großer Anteil der pflegebedürftigen älteren Menschen leidet an einer Erkrankung aus dem demenziellen Formenkreis, was sich als zusätzliche Herausforderung für häusliche Pflegesituationen erweist und häufig zu Grenzsituationen bzw. zur Beendigung ambulanter Pflegesettings führt. Derzeit gehen Schätzungen von über einer Million Menschen mit Demenz in Deutschland aus. Knapp die Hälfte der psychisch erkrankten pflegebedürftigen Personen wird zu Hause versorgt. Da demenzielle Erkrankungen erwiesenermaßen mit höherem Lebensalter bzw. Hochaltrigkeit zusammenhängen, ist infolge der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren mit einem sprunghaften Anstieg dieser Krankheitsformen zu rechnen. Schätzungen gehen von einer Anzahl von 2 Millionen Betroffener im Jahr 2050 in Deutschland aus (vgl. Meyer, 2006, 32).
Die zweithäufigste psychische Erkrankung ist die Depression, von denen bei den über 65-Jährigen fast jeder Zehnte betroffen ist (vgl. Berliner Altersstudie, 1999, 185-219).
69 % der Pflegebedürftigen im Sinne des SGB XI sind Frauen. Der Anteil weiblicher Pflegebedürftiger befindet sich mit 64 % innerhalb der häuslichen Versorgung auf einem deutlich geringeren Niveau als mit 79 % in stationären Einrichtungen. Das Durchschnittsalter der im Heim gepflegten Menschen ist wesentlich höher als im häuslichen Bereich. Auch der Anteil Schwerstpflegebedürftiger (Pflegestufe III) liegt mit 26% im Heim mehr als doppelt so hoch wie in der ambulanten Versorgung (12%) (vgl. Statistisches Bundesamt, 2003, 3).
Es zeichnet sich also die Tendenz ab, dass ambulante Pflegearrangements, die zum Teil über einen langen Zeitraum von pflegenden Angehörigen verlässlich bewältigt wurden, mit zunehmendem Alter und Grad der Pflegebedürftigkeit an ihre Grenzen stoßen. In diesen Fällen, sowie vermehrt bei weiblichen Hilfebedürftigen, verlagert sich das Pflegesetting häufig von der häuslichen Versorgung zunehmend in den stationären Bereich.
Teil II Anlage und Methodik der empirischen Untersuchung
3 Fragestellung
Grundlage der empirischen Untersuchung sind die in Interviews ermittelten Erfahrungen von Pflegenden, die die häusliche Pflegesituation beendet haben und deren pflegebedürftiger Angehöriger ins Pflegeheim übergesiedelt ist. Mit Hilfe der Befragung sollte herausgefunden werden, wie Angehörige die häusliche Pflegesituation erleben und welche Kriterien für den Entscheidungsprozess relevant sind. Des Weiteren sind der Übergang ins Heim und die damit verbundenen Emotionen Gegenstand der Untersuchung. Schließlich werden noch die Erfahrungen der Befragten mit der stationären Pflegesituation und deren Verortung in ihrer aktuellen Lebenswirklichkeit thematisiert werden.
4 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse
Als Untersuchungsplan wurde die innerhalb der qualitativen Forschung zentrale Einzelfallanalyse gewählt. Sie ermöglicht die Analyse von komplexen Zusammenhängen unter Betonung des lebensgeschichtlichen Hintergrunds der jeweiligen Person. Mit Hilfe dieses Instruments lassen sich sozialwissenschaftliche Hypothesen anhand eines konkreten Falls überprüfen. Mit relativ wenigen Versuchspersonen ermöglicht die Fallanalyse in die Tiefe gehende Einsichten auch in sozialwissenschaftlich schwer zugängliche Themenbereiche. Die Einzelfallanalyse kann auf vielfältigem Material basieren. Neben schriftlichen Quellen wie Tagebüchern, Krankengeschichten oder Autobiografien sind es v.a. mündliche Erzählungen, Berichte und Interviews, aus denen das entsprechende Material gewonnen wird (vgl. Mayring, 2002, 41-46). Insbesondere für die Interviews mit pflegenden Angehörigen ist der Aspekt relevant, dass die Einzelfallanalyse einen Zugang zu problematischen Themenbereichen eröffnet. „Pflegebedürftigkeit“ als nach wie vor stark tabuisiertes Thema stellt ein nicht einfach zu erschließendes Handlungsfeld dar. Viele Betroffene haben die Haltung internalisiert, dass Pflege etwas ist, das man „im Familienkreis erledigt“ und in dessen Intimität die Öffentlichkeit möglichst keinen Einblick haben soll. Besonders die Beendigung der häuslichen Pflege mit dem Umzug des Pflegebedürftigen ins Heim ist meist mit dem negativen Bild des „Abschiebens“ belegt und geschieht deshalb bevorzugt „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“. Im Rahmen einer von Vertrauen und Wertschätzung geprägten Gesprächssituation fällt es vielen Betroffenen leichter, Einblick in ihre Lebenssituation zu gewähren und über ihre Erfahrungen zu berichten, die dann auf dem Hintergrund der Lebenszusammenhänge verstehbar werden.
Die Anzahl an potenziellen Gesprächspartnern zur Forschungsfrage ist begrenzt. Deshalb ist die Möglichkeit, mit einer geringen Zahl an Versuchspersonen tiefer gehende Einsichten zu gewinnen, ein weiteres Argument für die Einzelfallanalyse im Zusammenhang mit dieser Thematik.
5 Feldzugang
Die Gesprächspartner wurden über verschiedene Zugänge gewonnen. Zwei Angehörige wurden von Sozialarbeiterinnen vermittelt, die in verschiedenen Pflegeheimen im Sozialdienst arbeiten und im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zu den Betreffenden haben. Eine dieser beiden Personen war mir bereits zuvor über die örtliche Kirchengemeinde bekannt. Über den Pflegedienstleiter einer anderen Einrichtung wurden zwei weitere Interviewpartner gewonnen. Eine pflegende Angehörige wurde durch eine Mitarbeiterin der örtlichen kirchlichen Sozialstation vermittelt. Zu einer weiteren Gesprächspartnerin kam der Kontakt über private Beziehungen zustande.
Bei der Auswahl der Gesprächspartner war es mir wichtig, Personen aus verschiedenen Kontexten zu befragen. Beispielsweise sollten sich die verwandtschaftlichen Beziehungen der Angehörigen zum Pflegebedürftigen voneinander unterscheiden. Dies wurde mit der Befragung eines pflegenden Ehemannes und Pflegenden aus verschiedenen intergenerativen Pflegebeziehungen umgesetzt. Auch wurden sowohl Angehörige aus ländlichen Regionen als auch aus urbaner Umgebung interviewt. Außerdem unterscheiden sich die Befragten auch hinsichtlich ihres sozialen und familiären Umfelds. Ziel dieses relativ breiten Spektrums an Erfahrungshintergründen war es, einen differenzierten Einblick und ein fundiertes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Angehörige den Wechsel von der häuslichen in eine stationäre Versorgungsform aus ihrer Perspektive erleben.
6 Datenerhebung:
Leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview
Als Erhebungsinstrument wurde das problemzentrierte Interview gewählt. Unter diesem Begriff versteht man eine offene, halbstrukturierte Befragung, die sich an einem Leitfaden orientiert. Die Interviewsituation soll als möglichst freies Gespräch gestaltet werden, das sich jedoch auf eine bestimmte Fragestellung konzentriert (vgl. Mayring, 2002, 67).
Im Vorfeld der Interviews muss eine Analyse des betreffenden Problems erfolgen, auf deren Basis entsprechende Aspekte herausgearbeitet und in einem Leitfaden zusammengestellt werden. Aufgrund der vorangehenden theoretischen Erschließung des Problemfeldes ist das problemzentrierte Interview besonders für theoriegeleitete Forschungsprozesse geeignet.
Der Leitfaden für das Gespräch ist in einer bestimmten logischen Reihenfolge konzipiert und enthält entsprechende Formulierungsvorschläge. Durch die Erstellung des Leitfadens wird eine gewisse Standardisierung der Interviews erzielt. Außerdem wird mit seiner Hilfe der Gesprächspartner auf bestimmte Themen hingelenkt, ohne ihn jedoch durch Antwortvorgaben zu beschränken. Das bedeutet, dass das Interview in Form eines offenen Gesprächs erfolgt, für das eine gewisse Vertrauensbeziehung Voraussetzung ist. Diese vertrauensvolle Atmosphäre sollte mittels einer empathischen, wertschätzenden Gesprächshaltung seitens des Interviewers geschaffen werden. Wird eine solche Gesprächsbeziehung hergestellt, kann auch der Befragte vom Interview profitieren. Der Vorteil eines halboffenen Interviews liegt, verglichen mit der Datenerhebung mittels geschlossener Verfahren, in einer größeren Ehrlichkeit und Reflektiertheit der Ergebnisse (vgl. Mayring, 2002, 68-70). Im Gegensatz zu der völlig offenen, narrativen Interviewform, die mehr zu explorativen Zwecken genutzt wird, können in die problemzentrierte Befragung Erkenntnisse aus der vorangegangenen Problemanalyse miteinfließen. Dies führt zu einer erhöhten Spezifizität der Fragestellung und zu differenzierteren Ergebnissen.
Das gewonnene Material wird auf Tonträgern festgehalten und für die weitere Bearbeitung transkribiert. Dafür ist aus Datenschutzgründen das Einverständnis des Befragten einzuholen und auf eine Anonymisierung des Interviews zu achten.
Für die vorliegende Untersuchung wurde das Instrument des problemzentrierten Interviews gewählt, weil über das Handlungsfeld „Pflegende Angehörige“ schon ein gewisser Erkenntnisstand vorliegt, der in die theoriegeleitete Problemstellung miteingebracht werden konnte. Da sich die Forschungsfrage im Wesentlichen jedoch auf die Erlebensqualität der Zielgruppe bezieht, erschien es sinnvoll, durch eine relative Offenheit der Fragestellung, die Eruierung des subjektiven Erfahrungshintergrunds zu fördern. Des Weiteren erfordert die recht sensible Thematik der Untersuchung ein entsprechend umsichtiges Vorgehen, das im Rahmen einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre am ehesten möglich ist.
7 Leitfaden
Als Grundlage für die Interviews mit den pflegenden Angehörigen wurde ein Leitfaden erstellt, der sich auf vier wesentliche Themenkomplexe der Forschungsfrage bezieht. Die Fragen sind chronologisch strukturiert und beziehen sich auf zeitlich unterschiedliche Phasen der Pflegesituation. Zu diesen vier Problemfeldern wurden jeweils Kategorien mit Fragen zu relevanten Aspekten der Thematik gebildet. Im Folgenden soll ein Überblick über die vier übergeordneten Themenkomplexe und ihre Unterkategorien erstellt werden.
Teil I: Häusliche Pflegesituation vor dem Einzug ins Pflegeheim
1. Einstieg: Entstehungsgeschichte der Pflegesituation
2. Pflegealltag, Belastungserleben
3. Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
4. Pflegemotive
5. Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation
Teil II: Entscheidung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform / Schritte des Entscheidungsprozesses
6. Beweggründe für Beendigung der häuslichen Versorgung
7. Akteure der Entscheidung / Unterstützung und Beratung im Entscheidungsprozess
8. Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung
9. Gründe für die Auswahl der Einrichtung
10. Alternative Lösungsoptionen
Teil III: Die Zeit der Integration ins Pflegeheim im Spannungsfeld zwischen Abschied und Neuorientierung
11. Aufnahmesituation
12. Subjektives Erleben des Einzugstags
13. Umstellungsphase und Neuorientierung des pflegenden Angehörigen
Teil IV: Die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger
14. Konsequenzen des Umzugs ins Pflegeheim für das Alltagserleben des Pflegenden Angehörigen
15. Beziehungsqualität pflegender Angehöriger – Pflegebedürftiger im Kontext der stationären Versorgung
16. Kontakt und Kommunikation pflegender Angehöriger – Mitarbeiter im Heim / Integration des Pflegenden Angehörigen in den Wohnbereichsalltag
17. Kontakt und Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen
18. Partizipationsmöglichkeiten für Angehörige
19. Kontakt zum Sozialdienst und Inanspruchnahme entsprechender Angebote
20. Ideen, Visionen, Anregungen
Die ausführliche Version des Leitfadens befindet sich im Anhang.
8 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse auf der Basis der kommentierten Transkription
Für die Auswertung der Interviews ist es erforderlich, das Material zuvor entsprechend aufzubereiten. Vor der Bearbeitung müssen deshalb die auf Tonträgern vorliegenden Daten zunächst transkribiert werden. Hierbei stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. Für die vorliegende Untersuchung wurde als Instrument die kommentierte Transkription verwendet. Die Form der Kommentierung erfolgte in Anlehnung an ein 1976 von W. Kallmeyer und F. Schütze entwickeltes System. Mit Hilfe der Kommentierung können über den Wortlaut hinaus auch Sprachmodus und nonverbale Kommunikationsbeiträge dargestellt werden. Diese Methode ermöglicht es, Emotionen und Informationen „zwischen den Zeilen“ besser wiederzugeben und somit zu einem tieferen Textverständnis beizutragen (vgl. Mayring, 2002, 91-92). Gerade im Hinblick auf die sensible Thematik der Problemstellung ist die Darstellung entsprechender Emotionsgehalte unverzichtbar für den Erkenntnisgewinn.
Die Auswertung des transkribierten Materials wurde anhand der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Mit Hilfe dieser Technik können Texte systematisch analysiert werden. Die Bearbeitung und Auswertung erfolgt schrittweise mit Hilfe von am Textmaterial entwickelten Kategoriensystemen. Mayring unterscheidet dabei drei Formen dieser Methode: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring, 2002, 115). Die Auswertung der vorliegenden Untersuchung wurde in Anlehnung an die zusammenfassende Analyse vorgenommen. Ziel der Analyse ist es, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (s. Mayring, 2003, 58).
Im Rahmen der hier verwendeten Analysetechnik werden bestimmte Sequenzen aus dem Text herausgearbeitet und paraphrasiert, das heisst in einer knappen, nur auf den Inhalt beschränkten Form umschrieben (Paraphrasierung). In einem weiteren Schritt werden die wesentlichen Inhalte verallgemeinert und in Kernaussagen reduziert (Generalisierte Reduktion). Dabei können inhaltsgleiche Kernaussagen gestrichen werden. Schließlich wird überprüft, ob die gebildeten Kernaussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren und die Kernaussagen einem theoriegeleiteten Kategoriensystem zugeordnet (vgl. Mayring, 2003, 59-61). Exemplarisch wurden einige Beispiele für diese Vorgehensweise dem Anhang beigefügt. Aufgrund der großen Materialfülle wurde jedoch auf das Abdrucken der gesamten Reduktionen und Kategorien verzichtet. Für die verschiedenen Kategorien werden dann jeweils konkrete Ankerbeispiele aus dem Text angeführt, die eine prototypische Funktion haben sollen. Die Thematik der Untersuchung sowie die Durchführung von zwei Interviewreihen ergegen eine relativ große Textfülle. Aufgrund des streng methodischen Vorgehens und der hohen Systematik eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse gerade auch für eine Analyse umfangreicheren Textmaterials (vgl. Mayring, 2002, 121). Gleichzeitig ist die qualitative Inhaltsanalyse auch ein Instrument, das aufgrund seines regel- und theoriegeleiteten Vorgehens keine willkürlichen bzw. vagen Interpretationen des Textmaterials zulässt. Dies verhindert ein „Sich Verlieren“ in der großen Materialfülle sowie eine Analyse des Textes lediglich anhand subjektiver Kriterien.
9 Darstellung der Interviewergebnisse
In Anlehnung an die chronologisch strukturierten Problemfelder, die im Leitfaden thematisiert wurden, werden im Folgenden auch die Ergebnisse aus den Interviews in jeweils vier verschiedenen Dimensionen dargestellt. Innerhalb dieser Bereiche wurden ebenfalls am Leitfaden orientierte Kategorien gebildet, innerhalb derer sich die Untersuchungsergebnisse abbilden. Die Kernaussagen der Interviews wurden zur besseren Markierung in Rahmen gesetzt. Entsprechende theoretische Ergänzungen sowie eigene Interpretationen ergänzen die Kernaussagen und Ankerbeispiele aus den Interviews und runden die inhaltliche Analyse des Textmaterials ab. Die erste Frage des Leitfadens wurde nicht mit in die Auswertung einbezogen, da sie inhaltlich für das Thema nur begrenzt relevant ist, und als Einstiegsfrage stattdessen die Funktion hatte, den Interviewpartner für das Gespräch aufzuschließen und den Redefluss in Gang zu bringen.
Teil III Der Umzug des Pflegebedürftigen ins Pflegeheim im Spannungsfeld zwischen Verlusterfahrung und Chance: Erfahrungen von pflegenden Angehörigen Darstellung der Untersuchungsergebnisse
Der Wechsel aus der häuslichen Versorgung ins Pflegeheim bedeutet sowohl für Pflegebedürftige als auch für Angehörige ein einschneidendes Erlebnis.
Eine solch tiefgreifende Veränderung stellt für die Betroffenen stets ein krisenhaftes Ereignis dar, das mit spezifischen Anforderungen an persönliche Anpassungsleistungen verbunden ist. Übergänge beinhalten immer sowohl Abschiedserfahrungen als auch Chancen für Neuorientierung und Wachstum.
Wie pflegende Angehörige die Statuspassage des Pflegeheimeinzugs in diesem Spannungsfeld zwischen Verlusterfahrungen und Neubeginn erleben, soll durch die folgende Darstellung der Interviewergebnisse verdeutlicht werden.
10 Die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger in häuslichen Pflegearrangements
Um die Bedeutung der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger für die Frage nach der Erlebensperspektive bei der Beendigung des Pflegeverhältnisses nachvollziehbar werden zu lassen, wurde bei der Darstellung der Ergebnisse dieses Teils auf besondere Ausführlichkeit Wert gelegt.
Die Übernahme von Verantwortung für einen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen bedeutet für die betroffenen Angehörigen in der Regel eine massive Veränderung ihrer bisherigen Lebenssituation. Insbesondere wenn das Ereignis unerwartet und unvorbereitet eintritt, bedeutet die erforderliche Anpassungsleistung an die neuen Lebensumstände eine große Herausforderung für die Pflegenden. Auch Faktoren wie Motivation, Qualität der Beziehung zum Pflegebedürftigen, Rückgriffmöglichkeiten auf unterstützende Netzwerke etc. tragen entscheidend dazu bei, wie die Pflegesituation von Angehörigen erlebt und bewältigt wird. Im Folgenden werden zentrale Aspekte der Situation von Betroffenen deutlich und ermöglichen einen näheren Einblick in die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger.
10.1 Pflegealltag, Belastungserleben
Die Versorgung und Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds wird von Angehörigen – abhängig von Pflegeintensität, Beziehungsqualität, eigener Konstitution und Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten – unterschiedlich belastend erlebt.
10.1.1 Erfahrungen aus der Alltagssituation pflegender Angehöriger
In den meisten Fällen sind die Betroffenen mit einer Umstrukturierung der Alltagsabläufe bis hin zu einer Neuorganisation der Lebenssituation konfrontiert.
Allerdings sind dabei innerhalb der Ehegattenpflege die konkreten Veränderungen in den Lebensvollzügen meist am wenigsten offensichtlich. In der Regel machen die eigene Berentung und die geklärte Wohnsituation keine einschneidenden äußeren Veränderungen notwendig. Das Belastungserleben basiert in diesen Fällen meist nicht auf der Notwendigkeit, die Pflegetätigkeit in den Alltag zu integrieren, sondern auf anderen Faktoren, wie z.B. Verlust von Intimität, gemeinsamer Lebensperspektive etc. (s. unten).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ankerbeispiel:
„ Herr E.: Äh .. dann sind wir natürlich (,) grundsätzlich (betont) immer miteinander (Pause) immer in die Stadt gegangen zum Einkaufen. (mhm) (Gedehnt) oder wir sind spazieren gegangen (,) mir sind, mir haben immer noch ne kleine Wanderung gemacht (mhm) ne kleine Tour (') gemacht.“ (1/45-48)
Aus dieser Aussage geht hervor, dass die Unterstützungsleistungen für die Ehefrau noch relativ gut in die Alltagsstruktur integriert werden konnten, solange die Pflegebedürftigkeit noch nicht so gravierend war. Liebgewonnene gemeinsame Gewohnheiten und Interessen wie Ausflüge oder Spaziergänge konnten nach wie vor gepflegt werden und wirkten kompensierend bzgl. der Veränderungen im Alltagserleben des Ehemanns.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Innerhalb der intergenerativen Pflege mussten die Betroffenen mehr oder weniger große Anpassungsleistungen aufgrund der Versorgungssituation erbringen. Die erforderlichen Veränderungen reichten von einer erhöhten Frequenz der Besuche, bzw. zeitweiser Versorgung in der eigenen Häuslichkeit bis hin zu Umgestaltungsmaßnahmen im Haus, Wohnortwechsel oder der Reduktion der Arbeitszeit.
Ankerbeispiel:
„Frau V.: Und ich hab dann (') aber zufällig hier einen anderen Job gekriegt und hab dann (betont) auch vor dem Hintergrund, (,) wegen den Eltern (,) äh (,) überlegt und dann da jetzt (,) angefangen. Also das war aber eine (') 60 Prozent – Stelle. (mhm) Vorher hatte ich (') ja, also (betont) mehr zu tun, aber halt (,) auch mehr (') Geld. Und als freie Mitarbeiterin wär's auch weniger, (,) wirklich weniger gewesen. (mhm) Aber ich hab' dann, (,) das war auch befristet erstmal wegen Elternzeitvertetung. Aber ich hab dann auch (,) auch wegen den (') Eltern hab ich (') gedacht, da bin ich wieder in Offenburg. Das war eine (') Teilzeitstelle, .. das geht schon (') irgendwie (,) und .. hab dann einfach mehr .. Zeit.“ (4/302-310)
Wie an dieser Stelle deutlich wird, wurde hier neben dem Wohnortwechsel auch der Umfang der Erwerbstätigkeit reduziert, um mehr Zeit für die Pflege der Eltern zur Verfügung zu haben. Dafür wurden auch finanzielle Einbußen in Kauf genommen.
Die Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Pflege stellt eine große Herausforderung dar, mit der viele Pflegende konfrontiert sind. Verheiratete Frauen zwischen 41 und 50 Jahren sind von dieser Doppel- bzw. Dreifachbelastung (Familienarbeit) besonders betroffen (vgl. bmfsfj, 2001, 18-19).
Insgesamt ist ein leichter Trend zur vermehrten Vereinbarung von Pflege und Erwerbstätigkeit festzustellen. Während zu Beginn der 90er Jahre lediglich 18 % der pflegenden Angehörigen einer Voll- bzw- Teilzeitbeschäftigung nachgingen, waren es 2005 schon 23 %. Dieser leichte Anstieg wird z.T. auf einen verminderten Umfang des zeitlichen Pflegeaufwands seit Einführung der Pflegeversicherung zurückgeführt. Die etwas verbesserte Vereinbarkeit von Pflege- und Erwerbstätigkeit wird auch als Begründung für das vermehrte Engagement von Männern in der häuslichen Pflege herangezogen. Allerdings ist nach wie vor die überwiegende Mehrheit der Pflegenden nicht bzw. nur eingeschränkt berufstätig (vgl. Meyer, 2006, 27). Die Partizipation Pflegender am Arbeitsmarkt ist stark vom Grad der Pflegebedürftigkeit des Angehörigen sowie von dessen kognitiven Beeinträchtigungen abhängig und sinkt mit zunehmendem Pflegeaufwand. In den neuen Bundesländern ist die Erwerbstätigkeit unter Pflegenden weiter verbreitet als im Westen, was zum einen auf die traditionell höhere Frauenerwerbsbeteiligung sowie auf die insgesamt angespanntere finanzielle Situation zurückgeführt wird. Neben den monetären Einbußen bedeutet für manche Pflegende die Aufgabe des Arbeitsplatzes auch den Verzicht auf einen persönlichen Freiraum angesichts der Zwänge der häuslichen Pflegesituation (vgl. Maly, 2001, 61-63).
10.1.2. Belastungserleben im Zusammenhang mit der häuslichen Pflegesituation
Die Pflege eines Angehörigen ist in der Regel mit einem hohen zeitlichen Betreuungsaufwand verbunden. Durchschnittlich 36,7 Stunden werden von der Hauptpflegeperson wöchentlich für die Versorgung des Pflegebedürftigen aufgewendet. Dabei ist zu beachten, dass die Belastung je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und kognitiver Situation des Hilfsbedürftigen sehr variiert. In Pflegestufe 3 eingestufte Menschen mit kognitiven Einschränkungen benötigen z.B. einen durchschnittlichen Betreuungsaufwand von knapp 62 Stunden (vgl. MuG III/ Wahl, 2005, 78). Neben der Pflegetätigkeit ist ein großer Teil der Angehörigen außerdem noch für Haushalts- und Erziehungsarbeit verantwortlich bzw. geht einer Erwerbstätigkeit nach.
Die Auswirkungen dieser vielfältigen Belastungen zeigen sich in verschiedenen Aspekten der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, finanzielle Probleme, soziale und psychische Schwierigkeiten sind wesentliche Kategorien, in welchen sich die Belastungen manifestieren.
10.1.2.1. Gesundheitliche Situation
Eine Querschnittuntersuchung zur häuslichen Pflege ergab eine deutlich höhere gesundheitliche Beeinträchtigung bei Pflegepersonen im Vergleich zur Kontrollgruppe: In der Studie gaben z.B. drei Viertel aller Befragten an, mindestens an einer Krankheit zu leiden (vgl. Gräßel, 1997, 35). Das Ausmaß der Beschwerden steht in engem Zusammenhang mit der Pflegeintensität und der Pflegedauer. Weitere wichtige Faktoren für vermehrte gesundheitliche Probleme sind die Störung der Nachtruhe durch die Pflege, Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Pflegebedürftigen und die Verschlechterung der finanziellen Lage durch die Pflegesituation. Auch die Nichtinanspruchnahme von Hilfe und Unterstützung bei der Pflege wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Pflegenden aus (vgl Gräßel, 1997, 50). Das Spektrum der gesundheitlichen Probleme ist breit: Depressionen, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen, kardiovaskuläre Erkrankungen und Suchtprobleme sind Beispiele für besonders häufig genannte Beeinträchtigungen (vgl. Maly, 2001, 58).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ankerbeispiel:
„ Frau F.: Ja aber es kam eben dann der Zeitpunkt, wo ich gut .. (leise und betont) Es ging nicht mehr. Ich konnte dann auch kaum mehr schlafen. (mhm) Ich meine, dann hat sie wieder (') gerufen. Ich wieder aufgestanden und es (,) dann kam (,) sie hat dann immer oje gerufen. (mhm) Oje, oje, es (,) (betont) ohne Pause und Ende. (mhm) Ich habe gesungen. Dann hat sie (') aufgehört. .. (mhm) Ich habe (betont) geredet. (,) Also das war (betont) sehr anstrengend!“ (5/273-278)
Diese Aussage bringt zum Ausdruck, in welch hohem Maß sich die Beeinträchtigung der Nachtruhe auf das Allgemeinbefinden auswirkt. Obwohl sich die Betroffene die Nachtwachen mit Mitarbeitern der Sozialstation teilte, führten die häufigen Störungen zu einer dauerhaften Schlaflosigkeit und schießlich zur völligen Erschöpfung.
„Erschöpfung“ ist neben „Gliederschmerzen“ und „Magenbeschwerden“ ein von Frauen häufig genanntes Symptom im Zusammenhang mit häuslicher Pflegetätigkeit. Insgesamt geben Frauen öfter an, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, als Männer. Letztere klagen im Vergleich besonders häufig über „Herzbeschwerden“ (vgl. Gräßel, 1997, 91-92). Zwei Drittel aller pflegenden Angehörigen nehmen regelmäßig Medikamente ein. Bei den somatotropen Arzneimitteln überwiegt der Anteil der männlichen Pflegenden im Gegensatz zu den Psychopharmaka, die häufiger von Frauen eingenommen werden (vgl. Gräßel, 1997, 36). Bei Pflegepersonen, die sich um einen demenziell erkrankten Angehörigen kümmern, fällt besonders die Häufung depressiver Symptome im Vergleich zu anderen Pflegenden auf. Insbesondere weibliche Pflegende mit einer langandauernden Pflegesituation tragen ein erhöhtes Depressionsrisiko. Dies wird mit dem in mehreren Untersuchungen nachgewiesenen Zusammenhang von Belastungs- und Depressionswerten begründet sowie auf den auch in der Allgemeinbevölkerung höheren Anteil von weiblichen depressiv Erkrankten zurückgeführt (vgl. MuG III, 2005, 124-125). Als weiterer Faktor für die gehäufte Entstehung von Depressionen bei Pflegenden wird die erlebte Hilflosigkeit angeführt, die sich angesichts der stetigen Verschlechterung des Zustands des Pflegebedürftigen ungeachtet des enormen persönlichen Engagements stark psychisch belastend auswirkt (vgl. Becker, 1997, 48).
Im Bereich der Prävention fällt auf, dass Pflegende häufig entsprechende Vorsorgeuntersuchungen vernachlässigen, Termine zu Kontrolluntersuchungen nicht wahrnehmen und leichtere Erkrankungen nicht ausreichend auskurieren. Tendenziell werden gesundheitliche Probleme von pflegenden Angehörigen häufig bagatellisiert bzw. verdrängt (vgl. Maly, 2001, 59).
Die Summe der Belastungsfaktoren für die gesundheitliche Situation Pflegender verdichtet sich im Begriff der „hidden patients“. In diesem Bild kommt zum Ausdruck, dass sich in den Pflegenden von heute häufig die Patienten und Pflegebedürftigen von morgen verbergen.
10.1.2.2 Finanzielle Situation
Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 sollte ergänzend zu den anderen Sozialversicherungen die finanziellen Folgen des Lebensrisikos „Pflegebedürftigkeit“ auffangen. Dieses Ziel der finanziellen Absicherung im Pflegefall wurde jedoch nicht in vollem Umfang erreicht. Nach wie vor ist die Lebenslage „Pflegebedürftigkeit“ mit hohen finanziellen Belastungen verbunden, welche nicht vollständig durch die Pflegeversicherung abgedeckt werden. In der Regel muss ein je nach Situation unterschiedlich großer Anteil von den Betroffenen selbst aufgebracht werden. Viele geraten dadurch in eine finanziell prekäre Situation, so dass Pflege neben Kinderreichtum als eines der „Armutsrisiken“ unserer Gesellschaft bezeichnet wird (vgl. Fröhlingsdorf, 2005, 90).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ankerbeispiel:
„ Herr Z.: Tagsüber war dann die AWO zweimal da, dann war der Pflegedienst paar Mal da. (,) (mhm)
Frau Z.: Wir konnten's bald gar nicht mehr zahlen.
Herr Z.: Dann noch der (') Notdienst.
I: Und Essen? Auch noch?
Frau Z.: Das sowieso!“ (2/717-726)
Eine wesentliche Ursache für die häufig angespannte finanzielle Lage sind die hohen Kosten für Pflege und Betreuung, die seit Einführung der Pflegeversicherung um ca. 15 % gestiegen sind. Besonders im stationären Bereich ist die Kostensteigerung immens: Während vor zehn Jahren ein Heimplatz durchschnittlich 3000 DM im Monat kostete (Fröhlingsdorf, 2005, 91), muss inzwischen mit einem durchschnittlichen Preis von 2550 Euro gerechnet werden (Mayer, 2006, 64). Diese hohen Kosten veranlassen viele Familien, zunächst von einer stationären Versorgung Abstand zu nehmen und ambulante Pflegesettings zu arrangieren.
Obgleich die Pflegekosten seit Einführung der Pflegeversicherung deutlich gestiegen sind, bewegen sich die Leistungen des SGB XI immer noch auf dem gleichen Niveau wie 1995. Diese Diskrepanz stellt einen realen Leistungsverlust dar, den viele Betroffenen nur schwer kompensieren können. Obwohl eines der Hauptziele der Pflegeversicherung war, Pflegebedürftige unabhängig von der Sozialhilfe zu machen, erhalten derzeit gut 320 000 Betroffene zur Deckung ihrer Pflegekosten staatliche Unterstützung in Form von Leistungen nach dem SGB XII (Fröhlingsdorf, 2005, 91).
Die Auswirkungen der steigenden Pflege- und Betreuungskosten auf das Familienbudget werden durch die Aufgabe der Berufstätigkeit seitens der Pflegenden häufig verschärft. Insbesondere Erwerbstätige mit geringem Einkommen und niedrigen Qualifikationen sind bereit, den Beruf der Pflegetätigkeit unterzuordnen. Der Verlust des Einkommens wird in diesen Fällen meist mit dem Bezug von Pflegegeld etwas kompensiert. Bei Besserverdienenden ist die Diskrepanz zwischen Einkommen und Pflegegeld oft so hoch, dass die Erwerbstätigkeit nur ungern aufgegeben wird (vgl. Niejahr, 2007, 23).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass häusliche Pflege i.d.R. zwar günstiger als eine stationäre Versorgungsform ist, die Betroffenen jedoch trotzdem erhebliche Kosten zu tragen haben. Finanzielle Vorteile aus der Pflege haben lediglich Personen, die für die Pflege im Gegenzug einen materiellen Ausgleich (z.B. Erbe) erhalten. Außerdem kann häusliche Pflege aufgrund des Bezugs von Pflegegeld für Menschen mit einem geringen bzw. keinem Einkommen finanziell lohnenswert sein, wenn sie die Pflege überwiegend allein leisten und wenig Hilfen in Anspruch nehmen.
10.1.2.3. Soziale Situation
Der enorm hohe zeitliche Aufwand einer häuslichen Pflege bewirkt in vielen Fällen eine Verlagerung des Lebensmittelpunktes auf die Pflegesituation und eine Anpassung des Lebensrhythmus an die Pflegeanfoderungen. Da die Dauer einer Pflegesituation in der Regel nicht abzuschätzen ist, ist auch eine eigene Zukunftsplanung für Pflegende sehr schwierig. Nicht selten werden eigene Interessen den Bedürfnissen des hilfsbedürftigen Angehörigen gänzlich untergeordnet: „Jemanden zu pflegen, das heißt oft, keine Zeit mehr zu finden für Freunde, den eigenen Partner, sich selbst.“ (s. Fröhlingsdorf, 2005, 90).
- Freiräume durch Auszug der Kinder und Berentung des Ehemannes durch häusliche
Pflege stark eingeengt (6/198-202)
Ankerbeispiel:
„ Frau S.: Ja gut, ich mein (,) meine Kinder waren ja auch, (,) unsre Kinder waren aus dem (') Haus. Ich hab ein (,) sehr (') unabhängiges Leben geführt. (mhm) Und (') just zu dem Zeitpunkt ist mein Mann in Rente gegangen. .. Wo wir sie dann geholt (,) also ein halbes Jahr bevor wir sie dann hierher geholt haben. (mhm) .. Und da muss ich schon sagen, das haben wir beide uns schon auch anders vorgestellt.“ (6/198-202)
Wie diese Angehörige gehören viele Pflegende einer Generation an, die selbst an der Schwelle zum Ruhestand steht bzw. die sich nach der Familienphase wieder vermehrt eigenen Interessen zuwenden möchte. Der Eintritt von Pflegebedürftigkeit innerhalb der Familie bringt neue Verpflichtungen und Einschränkungen mit sich und beschneidet gerade erst wiedergewonnene Freiräume drastisch.
- Dauerhaft schlechtes Gewissen, weil unterschiedliche Bedürfnisse der Familie nicht
vereinbar (3/261-273)
Ankerbeispiel:
„ Frau D.: Ich hab einfach auch ein schlechtes Gewissen (') gehabt. (,) Oder ich hab ihr morgens eingekauft und mittags ruft mich die von der Pflegestation an und sagt .. ja (,) hat ihre Mutter nichts? (Vorwurfsvoll) Ja, die verhungert! Die hat gar nichts im Haus! Dann hab ich gesagt, ich war doch grad da und hab ihr eingekauft! (mhm) Dann hat sie in der Zeit alles im Keller verstaut in irgendwelchen Schränken, (,) (mhm) haben wir hinterher gefunden.. Und ähm .. das war einfach ein permanent schlechtes Gewissen. (mhm) Sobald ich wieder weggefahren bin, hab ich ein schlechtes Gewissen gehabt. (mhm) Sobald ich (') hin bin, hab ich wegen den Kindern ein schlechtes Gewissen gehabt.“ (3/261-269)
Sind Angehörige wie in diesem Beispiel noch stark in familiäre Pflichten, v.a. in Kindererziehung, eingebunden, leiden sie häufig unter dem Gefühl, keinem richtig gerecht werden zu können. Ein permanent schlechtes Gewissen und Spannungen innerhalb der Familie sind häufig die Konsequenz aus der Überforderung, alle Bedürfnisse erfüllen zu wollen (vgl. Salomon, 2005, 21). In diesem Fall wurde das Gefühl des Aufgeriebenseins zwischen den unterschiedlichen Anforderungen noch durch die räumliche Distanz zum Pflegebedürftigen verstärkt. Die Anwesenheit bei der pflegebedürftigen Mutter hatte stets die Abwesenheit von der Familie zur Folge und umgekehrt.
Neben der Schwierigkeit, Pflegetätigkeit und Kindererziehung zu vereinbaren, haben häusliche Pflegesituationen auch Auswirkungen auf die Partnerschaft. Pflegende, die in einer festen Paarbeziehung leben, berichten häufig von vermehrten Konflikten. Verantwortlich für die Spannungen sind oft das geringe Zeitbudget für die Beziehungspflege und das gesteigerte Stresserleben. Auch die Reduktion emotionaler Zuwendung und das Gefühl des Partners, hinter den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen zurückstehen zu müssen, sind Ursache von Konflikten und können sich zur Zerreißprobe für die Beziehung entwickeln
(vgl. Gröning/Kunstmann/Rensing, 2004, 40).
Nach wie vor erfahren pflegende Angehörige wenig Bestätigung und Wertschätzung von ihrem Umfeld. Im o.g. Fall war die Angehörige sogar noch Vorwürfen seitens des Pflegedienstes ausgesetzt, die ihr schlechtes Gewissen noch verstärkten. Das Gefühl, den Ansprüchen nicht zu genügen, wirkt sich auch destabilisierend auf das Selbstwertgefühl aus. Generell wird familiale Pflege als Tätigkeit betrachtet, die – insbesondere von weiblichen Familienmitgliedern – im Rahmen der Intergenerationensolidarität selbstverständlich zu erbringen ist und keine besondere Wertschätzung genießt. Pflege als traditionell weibliche Aufgabe ist mit Eigenschaften verbunden, die in unserer Gesellschaft wenig anerkannt sind. Unentgeltlichkeit, körperliche Arbeit, der Kontakt mit Exkrementen, die Konfrontation mit Leiden und Tod etc. lösen in der Regel eher negative Assoziationen aus, die das schlechte Image von Pflegetätigkeiten zementieren (vgl. Salomon, 2005, 16).
Ein weiteres verbreitetes Phänomen im Zusammenhang mit häuslicher Pflege ist die Reduzierung von Sozialkontakten der Pflegenden, die nicht allein auf die hohe zeitliche Beanspruchung zurückzuführen ist. Auch latente Ängste, die Tabuisierung von Endlichkeit und Leid sowie das Auseinanderdriften der Lebensthemen sind Ursache für den allmählichen Rückzug von Freunden und Bekannten. Bei Pflegenden von Angehörigen mit Demenz ist dieses Phänomen besonders ausgeprägt, da die kognitiven Einschränkungen eine besonders hohe Anwesenheit der Betreuungsperson erfordern und Besuche sowohl von der Pflegeperson als auch von den Besuchern häufig als belastend erlebt werden. Verhalten und Reaktionen des an Demenz Erkrankten können befremdlich wirken und heftige Schamgefühle auslösen. Die Folge ist nicht selten ein völliger Rückzug des Pflegenden, verbunden mit dem zunehmenden Gefühl von Einsamkeit und Isolation (vgl. Gröning/Kunstmann/Rensing, 2004, 38). Der Pflegebedürftige wird häufig zur einzigen Bezugsperson und zum Lebensmittelpunkt, was nach der Beendigung des Pflegeverhältnisses durch Tod oder Übersiedlung ins Heim zu einer traumatischen Erfahrung für den Pflegenden führen kann.
10.1.2.4. Psychische Situation
Die oben aufgeführten gesundheitlichen, finanziellen und sozialen Faktoren, die aus einer Pflegeübernahme resultieren können, haben selbstverständlich auch Einfluss auf die psychische Befindlichkeit des Betroffenen. Sie werden von Aspekten ergänzt, die sich unmittelbar auf die psychische Situation des Pflegenden auswirken, wie z.B. die permanente Konfrontation mit Abschied und Verlust. Angehörige sind bei der Pflege eines kranken bzw. alten Menschen ständig mit dem allmählichen Nachlassen von Fähigkeiten konfrontiert, was sich als dauerhafte Verlusterfahrung auswirkt. Was im einzelnen als Verlust betrauert werden muss, hängt stark von der Beziehungskonstellation innerhalb der Pflegesituation ab.
Leidet der Pflegebedürftige an einem demenziellen Geschehen, ist der Prozess des Abschiednehmens zusätzlich erschwert, weil der der Betroffene „physisch noch lebt, aber nicht mehr als die vertraute Person am Familienleben teilnimmt.“ (s. Gunzelmann in Salomon, 2005, 20). Die Trauer um den Verlust des Angehörigen können sich viele Pflegende in einer solchen Situation nicht offen zugestehen, da der Pflegebedürftige ja noch lebt.
- Vorwürfe aufgrund dementiell bedingter Verkennung der Realität belastend (3/186-204)
Ankerbeispiel:
„ Frau D.: Und (,) ähm .. gut, die nächste Phase war dann, (vorwurfsvoll) warum hast du mir nicht erzählt, dass du verheiratet bist? Ich muss von den Nachbarn das jetzt erfahren. (mhm) Da hat sie halt mich (') wieder gesucht und da hat die Nachbarin zu ihr (') gesagt, ja aber die ist doch schon lang (') verheiratet! (mhm) Und dann hab ich gesagt, aber ich hab (,) ich hab doch 2 (') Kinder! Du hast doch 2 (') Enkelkinder! Und das war dann auch (,) also die (,) die Phase, (betont) das war ganz schlimm!
I: Dass sie dich nicht mehr so wahrgenommen hat? (,)
Frau D.: (') Nee!
I: So mit deinem Leben?
Frau D.: Nee, (,) genau! (mhm) (Pause) Und aber trotzdem komischerweise bei mir angerufen (') hat. (mhm) .. Und wenn, wenn ich nicht zuhause (') war und der Anrufbeantworter ging runter, dann hat die 30 mal hintereinander angerufen. (mhm) (Vorwurfsvoll) Warum redest du mit mir und gibst mir dann aber keine Antwort? (mhm) Dass ich mit den Nerven dann irgendwann ganz fertig war.“ (3/186-204)
In diesem Fall erlebte es die Tochter besonders belastend, von ihrer Mutter nicht mehr in ihrer Lebenssituation wahrgenommen zu werden. Die Mutter war nicht mehr in der Lage, Anteil an der Lebenssituation ihrer Tochter zu nehmen, was für diese auch ein Stück weit Abschiednehmen von der elterlichen Fürsorge und der „Nestwärme“ implizierte. Erschwerend für die Tochter kam hier hinzu, dass die Mutter durch ihre Anrufe Unterstützung in ihrer hilflosen Situation suchte und der Tochter aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen Vorwürfe machte, als diese nicht wie gewünscht reagierte. Während pflegende Ehepartner v.a. unter dem Verlust an gemeinsamer Lebensperspektive und Intimität leiden, erfordert die Übernahme elterlicher Verantwortung von pflegenden Kindern das oft schmerzliche Loslassen vertrauter Rollen innerhalb der Familienkonstellation. Die oben beschriebene Suche nach Hilfe und Unterstützung der pflegebedürftigen Mutter bei der Tochter ist bezeichnend für diese typische Rollenumkehr innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Becker, 1997, 47).
- Angehörige litt darunter, von Mutter nicht mehr erkannt zu werden (6/356 -356)
„ Frau S.: Sie hat auch mich dann als ihre Tochter nicht mehr (') erkannt. (-) Das ist natürlich ganz furchtbar für mich gewesen! (mhm) Wobei (,) wenn ich im (') Nachhinein (') sag, (Pause) hat sie das auch schon zu der Zeit wahrscheinlich manchmal nicht immer auf die Reihe gekriegt, wo sie noch in ihrer Wohnung gewesen ist. (mhm) Weil da hat sie mich (') schon auch manchmal als ihre Kusine (') vorgestellt, oder so. Also (,) (Pause) aber das war (,) da konnt ich damit noch ganz gut umgehn. (mhm) Aber wo's dann wirklich so konkret war, dass sie (-) uns eben nicht mehr als ihre Kinder und mein Mann (,) nicht mehr erkannt hat, das war dann schon (,) also ich denk einfach mal, das .. das belastet einen. (mhm) (Weint) Das hat mich also einfach aus dieser, aus dieser (') Fürsorge für meine (') Mutter hat mich das schon (betont) sehr, sehr belastet.“ (6/356-366)
Diese Situation bedeutet eine Zuspitzung der Verlusterfahrung, da hier die Angehörige sich von der Mutter gänzlich nicht mehr als Tochter wahrgenommen fühlt. Die Erfahrung, von einem geliebten und vertrauten Menschen nicht mehr erkannt zu werden, ist mit einer tiefen Kränkung verbunden und wird bisweilen – wenn auch unbewusst – einer Aufkündigung der Beziehung gleichgesetzt.
Ein weiterer Aspekt des Abschiednehmens ist, dass mit dem Verlust der bisherigen Beziehung zum Partner bzw. zu den Eltern auch ein Stück der eigenen Biografie endet. Die gemeinsam verbrachte Zeit ist auch ein Stück eigene Lebensgeschichte, die aufgund der demenziellen Entwicklung zu Ende geht.
- Bestürzung über Zustand nach Psychopharmakagabe im Krankenhaus (3/283-289)
Ankerbeispiel:
„ Frau D.: Und am Tag drauf .. ist sie (') dann .. wieder (,) raus aus dem (') Haus, wieder das Tal rein zu gelaufen, ist (') gestürzt, hat sich (') verletzt und ist ins Krankenhaus gekommen. (mhm) Sie war dann selber so verwirrt .. dass sie .. äh (,) also (') Beruhigungsmittel (,) (mhm) als ich sie besucht (') hab, dacht ich jesses, was ist mit der Frau los? Ich dacht, die (betont) stirbt jetzt. (mhm) Ich hab das gar nicht orten können, die haben die einfach ruhig gestellt. (mhm) hatte so nen Zettel (') hintendrauf, wo sie hingehört, und das war, (,) das war nicht meine (') Mutter!“ (3/283-289)
Die Veränderungen, welche die Tochter aufgrund der Psychopharmakagabe an ihrer Mutter wahrnimmt, führen ebenfalls zu einem Erleben der Entfremdung. Verstärkt wird diese Erfahrung durch die unvorbereitete Konfrontation mit der Veränderung in einer mit negativen Eindrücken verbundenen Umgebung. Außerdem ist zu vermuten, dass die Tochter sich eine gewisse Mitverantwortung für den Zustand der Mutter gibt, da sie das Weglaufen der Mutter mit nachfolgendem Sturz nicht verhindern konnte.
Ein weiterer belastender Faktor im Zusammenhang mit den Themen „Abschied“ und „Verlust“ ist die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Latente Ängste in Bezug auf eigene Pflegebedürftigkeit und Sterben können durch die Nähe zu einem pflegebedürftigen Menschen aktiviert werden. Der von vielen Menschen verdrängte eigene Tod wird als Zukunftsperspektive realisiert und entwickelt sich zum Thema, mit dem die Betroffenen sich nun auseinandersetzen müssen (vgl. Maly, 2001, 50-51).
- Belastung durch jahrelange Konfrontation mit Krankheit und zunehmender
Pflegebedürftigkeit (4/67-79)
„ Frau V.: Nur war dann der Zeitpunkt (,) kam's halt (') so, dass .. ich erstens dann mit den Nerven komplett am Ende war, (,) (mhm) weil das (') Ganze (,) hat (,) äh ich hatte (,) (betont) jahrelang schon mit der (,) mit meinen Eltern (,) oder vielmehr mit meiner Mutter weil sie ja auch MS - krank (') war .. zu tun gehabt. Mit diesen (') Krankheitsgeschichten (mhm) seit dem Abitur eigentlich (mhm) oder noch (') früher.“ (4/ 67-72)
In diesem Fall zog sich die Konfrontation mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit über einen außergewöhnlich langen Zeitraum hin. Außerdem musste sich die Betroffene schon mit dieser Thematik in einem Lebensabschnitt auseinandersetzen, in dem die Bewältigung üblicherweise noch schwerer fällt weil im Umfeld gänzlich andere Lebensthemen wichtig sind. Die Rollenumkehr, welche mit der Pflege der eigenen Eltern verbunden ist, wirkt sich für Kinder und Jugendliche noch wesentlich belastender aus als für erwachsene Pflegende und bedeutet in diesem Alter stets eine Überforderung. Aus diesem Grund ist zu vermuten, dass die erneute Konfrontation mit Hilfebedürftigkeit eines Elternteils für diese Angehörige zu einem gesteigerten Belastungserleben führte.
Ebenfalls als sehr beeinträchtigend können sich Schuldgefühle auswirken, die gegenüber dem Pflegebedürftigen empfunden werden.
- Belastung durch schlechtes Gewissen, dass Pflegebedürftige allein zuhause verbleibt
(3/261-269)
- Abendliche Weglauftendenz verbunden mit Sturzgefahr problematisch (3/239-241)
- Durch Halluzinationen verursachte Angstzustände versetzten Angehörige bei
Telefongesprächen in Sorge (3/147-150)
Ankerbeispiel:
„ Frau D.: Und .. äh .. auch (,) ja (,) was dann ziemlich schnell kamen (') Angstzustände, (,) was ich nicht richtig (,) ähm (,) manchmal rief sie dann bei mir (') an (,) da stehn 2 Männer bei (') mir (mhm) Und ich hab dann gesagt (') jesses, hoffentlich lasst die niemand (') rein wenn's klingelt!“ (3/147-150)
In diesem Fall hatte die räumliche Distanz zur Folge, dass die pflegebedürftige Mutter allein zuhause lebte. Neben den langen Wegstrecken, brachte dies für die Tochter auch das Gefühl mit sich, der Verantwortung gegenüber ihrer Mutter nicht gerecht zu werden. Die Entfernung zum Wohnort der Mutter brachte sowohl reelle Gefahren (Weglauftendenz) mit sich als auch unbegründete Sorgen, die durch die Demenzerkrankung verursacht wurden (Halluzinationen). Eine größere räumliche Entfernung zum Pflegebedürftigen bewirkt bei vielen Angehörigen das Gefühl, zu wenig für den Pflegebedüftigen zu tun, und verstärkt das schlechte Gewissen.
Oft kommen Schuldgefühle nicht direkt zum Ausdruck bzw. sind den Pflegenden gar nicht bewusst. Die Ursachen für Schuldgefühle können vielschichtig sein. Eine Möglichkeit ist die Inkongruenz zwischen dem eigenen moralischen Anspruch, die Pflege aus Dankbarkeit für Vergangenes gern übernehmen zu müssen, und dem tatsächlich erlebten Widerwillen gegenüber dieser Tätigkeit. Diese Haltung führt dann häufig zu versteckten Aggressionen gegenüber dem Pflegebedürftigen, die wiederum, wenn sie vom Pflegenden realisiert werden, neue Schuldgefühle hervorrufen. So entsteht eine Spirale der Aggression, die bis zur Gewaltanwendung in Pflegesituationen führen kann.
Ein häufig verschwiegenes Problem bei der Pflege von hilfsbedürftiger Familienmitglieder ist die permanente Konfrontation mit eigenen Scham- und Ekelgefühlen. Aufgrund der früher noch stärkeren Tabuisierung von Körperlichkeit und Sexualität ist für viele Angehörige der älteren Generation die Pflegetätigkeit die erste Situation, in der sie die eigenen Eltern nackt sehen. Dies ist für einen großen Teil der Betroffenen mit Peinlichkeit und starken Schamgefühlen verbunden. Auch der Umgang mit Ausscheidungen im Rahmen der Pflege kann Angehörige an die persönlichen Grenzen bringen.
- Angehörige fanden Zustand der Wohnung unerträglich und führten deshalb Grundreinigung
durch (2/274-285)
- Häufige Verunreinigung durch Urin und Stuhl für Angehörige sehr belastend (2/646-656)
Ankerbeispiel:
„ Frau Z.: Jetzt nach dem zweiten Mal hat sie dann einen Toilettenstuhl (') gekriegt. Hat sie aber gar nicht (') benützt. (mhm) .. Und hat immer alles .. ich sag wie's ist. (,) Sie hat sich ein Eimerchen (') genommen, (,) hat sich scheinbar über's (,) vor's Bett (') gestellt (mhm) und .. (mhm) also es hat immer ganz schlimm ausgesehen. (mhm) War .. also es war (betont) schlimm. (mhm)“ (2/646-650)
Nicht jedem ist es möglich, eigene Ekelgefühle im Umgang mit Exkrementen zu überwinden, so dass diese Pflegehandlungen zur Routine werden und die Betroffenen nicht besonders beeinträchtigen (vgl. Salomon, 2005, 22). Die Angehörige in diesem Beispiel verfügte über ein ausgeprägtes Reinlichkeitsempfinden und legte sehr großen Wert auf eine saubere Umgebung. Aus diesem Grund waren die Verschmutzungen in der Wohnung ihrer Schwiegermutter für sie nur schwer aushaltbar.
Ein weiterer belastender Faktor stellt für viele Angehörige die große Verantwortung dar, die sie innerhalb der häuslichen Pflege für den Pflegebedürftigen übernehmen. Insbesondere wenn diese allein getragen wird, kann sie die Betroffenen überfordern.
- Krankenhausaufenthalt als traumatisierend erlebt
Überforderung durch Aufforderung, Mutter nach Hause zu nehmen (5/52-62)
Ankerbeispiel:
„ Frau F.: Da hatte ich auch (,) furchtbare (') Erlebnisse, denn die haben dann gesagt (in gespielt barschem Ton) ja, sie müssen ihre Mutter jetzt .. wir können nichts mehr machen. Sie müssen ihre Mutter jetzt mit heim nehmen. (..), (...) einen Pflegeplatz zu suchen. (mhm) Denn sie war (,) ja (betont) nicht in der Lage da alleine was zu (betont) machen. (mhm) Ich meine, das war zwar wieder in Ordnung. Aber sie war halt noch nicht so (,) einsatzfähig, sag ich jetzt mal.
I: Ging's dann so um Kurzzeitpflege?
Frau F.: Ja (,) jaja, gut ich meine, ich habe von alledem ja noch gar nichts (') gewusst. (mhm) Ich, ich, ich war noch (betont) nie mit dem konfrontiert (,) keine Ahnung! (,)“ (5/52-62)
In diesem Beisiel wird deutlich, dass die Tochter die Aufforderung der Ärztin, ihre Mutter bei sich zuhause zu pflegen, als Überforderung erlebte. Da sie zuvor noch nie mit dem Thema „Pflege“ konfrontiert war, fühlte sie sich der Situation in keinster Weise gewachsen. Erschwerend kam für sie hinzu, dass sie keinerlei professionelle bzw. sonstige Beratung oder Unterstützung hatte. Fehlende Informationen oder Austausch mit anderen Betroffenen und mangelnde Inanspruchnahme von Unterstützung wirken sich verstärkend auf die Belastungen der Angehörigen durch die Verantwortung aus.
- Morgendliches Ankleiden problematisch, da Angst vor Weglauftendenz (1/260-270)
Ankerbeispiel:
„ Herr E.:.. aber später musst ich dann auch ihr zum Teil (') helfen, .. sich anzuziehen ... und .. äh . (') ja ... wie war denn das auch noch? .. Sie hat sie hat manchmal mir gesagt, dass sie .. den Drang nach außen (') hat. (') und .. (aufgeregt) sie war (') angezogen, ich war nicht (') angezogen, weil ich ja (') sie zunächst zunächst einmal versorgt hatte. Und dann wollte sie raus! (Pause)
I: Wollte sie raus .. und dann haben sie Mühe gehabt, sie zurückzuhalten?
Herr E.: Und dann hab ich sie .. Mühe gehabt .. und war eben gezwungen, sie .. eben die Tür abzuschließen .. und (betont) das hat sie natürlich konsterniert (mhm) (gespielt empört) Ich lass mich nicht einsperren! So ungefähr, nicht?“ (1/260-270)
Auch in dieser Aussage kommt eine große Hilflosigkeit und Angst vor der Verantwortung gegenüber der Pflegebedürftigen zum Ausdruck. Die Furcht, seiner Frau könnte beim Verlassen der Wohnung etwas zustoßen, veranlasste den Ehemann zum Abschließen der Haustür, was zur Eskalation führte und das Gefühl der Überforderung verstärkte.
- Hauswirtschaftliche Pflichten und Pflege als große Belastung erlebt (1/362-364)
- Verantwortung für Ehefrau als Belastung erlebt
Außerdem Gefühl der Überforderung beim Kochen (1/303-315)
„ Herr E.: Und was für (') mich eben schwierig war .. die (betont) Verantwortung, wenn ihr was passiert wär .. sie fällt, wenn sie .. irgendwie (,) stolpert oder so (,) (') und die Belastung durch's Kochen.“ (1/303-305)
Neben dem Druck der Verantwortung für die Ehefrau wird in dieser Aussage auch deutlich, dass die Übernahme von ungewohnten Tätigkeiten sich belastungsverstärkend auswirkt. In diesem Fall stellte die Verantwortung fürs Kochen für den Ehemann ein großes Problem dar. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Generation, in welcher Haushaltstätigkeiten als reine Frauendomäne betrachtet wurden, war mit der Übernahme dieser Aufgaben für ihn auch eine Rollenverschiebung verbunden, der er sich nicht gewachsen fühlte.
Weitere Herausforderungen in psychischer Hinsicht sind neben Rollenverschiebungen auch Veränderungen von Machtstrukturen innerhalb der Familie, die sich aus der Pflegesituation ergeben können, sowie dysfunktionale Beziehungen zwischen Pflegenden und Gepflegten.
In vielen Fällen ist es auch die Summe der Anforderungen durch die Pflegesituation, die zu einem Gefühl der permanenten Erschöpfung führt.
- Große Belastung durch Koordination und Aufrechterhaltung des Hilfesystems (4/42-49)
- Besuche bei Eltern belastend und arbeitsintensiv erlebt Abschalten fiel zunehmend auch zuhause schwer (4/82-109)
- Angehörige fühlten sich durch Hilfebedüftigkeit stark belastet
Versorgung nur aufgrund des Eintritts in Ruhestand möglich (2/428- 437)
„ Frau V.: Und (,) und seither (,) wurde dann immer mehr und mehr. (mhm) Zu dem Zeitpunkt dann war ich .. halt (betont) echt .. war ich schon am .. am .. am (,) Rande, ja. (mhm) Und .. es ist halt dann auch so, (,) man kommt zu den Eltern heim .. äh (,) und (betont) freut sich nicht sondern man weiß, oh jetzt muss ich dass wieder checken und das wieder checken und hoffentlich sind keine Katastrophen passiert. (mhm)
I: Es ist dann immer mit, mit Arbeit und (,)
Frau V.: (Betont) Mühe auch verbunden, ja. Und halt dann auch äh (,) wenn jemand so krank ist .. wie meine Mutter krank war, dann war ich halt, (,) dann war ich (betont) endlich mal greifbar, dann kamen halt hunderttausend Sachen auf einmal. (mhm) Da musst du anrufen, das musst du klären und das und so.“ (4/82-94)
Die ständige Verbindung der Besuche bei den Eltern mit Versorgungstätigkeiten sowie das Gefühl, dauernd verfügbar sein zu müssen, führte in diesem Fall dazu, dass ein Entspannen auch zuhause nicht mehr möglich war. Bei einem Andauern der Situation wäre hier die Gefahr eines Burn-outs nicht auszuschließen gewesen.
Generell ist bei der Betrachtung der psychischen Situation pflegender Angehöriger zu beachten, dass die dargestellten Belastungen selten isoliert auftreten. Vielmehr sehen sich Pflegende meist mit einem ganzen Bündel an Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert: „Bei den Hauptpflegepersonen liegt in der Regel eine sehr hohe, multifaktorielle Belastung – also mehrere Belastungsaspekte gleichzeitig – vor.“ (s. Maly, 2001, 48).
10.1.2.5. Positive Aspekte der Pflege
Obwohl die Sorge für einen pflegebedürftigen Angehörigen häufig mit einem hohen Maß an Beeinträchtigungen verbunden ist, berichten viele Angehörige, dass sie auch wichtige positive Aspekte mit der Pflegesituation verbinden. Bei einer entsprechenden Befragung im Rahmen der MuG III Untersuchung äußerten über 80 % der befragten Hauptpflegepersonen die Ansicht, dass Pflegen sich lohnt. Dabei ist besonders beachtenswert, dass von den Angehörigen der Demenzkranken diese Auffassung sogar 83,4 % vertraten (vgl. MuG III, 2005, 127-128). Psychische Faktoren scheinen für eine positive Einschätzung ausschlaggebend zu sein. Finanzielle Vorteile spielen nur eine untergeordnete Rolle und haben keinen direkten Einfluss auf eine positive emotionale Bewertung der Situation (vgl. Maly, 2001, 66). Als Beispiele für positives Erleben werden Gefühle der Zufriedenheit und persönliches Wachstum angeführt. Auch der Gedanke, dass die häusliche Pflege eine Verbesserung der Lebenssituation des Pflegebedürftigen darstellt, wird als Gewinn bei der Pflegesituation erlebt. Dankbarkeit und Zufriedenheit des Pflegebedürftigen sowie Anerkennung durch die Umwelt stärken das Selbstbewusstsein des Pflegenden und tragen ebenfalls zu einer positiven Bewertung der Pflegesituation bei. In verschiedenen Studien gaben die Befragten als positiven Effekt der Pflege auch an, neue Erfahrungen machen und an diesen wachsen zu können. Überwiegend wurde auch Freude am Zusammensein mit dem Pflegebedürftigen genannt sowie in einigen Untersuchungen eine Verbesserung der familialen Beziehungen festgestellt (vgl. Meinders, 2001, 54).
Die Erlebensqualität in der Pflege steht in enger Korrelation mit dem Interesse an einer Heimunterbringung. Je mehr positive Auswirkungen die Angehörigen mit der Pflegesituation in Verbindung bringen, desto geringer ist der Wunsch nach der Beendigung der Pflegebeziehung (vgl. Meinders, 2001, 69). Positive Aspekte der häuslichen Versorgung werden unter dem Begriff „gain“ subsumiert und finden zunehmend Beachtung in der Angehörigenforschung. Damit wird die Abkehr von einer reinen Defizitorientierung intendiert. Pflege wird zunehmend als familiale Entwicklungsaufgabe begriffen, was vermehrt die Frage aufwirft, welche Faktoren sich auf positives Pflegeerleben auswirken und durch welche Konzepte diese intensiviert werden können (vgl. Meinders, 2001, 50).
10.1.3. Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
Wie das Ausmaß der Belastungen von den Betroffenen erlebt und bewältigt wird, ist individuell sehr verschieden. Die subjektive Wahrnehmung der Situation sowie die individuellen Coping-Strategien sind hierbei bestimmende Faktoren. Positive Auswirkungen auf das Belastungserleben haben „ein hohes Vertrauen der Pflegepersonen in ihre eigenen Fähigkeiten bei Problemlösungen und das Bewusstsein, Kontrolle über die Situation zu haben“ (s. Maly, 2001, 48). Ebenso wurde ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Unterstützung bei der Pflege zu organisieren, und dem subjektiven Belastungsempfinden nachgewiesen (MuG III, 2005, 129).
Männliche Pflegepersonen nehmen tendenziell eher Hilfsangebote in Anspruch als Frauen. Auch Pflegende mit höherem Bildungsniveau greifen eher auf Unterstützung von außen zurück als Angehörige bildungsfernerer Milieus. Werden Pflegende nach ihren dringlichsten Bedürfnissen gefragt, sind die häufigsten Nennungen mit 38,6 % der Wunsch nach Erholung und mit 13,3 % das Bedürfnis nach Entlastung. Weitere Angaben beziehen sich auf den Wunsch nach Gesundheit, emotionaler Zuwendung oder finanzieller Unterstützung. Lediglich 3,4 % der Befragten würden die Pflegebeziehung am liebsten beenden (vgl. Gräßel, 1997, 101). Ca. 30 % der Hauptpflegepersonen fühlten sich bei ihrer Tätigkeit nicht ausreichend unterstützt. Ungefähr zwei Drittel waren mit der Unterstützung durch die Familie zufrieden, während dies nur etwa die Hälfte von Freunden und Nachbarn sowie von professionellen Gesundheits- und Sozialdiensten sagen konnte. Dies gilt unabhängig von Demenzerkrankungen für alle Angehörigen gleichermaßen (vgl. MuG III, 2005, 125-126).
Grundsätzlich lassen sich die Angebotsstrukturen für pflegende Angehörige in zwei Bereiche einteilen. Die erste Kategorie bezieht sich auf direkte Entlastungsangebote durch konkrete Hilfe bei Pflegetätigkeiten, während der zweite Bereich beratende, informierende und emotionale Hilfestellung für die Pflegenden umfasst (vgl. Gräßel, 1997, 101-102).
Beide Formen der Hilfen für pflegende Angehörige werden sowohl im professionellen Rahmen als auch im Kontext von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement erbracht.
10.1.3.1. Nutzung von professionellen Unterstützungs- und Hilfsangeboten
Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen zur Finanzierung der familial organisierten Pflegearrangements beitragen (vgl. MuG III, 2005, 73-74). Häufig ermöglicht erst der Bezug von Leistungen aus dem SGB XI die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung bei der Pflege. Analog zu der Anzahl Betroffener, die sich an professionelle Pflegedienste wendet, beziehen auch knapp ein Drittel der Pflegebedürftigen Leistungen der Pflegeversicherung in Form von Sach- bzw. Kombileistungen. Die anderen Leistungsempfänger haben sich für die Variante der Geldleistung entschieden, meist mit dem Ziel, Angehörigen für ihre Tätigkeit einen finanziellen Ausgleich zu verschaffen (vgl. MuG III, 2005, 75).
[...]
- Arbeit zitieren
- Birgitta Bernhardt (Autor:in), 2007, Von ambulanten zur stationären Pflege im Pflegeheim. Die Perspektive pflegender Angehöriger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88964
Kostenlos Autor werden












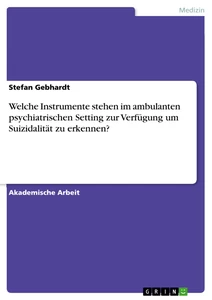


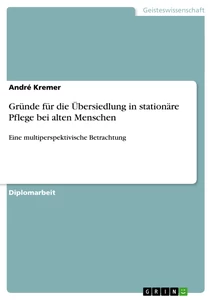
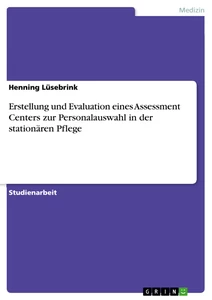



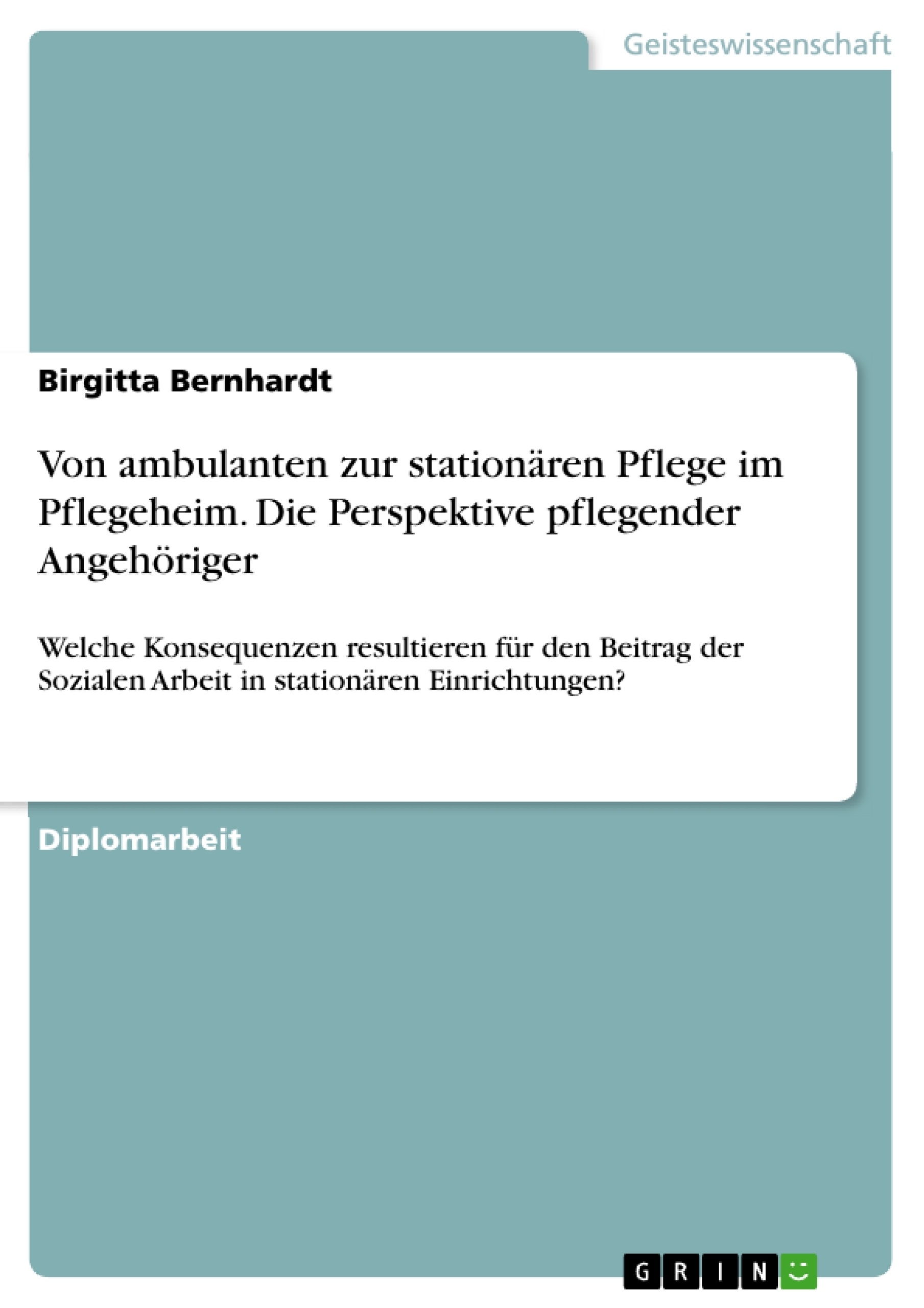

Kommentare