Leseprobe
Gliederung
1. Einleitung
2. Die männliche Sozialisation
2.1 Die Primärsozialisation in der Familie
2.1.1 Die Bedeutung des abwesenden Vaters
2.1.2 Die Mutter-Sohn-Beziehung
2.2 Die Sekundärsozialisation in der Gesellschaft
2.3 Die traditionelle Männerrolle
2.4 Konzepte der Männlichkeit
2.4.1 Hegemoniale Männlichkeit
2.4.2 Marginalisierte Männlichkeit
2.5 Entwicklungspsychologische Aspekte
2.5.1 Das kognitionspsychologische Entwicklungsmodell
2.5.2 Das psychoanalytische Modell
2.6 Weitere Entwicklungsfaktoren
2.6.1 Die Bedeutung der psychisch-sexuellen Entwicklung
2.6.2 Die Bedeutung der Gleichaltrigengruppe (Peer-Group)
2.7 Die Bewältigung des Mannseins
2.8 Gewalt als Ergebnis männlicher Sozialisation
3. Männer als Täter von Gewalt Theoretische Erklärungsansätze für die Täterschaft sexualisierter Gewalt
4. Männer als Opfer von Gewalt
4.1 Männer als Opfer allgegenwärtiger Gewalt
4.1.1 Jungen und Männer als Opfer ihrer Männlichkeit
4.1.2 Konsequenzen aus dem gesellschaftlichen Kontext
4.2 Jungen als Opfer sexualisierter Gewalt
5. Resumee
6. Quellennachweis
7. Anhang
1. Einleitung
Das Thema dieser Arbeit lautet „Männer als Täter und/ oder Opfer von Gewalt“. Es handelt sich bei dem Forschungsgebiet der männlichen Gewaltopfer um ein relativ junges Wissenschaftsgebiet.
Zunächst erscheint die zugrunde liegende Thematik dieser Arbeit aus zwei unabhängigen Teilbereichen zu bestehen, zum einen aus männlichen Tätern und zum anderen aus den männlichen Opfern von Gewalt. Um mit beiden Problematiken arbeiten zu können ist es nötig über den Sozialisationsprozess die näheren Hintergründe zu beleuchten.
Hierbei wird sowohl auf die Primärsozialisation in der Familie, als auch auf die Sekundärsozialisation in der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die „Männlichkeit“ eingegangen.
Die Sozialisation des Mannes erfolgt geschlechtsspezifisch und hat großen Einfluss auf die gelebte und real existierende Männerwelt. Diese unterliegt einem konstanten Wandel und besonders heute ist diese geprägt von einem beginnenden Zerfall tradierter Männlichkeitskonzepte und etablierter Männerrollen.
Ferner werden typische Facetten der Männlichkeit und die oben genannten Männerrollen beleuchtet, welche in ihrem Entstehen und Erleben im direkten Zusammenhang zur Sozialisation stehen. Das Profil der Männerwelt der Vergangenheit definierte sich durch eindeutige Rollenmuster und Handlungsmaxime, die durch soziokulturelle Hintergründe und gesellschaftliche Normen gestützt, legalisiert und aufrecht erhalten wurden.
Heutzutage sehen Männer veränderte Anforderungen an sich gestellt, die durch die technisierte Industrialisierung und Individualisierung unserer Gesellschaft geprägt werden: Männerrollen scheinen heute durch Funktionalität, Flexibilität und Beliebigkeit gekennzeichnet zu sein. Einerseits soll man(n) sich in die Gesellschaft einpassen können, ein gesellschaftsoffenes und mobiles Leben führen, andererseits aber eine eigenständige Persönlichkeit sein.
Aus den tradierten und verinnerlichten Werten der traditionellen Männlichkeit und dem Versuch sich den neuen Anforderungsprofilen zu stellen resultierten Bewältigungsstrategien des Mannseins, welche wiederum eine Verbindung zur Männergewalt ergeben werden.
Unentbehrlich für diese Arbeit ist es diese Bewältigungsstrategien aufzunehmen und zu ergründen. Der Fokus in diesem Kontext richtet sich insbesondere auf die Funktion der Ausübung von Gewalt für einen Mann und welche Bedeutung Gewalt im Leben eines Mannes haben kann. Hierbei spielen Rechtfertigungsmuster und Legitimationen bei der Ausübung von Gewalt eine entscheidende Rolle.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit soll sein, einen Verknüpfungspunkt zwischen männlichen Gewalttätern und männlichen Gewaltopfern zu finden, also eine bestimmte Größe, die einen Einfluss auf beide Teilbereiche aufweist. Diese Größe sollen die Ergebnisse der Ausführungen zur männlichen Sozialisation darstellen, welche den Ausführungen zu den männlichen Tätern und Opfern aus inhaltlichen Gründen vorangestellt werden.
Auf der Opferseite gilt es zunächst zu klären, wer die Opfer von Gewalt sind. Der Fokus richtet sich hierbei auf die Person des Geschädigten. In unserer Gesellschaft existiert ein Meinungsbild, nachdem Männer selten die Opfer, sondern ausschließlich die Täter von Gewalt sind. Dieser Aspekt bedarf einer genaueren Überprüfung. Des Weiteren gilt es zu klären, welche Aspekte besonders im Hinblick auf männliche Gewaltopfer zu berücksichtigen sind. Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich bei diesem Themenkomplex um ein vernachlässigtes Forschungsgebiet und daher gibt es auch erst wenig wissenschaftlich fundiertes Forschungsmaterial. Hier soll der Versuch unternommen werden, aus denen bis dato gewonnenen Erkenntnissen die männliche Opferwerdung als ein Zweistufenmodell zu erklären. Dieses besteht zunächst aus dem gesellschaftlichen Kontext, warum es Männern noch immer verwehrt ist Opfer zu sein und den unmittelbar mit der Opferwerdung zusammenhängenden Folgen. Weiterhin werden Probleme, die im Zusammenhang mit Männerbildern und Männerklischees und ihrer Bedeutung für Männer und den Reaktionen der Umwelt auf männliche Gewaltopfer stehen, beleuchtet.
Von der männlichen Sozialisation werden Erklärungsansätze geliefert, welche sich auf die männliche Täter-, als auch auf die männliche Opferwerdung beziehen lassen.
Diese Arbeit versucht Aspekte der männlichen Sozialisation herauszuarbeiten, die Auswirkungen auf Männer als Täter und auch als Opfer von Gewalt haben.
2. Die männliche Sozialisation
Eine einheitliche Definition für den Begriff „Sozialisation“ ist, aufgrund der Komplexität, wohl im Alltag, als auch in der Forschung kaum greifbar.
Im Groben ist der Begriff Sozialisation als Prozess der Eingliederung eines Menschen in eine soziale Gruppe, bzw. in die Gesellschaft in der er lebt zu verstehen.
Klaus Hurrelmann (1997) beispielsweise versteht Sozialisation als Verarbeitung innerer und äußerer Realität. Wiederum Lothar Böhnisch (2004) schreibt er habe Sozialisation bisher als Prozess des Aufwachsens und der Lebensgestaltung in Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst verstanden. Weiterhin ist es richtig, dass Sozialisation als die Integration des Menschen in vorgegebene soziale Rollensysteme und als lebenslanger Prozess verstanden wird. Es werden Verhaltensweisen erlernt, welche das Individuum benötigt um diese sozialen Rollen zu erfüllen sowie für den Erwerb seiner kulturellen Identität.
In den verschiedenen Altersstufen sind jeweils unterschiedliche Phasen der Entwicklung und Sozialisation von Belang. Beispielsweise steht von der Kindheit bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter der Aufbau und die Bildung der sozial handlungsfähigen und identischen Persönlichkeit im Vordergrund. Während im Erwachsenenalter bis hin ins Alter die Modifikation und Weiterentwicklung bereits bestehender Identitätsstrukturen im Mittelpunkt steht.
Als maßgebliche Erziehungsinstanzen gelten heute Familie, Schule, Arbeitsplatz und andere gesellschaftliche Institutionen (Microsoft, Encarta Enzyklopädie, 2003, Suchbegriff: Sozialisation).
Die geschlechtsspezifische Sozialisation des Mannes soll in dieser Arbeit die Grundlage darstellen, um Antworten auf die in der Einleitung formulierte Frage, warum Männer Täter von Gewalt werden, zu bekommen.
Die im Sozialisationsprozess erlernte/ angeeignete Gewaltanwendung soll hierbei als mögliche Handlungsstrategie für Männer betrachtet werden.
Ebenso soll die männliche Opferwerdung im Zusammenhang mit der Sozialisation des Mannes als deren Ergebnis verstanden werden. Hierbei sollen über die männliche Sozialisation Erklärungsansätze geliefert werden, warum die männliche Opferwerdung besonders problematisch zu sehen ist.
In diesem Kontext ist es unerlässlich auf die verfestigten und verinnerlichten Rollenmuster und –erwartungen, die an einen Mann gestellt werden, einzugehen.
Im Vorfeld werden jedoch für diese Arbeit relevante Punkte der Primär- und Sekundärsozialisation des Mannes aufgegriffen.
2.1 Die Primärsozialisation in der Familie
Bereits mit der ersten Frage mit der man einem Neugeborenen begegnet, nämlich die: „Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“, stellt man eigene Erwartungen an das geschlechtliche Wesen. Wie erkennt und lernt der Säugling männlich oder weiblich zu sein und wie entwickelt er seine eigene Geschlechtsidentität?
Die Sozialisation ist darauf angelegt, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten (gemäß der jeweiligen Vorstellungen, was Männer bzw. Frauen auszeichnet) zu entwickeln. Wie unterschiedlich diese Vorstellungen jedoch sind, hat Margaret Mead (1962) bereits gezeigt:
"In einer Gesellschaft, die auf der Polarisierung von zwei Geschlechtern beruht, gibt es keine Identität außerhalb des Geschlechts. Die Eindeutigkeit einer Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechter, und die daran geknüpften gesellschaftlichen Erwartungen (Fremdsozialisation) sowie Verinnerlichung und subjektive Aneignungsformen (Selbstsozialisation) sind Grundvoraussetzungen für soziale Interaktion und Identitätsbildung."
Eine solche Zugehörigkeit wird schon in der Familie über bestimmte Normen, Rollenerwartungen und allgemeine Umgangsformen vermittelt.
Die emotionale Dimension hat in der männlichen Primärsozialisation eine zentrale Bedeutung. Geschlechtsrollenstereotypen von Männlichkeit vertreten Annahmen über rationale (weniger emotional als Frauen) Männer. Selbsterfahrungen und Selbstbestätigungen über Gefühle werden bei Jungen gehemmt, verwehrt und externalisiert – nach außen gelenkt. Jungen lernen also schon in der Familie die Kanalisierung ihrer Emotionen. Schmauch (1985) sieht diese elterlichen Zuweisungen (der Junge soll großartig und männlich, als auch klein, tröstlich und passiv sein) als Ablehnung bestimmter Aspekte der Persönlichkeit des Jungen (vgl. Schmauch, 1985, zit. nach Maschwitz, 2000, S. 56).
„Wie schwer fällt es einem Mann einzugestehen, dass es in Kindheit und Jugend Situationen gab, in denen man darunter litt, Junge zu sein, wo man gezwungen wurde, sich „männlich“ zu verhalten, wo einem verwehrt wurde, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, denn dies wurde als „weibisch“ bzw. „unmännlich“ denunziert. (…) den damals erlebten negativen Gefühlen, wie Angst, Scham, Trauer, Hilflosigkeit, verweist auf tiefe kindliche Kränkungen und Verletzungen (…)“ (Miller, 1983, zit. nach Böhnisch/ Winter, 1994, S. 25).
Dieses erzwungen „männliche“ Verhalten wird später in der Arbeits- und Berufswelt weiter gefördert. Jegliche Gefühle und Bedürfnisse werden gelernt zu fürchten und zu unterdrücken. Diese emotionale Leere wird sowohl in der Erziehung als auch in der sozialen Umwelt vermittelt, Emotionen werden gesellschaftlich nicht anerkannt. Daraus resultierende Hilflosigkeit, Schrecken und Wut werden von der Umwelt abgelehnt, so dass sich schließlich an allem gerächt wird was diese Hilflosigkeit hervorrufen könnte.
Eltern sind die ersten Sozialisationsinstanzen im Leben des Kindes und die Personen, die es am nachhaltigsten prägen. Umso wichtiger erscheint es deshalb, sich mit den Bedeutungen des (abwesenden) Vaters und der Mutter für die männliche Sozialisation auseinander zu setzen.
2.1.1 Die Bedeutung des abwesenden Vaters
In den Familien ist der Vater meist physisch abwesend. Was wiederum für die Entwicklung und Identitätsfindung des Kindes nachhaltige Folgen haben kann.
Längst ist die klassische Rollenverteilung, welche den Vater als Beschützer und Ernährer der Familie und die Mutter als Betreuerin und Versorgerin der Kinder vorsieht, überholt. Das gesellschaftliche Bild von Familie und Erziehung gestaltete sich aufgrund dessen neu, dass durch veränderte ökonomische und soziale Verhältnisse immer mehr Frauen erwerbstätig wurden. Somit gewann der Vater als Bezugsperson für die Kinder zunehmend an Bedeutung.
Die Erziehung durch die Väter ist gefühlsmäßig eher distanziert. Des Weiteren ist in der Jungensozialisation meist die Rede von der Abwesenheit der Väter/ Männer. Mit dieser These ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft gemeint, wodurch der frauendominierte Alltag in den ersten Lebensjahren begründet liegt.
Mertens (1994) weist auch auf die mangelnde Bereitschaft von Vätern hin, sich auf die Bedürfnisse des Kindes einzulassen und emotional verfügbar zu sein. Eine homoerotische, identifikatorische Liebe zum Vater sei allerdings Grundlage für die Entwicklung der männlichen Identität (vgl. Mertens, 1994, zit. nach Maschwitz, 2000, S. 61).
Die Mutter ist also über das Austragen und Stillen hinaus, in den ersten Jahren für die Versorgung, Betreuung, Erziehung und Freizeitgestaltung des Kindes zuständig, während der Mann arbeitet. In der Zeit bis etwa zehn wächst der Junge in einer, wie oben bereits erwähnt, frauendominierten Alltagswelt auf, in Bereichen, die hauptsächlich von Frauen bestimmt sind: das Zuhause (Mutter+Kind/Kinder), der Kindergarten (Erzieherinnen), die Grundschule (meist Lehrerinnen). Männer sind in diesen Bereichen deutlich unterrepräsentiert (vgl. Böhnisch/ Winter, 1994, S. 63).
Im Gegensatz zum Mädchen, welches in der ersten Periode ihres Lebens vom gleichgeschlechtlichen Vorbild umgeben ist, hat der Junge wenig Kontakt zum direkten Vorbild "Mann".
„Da es schwierig ist, sich mit einem nicht erreichbaren Vater zu identifizieren, wird die Mutter mit dem in Verbindung gebracht, was nicht männlich ist. Sie wird als Mangelwesen und minderwertig betrachtet, während das Männliche überhöht und idealisiert erscheint, zumal die Realitätsprüfung an der auch real verfügbaren Vaterfigur kaum möglich ist“ (Mertens, 1994 zit. nach Maschwitz, 2000, S. 61).
Vielen Jungen steht also der Vater nicht als zweite Identifikationsfigur zur Verfügung, Männlichkeit wird ihnen in Form einer doppelten Negation vermittelt. Vereinfacht: Mann sein = Nicht-Frau / Nicht-Nicht-Mann sein.
"Frau ist, wer kein Mann sein kann. Eine Frau ist Nicht-Mann. Dem Jungen aber wird seine Männlichkeit zunächst durch Abgrenzung von der Mutter vermittelt, um diesen ihm am nächsten stehende Erwachsene ist das, was er nicht sein darf, um ein Mann zu werden. So wird sein Geschlecht als Nicht-Nicht-Mann bestimmt" (Hagemann-White, 1984, S.92).
Böhnisch und Winter (1994) erklären diesen Zusammenhang über die Abwesenheit bzw. die partielle Anwesenheit des Vaters sowie seine dadurch entstehende „Strafmacht“ („warte nur, wenn Papa nach Hause kommt“). Männer werden als „strafende Sanktionsinstanz“ kennen gelernt und wahrgenommen. Hier fehlt dem Jungen die Orientierung am Alltag des Vaters, die Schwächen, Probleme im Beruf, die täglichen Bewältigungsprobleme usw. bekommt der Junge nicht mit. Der Kontakt zur realen Lebenswelt der Männer fehlt. All jenes was für eine Geschlechtsidentität notwendig wäre. Um eine solche Identität entwickeln zu können, findet eine Orientierung also nicht direkt sondern im Negativ Bezug statt, die Identifikation erfolgt über männliche Distanzierung und Negation des Weiblichen. Eine „Nicht-Nicht-Mann-Identität“, eine Art „Umweg-Identifikation“ erfolgt aufgrund des Phänomens der abwesenden Männer. Der Mann wird über den Besitz von Penis, Status, Beruf etc. definiert und die Frau wird über das „Nicht-Haben“ („Nicht-Mann“) definiert (vgl. Böhnisch/ Winter, 1994, S. 65, 66).
Allzu oft erfolgt dann, als Ersatz für die fehlenden oder bruchstückhaften Erfahrungen mit Männern während der Sozialisation, unter anderem eine Identifikation mit Idolen aus Zeitschriften, Filmen, Medien aller Art, Spielzeugfiguren oder Superstars. Diese Identifikation führt zu weiteren Verunsicherungen und damit zu einer noch stärkeren Abgrenzung gegenüber der Mutter.
2.1.2 Die Mutter-Sohn-Beziehung
In der frühen Kindheit identifiziert sich der Junge mit der Mutter. Er nimmt somit dem Weiblichen zugeschriebene (Identitäts-) Anteile in sich auf.
Durch den in Punkt 2.1.1 bereits erwähnten frauendominierten Alltag eignet sich der Junge nach und nach den Frauen zugeschriebene Eigenschaften und Kompetenzen an. Bei der späteren Suche nach männlicher Identität geraten Jungen in ein Dilemma, sie müssen sich von ihren bis dato angeeigneten weiblichen Anteilen abgrenzen. Schließlich bedeutet Mann = Nicht-Frau sein. Aufgrund der gesellschaftlichen Verwehrung ihrer weiblichen Eigenschaften werden sie hilflos, was sie wiederum dazu bringt, das zu verachten oder zu hassen, was aus ihrem Selbst kommt. Hierauf werde ich unter anderem in Punkt 2.5.2 näher eingehen.
Die Mutter-Sohn-Beziehung scheint schon früh ambivalent geprägt zu sein. Einerseits ist da die Liebe zum eigenen Kind und daraus resultierende Verhaltensweisen und Zuwendung. Andererseits kulturelle Erwartungen, Stereotype, eigene schlechte Erfahrungen der Mutter mit ihrem Vater und anderen Männern.
Nach Schmauch (1988, S. 83) spielen hier (aus psychoanalytischer Sicht) unbewusste Fantasien der Mutter, wie der beneidete Bruder, der begehrte oder enttäuschende Vater, Verkörperung des eigenen imaginierten Penis, Vertreter des unterdrückenden Geschlechts oder verdrängte Erinnerungen eine entscheidende Rolle (vgl. Böhnisch/ Winter, 1994, S. 68).
Der Junge entwickelt ebenfalls eine ambivalente Beziehung zur Mutter. Er sieht sie als gesellschaftlich minderwertige Frau, als abgrenzende Mutter, als Mutter mit der Verschmelzung erwünscht wird, die den Sohn liebende und gleichzeitig die männliche Realität ablehnende Mutter.
Diese gespaltene Beziehung zur Mutter begünstigt zum Teil die unsichere Geschlechtsidentität des Jungen.
Die Mutter ist natürlich bestrebt ihren Sohn als „normales“ Mitglied der Gesellschaft zu erziehen und kommt somit in die Bedrängnis ihm die Stereotype der Gesellschaft zu vermitteln.
Auf der einen Seite bietet die Beziehung zur Mutter einen emotionalen Standort der Regression und Verschmelzung. Auf der anderen Seite besteht hier die Gefahr, dass Grenzen zerfließen, eine unter Umständen schmerzhafte Grenzziehung wird hier notwendig.
Moeller (1983) spricht von einem Miniaturmatriarchat in Form einer Mutter-Kind-Union in der Männergesellschaft. In der vaterlosen Gesellschaft werden die Söhne fast ausschließlich von der Mutter geprägt und somit die Entwicklung zum Mann. Weiterhin benennt er die gesellschaftlichen Veränderungen, Arbeitsteilungen und Wirtschaftszwänge welche die zwangsläufige Mutter-Kind-Isolation hervorrufen (vgl. Moeller, 1983, zit. nach Böhnisch/ Winter, 1994, S. 71).
Mit der Mutter erleben die Söhne also „nur“ ihren Alltag, eine indirekte Abwertung der Mutter findet hier statt. Eine weitere Abwertung der Mutter erfolgt dann durch die Erkenntnis der Funktion der Geschlechtsorgane. Röhner (1985, S. 184) beobachtete starke Reaktionen der Jungen auf die Gebär- und Stillfähigkeit der Frauen. Sie scheinen dadurch leicht kränkbar, angreifbar und verwundbar zu sein (vgl. Böhnisch/ Winter, 1994, S. 72). Hier kommt die „Frauenangst“ zum Vorschein, welche durch das Gefühl der Unterlegenheit gegenüber der scheinbaren Verbundenheit des Weiblichen mit der Natur durch ihre Fruchtbarkeit, geschürt wird.
2.2 Die Sekundärsozialisation in der Gesellschaft
„Die tätige Auseinandersetzung mit äußerer Natur“ im Zusammenhang mit Geschlechtersozialisation fassen Böhnisch/ Winter unter dem Begriff des „Gendering“. Gendering bezeichnet den Prozeß der sozialen Konstruktion von Geschlecht. In unserer Gesellschaft bedeutet das für Männer in der Regel das Einüben männlicher Dominanzkultur. Dabei treten die bereits erwähnten „Nebeneffekte“ auf, die Böhnisch/ Winter mit Externalisierung bezeichnen. Folgende Symptome sind dafür charakteristisch: Stummheit - Unfähigkeit über Emotionen zu sprechen, mythisch verklärt in der Aussage „Männer verstehen sich ohne Worte“; Einsamkeit - der „einsame Wolf“, Marlboro Mann; Körperferne - Angst vor Nähe, insbesondere unter Geschlechtsgenossen, Angst vor Homosexualität; Rationalität -Abwehr „störender“ Emotionen; Kontrolle -Unsicherheiten auf jeglicher Ebene werden vermieden. Böhnisch/ Winter bezeichnen dies im Extremfall als „autistische Störungen“.
Die männliche Dominanzkultur ist in eine patriarchale Gesellschaftsstruktur eingebettet. Da die Vorstellungen bezüglich der Geschlechtsrollen sich in historischen Prozessen geändert haben, verwenden Böhnisch/ Winter den Begriff der „Hegemonialen Männlichkeit“. Dazu aber mehr in Punkt 2.4.1.
2.3 Die traditionelle Männerrolle
„Rollenintegration“ bezeichnet das Lernen von sozialen Rollen, was auch Sozialisation im soziologischen Verständnis bedeutet.
Das Einüben, Ausfüllen, Übernehmen sozialer Rollen, das Rollenhandeln und die Rollenintegration spiegeln einen Teil des Rollengefüges (der traditionellen Männerrolle) des Sozialisationsprozesses. Die Rollenintegration ist dann gegeben, wenn die Rolle zur „natürlichen Selbstverständlichkeit“ wird. Männlichkeit wird als verinnerlichte Geschlechtsrolle betrachtet. Connell (2000) beschreibt Geschlechtsrollen nicht schlicht weg als Geschlechtsunterschiede, sondern betrachtet diese Geschlechtsrollen als die kulturelle Ausformung der biologischen Geschlechtsunterschiede.
Zum Einen ist also die traditionelle Männerrolle das Ergebnis der männlichen Sozialisation selbst, in der geschlechtsspezifische Rollenerwartungen vermittelt, erlernt und verinnerlicht werden. Zum Anderen ist sie auch der Beginn der männlichen Sozialisation, da sie die zu vermittelnden, zu erlernenden und zu verinnerlichenden Verhaltensweisen beinhaltet. Jungen und Männer entwickeln im Laufe ihrer Sozialisation sehr unterschiedliche Strategien im Umgang mit und in Aneignung von Männlichkeiten. Die für diese Arbeit relevante Männlichkeit ist die idealtypisch gedachte traditionelle Männlichkeit.
Über das typisch Männliche und typisch Weibliche herrscht ein recht homogenes Bild in unserer Gesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe von Rollenstereotypen, welche die traditionelle Männerrolle charakterisieren. In einer patriarchal geprägten Gesellschaft wird Jungen schon sehr früh durch verschiedene soziale Instanzen, wie Elternhaus, Kindergarten, Schule, Peer- Group, Medien etc. in ihrer Sozialisation vermittelt, wie die idealtypische Männlichkeit auszusehen hat. Typisierte Männerbilder sind demnach selbstsicher-männlich, cool, hart, konkurrierend, unerschrocken, zögert nicht, intelligent, gefühlsreduziert, kontrolliert, herrschend, machtvoll, verantwortungsvoll, von Großtaten fasziniert, logisch, der Ernährer der Familie, initiativ beim Sex, unabhängig und autoritär etc.
Kaufmann beschreibt die Verhältnisse in denen Jungen aufwachsen wie folgt:
„Das Feld, in dem die Triade männlicher Gewalt angesiedelt ist, sind Gesellschaften, welche auf Strukturen von Herrschaft und Kontrolle basieren. Obwohl diese Kontrolle manchmal im individuellen Vater symbolisiert und verkörpert wird – Patriarchat im wörtlichsten Sinne -, ist es wichtiger zu betonen, dass die patriarchalen Strukturen von Autorität, Herrschaft und Kontrolle soziale, ökonomische, politische und ideologische Aktivitäten ebenso wie unsere Beziehungen zur natürlichen Umwelt durchdringen“ (Kaufmann, 2001, S. 144).
In diesen Strukturen ist die Grundlage für die „Triade männlicher Gewalt“ zu sehen, denn (sexuelle) Gewalt hat immer auch mit Macht, Herrschaft und Kontrolle zu tun.
Wer als Mann den oben genannten Stereotypen nicht gerecht wird, oder werden kann, gilt in der Konsequenz als Weichei, Schwuchtel, verweichlicht, Schwuler oder dergleichen. Diese Männer, auf welche diese Tatsache zutrifft, werden durch solche ausgrenzenden Beurteilungen sanktioniert.
[...]
- Arbeit zitieren
- Katrin Voigt (Autor:in), 2006, Männer als Täter und/ oder Opfer von Gewalt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88558
Kostenlos Autor werden



















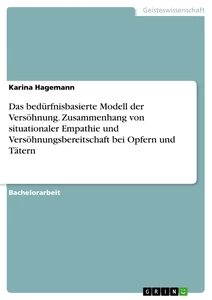


Kommentare