Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen des Marken- und Medienmarkenmanagements
2.1 Grundlegende Begriffe, Funktionen und medienspezifische Besonderheiten
2.1.1 Begriff der Marke
2.1.2 Begriff der Medienmarke
2.1.3 Funktionen der Marke und der Medienmarke
2.1.4 Begriff des (Medien-) Markenmanagements
2.1.5 Identitätsorientiertes (Medien-) Markenmanagement
2.1.6 Medienspezifische Besonderheiten
2.2 Markenmanagement
2.2.1 Markenpositionierung
2.2.2 Markenschutz
2.2.3 Markenstrategien
2.2.4 Brandingelemente der Marke
2.2.5 Markenanreicherung
2.2.6 Umsetzung und Implementierung der Marke
2.2.6.1 Marketing-Mix
2.2.6.2 Personalpolitik
2.2.7 Markencontrolling
2.2.7.1 Messverfahren
2.2.7.2 Markenwert
3 Medienmarkenmanagement aus der Perspektive des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy
3.1 State of the Art des Strategischen Managements
3.2 Elemente der Ansätze
3.2.1 Darstellung des Market-Base-View of Strategy
3.2.1.1 Grundannahmen des Market-Based-View of Strategy
3.2.1.2 Branchenstrukturanalyse
3.2.1.3 Konkurrenzanalyse
3.2.1.4 Wertkettenkonzept
3.2.1.5 Generische Strategien
3.2.2 Darstellung der Resource-Based-View of Strategy
3.2.2.1 Grundannahmen der Resource-Based-View of Strategy
3.2.2.2 Kriterien der Ressourcenauswahl
3.2.2.3 Konzept der Kernkompetenzen
3.3 Die Rolle der Marke in den beiden Ansätzen
3.3.1 Die Rolle der Marke in dem Market-Based-View of Strategy
3.3.2 Die Rolle der Marke in der Resource-Based-View of Strategy
3.3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Market-Based-View
und der Resource-Based-View of Strategy am Beispiel der Marke
3.4 Medienmarkenmanagement aus der Perspektive des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy
3.4.1 Medienmarkenpositionierung
3.4.1.1 Einführende Überlegungen zur Medienmarkenpositionierung
3.4.1.2 Differenzierungsstrategie für eine Medienmarkenpositionierung
3.4.1.3 Nischenstrategie für eine Medienmarkenpositionierung
3.4.1.4 Kostenführerschaftstrategie für eine Medienmarkenpositionierung
3.4.1.5 Weiterführende Positionierungsüberlegungen
3.4.2 Medienmarkenschutz
3.4.3 Medienmarkenstrategien
3.4.3.1 Einzelmarkenstrategie im Medienbereich
3.4.3.2 Dachmarkenstrategie im Medienbereich
3.4.3.3 Markentransferstrategie im Medienbereich
3.4.3.4 Markenfamilien- und Mehrmarkenstrategie im Medienbereich
3.4.3.5 Internationale Markenstrategien im Medienbereich
3.4.4 Brandingelemente der Medienmarke
3.4.4.1 Medienmarkenname
3.4.4.2 Weitere Brandingelemente der Medienmarke
3.4.5 Medienmarkenanreicherung
3.4.5.1 Co-Branding im Medienbereich
3.4.5.2 Charakter-Branding im Medienbereich
3.4.5.3 Lizensierung im Medienbereich
3.4.5.4 Sponsoring im Medienbereich
3.4.6 Umsetzung und Implementierung der Medienmarke
3.4.6.1 Marketing-Mix im Medienbereich
3.4.6.1.1 Leistungspolitik der Medienmarke
3.4.6.1.2 Preispolitik der Medienmarke
3.4.6.1.3 Distributionspolitik der Medienmarke
3.4.6.1.4 Kommunikationspolitik der Medienmarke
3.4.6.2 Personalpolitik im Medienbereich
3.4.7 Medienmarkencontrolling
3.4.7.1 Messverfahren im Medienbereich
3.4.7.2 Medienmarkenwert
4 Diskussion der Ergebnisse
4.1 Fazit
4.1.1 Von der akademischen Möglichkeit der Trennung zur praktischen
Notwendigkeit der Integration
4.1.2 Die Integration beider ‘Views of Strategy‘ im zeitgenössischen Medienmarkenmanagement
4.2 Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Zielpyramide des Markenmanagements
Abb. 2 Grundkonzept des Identitätsorientierten Markenmanagements
Abb. 3 Darstellung der Medienmarkenidentität und des -images
Abb. 4 Portfolio-Matrix mit integriertem Lebenszyklus
Abb. 5 Markenkategorisierung – Set-Konzepte
Abb. 6 SWOT-Konzept
Abb. 7 Phasen des Strategischen Managements
Abb. 8 Structure-Conduct-Performance-Paradigma
Abb. 9 Porters Branchenstrukturanalyse
Abb. 10 Porters Elemente der Konkurrenzanalyse
Abb. 11 Porters Wertkettenkonzept
Abb. 12 Kriterien der Ressourcenauswahl
Abb. 13 Kernkompetenzkonzept nach Prahalad/Hamel
Abb. 14 Core Assets und Kernkompetenzentwicklung
Abb. 15 Strategische Vorteile im Unternehmungsprozess
Abb. 16 Doppelperspektivischer Blick auf die Medienmarkenpositionierung
Abb. 17 Wertkette der TV-Wirtschaft
Abb. 18 Doppelperspektivischer Blick auf den Medienmarkenschutz
Abb. 19 Typische Markenarchitektur eines TV-Senders
Abb. 20 Verwertung von Medienangeboten (Windowing)
Abb. 21 Doppelperspektivischer Blick auf die Medienmarkenstrategien
Abb. 22 Doppelperspektivischer Blick auf die Brandingelemente der Medienmarke
Abb. 23 Doppelperspektivischer Blick auf die Medienmarkenanreicherung
Abb. 24 Programm-Promotion in der TV-Wirtschaft
Abb. 25 Selbstbezüglichkeit von kommunikationspolitischen Instrumenten
Abb. 26 Doppelperspektivischer Blick auf
die Umsetzung und Implementierung der Medienmarke
Abb. 27 Doppelperspektivischer Blick auf das Medienmarkencontrolling
1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, das Management von Medienmarken jeweils aus der Perspektive des Market-Based-View of Strategy (Outside-In-Perspektive) und der Resource-Based-View of Strategy (Inside-Out-Perspektive) zu beschreiben und nachvollziehbar zu machen.
Die Betrachtung des Medienmarkenmanagements soll sich an einem Durchlauf des klassischen Management-Regelkreises orientieren, d.h. mit der Planung und Organisation beginnen, dann die verschiedenen Dimensionen der Durchführung beleuchten und mit dem Controlling schließen.
Im zeitgenössischen Strategischen Management hat sich die Verbindung beider ‘Views‘ als optimale Lösung durchgesetzt. Solche integrativen Ansätze sind auch im Medienmarken-management verbreitet. Vor diesem Hintergrund mag die den Kern dieser Arbeit ausmachende künstliche Trennung der beiden Perspektiven als ein Rückschritt anmuten, dem als Fazit die Empfehlung des erneuten Schritts in Richtung Integration folgen müsste.
Die Trennung der Perspektiven hat aber außer ihrem akademischen Wert zwei wichtige Potenziale:
Erstens kann sie in der Lage sein, bezogen auf den Mediensektor, anschaulich zu erklären, warum jeweils einer der beiden Strategieansätze allein nicht ausreicht, um das Markenmanagement in all seinen Facetten zu erfassen.
Und, zweitens, kann diese gedankliche Trennung die Grundlage für ein Herausarbeiten der besseren Eignung einer der beiden Ansätze zur Erklärung bestimmter Teilprozesse des Medienmarkenmanagements werden.
Eines jener integrativen Modelle, das ‘Identitätsorientierte Markenmanagement‘, wird mit seiner speziellen Begrifflichkeit als ergänzende Sichtweise dem Kern dieser Arbeit zusätzlich Struktur verleihen, weil es eine Trennung, einen Wechsel zwischen und, besonders, die Integration von Outside-In- und Inside-Out-Perspektive am Beispiel des Konstrukts Marke anschaulich zu beschreiben vermag.
Im Folgenden soll die Struktur dieser Arbeit erläutert werden. Das Kapitel 2 stellt die Grundlagen des Marken- und Medienmarkenmanagements dar. Im Unterkapitel 2.1 wird neben wichtigen Begrifflichkeiten und medienspezifischen Besonderheiten der Ansatz des Identitätsorientierten Markenmanagements erläutert und anschließend auf den Medienbereich konkretisiert. Das Kapitel 2.2, welches sich mit Markenmanagement in allgemeiner Form beschäftigt, orientiert sich in seinem Aufbau in Anlehnung an Baumgarth an einem auf das Konstrukt Marke modifizierten Managementregelkreis, der im Bereich der Planung und Organisation mit Überlegungen zur Positionierung beginnt, im Rahmen der Durchführung ihre Umsetzung und Implementierung diskutiert und auf der Stufe der Kontrolle mit dem Markencontrolling abschließt. Diese Kapitelstruktur wird als Ordnungskriterium im Kapitel 3.4, d.h. bei der Konkretisierung auf das Medienmarkenmanagement, wieder aufgegriffen.
Das Kapitel 3 beginnt mit der Einordnung der Ansätze des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy in den Gesamtkontext des Strategischen Managements. Im Anschluss folgt die Darstellung der beiden Ansätze in allgemeiner, noch nicht auf Marken bzw. Medienmarken bezogener Form. Das Kapitel 3.3 diskutiert die Rolle der Marke in beiden ‘Views of Strategy‘ und beschreibt dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei ihrer Einpassung in die Ansätze.
Das Kapitel 3.4 stellt den Kern dieser Arbeit dar. In den jeweiligen Unterkapiteln wird zunächst das Management der Medienmarke dargestellt, um dann aus der Perspektive des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy diskutiert zu werden.
Im Kapitel 4.1 folgt im Fazit ein Rückblick auf die in der Einleitung formulierten Zielvorstellungen und eine Bewertung des praktischen Nutzens der akademischen Trennung der beiden Ansätze. Der Ausblick in Kapitel 4.2 beschreibt eine mögliche Zukunft des Medienmarktes aus der Perspektive des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy.
Im Anhang dieser Arbeit finden sich zum einen die Abbildungen, auf die im Text referiert wurde, und zum anderen eigene Darstellungen der diskutierten Ergebnisse des Medienmarkenmanagements aus der Perspektive beider Ansätze.
Aufgrund der Gattungsvielfalt im Mediensektor erfolgt im Kern dieser Arbeit keine ausschließliche aber dennoch vorwiegende Ausrichtung des Medienmarkenmanagements auf den Rundfunkbereich.
2 Grundlagen des Marken- und Medienmarkenmanagements
2.1 Grundlegende Begriffe, Funktionen und medienspezifische Besonderheiten
2.1.1 Begriff der Marke
In der Literatur findet man eine Vielzahl unterschiedlichster Definitionen, welche sich im Zeitablauf aufgrund äußerer Einflüsse und sich ändernder Begebenheiten entwickelt haben. Begriffe wie Marke, Markenartikel, Markenware und markierte Ware werden in den einschlägigen Werken zur weiteren aber nicht immer trennscharfen Ausdifferenzierung des Konzeptes Marke verwendet. Dieses Phänomen ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich hier Vertreter verschiedenster Forschungsrichtungen aber auch unternehmerischer Praxis terminologisch betätigten (vgl. Bruhn 1994a, 5). Der Einfluss von bspw. rechtlichen und politischen Faktoren, Veränderungen der Märkte und der Produkte, der Kommunikations- und Distributionsbedingungen sowie des Käuferverhaltens führten zu wechselnden Sichtweisen und neuen Herausforderungen der Markenpolitik (vgl. Esch/Wicke/Rempel 2005, 13-14; Meffert/Giloth 2002, 101; Sattler 2001, 24-37; Shocker/Srivastava/Ruekert 1994, 150-153). Die Markendefinitionen wurden im Zeitablauf obsolet, da sie zu deterministisch waren und bestimmte Phänomene der Markenbildung nicht berücksichtigten (vgl. Baumgarth 2004a,
2-5).
Die Ursprünge der Marke gehen auf Zeichen und Symbole zurück, deren Aufgabe darin lag, Informationen zu übermitteln (vgl. Baumgarth 2004a, 7; Mellerowicz 1963, 2). Später wurden Marken zur Kennzeichnung von Herkunft und Eigentum verwendet und übernahmen Auskunftsfunktion über die Güte des Produktes (vgl. Baumgarth 2004a, 7; Linxweiler 2001, 49; Mellerowicz 1963, 4). Der merkmalsorientierte Ansatz der Markendefinition entstand im letzten Jahrhundert und wird auf Domizlaffs Markenartikelkonzept (vgl. 1994, 690-721), veröffentlicht im Jahre 1939, zurückgeführt (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 20-21). Als charakteristische Darstellung des merkmalsorientierten Ansatzes wird in der Literatur oftmals die Definition von Mellerowicz verwendet (vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2006, 193; Baumgarth 2004a, 4; Meffert/Burmann 2002a, 20-21), worin lediglich Fertigwaren und deren Merkmale als Marke verstanden wurden (vgl. Mellerowicz 1963, 39).
Als im Jahr 1967 die gesetzliche Preisbindung aufgehoben wurde, kam dem Absatzbereich eine größere Bedeutung zu, weshalb die Marke nach der spezifischen Vermarktungsform ihres Produktes definiert wurde (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 22). Die absatzsystem- bzw. anbieterorientierte Sichtweise hatte die Aufgabe, beim Konsumenten ein bestimmtes Vorstellungsbild zu erzeugen und die Nachfrage zu steigern (vgl. Alewell 1959, 20).
Die Sättigung der Märkte führte in den 1970er Jahren zu der wirkungsbezogenen Sichtweise (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 23-24). Dieser Perspektive zufolge gelten all jene Güter und Dienstleistungen als Marke, welche aus Konsumentensicht als solche wahrgenommen werden (vgl. Bruhn 1994a, 8; Berekoven 1992, 43; Meffert/Steffenhagen/Freter 1979, 29). Nach Meffert kann eine Marke deshalb als „[…] ein in der Psyche des Konsumenten veranker-tes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder Dienstleistung beschrieben werden. Die zugrunde liegende markierte Leistung wird dabei einem mög-lichst großen Absatzraum über einen längeren Zeitraum in gleichartigem Auftritt und in gleichbleibender oder verbesserter Qualität angeboten [ Hervorhebungen im Original ] “ (1998, 785). Die positive Wirkung beim Konsumenten nimmt eine entscheidende Rolle ein (vgl. Esch/Wicke/Rempel 2005, 11; Baumgarth 2004a, 4), worin jedoch Operationalisierungs-probleme gesehen werden (vgl. Baumgarth 2004a, 5) und die mangelhafte Abgrenzung zum Begriff des Markenimages kritisiert wird (vgl. Welling 2003, 4). Viele Autoren der heutigen Zeit sehen den wirkungsbezogenen Ansatz als Ausgangspunkt und Definitionsgrundlage für ihre weiteren Ausführungen an und kombinieren bzw. erweitern diesen mit verschiedensten Elementen der anderen Definitionen zu dieser Thematik (vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2006, 194; Baumgarth 2004a, 4-5; Bruhn 1994a, 9; Bekmeier-Feuerhahn 1998, 29; Meffert 1998, 785).
In dieser Arbeit soll einem Derivat der wirkungsbezogenen Markendefinition gefolgt werden, bei dem auch die rechtliche Sichtweise Berücksichtigung findet. Demzufolge wird eine Marke als „[…] Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine Kombination aus diesen Bestandteilen, welches bei den relevanten Nachfragern bekannt ist und im Vergleich zu Konkurrenzangeboten ein differenzierendes Image aufweist, welches zu Präferenzen führt“ (Baumgarth 2004a, 5), verstanden.
2.1.2 Begriff der Medienmarke
Leitet man den Begriff Medien aus der lateinischen Sprache ab, so bedeutet er „[...] das Mittlere, auch Öffentlichkeit, Gemeinwohl, öffentlicher Weg [...]“ (Schanze 2002, 199) und beschreibt alle Mittel der Kommunikation (vgl. 2002, 199). In dieser Arbeit bezieht sich der Medienbegriff auf Massenmedien wie bspw. Zeitung und Zeitschrift, Rundfunk und TV, Bücher und Filme.
In der Literatur werden Medienorganisationen nach der Mediengattung eingeteilt. Als klassische Medienprodukte lassen sich der Printbereich mit Zeitungen, Zeitschriften und Büchern und der Rundfunkbereich mit TV und Radio voneinander abgrenzen (vgl. Sjurts 2005, 16). Des Weiteren werden häufig auch Speichermedien wie Videokassetten, CDs, DVDs, Onlinemedien und -netze dazu gezählt (vgl. Schumann/Hess 2006, 8-9). Die Tatsache, dass Telekommunikationsanbieter zunehmend Medieninhalte anbieten, legt nahe, diese ebenfalls dem Medienmarkt zuzuordnen (vgl. Eigler 2006, 526). In der Studie ‘Gute Unterhaltung‘ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young (vgl. 2005) finden zusätzlich zu o.g. Mediengattungen die Bereiche Film und Neue Medien mit den Teilbereichen Internet, Video- und Onlinespiele sowie mobile Dienste Berücksichtigung.
Innerhalb der verschiedenen Mediengattungen lassen sich spezifische Typen von Markenaus-prägungen feststellen. Im TV-Bereich können Formatmarken, mit welchen ein mehrteiliges Sendungskonzept bezeichnet wird (vgl. Meckel 1997, 477-478) wie bspw. ‘Tagesschau‘/ und von Genremarken, wodurch wechselnde Inhalte kategorisiert und oft mit einem konstanten Sendeplatz verknüpft sind (vgl. Wolff 2006, 43-44), unterschieden werden.
Medienmarken müssen einerseits den Publikumsmarkt und, andererseits, den Werbemarkt ansprechen, dabei aber trotzdem eine einheitliche Markenidentität kreieren (vgl. Siegert 2001, 121). Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit die Medienmarke analog zur Marke definiert werden (vgl. 2.1.1), wobei an der Stelle der relevanten Nachfrager mit Werbe- und Rezipientenmarkt eine Zweiteilung zu verzeichnen ist. Ein wichtiger Anlass für die Wahl dieser Begriffsbeschreibung liegt darin begründet, dass diese Definition den vielschichtigen Verwendungsformen der Brandingelemente gerecht wird, welche aufgrund der Produkt-charakteristika der Mediengattungen sehr unterschiedliche Formen annehmen können.
2.1.3 Funktionen der Marke und der Medienmarke
Die Marke übernimmt unterschiedlichste Funktionen. In der Literatur werden diese meist nach Anbieter- und Nachfragerperspektive eingeteilt (vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2006, 195; Meffert 1998, 785-786; Riedel 1996, 10-12), wobei Bruhn (vgl. 1994a, 24) auch Funktionen für den Handel benennt. Bei Medienmarken können die Funktionen aufgrund der medienspezifischen Besonderheiten (vgl. 2.1.6) aus der Perspektive der Medienorganisation, der Werbewirtschaft und der Rezipienten betrachtet werden.
Vergleicht man die in der Literatur aufgezeigten Funktionen, die eine Marke für den Konsumenten erfüllen kann, so lassen sich drei Hauptfunktionen ableiten: die Orientierungs- bzw. Identifikationsfunktion, die Unsicherheitsreduktion und der ideelle Nutzen.
Der Konsument ist mit einer Vielzahl von Informationen und unterschiedlichsten Produkten oder Leistungen konfrontiert. Zur Erleichterung der Auswahlentscheidung übernimmt die Marke in diesem Zusammenhang eine Orientierungs- bzw. Identifikationsfunktion für den Verbraucher (vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2006, 195; Meffert 1998, 785; Bruhn 1994a, 24), indem sie den Konsumenten informatorisch entlastet (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 381). Die Medienmarken übernehmen für den Rezipienten diese Funktionen bei Medienkauf oder
-nutzung und geben einen Interpretationsrahmen (vgl. Siegert 2001, 121) bzw. einheitliche Standards für Produktqualität vor, was wiederum die Kundenbindung erhöht und für stabile Reichweiten sorgt und wodurch Vorteile auf dem Werbemarkt erzielt werden können (vgl. Wirtz 2006, 106).
Die Markenbekanntheit und die Reputation einer Marke wirken vertrauensbildend und führen zu einer Qualitätsvermutung auf der Verbraucherseite (vgl. Esch/Herrmann/Sattler 2006, 195; Meffert 1998, 785-786). Bei Medienmarken zeigt sich dies in einer Unsicherheitsreduktion z.B. dadurch, dass die Glaubwürdigkeit gefördert oder das Risiko von Fehlentscheidungen verringert wird. Da es sich bei Medienprodukten um Erfahrungs- und Vertrauensgüter handelt, kommt dieser Funktion eine entscheidende Bedeutung zu (vgl. Wirtz 2006, 106; Siegert 2001, 121).
Eine weitere Funktion der Marke liegt in ihrem ideellen Nutzen für den Verbraucher begründet, der sich auf vielfältigste Weise zeigen kann, z.B. durch Übernahme einer Prestige-, Zugehörigkeits- oder -Imagefunktion (vgl. Meffert 1998, 786; Irmscher 1997, 30-31; Bruhn 1994a, 22-23). Auch eine Medienmarke kann einen individuellen oder sozialen Zusatznutzen bieten (vgl. Siegert 2001, 121). Dieser wird einerseits durch funktionale Nutzen wie Information, Unterhaltung, Bildung oder Beratung deutlich, welche den Medienprodukten inhärent sind, und, andererseits, durch z.B. die Möglichkeit zur Anschlusskommunikation oder die Zugehörigkeitsbekundung zu bestimmten Szene- oder Fangemeinschaften (vgl. 2001, 123-124).
Die Funktionen, die Marken aus Anbieterperspektive erfüllen können, lassen sich zusammenfassend als Preispremiums-, Differenzierungs-, Sicherheits-, Imagebildungs- und Wertsteigerungsfunktionen zusammenfassen (vgl. Meffert 1998, 786- 787). Bezogen auf die Medienmarke entspricht dies der Perspektive der Medienorganisation, wobei die Medien-marke zusätzlich noch eine Orientierungsfunktion für Produktion und Personalakquisition, eine Strukturierungsfunktion für Programmplanung und Publikums- und Mediaforschung sowie eine Zuordnungsfunktion von Werbewirkung zu Medienorganisationen übernimmt. Eine weitere wichtige Funktion liegt in verbesserten Möglichkeiten zum Schutz des geistigen Eigentums (vgl. Siegert 2001, 121-122).
Marken bieten aus der Perspektive des Anbieters für Unternehmen die Möglichkeit, einen höheren Preis zu erzielen (vgl. Backhaus 2003, 409; Sattler 2001, 23-24). Aus der Perspektive der Medienorganisation kann die Medienmarke eine bessere Verhandlungsposition gegenüber der Werbewirtschaft oder den Konsumenten unterstützen (vgl. Siegert 2001, 121).
Eine weitere Funktion betrifft die Differenzierung und die Präferenzbildung (vgl. Esch 2007, 24; Meffert 1998, 786). Die Markenpräferenzbildung und -loyalität sorgen für eine erhöhte Absatz- und Planungssicherheit auf Seite des Herstellers (vgl. Meffert 1998, 786; Bruhn 1994a, 24; Aaker 1991, 34-46). Des Weiteren bieten starke Marken einen Schutz vor Krisen und Aktionen der Konkurrenz (vgl. Shocker/Srivastava/Ruekert 1994, 155). Für Medien-marken können ähnliche Funktionen bestimmt werden, z.B. die Innovationssicherung oder die Profilierung gegenüber dem Wettbewerber (vgl. Siegert 2001, 121).
Die Marke übernimmt eine Imagefunktion und strahlt positiv auf das Firmenimage ab (vgl. Meffert 1998, 786; Bruhn 1994a, 24). Hinzu kommt, dass die Marke selbst einen ökonomischen Wert für die Unternehmung besitzt (vgl. Meffert 1998, 787). Auch auf Medienmarken treffen diese Funktionen zu.
Bruhn (vgl. 1994a, 24) beschreibt des Weiteren noch spezielle Funktionen, welche eine Marke für den Handel übernehmen kann. Darunter versteht er u.a. die Reduzierung des Absatzrisikos, die Steigerung der Rendite oder die Verringerung des eigenen Werbeaufwandes.
Bei Medienmarken tritt eine spezifische Besonderheit auf, weil die Perspektive der Werbewirtschaft zu berücksichtigen ist. Es lassen sich Sicherheits- und Orientierungs-funktionen nennen, wie z.B. die Bekanntheit und Verlässlichkeit des Marketingkonzeptes oder die höhere und zielgruppenspezifische Erzeugung von Aufmerksamkeit (vgl. Siegert 2001, 121). Aus den genannten Funktionen ergeben sich die Ziele der Markenpolitik, welche eine Entscheidungsgrundlage für durchzuführende Maßnahmen des Markenmanagements dar-stellen (vgl. Bruhn 1994a, 23). Die Zielpyramide des Markenmanagements (vgl. Abb. 1) lässt sich einteilen in ein Globalziel (vgl. Esch 2007, 58), welches in der Sicherung der Existenz und dem Erhalt oder der Steigerung des Unternehmenswertes besteht (vgl. Hahn/Hungenberg 2001, 13), und in ökonomische sowie verhaltenswissenschaftliche Ziele (vgl. Esch 2007, 58). Die Marke ist ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Globalzielerreichung eines Unternehmens, wobei die verhaltenswissenschaftlichen Ziele aufgrund der Beeinflussung von Konsumenten durch Sozialtechniken (vgl. Kroeber-Riel/Esch 2004, 135) auf die ökono-mischen Ziele wirken, und diese wiederum das Globalziel beeinflussen (vgl. Esch 2007, 57-58). Beim Medienmarkenmanagement gilt die gleiche Zielhierarchie (vgl. Siegert 2001, 121).
2.1.4 Begriff des (Medien-) Markenmanagements
In der Literatur werden die Begriffe des Markenmanagements und der Markenführung häufig synonym verwendet. Siegert (vgl. 2001, 65) benutzt sogar mit dem Konzept der Marken-pflege einen dritten Begriff gleichbedeutend. Die Tatsache, dass Meffert/Burmann/Koers (vgl. 2002, 8) in ihrer Definition für den Begriff Markenführung selbst das Wort Management benutzen, zeigt deutlich, dass beide Begriffe praktisch gleichbedeutend Verwendung finden. „Der Managementprozess der Planung, Koordination und Kontrolle dieser Maßnahmen [...]“ (2002, 8) wird von dem Markenbesitzer verfolgt, um den Wert der Marke zu steigern (vgl. Esch/Wicke/Rempel 2005, 43; Sattler 2001, 145-149; Irmscher 1997, 68-69; Aaker 1991, 21). Indem die Marke einen Zusatznutzen generiert, kann sie beim Konsumenten bspw. eine Kaufpräferenz für das Produkt auslösen und für Markentreue sorgen (vgl. 2.1.3). Dieses Ziel kann jedoch nur durch eine starke Marke erreicht werden (vgl. Meffert/Burmann/Koers 2002, 8). Unter dem Begriff der Markenführung werden alle Maßnahmen verstanden, die dem Markenaufbau dienen. Aufgrund nur leichter Variationen der Begriffsbedeutung sollen im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Begriffe ‘Markenmanagement‘ und ‘Markenführung‘ synonym verwendet und damit alle Aktivitäten bezeichnet werden, die sich auf das Führen bzw. das ‘Managen‘ von Marken beziehen. Ähnlich den Ausführungen von Siegert (vgl. 2001, 65) soll das Markencontrolling ebenfalls dem Kontext des Markenmanagements zugeordnet werden. Unter Medienmarkenmanagement versteht man entsprechend das Management der in Kapitel 2.1.2 definierten Medienmarken.
2.1.5 Identitätsorientiertes (Medien-) Markenmanagement
Aus den entstandenen Definitionen (vgl. 2.1.1) ergaben sich unterschiedliche Grundkonzepte des Markenmanagements, die sich im Zeitablauf veränderten. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand der identitätsorientierte Ansatz, welcher, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels ersichtlich wird, besonders gut den Anforderung der modernen Markenführung gerecht wird (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 19, 29).
In der Literatur liegen verschiedene Ansätze zur Erfassung der Markenidentität vor. Den Ansätzen gemein ist eine außen- und innengerichtete Betrachtung der Markenidentität (vgl. Esch/Langner/Rempel 2005, 105-125; Aaker/Joachimsthaler 2001, 50-54; Kapferer 1992, 50-56). Im Folgenden soll exemplarisch auf den Markenidentitätsansatz von Meffert/Burmann (vgl. 2002b, 49-68, Abb. 2) eingegangen werden. In dessen Zentrum steht eine wechselseitige Betrachtung zwischen Markenimage und Markenidentität und eine Verbindung von markenbezogenen Tätigkeiten, welche über die Grenzen von Funktion und Unternehmen hinaus geht (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 29). Das Selbstbild stellt die Perspektive der internen Anspruchsgruppen dar, das Fremdbild zeigt die Blickrichtung der externen. Vier konstitutive Merkmale kennzeichnen die Identität einer Marke und sind Voraussetzung für das Vertrauen, welches auf Kundentreue und -bindung ausgerichtet ist (vgl. Meffert/Burmann 2002a, 28; 2002b, 47; Meffert 1998, 812): erstens die Wechselseitigkeit, durch die die Markenidentität erst durch Abgrenzung zur Konkurrenz entsteht, zweitens, die Kontinuität im Markenmanagement, drittens, die Konsistenz in der Abstimmung der innen- und außengerichteten Maßnahmen zur Vermeidung von Widersprüchen und, viertens, die Individualität. Letztere bezeichnet die Einzigartigkeit einer Marke, welche vom Konsumenten wahrgenommen wird und zur Konkurrenzmarke differenziert (vgl. Meffert/Burmann 2002b, 45). Ähnlich den Überlegungen von Aaker/Joachimsthaler (vgl. 2001, 54) wird die Marken-identität aus Sicht der Produkt-, Personen-, Organisations- und Symbolperspektive betrachtet.
Meffert/Burmann betonen den Integrationsfaktor der identitätsorientierten Sichtweise, welcher die Inside-Out- mit der Outside-In-Perspektive aus den Ansätzen des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy verbindet und die Voraussetzung für ein erfolgreiches Markenmanagement darstellt (vgl. 2002b, 37-41). Die Wurzel der Marken-identität besteht im Generieren eines Kundennutzens aus Anbieterperspektive, welcher die besondere Kernkompetenz im Verständnis der Resource-Based-View of Strategy herausstellt und gleichzeitig als Fundament der Markenpositionierung dient (vgl. 2002b, 49-50).
An dieser Stelle folgt die Konkretisierung des Identitätsorientierten Markenmanagements im Hinblick auf den Mediensektor. „Das übergeordnete strategische Ziel des gesamten Medien-markenmanagements besteht nun darin, die Medienmarkenimages, welche die betreffenden Medienmarken bei der Werbewirtschaft sowie beim Publikum im Sinne von Akzeptanz-konzepten genießen, weitestmöglich an die gewünschte Medienmarkenidentität im Sinne des Aussagekonzepts des Medienunternehmens heranzuführen“ (Siegert et al. 2006, 47; vgl. Abb. 3). Die Umsetzung des Medienmarkenmanagements zeigt sich in erster Linie in den publizistischen Konzepten (vgl. 2006, 48). Mit diesem Begriff bezeichnen die Autoren alle inhaltlichen und formalen publizistischen Gestaltungsmerkmale sowie -prinzipien eines in regelmäßigen Abständen erscheinenden Medienproduktes, welches einen charakterisierenden Einfluss auf den publizistischen Auftritt des entsprechenden Mediums hat (vgl. 2006, 13). Im publizistischen Konzept sehen Siegert et al. das Verbindungsglied zwischen Aussagekonzept und Akzeptanzkonzept des Identitätsorientierten Medienmarkenmanagements, da es sich einerseits in dem Aussagekonzept der Medienmarkenidentität sehr dominant zeigt und, andererseits, das Medienmarkenimage durch Akzeptanz- und Erwartungskonzepte über-wiegend prägt. Publizistische Konzepte sind somit die entscheidenden Übermittler der wesentlichen Markeneigenschaften (vgl. 2006, 48-49). Das Senderimage z.B. ist entscheidend für die Priorität bei der Suche nach Sendungen, wobei die Sehentscheidungen jedoch anhand der konkreten Sendung getroffen werden. Somit wird durch das Image des Senders eine Vorentscheidung getroffen, während die Programme eines Senders wiederum einen starken Einfluss auf dessen Image haben (vgl. Karstens/Schütte 1999, 104).
2.1.6 Medienspezifische Besonderheiten
Beim Medienmarkenmanagement sind im Vergleich zum Markenmanagement Besonder-heiten zu berücksichtigen, die auf die Produkt- und Marktmerkmale sowie auf die Evolutionen des Medienmarktes zurückzuführen sind (vgl. Althans/Brüne 2002, 544-545; Caspar 2002b, 18-25).
Da sich Medienprodukte durch Gebrauch nicht abnutzen und leicht reproduzieren lassen, entsteht eine Nicht-Rivalität im Konsum, außerdem verursacht der öffentliche Zugang bei einigen Medien eine Nicht-Ausschließbarkeit (vgl. Wirtz 2006, 28; Sjurts 2005, 9; Kiefer 2001, 146). Die Tatsache, dass Medien meritorische Güter darstellen und externe Wirkungen wie bspw. die Beeinflussung der öffentlichen Meinung hervorrufen können, führt zu einer Einschränkung der Marktfähigkeit auf Seiten der Zuschauer, während diese Marktfähigkeit auf der Seite der Werbetreibenden erhalten bleibt (vgl. Sjurts 2005, 9).
Medienprodukte stellen Verbundprodukte dar und sind somit auf zwei Absatzmärkten, die von einander abhängig sind, aktiv (vgl. Wirtz 2006, 27-28; Kiefer 2001, 151, 154; Maier 2000, 62). Einerseits bieten Medien auf dem Rezipientenmarkt Informationen und Unter-haltung an und, andererseits, auf dem Werbemarkt Kontakte zu bestimmten Zielgruppen (vgl. Sjurts, 2005, 9; Baumgarth 2004b, 8; Picard 1989, 17-19). Die Werbekontakte entstehen aufgrund der Bindung des Publikums durch Schaffung von Aufmerksamkeitsanreizen (vgl. Caspar 2002b, 19). Allerdings trifft diese Marktkonstellation nicht auf alle Medienprodukte zu, da z.B. Buch-, Musik- oder Pay-TV-Produkte ihre Erlöse durch den direkten Verkauf an die Konsumenten erzielen und sich andere Medien nur anteilig über Werbung finanzieren, wie z.B. Zeitschriften (vgl. Schumann/Hess 2006, 36-37).
Die o.g. Produktzweigleisigkeit führt dazu, dass Medienunternehmen zwischen verschiedenen Erlösmodellen wählen können (vgl. Wirtz 2006, 70-74; Picard 1989, 17). Eine Möglichkeit besteht darin, das Produkt zur Erreichung hoher Reichweiten auf dem Rezipientenmarkt gratis anzubieten und auf dem Werbemarkt die Einnahmen zu erzielen. Diese Variante verfolgen private Rundfunkanbieter und einige Printmedien. Ein anderes Erlösmodell sieht Einnahmen auf Werbe- und Rezipientenmarkt vor, z.B. bei Zeitungen und Zeitschriften. Die Anzeigen-Auflagen-Spirale bezeichnet hierbei den Effekt, dass attraktive Inhalte zur Steigerung der Reichweite führen und diese wiederum viele Werbeeinnahmen generieren können. Dieser Effekt kann sich positiv aber auch negativ verstärken. (vgl. Kiefer 2001, 318-321). Durch die Erweiterung des Produktangebots in Form bspw. zusätzlicher Dienste, Merchandising-produkte, etc. können Medienorganisationen Verbundvorteile schaffen und das eigene Geschäftsfeld erweitern (vgl. Maier 2000, 62). Der Rechteverkauf bietet eine weitere Erlösquelle für Medienunternehmen, auch der Staat kann z.B. über Gebühren und Subventionspolitik eine Einnahmequelle darstellen, wobei in der Realität in der Regel ein branchentypischer Mix aus jenen vier Erlösformen anzutreffen ist (vgl. Wirtz 2006, 70-73; Neunzig 2004, 209).
Medienprodukte zeichnen sich durch hohe First-Copy-Costs aus, d.h. die Erstellung des ersten Exemplars verursacht hohe Fixkosten (vgl. o.V. 2004, 214-215). Im Vergleich dazu sind die Vervielfältigungskosten für die Produktion weiterer Exemplare gering, was bei steigender Auflage zu einer schnellen Fixkostendegression führt und dadurch zu einer Absenkung der durchschnittlichen Kosten für Medienprodukte. Zwischen den einzelnen Mediengattungen variiert die Struktur der variablen und fixen Kosten, z.B. sind die variablen Kosten im Printbereich aufgrund der Druck- und Vertriebskosten höher, wohingegen bei elektronischen Medien oder dem Internet die variablen Kosten sehr gering sind (vgl. Maier 2000, 63).
Eine weitere Besonderheit des Mediensektors sind die sogenannten Netzeffekte, die z.B. bei Online-Communities, Software-Produkten, CD- oder DVD-Systemen auftreten. Der Netz-effekt beschreibt das Phänomen, dass der Nutzen eines Gutes für den Verwender mit der Nutzung desselben Gutes durch andere Verwender steigt und umgekehrt (vgl. 2000, 64).
Baumgarth sieht eine besondere Problematik der Medienmarke aus der Mehrstufigkeit der Medienmärkte erwachsen. Die Wahl des Rezipienten werde meist durch die vorgelagerte Contentproduktion beeinflusst und weniger durch den Medienproduzenten selbst. So werde das TV-Programm weniger aufgrund der TV-Marke ausgewählt, als vielmehr wegen z.B. bestimmten Moderatoren oder Serien. Bei Buch oder Musik erfolge die Auswahl aufgrund des Autors oder Künstlers (vgl. 2004b, 8).
In der Literatur wird die Medienleistung meist als Dienstleistung betrachtet (vgl. Siegert 2001, 165, Schroeder 1994, 18). Dies geschieht aufgrund ihres hohen Anteils an Intangibilität und Immaterialität und aufgrund der Tatsache, dass sie teilweise den Konsumenten als externen Faktor integriert (vgl. Wirtz 2006, 29). Wenn man Güter nach dem Zeitpunkt der Qualitätsevaluation einteilt, so handelt es sich aus Rezipientensicht bei Medienprodukten um Erfahrungsgüter, da ihre Qualität erst nach der Rezeption beurteilt werden kann. Wenn die Qualität selbst im Nachhinein nicht erkennbar ist, handelt es sich sogar um Vertrauensgüter (vgl. Sjurts 2005, 10-11; Kiefer 2001, 150-151). Aus Perspektive der werbetreibenden Indus-trie können Medienprodukte als Inspektionsgüter betrachtet werden, da aufgrund von Reich-weitenerhebungen eine vorherige Qualitätsbeurteilung möglich ist (vgl. Sjurts 2005, 10-11).
Eine Besonderheit von Medienprodukten stellt die Tatsache dar, dass es sich um optische und inhaltliche Unikate handelt, weshalb eine gleichbleibende Qualität schwierig einzuhalten ist. Es entstehen Probleme dadurch, dass die Produkte leicht imitiert werden können, sie kaum Exklusivitätscharakter besitzen, die Markierung sich als schwierig erweist und eine zu große Inhaltsbreite vorliegt (vgl. Wirtz 2006, 97; Baumgarth 2004b, 6-7).
Auch der Konflikt zwischen, einerseits, publizistischer Arbeit, die sich u.a. in Aktualität, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit in der Berichterstattung zeigt, und, andererseits, dem ökonomischen Erfolg, der sich an Quoten, Auflagen, etc. bemisst, erschwert das Medienmarkenmanagement (vgl. Baumgarth 2004b, 8-9).
Wirtz beschreibt mit der Tatsache, dass besonders im Rundfunkbereich aufgrund der starken Regulierungen eine Markenbildung wenig Beachtung fand, ein Phänomen, das sich mit der Deregulierung änderte. Im Gegensatz dazu begannen Zeitungen und Zeitschriften schon früh mit einer Markenbildung, und auch im Internetsektor fand diese seit Beginn Berücksichtigung (vgl. 2006, 106, 445).
2.2 Markenmanagement
2.2.1 Markenpositionierung
Aufgrund der zunehmenden Preisorientierung der Konsumenten, des Wertewandels der Gesellschaft, des veränderten Konsumentenverhaltens, der Informationsüberlastung und der Tatsache, dass immer mehr Marken in den Markt drängen, kommt der Präferenzbildung bei den Konsumenten sowie der Differenzierungsfunktion gegenüber den Konkurrenten eine bedeutende Rolle zu (vgl. Meffert 1998, 788). In diesem Zusammenhang rückt die Marken-positionierung in den Fokus der Betrachtung (vgl. Mayer 1984, 251-256). Sowohl die Gestaltung ihrer Identität als auch die Positionierung einer Marke können von Unternehmens-seite bestimmt werden, um auf diese Weise das Fremdbild der Marke, das Markenimage, zu beeinflussen (vgl. Esch 2005, 136; Meffert/Burmann 2002b, 49; Myers 1996, 168-170). Ausgehend von der Markenidentität (vgl. 2.1.5) kann die Positionierung der Marke als „Extrakt der Markenidentität“ (Esch/Langner/Rempel 2005, 108) begriffen werden (vgl. 2005, 108). Die Positionierung stellt die Entscheidungsbasis der Markenführung dar (vgl. Baumgarth, 2004a, 116), deren Aufgabe darin besteht, einen übereinstimmenden ’Fit’ zwischen der Identität der Marke und der Markenführung sowie den Marketingmaßnahmen sicherzustellen, da andernfalls der Verlust von Kaufverhaltensrelevanz droht, welche sich in rückläufigen Marktanteilen zeigt (vgl. Esch/Langner/Rempel 2005, 107). Unternehmens-strategische Konzepte wie der relative Wettbewerbsvorteil, der komparative Konkurrenz-vorteil und ebenfalls der Ansatz der Unique Selling Proposition weisen Parallelen zur Positionierung auf (vgl. Baumgarth 2004a, 116; Backhaus 2003, 35-50).
Durch die Positionierung entsteht eine Differenzierung der eigenen Marke zu ihren Wettbewerbern (vgl. Esch 2005, 133), wobei der subjektive Wahrnehmungsraum des Ver-brauchers den relevanten Bezugsrahmen bildet (vgl. Esch 2007, 149; Kroeber-Riel/ Weinberg 2003, 221). Die Markenpositionierung hat die Aufgabe, durch Generierung von Inhalten und mentalen Mustern eine Präferenzbildung beim Konsumenten für eine bestimmte Marke hervorzurufen. Davon abzugrenzen ist die Markenposition, sie stellt das gespeicherte Wissen dar, das in den Köpfen der Konsumenten über eine Marke vorherrscht (vgl. Esch 2005, 134). In der Literatur werden die Verbraucherrelevanz, Konzentration auf wenige Merkmale, Abgrenzung zum Wettbewerber, keine kurzfristige Imitierbarkeit, Glaubwürdig-keit, Zukunftsorientierung, Flexibilität, Kontinuität und Operationalisierbarkeit als Kriterien für eine erfolgreiche Positionierung genannt (vgl. Bruhn 2005, 101-102; Myers 1996, 171-174).
Das Kriterium der Relevanz für den Verbraucher macht eine vorgeschaltete Segmentierung der Zielgruppe unabdingbar. Die potenziellen Käufer werden nach verhaltensorientierten, psychographischen, sozio-demographischen und geographischen Kriterien eingeteilt (vgl. Meffert 2000, 188).
Um die Position der Marke zu bestimmen wird sie in einem zwei- oder mehrdimensionalen, aus der Konsumentenperspektive betrachteten, Positionierungsmodell abgebildet, welches die Imagedimensionen von Marke und Konkurrenzmarke in Beziehung zu dem oder den Ideal-punkten der relevanten Verbrauchergruppen setzt (vgl. Trommsdorff 2004, 169-170; Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 222-224), um die optimale Position für die Marke abzuleiten (vgl. Brockhoff 1993, 134-137). Meffert betont, dass eine Positionierung nach den objektiv-technischen Produkteigenschaften in der heutigen Zeit nicht mehr zu differenzieren vermag, und auch die Tatsache, dass viele konkurrierende Produkte sich dem Idealpunkt einer Marke annähern, erschwere die Positionierung. Um eine neue Markenposition aufzubauen bieten sich die Besetzung der strategischen Nische, das Einbeziehen neuer Eigenschaftsdimensionen (USPs) oder die Erzeugung eines psychologischen Zusatznutzens an (vgl. 1998, 788-790).
Es gibt zwei Alternativen bei der Positionierung: Die Positionierung richtet sich nach dem Produkt, oder das Produkt richtet sich nach der Positionierung, wobei letztere Alternative für gesättigte Märkte besser geeignet zu sein scheint (vgl. Esch 2005, 136-137).
Durch die Festlegung der Positionierungsziele wird bestimmt, welche Position die Marke für den Verbraucher einnehmen soll (vgl. 2005, 143), wobei das Involvement der relevanten Konsumentengruppe den entscheidenden Faktor für die Zuwendung des Verbrauchers zu einer Leistung darstellt (vgl. Kroeber-Riel/Esch 2004, 72-74). Unterschieden werden kognitives und emotionales Involvement. Je nach Ausprägungsgrad empfiehlt sich eine gemischte, erlebnisorientierte oder sachorientierte Positionierung oder eine Förderung der Bekanntheit. Das Engagement des Verbrauchers ist bei geringem Involvement eher passiv und bei hohem eher aktiv (vgl. Esch 2005, 138-139).
Neben diesem Ansatz führt Baumgarth (vgl. 2004a, 120) ebenfalls die Preislagen-Positionierung und die konkrete Positionierung unter dem Begriff des materiellen Positionierungsansatzes auf.
Je nach Kongruenz zwischen Marke und Idealpunkt aus Konsumentensicht, ist eine der drei im Folgenden beschriebenen fundamentalen Positionierungsstrategien zu wählen. Das Ziel ist eine Annäherung der Marke an die Idealvorstellungen der Konsumenten. Bei hoher Überein-stimmung zwischen Marke und Idealpunkt sowie bei geringer Konkurrenz im relevanten Segment empfiehlt sich eine Beibehaltung der Position. Befinden sich einige Konkurrenz-marken in der Umgebung des Idealpunktes oder ist die Marke weit entfernt von demselben, so bietet sich die Umpositionierung an. Für neue Marken oder solche mit erheblichen Problemen stellt eine Neupositionierung der Marke die beste Strategie dar (vgl. Esch 2005, 145-147; Haedrich/Tomczak 1996, 105-108).
Einen weiteren strukturellen Positionierungsansatz stellt der wettbewerbsorientierte Ansatz dar. Unterschieden werden hierbei die Differenzierungs- und die Imitationsstrategie (vgl. Baumgarth 2004a, 121). Keller (vgl. 2005, 87-89) bezeichnet mit dem Begriff ‘Points-
of-Difference‘ Positionierungsdimensionen, die eine Differenzierung gegenüber den Konkurrenzmarken anstreben, und dem Konzept ‘Points-of-Parity‘ Imagedimensionen, welche die gleiche Ausprägung anstreben wie die Marken der Konkurrenz. Tomczak/
Roosdorp (vgl. 1996, 29-33) empfehlen für die Differenzierungsstrategie eine Betrachtung der Inside-Out-Perspektive, d.h. die Analyse unternehmensspezifischer Ressourcen, und der Outside-In-Perspektive, welche von den Bedürfniswünschen der Konsumenten ausgeht. Bei einem sehr großen Zielsegment kann die Imitationsstrategie die richtige Wahl darstellen, dabei strebt die Marke die Position an, die eine Konkurrenzmarke bereits inne hat (vgl. Baumgarth 2004a, 121).
2.2.2 Markenschutz
Der rechtliche Schutz der Marke stellt einen wichtigen Schritt im Rahmen des Markenmanagements dar. In Deutschland bietet das seit 1995 geltende Markengesetz laut §3 Abs. 1 rechtliche Schutzmöglichkeiten für „[…] Zeichen, insbesondere Wörter einschließ-lich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen […]“ (vgl. o.V. 2007). Um die Marke rechtlich zu schützen, gibt es drei Möglichkeiten: Man kann die Marke in das Register des Patentamtes eintragen lassen, man kann durch Benutzung der Marke bei mindestens 30% Bekanntheitsgrad Verkehrsgeltung (vgl. Baumgarth 2004a, 2; Giefers/May 2003, 35-36) erzielen oder durch notorische Bekanntheit (vgl. Baumgarth 2004a, 2; Giefers/May 2003, 35-36) der Marke, bei mindestens 60%, gemäß §4 MarkenG Markenschutz erwirken (vgl. o.V. 2007). Eine Markenregistrierung muss nach 10 Jahren verlängert werden, während der Schutz bei Verkehrsgeltung oder notorischer Bekanntheit erlischt, wenn der Bekanntheitsgrad unter bestimmte Grenzen sinkt (vgl. Berlit 1997, 197; Schröder 2005, 375; Giefers/May 2003, 35-36). Die relevanten Schutzrechte des Markengesetzes sind das Patentgesetz, das Markengesetz, das Gebrauchsmusterschutzgesetz und das Geschmacksmusterschutzgesetz (vgl. Baumgarth 2004a, 19).
Auf nationaler Ebene beinhalten neben dem Markengesetz (MarkenG) auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Handels-gesetzbuch (HGB) Regelungen zum Schutz der Kennzeichnung. Auf internationaler Ebene bieten das Madrider Markenabkommen (MMA), das Protokoll zum Madrider Marken-abkommen (PMMA), die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums (PVÜ) sowie die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GemMVO) Möglichkeiten für den rechtlichen Markenschutz, wobei auch entsprechende nationale Regelungen zu berücksichtigen sind (vgl. Schröder 2005, 355).
Bei einem Markenschutz über Deutschlands Grenzen hinaus kann die Marke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung von 1994 (GemMVO) in Alicante (Spanien) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen werden und erhält auf diese Weise einen einheitlichen Schutz in allen EU-Ländern (vgl. Sattler 2001, 48). Das Protokoll des Madrider Markenabkommens regelt den internationalen Markenschutz bei Nicht-Mitgliedsstaaten (vgl. 2001, 50).
Zu unterscheiden sind absolute und relative Schutzhindernisse. Absolute Schutzhindernisse begrenzen den Markenschutz im Bezug auf den Eintrag der Marke in das Register. Eine Marke muss deshalb verschiedene Kriterien erfüllen, um schutzfähig zu sein, z.B. muss die Marke eigenständig sein, Unterscheidungskraft besitzen, und es darf kein Freihaltebedürfnis vorliegen (vgl. Schröder 2005, 358; Berlit 1997, 32-57).
Bei relativen Eintragungshindernissen ist der Markenrechtsinhaber verpflichtet, durch Wider-spruchsverfahren oder Nichtigkeitsklagen die Geltung seiner Marke zu erwirken. Relative Schutzhindernisse entstehen gemäß §9 MarkenG aufgrund des Prioritätsvorranges älterer bestehender Marken (vgl. o.V. 2007; Berlit 1997, 58-96). Weitere relative Schutzhindernisse betreffen den Benutzungszwang, den zulässigen Drittgebrauch und die Verwechslungsgefahr.
Es besteht gemäß §27 MarkenG die Möglichkeit, Markenrechte weiter zu verwerten oder sie zu verkaufen (vgl. o.V. 2007). Im Rahmen der Weiterverwertung kann der Lizenznehmer gegen Entgelt ein Nutzungsrecht der Marke erkaufen, um seine Leistung damit zu markieren. Schwierigkeiten treten auf bei Verletzung der Lizenzverträge (vgl. Sattler 2001, 60).
Bei Markenrechtsverletzungen besteht laut §14 Abs. 6, 7 und §15 Abs. 5, 6 MarkenG ein Schadensersatzanspruch (vgl. o.V. 2007). Markenaufbau und -pflege sind kostspielig, wes-halb Gefahren wie bspw. die Benutzung der gleichen Marke durch Dritte oder Produkt-piraterie einen effektiven Markenschutz unverzichtbar machen (vgl. Schröder 2005, 353-355).
Aufgrund des Prioritätsrechts älterer Marken kann im Kollisionsfall die Folge eine Eliminierung der jüngeren Marke sein. Wenn eine eingetragene Marke nicht innerhalb von fünf Jahren benutzt wird, so erlischt gemäß §26 MarkenG ihr Schutz (vgl. o.V. 2007). Inhaber von geschützten Marken besitzen Ausschließlichkeitsrechte und können gemäß §24 MarkenG dadurch Dritten die Benutzung der Marke untersagen (vgl. o.V. 2007; Schröder 2005, 361).
2.2.3 Markenstrategien
Die Wahl des Markentyps bzw. der Markenstrategie stellt eine strategische Grundsatz-entscheidung für die durchgängige Führung der Marke dar (vgl. Becker 2005, 383; Haedrich/Tomczak 1990, 29). In der Literatur werden meist Einzelmarken-, Dachmarken- und Markenfamilienstrategie als Grundsatzstrategien unterschieden (vgl. Becker 2005, 385-394; Kapferer 1992, 157-179). Meffert unterscheidet die Markenstrategien nach vertikalem, internationalem und horizontalem Wettbewerb und ordnet dem horizontalen Wettbewerb noch die Markentransfer- und die Mehrmarkenstrategie zu. Im vertikalen Wettbewerb sieht er die Unterscheidung zwischen Hersteller- und Handelsmarkenstrategie. Die internationalen Strategien unterscheidet er nach dem Grad der Internationalisierung (vgl. 1998, 792). Im Hinblick auf die Ausrichtung dieser Arbeit sollen im Folgenden die Markenstrategien des horizontalen und des internationalen Wettbewerbs näher betrachtet werden, da diese Strategien auch für den Medienbereich von Bedeutung sind.
Bei der Einzelmarkenstrategie wird für jede Marke eine eigenständige Markenpersönlichkeit aufgebaut, die optimal auf die Bedürfnisse der Konsumenten ausgerichtet ist (vgl. Meffert 1998, 793). Diese Strategie empfiehlt sich für Unternehmungen mit heterogenem Produkt-profil (vgl. Becker 2005, 386-387). Unter der Prämisse eines ausreichend großen Marktsegments und der erfolgreichen Durchsetzung der Marke lassen sich Kosten-degressionseffekte erzielen. Durch den Aufbau eines unabhängigen Markenimages können negative Ausstrahlungseffekte auf andere Marken des Hauses nahezu ausgeschlossen werden. Die Einzelmarkenstrategie ist mit einem geringeren Koordinationsaufwand der Marketing-maßnahmen verbunden, da Abstimmungsprozesse mit anderen Marken entfallen, und sie bietet die Möglichkeit, das Innovationspotenzial der Marke besser herauszustellen (vgl. Becker 2006, 195-205; Meffert 1998, 793-794). Die Probleme der Einzelmarkenstrategie liegen in den steigenden Marketingaufwendungen und -kosten, die von einer Marke allein bewältigt werden müssen, außerdem in der Informationsüberlastung der Konsumenten, in der hohen Wettbewerbsintensität sowie in den schwierig zu realisierenden Leistungsvorteilen bei einer Vielzahl von Einzelmarken begründet (vgl. Becker 2006, 195-205; Meffert 1998, 793-794). Eine weitere Gefahr geht von einem Strukturwandel der Märkte aus, durch welchen das Überleben der Einzelmarke gefährdet sein kann (vgl. Becker 2006, 195-197).
Bei der Dachmarkenstrategie werden alle Produkte oder Dienstleistungen unter einer iden-tischen Marke offeriert, welche in der Literatur auch unter dem Synonym der Unternehmens- bzw. Companymarke oder dem Begriff des Corporate Brand diskutiert wird (vgl. Becker 2006, 195-205; Esch et al. 2005a, 405). Bei umfangreichem Produktprogramm, mangelnder Differenzierung in der Positionierung oder in der Zielgruppe sowie extremen Trend-schwankungen bietet sich die Wahl der Dachmarkenstrategie an (vgl. Becker 2005, 391). Dieser Markentyp weist ökonomische Vorteile auf, wobei der wesentliche Nachteil in der mangelnden Profilierungsmöglichkeit liegt (vgl. 2005, 392). Zur Reduktion der negativen Ausstrahlungseffekte auf das gesamte Unternehmen werden häufig Markenstrategien kombiniert, z.B. Dachmarken- mit Einzelmarken- oder Familienmarkenstrategie (vgl. Meffert 1998, 800). Die jeweiligen Branchenbedingungen sind für die Wahl einer Markenstrategie zu berücksichtigen (vgl. Becker 2005, 388).
In der Literatur ist der Begriff des Markentransfers uneinheitlich definiert, häufig werden auch die Bezeichnungen Markenausdehnung oder Markenerweiterung verwendet (vgl. Esch et al. 2005b, 907; Baumgarth 2004a, 142; Caspar 2002a, 235; Meffert 1998, 800). Inhaltlich geht es um die Nutzung des Images einer bereits etablierten Marke für ein neues Produkt oder eine neue Leistung (vgl. Meffert 1998, 800; Hätty 1994, 562; Aaker 1991, 208-209). Zwei Hauptausprägungen lassen sich voneinander abgrenzen. Einerseits die Produktlinien-erweiterung, welche die Verwendung der Marke innerhalb der gleichen Produktkategorie beschreibt und auch als Line-Extension bezeichnet wird (vgl. Esch et al. 2005b, 907; Caspar 2002a, 235), und, andererseits, der Markentransfer, welcher auch als Brand-Extension oder Markenerweiterung diskutiert wird. Er beschreibt die Verwendung des Markennamens für ein Produkt oder eine Leistung eines neuen Produktbereiches (vgl. Esch 2007, 351; Caspar 2002a, 235). Die Lizensierung, das Co- und das Sub-Branding sind eine abgewandelte Form des Markentransfers (vgl. Baumgarth 2004a, 143). Die Gründe, welche für einen Marken-transfer sprechen, liegen u.a. in dem reduzierten Flop-Risiko, der Verringerung der Kosten für die Markenbildung, dem Vertrauen der Abnehmer in die Ursprungsmarke und in der Stärkung derselben. Diesen Vorteilen stehen eine Reihe von Nachteilen gegenüber, wie bspw. die Kannibalisierungsgefahr, der Rückgang der Markenstärke oder eine nur geringe Akzeptanz der transferierten Marke (vgl. Esch 2007, 353-354; Keller 2003, 581-582; Caspar 2002a, 237; Hätty 1994, 578-579). Der Erfolg der Markenerweiterung und der Lizensierung hängt von einigen Grundbedingungen ab, so stellt bspw. ein hoher ’Fit’ zwischen Ursprungsmarke und Transferprodukt eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dar, auch starke Ursprungsmarken können ein wichtiger Erfolgsfaktor sein (vgl. Keller 2003, 608-609; Völckner 2003, 260; Caspar 2002a, 257; Tauber 1988, 29-30).
Markenfamilienstrategien werden verwendet, wenn mehrere ähnliche Produkte unter einer Marke geführt werden und kein Bezug zu dem Unternehmensnamen besteht (vgl. Meffert 1998, 795). In der Unternehmung können mehrere Familien nebeneinander bestehen, entweder im selben Produktfeld oder auch in verschiedenen (vgl. 1998, 795). Die Produkte einer Familie partizipieren gegenseitig an ihrem Gruppenimage (vgl. Becker 2005, 388), wobei die einzelnen Produkte in den jeweiligen Teilmärkten eine eigenständige Markenper-sönlichkeit inne haben dürfen, jedoch das gleiche Nutzenversprechen der Gruppe befriedigen müssen (vgl. o.V. 1996, 66-68). Diese Strategie kombiniert die Vorzüge der Einzelmarken-strategie, vor allem die Profilierungsstärke, mit dem ökonomischen Vorteil der Dachmarken-strategie und umgeht eine starke Ausprägung der Nachteile beider Strategien (vgl. Becker 2005, 388-389), wobei ein mangelndes Zusammenpassen der Produkte oder der Qualität sowie ein unterschiedliches Image die Gefahr von negativen Ausstrahlungseffekten auf die Familie bergen (vgl. Meffert 1998, 797). Empfehlenswert ist diese Strategie, wenn Produktlinien aus heterogenen Sortimenten entstehen, wobei eine starke „Pioniermarke“ (Becker 2005, 389) die Grundvoraussetzung für die Markenfamilienstrategie bildet (vgl. 2005, 388-389).
Von einer Mehrmarkenstrategie spricht man, wenn es sich um eine gleichzeitige Führung von mindestens zwei Marken pro Produktbereich handelt, welche meist auf den Gesamtmarkt ausgerichtet sind (vgl. Meffert 2002, 139). Der Vorteil liegt in einer verbesserten Absicherung der Marktposition (vgl. Baumgarth 2004a, 135; Meffert/Perrey 2002, 211), wohingegen die Zersplitterung finanzieller sowie personeller Unternehmensressourcen und das Risiko der Kannibalisierung dagegen sprechen (vgl. Meffert/Perrey 2005, 822; Meffert 1998, 794-795).
Bei den Markenstrategien im internationalen Wettbewerb unterscheidet Meffert (vgl. 1998, 808-811) zwischen den multinationalen Markenstrategien, welche an die länderspezifischen Bedürfnisse und Besonderheiten optimal angepasst werden, und den globalen Marken-strategien, welche eine weltweite, identische Markierung, Qualität, Positionierung, etc. anstreben. Letztere bieten Vorteile in Bezug auf eine einheitliche Markenidentität, des Weiteren lassen sich Lern- und Know-How-Effekte nutzen. Die Nachteile ergeben sich vor allem dadurch, dass lukrative Nischen und länderspezifische Besonderheiten vernachlässigt werden. Meist verfolgen die Unternehmen auf internationalen Märkten somit eine gemischte Markenstrategie.
2.2.4 Brandingelemente der Marke
Das Branding fördert den Markenaufbau, wobei der Begriff in der Literatur unterschiedlich definiert wird (vgl. de Chernatony/McDonald 1998, 16; Gotta 1994, 775-776; Murphy 1990, 4). In der vorliegenden Arbeit soll der Definition von Esch und Langner gefolgt werden, die „[…] unter Branding alle Maßnahmen verstehen, die dazu geeignet sind, ein Produkt aus der Masse gleichartiger Produkte herauszuheben und die eine eindeutige Zuordnung von Produkten zu einer bestimmten Marke ermöglichen“ (2005a, 577). Die Markenzeichen können unterschieden werden nach optischen, akustischen, olfaktorischen, gustatorischen und taktilen Markenzeichen (vgl. Irmscher 1997, 19). Teilelemente des Brandings sind z.B. Markenname, Logo, Symbol, Slogan, Jingle oder Verpackung und Design (vgl. Keller 2005, 89; Baumgarth 2004a, 160).
Der Markenname dient dem Transport von Mitteilungen und Inhalten und unterstützt die Positionierung der Marke in den Köpfen der Konsumenten (vgl. Gotta 1994, 778). Des Weiteren können Namen dahingehend unterschieden werden, wie stark ihr Bezug zum Angebot bzw. wie hoch der Bedeutungsgehalt des Markennamens ist (vgl. Baumgarth 2004a, 161). Andere Ordnungsprinzipien gliedern Markennamen in die Kategorien deskriptiv, assoziativ, artifiziell und verbraucht (vgl. Gotta 1994, 780-782; Latour 1996, 94-96). Obwohl deskriptive Namen (z.B. ‘Kinderschokolade‘) den Vorteil inne haben, schnell Assoziationen aufzubauen, so sind sie ungeeignet zur Internationalisierung, eignen sich nur bedingt für den Markentransfer (vgl. Baumgarth 2004a, 162-163) und unterstützen nicht die Entwicklung der Markenpersönlichkeit (vgl. Gotta 1994, 780). Assoziative Markennamen (z.B. das Parfum ‘Opium‘) bieten den Vorteil, dass sie auf bereits Erlerntes zurückgreifen, jedoch sind sie wenig eigenständig und können nachgeahmt werden (vgl. 1994, 781). Artifizielle Namen (z.B. der Renault ‘Clio‘) haben den Vorteil, dass sie sich leicht schützen lassen und nach Belieben aufgeladen werden können. Sie sind eigenständig und unverwechselbar. Verbrauchte Markennamen (z.B. ‘Royal‘ für Premiumprodukte) hingegen sind beliebt bei Verbrauchern, da sie eine starke Aussagekraft besitzen, jedoch können sie nicht differenzieren (vgl. 1994, 782).
In der Literatur werden Phasenmodelle zur Namensfindung vorgeschlagen, die von der Bedarfsanalyse bis zur rechtlichen Absicherung führen (vgl. Kircher 2005, 593; Keller 2003, 190; Kohli/LaBahn/Thakor 2001, 456-472; Gotta 1994, 783-785; Herstatt 1994, 759-770). Kircher (vgl. 2005, 589-593) führt als Merkmale eines erfolgreichen Markennamens Eigenständigkeit, Seriosität und Merkfähigkeit auf, und als Anforderungen nennt sie juristische Schutzfähigkeit, sprachlich-kulturelle Eignung und Positionierungsadäquanz.
Beim Logo handelt es sich um ein visuelles Brandingelement (vgl. Esch/Langner 2005b, 605). Sein Vorteil liegt in der Bildhaftigkeit, die von uns Menschen leichter im Gedächtnis abgespeichert werden kann (vgl. Madigan 1983, 68-69) und weshalb eine gemeinsame Darstellung von Markenlogo und -name gefordert wird (vgl. Esch/Langner 2005b, 607-608). Damit das Logo zur Entwicklung der Markenbekanntheit beiträgt und imagefördernd wirkt, muss die Gestaltung des Logos Aufmerksamkeit erzeugen, gut erinnert werden und auf die Positionierung harmonisiert sein (vgl. 2005b, 606-607). „Um den Markenwert zu steigern, sollten Markenlogos, erstens, Aufmerksamkeit erregen, d.h. aktivieren, zweitens, Gefallen erzielen, drittens, positionierungsrelevante Assoziationen kommunizieren und, viertens, leicht wahrnehmbar und erinnerbar sein“ (2005b, 607). Dabei sollten konkrete Logos vorgezogen werden, da sie besser im Gedächtnis gespeichert werden können (vgl. Esch 2007, 226; Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 354; Madigan 1983, 68-69). Auch die Wahl der verwendeten Farbe kann einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Eigenschaften des Produktes haben (vgl. Esch 2007, 245; Esch/Langner 2005b, 613-618).
Als Informationsträger für emotionale oder beschreibende Inhalte bietet sich der Slogan bzw. Claim als weiteres Brandingelement an. Er besteht aus Phrasen (vgl. Baumgarth 2004a, 170) und kann die Wiedererkennung der Marke und die Markenbekanntheit fördern sowie die Positionierung unterstützen (vgl. Keller 2003, 204-209). Jingles sind auditive Branding-elemente, welche den Slogan meist musikalisch unterstützen und direkt oder indirekt eingesetzt werden, wobei indirekte Jingles wenig unterscheidbar sind und deshalb lediglich der emotionalen Aufladung dienen (vgl. Linxweiler 1999, 203-204).
Auch die Verpackung und das Produktdesign stellen Brandingelemente dar, welche neben der Nutzenfunktion, wie z.B. Schutz der Ware beim Transport (vgl. Seidler 1994, 835-836), wei-tere Funktionen, z.B. die Wiedererkennung, erfüllen können (vgl. Baumgarth 2004a, 171).
Alle Brandingmaßnahmen müssen in der Art auf einander abgestimmt werden, dass ein kongruentes Markenimage vermittelt und der Markenwert gesteigert werden kann (vgl. Esch/Langner 2005b, 614).
2.2.5 Markenanreicherung
Das Image einer Marke kann durch einige ergänzende Objekte gefestigt oder umgestaltet werden (vgl. Baumgarth 2004a, 177). Die Ziele einer Markenanreicherung sind die Förderung der Bekanntheit, die Unterstützung der Glaubwürdigkeit, die Umpositionierung und die Steigerung der Kaufabsicht (vgl. Rossiter/Percy 1997, 263). Gefahren bestehen darin, dass die Ergänzung von der Marke ablenkt (vgl. Kroeber-Riel/Weinberg 2003, 99; Felser 2001, 311), dass der Markenkern verwässert wird und dass keine vollständige Markenkontrolle mehr besteht (vgl. Baumgarth 2004a, 177). Als verschiedene Möglichkeiten der Anreicherung werden in der Literatur z.B. das Co-Branding, die Testimonials, die Lizensierung oder Sponsorings angeführt (vgl. Keller 2005, 91; Baumgarth 2004a, 176).
Beim Co-Branding werden für die Markierung eines Produktes oder einer Leistung zwei oder mehrere rechtlich selbstständige Marken gleichzeitig verwendet (vgl. Aaker/Joachimsthaler 2001, 151). Ein Beispiel hierfür ist das Co-Branding der Marken ‘RITTER Sport‘ und ‘Smarties‘. In der Literatur wird das Co-Branding ebenfalls unter dem Begriff der Markenallianzen diskutiert (vgl. Esch/Redler/Winter 2005, 483). Es lassen sich verschiedene Ausprägungen unterscheiden, bspw. nach der Anzahl der Marken, nach vertikaler, horizontaler oder lateraler, interner oder externer Zusammenarbeit. (vgl. 2005, 484-486; Baumgarth 2004a, 179). Durch die unterschiedlichen Kompetenzen der Marken sollen die Produkte besser profiliert sowie der Bekanntheitsgrad gesteigert werden, ein Imagetransfer stattfinden (vgl. Esch/Redler/Winter 2005, 483-484) sowie Markteintrittsbarrieren und Kosten für den Aufbau neuer Marken reduziert und zusätzliche Nutzen für den Abnehmer erzeugt werden (vgl. Baumgarth 2004a, 180; Keller 2003, 361; Boad 1999, 22-37). Den Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber, wie bspw. die veränderte Positionierung der Partnermarke in der Allianzphase, der Verlust von Exklusivität und Schwierigkeiten bei der Aufhebung der Kooperation (vgl. Boad 1999, 22-37). Um Markenallianzen bzw. Co-Brandings erfolgreich umzusetzen, werden in der Literatur eine Reihe von Voraussetzungen beschrieben, z.B. sollten die Marken zusammenpassen, sich in ihren Kompetenzen ergänzen, positive Ausstrahlungseffekte haben (vgl. Park/Jun/Shocker 1996, 464-465) oder eine Überschneidung der Zielgruppen aufweisen. Dabei ist ein globaler ’Fit’ von Marke und Produkt sowie das Gefallen der Werbung wünschenswert (vgl. Baumgarth 2004a, 182; Simonin/Ruth 1998, 39), wobei Esch (vgl. 2007, 409) einen mittleren Produkt-‘Fit‘ als ideal ansieht.
Bei Testimonials handelt es sich um prominente Personen, welche die Produkte in der Werbung mit dem Ziel empfehlen, durch ihr eigenes Image die Markenwahrnehmung positiv zu beeinflussen, eine stärkere Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Positionierung durch Beweise zu verstärken (vgl. Haase 2000, 56). Erfolgversprechend ist der Einsatz von Testimonials, wenn sie glaubwürdig sind (vgl. Baumgarth 2004a, 184), nur für wenige Marken werben (vgl. Tripp/Jensen/Carlson 1994, 543-545), keine negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit verursachen (vgl. Till/Shimp 1998, 79-81), attraktiv sind und zu der Marke passen (vgl. Baumgarth 2004a, 185). Als Beispiel hierfür lässt sich ‘Heidi Klum‘ anführen, die für ‘McDonalds‘ eine neue Salatproduktlinie beworben hat.
Ein weiteres Thema, das unter dem Begriff Markenallianzen diskutiert wird, betrifft die Lizensierung (vgl. Boad 1999, 22-37). Dabei gestattet ein Markeninhaber einem anderen Unternehmen die Nutzung der Marke für die Markierung seiner Produkte (vgl. Binder 2005, 525). Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung des ‘JOOP!‘-Logos durch Brillenhersteller. Die Lizenzvergabe wird als Auslagerung der Wertschöpfungsaktivitäten an externe Unternehmen verstanden und kann als Markenerweiterung angesehen werden (vgl. 2.2.3), wobei sich die Grundsatzfrage stellt, ob man bei einer Markenerweiterung selbst produziert oder die Leistung einkauft (vgl. 2005, 527-528). Bei der Lizenzvergabe handelt es sich um eine ‘buy‘-Entscheidung, die unter bestimmten Umständen erfolgversprechend sein kann, z.B. wenn hohe Eintrittsbarrieren bestehen oder bei fehlendem Know-How oder Kundenzugang (vgl. 2005, 528). Binder betont, dass beide Seiten von der Lizenzvergabe profitieren, der Lizenznehmer kann sich auf das Image der Lizenzmarke stützen und reduziert sein Risiko und seine Kosten und kann höhere Preise erzielen. Der Lizenzgeber kann durch die Lizenzvergabe die Markenloyalität, den Bekanntheitsgrad, die Kompetenz und das Image seiner Marke fördern und erzielt zusätzlich Zugang zu neuen Distributionskanälen sowie Lizenzeinnahmen (vgl. 2005, 529-531). Einen weiteren Vorteil bietet die Lizensierung dadurch, dass durch Verwendung und Inskription in weitere Warenklassen der Markenschutz gesteigert wird (vgl. 2005, 532). Obwohl die Erfolgsrate bei der Lizensierung größer ist als bei der Markenerweiterung, trägt die Lizensierung nicht zur Steigerung des Markenwertes bei und bedarf eines erheblichen koordinatorischen Aufwandes (vgl. 2005, 532-534, 547).
Unter Sponsoring soll „[…] die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten verstanden werden, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen im sportlichen, kulturellen und/oder sozialen Bereich verbunden sind, und um damit gleichzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen“ (Bruhn 2003, 3-6). Als wesentliche Ausprägungen werden in der Literatur Sport-, Kultur-, Umwelt-, Sozial- und Programmsponsoring genannt (vgl. Baumgarth 2004a, 186; Bruhn 1994b, 1132-1133). Sponsoring kann einen entscheidenden Anteil zur Profilierung der Marke im Wettbewerb beitragen sowie bei Auswahl des passendenden Sponsorenbereichs dabei helfen, die Markenpersönlichkeit aufzubauen (vgl. Bruhn 1994b, 1134). Diese Vorteile sind dann gegeben, wenn nur wenige Förderpartner gleichzeitig auftreten und wenn die Marke einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt, da unbekannte Marken nicht erkannt werden können (vgl. Baumgarth 2004a, 187).
2.2.6 Umsetzung und Implementierung der Marke
2.2.6.1 Marketing-Mix
Vor dem Hintergrund der Umsetzung und Implementierung einer Marke haben die Marketinginstrumente und die Personalpolitik einen wichtigen Einfluss auf die Markenführung (vgl. Baumgarth 2004a, 193).
Die Marketinginstrumente der Preis-, Leistungs-, Distributions- und Kommunikationspolitik sollten in der Art aufeinander abgestimmt werden, dass sie die Markenpersönlichkeit optimal unterstützen (vgl. 2004a, 193-194). Die Analyse der Position der Marke in ihrem Lebenszyklus hat Konsequenzen für den Marketing-Mix, denn jene Analyse kann „[…] zur Fundierung strategischer Grundsatzentscheidungen verwendet werden […]“ (Meffert 1998, 333). Die Schwierigkeit des Marketings besteht nach Baumgarth darin, die bestmögliche Auswahl und Abstimmung der Instrumente zu finden, da diese unterschiedlich geeignet sind, die Ziele der Marke zu unterstützen, z.B. lässt sich eine intensive Distribution nicht mit einer Premiummarkenpositionierung vereinbaren, wohingegen die Hochpreisstrategie sehr gut diese Positionierung unterstützt. Als Auswahlhilfe für Kriterien wie bspw. dem Potential zur Erreichung von Marken-, Zielgruppe- oder Positionierungszielen sind heuristische Verfahren geeignet, wobei es ebenfalls analytische Verfahren gibt, welche jedoch keine Bestimmung der Instrumente erlauben (vgl. 2004a, 202).
Baumgarth sieht die Inhalte der Leistungspolitik als Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Sachleistungen, Zusatzleistungen und in Bezug auf das Programm. Mit den Zusatzleistungen z.B. sind produktergänzende Services gemeint, die der Anbieter zur Absatzförderung vor, während und nach dem Kauf offeriert. In ihrem Mix unterstützen die leistungspolitischen Instrumente den Imageaufbau und die Positionierung einer Marke (vgl. 2004a, 196-197).
Zu den preispolitischen Instrumenten zählt Baumgarth die Preisfestlegung, die Preisvariation und die Preisdurchsetzung. Entscheidungen im Sinne der Preisfestlegung beeinflussen u.a. Markenimage und Zielgruppenbreite. Mit der Preisvariation ist die Veränderung der Preispolitik im Zeitablauf gemeint. Entweder kann man eine Marke hochpreisig ‘launchen‘ und später den Preis nach unten anpassen (Skimming-Strategie) oder niedrigpreisig in den Markt eindringen, um im Zeitverlauf den Preis nach oben zu korrigieren (Penetrations-Strategie). Des Weiteren kann der Preis im Rahmen von Zeitrabatten und Sonderangeboten variiert werden. Das Instrument der Preisdurchsetzung beinhaltet die Faktoren der Preisbindung und der unverbindlichen Preisempfehlung (vgl. 2004a, 200-202).
Bei der Distributionspolitik hebt Baumgarth im Wesentlichen zwei Gestaltungsparameter hervor: die physische und die akquisitorische Distribution. Mit dem ersteren Parameter sind Entscheidungen über Absatzwegesystem und Logistik überschrieben, während sich die akquisitorische Dimension mit Fragen des Absatzkanalimages, der Markenkommunikation am Point of Sale (PoS), der Preisgestaltung und der Servicebereitstellung auseinandersetzt. Im Rahmen des indirekten Vertriebs werden mit dem Druck- und Sog-Prinzip zwei idealtypische Formen der Angebot- und Nachfragepolitik diskutiert (vgl. 2004a, 198-200).
Eine eminent wichtige Bedeutung kommt der Kommunikationspolitik zu (vgl. 2004a, 193-194), da sie die Bekanntheit der Marke und die Positionierung fördert sowie durch klassische Kommunikation, d.h. massenmediale Präsenz, schnell einen Markenwert aufzubauen vermag (vgl. Rossiter/Percy 2005, 633). Die klassische Kommunikation durch z.B. Anzeigen, Broschüren, TV-Spots, etc. ist von der nicht-klassischen Kommunikation, z.B. Event, Sponsoring, etc., abzugrenzen, wobei sich letztere zur Steuerung von Imagekomponenten besser in bestimmten Zielgruppen einsetzen lässt (vgl. Baumgarth 2004a, 194-196). Rossiter/Percy (vgl. 2005, 634- 635) sehen jedoch in der massenmedialen Werbung das größte Potential für Markenführung und -aufbau und benennen deren potentielle Wirkungen. Voraussetzung für die Markenbekanntheit ist die Sensibilisierung des Konsumenten für Wünsche und für Produkte bzw. Dienstleistungen, die seine Bedürfnisse befriedigen können.
2.2.7.2 Personalpolitik
Die Markenpolitik unterliegt ebenfalls dem Einfluss der Personalpolitik (vgl. Baumgarth 2004a, 209). Dazu gehören die Bereiche Personalbeschaffung, -auswahl, -einsatz,
-freisetzung, -entwicklung und -entlohnung (vgl. Berthel/Becker 2007, 9). Baumgarth sieht die Beschaffung von qualifizierten Mitarbeitern, die Entwicklung des Personals sowie die Motivation und Bindung der Mitarbeiter als wichtige, für die Markenführung entscheidende Bereiche an, da gerade die interne Markenführung einen besonderen Einfluss auf den Erfolg der Marke hat (vgl. 2004a, 209-210). Jeder Kontakt zwischen Kunde und Mitarbeiter eröffnet die Möglichkeit, dem Kunden positive Informationen über die Marke zu vermitteln. Entsteht ein inkongruentes Bild der Marke aufgrund unterschiedlicher Kommunikation in der Werbung einerseits und dem Verhalten der Mitarbeiter andererseits, so irritiert dies den Kunden. Damit Mitarbeiterverhalten und -kommunikation das Markenimage stärken, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Markeninhalte von den Mitarbeitern verstanden, internalisiert und kommuniziert werden (vgl. Esch et al. 2005c, 987). Kotler und Pfoertsch
„ […] show and emphasize the importance of motivating and empowering your employees - transforming them into true brand ambassadors“ (2006, 109). Diese unter dem Begriff des Behavioral-Branding diskutierten Maßnahmen übernehmen gerade im Dienstleistungs- und Business-to-Business-Bereich aufgrund des häufigen Kundenkontaktes und des Service-charakters eine tragende Funktion (vgl. de Chernatony/McDonalds 1998, 168-173). Im Dienstleistungsbereich fällt dem Konsumenten aufgrund der Immaterialität des Produktes eine vorherige Qualitätseinschätzung sehr schwer (vgl. Meffert/Bruhn 2006, 121), weshalb die Marke ebenso wie das Mitarbeiterverhalten eine Auskunftsfunktion übernehmen (vgl. Meffert/Bruhn 2006, 487, 510; Bruhn 2000, 412-414). Des Weiteren eignet sich das Behavioral-Branding für die Schaffung eines markeneinheitlichen Bewusstseins bei den Mitarbeitern und trägt dadurch zur Standardisierung des Mitarbeiterverhaltens gegenüber dem Kunden bei (vgl. Meffert/Bruhn 2006, 626-630), was die Steigerung des Konsumenten-vertrauens unterstützen kann (vgl. de Chernatony/Segal-Horn 2001, 663). Aufgrund von Unternehmenszusammenschlüssen und Internationalisierungstendenzen arbeiten unterschied-lichste Menschen zusammen (vgl. Esch et al. 2005c, 990). Vor diesem Hintergrund kann eine gelebte Unternehmenskultur zusammen mit Behavioral-Branding der Vereinheitlichung des Verhaltens der Mitarbeiter dienen (vgl. Thomson et al. 1999, 831-832).
2.2.7 Markencontrolling
2.2.7.1 Messverfahren
Von Bedeutung für markenpolitische Entscheidungen, Strategien und Maßnahmen sind die Informationen des Markencontrollings (vgl. Irmscher 1997, 69). Leistungsfähigkeit, Rentabilität und Profitabilität, Stabilität und Dauerhaftigkeit der Marke gegenüber der Konkurrenzmarke sowie Informationen über das Wachstumspotential bieten unverzichtbare Hinweise für das Markenmanagement (vgl. Winters 1991, 70-73). Neben Bilanzierung, Lizensierung, An- und Verkauf von Marken und zur Bemessung des Schadens bei Markenpiraterie finden die Markenbewertungsmethoden vor allem Verwendung für Steuerungs- und Controllingzwecke der Markenführung (vgl. Esch/Geus 2005, 1266-1267; Murphy 1990, 152).
Im Sinne der Bewertungsperspektive stehen sich zwei verbreitete Ansätze gegenüber: die Lebenszyklusanalyse (vgl. Meffert 2000, 338-346) und die Portfolio-Analyse (vgl. Bea/Haas 2005, 136-140; Meffert 2000, 350-353; Kreikebaum 1997, 74-77).
Die Lebenszyklusanalyse untersucht, in welcher Lebensphase die Marke sich befindet. Es werden für ein Produkt im Verlauf seines Lebens stets zunächst steigende und dann sinkende Umsätze angenommen. Man unterscheidet im Detail die Einführungs-, Wachstums-, Reife-, Sättigungs- und Degenerationsphase. Die Lebenszyklusanalyse ist umso reliabler und aus-sagereicher, je allgemeiner ihre Bezugsgröße ist. Betrachtet man ganze Geschäftsfelder oder eine gesamte Branche, so ist dieser Ansatz sehr brauchbar. Bei der Betrachtung einzelner (Marken-)Produkte ist der Aussagewert eingeschränkt. Das Modell liefert aber immerhin deskriptive Resultate und vermag Anregungen zum Verständnis von Absatzproblemen zu geben (vgl. Meffert 2000, 340-346), macht aber Prognosen über die Verweildauer einzelner Produkte in Lebensphasen und die Formulierung von Strategieempfehlungen fast unmöglich (vgl. Bea/Haas 2005, 131).
Die Lebenszyklusanalyse soll aber hier Erwähnung finden, weil sie im konkreten Bezug zum Medienbereich (vgl. 3.4.7.1) ihre Anwendbarkeit zeigt.
Die Portfolio-Analyse ist „[…] eine Technik zur Beschreibung der strategischen Situation eines Unternehmens. Sie bildet demzufolge die Unternehmensumwelt und die interne Situa-tion eines Unternehmens ab“ (Bea/Haas 2005, 138). Diese Analyse geht von der Annahme aus, dass ein Unternehmen in verschiedenen Geschäftsfeldern mit unterschiedlichen Marken aktiv ist und dass diese Einzelaktivitäten unterschiedlich erfolgreich sind. Durch diese horizontale Streuung erfolgt, vergleichbar mit dem Wertpapierportfolio eines privaten Anlegers, eine effektive Risikominimierung (vgl. 2005, 136). In ihrer Veranschaulichungs-form, einer zweidimensionalen Matrix, werden eine Umweltgröße (z.B. Marktwachstum) und eine unternehmensinterne Größe (z.B. relativer Marktanteil) gegeneinander aufgetragen (vgl. Bea/Haas 2005, 139; Kreikebaum 1997, 76). Es ergeben sich auf diese Weise vier verschiedene Felder, denen z.B. Marken eines Unternehmens zugeordnet werden können: Stars, Cash-Cows, Question Marks und Poor Dogs. Dieses Portfolio-Modell hat beschreibendes und erklärendes, aber auch entscheidungsfindendes Potenzial. Letzteres wird deutlich, weil sich durch einen Vergleich zwischen Soll- und Ist-Portfolio Problemlücken identifizieren und Normstrategien wählen lassen (vgl. Bea/Haas 2005, 138). An diesem Modell wird kritisiert, dass es z.B. Entwicklungen im Zeitablauf ausblendet, Konkurrenz-situationen nicht ausreichend abbildet und willkürliche Grenzen zwischen Matrixfeldern zieht (vgl. Kreikebaum 1997, 81; Bea/Haas 2005, 161-165).
Bea und Haas (vgl. 2005, 150) z.B. kombinieren beide Ansätze miteinander, um Schwächen einer jeweils singulären Analyse zu kompensieren und schlagen eine Portfolio-Matrix mit integriertem Lebenszyklus vor (vgl. Abb. 4).
2.2.7.2 Markenwert
Der Markenwert entsteht im Wahrnehmungsraum des Konsumenten und ist deshalb Zielgröße des Controllings. Zur Steuerung und Kontinuitätswahrung der Marke stellt der verhaltens-wissenschaftliche Markenwert ein geeignetes Instrument dar (vgl. Esch 2007, 63). Nach Aaker (vgl. 1991, 27-29) wird er über Markentreue, Bekanntheitsgrad, angenommene Qualität, Assoziationen und andere Vorzüge der Marke wie bspw. Patente operationalisiert. Esch (vgl. 2007, 63-65) hingegen sieht zwischen diesen Faktoren Überschneidungen, welche zu Ungenauigkeiten in der Operationalisierung führen (vgl. Kroeber-Riel/Esch 2004, 35-37), und schreibt der Markenbekanntheit und dem Markenimage eine hohe informatorische Bedeutung für die Markenführung zu.
In den folgenden Ausführungen soll auf die Markenwert-Elemente Bekanntheit und Treue bzw. Präferenz näher eingegangen werden. Die Bekanntheitspyramide von Aaker (vgl. 1991, 61-62) unterteilt den Bekanntheitsgrad von der unbekannten bis zur dominierenden Marke. „Je höher die Stellung einer Marke in der Bekanntheitspyramide, desto eher wird diese Marke auch beim Kauf präferiert“ (Esch 2007, 68). Die Markentreue lässt sich gemäß Baumgarth in die echte und unechte Version unterteilen, wobei die echte Markentreue eine hohe Überzeugung des Konsumenten für die Marke, d.h. die überdauernde Präferenz des Konsumenten für jene Marke, wiederspiegelt und die unechte Treue nur Resultat von Bequemlichkeit ist (vgl. 2004a, 84). Die Markenpräferenz ist das Ergebnis eines aktuellen Vergleichs der Einstellungen gegenüber verschiedenen Marken und stellt eine wichtige Basis für die Markenwahl dar (vgl. 2004a, 73). Trommsdorff und Paulssen ordnen die Gesamtheit der dem Konsumenten bekannten Marken verschiedenen ‘Sets‘ zu, wobei nur im ‘Relevant Set‘ die Marken zusammengefasst sind, die theoretisch für die tatsächliche Markenwahl in Frage kommen (vgl. 2005, 1376; Abb. 5).
Baumgarth unterscheidet bei der Präferenzbildung eine High- von einer Low-Involvement-Situation. High-Involvement bedeutet ein intensives Integrieren von Einzelbeurteilungen zu einer Markenpräferenz, während eine Low-Involvement-Entscheidung in Form einfacher Heuristiken abläuft (vgl. 2004a, 73-76). Andere Autoren definieren das Involvement über den Preis von Markenprodukten und damit über die Risikobehaftung einer Kaufentscheidung. Bei Low-Involvement-Produkten reichen in der Regel eine positive Einstellung und die Verfügbarkeit aus, um einen Kaufanreiz auszulösen, während High-Involvement-Produkte einen wie oben angedeuteten längeren Entscheidungsprozess erfordern (vgl. Rossiter/Percy 2005, 638). Die gedankliche Markenwahl ist der letzte Schritt vor dem objektiv messbaren Kauf bzw. Konsum einer Marke (vgl. Baumgarth 2004a, 79).
3 Medienmarkenmanagement aus der Perspektive des Market-Based-View und der Resource-Based-View of Strategy
3.1 State of the Art des Strategischen Managements
Die erfolgreiche Führung eines Unternehmens hat als Ziel die dauerhafte Sicherung des Unternehmenserfolgs (vgl. Welge/Al-Laham 2003, 4-6). Die in diese Richtung wirkenden Anstrengungen unternehmerischer Entscheidungsträger haben sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert, sie sind komplexer, multifaktorieller geworden und die Begrifflich-keiten, die sie beschreiben, haben sich entsprechend weiterentwickelt.
Bis Anfang der 50er Jahre wurde der Begriff der Finanzplanung verwendet. Er beschreibt die Tatsache, dass das Erreichen des Wachstumsziels ganz klar im Fokus stand, während die Umweltbedingungen in ihren Veränderungen vorhersehbar waren und keinen Planungsfaktor darstellten (vgl. 2003, 8).
Ab Mitte der 50er Jahre entwickelte sich die Langfristplanung. Erstmalig wurde mit Mehrjahres-Budgetierung mittelfristig in die Zukunft geschaut, und die dynamischer und komplexer werdende Unternehmensumwelt kam in den Fokus.
Die Phase der strategischen Planung folgte in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die SWOT-Analyse (vgl. Abb. 6), d.h. das Erkennen der eigenen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses) und die Analyse der Umwelt mit ihren zukünftigen Chancen (opportunities) und Risiken (threats) füllte die strategische Planung mit Leben (vgl. Bea/Haas 2005, 12-13). Die Entwicklung der Krisenforschung und das Implementieren von Frühwarnsystemen sind als Versuche, ökonomische Trendbrüche zu antizipieren, ebenfalls dieser Entwicklungsphase zuzuordnen.
Die in den 80er Jahren einsetzende vierte und letzte Entwicklungsphase, die des Strategischen Managements, ist die Konsequenz aus den immer deutlicher werdenden Schwächen der strategischen Planung. Letztere blieb immer auf der Ebene der methodischen Überlegungen stehen und beschäftigte sich nicht mit der tatsächlichen Umsetzung von strategischen Entscheidungen und deren Kontrolle.
Das Strategische Management beinhaltet aber außer der Implementierung und dem Controlling von Strategien auch eine um den politischen und sozio-kulturellen Einfluss-bereich erweiterte Umweltanalyse (vgl. Welge/Al-Laham 2003, 10-11).
Bea und Haas unterteilen die Phase des Strategischen Managements in zwei Abschnitte. Der erste reicht bis etwa 1995, der zweite und auch heute noch aktuelle Abschnitt löst im selben Jahr ersteren ab. Diese Unterteilung ist vor dem Hintergrund der Themenstellung dieser Arbeit interessant, weil sie Market-Based-View und Ressource-Based View of Strategy zeitlich und inhaltlich von einander abgrenzt. Bis 1995 herrschte im Strategischen Management eine marktorientierte Sicht vor, während ab 1995 langsam der ressourcen-orientierte Ansatz an Bedeutung gewann (vgl. 2005, 14-15; Abb. 7).
Der Market-Based-View, unter seinem Hauptautor Michael Porter, restringiert sich auf den Effekt der Branche, den sie auf den Erfolg des Unternehmens ausübt. Über mehr als ein Jahrzehnt sprach man ihr größte Akzeptanz zu. In den 1990er Jahren kündigte sich dann eine entscheidende Wende an. Empirische Erkenntnisse, die den Einfluss der Branchenumwelt auf den Erfolg des Unternehmens nicht ausreichend bestätigen konnten, aber auch der globale Wandel initiierten eine Abkehr von der marktorientierten Sichtweise hin zum ressourcen- bzw. unternehmens-spezifischen Fokus. Besonders in den letzten Jahren hat sich im Bereich des Strategischen Managements eine fast inverse Sicht entwickelt. Die Orientierung hin zum Inneren der Unternehmung rückte ab Mitte der 1990er Jahre deutlich in den Vordergrund.
In letzter Zeit ist man wieder eher darauf bedacht, ganzheitliche Ansätze zu entwickeln, die beide Perspektiven integrieren (vgl. Wolf 2005, 433).
3.2 Elemente der Ansätze
3.2.1 Darstellung des Market-Base-View of Strategy
3.2.1.1 Grundannahmen des Market-Based-View of Strategy
Der marktorientierte Ansatz betrachtet das Unternehmen aus der Absatzmarktperspektive und nimmt mit anderen Worten eine Outside-in-Sicht ein, nach der die Erfolgsfaktoren aus den Markt- und Umweltanforderungen abgeleitet werden. Mittels Konzeption von Produkt-Markt-Strategien soll auf Chancen und Bedrohungen der Umwelt und des Marktes reagiert werden. Da der Market-Based-View of Strategy vor allem durch die Arbeiten Porters gekennzeichnet ist, soll nach einer kurzen Darstellung der Ursprünge im weiteren Verlauf auf Porters Ausführungen näher eingegangen werden. Porters Ansatz baut auf dem Structure-Conduct-Performance-Paradigma (vgl. Abb. 8) der Industrieökonomik von Mason und Bain auf (vgl. Bea/Haas 2004, 26).
„Die dem Structure-Conduct-Performance-Paradigma bzw. der mit ihm in Eins zusammen-fallenden Market-Based View zugehörigen Abhandlungen fragen an, welche Faktoren den (entsprechend zur U.S.-amerikanischen Wirtschaftskultur rein ökonomisch interpretierten) Erfolg von Unternehmen bestimmen“ (Wolf 2005, 414). Die Struktur der Branche (Structure) bedingt das Verhalten (Conduct) der Unternehmen einer Branche, und dieses Verhalten bedingt das Ergebnis (Performance) des Unternehmens (vgl. Welge/Al-Laham 2003, 36).
Die strategischen Aktivitäten eines Unternehmens haben folglich das Ziel, sich unter Aufmerksamkeit auf die dort bestehenden Verhältnisse in einer attraktiven Branche zu positionieren und aktiv zu werden. Gemäß Porter hat ein Unternehmen in einer Branche einen gewissermaßen vorbestimmten Platz, auf dem es sich optimal entwickeln kann (vgl. 2000, 25). Zur Bestimmung dieses Platzes hat Porter einen Katalog von Instrumenten entwickelt: die Branchenstrukturanalyse, die Konkurrenzanalyse, das Modell der Wertschöpfungskette und die Generischen Strategien.
Es ist bemerkenswert, dass das Structure-Conduct-Performance-Paradigma mit seiner marktorientierten Perspektive eine Forschungsrichtung geebnet hat, die das Unternehmen als ‘black box‘ beschreibt und die Binnenprozesse fast vollständig aus der Wahrnehmung nimmt (vgl. Wolf 2005, 415). Das Structure-Conduct-Performance-Paradigma sieht die Struktur der Branche für die in ihr wirkenden Unternehmen als verhaltensbestimmenden Faktor. Man postuliert weiterhin, dass der Conduct der Marktteilnehmer lediglich die wettbewerbliche Umgebung reflektiert und folglich für den Erfolg eines Unternehmens nicht entscheidend ist. Vielmehr ist eine Analyse der Industriestruktur ausreichend, bei der das Interesse auf Eintrittsbarrieren, die Anzahl und Verteilung von Firmen, die Produktdifferenzierung sowie die Elastizität der allgemeinen Nachfrage gerichtet ist (vgl. Porter 1981, 611).
Die Inside-Out-Perspektive ist im Market-Based-View fast völlig ausgeblendet, dennoch wird die Stellung der Ressource in diesem Ansatz beschrieben. Letztere ist aus marktorientierter Sicht nur Mittel zum Zweck, sie bestimmt nicht den Wert einer Unternehmung, sondern ihre Wertigkeit wird durch den Markt determiniert. Porter bringt diesen Gedanken auf den Punkt: „Resources are not valuable in and of themselves, but because they allow firms to perform activities that create advantages in particular markets“ (1991, 108).
In den folgenden Unterkapiteln werden Porters o.g. Instrumente zur Bestimmung der optimalen Positionierung näher dargestellt.
3.2.1.2 Branchenstrukturanalyse
Porters Branchenstrukturanalyse (vgl. Abb. 9) entfaltet sich als Beschreibung der fünf Wettbewerbskräfte, mit deren Hilfe die strukturellen Eigenschaften einer Branche analysiert werden und welche im Sinne der Industrial Organization-Forschung verantwortlich sind für Intensität des Wettbewerbs und die dadurch entstehende Rentabilität der Branche (vgl. Porter 1999, 33). Die Kräfte unterscheiden sich je nach ihrer Branche und können sich auf im Laufe ihrer Entwicklung verändern (vgl. Porter 2000, 29). Diese fünf Kräfte sind die Eintritts-barrieren, die Intensität der Rivalität, die Bedrohung durch Ersatzprodukte, die Bedrohung durch neue Anbieter und die Verhandlungsmacht der Lieferanten und der Abnehmer.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dipl. Medienwirtin Simone Drott (Autor:in), 2007, Medienmarkenmanagement aus Perspektive des market-based-view und der resource-based-view of strategy, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87521
Kostenlos Autor werden

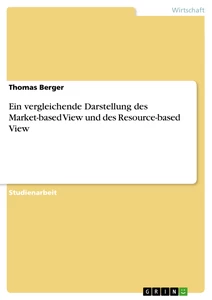
















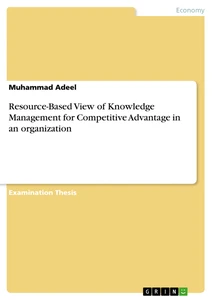



Kommentare