Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wolfram von Eschenbach
2.1 Der Dichter und sein Publikum
2.2 Wolframs Wirkungsästhetik
2.3 Die Religiosität Wolframs und das Religiöse in seinen Werken
3. Gottesbilder in der mittelalterlichen Dichtung
3.1 Gottesvorstellung und Gottesdienst im hohen Mittelalter
3.2 Gottes Gnade und das Gottesgnadentum
3.3 helfe und triuwe
4. Zwischenmenschliche Beziehungen in der mittelalterlichen Gesellschaft
4.1 Das Lehnswesen
4.2 Die Stellung der Kirche im hohen Mittelalter
5. Parzival: Artusritter oder Ausnahmeheld?
5.1 Parzivals art
5.2 Parzivals Wissen über Gott
5.2.1 Gotteslehre von Herzeloyde
5.2.2 Gotteslehre von Gurnemanz
5.2.3 Gotteslehre von Trevrizent
6. Parzivals Gottesbezug
6.1 Die Ritterbegegnung (Vers 120,11 – 124,24)
6.2 Verfluchung durch Sigune (Vers 251,29 – 255,30)
6.3 Verfluchung durch Cundrîe (Vers 312,2– 319,19)
6.4 Parzivals Aufbruch vom Artushof (Vers 329,14 – 333,30)
6.5 Parzival und der graue Ritter (Vers 446,1 – 452,9)
6.6 Einkehr bei Trevrizent (Vers 452,15 – 502,30)
6.7 Feirefizkampf (Vers 734,18 – 754,30)
6.8 Berufung Parzivals durch Cundrîe (Vers 778,13 – 786,12)
6.9 Anfortas´ Erlösung (Vers 787,1– 799,13)
7. Schlussbetrachtung
9. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis für Textzitate:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Eine der wohl umstrittensten Fragen der Mediävistik formiert sich um den Parzival Wolframs von Eschenbach. Es handelt sich hierbei um den zweiten erfolgreichen Versuch der Erringung des so genannten Grals durch den Titelhelden Parzival. Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang, dass der Gral dem Berufenen nur eine Chance eingeräumt hatte, ihn zu erreichen und eine zweite ausdrücklich ausschloß. Das Erreichen des Grals und das damit verbundene Erlösen des noch amtierenden Gralskönigs, der an einer unheilbaren Verletzung leidet, werden von dem Gral selbst an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die zentrale Vorgabe ist die, wie der Hörer/ Leser nach der Hälfte der Erzählung erfährt, dass der Auserwählte bei seiner ersten Konfrontation mit dem Gral die Frage nach dem Leiden des noch amtierenden, aber an einer unheilbaren Verletzung erkrankten Gralskönigs stellen muss. Hinzu kommt, dass er diese Frage aus eigenem Antrieb stellen muss, ohne vorher zu wissen, dass genau dies seine Aufgabe ist. Ebenso erging von dem Gral das Verbot, dass der Auserwählte von niemandem vorher auf seine Aufgabe und die Form der Durchführung hingewiesen werden darf. Stellt er diese Frage nicht, so verwirkt er dadurch für immer sein Anrecht auf den Gral und der Gralskönig wird nicht von seinem Leiden erlöst. Da nun Wolframs Parzival bei seiner ersten Begegnung mit dem Gral diese Frage nicht stellt, erhält er den Gral nicht, erlöst auch den Gralskönig nicht von seinem Leid und wird darüber hinaus von der Gralsbotin Cundrîe verflucht. Entgegen der zuvor deutlich gemachten Regel, erhält Parzival, der mittlerweile Artusritter geworden ist, jedoch eine zweite Chance, die Frage zu stellen und den Gral zu erwerben. Zudem wird er zuvor noch über den Hintergrund der Frage und der Tatsache, dass er diese stellen muss, aufgeklärt, was neben dem generellen Widerspruch der zweiten Möglichkeit auch noch gegen die damit verbundenen Bedingungen bzw. Verbote verstößt. Es scheint demnach ein innerlitarischer Widerspruch innerhalb Wolframs Werk vorzuliegen.
Wolfram belässt es jedoch nicht bei der einfachen Gegenüberstellung von Gral und Berufenem, sondern verknüpft diese beiden Krisenherde mit einer weiteren, übergeordneten Instanz: und zwar dem christlichen Gott. Im Gesamtbild ergibt sich daraus, dass der zum Gral Berufene von Gott dazu berufen werden muss und der Gral auf mysteriöse Weise als religiöse Reliquie mit Gott verbunden ist. So konstatiert auch Mohr für Parzivals letzliches Erreichen des Grals: „Gottes Gnade beruft ihn zum Gral.“[1] Wolfram führt dadurch mit der göttlichen und somit religiösen Thematik eine weitere Ebene ein, die aus den vorigen Artusromanen nicht bekannt ist.
Dies führte in der Parzival-Forschung verstärkt zu theologisch intendierten Interpretationen des Parzival. So sieht beispielsweise Schröder anhand seiner theologischen Deutung des Werks in „Parzivals Lebensgeschichte […] eine ritterliche Heiligenvita.“[2] Laut seiner Interpretation ist Parzival „Held und Heiliger zugleich […] und bewährt sich als echter Christ überhaupt und schlechthin.“[3] Diese Ansicht findet sich ebenso bei Wieners. Laut diesem wird Parzival „zum Vermittler der Einsicht in die wahre Gott-Mensch-Beziehung, in der Gott alles und der Mensch nichts ist, und zum Vermittler der Demut, die gläubig sich Gott hingibt, ohne je an Gottes Güte zu zweifeln.“[4] Um zum Vermittler der Demut gegenüber Gott zu werden und als Heiliger bezeichnet werden zu können, hätte Wolfram die Demut und die Ehrfurcht vor Gott in seinem Werk kenntlich machen müssen. Allerdings wird mit Parzival dem Zuhörer/ Leser ein Held vorgestellt, der bei seiner Einführung in die Geschichte noch nichts von Gott erfahren hat, sich seiner nicht bewusst ist und später nach seinem fehlgeschlagenen ersten Versuch den Gral zu erringen, zudem erklärt, Gott zu hassen, weil dieser ihm nicht beistand bzw. geholfen hat. Des Weiteren hat sich Parzival bereits vorher in Sünde verstrickt, da er einen seiner Verwandten getötet und den Tod seiner Mutter mitverschuldet hat. Letzteres entschuldigt Schröder über die damalige tumpheit des Helden.[5] Da er all diese Taten im Unwissen beging, wie den Kampf gegen Ither, bei dem er nicht weiß, dass er mit seinem Gegner verwandt ist, sieht Schröder diese Taten nicht als Sünden an.[6] Den Hass und die damit verbundene Absage an Gott verkündet Parzival jedoch erst später, nachdem er auch von dem Erzähler nicht mehr als tumber knappe bezeichnet wird, wie dies vorher der Fall war. Laut Koppitz besteht die eigentliche Schuld Parzivals daher auch „nicht in der Unterlassung der Frage, auch nicht in dem unbedachten Fortrennen von seiner Mutter, was ihren Tod zur Folge hat, nicht einmal in der Tötung Ithers, sondern im Trotzen gegen Gott, in der hôchvart.“[7] Laut Bertau ist dieses Trotzen gegen Gott jedoch immer noch auf seine tumpheit zurückzuführen. Diesmal bezieht sich die tumpheit allerdings auf seine Unkenntnis über das Wesen Gottes.[8] Erst seine Belehrung über Gott durch seinen Onkel, den Einsiedler Trevrizent, vervollständigt Parzivals Wissen über Gott.[9] Somit erwirkt sich Parzival nun die zweite Chance, indem er „den Mut (hat), auf den Irrtum menschlicher Regelkenntnis und die Wunderkraft Gottes zu setzen.“[10] Dem widerspricht jedoch die Feststellung Bumkes hinsichtlich Parzivals Verhalten nach der Lehre Trevrizents, denn auch nachdem ihm Trevrizent offen gelegt hatte, dass sein Hass gegen Gott falsch ist, zeigt Parzival „keine Bußgesinnung, geht keine Bußverpflichtungen ein und handelt in dem wichtigsten Punkt gegen Trevrizents Rat: er setzt seine Gralsuche fort, obwohl Trevrizent das für unsinnig erklärt hat, da niemand unberufen zum Gral gelangen könne (468,10ff).“[11] Trevrizent zeigt ihm zwar ein anderes Gottesverständnis auf, als sein bisheriges, „aber von einer ´inneren Wandlung´, einer ´Umkehr´ ist nichts zu spüren.“[12] Hierdurch wird jedoch fraglich, wieso Parzival im Kampf gegen seinen Halbbruder Feirefiz, dessen Identität sich ihm erst nach dem Kampf eröffnet, behauptet, auf Gott zu vertrauen. Wenn sich aber seine bisherige Beziehung zu Gott nicht verändert hat, müsste er diesem immer noch im Hass gegenüberstehen oder zumindest von dessen Hilfe und seiner Treue nicht überzeugt sein. Sollte sich diese Wandlung unbemerkt vollzogen haben, so bleibt laut Bunke aber dennoch unklar, „wie die letzten Worte Trevrizents zu beurteilen sind, der behauptet, daß Parzival es Gott abgetrotzt habe, daß Gott ihm seinen Willen erfüllt habe.“[13] Dies widerspricht dem Bild eines heiligen und überzeugten Christen, wie Parzival im Sinne Schröders und Wieners am Ende des Romans erscheint. Zudem wird an einem Gott hassenden und ihm trotzenden Helden auch nicht die Erkenntnis von Gottes Allmacht und demgegenüber der menschlichen Nichtigkeit deutlich. Dies führt wiederum dazu, dass die Handlungsweise Gottes hinterfragt werden muss, da sich dieser laut der Beschreibung seine Gnade abtrotzen lässt von einem Menschen, der ihm über längere Zeit abgeschworen und diese Sünde danach auch nicht gebüßt hat.
Um nachvollziehen zu können, warum Parzival dennoch Gottes Gnade erhält und von diesem zum Gral berufen wird, muss zuerst seine Beziehung zu Gott und die Veränderung seines Gottesbildes geklärt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird daher die narrative Inszenierung der weltlich-geistlichen Beziehung zwischen dem Titelheld Parzival und Gott als der höchsten geistlichen Instanz untersucht. Hierbei wird primär die narrative Darstellungsweise an zentralen Stellen des Textes betrachtet, um daraus eine mögliche Erklärung für Parzivals Berufung zum Gral ableiten zu können.
Des Weiteren ist Wolframs Intention hinsichtlich der Wirkung seines Werkes zu hinterfragen, insbesondere in Bezug auf die Erweiterung durch die religiöse Thematik; entsprechend der Interpretationen von Schröder und Wieners müsste sich, laut Remakel, in der Anlehnung an die Heilsgeschichte und christlichen Glaubensvorstellungen Wolframs Absicht offenbaren, „die Hörer oder Leser zu erziehen.“[14] Simson hingegen kommt aufgrund des von Wolfram beschriebenen Publikums zu dem Schluss, dass Wolfram gedichtet hat, „um den Burgherren und die Seinen zu unterhalten, zur heiteren Kurzweil einiger Tage.“[15] Daraus ergibt sich die Frage, wie die religiöse Komponente in ein unterhaltendes Werk passt. Es ist überdies zu untersuchen, wozu die religiöse Komponente diente. Dies kann beantwortet werden, indem festgestellt wird, ob der Parzival als religiöses Lehrwerk mit christlicher Botschaft oder als unterhaltende Geschichte konzipiert wurde. Zudem ermöglicht dies Rückschlüsse auf die Konzeption von Parzivals Verhältnis zu Gott zu ziehen. Hierzu muss Wolframs Bezug zur Religion und das Verhältnis der mittelalterlichen Gesellschaft zum christlichen Glauben und zur Religion genauer betrachtet werden.
Wie Koppitz feststellt, fällt zwar bei Wolfram auf, dass dem Rezipienten „Wörter, die Ethisches bezeichnen sollen, sehr häufig begegnen.“[16] So zum Beispiel bei der triuwe bzw. triwe, die meist Gott zugeschrieben wird und seine Verbundenheit zu seinen Geschöpfen ausdrücken.[17] Allerdings verwendet Wolfram den Begriff der triwe und andere zentrale Leitwörter wie z.B. die Hilfe bzw. helfe in verschiedenen Sinnzusammenhängen und dabei auch mit anderen Bedeutungen.[18] So taucht die triwe gleich zu Beginn des Parzival auf, im Sinne der Treue eines Vasallen zu seinem Lehnsherrn (V. 6,10ff). Diese Bedeutung der triwe sieht auch Schmid in dem Verhältnis Parzivals zu Gott dargestellt, wodurch sich eine Deutung jenseits der religiösen Ebene ergibt. Deshalb wird im Folgenden ebenfalls das mittelalterliche Lehnswesen genauer betrachtet, um zu prüfen, inwieweit Wolfram den Regelungen des Lehnswesens bei der Konzeption der Beziehung Parzivals zu Gott gefolgt ist.
Zum anderen muss neben den außerliterarischen Bezügen der Parzival hinsichtlich des Erzählstils und der Gattung eingeordnet und bestimmt werden, um eine adäquate Erklärung über dessen Wirkungsästhetik geben zu können. Hierbei ist sowohl die religiöse Dichtung des Mittelalters als auch die Artusepik näher zu betrachten. Letzterer ordnet unter anderem Roßnagel den Parzival zu, da er in Parzival den Prototyp des Artusritters sieht und daher das Werk trotz seiner religiösen Erweiterung zur Artusepik zählt. Laut seiner Interpretation folgt Wolfram der Erzählstruktur des Doppelweges, wie Kuhn sie für den Erec Hartmanns von Aue konstatierte.[19] Diese Doppelwegstruktur ermöglicht es Roßnagel, auch die zweite Berufung zum Gral zu erklären. Dabei vernachlässigt er jedoch die religiöse Komponente. Wird diese nun der Analyse hinzugefügt, muss daher betrachtet werden, inwiefern der Parzival noch der Artusepik oder eher einer religiösen Dichtung entspricht.
Unter Berücksichtigung von Wolframs mehr oder weniger religiösem Erzählstil, seinem Bezug zur christlichen Religion und seiner Wirkungsabsicht wird dann der von ihm dargestellte Gottesbezug Parzivals analysiert, um darüber seinen als auch Gottes Anteil und die Tatsache des schlussendlichen Erringens des Grals erklären zu können.
Vorab sei zudem noch klargestellt, dass diese Arbeit keinerlei Anspruch auf alleinige Richtigkeit unter allen Lösungsvorschlägen zu den Interprationsdifferenzen der Parzivalrezeption erheben will und dies auch nicht kann. Diese Arbeit soll vielmehr eine Sichtweise und somit eine weitere Lösungsmöglichkeit offenbaren, die in der „Flut von Lösungsvorschlägen“[20] bisher weitgehend unberücksichtigt blieb. Diese Flut der Lösungsvorschläge, um Knapps Analogie aufzugreifen, entspringt dem Meer der Interpretationen die in immer wieder auflebenden Wogen über den Parzival angefertigt wurde. Diese Beliebtheit des Werkes erstreckt sich dabei nicht nur auf die Forschung, sondern reicht bis zu seiner Entstehungszeit zurück. Trotz der Länge des Werkes und seiner Interpretationsschwierigkeiten zählt es, wie unter anderem Bumke und Schirok anmerken, zu den bedeutendsten literarischen Werken des deutschen Mittelalters. Die Beliebtheit des Parzival noch über das Mittelalter hinaus lässt sich unter anderem daran aufzeigen, dass Richard Wagner eine Oper auf der Grundlage des Parzival komponiert hat und dass er als eines der ersten deutschen Werke 1477 in den Buchdruck aufgenommen wurde. Wie auch schon Schirok anmerkt, hätte der Verleger Johann Mentelin den Parzival im Jahre 1477 wahrscheinlich nicht in sein Verlagsprogramm aufgenommen, ohne vorher seine Nachfrage geprüft zu haben.[21] Diese Beliebtheit wird zumeist auf den Autor zurückgeführt, der auch aufgrund der Anzahl der erhaltenen Handschriften des Parzival und des Willehalm als ein Bestsellerautor seiner Zeit gilt.[22] Um eine adäquate Analyse über den Parzival bieten zu können, ist daher die ungeteilte Aufmerksamkeit vorerst dem Autor des Parzival zu widmen sowie den äußeren Faktoren, die auf sein Denken und Schreiben eingewirkt haben können.
2. Wolfram von Eschenbach
Um herauszufinden, wer der historische Wolfram von Eschenbach war, hat sich die Forschung jahrzehntelang damit beschäftigt, historische Verweise auf eine biographische Person zu finden, um seine regionale und ständische Herkunft verorten zu können.[23] Hierzu wurden als Anhaltspunkte die Selbstaussagen des Dichters in seinen Werken Parzival, Willehalm und den Fragmenten des Titurel verwendet. Doch diese Selbstaussagen sind zum einen wenig informativ und zum anderen auch in sich selbst widersprüchlich. So weist sich Wolfram im Parzival selbst als Ritter aus und nicht als Dichter und behauptet zudem in seiner Selbstverteidigung von sich selbst, dass er kan decheinen buochstap (Parzival Vers 115,27). In einer schriftlich fixierten Dichtung zu lesen, dass der Autor keinen Buchstaben kennen würde, ist natürlich verwirrend und beschäftigt die Forschung noch heute.[24] Aufgrund dieser Aussage allein ist allerdings schon zu bezweifeln, inwiefern Wolframs Selbstaussagen der Wirklichkeit entsprechen.[25] Ein ebenso gespaltenes Bild bietet sich dem Wolfram-Forscher bei dem Versuch der Einordnung Wolframs zwischen den Dichterkollegen seiner Zeit. Einerseits wird er von der Forschung in die Traditionen seiner Zeit gestellt, da er beim Parzival ebenfalls den Artusstoff mit einfließen lässt, der ihm durch Hartmanns von Aue Iwein und Erec bekannt war.[26] Andererseits wird Wolfram aus dieser Tradition herausgehoben, da thematische und strukturelle Abweichungen gegenüber der Hartmannschen Artusliteratur bestehen und Wolfram mit der religiösen Thematik durch den Gral im Parzival und die Kreuzzugsthematik im Willehalm das literarische Themenspektrum erweitert.[27] Die Wurzel dieser Differenzen bringt McDonald mit einer knappen Begründung auf den Punkt: „Da außerliterarische Zeugnisse nicht vorhanden sind, ist die Forschung auf seine Werke selbst angewiesen.“[28] Schirok verweist hierbei auf die außerliterarischen Anspielungen Wolframs in seinen Werken, da durch die Kenntnis regionaler Gepflogenheiten auf das Umfeld oder den Herkunftsort des Dichters geschlossen werden kann. Wolframs Kenntnisse über die Trüdinger Krapfenpfanne kann beispielsweise als Indiz dafür gesehen werden, dass er sich in dieser Region um Hohentrüdingen in Oberfranken aufgehalten hat.[29] Wiederum Anspielungen auf bestimmte adlige Personen und Herrscher lassen auf Aufenthalte an verschiedenen Höfen der jeweiligen Herrscher schließen.[30]
Im Falle anderer Dichter kann auch über deren Auftraggeber geschlossen werden, dass sich der jeweilige Dichter am Hofe des Auftraggebers oder zumindest in dessen Umgebung aufgehalten hat. Allerdings benennt Wolfram im Parzival keinen Mäzen explizit, wie es unter anderem Chrétien in seinem Lancelot tut.[31]
Der Auftraggeber liefert als solcher zum einen neben der Information, an welchem Ort sich der Dichter aufgehalten und möglicherweise auch gewirkt hat, noch einen weiteren Hinweis. Denn als Auftraggeber ist er zugleich Publikum für den Dichter, da er den Auftrag erteilt hat, um dessen Arbeitsessenz auch vorgetragen zu bekommen. Ein höfischer Auftraggeber liefert somit gleichzeitig das Indiz, dass das Werk auch am Hofe und somit für ein höfisch-adliges Publikum vorgetragen wurde.
Darüber hinaus wird mit dem Auftraggeber in der mittelalterlichen deutschen Dichtung auch der Verweis auf den Beschaffer der Quelle gegeben, die zur Legitimation der Richtigkeit und der Wahrheit des Erzählten verwendet wurde. Da viele deutsche Dichtungen aus dem Französischen übersetzt und weitergedichtet wurden, verweisen Dichter wie beispielsweise Hartmann von Aue in seinem Erec auf die gleichnamige Vorlage des nordfranzösischen Dichters Chrétien de Troyes, um die Verantwortung über den Wahrheitsgehalt des Erzählten auf diese abzuwälzen. Die Angabe über die Quelle oder die Quellen bei Wolframs Parzival ist allerdings ungesichert, da nur eine von ihm benannte Quelle erhalten geblieben ist, die zweite aber nicht, wobei auch nur wenige Hinweise auf deren Urheber zu finden sind.[32] Daher soll hier nur mit in die Interpretation einfließen, was auch heute noch nachgewiesen werden kann. Dies ist der Li conte du Graal von Chrétiens de Troyes. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass Wolfram sich im Parzival von dem Werk Chrétiens distanziert. Wie auch deutlich wird, ist der Parzival Wolframs keine einfache Übersetzung vom Französischen ins Deutsche, da Wolfram mehrere Teile hinzugedichtet und teilweise abgeändert hat, was insbesondere für das Gottesverhältnis Parzivals gilt. Vollständig erweitert gegenüber Chrétiens Werk sind die jeweils zwei Bücher umfassende Vorgeschichte und das Ende[33]. Zwar verweist Wolfram auf eine weitere Quelle, die möglicherweise die Vorlage für diese Teile lieferte. Da diese Quelle jedoch umstritten ist, soll hier davon ausgegangen werden, dass der Anfang als auch das Ende des Parzivals die reine Dichtkunst Wolframs darstellen.
2.1 Der Dichter und sein Publikum
Ähnlich kompliziert wie die Suche nach Hintergrundinformationen über den Autor lässt sich das Publikum Wolframs bestimmen, vor dem er seine Werke vorgetragen hat.[34] Die Ursache hierfür ist teilweise der bisherigen Rezeptionsforschung selbst geschuldet, denn im Gegensatz zur historischen Forschung über die biographischen Autoren und deren Produktion von Literatur entpuppt sich die Rezeptionsforschung, wie Schirok konstatiert, als „ein Gemenge von divergierenden Theorien und Ansätzen“[35], das aufgrund einer exorbitanten Theorie- und Modellentwicklung den Bezug zur Praxis verloren hat. Um Wolframs Rezipientenkreis bestimmen zu können, empfiehlt es sich daher nicht, eine der praxisfernen Theorien zu bemühen, sondern es erfordert vielmehr, Überlegungen von Grund auf anzustellen, die sich entlang historischer Daten und Tatsachen veranschaulichen lassen.[36] Daraus ergibt sich jedoch auch gleichzeitig der zweite Teil, der die Suche nach dem vom Dichter intendierten Rezipientenkreis problematisch gestaltet. Da nur wenige gesicherte Daten oder Aufzeichnungen aus diesem Zeitraum vorliegen, wie dies schon im Falle der Bestimmung des historisch biographischen Autors war, muss die Analyse des Publikums mittelalterlicher Dichtung auf allgemeinen Folgerungen und Indizien aufbauen.
Dennoch ist es unabdingbar, das Publikum zu bestimmen, da es eine entscheidende Wirkung auf die Literaturproduktion hat und auf die Art und Weise, wie der Dichter seine Geschichte zusammenstellt und ausformuliert. Will ein Dichter, dass seine Dichtung verstanden wird, so muss er sich beim Verfassen seiner Dichtung an den Adressaten und deren Wissen und Kenntnissen orientieren, ebenso wie an deren Gesellschaftsverständnis und deren gesellschaftlichen Status. Selbst wenn der Dichter nur für sich selbst dichtet und nicht für ein Publikum, wird er auch nur das für sein Werk verwenden, worüber er selbst Kenntnis besitzt.
Dass die Werke auf das Wissensspektrum des höfischen Publikums zugeschnitten wurden, kann des Weiteren aufgrund der Lebensweise und -bedingungen der Dichter angenommen werden. Da diese auch von ihrer Arbeit leben mussten, waren sie gezwungen gewisse Vermarktungsbedingungen bei der Konzeption ihrer Werke mit einfließen lassen, denn das Dichten war ihr Handwerk, für das sie Lohn in Form von Unterkunft, Nahrung oder Geldmittel erhielten. Wie auch Schirok und Brunner bestätigen, wird in der mediävistischen Forschung mittlerweile einheitlich angenommen, dass die Dichter des hohen Mittelalters, bedingt durch die kostspieligen Gegebenheiten des Schreibens und der Quellenbeschaffung, am Hof eines hochadligen Gönners dichteten und auch ihre Dichtung den an diesen Höfen lebenden Personen vortrugen.[37] Für ein unverständliches Werk hätte ein Dichter keine oder nur eine geringe Entlohnung erhalten, weswegen eine Orientierung an der Zielgruppe und somit an dem mittelalterlichen Publikum bzw. einem oder mehreren Mäzenen bei der Konzeption und Dichtung des Werkes von Nöten war, wie sie auch heute ist und wodurch für die heutige Analyse des Werkes der Faktor Publikum ebenso berücksichtigt werden muss.
Aus den Anspielungen im Parzival auf andere zeitgenössische Werke lässt sich schließen, dass Wolfram diese Werke gekannt haben muss und dementsprechend aber auch vorausgesetzt hat, dass sein Publikum diese Werke kennt, denn sonst würde er es damit nicht konfrontieren.[38] Wenn sich im VIII. Buch Liddamus gegen Kingrimursels Vorwurf der Feigheit zur Wehr setzt, vergleicht er sich und seine Handlungsweise mit der Romanfigur Turnus aus dem Eneasroman Heinrichs von Veldeke:
(ER, V. 419,12) welt irz sîn hêr Turnus,
sô lât mich sîn hêr Tranzes
„Die Äußerung bleibt unverständlich, wenn der Hörer nicht die genannten Personen aus Veldekes Eneasroman kennt und ihre Auseinandersetzung im Gedächtnis hat.“[39] Da diese Anspielungen Wolframs auf zeitgenössische Literatur und Dichter häufig im Parzival auftreten, kann davon ausgegangen werden, dass Wolfram für ein literarisch gebildetes Publikum dichtete bzw. seine Werke diesem vortrug.[40] Eine konkrete Aussage über Wolframs Publikum stellt Simson auf, laut dem „Wolfram als Ritter und für Ritter gesungen“[41] hat. Simson sieht dies dadurch belegt, dass Wolfram sich beim Parzival auf das beschränkt, was er und sein Publikum kannten. Als höfischer Ritter umfasst dies „die Welt der Burg, des ritterlichen Kampfes, der höfischen Minne.“[42] Damit schränkt er Wolfram thematisch ein und ordnet ihn anhand der genannten Themen allein der Gattung des Artusromans zu, die es später noch genauer zu betrachten gilt. Hier ist nun mehr das Augenmerk darauf zu legen, was Simson zu dieser Aussage ableitet und nicht, wie er zu dieser Aussage gelangt ist. Aufgrund von diesem Themenspektrum, der höfischen Atmosphäre als Vortragsort und dem höfischen Publikum geht Simson davon aus, dass es Wolframs Absicht war, das Publikum zu unterhalten.[43] Allerdings orientiert er sich hinsichtlich der Aussagen über den Autor und das Publikum an den Angaben des Erzählers im Parzival, die, wie oben beschrieben, jedoch nur unter Vorbehalt als Grundlage für eine solche Aussage über den Autor verwendet werden können.
Zudem umfasst der Parzival darüber hinaus, um die Analogie von Simson aufzunehmen, die Welt der Taufe, die Welt Schöpfungsgeschichte, die Welt der Sünde und die Welt der Erlösung. Um das konträre Bild aufzulösen, ist als Resultat festzuhalten, dass der Parzival mehr als nur das Weltliche umfasst, da er dieses mit dem Geistlichen bzw. Jenseitigen erweitert und verbindet. Laut Mockenhaupt wird im Parzival „die religiöse Problematik des der Weltkultur zugewandten Rittertums aufgegriffen und durchbehandelt; […] dabei wird die Religion als solche zur Grundlage dieses Rittertums gemacht, die sich ins Leben hinein auswirken soll“[44]. Demnach liegt im Parzival die Synthese der religiösen Elemente mit den Komponenten des Artusrittertums vor. In Bezug auf den Anteil der religiös-christlichen Elemente kann daher nicht ohne Vorbehalt davon ausgegangen werden, dass sie, wie Kratz beschreibt, nur im „background“ vorkommen.[45]
Es muss vielmehr aufgrund dieser religiös-ethischen Erweiterung hinterfragt werden, ob es Wolframs einzige Absicht war, sein Publikum zu unterhalten. Um dies zu überprüfen, ist im Folgenden die Intention Wolframs hinsichtlich der Wirkung des Parzival näher zu betrachten.
2.2 Wolframs Wirkungsästhetik
Die Frage nach der Wirkung der Literatur kann im Falle der mittelalterlichen Dichtung häufig von den Autoren bzw. dem Erzähler indirekt selbst beantwortet werden. Dies ist nach Brall möglich, indem die Reflexionen über die Wirkintention und Wirkungsmöglichkeiten des Erzählens aus dem Text heraus gedeutet werden, die insbesondere im Prolog, Epilog und den Erzählerkommentaren vorzufinden sind.[46] Jedoch gilt dies nicht für Wolframs Parzival, da er bzw. der Erzähler keine Angaben darüber macht, wie das Publikum das Werk auffassen soll.
Da auch über die Reaktionen des Publikums selbst und auch über die Vortragsweise in Bezug auf die Intonierung der Verse durch den Dichter/ Sänger nichts überliefert ist, muss die Wirkintention anhand des Textes bzw. des Erzählstils des Autors ermittelt werden. Hierbei wird die Entfaltung von zentralen Elementen der Dichtung und deren Einführung in die Geschichte analysiert. Als Primärbeispiel kann hier der Gral aus Wolframs Parzival dienen. Dieser Gral ist vor Wolframs Parzival nur in den Werken von zwei französischen Dichtern überliefert. Zum einen in dem Li romanz de l´estoire du Graal von Robert de Boron, bei dem der Gral mit der Heilsgeschichte verknüpft wird, indem er ihn als den Abendmahlskelch beschreibt, in dem das Blut Jesu Christi nach dessen Kreuzigung aufgefangen wurde und der dann von Joseph von Arimathäa vor den Römern verborgen wurde.[47] Zum anderen ist der Gral Bestandteil der Erzählung von der umstrittenen Quelle Wolframs, dem Conte du Graal von Chrétien de Troyes. Bei diesem ist er zwar nicht wie bei Robert als Abendmahlskelch ausgewiesen, dennoch wird der Gral mit der Heilsgeschichte verknüpft und zudem entsprechend der Wortherkunft von dem niederländischen „Graal“ noch als Schüssel beschrieben, wobei zumindest in der Form eine direkte Ähnlichkeit zu Robert besteht.[48]
Der Gral im Parzival wird jedoch lediglich als stein beschrieben, ohne einen Hinweis auf die Art des Steins und „ohne die geringste Angabe zu Form, Farbe und Größe.“[49] Im Gegensatz zu den vorigen Gralromanen verquickt Wolfram seinen Gral auch nicht mit der Heilsgeschichte. Allerdings verleiht er dem Gral überirdische Fähigkeiten. So konstatiert unter anderem Strohkirch, dass der Gral Wolframs „dem Betrachter ewiges Leben beinahe ohne Altern schenkt und eine paradiesische Versorgungslage an Nahrungsmitteln erzeugt.“[50] Die Kraft hierzu erhält er durch eine Oblate, die immer am Karfreitag von einer Taube aus dem Himmel gebracht und auf den Gral gelegt wird.[51] Dadurch wird der Gral „aus der höfisch-ritterlichen Sphäre in die geistlich-ritterliche emporgehoben.“[52] Eine christlich-religiöse Komponente ist demnach im Hinblick auf die Beschreibung des Grals nicht zu leugnen. Durch die ungenaue Beschreibung mystifiziert Wolfram diesen Gral jedoch. Ebenso vermag Wolfram mit dem Gral eine Spannung aufzubauen, indem er die Informationen über die Beschaffenheit und die Fähigkeiten des Grals dem Hörer/ Leser nur zu bestimmten Zeitpunkten der Geschichte preisgibt.[53] Trotz der undeutlichen Informationen über den Gral und der damit bewirkten Mystifizierung schreibt Wolfram ihm eine entscheidende Rolle in der Geschichte zu, wodurch er ebenso eine Spannungssteigerung erreicht.[54]
Insgesamt ergibt sich am Exempel des Grals ein ambivalentes Bild. Zum einen setzt er ihn in Verbindung zum Himmel und somit auch möglicherweise zu Gott bzw. in eine religiöse Sphäre, verwendet aber andererseits diese Informationen auch um eine Spannung aufzubauen.
Somit stehen sich zwei Wirkungsoptionen entgegen. Erstens eine religiös-christlich intendierte Wirkung, der mit dem Bezug zur Heilsgeschichte ein ernstes Thema zu Grunde liegt, und zweitens eine unterhaltende Wirkung.
Zur Absicht, das Publikum zu unterhalten, kann allerdings weiterhin Wolframs Komik angeführt werden.[55] Das komische Moment fällt laut Nellmann dem Hörer/ Leser daher auf, da Wolfram eine humoristische Eigenart entwickelt, die sich im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Dichtern deutlich von diesen absetzt. Wie auch Bumke anmerkt, treten verstärkt Wortwitze auf, die fast immer dieselbe Struktur haben und daher als Markenzeichen Wolframs gelten können.“ Des Weiteren zählen laut Bumke ausgefallene Neubildungen, insbesondere in Bezug auf komisch klingende Namen und Beschreibungen über gesellschaftliche Zustände, die von der höfischen Norm abweichen, zu Wolframs komischem Erzählstil.[56] Der „Hauptgegenstand der Komik“[57] bei Wolfram ist, so Bumke, jedoch die übersteigerte Darstellungen des menschlichen Körpers und dessen Funktionen.
Deutlich wird daran, dass Wolfram auf ein breites Spektrum der Komik zurückgreift, was wiederum die Sonderstellung der Komik in seinem Erzählstil bestätigt.
Aufgrund dieser Komik kann angenommen werden, dass Wolfram in erster Linie die Absicht verfolgt, das Publikum erheitern zu wollen. Daher konstatiert auch Bertau im Hinblick auf Wolframs Wirkintention, er suche „nicht Überwältigung, sondern kritische Distanz und befreiendes Gelächter seines Publikums.“[58]
Lowet hingegen betont wiederum das religiöse Moment, das seiner Meinung nach eine ebenso hervorstechende Stellung im Erzählstil einnimmt wie die Komik. Anhand der detailgetreuen Beschreibungen christlicher Rituale, wie beispielsweise dem Ablauf einer Taufe am Beispiel des Feirefiz und der ausschweifenden Berichte Trevrizents über die Schöpfungsgeschichte, folgert Lowet, dass Wolfram „nicht nur anregen oder unterhalten will, sondern sich mit den geistigen Problemen, die er vorfindet, in seiner Dichtung auseinandersetzen (will).“[59]
An diesen gegensätzlichen Interpretationen wird deutlich, dass anhand des Textes nicht eindeutig auf Wolframs Wirkintention geschlossen werden kann. Da sich die Auslegungen an der religiösen Komponente des Textes bricht, muss diese in ihrem Ursprung näher untersucht werden. Um zu einem Ergebnis hinsichtlich der intendierten Wirkung des Parzival zu kommen, ist daher Wolframs Bezug zur Religion näher zu betrachten.
2.3 Die Religiosität Wolframs und das Religiöse in seinen Werken
Wolframs beweist am Ende des Parzival eine gewisse religiöse Weitsicht, die sich dem Zuhörer/ Leser in der Vorausdeutung auf Feirefiz´ und Respanses de Schoyes weiteres Leben im Orient und der vorhergehenden Taufe von Feirefiz eröffnet. An dieser und dem Kind namens Johannes, das die reinste Christin innerhalb der Gralsgesellschaft Respanse de Schoyes gebiert, wird deutlich, „daß der Taufburleske in Munsalvaesche geradezu heilsgeschichtliche Bedeutung zukommt, insofern sie (die Taufe) die Christianisierung des Orients einleitet.“[60] Mit der Identifizierung von Feirefiz´ Sohn Jôhan mit dem Presbyter Johannes verweist Wolfram auf eine historisch reale Gestalt und zwar auf einen christlichen Herrscher im Orient, der große Reichtümer besaß.[61] Bezeugt ist dieser Priester Johannes über einen lateinischen Brief, den er selbst verfasst an den byzantinischen Kaiser Manuel geschickt haben soll, in dem er berichtet, dass er die Perser und die Meder besiegt hat. „Dieser Brief ist in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden und war in mehreren Fassungen verbreitet.“[62] Eine dieser Fassungen muss Wolfram gekannt haben, was eine Aussage über seine Bildung auf dem Gebiet der christlichen Literatur zulässt. Auch wenn Wolfram diese Schrift und deren Thematik kannte, hätte er sie aber noch nicht wieder aufgreifen müssen; dennoch baut er Teile dieser Geschichte über den Priester Johannes in sein eigenes Werk ein, was andeutet, dass er sich mit dem Inhalt und der Bedeutung des Briefes näher befasst haben muss.
Einen weiteren Aufschluss über Wolframs Religiosität liefert zudem der nach dem Parzival von ihm verfasste Willehalm. Dessen Prolog beginnt bezeichnenderweise mit einem Gebet. Dieses Gebet, so Ohly, „an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in einer klaren Dreiergliederung ordnend wie der Dichter der Littanei (sic!), läßt Wolfram nach dem Gesamtanruf der Trinität, der kirchlichen Appropriationslehre folgend, den Vater und Schöpfer als potentia, den Sohn als sapientia und den Heiligen Geist als bonitas wirksam erscheinen.“[63] Diese Orientierung an den Vorgaben für Gebete und die Kreuzzugsthematik sowie die Tatsache, dass Wolfram sein Werk mit einem Gebet beginnt, lassen auf eine Affinität Wolframs zur Religion bzw. dem christlichen Glauben schließen.
Das Gebet an den heiligen Geist ist laut Schwietering zudem als „christliche Devotionsformel“[64] zu interpretieren, derer sich neben den Laienpredigern auch die mittelalterlichen Dichter bedienten. Der Dichter bezeugt somit seine Demut vor Gott. Der Parzival enthält allerdings kein solches Gebet. Zudem wird auch bei diesem nicht ersichtlich, ob der Erzähler oder der Autor sich demütig und ehrfürchtig vor Gott erklären.[65] Stand beim Willehalms die Nennung der Trinität zu Beginn des Werkes, so taucht die Darstellung Gottes beim Parzival erst zum Schluss auf, da sich bei diesem das Gottesbild auch erst im Laufe der Geschichte entwickelt und herauskristallisiert. Weiterhin nimmt entgegen dem Parzival der christliche Gott im Willehalm keine Stellung ein, von der der gesamte Ausgang des Romangeschehens abhängig gemacht wird, denn wie schon Mohr oben verdeutlichte ist es Gottes Gnade, die es dem Helden erlaubt, den Gral zu erringen. Vordergründig liegen daher verschiedene Gottesbilder bzw. Gottesdarstellungen zwischen Wolframs Werken vor.
Da in dieser Arbeit allerdings der Bezug des Titelhelden Parzival zu dem von Wolfram dargestellten Gott untersucht wird, gilt es, dieses Gottesbild näher zu bestimmen. Dies wird zuerst vor dem Hintergrund der literarischen Darstellungen Gottes vorgenommen. Dabei wird betrachtet, wie Gott oder Götter in der mittelalterlichen Dichtung um 1200 und davor dargestellt wurden. Hierbei sollen primär die Gottesdarstellungen in den zeitgenössischen Werken untersucht werden, auf die Wolfram im Parzival verweist, da er über diese demenstprechend Kenntnis hatte und sich womöglich bei seiner Darstellung Gottes an diesen orientiert hat.
3. Gottesbilder in der mittelalterlichen Dichtung
Hinsichtlich der unterschiedlichen Gattungen der von Wolfram benannten Werke mahnt Theisen, zu differenzieren, ob in der jeweiligen Dichtung nur von Gott gesprochen wird oder ob ein tatsächliches Handeln Gottes beschrieben wird, denn bezüglich der Antikenromane und wie dem dem Eneasroman Heinrichs von Veldeke oder dem Straßburger Alexander des Pfaffen Lamprecht, ist gegenüber der Artus- oder Gralsepik zu konstatieren, dass die antiken Götter als handelnde und somit den Verlauf der Geschichte mitbestimmende Figuren beschrieben werden.[66] So werden im Eneasroman von Veldeke unter anderem auch Handlungen der Götter untereinander beschrieben, wie am Beispiel der Geschichte über die Anfertigung von Eneas´ Rüstung deutlich wird. Hierbei wird von der Göttin Venus berichtet, dass sie die Rüstung von dem Gott Mars anfertigen lässt, wobei für diese beiden eine Beziehung anhand menschlicher Züge erzählt wird. Ebenso wie die Götter untereinander reden und handeln, können sie dies auch mit den übrigen Figuren der Geschichte. Eine solche Situation stellt Veldeke bei dem Dialog zwischen Eneas und seiner Mutter Venus dar, als diese ihm die Rüstung übergibt.
Die Artusepik weist dagegen derartig beschriebene Handlungen Gottes nicht auf. Die Diskussion zwischen Göttern wäre im Falle des monotheistischen christlichen Gottes auch nicht möglich, da es sich nur um einen einzigen Gott handelt, der daher auch nicht mit anderen Göttern interagieren kann. Ebenso wird dieser christliche Gott auch nicht als handelnde Figur erzählt, die in Interaktionen mit den menschlichen Figuren tritt. Wie Theisen bemerkt, können sich die Personen, von denen erzählt wird, zwar „alles Mögliche unter Gott und dem Wirken Gottes und den Regeln des Wirken Gottes vorstellen“[67], ein tatsächlich aktives Eingreifen als handelnde Figur wird im Falle des christlichen Gottes in der mittelalterlichen weltlichen Literatur jedoch nicht beschrieben.[68]
Gott greift zwar im Erec in die Handlung und den Verlauf der Geschichte ein, als Erec mit dem Tode ringt und Enite sich im Glauben, dass Erec bereits tot sei, mit einem Schwert erstechen will. Allerdings wird das Handeln bzw. Eingreifen Gottes wiederum nur durch den Erzähler berichtet:
(ER, Vers 6115) nû kam geriten ein man,
der si es erwande,
den got dar gesande. (…)
den hâte got dar zuo erkorn,
daz er si solde bewarn.
Woher nun der Erzähler weiß, dass diese Handlung von Gott so gewollt und durchgeführt wurde, wird an dieser Stelle natürlich nicht hinterfragt, sondern es wird unzweifelhaft angenommen, dass der allwissende Erzähler über diese Hintergründe bescheid weiß.
Ein Eingreifen Gottes erscheint zwar für den aufgeklärten heutigen Leser/ Hörer befremdlich, dürfte aber dem mittelalterlichen Hörer/ Leser als absolut legitim erschienen sein, da diese Darstellung dem Gottesbild entspricht, wie es die Kirche im Mittelalter predigte und in der geistliche Dichtung und theologischen und philosophischen Schriften des Mittelalters beschrieben wird.
Wie Schwarz feststellt, formiert sich die mittelalterliche Gottesvorstellung entgegen den philosophischen Deutungen Platons oder der Gnostiker nicht um ein rein transzendentes Gottesbild, das fern der menschlichen Existenz sich nur im Jenseits offenbart, sondern um den „Begriff des Gottmenschtums“[69]. Bei dieser Auslegung der mittelalterlichen Gottesvorstellung orientiert sich Schwarz an den Schriften des nach seiner Meinung für die Kirche bedeutendsten und für das mittelalterliche Gottesverständnis prägendsten Theologen Augustin von Thagaste in Numidien[70] (354 – 530 n.Chr.). Dieser untersucht und beschreibt das Verhältnis Gottes zum Menschen in seiner Abhandlung über die Confessiones, wobei er primär auf die Briefe des Paulus im Alten Testament und deren Aussagen zum Gottesbezug der Menschen aufbaut. Das Gott-Mensch-Verhältnis erwächst dabei aus der Schöpfungsgeschichte, in der erzählt wird, dass Gott den Menschen auf sein Abbild hin geschaffen und mit freier Willensentscheidung ausgestattet hat. Gott bleibt aber immer „das am meisten Seiende (summe est), da Sein und Einssein dasselbe und Gott die Ureinheit sei, alles Übrige nur teilnehme. Ohne ihn ist nichts, weil alles durch ihn ist.“[71]
Für den Armen Hartmann ist Gott zum einen der große und mächtige Schöpfer, der den Menschen geschaffen und die Welt zu dessen Nutzen geschaffen hat, „er ist aber auch der gnädige Gott.“[72] Gott wird über alles gestellt, was wie Freud bemerkte, den Menschen einschüchtern muss und ihn in seiner Entwicklung begrenzte, da er sich immer als Unfreier sehen wird, der sich nie voll entfalten kann.[73] Diese alleinige Stellung Gottes an der Spitze einer künstlich geschaffenen Hierarchie ist eine Besonderheit nur bestimmter Religionen. So verweist z.B. Petermann darauf, „daß Griechen und Römer sowie ihre indogermanischen Vorfahren im Gegensatz zu den monotheistischen Religionen des Judentums, des Christentums und des Islams die Vorstellung von einem in jeder Hinsicht absoluten Gott fremd war.“[74]
3.1 Gottesvorstellung und Gottesdienst im hohen Mittelalter
Dieses Gottesbild des gnädigen Herrschers und der christliche Glaube insgesamt durchsetzen und prägen das hohe Mittelalter und dessen Gesellschaft, so Angenendt, was unter anderem an der anwachsenden Zahl des spirituell-mystischen Schrifttums im 12. Jahrhundert und an dessen Inhalt deutlich wird.[75] Wie Wilson an den Schriften St. Bernhards von Clairvaux zeigt, beschäftigen sich diese hauptsächlich mit der Beziehung der Menschen zu Gott bzw. dem Glauben an diesen, wobei sie Hinweise und Anweisungen geben, wie diese Beziehung ordnungsgemäß zu pflegen ist.[76] Ebenso wird der Bezug zur Religion in den geistlichen Schriften selbst bezeugt. So wurde, laut dem Predigtbuch des Priesters Konrad und dessen Abschnitt zur Messpredigt, die Messe „täglich gefeiert, um die Menschen im Dienst Gottes zu befestigen (63/1; 76/25).“[77] Dies entspricht der Auslegung des 2. Buch Mose, anhand dessen Grünwaldt feststellt, „dass zur Gottesbeziehung zwei elementare Vollzüge gehören: die Ethik und der Gottesdienst. Die Menschen, die Gott in seine Gemeinschaft ruft, sollen ihr Leben nach ihm ausrichten, und dazu gehören ein Leben nach dem Willen Gottes sowie der Gottesdienst mit Opfer und Gebet.“[78]
Dieser Gottesdienst wird heute zwar auch noch geleistet, der Stellenwert, den der Gottesdienst für die mittelalterliche Gesellschaft hatte, kann aber anhand der heutigen Form nicht mehr nachvollzogen werden. In der heutigen modernen, aufgeklärten Gesellschaft kennt nur ein Bruchteil der Mitglieder einer Gesellschaft den Inhalt und den Ablauf von Gottesdiensten, da die Kirche und der christliche Glaube im Leben vieler Menschen eine geminderte Rolle spielen. Dem entgegen wurden im Mittelalter „nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens […] in die christliche Liturgie integriert, von der Geburt und Eheschließung bis zu Krankheit und Tod. Außerdem prägten Gebet, Kirchen- und Heiligenfeste die Zeit im Tages- und Jahresablauf.“[79] Wobei der Begriff der Liturgie für den Gottesdienst erst seit der Frühneuzeit geläufig wurde.
In diesem Gottesdienst beten die Menschen zu Gott und bitten ihn somit um seinen Beistand, die Vergebung ihrer Sünden. Denn nur wer Gott liebt und ihm aus Liebe dient, kann, wie das Predigtbuch des Priesters Konrad besagt, „den Tod Christi für sich fruchtbar machen.“[80] Dass dieses Fruchtbar machen des Todes Christi im Sinne und Wollen der Menschen liegt, ergibt sich aus der Sündhaftigkeit aller Menschen, die wiederum aus der Erbsünde folgt.
Diese Erbsünde ergibt sich aus dem Sündenfall, wie ihn die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament berichtet. Den ersten Menschen, Adam, so heißt es dort, hat Gott aus sich selbst heraus geschaffen und ihm als sein Geschöpf nur eine einzige Auflage erteilt, und zwar, ihn zu lieben und nicht an ihm zu zweifeln. Wie aber das Predigtbuch Konrads zeigt, werden sie Gott abtrünnig, als sie vom Teufel in Versuchung geführt werden. „Durch die Sünde verlieren die ersten Menschen den Stand der Unschuld (den namen maide 261/24), und Gott verstößt sie wegen ihres Ungehorsams auf die Erde.“[81]
Wie Grünwaldt davon ausgehend zeigt, hat zwar „die der Sünde verfallene Welt […] den Tod verdient, aber aus Liebe zu seinen Geschöpfen hat Gott entschieden, die Welt nicht noch einmal wie in der Sintflut dem kollektiven Tod auszuliefern. Stattdessen hat er selbst den Tod auf sich genommen, aber uns angerechnet.“[82] Den Tod der Menschen hat er durch seinen Sohn Jesus Christus, den er geschickt hat, um die Menschen zu erlösen, auf sich genommen, wie im Neuen Testament von den Aposteln berichtet wird. „Eine zentrale neutestamtentliche Stelle zum Verständnis des Sterbens Jesu für uns ist Markus 10,45: ´Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele´.“[83]
Durch die Taufe zum Christen bekennt der Mensch sich zu Christus und den Sünden der Menschheit, wodurch er mit Christus am Kreuz stirbt. Dadurch ist jedoch auch der „in jedem Menschen fortlebende Adam, der Sünder, mit Christus gekreuzigt worden oder – im Bild der Taufe – im Taufwasser ertränkt worden, damit der Leib nicht mehr die Sünde zur Wirkung kommen lassen soll.“[84] Im Zentrum des christlichen Glaubens steht daher laut Grünwaldt „die Bekenntnis, dass Jesus Christus für uns gestorben ist.“[85] Da Gott uns Menschen aber somit „den Tod Jesu als unseren Tod anrechnet, so rechnet er uns Jesu Leben als unser Leben zu. Für uns heißt das, nicht so zu leben, als sei unser Leben unser Verdienst.“[86]
Daher steht der Mensch in Gottes Schuld und sollte ihm daher im eigenen Interesse dienen, da nur über den Dienst an Gott auch, wie Konrad oben beschreibt, der Tod Gottes für den Menschen fruchtbar wird. Da der Mensch zudem auch noch nach der Taufe Sünder bleibt, so Grünwaldt, sollte es auch darüber hinaus in seinem Interesse liegen, Gott durch das Befolgen seiner Ordnung und durch Demut und Buße zu dienen. Hierbei richtet er sich nach dem oben schon angesprochenen Augustin, der laut Grünwaldt die Taufe nicht als völlige Erlösung von der Erbsünde erklärt: „Die Erbsünde wird in der Taufe vergeben, nicht dass sie nicht nicht mehr sei, sondern dass sie nicht mehr zugerechnet werde.“[87] Durch die Veranlagung als Sünder, kann der Mensch jedoch jederzeit der Sünde verfallen. Wie auch Konrad in seinem Predigtbuch weiterhin feststellt, sündigen die Menschen täglich, „denn Keiner ist frei von Sünde.“[88] Allerdings sind bei diesen Sünden nun die persönlichen Sünden gemeint. Denn wie Mertens für die Predigten aus dem Predigtbuch des Priesters Konrad konstatiert, „wird zwischen der Erbsünde (sunden, die iuch ane gerbet waren 174/28) und der persönlichen Sünde (die ir selbe virdient hetet 174/29) unterschieden.“[89] Die persönliche Sünde scheidet die Menschen in gut und böse, trennt den Sünder von Gott und gibt seine Seele in die Gewalt des Teufels.[90]
Der Antrieb des Menschen, kein Sünder sein zu wollen und somit die Notwendigkeit des Gottesdienstes und das Hoffen auf Gottes Gnade, ergibt sich zudem aus der Ankündigung des Jüngsten Gerichts, das laut Hörner in etlichen Predigten des Mittelalters beschrieben wird.[91] Bei diesen Beschreibungen erscheint Christus in seiner ganzen Pracht, als Herrscher-Richter, als König und Triumphchristus, um über die Menschen zu richten.[92] In den meisten Predigten über das Jüngste Gericht, werden dann die Toten erweckt und müssen neben den Lebenden vor Jesus treten, der anhand ihrer Sünden, die sie nicht vor ihm verbergen können, darüber richtet, ob sie in die Hölle und somit zur ewigen Strafe verdammt werden oder in den Himmel kommen.[93]
Damit Gott die Sünden im Jenseits nicht rächt, „soll der Mensch um ein langes Leben bitten, daß er seine Sünden noch im Diesseits abbüßen kann.“[94] Völlig frei wird er zwar durch die Buße nicht, aber er zeigt sich dadurch Gott gegenüber demütig und bestätigt diesem so seine Liebe und Loyalität zu ihm und beteuert zudem, seiner ordo weiterhin zu folgen.[95]
Ein Beispiel aus der mittelaltlerlichen Literatur für ein Verhältnis von Protagonist zu Gott, das durch Demut und Buße des Helden wieder korrigiert wird, bildet der Gregorius Hartmanns von Aue. Dessen Protagnist Gregorius hatte aus Unwissenheit Inzucht begangen, diese Sünde jedoch daraufhin 17 Jahre auf einem Felsen in Askese lebend abgebüßt. Direkt nachdem er die Sünde erkennt entscheidet er sich „ohne Anflug von Auflehnung oder Verzweiflung musterhaft für den rechten Weg; er ist sogleich bereit, Buße zu tun und sich Gottes Gnade anzuvertrauen.“[96]
Allerdings bedeutet der Verweis auf Gottes Gnade hier, dass er darauf hoffen soll, von seinen Sünden erlöst zu werden, denn wie auch im Fall der Erbsünde, sind die Sünden lediglich vergeben, nicht aber vergessen und völlig getilgt. Die einzige Möglichkeit von den Sünden erlöst zu werden, führt daher über Gottes Gnade.
Da diese Gnade Gottes im Parzival an zentraler Stelle wirksam wird, wenn die Gralsbotin Cundrîe Parzival mit den Worten got will genâde an dir nu tuon (V. 781,4) zum Gral und zur Erlösung Anfortas beruft, muss diese nun näher betrachtet werden.
3.2 Gottes Gnade und das Gottesgnadentum
Im Hinblick auf das christliche Gnadenverständnis kann für den Parzival die Gnadenlehre Augustins herangezogen werden. Diese wird trotz Augustins verstärkter Rezeption im Mittelalter hier nur verkürzt angesprochen wird, da eine ausführliche theologische Diskussion der vollständigen Gnadenlehre Augustins den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.[97]
Die zentrale Aussage seiner späteren und der, aufgrund der Überarbeitung und Revidierung der Vorigen, daher als letztendlich richtig angenommenen Gnadenlehre, offenbart sich darin, dass die Gnadenzuteilung Gottes willkürlich bzw. für den Menschen nicht nachvollziehbar ist.[98] Somit ermöglicht diese auch, dass ebenso die Sünder von dieser Gnade Gottes erfasst werden können. Wie auch Neumann anmerkt, ist in Augustins Gnadenlehre „das Verhältnis zwischen menschlichem Verdienst und göttlicher Gnade, zwischen Ursache und Wirkung […] aufgelöst. Die göttliche Gnade wird nicht aufgrund guter Werke erteilt, und es ist unzulässig zu erwarten, daß zumindest jeder, der sich durch gute Werke empfiehlt, von Gott begnadet wird.“[99] Hinsichtlich der Möglichkeit sich durch gute Werke Gottes Gnade zu verdienen, würde das laut Augustinus bedeuten, dass Gottes Entscheidung beeinflussbar wäre. Dies würde Gottes Macht gegenüber den hierarchisch niederen Menschen einschränken.[100] Wie auch der Priester Konrad daher im Predigtbuch erläutert, hat Gott in seiner Huld bestimmte Menschen zum ewigen Leben erwählt, „doch nur er allein weiß, wer erwählt ist und wer nicht.“[101]
Der göttlichen Gnade hat sich zudem aber auch das weltliche Königtum bedient, um seine Machtstellung zu legitimieren. „Denn da nach biblischer Lehre (Röm. 13,1) alle Gewalt von Gott kommt, war folglich alle Herrschaft Ausfluß seiner Gewalt und der König selbst imago Dei: ´Bild Gottes´.“[102] Diese Herleitung wurde im 8. Jahrhundert erstmals von den Karolingern praktiziert und ist, wie Fleckenstein ergänzt, für das gesamte Mittelalter und weit darüber hinaus von grundlegender Bedeutung geblieben“[103]. Seitdem macht es das Wesen der Herrschers aus, „daß der König ´von Gottes Gnaden´ (gratia Dei rex) seine Herrschaft als von Gott verliehenes Amt verstand.“[104] Diese Bezeichnung bleibt insofern präsent, indem sie bei der Betitelung immer mit genannt wird. Dies kann unter anderem anhand von Urkunden bezeugt werden, wie z.B. mit der am 11. Februar 1243 in Hagenau ausgestellten Urkunde, in der König Konrad IV. einen Spruch über den Nachweis von Lehnsbesitz eines Mannen durch das Zeugnis der Lehnsgenossen bestätigt. Hierbei lautet die Benennung Konrads IV: „Conradus divi augusti imperatoris Friderici filius die gratia Romanorum in regem electus semper augustus et heres regni Ierusalem universis imperii fidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum.“[105] Die Legitimation der Herrschaft von Gottes Gnaden und der Verwendung dieser im Titel der Anrede ist bis heute erhalten geblieben, wie sich am Beispiel der Königin von England oder dem spanischen König verdeutlichen lässt.
Bei dieser Bezeichnung fällt allerdings in Verbindung zu der Thronfolgeregelung der Erbmonarchie ein Bruch zu der Gnadenlehre Augustins auf, denn dadurch, dass die Herrschaft meist an den direkten männlichen Nachfahren des Königs weitervererbt wurde, müsste dieser automatisch Gottes Gnade erhalten. Laut Augustin ist aber die Gnadenzuteilung Gottes willkürlich und für den Menschen nicht nachvollziehbar. Daran wird deutlich, dass sich die Herrscherweihe durch Gottes Gnaden nicht an der Gnadenlehre Augustins orientiert.
3.3 helfe und triuwe
Welches Gnadenprinzip bei Parzival zutrifft wird noch zu prüfen sein, denn dieser erhält zwar Gottes Gnade, wie oben angemerkt, diese steht aber neben ihrer weltlichen Bedeutung ebenso im Zusammenhang mit seiner Berufung zum Gralskönigsamt und somit seiner Legitimation und Einsetzung in ein Herrscheramt.
Um diese Gnade hatte Parzival allerdings nicht formell gebeten, wie es Gregorius tat, der zur Vergebung seiner Sünde auf die Gnade gehofft hatte. Parzival fordert und bittet allerdings in der Geschichte durchgehend um Gottes helfe und nicht um seine genâde.
Dies stellt ebenso Mohr fest, der die helfe -Motivik zu den terminologischen Leitmotiven des Parzival zählt, die das gesamte Werk durchziehen.[106] Dennoch gibt er zu bedenken, dass die helfe aber nicht mit einer einheitlichen Bedeutung verwendet wird, sondern verschiedene Inhalte umfasst. Dies kann zum einen die Kampfeshilfe sein, zum anderen aber auch die Minnehilfe oder die Wundenhilfe.[107] Wie sich die Hilfe also im Endeffekt äußert, ist unterschiedlich. Es kann auch nicht eine bestimmte Hilfe jeweils immer nur einer Figur zugeordnet werden, so dass z.B. Gawan nur im Zusammenhang mit der Minnehilfe genannt wird, da er auch Wundenhilfe leistet, wie im Falle des Ritters, der von Lischoys Gwelljus besiegt wurde und ohne sachkundige medizinsche Hilfe gestorben wäre (V. 505,15 – 507,9). Dies gilt zumindest für alle weltlichen Figuren. Gott hingegen wird fast durchgehend in Verbindung mit einer nicht spezifizierten Hilfe genannt. Wie auch Mohr konstatiert, ist, „wenn von Gottes Hilfe die Rede ist, […] häufig ganz allgemein ´Lebenshilfe´ gemeint. Der Inhalt der Hilfe wird nicht ausgesprochen, er ist auch kaum als etwas Konkretes in Gedanken zu ergänzen.“[108] Erst im IX. Buch wird die Hilfe Gottes durch den Einsiedler Trevrizent teilweise konkretisiert:
(V. 462,15) mit dienste gein des helfe grôz,
den der stæten helfe nie verdrôz
für der sêle senken.
Seine Hilfe muss sich somit auf die geistige Verfassung der Menschen beziehen, da er eingreift, wenn die Seele zu versinken droht. Wie sich diese Hilfe äußert, ist damit allerdings noch nicht erklärt. Diese Beschreibung gibt nur an, wann sie zum Einsatz kommt. Bereits Augustin wandte sich mit der Bitte um Hilfe an Gott, wobei auch er diese Hilfe nicht konkretisiert. So benennt er Gott im ersten Buch seiner Confessiones über dessen Funktion für die Menschen: „Du (sic!) meine Hilfe und mein Schutz“[109]
Da die helfe in Bezug auf Gott somit nicht genau benannt werden kann, versucht Mohr, über die jeweiligen Begleitvorstellungen diese zu charakterisieren. So stellt er fest, dass „vor allem triuwe im Bereich des Helfens und Ratens als typische Begleiterscheinung auftritt, und zwar in allen Inhalten.“[110], wobei die triuwe meist als Bedingung der helfe vorangestellt ist. Sie erscheint dadurch als notwendiges Kriterium für die Hilfe. „Die triuwe oder pietas, welche die Verwandten untereinander bindet („lehnsrechtlich“), welche Lebende und Tote bindend verbindet (sic!), sie verbindet auch Gott und die Menschen.“[111] Daher konstatiert auch Bertau, dass Wolfram im Parzival „das Verhältnis zu Gott als Verhältnis der triuwe gedacht werden läßt.“[112] Für die Gewährung von Gottes Hilfe, gleichwohl wie für die gesamte Beziehung Parzivals zu Gott, nimmt die triuwe somit eine Mittlerstellung ein.
Die Verbindung des triuwe -Motivs mit der helfe findet sich im Mittelalter zudem in einem Rechtsverhältnis konkret formuliert und zwar, wie Bertau es oben schon angeschnitten hat, ist das Prinzip der Treue und Hilfe in dem mittelalterlichen Lehnswesen formuliert. Diese vertragliche Regelung zwischen zwei Personen baut insofern auf die Treue auf, „daß der Vasall seinem Herrn aufgrund seiner Treue, seiner fides, dient.“[113] Für seine Treue und seinen Dienst erhält er neben sachlichen Gaben ebenso die Zusicherung der Treue seines Herrn ihm gegenüber. Wie im Folgenden ausführlicher gezeigt wird, handelt es sich somit, wie auch Haferland konstatiert, um das Grundmuster einer sozialen Interaktionsform, die über die rechtliche Regelung hinausgeht.
4. Zwischenmenschliche Beziehungen in der mittelalterlichen Gesellschaft
Durch das jeweilige Versprechen der Treue ergibt sich das „Muster der Reziprozität.“[114] Die archaiche Form dieser Reziprozität, so Haferland, ist der Gabentausch. Allerdings müssen es „nicht notwendig Gaben sein, über die sich Reziprozität ausdrückt. Gaben lassen sich substituieren durch ein Verhalten, das ähnliche Wirkung hervorbringt.“
Da es sich bei diesem Muster der Reziprozität zwischen zwei Personen um eine soziale Interaktionsform handelt, kann diese anhand der soziologischen Handlungstheorie analysiert werden. Hierzu wird das Modell des Homo Sociologicus, wie Schimank es anhand der klassischen Soziologie beschreibt, verwendet. Laut diesem werden mit der Vergabe einer Gabe oder auch einer Gefälligkeit, wie z.B. einer nicht sachgebundenen Hilfeleistung, an den jeweiligen Interaktionspartner bestimmte Erwartungen geknüpft. Vereinfacht ausgedrückt, erwartet der Geber von dem Nehmer eine adäquate Gegenleistung, ebenfalls in Form einer Gabe an ihn.[115] Mit einer Gabe, unabhängig davon ob sie sachgebunden ist oder nicht, wird daher eine Erwartungshaltung erzeugt, die entweder von dem Interaktionspartner enttäuscht oder erfüllt werden kann, woraus sich wiederum positive oder negative Sanktionen oder Einstellungen zu dem Gegenüber ergeben.[116]
Dieses Muster der sozialen Interaktion, liegt, wie Haferland anmerkt, in den Lehnsverträgen in schriftlich und rechtlich fixierter Form vor.[117] Ebenso werden laut Brall diese Grundmuster sozialer Interaktion im literarischen Medium erprobt.[118] Es gilt zwar zu beachten, dass es sich bei der Literatur nicht um faktische Geschichtsschreibung, sondern um Fiktion handelt und somit die Interaktionsformen gegenüber der Realität abgeändert werden können.[119] Da soziale Interaktionsformen der Reziprozität jedoch „den Grundbaustein im Netzwerk höfischer Interaktion schaffen“, wie unter anderem am Lehnsrecht verdeutlicht werden kann, folgt die Dichtung laut Haferland meist den grundlegenden Formen, wie sie aus der Realität bekannt sind.[120]
Dies belegt er unter anderem daran, was von den Dichtern in ihren Werken als bekannt vorausgesetzt und was neu eingeführt wird. Führen die Dichter entgegen der Realität veränderte Figuren, Dinge oder gesellschaftliche Zusammenhänge, über die sie erzählen, in die Texte neu ein, so müssen sie diese dem Publikum erst bekannt machen. Dies ist notwendig, um das Verständnis der Erzählung auf Seiten des Publikums zu gewährleisten, da der Autor manche Dinge, die er neu erfindet, nicht beim Publikum als bekanntes Wissen voraussetzen kann.
Dies kann unter anderem am Beispiel des Grals im Parzival oder auch an dem Regel- und Ordnungssystem innerhalb der Gralsgesellschaft verdeutlicht werden. Um das Verständnis der Abläufe und Interaktionen der Gralsgesellschaft nachvollziehen zu können, muss Wolfram diese dem Publikum bekannt machen. Das Ordnungssystem der Gralsgesellschaft entspricht zwar nicht dem der höfischen Gesellschaft, wie Pratelidis anhand eines Vergleichs zur höfischen Artusgesellschaft darstellt[121], wodurch ihre Gesetze auch von Wolfram beschrieben werden müssen. Was er jedoch nicht neu einführen und beschreiben muss, sind die generellen „Annahmen über die Beschaffenheit der Welt, Kenntnisse sozialer Institutionen, Wissen über Regeln des Verhaltens und Handelns, Formen ästhetischen Ausdrucks.“[122] Wie auch an der Gralsgesellschaft verdeutlicht werden kann, bauen die sozialen Interaktionen innerhalb dieser Gesellschaftsordnung ebenso auf das Muster der Reziprozität auf. Indem die Gesellschaftsmitglieder sich treu gegenüber dem Gral verhalten, seinem Ordnungssystem folgen und ihm dadurch dienen, indem sie ihn beschützen, werden sie von diesem mit allem versorgt, was sie benötigen. Außerdem gewährleistet der Gral diesen einen gewissen Schutz bei ihren Kämpfen, da jemand, der ihn gesehen hat, laut der Aussage Trevrizents, eine Woche lang unverwundbar ist.
Diese soziale Interaktionsform der Reziprozität kann darüber hinaus auch neben der fiktiven Gralsgesellschaft auf die mittelalterliche Gesellschaft und ihr Verhältnis zu Gott übertragen werden. Ganz plakativ gesagt, dienen hierbei die Menschen Gott und erwarten dafür von ihm eine Entlohnung in Form einer Nichtbestrafung am Jüngsten Gericht. Inwiefern diese Aussage eingeschränkt werden muss und wie sie auf Parzival und seine Beziehung zu Gott übertragen werden kann, wird an anderer Stelle diskutiert. Vorab muss zu einer Deutung entlang dieser Interaktionsform das oben bereits genannte mittelalterliche Lehnsrecht näher beschrieben werden, da laut Haferland die Lehnsverträge diese Interaktionsmuster schriftlich und formell fixiert enthalten und somit anhand eines Vergleichs zu der Verwendung der Leitmotive im Parzival einen Orientierung Wolframs an diesen Interaktionsformen untersucht werden kann.
4.1 Das Lehnswesen
Das Lehnswesen bzw. spezieller das Lehnsrecht beschreibt ein zwischen zwei Personen rechtliches Verhältnis, das erstmals im 8. Jahrhundert im deutschen Raum auftaucht und dokumentiert wurde, sich seitdem weiterentwickelt hat und im Mittelalter zu seiner vollen Blüte aufwuchs.[123] Für die ursprüngliche Form eines Lehnsverhältnisses aus dem 8. Jahrhundert gibt Bosl das Beispiel einer commendatio[124] aus der Formula Turonensis Nr.48, „in der sich ein armer Freier, der sich weder kleiden noch ernähren kann, in alterius mundoburdum tradere vel commendare debet, wobei er ingenuili ordine… servicium vel obsequium verspricht und – […] – lebenslängliche Dauer und Unkündbarkeit zugesichert erhält.“[125] Bis zum 12. Jahrhundert hatte sich das Lehnswesen soweit ausgeweitet, dass es nicht mehr nur von den ärmsten Personen gebraucht wurde, um sich Nahrung und ein Obdach gegen die Leistung von verschiedenen Diensten zu erkaufen, sondern von allen Mitgliedern der Gesellschaft, wodurch es auch zum politischen Mittel wurde.[126] Somit veränderte sich im Laufe der Zeit neben dem Lehen selbst, das sich, laut Ganshof, immer stärker auf Land und materielle Dinge bezog, auch die Beziehung zwischen dem Lehnsherren, der das Lehen vergibt, und dem Vasallen, der das Lehen empfängt. In der Form des 8. Jahrhunderts war die Beziehung noch sehr persönlich und stark ausgerichtet auf den Lehnsherren, da die Vasallen direkt von diesen abhängig waren. Neben den gegenseitigen Pflichten und Rechten, die in der Kommendation formuliert waren und seit dem 9. Jahrhundert einheitlich mit der Formel des „ auxilium et consilium “[127] wiedergegeben werden, wurde ebenfalls seit dieser Zeit beim Eintritt in das Lehnsverhältnis die Leistung eines Treueides eingeführt. Dieser Treueid wurde unter der Anrufung Gottes und der Berührung einer res sacra geleistet und sollte eine persönlichere Bindung des Vasallen an den Lehnsherren bewirken, damit dieser eine zusätzliche Sicherung über die Dienste des Vasallen hatte. „Denn ein verletzter Eid war dasselbe wie ein Meineid, d.h. eine Todsünde.“[128] Wie Hauser unter anderem jedoch für das 12. Jahrhundert anmerkt, schwand durch die Verdinglichung des Lehens die persönliche Beziehung zwischen dem Lehnsherren und dem Vasallen und „das persönliche Moment der Treue, dieses besondere Band zwischen Herr und Vasall, trat zurück.“[129] Die formalen Pflichten der beiden Lehnsparteien veränderten sich jedoch fast nicht, was an der Formel des auxilium et consilium verdeutlicht werden kann, deren Verwendung unverändert seit der Karolingerzeit in den Lehnsurkunden überliefert ist. An dieser Stelle tritt zwar der Aspekt der Hilfe wieder auf, diese gilt aber hier, im Gegensatz zu der oben angesprochenen helfe Gottes, für beide Parteien reziprok. Das heißt aber nicht, dass Hilfe mit Hilfe vergolten werden muss, sondern dass der Vasall für seine Dienste, die er dem Lehnsherren leistet, von diesem jedwede Art von Hilfe erwarten kann, ebenso wie der Lehnsherr für das vergebene Lehen die Hilfe des Vasallen erwarten darf. Bei der Beziehung der Menschen zu Gott handelt es sich dagegen mehr um ein einseitiges Verhältnis, das auf Seiten Gottes nur mit Einschränkung als bindend bezeichnet werden kann. Die Pflicht der Menschen ist es dabei, Gott ihren Dienst zu erweisen, was ebenso wie beim Lehnswesen hauptsächlich durch Treue zum Herrn bzw. Gott geschieht, wobei die Menschen um Gottes Hilfe bitten dürfen, es ihnen aber nicht obliegt, diese nach dem Prinzip der Vergütung von Dienstleistungen rechtmäßig einzufordern. Da Gott als Schöpfer über allem steht, kann und darf er selbst entscheiden, ob er Hilfe gewährt oder nicht. Allerdings müsste die Gewährung von Hilfe in seinem Interesse liegen, da es sich um seine Geschöpfe handelt, für die er selbst bereit war, seinen eigenen Sohn auf die Erde zu schicken.
[...]
[1] Mohr, Wolfgang: Parzival und Gawan, In: Heinz Rupp (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach, Darmstadt 1966: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 306.
[2] Schröder, Walter Johannes: Der Ritter zwischen Welt und Gott, Idee und Problem des Parzivalromans Wolframs von Eschenbach, Weimar 1952: Herrmann Böhlaus Nachfolger, S. 253.
[3] Ebd., S. 253.
[4] Wieners, Peter: Das Gottes- und Menschenbild Wolframs im „Parzival“, Bonn 1973: Rudolf Habelt Verlag, S. 159.
[5] Zur tumpheit Parzivals vgl. Simson, Otto Georg von: Über das Religiöse in Wolframs Parzival, In: Heinz Rupp (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach, Darmstadt 1966: Wissenschaftliche Buchtgesellschaft, S. 215ff. Laut diesem ist Parzival in seiner Jugend noch „ tumb, eine unreifer Tor“ (ebd., S. 216), aufgund seiner Erziehung in der Abgescheidenheit im Wald von Soltane. Erst nach der höfischen Erziehung des Fürsten Gurnemanz legt er diese tumpheit ab.
[6] Vgl. hierzu auch Maurer, Friedrich: Parzivals Sünden, In: Heinz Rupp (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach, Darmstadt 1966: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 49-103. Maurer als auch Schröder folgen hinsichtlich der Definition von Parzivals Sünden der Sündenlehre Augustins. Laut dessen Schrift De libero arbitrio werden „echte Sünden auf der einen und Versagen aus Unwissenheit, Unvermögen als Folgen der Erbsünde deutlich geschieden, und es kann keine Rede davon sein, daß die aus Unwissenheit fließenden Vergehen und Versagen ´Sünden von vollem Gewicht´ seien.“ (Maurer, Friedrich: Parzivals Sünden, S. 81). Demnach ist der Zustand der Unwissenheit ein Zustand der Strafe, nicht aber der eigentlichen Sünde.
[7] Koppitz, Hans-Joachim: Wolframs Religiosität, Beobachtungen über das Verhältnis Wolframs von Eschenbach zur religiösen Tradition des Mittelalters, Bonn 1959: H. Bouvier & Co. Verlag, S. 160.
[8] Vgl. Bertau, Karl: Über Literaturgeschichte, literarischer Kunstcharakter und Geschichte in der höfischen Epik um 1200, München 1983: C.H. Beck Verlag, S. 52.
[9] Vgl. ebd., S. 52.
[10] Ebd., S. 52.
[11] Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach, 8. völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart/ Weimar 2004: Verlag J.B. Metzler, S. 133.
[12] Ebd., S. 133.
[13] Ebd., S. 134.
[14] Koppitz, S. 154.
[15] Simson, S. 209.
[16] Koppitz, S. 154.
[17] Vgl. ebd., S. 154f.
[18] Über Leitwörter und Leitmotive siehe auch Mohr, Wolfgang: Hilfe und Rat in Wolframs Parzival, In: Benno von Wiese und Karl Heinz Borck (Hrsg.): Festschrift für Jost Trier zu seinem 60. Geburtstag am 15. Dezember 1954, Meisenhein/ Glan 1954: Westkulturverlag Anton Hain, S. 173-197.
[19] Vgl. Roßnagel, Frank: Die deutsche Artusepik im Wandel, Die Entwicklung von Hartmann von Aue bis zum Pleier, Stuttgart 1996: Helfant Edition. und vgl. Kuhn, Hugo: Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart 1959: Metzler Verlag.
[20] Knapp, Fritz Peter: Von Gottes und der Menschen Wirklichkeit, Wolfram fromme Welterzählung Parzival, DVjs. 70 (1996), S. 351.
[21] Vgl. Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter, Darmstadt 1982: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 58., dieser geht davon aus, dass bei einem gewissen finanziellen Risiko, das der Druck auch damals schon beinhaltete wenn das gedruckte Werk keine Abnehmer bzw. Käufer fand, auch schon die frühen Verleger eine Art von Marktanalyse durchgeführt haben, um sich gegen mögliche Verluste aufgrund von „Ladenhütern“ abzusichern. Der Entschluss zum Druck ist, ausgehend von dieser Annahme, ein Indiz für die Popularität und Beliebtheit eines Werkes.
[22] Im Vergleich zu anderen Handschriften aus der Zeit Wolframs, stechen der Parzival als auch der Willehalm zahlenmäßig hervor. In der Gesamtanzahl sind von Hartmanns von Aue Iwein 32 Hss. und vom Erec 4 Hss. überliefert, von Ottfrieds von Straßburg Tristan sind 27 Hss. erhalten und von dem Nibelungenlied 33 Hss.; dahingegen stehen der Willehalm mit 70 erhaltenen Hss. und als Rekordhalter mit den meisten überlieferten Hss. der Parzival mit 15 vollständigen Hss., 71 Fragmenten und somit einer Gesamtzahl von 86 Hss. (vgl. Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter, S. 57). Simson hebt die Popularität des Parzival ebenso hervor, indem er von ihm als „dem höchsten Werk unserer mittelalterlichen Dichtung“ spricht (ebd., S. 207).
[23] Vgl. Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach, S. 1ff.
[24] Vgl. Nellmann, Eberhard: Wolframs Erzähltechnik, Untersuchungen zur Fiktion des Erzählens, Wiesbaden 1973: Franz Steiner Verlag. Dieser verweist zudem auf die Rolle des fiktiven Erzählers gegenüber dem realen Autor. So verweist er auch an dieser Stelle, dass Wolfram hier nicht in eigener Person spricht, sondern den Erzähler vorschiebt, „den er als analphabetisches Genie präsentiert.“ (ebd., S. 28).
[25] Über die Authentizität von Selbstaussagen in mittelalterlicher Literatur siehe auch Bertau, Karl: Über Literaturgeschichte. Bei dem Versuch, die biographische Person des Autors zu erfassen und im historischen Kontext zu belegen, verweist Bertau darauf, dass es sich bei der mittelalterlichen Literatur trotz häufiger Parallelen zum historischen Mittelalter um Fiktion handelt. In diesen erdachten Geschichten kann Wolfram „mit seinem Vorstellungsinventar ebensogut (sic!) ein armer Mann wie ein reicher Herr gewesen sein.“. Durch seine Kenntnisse über die ritterlichen und höfischen Gepflogenheiten ist zwar eine Nähe zum Rittertum gegeben, „aber stricto sensu beweisen, daß er dies oder das war, können wir kaum.“ (ebd., S. 44-45.). Siehe auch McDonald, William C.: Wolfram von Eschenbach, Der Mythos im Internet, In: Ulrich Müller und Werner Wunderlich (Hrsg.): Künstler, Dichter, Gelehrte, Konstanz 2005: UVK Verlagsgesellschaft, S. 567-582. Er sieht die wenigen Informationen über den Dichter vor der Größe und Bedeutung seiner Werke und hier insbesondere des Parzival in keiner ausgeglichenen Relation: „Obwohl er ein umfangreiches und gern rezipiertes Werk hinterließ, weiß man herzlich wenig über den Menschen Wolfram.“ (ebd., S 569.).
[26] Vgl. Roßnagel, S. 6-21. Dieser nennt Wolfram, wenn er von der Artusdichtung spricht, in direkter Linie mit Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg. Selbst seinen Titelhelden Parzival stellt er fast unbekümmert neben einen Iwein, einen Erec oder einen Tristan. Für ihn sind daher „die klassischen Artusepen Erec, Iwein und Parzival “ (ebd., S. 18), wobei er zwar Unterschiede eingesteht, dennoch in allen dreien eine gleiche Handlungsstruktur herausdeutet. Dem steht unter anderem McDonald, S. 568-571 entgegen, der als Stellvertreter für die Kontrapartei genannt werden kann, da er in Wolfram einen Künstler sieht, der sich nicht in die Erzähltraditionen seiner Schaffenszeit einordnen lässt und gerade deshalb unter den Dichtern des hohen Mittelalters besonders hervorsticht.
[27] Vgl. Wieners, S. 29f.
[28] McDonald, S. 573.
[29] Vgl. Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter, S. 25. „Die sicher lokalisierbaren Anspielungen der Bücher IV und V gelten Wolframs engster Heimat, Hohentrüdingen (Buch IV) und Abenberg (Buch V).“ (ebd., S. 25.).
[30] Vgl. ebd., S. 25-26. Schirok führt hier die Aussagen über den Grafen von Wertheim im Buch IV oder die Benennung Hermanns von Thüringen im VI. Buch als Hinweise auf Wolframs Aufenthalte an adligen Höfen an.
[31] Vgl. Haug, Walter: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter, Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt 1985: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 108f. Bereits der erste Vers des Lancelot verweist auf Marie von Champagne als Auftraggeberin: „ Puis que ma dame de Champaigne vialt que romans a feire anpraigne “ (Lancelot Vers 1 und 2, zitiert aus ebd., S. 108).
[32] Ausführlich zur Quellenfrage Wolframs insbesondere im Hinblick auf die Vorgeschichte des Parzival, siehe auch Lowet, Ralph: Wolfram von Eschenbachs Parzival im Wandel der Zeiten, München 1955: Pohl & Co. Verlag.
[33] Diese Arbeit orientiert sich an der historisch kritischen Fassung des Parzival nach Karl Lachmann und dessen Einteilung des Werks in 16 Bücher.
[34] Vgl. Nellmann, S. 1. Nellmann stellt zwar fest, dass es bei den vorigen und zeitgenössischen Dichtern Wolframs ebenso schwer ist, das Publikum näher zu erfassen, betont aber dabei, dass unter allen diesen Dichtern und ihren Werken bei Wolfram verhältnismäßig viele Aussagen und Anspielungen auf das Publikum zu finden sind.
[35] Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter, S. 4.
[36] Ebenso kommt Schirok zu der Schlussfolgerung: „Geht man von den entwickelten theoretischen Modellen aus, so ist die Untersuchung historischer – z.B. mittelalterlicher – Rezeptionsprozesse in der Tat ein aussichtsloses Unterfangen.“ (ebd., S. 5).
[37] Vgl. Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick, Stuttgart 1997: Reclam. Wie Brunner allerdings anmerkt, fehlen meist konkrete Hinweise in den Texten der Dichter selbst als auch in Urkunden, Chroniken oder sonstigen schriftlichen Aufzeichnungen dieser Zeit, in denen ein Dichter namentlich benannt wird und über den ausgesagt wird, dass er an einem bestimmten Hof an einem bestimmten, benannten Werk gearbeitet hat. Die populärste Ausnahme bildet Walther von der Vogelweide, der in seinen Liedern von sich selbst behauptet, diese in Österreich am Wiener Hof gedichtet und gesungen zu haben, was auch durch eine Urkunde belegt werden kann. „Am 12. November schenkte ihm der Bischof von Passau, […], Wolfger von Erla, in der Näher Wiens Geld für einen Pelzrock – dies ist der einzige urkundlich unstrittige Nachweis Walthers.“ (ebd., S. 179.)
[38] Zur Übersicht und Aufschlüsselung der Anspielungen auf zeitgenössische Werke vgl. auch Nellmann, S. 29ff. Wie er einleitend bemerkt, zeigt sich Wolfram „als intimer Kenner der Gegenwartsliteratur, wie die zahlreichen Hinweise auf die Geschichten von Eneas, Erec, Iwein, Tristan u.a. belegen.“ (ebd, S. 29f.) Vgl. auch Haferland, Harald: Höfische Interaktion, Interpretationen zur höfischen Epik und Didaktik um 1200, München 1988: Wilhelm Fink Verlag, S. 10-18. Haferland verweist darauf, dass es keinen Königsweg gibt, „einer historischen Realität über ihre fiktionale Brechung wieder habhaft zu werden, (…) in Präsuppositionen aber, die Texte immer schon auch ganz unbehelligt von jeglicher Fiktionalität vornehmen, hat Interpretation grundsätzlich Zugang zu einer historischen Realität.“ (ebd., S. 11). Wenn also nicht direkt von den Anmerkungen der Dichter im fiktionalen Text eindeutig auf die Art des Publikum geschlossen werden, so können zumindest einige grundlegende Informationen über die generellen logischen Bedingungen die für das Schreiben von Literatur, das Dichten oder allgemein gesellschaftliche Gegebenheiten gelten, gefolgert werden.
[39] Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter, S. 23.
[40] Eine Übersicht und Interpretationen zu inner- und außerliterarischen Anspielungen und Verweisen auf andere Werke und Dichter im Parzival finden sich bei Schirok, Bernd: Parzivalrezeption im Mittelalter und Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach. Schirok konstatiert zudem anhand der wechselnden Häufigkeit der literarischen Anspielungen einen Wechsel des Publikums. So deutet für ihn die Tatsache, dass in den Büchern VI und VII nur wenige Anspielungen auftreten, darauf hin, „daß Wolfram für ein anderes Publikum schreibt als bei den Büchern vorher und daß dieses Publikum entweder nicht über größere literarische Kenntnisse verfügte oder Wolfram sich in dieser Beziehung nicht sicher war.“ (ebd., S. 22). Da aber die Zurückhaltung Wolframs hinsichtlich der literarischen Anspielungen mehrere nicht näher nachvollziehbare Gründe haben kann und zudem auch nicht genau bestimmt werden kann, wo Wolfram diese Bücher dichtete und vortrug, ist die Ausdifferenzierung des Publikums anhand solcher Beispiele zu vernachlässigen und eher von einer generellen Aussage über das Publikum und dessen Bildungs- und Kenntnisstand auszugehen.
[41] Simson, S. 209.
[42] Ebd., S. 209. Dieser schließt jedoch allein aus den innerliterarischen Aussagen, die der Erzähler innerhalb der Texte macht, auf das Publikum. Dass diese Methode auf Widerspruch stößt, gründet sich allein schon in der Tatsache, dass hierbei von Informationen aus einem fiktionalen Texte direkt auf die Realität geschlossen wird. Wie Nellmann, S. 1-3 ebenfalls kritisch anmerkt, können zwar der Erzähler und das beschriebene Publikum Abbilder des Autors und des wirklichen Publikums sein, da die Auskünfte über beide aber innerhalb eines fiktionalen Textes stehen, müssen sie „in erster Linie als Bestandteile der epischen Fiktion gewertet werden.“ (ebd., S. 2).
[43] Vgl. ebd., S. 209.
[44] Mockenhaupt, Benedikt: Die Frömmigkeit im Parzival Wolframs von Eschenbach, Ein Beitrag zur Geschichte des religiösen Geistes in der Laienwelt des deutschen Mittelalters, Darmstadt 1968: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 268.
[45] Vgl. Kratz, Henry: Wolfram von Eschenbach´s Parzival. An attempt at a total evaluation, Bern 1973: Francke Verlag, S. 426.
[46] Vgl. Brall, Helmut: Gralssuche und Adelsheil, S. 540, der zwar anmerkt, dass es in der Volkssprache keine frühe systematische Literaturtheoriebildung gibt, jedoch frühe Formen literaturtheoretischer Reflexion der Autoren mittelalterlicher Literatur in Epilog, Prolog und Kommentaren zu finden sind. In diesen Segmenten reflektieren die Autoren „die Bedingungen des Erzählens sowie die Wirkungsmöglichkeiten und Ansprüche von Literatur überhaupt.“ (ebd., S. 540).
[47] Für eine Gesamtübersicht über die Gralromane des Mittelalters und in diesem Falle den Li romanz de l´estoire du Graal Roberts de Boron und dessen Darstellung des Grals vgl. Studer, Eduard: Von mancherlei Schwierigkeiten, den Gral zu finden, Abschiedsvorlesung gehalten an der Universität Freiburg Schweiz am 22. Juni 1988, Freiburg Schweiz 1989: Universitätsverlag Freiburg Schweiz, S. 15ff.
[48] Vgl. ebd., S. 17.
[49] Schäfer, Hans-Wilhelm: Kelch und Stein, Untersuchungen zum Werk Wolframs von Eschenbach, Frankfurt a.M./ Bern 1983: Verlag Peter Lang, S. 48
[50] Strohkirch, Katharina: Zum Löwen geboren, Gender in Entwicklungsromanen aus verschiedenen Jahrhunderten: Parzival, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Ahnung und Gegenwart, Netzkarte, Der junge Mann, Stockholm 2002: Almqvist und Wiksell, S. 51.
[51] Vgl. Studer, S. 21.
[52] Hagen, Paul: Der Gral, Straßburg 1900: Karl J. Trübner, S. 86.
[53] Vgl. Nellmann, S. 45f, 93-95. Nellmann weist in Bezug auf Wolframs Erzähltechnik darauf hin, dass dieser sich mehrerer „Spannungsmanöver“ bedient, wie unter anderem die von dem Erzähler häufig vorgenommenen verzögerten oder nachgetragenen Informationen über bestimmte Sachverhalte.
[54] Bezogen auf die Stellung des Grals in der Geschichte und der verteilten Informationen über ihn, kommt McDonald zu dem Schluss, dass Wolfram ihn zu einer dicht verwobenen „Mega-Mythlogie“ erhebt, was wiederum dazu führt, dass der Gral „die Gemüter fesselt und als Designer-Logo zum Kaufen anregt.“ (McDonald, S. 575.)
[55] Vgl. Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach, S. 224-228. Bumke weist dabei insbesondere auf die zentrale Bedeutung der Komik für Wolframs Erzählstil hin: „In der Parzival-Forschung gibt es einen Konsens darüber, daß Komik ein wichtiges Kennzeichen von Wolframs Erzählstil ist.“ (ebd., S. 224); zu Wolframs Komik vgl. auch Wehrli, Max: Wolframs Humor, In: Heinz Rupp (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach, Darmstadt 1966: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 104-124. sowie Bertau, Karl: Wolfram von Eschenbach, Neun Versuche über Subjektivität und Ursprünglichkeit in der Geschichte, München 1983: C.H. Beck.
[56] Vgl. ebd., S. 224-225.
[57] Ebd., S. 225.
[58] Bertau, Karl: Schrift – Macht – Heiligkeit in den Literaturen des jüdisch-christlich-muslimischen Mittelalters, Herausgegeben von Sonja Glauch, Berlin/ New York 2005: Walter de Gruyter, S. 368.
[59] Lowet, S. 131. Dem entgegen steht zwar Simsons Urteil über Wolfram, der sich gegen einen anspruchsvollen Umgang mit den Themen seiner Zeit stellt, da er davon ausgeht, dass Wolfram lediglich so gedichtet hat, „wie der Vogel singt, unbekümmert und heiter, trotz dem Ernst seines Anliegens.“ (Simson, S. 208). Da er allerdings diese Aussage auf Wolframs Bildung zurückführt und sich hierbei lediglich auf die in der Forschung viel diskutierten Selbstaussagen Wolframs beruft, ist dieses Urteil über den Dichter nur eingeschränkt als stichhaltig anzusehen. Hinzu kommt, dass er sich bei seiner Stellungnahme allein auf den Text beruft, dies jedoch im Text nur an der Unbekümmertheit in der Anrede des Erzählers an das Publikum im Parzival fest macht und nicht an der Erzählung oder Erzählweise selbst (vgl. Simson, S. 208-209).
[60] Bumke, Joachim: Parzival und Feirefiz – Priester Johannes – Loherangrin, Der offene Schluß des Parzival Wolframs von Eschenbach, In: DVjs. 69 (1991), S. 244.
[61] Vgl. ebd., S. 244.
[62] Ebd., S. 245.
[63] Ohly, Friedrich: Wolframs Gebet an den heiligen Geist im Eingang des Willehalm, In: Rupp, Heinz (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach, Darmstadt 1966: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 458-459.
[64] Schwietering, Julius: Die Demutsformel mittelhochdeutscher Dichter, Berlin 1921: Weidmannsche Buchhandlung, S. 2.
[65] Schwietering bestätigt diese Demutsformel anhand des Gebets ebenso nur für den „geistlichen Willehalm “, nicht aber für den Parzival Wolframs (vgl. ebd,. S. 21-24).
[66] Vgl. Theisen, Joachim: Des Helden bester Freund, Zur Rolle Gottes bei Hartmann, Wolfram und Gottfried, In: Christoph Huber, Burghart Wachinger und Hans-Joachim Ziegler (Hrsg.): Geistliches in weltlicher Literatur und Weltliches in geistlicher Literatur des Mittelalters, Tübingen 2000: Max Niemeyer Verlag, S. 153-170.
[67] Ebd., S. 155.
[68] Diese Feststellung beschränkt sich allerdings nur auf den höfischen Roman, da neben den Antikenromanen ein aktiv handelnder Gott unter anderem auch geistlicher Dichtung wie im Sankt Trudpeter Hohenlied vorkommt und dort sogar eine zentrale Figur darstellt: „Der Geliebte ist darin Gott, seine Freundin die einzelne Seele, die sich nach unio mit dem sponsus sehnt.“ (Bertau, Karl: Schrift – Macht – Heiligkeit, S. 366.)
[69] Schwarz, Hermann: Der Gottesgedanke in der Geschichte der Philosophie, Erster Teil von Heraklit bis Jakob Böhme, Heidelberg 1913: Carl Winters Universitätsbuchhandlung, S. 177. Ursprünglich geprägt wurde der Gottmenschheitsgedanke von Athanasius (296 – 373 n.Chr.), wurde von Schwarz nun aufgegriffen und umgedeutet im Zuge eines veränderten Gottesbildes im Mittelalter. Christus, als der Fleisch gewordene Gott und mit ihm die Gottmenschheitsidee, wurde von Athanasius noch als Paradoxie gedeutet, da sich die Begriffe Gottes und des Menschen nicht vereinigen ließen, wohingegen von Schwarz für das mittelalterliche Gottesbild die Formung einer Zweieinheit sieht: „Der Gottmensch soll Gottes Sohn sein, der neue Gott, den die Christen anbeten, der Sohn des Jehova, den die Juden angebetet hatten, und die hellenistische Vorstellung von der Emanation des Fleisch gewordenen Gottes zum transzendenten Weltschöpfer beleuchten und aufhellen“ (ebd., S. 181-182).
[70] Auch bekannt als Augustinus von Hippo, Aurelius Augustinus oder Augustin. Um eine einheitliche Benennung zu gewährleisten, wird er in dieser Arbeit durchgehend als Augustin bezeichnet.
[71] Schwarz, S. 194.
[72] Rupp, Heinz: Religiöse Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts, Untersuchungen und Interpretationen, 2. Aufl., Bern und München 1971: Francke Verlag, S. 137.
[73] Lauret, Bernard: Schulderfahrung und Gottesfrage bei Nietzsche und Freud, München 1977: Chr. Kaiser Verlag, S. 380ff.
[74] Petermann, Hubert: Beobachtungen zu den Appellativen für „Gott“, Ein sprachwissenschaftlicher Beitrag zum Gottesverständnis der Alten, In: Karl-Friedrich Kraft, Eva Maria Lill und Ute Schwab (Hrsg.): Triuwe, Gedächtnisbuch für Elfriede Stutz, Studien zur Sprchgeschichte und Literaturwissenschaft, Heidelberg 1992: Heidelberger Verlagsanstalt, S. 128.
[75] Zur Entwicklung der Religion und des christlichen Glaubens in Verbindung mit der Entwicklung und den Formen der Gesellschaft vom Früh- bis zum Spätmittelalter vgl. Angenendt, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
[76] vgl. Willson, Bernard: Das Fragemotiv in Wolframs Parzival, In: GRM 43 (1962), S. 140f.
[77] Mertens, Volker: Das Predigtbuch des Priesters Konrad, Überlieferung, Gestalt, Gehalt und Texte, Mnchen 1971: C.H. Beck Verlag, S. 149.
[78] Grünwaldt, Klaus: Gott und sein Volk, Die Theologie der Bibel, Darmstadt 2006: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 142.
[79] Carmassi, Patrizia: Divina Officia, In: Dieselbe (Hrsg.): Divina Officia, Liturgie und Frömmigkeit im Mittelalter, Wolfenbüttel 2004: Harrassowitz Verlag, S. XI. Carmassi merkt zusätzlich an, dass der Begriff der Liturgie erst seit der Frühneuzeit als Benennung des Gottesdienstes verwendet wird. Im lateinischen Mittelalter wurde der Gottesdienst „mit den Ausdrücken divina officia (Gott geschuldete Dienste), ecclesiastica officia, opus dei, misteryum oder eben ritus bezeichnet.“ (ebd., S. XI)
[80] Mertens, Volker: Das Predigtbuch des Priesters Konrad, S. 141.
[81] Ebd., S. 132.
[82] Grünwaldt, S. 124.
[83] Ebd., S. 119.
[84] Vgl. ebd., S. 260ff. Grünwaldt verweist bezüglich der Erlösung der Menschen durch Christus auf den Text des Paulus aus dem 1. Korintherbrief 15, in dem gesagt wird, „dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift.“ (ebd., S. 260) Weiterhin beschreibt er im 1. Korintherbrief den Zusammenhang zwischen Adam und Christus: „So wie durch den Einen, Adam, die Sünde und damit der Tod in die Welt kam, so kommt durch den einen, Christus, das Leben.“ (ebd., S. 267).
[85] Ebd., S. 118.
[86] Ebd., S. 127.
[87] Ebd., S. 126.
[88] Mertens, Volker: Das Predigtbuch, des Priesters Konrad, S. 135.
[89] Ebd., S. 135.
[90] Vgl. Ebd., S. 135.
[91] Vgl. Hörner, Petra: Gedenke der Gnade und Gerechtigkeit, Tradition und Wandel des Jüngsten Gerichts in der literarischen Darstellung des Mittelalters, Berlin 2005: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, S. 7ff.
[92] Vgl. ebd., S. 16f.
[93] Vgl. ebd., S. 11ff.
[94] Mertens, Volker: Das Predigtbuch des Priesters Konrad, S. 135.
[95] Vgl. ebd., S. 150.
[96] Haug, Walter: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter, S. 150.
[97] Vgl. Drecoll, Volker Henning: Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins, Tübingen 1999: Mohr Siebeck, S. 1ff. Bezüglich dieser ist, wie Drecoll anmerkt, zu beachten, dass nicht von einer einheitlichen und durchgehenden Gnadenlehre bei Augustin gesprochen werden kann, da dieser dank eines Konfessionswechsels seine erste Ansichtsweise zu Gnade revidiert hat und somit zwischen „früher und später augustinischer Gnadenlehre“ (ebd., S. 21) unterschieden werden muss. So revidierte er z.B. seine Position aus seiner Schrift De libero arbitrio in seiner späteren Schrift Retractationes, da seine Gnadenlehre sonst seinen vorigen Aussagen in den De libero arbitrio widersprechen würde.
[98] Vgl. Neumann, Uwe: Augustinus, Reinbek bei Hamburg 1998: Rowohlt Verlag, S. 64. Diese Aussage geht aus dem Briefwechsel zwischen Augustinus und dem Mailänder Bischoff Simplicianus hervor. Simplicianus hatte in einem Brief mehrere philosophische Fragen an Augustinus gestellt. Seine zweite Frage war dabei, warum Gott, wie es im Römerbrief des Paulus (9, 10-29) heißt, den Zwillingen Jakob und Esau schon vor deren Geburt eine unterschiedliche Wertschätzung zukommen ließ. Augustin antwortete darauf, „Gott habe aus für Menschen nicht nachvollziehbaren Gründen seine Gnadenwahl getroffen, die von Verdiensten oder Mängeln der Menschen nicht beeinflußbar sei.“ (ebd., S. 64.)
[99] Ebd., S. 64f..
[100] Vgl. ebd., S 65.
[101] Mertens, Volker: Das Predigtbuch des Priesters Konrad, S. 136.
[102] Fleckenstein, Josef: Vom Rittertum im Mittelalter, Perspektiven und Probleme, Goldbach 1997: Keip Verlag, S. 115.
[103] Ebd., S. 115
[104] Ebd., S. 116.
[105] Zitiert aus Spieß, Karl-Heinz: Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Unter Mitarbeit von Thomas Willich, Idstein 2002: Schulz-Kirchner Verlag, S. 99. Die Handschrift der Urkunde befindet sich im Salzburger Urkundenbuch, Band 3, Nr.1006. Übersetzung von Thomas Willich: „Konrad, Sohn des geheiligten Augustus und Kaisers Friedrich, von Gottes Gnaden gewählter Römischer König, allzeit Mehrer des Reiches und Erbe des Königreiches Jerusalem, allen Getreuen des Reiches, die diesen Brief sehen werden, seine Gnade und alles Gute.“ (ebd., S. 99)
[106] Vgl. Mohr, Wolfgang: Hilfe und Rat in Wolframs Parzival, S. 174.
[107] Vgl. ebd., S. 177.
[108] Ebd., S. 177.
[109] Augustinus, Aurelius: Bekenntnisse, Übertragen von Carl Johann Perl, 5. Aufl., Paderborn 1963: Ferdinand Schöningh Verlag, S. 76
[110] Mohr, Wolfgang: Hilfe und Rat in Wolframs Parzival, S. 182.
[111] Bertau, Karl: Über Literaturgeschichte, S. 49
[112] Ebd., S. 49.
[113] Ganshof, François Louis: Was ist das Lehnswesen?, Darmstadt 1961: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 36.
[114] Haferland, S. 118.
[115] Vgl. Schimank, Uwe: Handeln und Strukturen, Einführung in die akteurtheoretische Soziologie, 2. Aufl., Weinheim 2002: Juventa Verlag, S. 93.
[116] Vgl. ebd., S. 94f.
[117] Haferland, S. 160.
[118] Brall, S. 102.
[119] Wie auch Brall bemerkt, muss bei der Bezugnahme auf die reellen historischen Verhältnisse immer berücksichtig werden, dass es sich bei den Verhältnissen von Gesellschaft, Individuum und höfischer Kultur, um „vorgeführte Modelle einer gewünschten Ordnung“ (ebd., S. 541) handeln kann. vgl. auch Ridder, Klaus: Fiktionalität und Autorität, Zum Artusroman des 12. Jahrhunderts, In: DVjs. 75 (2001), S. 537-560. Laut diesem ist „die Artuswelt ist zwar nicht vollständig von der historischen Realität entrückt, sie hat jedoch ihre eigene, von der historiographischen Überlieferung unabhängige Chronologie und Geographie.“ (ebd., S. 543).
[120] Vgl. Haferland, S. 150ff.
[121] Pratelidis, Konstantin: Tafelrunde und Gral, Die Artuswelt und ihr Verhältnis zur Gralswelt im „Parzival“ Wolframs von Eschenbach, Würzburg 1994: S. 124ff.
[122] Haferland, S. 9f.
[123] Vgl. Bosl, Karl: Das ius ministerialium, Dienstrecht und Lehnrecht im deutschen Mittelalter, In: Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte geleitet von Theodor Mayer (Hrsg.): Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen, Vorträge gehalten in Lindau am 10.-13. Oktober 1956, Lindau/ Konstanz 1960: Jan Thorbecke Verlag, S. 51-94. sowie weiterführend vgl. Ganshof, François Louis: Das Lehnswesen im fränkischen Reich, In: Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte geleitet von Theodor Mayer (Hrsg.): Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen, Vorträge gehalten in Lindau am 10.-13. Oktober 1956, Lindau/ Konstanz 1960: Jan Thorbecke Verlag, S. 37-50. und für einen detaillierten Überblick über das so genannte „Lehnszeitalter“, das die Zeit vom 8. Jahrhundert bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts umfasst, unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede auf dem Westeuropäischen Kontinent siehe Mitteis, Heinrich: Der Staat des hohen Mittelalters, Grundlinien der vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters, 7. unveränderte Aufl., Weimar 1962: Hermann Böhlaus Nachfolger.
[124] Vgl. Ganshof, François Louis: Was ist das Lehnswesen?, S. 4. Der Rechtsakt, bei dem sich ein freier Mann in die Gewalt bzw. unter den Schutz eines anderen begibt, wird seit der Karolingerzeit Kommendation bzw. commendatio genannt.
[125] Bosl, S. 59.
[126] Vgl. Schulze, Hans K.: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Band 1: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft, 2. verbesserte Aufl., Stuttgart/ Berlin/ Köln 1990: Kohlhammer Verlag, S. 62ff., der die Verwendung des Lehnrechts als politisches Mittel unter anderem am Beispiel der Auseinandersetzung Friedrich Barbarossas gegen Heinrich den Löwen aufzeigt. Vgl. auch Kammler, Hans: Die Feudalmonarchien, Politische und wirtschaftlich-soziale Faktoren ihrer Entwicklung und Funktionsweise, Köln/ Wien 1974: Böhlau Verlag. Kammler stellt am Beispiel des französischen Königs im 11. Jahrhundert dar, wie sich das Vasallentum seit dem 8. Jahrhundert verändert hat: „der König von Frankreich im 11. Jahrhundert unterschied sich von seinen Baronen, die teils reicher und mächtiger als er waren, nur dadurch, daß er niemandes Lehnsmann war.“ (ebd., S. 95.)
[127] Vgl. Ganshof, François Louis: Was ist das Lehnswesen?, S. 90ff. Ganshof macht in Bezug auf den Begriff auxilium deutlich, dass es sich dabei nicht nur um militärische Hilfe handelt. Für den Waffendienst wurde das Wort servitium verwendet, „während mit auxilium anscheinend alle anderen Arten von Hilfe gemeint sind.“(ebd., S. 91).
[128] Ebd., S. 28.
[129] Hauser, Sigrid: Staufische Lehnspolitik am Ende des 12. Jahrhunderts 1180-1197, Frankfurt a.M./ Berlin/ Bern/ New York/ Paris/ Wien 1998: Peter Lang Verlag, S. 34.
- Arbeit zitieren
- Christoph Monnard (Autor:in), 2007, Parzivals Gottesbezug - Untersuchung der narrativen Inszenierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87329
Kostenlos Autor werden

















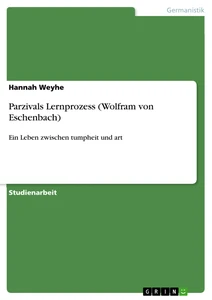




Kommentare