Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Gesundheit ist eine Frage der Definition.
3 Die gesundheitliche Lage in Deutschland. Ein Überblick.
4 Die Unterschiede zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit.
5 Die unterschiedlichen sozialen Einflussfaktoren auf Gesundheit
5.1 Die klassischen soziodemographischen Einflussfaktoren auf Gesundheit.
Das Alter als vertikaler Einflussfaktor auf Gesundheit.
5.1.2 Das Geschlecht als vertikaler Einflussfaktor auf Gesundheit.
5.1.3 Der Familienstand und das soziale Netz als vertikale Einflussfaktoren auf Gesundheit.
5.1.4 Bildung, Einkommen, Status. Soziale Schicht als horizontaler Einflussfaktor auf Gesundheit.
5.1.5 Die Wohnsituation und die Unterschiede zwischen Ost und West als Einflussfaktoren auf die Gesundheit.
5.2 Der Zusammenhang zwischen Gesundheits- und Risikoverhalten und sozialer Schicht und deren Einfluss auf die Gesundheit.
5.2.1 Die schichtspezifischen Unterschiede im Ernährungsverhalten und deren Einfluss auf die Gesundheit.
5.2.2 Die schichtspezifischen Unterschiede in Bezug auf Tabak- und Alkoholkonsum.
5.2.3 Die schichtspezifischen Unterschiede im Sport- und Freizeitverhalten.
5.2.4 Die schichtspezifischen Unterschiede der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen.
6 Zusammenfassung
7 Literatur
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Subjektiver Gesundheitszustand, Angaben in Prozent.
Tab. 2: Prävalenz mindestens einer Allergie nach Alter und Geschlecht.
Tab. 3: Körperliche Aktivität und ihr risikosenkender Einfluss auf Krankheiten.
Tab. 4: Idealtypische Kennzeichnung der unterschiedlichen Sportpräferenzen unterer und oberer Sozialschichten..
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Drei Dimensionen der Laienauffassung von Gesundheit. In Anlehnung an Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2001: 9
Abb. 2: Anteil der Frauen mit Kleinkind, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nach Ost und West. Datenbasis: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 12. Eigene Darstellung.
Abb. 3: Das Modell des sozioemotionalen Rückhalts. In Anlehnung an Siegrist 1995: 183 zitiert nach Bauch 2000: 160.
Abb. 4: Modell der beruflichen Gratifikationskrisen. In Anlehnung an Bauch 2000: 144.
Abb. 5: Soziale, psychische und physische Folgen von Arbeitslosigkeit. Quelle: Waller 1991: 55 zitiert nach Hurrelmann 2000: 28.
Abb. 6: Ein Modell des Belastungs-Überforderungs-Prozesses. In Anlehnung an Pearlin 1987: 60 zitiert nach Hurrelmann 2000: 54.
Abb. 9: Zahl der Todesfälle an Herz-Kreislauferkrankungen im Jahr 2002 je 100.000 Personen. Datenbasis: Office for Official Publications of the European Communites 2005: 59f. Eigene Darstellung.
Abb. 10: Sportliche Aktivität in West- und Ostdeutschland. Datenbasis: Nagel et al. 2003: 117. Eigene Darstellung.
1 Einleitung
In Deutschland wird großer Wert auf das Präventionsangebot zur Erhaltung der Gesundheit gelegt. So gibt es eine Vielzahl von Vorsorgeuntersuchungen, wie z.B. die empfohlene Darmkrebsvorsorge, d.h. Darmspiegelung ab 50 Jahren, aber auch die regelmäßige Kontrolle der Zähne, bei unter 18-Jährigen zweimal, bei über 18-Jährigen ein Mal jährlich. Die Wahrnehmung solcher Präventionsangebote und die Teilnahme an diesen ist jedoch nicht auf alle sozialen Schichten gleichmäßig verteilt.
Ich möchte die unterschiedlichen soziodemographischen Einflussfaktoren, aber auch den Einfluss des Gesundheits- und Risikoverhaltens auf die Gesundheit der Deutschen untersuchen.
Gesundheit ist ein Lieblingsthema der Deutschen und keineswegs ein neues Thema. Bereits in den 1970er Jahren gab es einen Trend zum Jogging, einer Sportart, die jeder ohne große Aufwendungen und Hilfsmittel ausüben kann. In den 1980er Jahren kam die Trendsportart Aerobic aus Amerika und führte zu einem neuen Fitnessboom in Deutschland (Dreßler 2002: 41ff). Im Jahr 1980 gab es in Deutschland bereits 1000 Fitnessstudios, in denen ca. 370.000 Mitglieder trainierten (Deutscher Sportbund e.V. 2000 zitiert nach Dreßler 2002: 44). Zum Jahresende 2001 trainierten bereits 5.400.000 Mitglieder in 6500 Fitnessstudios (Deutscher Sportbund e.V. zitiert nach Deloitte&Touche GmbH: 2006: 5, vgl. auch Rütten et al. 2005: 17).
Der starke Anstieg der Mitgliederzahlen impliziert, dass immer mehr Menschen an der Gesunderhaltung ihres Körpers interessiert sind. Weiterhin wird damit die These akzeptiert, dass jeder selbst für seine Gesundheit und Fitness verantwortlich sei. Heutzutage ist der Gesundheitssport wie Nordic Walking, Aquafitness und Yoga für einen breiten Bevölkerungsanteil interessant, um das eigene körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden zu erhalten bzw. wiederherzustellen und somit auch präventiv gegen die Entstehung von modernen Zivilisationskrankheiten zu wirken (Albers 2002: 142). Aber auch der Extremsport hat in seiner Bedeutung zugenommen (vgl. auch Burrmann 2005a: 108). Insgesamt hat der Anteil der Bevölkerung, der Sport treibt, durch alle Altersgruppen hinweg zugenommen, zwischen 1998 und 2004 sogar um mehr als zehn Prozentpunkte (Wasmer und Haarmann 2006: 530). Aktuelle Studienergebnisse bestätigen die gesundheitsfördernde Wirkung sportlicher Aktivität eindeutig (Breckenkamp und Laaser 2001 zitiert nach Grünheid 2005: 176). Daher ist die Zunahme des Anteils der Bevölkerung der Sport treibt als positiv zu werten.
Gesundheit und die Beschäftigung damit ist nach Bauch als ein wichtiges Merkmal von modernen Gesellschaften zu verstehen (Bauch 1996: 9). Denn eine Gesellschaft kann nur bestehen, wenn die Bevölkerung gesund ist und somit die Erfüllung der sozialen Rollen gegeben ist (Siegrist 1995 zitiert nach Wolf und Wendt 2006: 12). Die Aufgabe des Gesundheitssystems sollte demnach darin bestehen, die Kranken schnellstmöglich wieder zu heilen, damit sie ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Verpflichtungen wahrnehmen können (Parsons 1958; Mechanic 1975; Field 1989 zitiert nach Wolf und Wendt 2006: 20; vgl. auch Gerlinger 2006: 37). Im Krankheitsfall wird der Patient vorübergehend von seinen gesellschaftlichen Rollen befreit. Er wird nicht für seine Krankheit moralisch verantwortlich gemacht, hat jedoch die Verpflichtung schnellstmöglich gesund zu werden und dazu einen Arzt zu besuchen (Parsons 1951 zitiert nach Hurrelmann 2000: 67; vgl. auch Siegrist 2005: 40f).
Gesundheit ist für die Soziologie ein wichtiges Thema, weil durch Gesundheit bzw. Krankheit Lebenschancen oder -risiken eröffnet werden (Wolf und Wendt 2006: 7). Obwohl es sich bei Gesundheit um ein Lieblingsthema der Deutschen handelt, wurde es bis 1998, im Vergleich mit anderen Staaten der EU, eher wenig sozialwissenschaftlich untersucht. Erst 1998 gab es in Deutschland den ersten Gesundheitsbericht, der auf den positiven Zusammenhang zwischen der sozialen Schicht und Gesundheit eingeht. Die innerdeutsche Datenlage ist als historische Folge des Dritten Reiches ausgesprochen schlecht, weil zum Beginn des Dritten Reichs deutsche Forschungstraditionen auf diesem Gebiet abgebrochen und erst spät wieder aufgenommen wurden (König 2000: 269). In den vergangenen Jahren wurde dieses Problem jedoch erkannt, und die Datenlage wurde in Bezug auf die Gesamtbevölkerung und auch bei einzelnen Gruppen verbessert (von dem Knesebeck 2005 zitiert nach Gerlinger 2006: 47).
Im Jahr 2006 wurde eine Reihe von wichtigen Veröffentlichungen im Bereich der Gesundheitsberichterstattung publiziert. Beispielsweise ist der Gesundheitsbericht nun zum dritten Mal veröffentlicht worden und auch der Datenreport ist mit aktuellen Daten erschienen. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die diese interpretieren und neu aufarbeiten. Zum Teil werden auch Daten, die von den Krankenkassen erhoben wurden, verwendet. Dabei ist jedoch die Verlässlichkeit der Angaben mitunter fraglich, da viele auf freiwilligen Selbstauskünften beruhen. Zudem wurden die Daten nicht zu sozialwissenschaftlichen Forschungszwecken erhoben und sind daher nicht immer aktuell oder aussagekräftig. Auch bei Gründen für eine Krankschreibung kann man nicht immer davon ausgehen, dass die auf dem Krankenschein gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. In vielen Praxen werden oftmals nur einige wenige ICD-10 verschlüsselte Krankheiten routinemäßig für die Krankschreibung benutzt (König 2000: 272f). Bei den Angaben zur Mortalität ist jedoch davon auszugehen, dass sie zuverlässig sind (Mielck 2005: 16). Bei der Analyse von einzelnen Krankenkassendaten ist zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass die Mitgliederstruktur einzelner Krankenkassen nicht repräsentativ ist und somit keine Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung gezogen werden können. Dies liegt in der relativen Homogenität der Mitgliederstruktur von Krankenkassen begründet (Mielck 2005: 17).
Die zunehmende Zahl der Publikationen in der Gesundheitsberichterstattung ist jedoch im internationalen Vergleich nur als ein Schritt in die richtige Richtung zu werten. Für eine perspektivische Verbesserung der Datenlage sollte man beispielsweise den Beruf jedes Verstorbenen auf dem Totenschein erfassen, um eine Verortung in einer sozialen Schicht zu ermöglichen. Dieses Vorgehen ist in Großbritannien bereits seit 1910 üblich (König 2000: 269). In Deutschland ist dies allerdings bislang weder üblich noch möglich (Mielck 2005: 96). Als Grund dafür wird oft das strenge deutsche Datenschutzgesetz angegeben, dies scheint allerdings eher nur ein Vorwand zu sein.
In dieser Magisterarbeit gebe ich einen Überblick über die aktuelle Forschungslage zum Thema der sozialen Einflussfaktoren auf Gesundheit in Deutschland. Dabei stütze ich mich auf die einschlägige Literatur sowie auf statistische Erhebungen neueren Datums. Viele Ergebnisse dieser Erhebungen wurden im Jahr 2006 veröffentlicht und bilden somit die aktuelle gesellschaftliche Situation bestmöglich ab.
Das Thema dieser Magisterarbeit ist ein interdisziplinäres Thema, welches nicht nur von der Soziologie aus der Perspektive der sozialen Ungleichheit betrachtet wird. Vielmehr haben sich in den letzten Jahren innerhalb der Soziologie eigenständige Strömungen entwickelt, die sich beispielsweise als Gesundheitssoziologie oder Medizinische Soziologie mit dem Thema mehr oder weniger medizinisch-soziologisch beschäftigen. Aber auch andere Wissenschaften, wie die Sozialepidemiologie, wurden ebenso wie die Medizin mit ihrer thematisch einschlägigen Literatur im Rahmen dieser Magisterarbeit zu Rate gezogen. Auch die Psychologie spielt insbesondere im Bereich der psychischen Belastungen der Berufstätigkeit eine Rolle. Da es sich beim Untersuchungsgegenstand um Menschen handelt, die in vielfältigen sozialen Netzen eingebunden und zum Großteil auch berufstätig sind, wurde in Ansätzen auch die wirtschaftswissenschaftliche Perspektive der Gesundheit, des so genannten Humankapitals, berücksichtigt. Denn nicht nur die Individuen selbst, sondern auch die Unternehmen sind an der Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter, des Humankapitals, interessiert und investieren entsprechend in die Weiterbildung genauso wie in den Mitarbeitersport und in ein gesundes Angebot an Speisen in der Betriebskantine.
Diese Magisterarbeit ist im Zusammenhang mit der soziologischen Diskussion um bestehende und sich reproduzierende soziale Ungleichheit zu sehen. Auch wenn es in der deutschen Gesellschaft für weite Bereiche sozialer Ungleichheit eine große Akzeptanz gibt, wird diese im Bereich der Gesundheit und den damit verbundenen Lebenschancen von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Es gilt hier das hippokratische Ideal, dass jeder Kranke nach seinen Bedürfnissen und unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten und seiner sozialen Stellung optimal zu versorgen sei (vgl. auch Bundesärztekammer 1984). Dennoch sind die Gesundheitschancen der Bevölkerung nicht gleich verteilt (Altgeld et al. 2006: 10). Bei anderen Gütern, wie beispielsweise Wohnraum oder Einkommen als solches, ist es allgemein akzeptiert, dass diejenigen, die über ein höheres Einkommen verfügen auch die besser ausgestatteten Wohnungen mit mehr Wohnraum pro Kopf beziehen sollen (Behrens 2000: 60f).
Im Rahmen dieser Magisterarbeit möchte ich nach ein paar einleitenden Betrachtungen zunächst die Begriffe Gesundheit und Krankheit definieren. Da es eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen gibt, muss dies den weiteren inhaltlichen Betrachtungen vorangestellt werden.
Im dritten Kapitel gebe ich einen Überblick über die aktuelle gesundheitliche Lage in Deutschland auf Grundlage der neuesten Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung.
Die Unterschiede zwischen objektiver und subjektiver Gesundheit und die Wichtigkeit der subjektiven Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes erläutere ich im vierten Kapitel.
Das fünfte Kapitel ist der inhaltliche Schwerpunkt und ausführlichste Teil dieser Magisterarbeit. Es ist logisch in zwei große Blöcke unterteilt. Der erste Block, Kapitel 5.1, umfasst die klassischen soziodemographischen Einflussfaktoren auf die Gesundheit. Auf den folgenden Seiten werden Ergebnisse für die Faktoren Alter, Geschlecht, Familienstand und soziales Netz sowie die Wohnsituation zusammengestellt und kritisch untersucht. Die soziale Schicht und ihr Einfluss auf die Gesundheit ist ein zentraler Aspekt dieses ersten Blocks.
Im zweiten Block, Kapitel 5.2, beschäftige ich mich mit Verhaltensaspekten, also dem Gesundheits- und Risikoverhalten. Hierbei fokussiere ich insbesondere auf den Einfluss der Ernährung, Tabak- und Alkoholkonsum sowie das Sport- und Freizeitverhalten. Ebenso wie die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Vorsorgemaßnahmen variieren diese Verhaltensweisen schichtspezifisch. Anhand umfangreicher Literaturrecherche stelle ich die Ergebnisse der aktuellen Publikationen zusammen und einander gegenüber.
Im sechsten Kapitel fasse ich die Ergebnisse meiner Recherche zusammen und gebe einen Ausblick auf mögliche Handlungsfelder, um gesundheitliche Ungleichheit perspektivisch zu reduzieren.
2 Gesundheit ist eine Frage der Definition.
Im Folgenden werde ich einen Überblick über die unterschiedlichen Definitionen und Bedeutungsrahmen von Gesundheit geben. Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen von Gesundheit, die immer wieder einen anderen Fokus haben. Bengel et al. fassen zusammen: „Für manche ist Gesundheit gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Glück, andere verstehen darunter das Freisein von körperlichen Beschwerden. Wieder andere betrachten Gesundheit als Fähigkeit des Organismus, mit Belastungen fertig zu werden“ (Bengel et al. 2001: 15).
Die wohl umfassendste Definition von Gesundheit stammt dabei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in der Präambel der Verfassung der WHO vom 22.7.1947 geschrieben steht:
„Gesundheit [ist, C.K.] als ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung“ (Wolf und Wendt 2006: 9, Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2001: 8).
Dass es sich bei Gesundheit um einen festen Zustand handelt, wird in der Literatur stark diskutiert. Gesundheit wird vielmehr als ständig ablaufender Prozess zwischen den Belastungen und Anforderungen des Alltags und den Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien) angesehen. Entsprechend fasst Antonovsky Gesundheit wie folgt zusammen:
„Gesundheit ist kein normaler, passiver Gleichgewichtszustand, sondern ein labiles, aktives und sich dynamisch regulierendes Geschehen. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist nicht Gleichgewicht und Gesundheit, sondern Ungleichgewicht, Krankheit und Leiden“ (Bengel et al. 2001: 25).
In diese Richtung, dass Gesundheit eine Form von Gleichgewicht sei, geht auch folgende Definition.
„[…] dass Gesundheit als eine gelungene Balance zwischen soziogenen Anforderungen und Belastungen einerseits und individuellen Handlungsressourcen andererseits aufzufassen ist“ (Badura 1977 zitiert nach Gerlinger 2006: 43; vgl. auch Hurrelmann 2000: 8).
Nur, wenn ein Individuum über die notwendigen Handlungsressourcen und Bewältigungsstrategien verfügt, um seine täglichen Belastungen erfolgreich zu bewältigen, kann sich ein dauerhafter Zustand von Gesundheit einstellen. Individuelle Handlungsressourcen sind beispielsweise Optimismus, positive Problembewältigungsstrategien und ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl (Lampert et al. 2006 zitiert nach Jungbauer-Gans 2006: 97; vgl. auch Deck und Kohlmann 2002: 334).
Weitere Bewältigungsressourcen, die auch vielfach unter dem Begriff Lebenskompetenz zusammengefasst werden, sind:
- Selbstwahrnehmung,
- Empathie,
- kreatives und kritisches Denken,
- Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeit,
- Gefühls - und Stressbewältigung,
- Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit (Bühler und Heppekausen 2005: 16f).
Neben den positiven Bewältigungsstrategien existieren auch einige gesundheitsschädliche Bewältigungsstrategien, die physische und psychische Probleme verursachen können. Dies sind beispielsweise der Versuch, die Probleme zu verdrängen, erhöhter Fernsehkonsum oder starker Alkohol- und Drogenkonsum (Wolf und Wendt 2006: 16; vgl. auch Klocke 2006: 200).
Eine Stärkung der Lebenskompetenz und der Problembewältigungsstrategien könnte zu also zu einer Verbesserung der Gesundheit im Sinne einer Gleichgewichtsherstellung zwischen Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten führen (vgl. auch Hurrelmann 2000: 7; vgl. auch Kolip und Koppelin 2002: 496).
Entsprechen die Problembewältigungsstrategien nicht den Belastungen, kommt es zu negativen Folgen für die Person. Ohnmacht, das Gefühl des Ausgeliefertseins und dadurch ausgelöster chronischer Stress sind Folgen von unzulänglichen Coping-Strategien (Wolf und Wendt 2006: 16). Stress bezeichnet den psychosozial belastenden Zustand, wenn die Anforderungen die Bewältigungskapazitäten übersteigen (Wolf 2006: 159). Ein dauerhafter Stresszustand kann zu einem Burnout führen, dessen schlimmste Folge der Tod ist . Ein Burnout ist „ein Gefühl völliger Erschöpfung oder innerer Leere, das vor allem Personen betrifft, die extremen Anforderungen ausgesetzt sind oder sich selbst unter starken Leistungsdruck setzen“ (Leppin 2007: 99).
Baduras Definition von Gesundheit wurde um die Voraussetzung der Entstehung von Gesundheit weiterentwickelt und in der Ottawa-Charta der WHO (1986) formuliert.
Die Voraussetzungen für Gesundheit bestehen demnach darin, „dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen“ (WHO 1986: 119 zitiert nach Gerlinger 2006: 44, vgl. auch WHO 27.4.2007).
Weiterhin heißt es dort, dass es sich bei Gesundheit um eine Ressource handelt, „die einen Menschen in die Lage versetzt, ein „produktives“ Leben zu führen (Klocke 2006: 204, vgl. auch WHO 27.4.2007).
In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass das Vorhandensein von positiven Bewältigungsstrategien positiv mit dem sozialen Status verbunden ist, d.h. dass die höheren sozialen Statusgruppen in Bezug auf positive Bewältigungsstrategien besser ausgestattet sind (Steinkamp 1999 zitiert nach Wolf 2006: 159). Demnach ist für die unteren Statusgruppen ein verstärktes Auftreten von Stress und chronischem Stress zu erwarten (Jungbauer-Gans 2006: 96; Badura und Pfaff 1989 zitiert nach Wolf 2006: 159). Jedoch berichtet Wolf auch von einem erhöhten psychosozialen Druck bei Berufsgruppen mit höherem Prestige und weist zugleich darauf hin, dass auch Personen, die über einen höheren Bildungsstand verfügen, häufiger von psychosozialen Belastungen berichten als Personen mit einem geringeren Bildungsstand (Wolf 2006: 167). Die Ursachen dafür könnten in einer stärker ausgeprägten Symptomaufmerksamkeit nicht nur für psychosoziale Belastungen in den höheren sozialen Schichten liegen (Mielck 2000 zitiert nach Jungbauer-Gans 2006: 93f).
Beschäftigt man sich mit Gesundheit, fällt der Blick beinahe zwangsläufig auf das Gegenteil: Krankheit. Ebenso sollte die Person berücksichtigt werden, die das Diagnose-Monopol besitzt und für die Wiederherstellung von Gesundheit verantwortlich ist: Der Arzt.
Der Arzt ist seinem Selbstverständnis nach ein Heiler von Krankheiten. Jemand der zum Arzt geht, ist also krank. Nur wenn eine Krankheit vorhanden ist, kann er mit seinem Wirken am Patienten beginnen. Es findet hier eine logische Umkehrung statt, die Luhmann als „pervers“ bezeichnet (Bauch 1996: 77). Pervers deshalb, weil eigentlich die Abwesenheit von Krankheit, die Gesundheit, der als positiv zu wertende, erstrebenswerte Zustand sein sollte. Nach der „krank“/“gesund“ Dichotomie fallen Personen, die gesund sind automatisch aus dem medizinischen Versorgungssystem heraus. Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen (Bengel et al. 2001: 26). Insofern ist das Vorhandensein einer Krankheit im Rahmen des Krankheitssystems als positiv zu werten, obwohl es dem eigentlich negativ zu wertenden Zustand der Krankheit entspricht. Diese Sinnzuschreibung widerspricht einer Vielzahl von Codierungen von Systemen, in denen es positiv ist, etwas zu besitzen als es nicht zu besitzen z.B. Recht/Unrecht (Recht), Regierung/Opposition (Politik), wahr/unwahr (Wissenschaft) (Fuchs 2006: 10). Damit wird Gesundheit als negativer Befund, als Abwesenheit von Krankheit definiert oder auch als „Schweigen der Organe“ bezeichnet (Bauch 1996: 77, vgl. auch Bengel et al.2001: 16).
Ein Krankheitssystem arbeitet nach Luhmann rationaler, wenn es keine Energie in die Vorbeugung aller erdenklichen Risiken investiert, als wenn es sich im Krankheitsfall um die schnelle Genesung kümmert (Luhmann 1990 zitiert nach Bauch 1996: 79). Diese Überzeugung wird im deutschen Gesundheitssystem heutzutage nicht mehr vertreten und es findet eine zunehmende Orientierung an präventiven Maßnahmen statt. Die gesetzlichen Krankenkassen sind nach § 20 Abs. 1 und 2 des Fünften Sozialgesetzbuches vielmehr verpflichtet, einen Teil ihrer Ausgaben für Prävention aufzuwenden. Zu derartigen Angeboten zählen nach § 20 Abs. 4 SGB V Kurse zur Prävention (Sport, Ernährung etc.), Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-förderung und die Förderung von Selbsthilfegruppen (Lange und Ziese 2006: 124). Die Ausgaben für Prävention betrugen im Jahr 2003 jedoch lediglich 4,6 Prozent der Gesamtausgaben. Für Arzneimittel, Hilfsmittel, Zahnersatz und sonstigen medizinischen Bedarf wurden 2003 26,7 Prozent, für ärztliche Leistungen 26 Prozent sowie für pflegerische und therapeutische Leistungen 22,8 Prozent der Gesundheitsausgaben von insgesamt 239,7 Milliarden Euro ausgegeben (Statistisches Bundesamt 2006: 192). Die Ausgaben für präventive Maßnahmen werden heutzutage auch aus Kostengründen vorgenommen, weil man sich dadurch die Verhinderung von Krankheiten und somit geringere Kosten des Gesundheitssystems verspricht (Altgeld et al. 2006: 6). Weitere Gründe für Prävention fassen Altgeld et al. zusammen: „Prävention verhindert vermeidbares Leid. Prävention verlängert das Leben. Prävention steigert die Lebensqualität. Prävention ermöglicht ein produktives und aktives Leben. Prävention macht Spaß. Prävention fördert das soziale Kapital und damit den Zusammenhalt in der Gesellschaft“ (Altgeld et al. 2006:9).
Präventionsangebote können in drei unterschiedliche Gruppen mit spezifischen Zielen eingeteilt werden. Die primäre Prävention ist auf die Stärkung der eigenen Bewältigungsressourcen ausgerichtet, um die Entstehung der Krankheit zu verhindern oder ihre Ausbreitung zu minimieren. Die sekundäre Prävention ist darauf ausgerichtet, die Wahrscheinlichkeit, die Dauer und das Ausmaß des Auftretens der Krankheit zu verringern. Die tertiäre Prävention hat als Ziel, den Schweregrad der Krankheit zu reduzieren und eine Verschlimmerung zu verhindern (Hurrelmann 2000: 98; vgl. auch Kolip und Koppelin 2002: 491; vgl. auch Siegrist 2005: 277f).
Insgesamt wirkt Prävention jedoch nicht bei jeder Person mit der gleichen Intensität oder mit gleichem Effekt. Vielmehr kommt es hier zum so genannten Paradoxon der Prävention. Es bedeutet, dass die Personen mit einem relativ geringen Erkrankungsrisiko von einer präventiven Maßnahme stärker im Sinne der Verhinderung der Krankheitsentstehung profitieren, als Personen mit hohem Risiko (Siegrist 2005: 279).
Das moderne deutsche Gesundheitssystem versucht mit seiner Vielzahl an Präventionsangeboten der Entstehung von Krankheiten vorzubeugen und das Leben mit einer Krankheit so lange wie möglich zu erhalten. Zu den Präventionsangeboten zählen nicht nur rein sportmedizinische Angebote wie Sportkurse, sondern beispielsweise auch Lärmschutzwälle an Autobahnen, die genauso als vorbeugende Maßnahmen zu verstehen sind. Damit greift die Gesundheitspolitik immer weiter in die Gesellschaft ein. Auch wird der Körper nicht mehr als alleinige Ursache der Krankheit gesehen, sondern als Manifestationsraum von Krankheiten. Das Ursachenbündel von Krankheiten wird zunehmend im individuellen, selbstverschuldeten Verhalten oder im gesellschaftlichen Kontext gesucht (Bauch 1996: 80).
Der Begriff Gesundheit wird also wesentlich weiter gefasst und im Rahmen der modernen Gesundheitspolitik spielt auch die Patientencompliance, d.h. das Mitwirken des Patienten, eine immer größere Rolle (Bauch 1996: 96). Daher ist es nur konsequent mit „lebensförderlich“/„lebenshinderlich“ ein neues Begriffspaar für das Gesundheitssystem einzuführen.
Fraglich ist auch, wann eine Person als krank einzustufen ist. Behrens stellt hier die Frage, ob eine Person, die an einer unheilbaren Krankheit leidet aber keinerlei Symptome besitzt, als krank gelten solle. Er stellt fest, dass dies in unserem Alltagssprachgebrauch nicht so ist (Behrens 2000: 66). Dies bedeutet, dass man erst als „krank“ eingestuft wird, wenn Symptome von einem Arzt festgestellt werden können, was wiederum für eine arztzentrierte Wahrnehmung spricht. Diese Vorgehensweise wird in der Literatur vielfach bestätigt (vgl. Bengel et al. 2001: 16, Novak 2002: 58). Die Feststellung einer Krankheit und Diagnose wird gefolgt von der objektiven Einordnung in den internationalen Krankheitenkatalog (ICD, aktuell in der 10. Auflage).
Im Folgenden möchte ich mich nun genauer mit dem epidemiologischen Übergang befassen.
Die Bevölkerungszahlen der modernen Industrienationen sind in den vergangenen Jahrhunderten stetig gestiegen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Verringerung der Säuglingssterblichkeit durch die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Weiterhin haben Fortschritte in der Medizin dazu geführt, dass die Hygienestandards und andere präventive Maßnahmen verbessert wurden und somit einen indirekten Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung hatten. In der Folge werden die Menschen älter und die Bedeutung von chronischen Erkrankungen nimmt zu. Zu den chronischen Erkrankungen zählen beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bösartige Neubildungen (Schmidt, 2002: 192). Aber auch Muskel-Skelett-Erkrankungen, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen sowie psychische Erkrankungen sind diesem Bereich zuzuordnen (Badura et al. 2006: V). Chronische Erkrankungen können nicht geheilt werden, sondern bestenfalls in ihrem Verlauf gestoppt werden. Nur selten kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden (Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2005a: 108). Die Tendenz des Anstiegs chronischer Erkrankungen wird auch als epidemiologischer Übergang bezeichnet (Siegrist 2005: 30). Zudem konnte in den letzten Jahren beobachtet werden, dass sich diese chronischen Erkrankungen zu Ungunsten der unteren sozialen Schichten verschieben (Jungbauer-Gans 2006: 91f).
Die Gesundheitschancen sind also nicht gleich in allen sozialen Schichten verteilt. Vielmehr haben Angehörige der untersten sozialen Schicht rein statistisch gesehen ein wenigstens doppelt so hohes Risiko, ernsthaft zu erkranken oder vorzeitig zu sterben als die oberste soziale Schicht (Altgeld et al. 2006: 10). Die Ursachen dafür liegen in der höheren Belastung der Angehörigen der unteren sozialen Schichten im Vergleich zu den Angehörigen höherer sozialer Schichten. Durch häufiger auftretendes Risikoverhalten wie z.B. Rauchen, nicht den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung entsprechendes Essverhalten, keine ausreichende Bewegung und die zum Teil geringere Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen sind die Gesundheitschancen für Angehörige unterer sozialer Schichten niedriger (Altgeld et al. 2006: 11; vgl. auch Maaz et al. 2007: 6). Da Angehörige unterer sozialer Schichten größeren Restriktionen ausgesetzt sind, neigen sie häufiger zu solchem „Fehlverhalten“, weil sie über keine passenden, positiven Bewältigungsstrategien verfügen (Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2005a: 99).
Der epidemiologische Übergang betrifft allerdings nicht ausschließlich die unteren sozialen Schichten. Siegrist hat bei der Ursachenforschung für das verstärkte Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Industrienationen zwei Erklärungsstränge gefunden: Zum einen spielt hier gesundheitsschädigendes Verhalten wie eine zu fettreiche Ernährung, starker Alkoholkonsum, Zigarettenrauchen sowie Bewegungsmangel eine wichtige Rolle. Ein weiterer Erklärungsansatz besteht im Erleben von sozioökonomischen und psychosozialen Belastungssituationen. Dazu zählt Siegrist u.a. ein hohes Arbeitspensum mit wenig Kontrollspielraum sowie eine Berufstätigkeit mit hohen Anstrengungen, aber niedriger Belohnung (Siegrist 1996: 110f zitiert nach Helmert et al. 2000: 19f). Die in beiden Erklärungsansätzen genannten Risiken treffen zwar eher auf untere soziale Schichten zu, aber eben nicht ausschließlich.
3 Die gesundheitliche Lage in Deutschland. Ein Überblick.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Gesundheit der Deutschen insgesamt kontinuierlich verbessert. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Gesundheit der Ostdeutschen sich stark verbessert hat und somit den Durchschnitt für Gesamtdeutschland erhöhen konnte (Lange und Ziese 2006: 13).
Die Säuglingssterblichkeit mit 4,1 Todesfällen je 1000 Lebendgeburten gehört zu den niedrigsten Raten der Europäischen Union. Auch die allgemeine Sterblichkeit ist in den letzten zwei Jahrzehnten gesunken (Lange und Ziese 2006: 69).
Die häufigste Todesursache sind heutzutage Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Krankheiten sind auch als Zivilisationskrankheiten bekannt, weil sie durch die persönliche Lebensweise im Wohlstand begünstigt werden. Bewegungsmangel, Rauchen und Übergewicht sind Risikofaktoren, die durch eine gesündere Lebensweise vermieden werden könnten (Lange und Ziese 2006: 23).
Die zweithäufigste Todesursache sind Krebserkrankungen. Bei Männern ist die häufigste Krebserkrankung der verhaltensbedingte Lungenkrebs, bei Frauen der Brustkrebs. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung beider Geschlechter und ist vor allem ernährungsabhängig (Lange und Ziese 2006: 40).
Die Zahl der Infektionskrankheiten ist zwar insgesamt rückläufig, jedoch steigt die Zahl bestimmter Infektionskrankheiten, wie beispielsweise HIV, an. Die Bedeutung dieser Infektionskrankheiten, zu denen auch Tuberkulose und die Influenza gehören, ist nicht zu unterschätzen. Zudem hat die Zahl ausländischer Infektionskrankheiten, welche durch einen verstärkten Tourismus und Reiseverkehr auch immer mehr in Deutschland auftreten, sowie die Bedeutung resistenter Erreger zugenommen (Lange und Zeise 2006: 13, 19).
Die Gesundheit von Frauen und Männern unterscheidet sich noch immer, jedoch sind Angleichungstendenzen zu beobachten. Frauen haben eine um 5,6 Jahre höhere Lebenserwartung als Männer (Lange und Ziese 2006: 15). Dies liegt vor allem am gesundheitsschädigenden Risikoverhalten und an den schlechteren Arbeitsbedingungen der Männer. Sie rauchen häufiger als Frauen und trinken mehr Alkohol.
Insgesamt raucht ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland (Lange und Ziese 2006: 107). Die Zahl der jugendlichen Raucher befindet sich mit 20 Prozent der 12- bis 17-Jährigen auf einem der höchsten Niveaus im europäischen Vergleich (Lange und Ziese 2006: 109).
Bei den Männern ist es ein Drittel, bei den Frauen ein Sechstel, die Alkohol in gesundheitsschädigenden Mengen konsumieren. Die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker nimmt weiter zu (Lange und Ziese 2006: 107ff).
Neben den Unterschieden zwischen den Geschlechtern, gibt es gesundheitliche Unterschiede zwischen den sozialen Schichten. Untere soziale Schichten haben im Vergleich zu höheren sozialen Schichten eine Reihe gesundheitlicher Nachteile und erhöhte Krankheitsrisiken (Lange und Ziese 2006: 13). Diese sind auf „stärkere Arbeitsbelastungen, schlechtere Wohnverhältnisse, vermehrten Zigarettenkonsum, häufigeres Übergewicht und größeren Bewegungsmangel“ zurückzuführen (Lange und Ziese 2006: 83, Hervorhebungen getilgt). Weitere Risikogruppen stellen Arbeitslose und Alleinerziehende dar (Lange und Ziese 2006: 83). Von Übergewicht sind aktuell ein Drittel der Frauen und die Hälfte der Männer ab 18 Jahren betroffen (Lange und Ziese 2006: 113).
Ernährungsgewohnheiten spielen eine große Rolle bei der Entstehung von Krankheiten. Die Ernährung hat sich im Allgemeinen verbessert, so dass mehr Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Obst und Gemüse sowie nicht-alkoholische Getränke konsumiert werden. Dies trifft jedoch nicht für alle sozialen Schichten zu. Gleichzeitig hat auch der Konsum von Fertiggerichten, Fast Food und Nahrungsergänzungsmitteln zugenommen (Lange und Ziese 2006: 97ff).
Durch langes Sitzen am Computer und nicht ausreichende Bewegung leiden immer mehr Menschen in Deutschland an Rückenschmerzen. Ein Fünftel der Frauen und ein Siebtel der Männer ist davon betroffen (Lange und Ziese 2006: 19). Die Intensität der psychischen Belastungen hat zugenommen und äußert sich in einer Steigerung der Depressionen und Angststörungen. Immer mehr Menschen werden auch aus diesen Gründen frühzeitig berentet (Lange und Ziese 2006: 19, 29).
Die sportlich-körperliche Aktivität hat zwar seit 1990 zugenommen, jedoch führen viele berufliche Tätigkeiten zu einem Bewegungsmangel im Alltag (Lange und Ziese 2006: 81).
In Deutschland werden immer mehr Menschen immer älter. Dies ist eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, da die Zahl der chronischen Erkrankungen im Alter steigt und eine umfangreichere Pflege notwendig wird (Lange und Ziese 2006: 13). Demenz ist eine der wichtigsten Erkrankungen im Alter, die auf 30 Prozent bei den über 90-Jährigen steigt (Lange und Ziese 2006: 33).
4 Die Unterschiede zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit.
„Bist du gesund?“ - Auf Grundlage der im zweiten Kapitel vorgestellten Definitionen wird man eine Reihe unterschiedlicher Antworten auf diese Frage bekommen. Es ist anzunehmen, dass mindestens so viele Antworten auf diese Frage möglich sind, wie es Individuen und somit unterschiedliche Definitionen von Gesundheit gibt. Jeder definiert Gesundheit anders, Frauen anders als Männer, Angehörige höherer sozialer Schichten anders als Angehörige unterer sozialer Schichten, empfindliche Menschen anders als unempfindliche. Jaspers stellt dazu fest: „Was krank im allgemeinen sei […] hängt weniger vom Urteil der Ärzte als vom Urteil der Patienten ab und von den herrschenden Auffassungen der jeweiligen Kulturkreise“ (Jaspers 1946: 652 zitiert nach Dörr 2002: 76; vgl. auch Langenmayr 1980: 9; vgl. auch Siegrist 2005: 25).
Es existiert also eine Vielzahl von Laienauffassungen zur Definition von Gesundheit, die bereits Herzlich untersucht hat. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der Laienauffassung von Gesundheit folgende drei Dimensionen gibt, die auch in späteren Studien immer wieder bestätigt wurden (Herzlich 1973 zitiert nach Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2001: 8f):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Drei Dimensionen der Laienauffassung von Gesundheit. In Anlehnung an Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2001: 9
Auch Siegrist bestätigt diese drei Dimensionen der Laiendefinition von Gesundheit (Siegrist 1996 zitiert nach Siegrist 2005: 32f).
Neben der subjektiv-persönlichen Ebene von Gesundheit kann Gesundheit auch auf der sozial-normativen Ebene und der medizinisch-professionellen Ebene (anhand von medizinisch-therapeutischen Kriterien) festgestellt werden (Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2001: 15f; vgl. auch Langenmayr 1980: 11).
Es macht einen Unterschied, ob sich jemand gesund fühlt oder von Ärzten als gesund bezeichnet wird, weil keine Diagnose zu stellen ist, auch wenn er sich selbst vielleicht nicht als gesund beschreiben würde. Siegrist beschreibt dieses Problem, indem er zwischen Befinden und Befund deutlich unterscheidet (Siegrist 2005: 37f). Weiterhin ist fraglich, ob es jemals eine Person geben wird, bei der nicht irgendein Arzt doch eine Diagnose stellen könnte oder allein die Abweichung von den Norm- bzw. Durchschnittswerten als Krankheitsbild definiert (Herrmann 1997 zitiert nach Gerlinger 2006: 43; vgl. auch Bengel et al. 2001: 16; vgl. auch Siegrist 2005: 26). Was ist mit den Blutwerten? Gibt es nicht vielleicht doch Bewegungsmangel? Wie ist dieser definiert? Ist das Körpergewicht nicht doch etwas zu hoch? Was ist mit der Anzahl der Kopfhaare? Gibt es nicht vielleicht doch eine - wenn auch noch so kleine - Fehlhaltung, eine kleine Ungenauigkeit der Natur?
Fühlt man sich krank, fühlt man sich subjektiv nicht gesund, bezeichnet man den eigenen Gesundheitszustand als schlecht. Dies hat Konsequenzen auf die tatsächliche Gesundheit. Die subjektive Einschätzung der Gesundheit spiegelt nämlich die Zufriedenheit mit der gesamten Lebenssituation und die Annahme, die eigene Gesundheit selbst beeinflussen zu können wider (Bundesministerium für Gesundheit 2006: 41f).
Auch wenn die äußeren Lebensbedingungen nahezu perfekt sind, kann man sich trotzdem subjektiv krank bzw. nicht wohl fühlen. Man ist nicht zufrieden, obwohl man es eigentlich - objektiv betrachtet - sein könnte. Unterschiedliche Personen können, obwohl sie die gleichen Krankheiten haben, ihren Gesundheitszustand unterschiedlich bewerten. Mueller und Heinzel-Gutenbrunner führen diese Bewertungsunterschiede beim Vergleich von älteren und jüngeren Personen darauf zurück, dass bei älteren Menschen die Krankheiten und die entsprechenden Symptome wahrscheinlich stärker ausgeprägt sind, als bei den jüngeren (Mueller und Heinzel-Gutenbrunner 2005a: 125).
Die subjektive Lebenszufriedenheit wird oft mit den objektiven Lebensbedingungen gleichgesetzt. Jedoch müssen objektiv gute Lebensbedingungen nicht automatisch zu einer subjektiven Lebenszufriedenheit auf gleichem Niveau führen. Genauso ist es auch möglich, dass objektiv schlechte Lebensbedingungen mit einer hohen subjektiven Lebenszufriedenheit zusammenfallen. Die Gründe für diese zunächst paradox erscheinende Situation liegen wohl an der zu großen und schwer bzw. nicht messbaren Komplexität des Untersuchungsgegenstandes oder an der methodischen Unzulänglichkeit der bisherigen Untersuchungen (Zapf 1984 zitiert nach Wolf und Wendt 2006: 26).
Für Deutschland gibt es einen, bis auf wenige Lebensbereiche gültigen, negativen Trend: Bis auf die Werte für Wohnung und Umwelt sind die Deutschen im Zeitraum von 2000 bis 2004 immer weniger zufrieden mit den einzelnen Lebensbereichen (Christoph 2006: 443f). Auch die Zufriedenheit mit der Gesundheit sinkt in Deutschland im Zeitraum von 2000 bis 2004 unabhängig von Alter, Bildungsniveau, Erwerbsstatus, verfügbarem Haushaltsnettoeinkommen, Region oder Geschlecht (Andersen et al. 2006: 465).
Die Selbsteinschätzung der Gesundheit hat sich als aufschlussreich für den tatsächlichen Gesundheitszustand erwiesen (Helmert 2003b zitiert nach Mielck 2005: 26). In Deutschland bewerten im Jahr 2004 50 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen ihre Gesundheit als „gut“ (Andersen et al. 2006: 464). Eine Antwortmöglichkeit „sehr gut“ gab es hier nicht. Vergleicht man diese Zahlen mit dem EU-15 Niveau, so wird klar, dass Deutschland mit seinen Werten unter dem Durchschnitt liegt. 64,6 Prozent der Männer und 57,4 Prozent der Frauen beurteilen ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“ oder „gut“. In Spanien liegt der Wert für die Männer bei 73 Prozent und für die Frauen bei 63,2 Prozent, also beide Male über dem EU-15 Durchschnitt (Office for Official Publications of the European Communites 2005: 26). Die Ursachen für diese Unterschiede zu untersuchen, könnte ein lohnendes Forschungsfeld sein.
[...]
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Claudia Kunze (Autor:in), 2007, Gesund sein, sich gesund fühlen - Soziale Einflussfaktoren auf die Gesundheit in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86213
Kostenlos Autor werden




















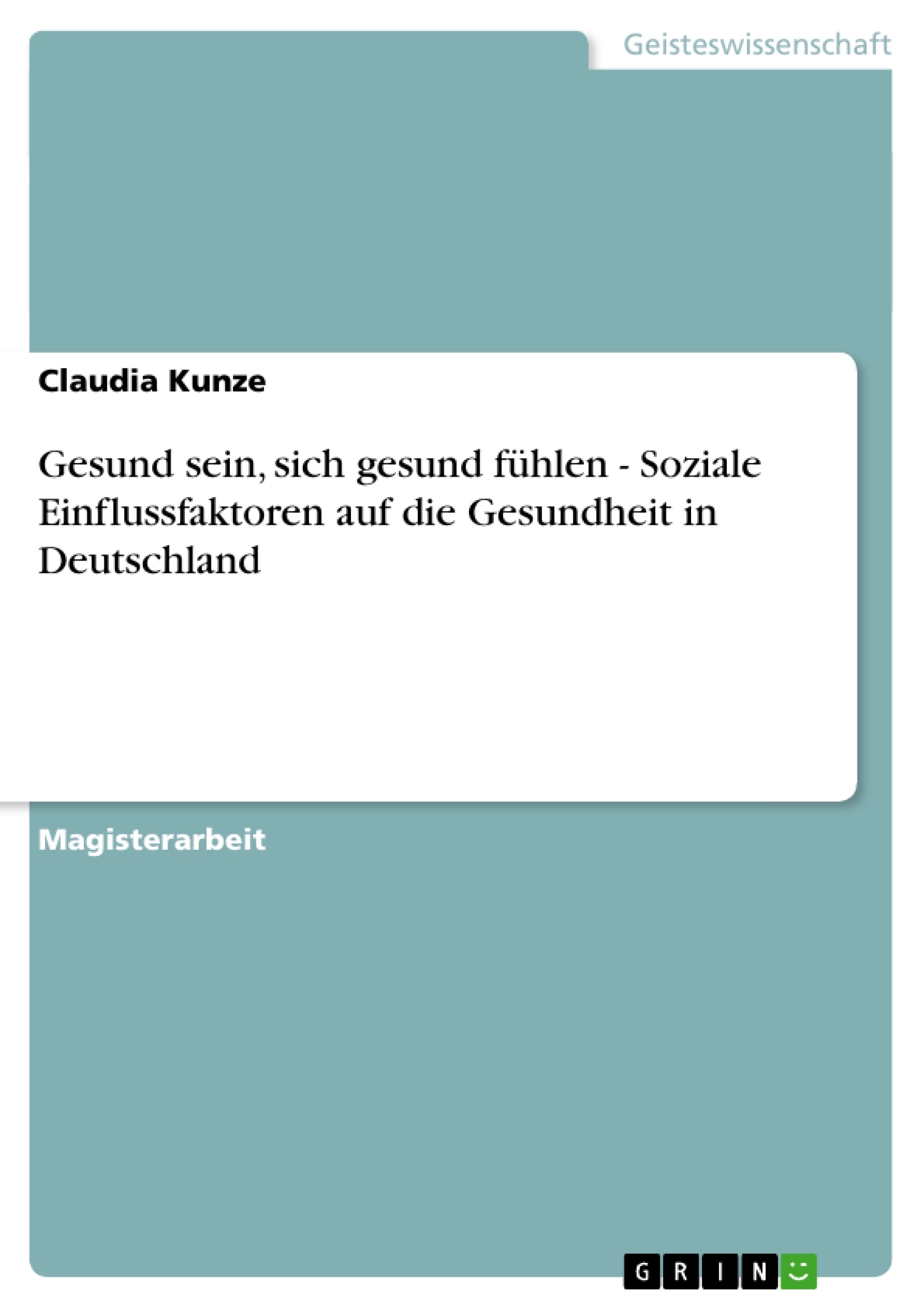

Kommentare