Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
2 Geschichte der Musik
2.1 Entstehung von Musik
2.2 Wissenschaftliche Erklärungen der Evolution von Musik
2.2.1 Die Evolution der Musik durch sexuelle Selektion
2.2.2 „Musilanguage“
2.2.3 Entstehung der Musikalität durch Mutter-Kind-Interaktion
2.2.4 Sozialer Zusammenhalt
2.3 Zusammenfassung
3 Physikalische, psychologische und physiologische Grundlagen von Musik und ihrer Wirkung auf den Menschen
3.1 Physikalische Grundlagen
3.1.1 Rhythmus, Melodie und Harmonie
3.2 Physiologische Grundlagen
3.3 Hirnphysiologie
3.4 Musik und Emotion
3.5 Individuelles Hören
3.6 Musikgeschmack
3.6.1 Musikgeschmack und Alter
3.6.2 Musikgeschmack und Sozialstatus/ Bildung
3.6.3 Musikgeschmack und Persönlichkeit
3.6.4 Situative Musikpräferenzen
4 Musik und außermusikalische Begabung
4.1 Intelligenz
4.2 Soziale Kompetenz
5 Die Bedeutung von Musik für Jugendliche
5.1 Jugend
5.2 Jugend und Medien
5.2.1 Entspannung und Alltagsbewältigung
5.2.2 Identifikation
5.2.3 Musik und Sexualität
5.3 Jugendliche (Musik)Kultur und Vermarktung
5.4 Musikalische Praxis
5.5 Effekte durch aktives Musizieren
5.5.1 Erfolg erleben
5.5.2 Soziale Kompetenz
5.5.3 Kreativität und Ausdrucksfähigkeit
5.5.4 Musik als Droge
6 Resümee
7 Musik in der sozialen Arbeit in Abgrenzung zu Musiktherapie und Musikpädagogik
7.1 Musiktherapie
7.2 Musikpädagogik
8.1 Bedingungsanalyse
8.1.1 Lehrende-Ressourcen
8.1.2 Lernende-Voraussetzungen
8.1.3 Lehr-Lernsituation
8.2 Ziele
8.3 Methoden
9 Projekte
9.1 Musikwerkstatt Botnang
9.2 Musikmobile
9.2.1 Rockmobil Gießen
9.2.2 Jamliner Hamburg
9.3 Musikprojekte für Frauen und Mädchen
9.4 Fallspezifische Musikprojekte
9.4.1 Musikgruppe Jugendhaus JVA Düsseldorf
10 Fazit
11 Checkliste Musikprojekt
Literatur
1 Einleitung
„Musik gilt als das emotional wirksamste ästhetische Kommunikationsmittel in der Kultur des Menschen“.[1]
Jede menschliche Gesellschaft musiziert. Auf der ganzen Welt, durch alle Kulturen, vom Angehörigen eines Naturvolks bis zum Akademiker in Industrienationen wird getrommelt, gesungen und komponiert. Durch archäologische Funde ist belegt, dass bereits vor bis zu 600.000 Jahren die Frühmenschen Musikinstrumente gebrauchten.[2] Musik ist also nicht nur international, sondern auch ein sehr frühes Element der menschlichen Entwicklung.
Daneben ist der Einsatz von Musik in fast allen menschlichen Lebenslagen üblich. Musik ist Untermalung, Inspiration und Ansporn in Kulthandlungen, Medizin, Krieg, Liebe oder wird als Stimulans in Supermärkten benutzt.
Zwar ist nicht davon auszugehen, dass Musik kulturübergreifend „verstanden“ wird. Dazu ist die Konnotation musikalischer Ausdrucksmuster mit außermusikalischen Inhalten zu sehr an kulturelle Rahmenbedingungen gebunden.[3] Ein/e Europäer/in wird also nicht zwangsläufig ein asiatisches Wiegenlied auch als Wiegenlied erkennen. Er/Sie wird aber sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form von dem Lied berührt werden.
Ein spezieller Bereich der Musik ist ihre Verbindung mit der Phase der Jugend. Der Übergang vom Kindsein in die Erwachsenenwelt ist fast immer von Konflikten mit den älteren Generationen und deren Vorstellungen und Konventionen geprägt.
Ausdruck findet dieser Konflikt zwischen Jungen und Alten häufig in einer Jugend(sub)kultur, die sich über Kleidung, Sprache und Musik identifiziert und von der Erwachsenenwelt abgrenzt. In der Jugend hat Musik nachweislich einen wesentlich höheren Stellenwert als in späteren Lebensphasen.[4]
Diese Tatsache macht Musik für die soziale Arbeit mit Jugendlichen interessant. Kann Musik ein Zugang sein, um in Kontakt mit Jugendlichen zu treten und dann im Verlauf musikalischen Handelns andere, sozialpädagogische zu Ziele erreichen? Ist Musik eine Möglichkeit „subkulturübergreifender“ Kommunikation unter jungen Menschen?
Die soziale Arbeit befasst sich seit den 1970er Jahren mit der Rolle von Musik in der sozialen Arbeit. Seit der Gründung der Fachhochschulen findet sich im Studium der Sozialpädagogik/Sozialarbeit der Bereich Musik in den Lehrplänen wieder. Dementsprechend ist auch die Zahl von Projekten und Einsatzbeispielen für Musik in der sozialen Arbeit und der begleitenden Literatur mittlerweile recht groß.
Meine eigene Jugend und die mit ihr verbundene musikalische Sozialisation, sowohl als Musikhörer als auch als Hobbymusiker, macht Musik als Methode in der sozialen Arbeit für mich interessant. Die Erfahrungen, die ich selbst als Bandmusiker gemacht habe, weiterzugeben und das mit meinem zukünftigen Beruf als Sozialpädagoge zu verknüpfen, wäre mir ein besonderes Vergnügen. In dieser Arbeit versuche ich, die mit dem Einsatz von Musik in der sozialen Arbeit verbundenen Aspekte näher zu erläutern. Mein Hauptaugenmerk wird dabei auf der Entwicklung und Durchführung von Musikprojekten mit Jugendlichen liegen. Dazu werde ich in der Arbeit die meiner Meinung nach wichtigen Aspekte von Entstehung und Wirkung von Musik, ihre Bedeutung für Jugendliche und Praxisbeispiele von Musikprojekten sowie deren didaktischen Hintergrund näher betrachten.
2 Geschichte der Musik
2.1 Entstehung von Musik
Zur Entstehung von Musik gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Einig ist sich die Forschung auf Grund archäologischer Funde darüber, dass bereits Frühmenschen vor 10.000-50.000 Jahren Musikinstrumente wie Flöten mit Grifflöchern oder Schwirrhölzer herstellten und benutzten. Älteste Funde belegen einfache Flöten in der Zeit bis vor 600.000 Jahren. Diese jedoch werden eher als reine Signalinstrumente gedeutet, da sie keine Tonhöhenvarianz ermöglichten. Zudem wurden erst im Zusammenhang mit den jüngeren Funden Indizien für den Einsatz der Instrumente bei kultischen Handlungen gefunden.[5]
Man vermutet, dass der Einsatz von Musik in der Frühphase ausschließlich in Verbindung mit Magie und Religion stattfand. Daher spricht Wörner von einem „gewaltigen geistesgeschichtlichen Sprung“[6] zwischen den Signalflöten und den späteren Musikinstrumenten. Diese Entwicklung spiegelt die kulturelle Entwicklung des Menschen, die Entwicklung einer Vorstellung von Magie und von Religion wider.
Dieser Zusammenhang von geistlichem Denken und der Musik ist über die Zeit erhalten geblieben. Viele Kulturen verbinden ihre Schöpfungsmythen mit Musik. So soll in der altindischen Mysthik die Musik den Menschen von den Göttern gegeben worden sein und rituelle Musik, Tanz und Gesang sollen die kosmische Kraft perpetuieren.[7] Ähnliches lässt sich auch für andere Kulturen belegen, die verschiedene religiöse Hintergründe hatten, wie den Buddhismus oder den Hinduismus im späteren Indien.
Auch in der jüdisch-christliche Lehre wird von Jubal gesprochen, von dem die Flöten- und Zitherspieler abstammen sollen.[8]
Die griechische Mythologie sieht in der Musik ein Geschenk Apollons und der Musen. Diese Überzeugungen spiegeln sich auch in der Betrachtung von Musik in den verschiedenen Kulturen wider. Neben älteren Sichtweisen, wie im Hinduismus, in dem es heißt „die Welt ist Klang“,[9] oder der tibetischen Lehre, nach der alle Klänge Gebete sind, gibt es auch in der europäischen Tradition wichtige Verknüpfungen von Göttlichkeit und Musik. So ist von Martin Luther überliefert, dass Musik, nebst dem Worte Gottes, das Einzige ist, sie lenkt und beherrscht die menschlichen Gefühle.[10]
2.2 Wissenschaftliche Erklärungen der Evolution von Musik
Neben den Mythen, die das Göttliche, Übernatürliche zum Ursprung der Musik erklären, gibt es auch Forschungsansätze über die Gründe und den Ablauf des geistesgeschichtlichen Sprungs von Tönen als Signal zur Musik.
Die dazu entwickelten Theorien müssen dabei immer als Vermutung angesehen werden. Zum einen geht es nicht um einen Zeitpunkt, an dem Musik von den frühen Menschen „erfunden“ wurde, sondern um eine Zeitspanne von mehreren zehntausend oder sogar hunderttausend Jahren. Daneben ist die Entwicklung nicht lückenlos nachvollziehbar, im Gegenteil überwiegen die Lücken in der Dokumentation bei weitem.[11] In der Forschung zur Evolution der Musik ist man sich zwar grundsätzlich einig, dass die Musik mit der Entwicklung des menschlichen Verstandes ihren Ursprung nahm und mit der Entwicklung der Sprache einherging.[12] Von dieser Grundannahme haben sich aber verschiedene Theorien entwickelt, die den Ursprung und die Evolution der Musik untersuchen.
D. Zelimir macht in seinem Text auf ein gewisses Potential für Verwirrung aufmerksam, das der Begriff der „Evolution“ der Musik in sich trägt. So ist in dem Begriff sowohl die darwinistische Idee der biologischen Weitergabe bestimmter für das Überleben vorteilhafter Fertigkeiten enthalten, wie auch die kulturell begründete Entwicklung und Veränderung musikalischer Systeme und Stile.[13]
2.2.1 Die Evolution der Musik durch sexuelle Selektion
Nach diesem Erklärungsansatz ist die Entstehung von Musik auf das darwinistische Modell der „sexuellen Selektion“ und der damit verbundenen „Adaption“ von für das Überleben wichtigen Eigenschaften und Fertigkeiten zurückzuführen. Die Eigenschaften und Fähigkeiten der reproduktiv erfolgreichsten Gruppe werden weitergegeben und finden auf lange Sicht Niederschlag in den Erbinformationen des Nachwuchses.[14] Darwin hat in der Musik die Nachahmung von Tierlauten gesehen und sie genau wie Vogelstimmen als sexuellen Lockruf interpretiert.[15] Dieser Theorie folgend muss Musik aber mehrere Eigenschaften erfüllen. Sie muss einen Vorteil für das Überleben bieten, oder zumindest die Chancen zur Reproduktion für die musizierenden Frühmenschen im Vergleich zu den nicht musizierenden vergrößern; und sie muss das Potential für eine genetische Weitergabe haben. Der praktische Wert der Musik für das Überleben ist dabei sehr umstritten. Schon in der Antike gingen Philosophen davon aus, dass Musik und Kunst allgemein keinen praktischen Nutzen haben.[16] Auch die Adaption von Musikalität, also die Entwicklung vererbter Strukturen im Gehirn, ist umstritten. Zwar ist man sich über die adaptiven Eigenschaften der menschlichen Sprache einig; ob diese aber auf Musik übertragen werden können, ist nicht klar.[17] Zudem gibt es den Einwand, die sexuelle Selektion hätte die Musik zu einer Fertigkeit werden lassen müssen, die nur bei einem Geschlecht vorzufinden wäre, wie es auch beim Vogelgesang der Fall ist.
Dem entgegen sieht Geoffrey Miller[18] die sexuelle Selektion als Grundlage der Musik an. Für ihn ist die Annahme, dass Musik nur ein Nebenprodukt der Kultur allgemein sei, und sie dem großen Gehirnvolumen und der Entwicklung eines Bewusstseins zu verdanken sei, unzureichend.
Dem Einwand, dass Musik von beiden Geschlechtern gemacht wird, hält Miller entgegen, dass auch andere Beispiele adaptiver Verhaltensweisen aus dem Tierreich bei männlichen und weiblichen Angehörigen der Spezies zu finden sind. Auch hätte Darwin in seinen Ausführungen zu Musik darauf hingewiesen, dass bei Frühhominiden die Partnerwerbung von beiden Geschlechtern üblich war.[19]
Miller sieht in der Musik eine komplexe biologische Adaption. Er verweist auf bestimmte Gehirnareale, die nur für die Verarbeitung musikalischer Signale zuständig sind, und es dem Menschen erlauben, hunderte von Melodien zu speichern und zu reproduzieren. Indizien für den Nutzen von Musik im Sinne der Entstehung der Musik durch sexuelle Selektion sieht Miller in einer Reihe von Indikatoren. So ist die sexuelle Motivation eher indirekt. Ein Tänzer zeigt im Tanz seine körperliche Fitness und seine Koordinationsfähigkeit. Ein Instrumentalist zeigt seine Fähigkeit zur Automation komplexer technischer Abläufe, was dafür spricht, dass er viel Zeit hat; nach Miller ein Indiz für das Fehlen familiärer Verpflichtungen.[20]
2.2.2 „Musilanguage“
Eine weitere Theorie zur Entstehung der Musik basiert auf der Annahme, dass die menschliche Sprache und die Musik einen gemeinsamen Ursprung haben. Steven Brown[21] entwirft dafür das Modell der „Musilanguage“.
Dabei geht Brown davon aus, dass der Sprache und der Musik ein „Ursystem“ vorausging und sich beide daraus entwickelten. Er unterscheidet dabei verschiedene Merkmale, die den Verlauf der Auseinanderentwicklung verdeutlichen.
1. shared features (gemeinsame Merkmale): hiermit sind die Eigenschaften gemeint, die für Sprache und Musik gleichermaßen nötig sind, wie die generelle Vokalisation und die Fähigkeit, emotionale Zustände musikalisch und sprachlich auszudrücken
2. parallel features (parallele Merkmale): dies sind Merkmale, die in Sprache und Musik analog, aber nicht identisch sind. Dazu zählen Phrasierung und Kombination; es werden in beiden Medien spezielle Aufbaublöcke und übergeordnete Strukturen verwendet, das „Material“ ist aber anderes
3. distinct features (spezialisierte Merkmale): hierunter werden die Eigenschaften gefasst, die nur für die Musik oder nur für die Sprache charakteristisch sind. Als Beispiele werden die propositionale Syntax und der isometrische Rhythmus genannt.
Brown zufolge gab es im Verlauf der Entwicklung diese drei Stadien, die sich auf die Entwicklung des zentralen Nervensystems (ZNS) auswirkten. Vor der Auseinanderentwicklung von Sprache und Musik gab es im ZNS einen gemeinsamen Bereich (Modul), der die undifferenzierten Merkmale der ersten Gruppe verarbeitete. Durch die Trennung der Entwicklung beider Fähigkeiten fand eine Reorganisation des ZNS statt, und es entstanden Bereiche, die sich über die zweiten und später dritten Merkmale „spezialisierten“. Brown nimmt an, dass bis heute diese ersten Module im ZNS für Sprache und Musik parallel genutzt werden und führt als Beweis Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren an, die dies bestätigten.[22]
2.2.3 Entstehung der Musikalität durch Mutter-Kind-Interaktion
Ellen Dissannayake entwickelt eine Theorie zur Entstehung von Musik und der Musikalität, die auf der Beobachtung der Interaktion zwischen Müttern und ihren kleinen Kindern basiert. Danach ist nicht die Werbung unter Erwachsenen die Basis für Kultur, darunter Musik, sondern die Fähigkeit von Müttern, tonale Muster in der Kommunikation mit ihren Kindern zu produzieren.[23]
Diese Kommunikation wird dabei als wichtige Grundlage für die Entwicklung eines Koordinationsvermögens für die Emotionalität im Erwachsenenalter gesehen. Die Mutter-Kind-Interaktion ist (wenn man den pränatalen Abschnitt unberücksichtigt lässt) durch Berührungen und Hinwendung geprägt, die durch Vokalisation der Mutter unterstützt werden. Diese werden von der Mutter mit steigenden Fähigkeiten des Kindes angepasst, aus beruhigendem Summen wird dabei ein aufmunterndes Singen. Diese Hinwendung steigert die Aufmerksamkeit des Kindes und aktiviert es. Insgesamt ist diese Interaktion für die Vermittlung wichtiger psychologischer und soziokultureller Fähigkeiten für das Kind verantwortlich. Dissanayake nennt dabei unter anderem die Vermittlung der Erkenntnis von expressiven Merkmalen der Sprache und die Stärkung neuronaler Netzwerke, die für soziale und emotionale Funktion prädisponiert sind. Zudem stellt diese Interaktion eine erste Vermittlung von kulturellen Normen geeigneten sozialen Verhaltens dar.
Dieser Ansatz sieht Musik eher im Zusammenhang mit Tanz und Mime und geht davon aus, dass die frühe Mutter-Kind-Interaktion eine Voraussetzung für die spätere Teilhabe an Ritualen und Kulthandlungen ist.[24]
2.2.4 Sozialer Zusammenhalt
In der Diskussion um die für das Überleben wichtigen Eigenschaften von Musik, und den damit einhergehenden Konsequenzen für ihre Entstehung (sexuelle Selektion oder nicht), stellt eine Theorie den sozialen Zusammenhalt in Gruppen in den Vordergrund. Dieser soziale Zusammenhalt in Gruppen ist ein für das Überleben des frühen Menschen wichtiger Faktor, da der Mensch ein soziales Lebewesen ist und ein Überleben für den einzelnen Hominiden in der Frühzeit sehr schwer gewesen wäre. Um aber eine soziale Gruppe zu organisieren und zu stabilisieren, braucht man Kommunikationsmittel, die den verschiedenen Anforderungen eines gemeinschaftlichen Lebens gerecht werden.
Nach der Grooming and Gossip -Theorie Robin Dunbars[25] ist die Sprache eine Weiterentwicklung der bei Primaten für den sozialen Zusammenhalt wichtigen Körperpflege. Da die Gruppengröße der Menschen in der Frühzeit auf bis zu 150 Mitglieder geschätzt wird und damit eine Allianzbildung und die Pflege sozialer Kontakte durch gegenseitige Körperpflege einen großen Aufwand bedeutet hätten, hat die Sprache diese Funktion übernommen. Auf dieser Grundlage der Sprache als Träger einer Funktion für den sozialen Zusammenhalt formuliert D. Huron eine Hypothese, in der er diese Funktion für die Musik analog übernimmt. Demzufolge ist Musik eine Möglichkeit der verbalen Kommunikation in größeren Gruppen.[26] Neben dieser rein akustischen Begründung finden sich aber auch physiologische Ansätze. So wird Musik für die Senkung des Testosteronspiegels verantwortlich gemacht. Da Testosteron die Aggressivität und das sexuelle Wettbewerbsverhalten steuert, führt dessen Senkung zu einem harmonischeren Zusammenleben in der Gruppe. Darin sieht Dunbar den Beweis für den Wert von Musik für das Überleben der menschlichen Spezies.[27]
2.3 Zusammenfassung
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Theorien und Studien sollen nur einen Einblick geben in die Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Ansätze, mit denen die Entstehung von Musik erklärt wird. Wie eingangs erwähnt, wird die Forschung zu diesem Thema durch eine mangelnde Faktenlage erschwert; die Frühmenschen haben keine Aufzeichnungen darüber hinterlassen, wie und warum sie begonnen haben, Musik zu machen. Man kann die eine dieser Theorien für sinnvoller halten als die andere, bzw. die sich nicht widersprechenden in beliebiger Variation zusammensetzen, um zu einem logischen Weg für die Entstehung der Musik zu kommen. Der entscheidende Aspekt dieses Kapitels ist die durch alle Diskussionen vorhandene Akzeptanz von Musik als elementarem Bestandteil der menschlichen Kultur.
3 Physikalische, psychologische und physiologische Grundlagen von Musik und ihrer Wirkung auf den Menschen
3.1 Physikalische Grundlagen
Die physikalische Grundlage der Musik ist der Schall. Dieser ist definiert als „mechanische Schwingungen und Wellen eines elastischen Mediums im Frequenzbereich des menschlichen Hörens (16-20000 hz)“.[28]
Das elastische Medium ist hier die Umgebungsluft. Die für die Art des Schalls relevanten Merkmale sind die Amplitude, die die „Höhe“ der Welle und damit die Lautstärke des Schalls beschreibt, und die Frequenz, die die Länge der Welle und damit die Tonhöhe darstellt. Die Einheit für die Tonhöhe ist Hertz, mit der die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde gemessen werden (so hat beispielsweise der Ton a’ eine Frequenz von 440 hz).
Eine einzelne Schwingung ergibt einen reinen Ton (Sinuston), der aber nur elektronisch herzustellen ist. Bei natürlichen Schallen unterscheidet man Geräusch, Knall und den Klang. Einzelne, von der menschlichen Stimme oder Musikinstrumenten erzeugte Töne sind bereits Klänge, da sie nie nur aus dem vorherrschenden Ton bestehen, sondern aus der Summe bestimmter Sinustöne. Der Grundton ist dabei der tiefste Ton. Die darüber liegenden Teiltöne werden Formanten genannt und bilden die Klangfarbe. So klingt ein „Ton“ A auf einer Gitarre anders als auf einer Flöte, was an den Obertönen liegt, die in einer anderen Zusammensetzung und in anderen Frequenzen für jedes Instrument typisch auftreten.
Auch die Anzahl der Obertöne ist für den Klang wichtig. Obertonarme Klangquellen, wie die Flöte, klingen weicher als obertonreiche, bei denen die Obertöne den Klang schriller machen. Daneben ist die Stärke der Teiltöne wichtig für den Klang, den ein Instrument erzeugt. Das Klavier erzeugt beispielsweise durch seine große Dynamik in den Obertönen seinen besonderen Klang.
Das Verhältnis der Obertöne zueinander ist ein weiterer Aspekt der Klänge. Sie können zum einen harmonisch sein, dass heißt, die einzelnen Teiltöne (bzw. ihre Frequenz in Hertz) stehen in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander. Zum anderen gibt es die unharmonischen Obertöne, die in einem nur in Bruchzahlen auszudrückenden Verhältnis stehen. Klänge mit vielen unharmonischen Obertönen werden zum Beispiel von Glocken oder angeschlagenen Metallstäben produziert. Aber auch das obertonreiche Klavier produziert solche Klänge.
Auch Geräusche zeichnen sich durch unharmonische Obertöne aus, sie unterscheiden sich von Klängen und Tönen aber dadurch, dass ihre Schwingungen sich nicht periodisch wiederholen. Die Knalle sind ebenfalls unharmonisch, dazu aber noch kurz und impulshaft. Ihre Klangfarbe hängt dabei von ihrer Dauer ab.[29] Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge der aufgeführten physikalischen Merkmale von Schall und Musik.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Klangfarben, Tonhöhen, Schall; in Michels, U., 2005; S. 16
3.1.1 Rhythmus, Melodie und Harmonie
Töne, Klänge und Geräusche sind noch nicht zwingend Musik. Die Tatsache, dass Musik im Ablauf von Zeit geschieht (anders als die Malerei, die nach ihrer Entstehung Raum aber keine Zeit einnimmt) macht es notwendig, ihr einen zeitbezogenen Rahmen zu geben. Die Ordnung dieses Zeitrahmens ist der Rhythmus. Der Rhythmus kann durch die Länge von Klängen, ihre Wiederholung, durch die Varianz ihrer Dynamik oder bestimmte Rhythmusinstrumente dargestellt werden.
Daneben können Klänge zu Melodien geformt werden, indem verschiedenen Tönhöhen aneinander gereiht werden. Eine andere Möglichkeit der Gestaltung von Klängen ist die Harmonie, d. h. mehrere Klänge werden zur gleichen Zeit erzeugt. All diese Parameter von Musik können einzeln (Gesang, Trommel) oder zusammen (Orchester, Band) auftreten. Tatsächlich scheint die Frage, wann Schallereignisse Musik sind, noch lange nicht geklärt. Neben der bekannten, eher den Musikgeschmack betreffenden Sicht auf die Grenze zwischen Musik und Nichtmusik („Die Flippers? Das ist doch keine Musik!“) ist es auch wissenschaftlich nicht ganz einfach, diese Grenze zu definieren. Ist Vogelgesang Musik? Melodie und Rhythmik sind vorhanden. Trotzdem fehlt nach gängiger Meinung im Gesang von Tieren ein wichtiges Kriterium. Michels bezeichnet dieses Kriterium als die „geistige Idee“,[30] die neben dem akustischen Material für die Musik entscheidend ist; Wörner[31] spricht vom Sinn, den die Tonverbindungen haben müssen.[32]
3.2 Physiologische Grundlagen
Ein Schall wird beim Menschen über das Ohr aufgenommen. Das Ohr ist dabei in verschiedene Bereiche unterteilt. Das wie ein Trichter aufgebaute Außenohr empfängt die Schallwellen, verstärkt sie auf das 2- 3fache und leitet sie in das Mittelohr. Das Trommelfell überträgt die Druckschwankungen weiter an die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel in der mit Luft gefüllten Paukenhöhle. Dort wird der Schall noch einmal verstärkt und an das Innenohr und die darin liegende mit Lymphe gefüllte Schnecke weitergegeben. Im Innern dieser Schnecke liegt die Basilmembran, in der über das Cortische Organ, in dem Haarzellen angeordnet sind, der Schall an den Hörnerv geleitet wird. Die Schnecke verengt sich in ihrem Verlauf, in den breiteren Teilen werden die tieferen, in den engeren die höheren Frequenzen empfangen. Klänge werden dabei in ihre einzelnen Töne aufgeschlüsselt und erst im Gehirn wieder zu einem Gesamtbild zusammengesetzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Ohr; in Michels, U., 2005; S. 18
Über den Hörnerv werden die empfangenen Signale an das Gehirn weiter geleitet. Das Gehör ist dabei in der Lage, 1.500 Tonhöhenunterschiede und 325 Stärkestufen, zusammen also 340.000 unterschiedliche Werte zum Gehirn zu leiten. Die Gesamtlautstärke wird durch die Summe der eingehenden Impulse bestimmt.[33]
Die Axone, die „Leitungen“ des Hörnervs, transportieren die aufgenommenen und verstärkten Schallwellen dann als elektrische Impulse in den unteren Teil des Stammhirns, von wo aus sie bis in die primäre Hörrinde geleitet werden. Die Verbindungen weisen dabei eine Überkreuzung auf, die Informationen aus dem rechten Ohr werden hauptsächlich an die linke Gehirnhälfte übertragen und umgekehrt.[34]
3.3 Hirnphysiologie
In diesem Kapitel wurden bisher die Faktoren und Abläufe von der Entstehung eines musikalischen Reizes bis zur Ankunft im menschlichen Gehirn beschrieben. Wünschenswert wäre es jetzt, die weiteren Verläufe und ihre Auswirkungen auf die menschliche Psyche und Stimmungslage direkt mit bestimmten musikalischen Parametern in Verbindung zu bringen. Vor dem Hintergrund, Musik in der sozialen Arbeit einzusetzen, wäre es sinnvoll zu erfahren, mit welcher Art von Musik man welches außermusikalische Ziel erreichen kann. Anders als in der Akustik sind aber nach der „Ankunft“ der Musik im Gehirn nicht mehr nur die Physik oder Chemie für die weiteren Abläufe zuständig. Zwar gibt es Verfahren, die zeigen, welche Hirnregionen auf Musik reagieren und in welcher Art und Weise. Zu diesen Verfahren gehört das Elektronenenzephalogramm (EEG), mit dessen Hilfe elektrische Signale im Gehirn gemessen werden können. Gesucht wird dabei nach so genannten EVPs, evozierten Potentialen. Dies sind Veränderungen in der Elektrophysiologie des Gehirns, die „vor, während und nach einem motorischen, sensorischen oder psychischen Ereignis im EEG messbar sind“[35]. Ein anderes Verfahren basiert auf der Messung der Durchblutung bestimmter durch Musik aktivierter Gehirnregionen. Dabei werden Kontrastmittel injiziert, die dann mittels Computertomographie bildlich dargestellt werden können.[36] Die Darstellbarkeit der Reaktionen des Gehirns auf Musik ist aber trotz dieser Methoden stark eingeschränkt. So ist klar, dass in einem Computertomographen entspanntes Musikhören sicherlich schwierig wird, und eine Auswertung der gehirnchemischen Abläufe beim aktiven Musizieren ist bisher auf Grund ihrer Komplexität völlig unmöglich. Zudem ist zwar mit diesen Methoden ein quantitativer Befund möglich, es wird eine gehirnphysiologische Aktivität nachgewiesen, eine qualitative Aussage über ihre Auswirkung auf die Psyche lässt sich daraus aber nicht ableiten.[37]
3.4 Musik und Emotion
In früheren Schriften zum Zusammenhang von Musik und Emotion wurde versucht, bestimmte musikalische Parameter mit Emotionen in Verbindung zu bringen. Heiner Gembris[38] verweist auf Platon, der in seinem Werk „Der Staat“ die verschiedenen Tonarten im Hinblick auf ihre Aktivierungs-potentiale beschreibt. Platon geht davon aus, dass der lydische Modus weich und schlaff sei, der dorische dagegen aufrüttelnd wirke und in Verbindung mit dem phrygischen Modus Tapferkeit und Männlichkeit erwecke und so das geeignete Mittel für die Ausbildung junger Soldaten sei. Platon schien dabei der erzieherische Nutzen die Rechtfertigung für Musik im Allgemeinen sein: „Die Musik ist nicht zu unverständlicher Ergötzung, sondern dazu da, die ungeordneten Bahnen unserer Seelen in Ordnung und Einklang mit sich selbst zu bringen“.[39]
Eine ähnliche Sichtweise der Verbindung von musikalischen Eigenschaften und des Gemütszustandes hat sich im Barockzeitalter entwickelt. Die so genannte Affektenlehre beschreibt Verbindungen zwischen seelischen Erregungszuständen (Affekte) des Menschen und musikalischem Ausdruck.
Rene Descartes hat im 17. Jahrhundert 6 Grundformen von Affekten beschrieben: Verwunderung, Liebe, Hass, Trauer, Verlangen und Freude. Diese wurden durch bestimmte Tonarten, Mehrklänge in bestimmten Tonabständen und Instrumenten ausgedrückt.[40] So sollten Durtonarten lustig, frech und erhebend sein, die Molltonarten eher traurig, zärtlich und schmeichelnd. Konsonanzen standen für Ruhe und Zufriedenheit, Dissonanzen drückten Ekel und Schmerz aus.
Durch die Verbindung bestimmter musikalischer Parameter konnte ein Komponist so deutlich machen, was er ausdrücken wollte. Sollte Schmerz dargestellt werden, so wurden kleine, meist abwärts gerichtete Intervalle gespielt, oft chromatische Gänge; es gab eine Häufung von Dissonanzen und Sextakkorden und das Tempo war langsam. Freude dagegen wurde gezeigt mit großen Intervallen, durch die Bevorzugung von Durtonarten und durch schnelleres Tempo. Diese Ausdrucksmittel orientierten sich stark am körperlichen Ausdruck der zu zeigenden Gemütszustände, man versuchte, die Bewegungsmuster des Affekts in der Musik nachzubilden.[41]
Auch wenn die Affektenlehre als überholt gilt, wirkt sie bis heute in unserem Kulturkreis weiter. Musikalische Ausdrucksmuster, die bestimmte Gemütszustände beschreiben, sind immer noch an diese Lehre angelehnt. So finden sich vorrangig Molltonarten und ein langsames Tempo in Stücken, die von Trauer und Verlust handeln.
Aber die Frage, ob die verschiedenen musikalischen Ausdrucksmuster die Stimmung, die sie beschreiben auch beim Hörer hervorrufen, ist umstritten.
In jedem Fall war die Affektenlehre Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Untersuchungen zur Wechselwirkung von Musik und Emotionen, von Experimenten zum Zusammenhang von Tonhöhe und Lautstärke auf den Herzschlag im späten 18. Jahrhundert[42] bis hin zu den im vorigen Kapitel beschriebenen EEG-Studien.
Gembris verweist darauf, Musik sei ein „ganzheitliches Gebilde, das sich in der Zeit entfaltet und man kann schlecht ein einzelnes Intervall, einen einzelnen Akkord, Rhythmus usw. aus dem Kontext lösen, um dieses Element isoliert auf seine Wirkung hin zu untersuchen“.[43] Trotzdem geht er davon aus, dass man bestimmte grundsätzliche Tendenzen der Wirkung von Musik beschreiben kann. Er unterscheidet dabei zwischen den aktivierenden und den beruhigenden Wirkungen musikalischer Parameter. Dabei zählen zu den aktivierenden große Lautstärke, häufige Lautstärkeänderungen, schnelles Tempo, ein weiter Tonumfang und ein mittlerer bis hoher Grad von Komplexität. Die entgegen gesetzten Parameter, geringe Lautstärke etc., haben demnach eine beruhigende Wirkung.[44] Ähnlich beschreibt auch Wickel diese Zusammenhänge. Er geht dabei von den zwei grundlegenden Tonuslagen des vegetativen Nervensystems aus. Dies sind die symphatische Tonuslage, bei der der Organismus aktiviert und in Erregung gesetzt wird, und die parasymphatische Tonuslage, bei der sich der Körper entspannt und sich die Aufmerksamkeit verringert. Diese beiden Grundstimmungen werden im Nervensystem durch Nervenimpulse aus dem Gehirn und über die Ausschüttung von Botenstoffen wie Adrenalin an die Organe gesteuert.[45] Wickel sieht die gleichen Beziehungen zwischen Tempo, Lautstärke, Dissonanzgrad und der Stimmungslage wie Gembris.
[...]
[1] Wickel, H. H., 1998; S. 7
[2] Wörner, Karl H., 1954; S. 21f
[3] Zelimir, D., 2004; S. 110ff
[4] Hill, Burkhard, 2004 ; S.329ff
[5] Wörner, K.-H., 1980; S. 21ff
[6] ebenda, S. 24
[7] Baumann, M., 2000; S. 2
[8] Altes Testament, Genesis 4.21
[9] Baumann, M., 2000; S. 2
[10] ebenda
[11] Wörner, K.-H., 1980, S. 24
[12] ebenda, S. 25
[13] Zelimir, D., 2004; S. 12
[14] ebenda, S. 16
[15] Wörner, K.-H., 1980; S. 25
[16] Zelimir, D., 2004; S. 17
[17] ebenda
[18] Miller, G., 2001, S. 13
[19] Zelimir, D., 2004, S. 34
[20] ebenda, S. 36
[21] Brown S., 2000, S. 21ff
[22] Brown S., 2000, S. 25
[23] Dissanayake, E., 2000, S. 29ff
[24] ebenda, S. 31f
[25] Dunbar, R., 1996, S. 44ff
[26] Huron, D., 2001, S. 46ff
[27] Zelimir, D., 2004, S. 69
[28] Michels, U., 2005, S. 15
[29] Michels, U., 2005; S. 15ff
[30] Michels, U., 2005; S. 11
[31] Wörner, Karl H., 1954; S. 19
[32] vgl. auch: Wickel, H. H., 1998; S. 137ff;
Ziegenrücker, W., 1993; S. 32ff
[33] Michels, U., 2005; S. 19
Plattig, K.-H., 1997; S. 613ff
[34] Gruhn, W., 1998; S. 16
[35] Birbaumer, N.; Schmidt, R. F., 1989
[36] Pettsche, H., 1997, S. 632
[37] Wickel, H. H., 1998; S. 30
[38] Gembris, H., 2000; S. 2
[39] Schroeder, W. C., 1999; S. 52
[40] Michels, U., 2005; S. 271
[41] Gembris, H.; 2000; S. 3
[42] ebenda
[43] ebenda, S. 4
[44] Gembris, H., 2000; S. 4
[45] Wickel, H. H., 1998; S. 31
- Arbeit zitieren
- Hendrik Bolte (Autor:in), 2007, Musik in der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85816
Kostenlos Autor werden





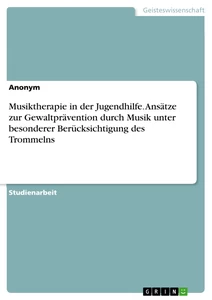














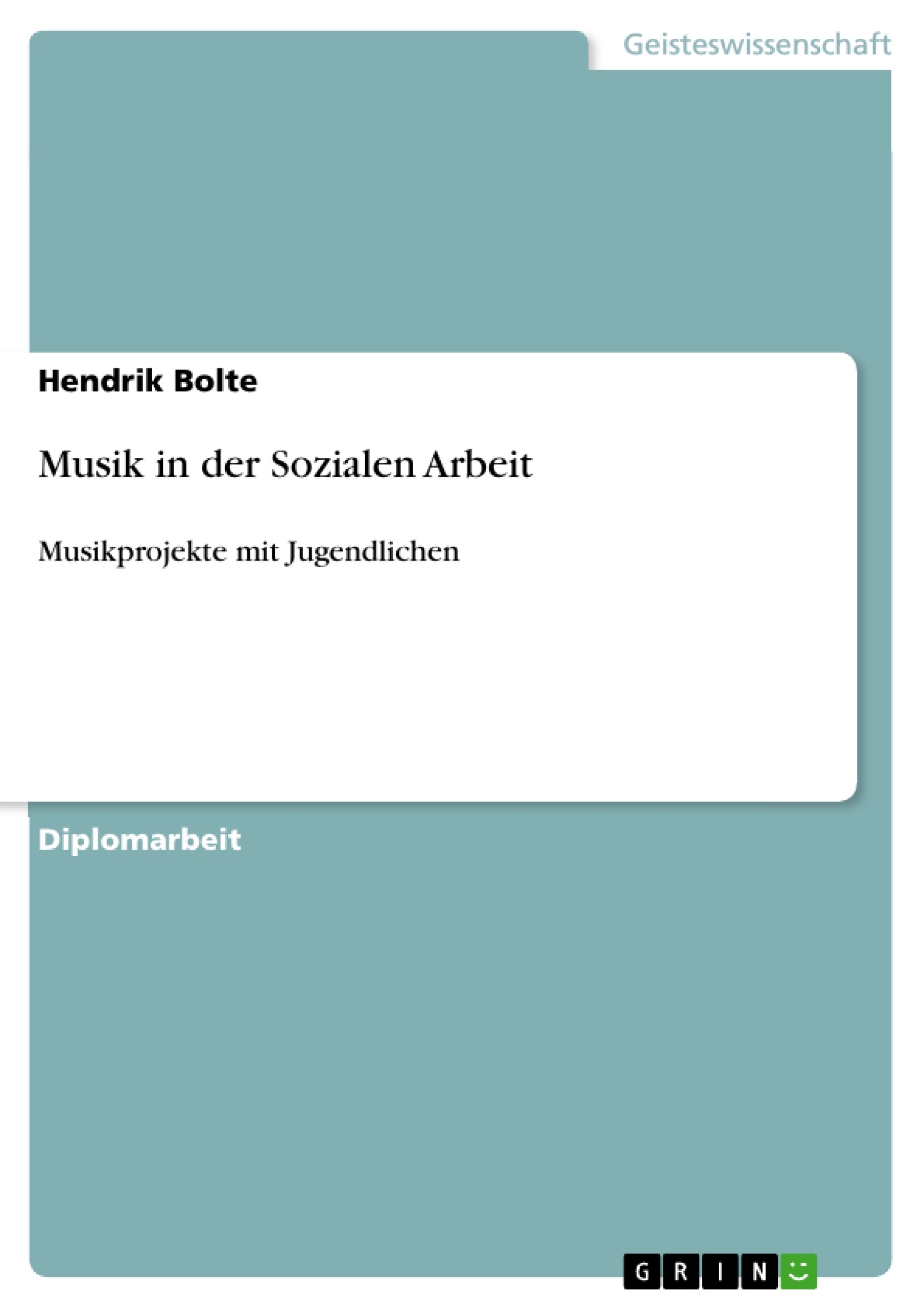

Kommentare