Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I THEORETISCHER HINTERGRUND
1 Einleitung
2 PatientInnen auf der Intensivstation
2.1 Informationsbedürfnis chirurgischer PatientInnen
2.2 Ängste der PatientInnen
2.2.1 Bewältigungsstrategie
2.2.2 Studien zum Angsterleben
2.3 Belastungsfaktoren für PatientInnen
2.4 Musik auf der Intensivstation
2.4.1 Musikwahl
2.4.2 Reaktionen der PatientInnen
3 Angehörige auf der Intensivstation
3.1 Studien über Angehörige auf der Intensivstation
3.2 Der erste Besuch auf der Intensivstation
3.3 Ängste der Angehörigen
3.4 Die wichtige Rolle der Angehörigen
4 Pflegeanamnese auf der Intensivstation
5 Kommunikation
5.1 Zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion
5.2 Begriffsbestimmung
5.3 Die fünf pragmatischen Axiome nach Watzlawick
5.4 Die gestörte Kommunikation
5.5 Kommunikation auf der Intensivstation
5.5.1 Grundregeln für die Kommunikation auf der Intensivstation
5.5.2 Umgang mit IntensivpflegepatientInnen
5.5.3 Richtlinien zur Kommunikation mit IntensivpatientInnen
II EMPIRISCHER TEIL
1 Forschungsfragen und Hypothese
2 Methode
2.1 Zugang zum Forschungsfeld
2.2 Untersuchungsablauf
2.3 Stichprobe
3 Fragebogen
3.1 Erstellung des Fragebogens
3.2 Gestaltung der Fragen
3.3 Aufbau
3.4 Verwendete Skalen
4 Ergebnisse
4.1 Deskriptive Analyse
4.1.1 Aufenthalt auf der Intensivstation
4.1.2 Angst
4.1.3 Umgang mit Schmerzen
4.1.4 Beatmung und Kommunikation
4.1.5 Katheter und Sonden
4.1.6 Privatheit auf der Intensivstation
4.1.7 Soziodemographische Daten
4.1.7.1 Altersstruktur
4.1.7.2 Geschlecht
4.2 Weitere Ergebnisse
4.2.1 Hypothese
4.2.2 Gegenüberstellung einzelner Gruppen
4.2.2.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede
4.2.2.2 Unterschiede zwischen PatientInnen mit und ohne frühere Aufenthalte auf Intensivstationen
4.2.2.3 Unterschiede zwischen Altersgruppen
4.2.2.4 Zusammenhang zwischen Erhalt von Kathetern und Angst ..
5 Diskussion und Ausblick
III Literaturverzeichnis
IV Anhang
1 Abbildungsverzeichnis
2 Tabellenverzeichnis
3 Fragebogen
Danksagung
Zu Beginn meiner Arbeit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Seidl, Vorständin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Wien, für die Betreuung dieser Arbeit. Sie begleitete mich durch die gesamte Arbeit und stand mir mit fachlichen Anregungen und menschlichem Verständnis in jeder Phase der Arbeit zur Seite.
Ebenso möchte ich mich bei Frau MMag. Dr. Ilsemarie Walter, Mitarbeiterin der Abteilung Pflegeforschung, für ihre Begleitung während der Erstellung des Fragebogens und besonders für die Unterstützung während der Datenanalyse bedanken.
Mein großer Dank gilt auch meinen Eltern und meinem Mann, die mir während der gesamten Studienzeit und besonders in der Abschlussphase des Studiums mit unterstützenden Gesprächen und viel Motivation zur Seite standen. Seit der Geburt unseres ersten Sohnes gilt meinen Eltern ein besonderer Dank für die stundenweise Kinderbetreuung.
Bedanken möchte ich mich weiters beim ärztlichen Leiter des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, Univ.-Prof. Dr. Reinhard Krepler und dem Oberpfleger, Karl Heinz Weber, die mir die Genehmigung einer Patienten- befragung an den chirurgischen Intensivstationen erteilten. Für die Mithilfe bei der Durchführung der Befragung bedanke ich mich sehr herzlich bei allen beteiligten Stationsleitungen.
Nicht zuletzt gilt mein Dank all jenen PatientInnen, die sich bereit erklärten, den Fragebogen auszufüllen und damit die Studie ermöglichten.
Zusammenfassung
Ein Aufenthalt im Krankenhaus und auf der Intensivstation im Besonderen stellt für jeden Menschen einen Ausnahmezustand dar. Gerade deshalb ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Sensibilität im Umgang mit den PatientInnen notwendig. Ausreichende, für die Betroffenen gut verständliche Informationen sind wichtig, um den Menschen größtmögliche Autonomie in einer ungewohnten Umgebung zu ermöglichen.
Aus diesem Grund wurde ein Fragebogen entworfen mit dem Ziel, den Informationsstand von PatientInnen vor einer Operation mit anschließendem Aufenthalt auf einer chirurgischen Intensivstation zu erfassen. Im Rahmen dieser quantitativen Studie wurden 100 Fragebögen an PatientInnen auf chirurgischen Intensivstationen im Allgemeinen Krankenhaus Wien ausgeteilt, wovon 83 ausgewertet werden konnten. Das Durchschnittsalter der PatientInnen liegt bei 59,99 Jahren bei einer Streubreite von 27 bis 83 Jahren. Das Sample setzt sich aus 35 Frauen (42,2%) und 48 Männern (57,8%) zusammen.
Das besondere Augenmerk lag darauf, einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Einfluss von erhaltenen Informationen und den bestehenden Ängsten der PatientInnen zu erkennen. Die Hypothese bestätigte sich, dass PatientInnen umso weniger Angst vor dem bevorstehenden Aufenthalt auf der Intensivstation haben je ausreichender sie sich über diesen informiert fühlen. Jene PatientInnen, die angaben, „sehr viel“ oder „viel“ Angst vor der Operation zu haben, hatten deutlich weniger Information über den Erhalt einer Magensonde oder eines Blasenkatheters.
Bei der Gegenüberstellung von PatientInnen mit und ohne Erfahrung aus früheren Aufenthalten auf Intensivstationen in Bezug auf ihre Angst zeigte das Ergebnis, dass sich persönliche Erfahrungen positiv auf das Angstausmaß auswirkten. Ein weiterer Unterschied zeigte sich dahingehend, dass mehr als doppelt soviel Frauen wie Männer angaben, „sehr viel“ oder „viel“ Angst vor dem Aufenthalt gehabt zu haben.
Wie das Ergebnis der Studie zeigt, ist der Information von PatientInnen im Spital ein noch höherer Stellenwert einzuräumen.
Abstract
A stay in hospital, in particular a stay in an intensive care unit, creates an emergency situation for everyone. That is why high levels of empathy and sensitivity in dealing with patients are necessary. It is important to offer sufficient and understandable information to persons who are affected, in order to give them the greatest possible autonomy in an unfamiliar environment.
Therefore a questionnaire was created with the aim of evaluating the level of information of patients before an operation with a subsequent stay in a surgical intensive care unit. In the case of this quantitative study, 100 questionnaires were given to patients in intensive care units at the General Hospital of Vienna (AKH Wien), of which 83 could be analyzed. The average patient age was 59.99 years with a range of 27 to 83 years. The sample included 35 women (42.2%) and 48 men (47.8%).
Specific emphasis was given to recognizing a possible relationship between the influence of given information and the existing fears of patients. The hypothesis was confirmed that those patients who feel adequately informed about their impending stay in an intensive care unit are less frightened. Patients who declared having been "very much" or "much" afraid of the operation had received significantly less information about stomach tubes or catheters.
A comparison of patients with and without experience from former stays in intensive care units showed a positive influence of personal experience on the level of fear. A further difference could be found: more than twice as many women than men declared having been "very much" or "much" afraid of their stay.
As the results of the study show, the information of patients in hospital should be granted a more important role.
I THEORETISCHER HINTERGRUND
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Evaluation des Informationsstandes von PatientInnen über ihren geplanten Aufenthalt auf der Intensivstation“ basiert auf einer im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführten empirischen Studie auf den chirurgischen Intensivstationen des Allgemeinen Krankenhauses Wien. Ziel war es, den Informationsstand der PatientInnen zu evaluieren und eventuell bestehende offene Fragen und Unklarheiten aufzuzeigen.
Die Arbeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im theoretischen Abschnitt werden Studien über PatientInnen und Angehörige auf der Intensivstation vorgestellt. Es wird näher auf die Ängste und Belastungen von PatientInnen und die wichtige Rolle der Angehörigen eingegangen. Weiters wird die Pflegeanamnese auf der Intensivstation vorgestellt. Der zwischenmenschlichen Kommunikation und Interaktion auf der Intensivstation wird wegen ihrer Wichtigkeit ein eigenes Kapitel gewidmet.
Der empirische Teil beginnt mit der Vorstellung der Forschungsfragen und der Hypothese der erarbeiteten Studie. Im Anschluss werden die Methode und der Aufbau des Fragebogens vorgestellt. Die Darstellung der Ergebnisse ist gegliedert in die deskriptive Analyse, die Überprüfung der Hypothese und die Gegenüberstellung einzelner Gruppen in Bezug auf ihre Angst vor dem Aufenthalt auf der Intensivstation. Den Abschluss bilden Diskussion und Ausblick, in dem die erarbeiteten Ergebnisse interpretiert und mit bereits bestehenden Forschungen verglichen werden.
2 PatientInnen auf der Intensivstation
Sarah Russell führte 1999 eine Studie auf der Intensivstation des Royal Melbourne Hospital in Australien durch. Es wurden 298 Patienten zu ihren Wahrnehmungen, Erinnerungen und Erfahrungen auf der Intensivstation befragt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Erinnerungen der PatientInnen oft viel weiter zurück gehen und detaillierter sind als angenommen wird. So erinnerte sich eine Patientin, dass sie nackt im Bett lag und gewaschen wurde, während sich die Pflegepersonen über ihr Privatleben unterhielten. Ein anderer Patient verglich die Station mit einem Kriegsgebiet. Oft erinnerten sich PatientInnen zum Beispiel an bestimmte Teile eines Gesprächs, Pflegepersonen, die ihnen das Gefühl der Sicherheit gaben und Angehörige, die ihnen vom Leben außerhalb des Spitals erzählten.
Mangel an Kommunikation, fehlende Privatsphäre, Angst, Schmerzen und kontinuierlicher Lärm stellten die größten Probleme für PatientInnen auf der Intensivstation dar.1
„In der Intensivmedizin werden alle therapeutischen Möglichkeiten nach dem letzten Stand des medizinischen Wissens eingesetzt, um gestörte oder ausgefallene vitale Organfunktionen temporär zu ersetzen.
So entsteht genügend Zeit für die Diagnose und kausale Behandlung des Grundleidens mit dem Ziel, dem Intensivpatienten Heilung, Linderung oder Sterbebegleitung zu geben.“2
Diese optimale Betreuung von PatientInnen mit lebensbedrohlichen Störungen vitaler Funktionen ist nur möglich, wenn hochqualifiziertes Personal bei optimalen räumlichen Verhältnissen und mit modernsten Überwachungs- und Therapiegeräten arbeitet.3
Aldridge schreibt über die Situation der PatientInnen auf einer Intensivstation:
„Wo Patienten oft verletzt, desorientiert, intubiert, an Maschinen angeschlossen oder sogar bewusstlos sind und sich nicht mitteilen können, dann müssen wir einen Weg finden, Gemeinschaft mit diesen Patienten zu ermöglichen.“4 Der Musiktherapeut und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. David Aldridge, Leiter des Lehrstuhls für Qualitative Forschung in der Medizin an der Universität Witten/Herdecke, beschreibt den gestörten Schlaf als ein Hauptproblem auf der Intensivstation. Dadurch kommt es für die PatientInnen zu einem komplett unregelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus, der sich sehr negativ auf die Stoffwechselvorgänge auswirkt. Es ist unumstritten, dass es pflegerischer und medizinischer Handlungen bedarf, bei denen auf die Uhrzeit keine Rücksicht genommen werden kann. Nach Möglichkeit soll aber darauf geachtet werden, dass PatientInnen ihre wohl verdienten Ruhepausen bekommen und auch, wenn sie sich im künstlichen Tiefschlaf befinden, ein Tag-Nacht-Rhythmus eingehalten wird.5
Intensivstationen sind meist sehr hell erleuchtet, laut, und es ist oft hektisches Treiben zu beobachten. Einige Geräusche wie die der Beatmungsmaschinen, der Luftkissenbetten oder der Infusionspumpen beim Ein- und Ausschalten nicht zu vermeiden sind. Sehr wohl zu vermeiden ist zum Beispiel das oftmalige Alarmsignal der Infusionspumpen und Perfusorspritzen, wenn kontinuierlich zu verabreichende Medikamente zu Ende gehen.
2.1 Informationsbedürfnis chirurgischer PatientInnen
PatientInnen kommen aus unterschiedlichen Gründen auf die Intensivstation. Wenn sie nach einem traumatischen Ereignis, einer ungeplanten Operation oder auch einem massiven internen Geschehen akut auf die Intensivstation kommen, bleibt selbstverständlich nur wenig oder manchmal auch keine Zeit für Aufklärung. In solchen Fällen muss das medizinische Personal lebenserhaltend und rasch für die PatientInnen entscheiden.
Es gibt aber viele Fälle in denen die PatientInnen über ihren Aufenthalt im Vorhinein Bescheid wissen. Vor größeren Operationen ist ein geplanter Aufenthalt auf einer chirurgischen Intensivstation unumgänglich. Auf diesen sollten PatientInnen bestmöglich vorbereitet werden.
Eine Vielzahl empirischer Studien befasst sich mit dem Informationsbedürfnis chirurgischer PatientInnen, dem präoperativen Wissensstand bezüglich der bevorstehenden chirurgischen Intervention sowie möglicher Wissensdefizite und deren Auswirkungen auf die emotionale Befindlichkeit. Im Folgenden werden einige relevante Studien vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen wie wichtig präoperative Information für PatientInnen und Angehörige ist und welche Wege zur Angst- und Stressreduktion gefunden werden konnten.
Lynn-McHale u.a. sind 1997 in ihrer Studie über präoperative Besichtigungen der Intensivstation zur Angstreduktion zu folgenden Ergebnissen gekommen: Ihre Stichprobe umfasste 92 PatientInnen vor herzchirurgischen Eingriffen, von denen 48 eine Führung durch die Intensivstation bekam und 44 Personen keine. Weiters nahmen 91 Angehörige an der Studie teil, die ebenfalls in eine Versuchsgruppe mit 48 und eine Kontrollgruppe mit 43 Personen geteilt wurden. Sowohl die PatientInnen als auch die Angehörigen der Versuchsgruppe empfanden die Führungen durch die Intensivstation als positiv und befürworteten sie auch für andere PatientInnen, gaben allerdings an, dass sich ihre Angst vor dem Aufenthalt dadurch nicht minimiert hat. Über die Hälfte der PatientInnen beschrieben, dass es ihnen geholfen hat zu sehen, was sie nach der Operation erwartet. Für die Angehörigen ermöglichte der Einblick in die Intensivstation eine bessere Vorbereitung auf ihren ersten Besuch. Angehörige, die vorher noch nie auf einer Intensivstation waren, beschrieben oft große Angst davor, sowie komplette Ohnmacht und Hilflosigkeit während ihres Besuches.6
Die Wichtigkeit der Informationen über den Aufenthalt auf der Intensivstation werden auch in der Studie von Sarah Watts und Ade Brooks 1997 aus England deutlich. Das Ergebnis besagt, dass die Informationen die PatientInnen vor ihrem Aufenthalt auf einer Intensivstation erhalten haben, sich als sehr hilfreich erwiesen. Besonders hervorgehoben wurden die Auskünfte über Schmerzen und Angst, Mund- und Intimpflege sowie das Legen und Pflegen des Harnkatheters. An erster Stelle stand für 72% der PatientInnen der Besuch einer Pflegeperson vor der Operation. Sehr eindrucksvoll empfanden 54% der PatientInnen eine Führung durch die Intensivstation von einer Pflegeperson. Ebenso wichtig beurteilten sie den zusätzlichen Erhalt von schriftlicher Information.7
Erfreulicher Weise konnte auch eine österreichische Studie aus dem Jahr 1998 gefunden werden. Hier führten Marion Steinbichler und Claudia Parlacska unter Führung der Praxisanleiterin auf einer chirurgischen Normalstation im Kaiser Franz Joseph Spital ein Projekt durch, dessen Ziel es war die präoperative Betreuung der PatientInnen zu optimieren. Die PatientInnen erhielten Informationen über den Ablauf der unmittelbar prä- und postoperativ durchgeführten Maßnahmen. Durch das Gespräch sollte ein Vertrauensverhältnis zu den PatientInnen aufgebaut werden und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Fragen, Erfahrungen, Erwartungen, Ängste und Sorgen anzusprechen.
Bei der morgendlichen Dienstübergabe wurden die Inhalte der Pflegevisite präsentiert und die notwendigen Informationen an das jeweilige OP-Team weitergegeben, damit dieses auf Wünsche und Bedürfnisse der PatientInnen eingehen konnte. Es wurden 52 PatientInnen im Rahmen des Projekts befragt, wobei es 34 als angenehm, 14 als informativ, 3 als unnötig und keine der PatientInnen als unangenehm empfand.
Zur Veranschaulichung wurden Beispiele für die Wichtigkeit der präoperativen Pflegevisite gebracht. Eine Patientin berichtete von ihrem traumatischen Erlebnis einer Vergewaltigung und ihren daraus resultierenden Ängsten festgebunden zu werden. Ein anderer Patient der im Krieg verschüttet wurde und unter Platz- und Erstickungsängsten litt, wollte statt der Sauerstoffmaske lieber eine Sauerstoffbrille. Als Ziel für die Zukunft definierten es die Pflegepersonen für wichtig, die präoperative Pflegevisite in den Pflegestandard aufzunehmen.8
Alexander Ambros beschäftigte sich in seiner Dissertation am Institut für Psychotherapie und medizinische Psychologie der Universität Würzburg im Jahr 2003 mit dem Thema: „Die präoperativen Aufklärung bei kardiochirurgischen PatientInnen - Informationsvermittlung und psychologische Aspekte“. In einer quantitativen Arbeit untersuchte er den Einfluss präoperativer Patientenaufklärung auf die Informiertheit und die Angst kardiochirurgischer PatientInnen. Er stellte sich Fragen zur Aufnahmemöglichkeit angebotener Informationen durch PatientInnen, die Auswirkung der Aufklärung auf das emotionale Befinden der PatientInnen und die Zufriedenheit der PatientInnen mit der dargebotenen Aufklärung.
Das Ergebnis der Studie besagt, dass die PatientInnen ihren Informationsbedarf mehrheitlich gedeckt sehen, wobei sie ihren Wissenstand aber nicht richtig einschätzten. Das Informationsgespräch führte im Vergleich zum schriftlichen Aufklärungsbogen zu einer Verbesserung der Informiertheit der PatientInnen und auch zu einer emotionalen präoperativen Stabilisierung.9
Im Jahr 2001 veröffentlichten A. Roth-Isigkeit u.a. ihre Studie über Auswirkungen präoperativer Vorbereitung auf die Zufriedenheitseinschätzungen kardiochirurgischer Patienten. Sie teilen 52 Männer in 2 Gruppen wobei eine die übliche Prämedikationsvisite hatte und die andere eine erweiterte präoperative Vorbereitung mittels Videofilm über den peri- und postoperativen Verlauf von kardiochirurgischen Eingriffen. Das Ergebnis zeigte, dass die Experimentalgruppe signifikant zufriedener mit dem Operationsablauf war als die Kontrollgruppe. Die bessere Vorbereitung auf die Operation wirkte sich aber nicht auf die Zufriedenheit mit anderen Gegebenheiten im Spital wie Räumlichkeiten, Essen, Pflegepersonal, ärztliches Personal oder dem stationären Aufenthalt aus.10
In der Zeitschrift „Intensive and Critical Care Nursing“ veröffentlichten Jenny McGaughey und Sheila Harrison im Jahr 1994 zwei Artikel.
Im einen beleuchten sie den präoperativen Informationsbedarf von PatientInnen und deren Angehörigen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die größten Ängste von PatientInnen und Angehörige vor der Narkose, der Operation und der Intensivstation beschrieben werden. Interessant war, dass Angehörige oft mehr Angst angaben als PatientInnen selbst. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit die Operation zu verstehen und die Erkenntnis, dass durch individuelle Betreuung und Information die Zufriedenheit erhöht und die Angst deutlich reduziert werden konnte. Um hochqualitative Betreuung planen zu können, ist es notwendig Informationen und Informationsbedürfnisse von PatientInnen und ihren Angehörigen zu erheben.11
Diese Arbeit war die Basis für einen weiteren Artikel, in dem die Entwicklung einer Informationsbroschüre für PatientInnen und deren Angehörige erarbeitet wurde. Eine gute Struktur an Informationen ist wichtig für das Verständnis der PatientInnen und die Effizienz der Informationsvermittlung.12
2.2 Ängste der PatientInnen
Im Mittelpunkt der intensivmedizinischen Behandlung steht ohne Zweifel die Behandlung der somatischen Erkrankung. Die psychische Situation der PatientInnen ist aber nicht außer Acht zu lassen. Ihr wird zunehmend mehr Beachtung geschenkt. Schneider meint dazu wörtlich: „Die Situation der PatientInnen ist neben dem somatisch aktuellen Krankheitszustand vor allem durch eine psychosoziale und psychophysiologische Extremsituation mit folgenden Aspekten geprägt.“13
Er fährt mit einer detailliert Darstellung der Extremsituationen fort:
1. psychosoziale Extremsituationen:
- Angstsituation: zum Beispiel hervorgerufen durch Schmerz, Luftnot,
Lähmung, Sprachverlust, sensorische Ausfälle bis zur Todesangst, Überwältigungsängste (Erduldung externer Therapiemaßnahmen, wie Intubation, künstliche Beatmung, kardiale Elektrostimulation)
- Entmündigungssituation: totaler Verlust gewohnter Eigenaktivitäten, totale Fremdkontrolle aller Körperfunktionen, de facto totaler Entscheidungs- verlust
- Abschirmungssituation: Abschirmung von der Außenwelt, nicht selten fenster- und uhrenlose Räume, Abschirmung von Bettnachbarn oder Einzelzimmer und minimale Besuchszeiten
- Kommunikationsmangel: häufige Personalkontakte sind nicht identisch mit häufiger Kommunikation!
- Durch Mangel an situationsbezogenen Auskünften, fehlende ungestörte
Gespräche, fehlende bzw. schnell wechselnde Bezugspersonen, Mangel an Bettnachbarn bzw. Abschirmung, eingeschränkte Krankenbesuchsfrequenz, krankheits- und/oder therapiebedingte Sprachbeschränkung bzw. Unmöglichkeit zu sprechen
2. psychophysiologische Extremsituationen:
- Schlafmangel durch Überwachungs- Diagnose- und Therapiemaßnahmen, kein regelmäßiger, nur oberflächlicher Nachtschlaf, Traumphasenunterbrechungen
- Wahrnehmungsmangel im Sinne der Monotonie besonders optischer (Blick an die Decke) und akustischer (Apparategeräusche) Reize sowie der Indifferenz und Identifikationsschwäche akustischer Reize (geräuschintensive Betriebsamkeit einer Intensivstation), pharmakologische (therapiebedingte) Nebenwirkungen
- Orientierungsmangel verbunden mit Wahrnehmungsmangel durch fehlendes Tageslicht und fehlende Orientierungshilfen wie Kalender, Uhr, durch körperliche Fixierung oder Lähmung und Mangel an Information durch das Personal14
Die Ängste der PatientInnen müssen von Pflegepersonen und ÄrztInnen beachtet, zugelassen und vor allem reduziert werden. Hierzu ist es notwenig, dass auf die PatientInnen eingegangen wird, ihr Wissensstand eruiert wird und, wenn notwendig, erweitert wird.
Apparate, Geräte und Überwachungseinheiten sind den PatientInnen verständlich und wenn notwenig mehrfach zu erklären. Die PatientInnen sollen sie als Hilfe und nicht als angsterregende, unbekannte Apparaturen ansehen. Optische und akustische Signale sind ebenfalls in angemessener Form zu erläutern und sollten dem Sicherheitsbedürfnis und der Beruhigung der PatientInnen dienen. Um die Angst zu reduzieren ist auf mögliche Fehlalarme hinzuweisen. Reanimationen bzw. Notfallmaßnahmen bei anderen PatientInnen sollten, wenn möglich, visuell und akustische abgeschirmt werden. Auf die ständige Anwesenheit der Pflegepersonen in nächster Umgebung und weitere Überwachungsmonitore am Stützpunkt und im Aufenthaltsraum ist wiederholt hinzuweisen. Weiters ist den PatientInnen eine Glocke in Reichweite zu positionieren und deren Funktion ausführlich zu erklären. Dem Kontaktbedürfnis der PatientInnen mit Angehörigen ist individuell entgegenzukommen, wobei in erster Linie die Wünsche der PatientInnen und nicht der Angehörigen zu befolgen sind. Zuletzt soll noch einmal auf die Wichtigkeit der Erklärung von pflegerischen und therapeutischen Handlungen hingewiesen werden.
2.2.1 Bewältigungsstrategie
Suzanne M. Miller und C. E. Mangan entwickelten im Jahr 1983 die Bewältigungsstile „Monitoring“ und „Blunting“. Sie zeigten damit die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien von Menschen in bedrohlichen Situationen auf. Sie stellten fest, dass die Angstwerte dann am niedrigsten waren, wenn die Bewältigungsdisposition und der Umfang der Information übereinstimmten. Als „Monitors“ werden Menschen bezeichnet, die Informationen aufsuchen. Sie bevorzugen einen vigilanten Angstbewältigungsstil, durch den vermehrte Aufklärung zu einer stärkeren emotionalen Stabilisierung führt. Im Gegensatz zu „Blunters“ die für ihre Informationsmeidung und Entschärfung von negativen Reizen bekannt sind.
1987 wurde von Miller die bedeutende Miller Behavioral Style Scale (MBSS), die aus 32 Items besteht, publiziert. Sie erfasst in ihrem Test die zwei grundlegenden Modi von Coping und geht in ihrer Hypothese davon aus, dass insbesondere die Art der Informationsverarbeitung zu einer Stressreduktion führen kann.
In empirischen Studien zeigte sich, dass informationssuchende Personen in der Auseinandersetzung mit weitgehend unkontrollierbaren Ereignissen stärkere subjektive und objektive Belastungsreaktionen aufweisen als informations- meidende Menschen. Weiters konnte nachgewiesen werden, dass „Monitors“ tendenziell weniger belastet sind, wenn sie umfangreiche Information erhalten, hingegen „Blunters“ von einer Reduktion der Information profitieren.
In der Studie „Effects of coping style on psychological reactions of low-income, minority women to colposcopy” versuchten Suzanne M. Miller u.a. die Wechselwirkungen zwischen der präoperativ erhaltenen Informationsmenge und dem Copingstil zu analysieren. Sie teilten 36 Kolposkopiepatientinnen anhand der Ergebnisse der Miller Behavioral Style Scale in „Monitors“ und „Blunters“ ein. Das Ergebnis zeigte, dass sich „Monitors“ wesentlich wohler fühlten, wenn sie ausführlich über die bevorstehende Untersuchung informiert wurden. Im Gegensatz zu den „Blunters“ die sich wesentlich entspannter zeigten, wenn sie weniger Informationen bekamen.15
2.2.2 Studien zum Angsterleben
Eva-Maria Liebl und Josef W. Egger beschäftigten sich 1999 mit der Wirkung präoperativer Aufklärung auf das Angsterleben und Befinden herzchirurgischer Patienten. Ihre Stichprobe setzte sich aus 60 herzchirurgischen PatientInnen zusammen, wobei sich 27 einer Herzklappenoperation und 33 einer Bypassoperation unterzogen. Sie formulierten die Hypothese, dass die Kombination aus Aufklärungsgespräch und Broschüre zu einer stärkeren Reduzierung von Angsterleben und einer Verbesserung der kognitiv-emotionalen Befindlichkeit während des präoperativen Verlaufes beiträgt, als die alleinige Vorgabe der Broschüre. Sie berücksichtigten das von Miller und Mangan entwickelte Konzept und nahmen an, dass bei den „Monitors“ die Kombination von Aufklärungsbroschüre und Aufklärungsgespräch zu einer stärkeren emotionalen Stabilität präoperativ führt. Hingegen ist für die „Blunters“ das alleinige Durchlesen der Broschüre für ihr Wissen ausreichend. Interessant ist auch das Ergebnis über das präoperative Informationsbedürfnis. 60% der PatientInnen gaben an „viel“ über die Operation wissen zu wollen, 32% „wenig“ und 8% wollten „gar nicht“ aufgeklärt werden. Es ergaben sich auch signifikante Unterschiede von Altersgruppen. Demnach wollten jüngere PatientInnen sehr signifikant häufiger mehr über die Operation wissen als ältere Menschen. Große Unterschiede sind auch zwischen dem präoperativen Informationsbedürfnis chirurgischer PatientInnen und dem tatsächlichen Wissen zu beobachten.16
Das Ergebnis zeigt somit Parallelen zur Studie von Jäger, Maiwald, Beckmann und Schwemmle aus dem Jahr 1984. Sie verglichen das präoperative Aufklärungsgespräch, als eher differentielle Methode, mit einer standardisierten Aufklärungsbroschüre hinsichtlich ihrer Wirkung auf die emotionale Lage und den Wissensstand bei PatientInnen vor einer Bauchoperation. Die Ergebnisse zeigten, dass mündliche und schriftliche Aufklärung für die Wissensvermittlung gleichermaßen geeignet sind, wobei eine Kombination von beiden den Wissenszuwachs zu vergrößern scheint. Ein zusätzlicher Vorteil in der mündlichen Aufklärung ergibt sich in der positiven Einflussnahme des Gesprächs auf die emotionale Situation der PatientInnen.17
Auch Wallace kam 1986 in seiner Untersuchung gynäkologischer Patientinnen zur gleichen Schlussfolgerung.18
In der Studie von Cathrine Derham im Jahr 1991 wurde eine Informations- broschüre evaluiert. Ziel war es, dass PatientInnen weniger Angst vor dem Aufenthalt haben, und sie die Möglichkeit bekommen, Fragen an das Fachpersonal zu stellen. Jeder der 20 PatientInnen empfand die Informationen über die unterschiedlichen Tätigkeiten des Personals, das Ausmaß an Überwachung durch die Monitore, die vorhandenen Geräusche auf der Intensivstation, den Erhalt von Infusionen sowie die Angaben zur Beatmung als sehr wertvoll. Drei PatientInnen gaben an verunsichert zu sein über die Informationen zur künstlichen Beatmung und über die möglichen negativen Reaktionen ihrer Familie zur Aufnahme. Ein Patient gab an, dass auch seine Frau die Informationsbroschüre als sehr hilfreich empfand und danach weniger Angst hatte. Gesamt gesehen ist es wichtig, dass eine Informationsbroschüre das persönliche Aufklärungsgespräch nicht ersetzt. Vielmehr stellt sie einen informativen Beitrag zur Orientierung für PatientInnen und Angehörige vor dem Gespräch dar.19
2.3 Belastungsfaktoren für PatientInnen
In der wissenschaftlichen Literatur werden drei Bereiche beschreiben, die als potentielle Ursachen für die Entstehung eines Durchgangsyndroms oder auch Intensiv-care-unit-Syndrom ausschlaggebend sind:
- Belastungen, die aus der Erkrankung und der Persönlichkeit der PatientInnen resultieren, wie die Schwere der Grunderkrankung, Persönlichkeitsmerkmale wie vorbestehende Depressivität oder erhöhte Ängstlichkeit.
- Belastungen, die aus den therapeutischen Maßnahmen der Intensivstation resultieren, wie Schmerzen, veränderter Schlaf-Wach-Rhythmus und therapeutische Maßnahmen.
- Belastungen interaktioneller Art wie Kommunikationsstörungen und soziale Isolation auf der Intensivstation.20
Die Zahl der betroffenen IntensivpatientInnen ist nicht zu unterschätzen. Leidet doch jede dritte PatientIn mit einer Mindestliegedauer von drei Tagen in unterschiedlicher Ausprägung an diesem Syndrom.
Anne Liedtke ist Psychologin an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Martin-Luther Universität in Halle-Wittenberg. Sie beschäftigte sich im Artikel „Die blaue Mafia“ mit dem subjektiven Erleben von PatientInnen bei Langzeitintensivtherapie. Sind PatientInnen durch physischen und psychologischen Belastungsfaktoren vom Intensiv-care-unit-Syndrom betroffen, ist ihre Kooperationsfähigkeit in Hinblick auf den Genesungsprozess eingeschränkt. Aus panischer Angst ist es ihnen beispielsweise nicht möglich suffizient zu atmen, wodurch die Entwöhnungsphase erschwert und oft verlängert wird. Je ängstlicher, geschwächter und unkooperativer PatientInnen werden, umso weniger sind sie in der Lage, selbständig zu atmen und am Genesungsprozess aktiv teilzunehmen. Dadurch dauert der Aufenthalt auf der Intensivstation länger und PatientInnen die ihre Angst nicht reduzierten können, versuchen permanent ihr psychologisches Dilemma zu lösen, indem sie sich in eine nicht realitätsgetreue Welt zurückziehen. Dieser sehr sinnvolle Schutzmechanismus der Psyche ist jedoch dem körperlichen Zustand der PatientInnen nicht zuträglich und ein erheblicher Störfaktor für die Behandlung. Weiters verändert sich bei den PatientInnen im Laufe des Aufenthalts auf der Intensivstation die Körperwahrnehmung. Durch das veränderte Bewusstsein verlieren sie das Gefühl für die Körpergrenzen, und die Konturen des eigenen Körpers verschwimmen. Der Rückzug in die „eigene Welt“ - die Welt der Träume wird noch zusätzlich durch die mangelnde Kommunikation verstärkt. PatientInnen werden oft als kommunikationsunfähig bezeichnet, nur weil sie sich auf Grund des Beatmungsschlauchs nicht verbal artikulieren können. Es ist die Aufgabe des Personals jene Kommunikationsebenen der PatientInnen zu nützen, die noch verfügbar sind. Wenn das Behandlungsteam die Nöte und Ängste der PatientInnen erkennt und ihnen emotionale Zuwendung zukommen lässt, werden die Urängste und die emotionale Verunsicherung gemindert.21
Am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke führte Andrea Besendorfer im Jahr 2002 eine qualitative Untersuchung durch, in der sie mittels narrativer Interviews versuchte, mehr über das Erleben von PatientInnen auf Intensivstationen zu erfahren. Das Ergebnis fasste sie in drei Dimensionen zusammen. Die erste Dimension beschreibt das Erleben von Orientierungs- beeinträchtigungen, Erinnerungslücken und Träumen. Die zweite Dimension spiegelt die Strukturierung der Zeit und Rekonstruktion der Ereignisse, sowie das Gefühl sich selbst als krank oder gesund erlebt zu haben, wieder. In der dritten Dimension wird das Vertrauen zwischen PatientInnen und Angehörigen, Pflegepersonen und ÄrztInnen widergespiegelt. Diese drei Dimensionen stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander und haben bis auf eine Ausnahme einen prozesshaften Charakter. Diese Ausnahme stellt das „Vertrauen“ dar, welches als Phänomen zu betrachten ist und einen übergeordneten Stellenwert im Erleben der PatientInnen einnimmt. So wirkt sich das Vertrauen stark auf die Beziehung zwischen PatientInnen und Personal aus. Sogar Fehler in der Behandlung können bei bestehendem Grundvertrauen eher akzeptiert werden.22
2.4 Musik auf der Intensivstation
Radios und Kassettenrekorder sind auf Intensivstationen keine Seltenheit, aber die Frage nach der „richtigen Musik“ ist nicht leicht zu beantworten. Der kontinuierlich herrschende Geräuschpegel auf der Intensivstation stellt eine sehr große Belastung für die PatientInnen und auch das dort arbeitende Personal dar. Musik darf nicht den Sinn haben diese Geräusche zu übertönen, denn dann wird sie nur als zusätzliche Lärmbelastung wahrgenommen.
2.4.1 Musikwahl
Der Musikgeschmack von PatientInnen ist sehr unterschiedlich und die Musikwahrnehmung ein individuelles Geschehen. Was für den einen Entspannung bedeuten mag, kann für den Bettnachbarn eine große Belastung darstellen.
Nur in sehr seltenen Fällen sind die PatientInnen über die Möglichkeit des Musikhörens auf der Intensivstation ausreichend informiert und haben dadurch die Möglichkeit ihre Lieblingsmusik vorzubereiten. Dies ist nur möglich, wenn es sich um eine geplante Operation mit anschließendem Aufenthalt auf der Intensivstation handelt. Die Musikwahl für bewusstlose PatientInnen bedarf bestmöglicher Einholung von Informationen über die Art der Musik, die bevorzugte Lautstärke sowie die Dauer des Musikhörens. Dabei ist aber zu beachten, dass es sich um Richtlinien handelt, die auf den gesunden Menschen zutreffen. Niemand weiß genau, welche Veränderungen der Mensch durch die Erkrankung, den Unfall und den bisherigen Aufenthalt auf der Intensivstation durchgemacht hat. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das Pflegepersonal die PatientInnen während des Musikhörens genau beobachtet und eventuelle Veränderungen dokumentiert. Hat das Personal nur im geringsten den Verdacht, dass den PatientInnen die Musik nicht behagt, ist sie sofort zu beenden. Vor Beginn des Musikhörens sollen PatientInnen über das Vorhaben informiert werden.
Gustorff schreibt, dass man nicht länger als 10 Minuten mit den PatientInnen Musik hören soll und dabei auch immer Körperkontakt beibehalten werden soll. Wenn sich die Pflegepersonen davon überzeugt haben, dass die Musik den PatientInnen gut tut, können auch Angehörige in dieser Zeit bei ihnen sein. Es sollte jedoch nicht öfter als dreimal täglich Musik gehört werden.23
2.4.2 Reaktionen der PatientInnen
Die Äußerungen der PatientInnen können sehr unterschiedlich sein. Besonders am Anfang darf die Erwartungshaltung von Angehörigen und Pflegepersonen nicht zu groß sein. Bereits kleine Veränderungen der Atemfrequenz und des Herzschlages können erste Zeichen der PatientInnen sein, dass sie die Musik wahrnehmen. Je nach Wachzustand können auch Augenbewegungen oder kleine Bewegungen der Extremitäten beobachtet werden.
In der Praxis werden PatientInnen oft sehr laut angesprochen oder gar angeschrien um direkte Reaktionen von ihnen zu bekommen. Dabei wird scheinbar vergessen, dass bewusstseinsgetrübte Menschen nicht taub sind, sondern zur Zeit auf Grund des Beatmungsschlauches in Mund oder Nase nicht sprechen können. Die Erfahrung zeigt, dass PatientInnen auf ruhige, langsame, entspannte und deutliche Sprechweise wesentlich besser ansprechen und eher reagieren.
3 Angehörige auf der Intensivstation
Die Benachrichtigung, dass ein Angehöriger auf der Intensivstation liegt, kommt manchmal geplant, aber sehr oft ungeplant. In jedem Fall ist für Angehörige der erste Besuch auf einer Intensivstation von großer Angst und viel Unsicherheit begleitet. Sie wissen nicht wie es ihrem erkrankten Familienmitglied geht, das dort arbeitende Personal ist ihnen fremd und sie kennen die Station nicht. Aus diesen Gründen haben sich Informationsbroschüren für Angehörige als sehr hilfreich erwiesen. In ihnen werden Angehörigen die zahlreichen Apparate,
Katheter, Monitore und ähnliches erklärt. Weiters wird der Tagesablauf beschrieben und die Besuchs- und telefonischen Auskunftszeiten erläutert. Liegen diese Broschüre bereits vor der Station im Aufenthaltsbereich auf, kann die Wartezeit damit sinnvoll überbrückt werden. Der Angehörige hat bereits einen kleinen Einblick, in das Stationsgeschehen.
Keinesfalls darf jedoch die Broschüre ein Gespräch mit Pflegepersonen und ÄrztInnen ersetzen.24
Wenn bekannt ist, dass die PatientInnen nach der Operation auf eine Intensivstation verlegt werden, ist es natürlich sinnvoll die nächste Bezugsperson, mit Einverständnis der PatientInnen, bereits an den Vorbereitungen teilhaben zu lassen.
Wie in der in Kapitel 2.1. näher vorgestellten Studie von Lynn-McHale u.a., ist es für Angehörige sehr hilfreich präoperativ an einer Führung durch die Intensivstation teilnehmen zu dürfen.
„Die unbekannten Apparate und die Geschäftigkeit des Pflegepersonals sowie die häufige Notwendigkeit, wegen Behandlungsmaßnahmen bei den Zimmernachbarn den Raum verlassen zu müssen, verstärken das Gefühl, zu stören, unerwünscht zu sein.“25
Nicht selten werden Angehörige als zusätzliche Belastung auf der Intensivstation empfunden. Ich denke es ist wichtig, den Angehörigen von Anfang an ihre wichtige Rolle für die PatientInnen spüren zu lassen und zu erklären. Man darf nicht außer Acht lassen, dass sie sich genauso wie ihre Liebsten in einer Ausnahmesituation befinden und jeder Mensch in einer solchen unterschiedlich reagiert.
„Die notwendige emotionale Stützung und psychische Führung der Angehörigen ist aber eine wenig kalkulierte, als zusätzliche Belastung von Ärzten und Schwestern empfundene Aufgabe zu betrachten. Bevorzugt wird deshalb häufig die Besuchssperre oder -beschränkung, die obendrein durch hygienische
Forderungen ohnehin indiziert und legitimiert erscheint. Andererseits stellt die Vereinsamung des Patienten eine schwere psychische Belastung dar.“26
Wenn es gelingt, beim Angehörigen Verständnis und Akzeptanz für das Intensivtherapiemilieu zu wecken, führt dies zu einer veränderten Einstellung, zu der vorerst unbekannten und als bedrohend empfundenen Technik. In Folge bewirkt diese vermehrte Kooperationsbereitschaft und daraus resultierend auch einen günstigen Einfluss auf die PatientInnen. Dies macht sich letztlich in einer Beruhigung und emotionalen Stabilisierung der PatientInnen bemerkbar.
3.1 Studien über Angehörige auf der Intensivstation
Hans Joachim Hannich und Ch. Wedershoven publizierten 1985 ihre Studie zur Situation von Angehörigen auf der Intensivstation. Sie untersuchten mittels einem 46 Items umfassenden Fragebogen folgende Bereiche:
- Der Erstkontakt auf der Intensivstation.
- Das Erleben der Situation auf der Intensivstation.
- Das Ausmaß an Aufklärung zur Situation der PatientInnen.
- Die psychosozialen Hilfen zur Situationsbewältigung.
- Die nachfolgende Bewertung der Erfahrungen auf der Intensivstation.
Die Fragebögen wurden an 210 Personen verschickt, wobei 61 retourniert und 57 davon ausgewertet werden konnten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wartezeit für Angehörige meist als beunruhigend und beängstigend erlebt wurde. Die Sorge um das Befinden der kranken Menschen im Vordergrund, so dass Informationen über den Zustand und die Intensivstation immer als hilfreich empfunden wurden. Beim Anblick der PatientInnen beschrieben die Angehörigen ihre emotionalen Reaktionen als Unruhegefühle, Mitgefühl, Verzweiflung, Hilflosigkeit und bei verstorbenen PatientInnen als Trauer. Die hochtechnische Umgebung der Intensivstation empfanden die meisten Angehörigen als beruhigend.
Die Beziehung zu den Pflegepersonen und ÄrztInnen wurde als positiv eingeschätzt. Bei 83,3% der Angehörigen herrschte der Eindruck, dass sie auf der Intensivstation erwünscht waren. 97,6% bezeichneten ihre Beziehung gegenüber den Ärzten und 89% gegenüber dem Pflegepersonal als gut bzw. sehr gut. 89,5% der Angehörigen waren der Meinung, dass ihre Bedürfnisse vom Behandlungsteam entsprechend berücksichtigt wurden.27
1993 publizierten K. Hermanns und F. Salomon eine empirische Untersuchung zum Thema: Sterben und Tod auf einer operativen Intensivstation aus Sicht naher Angehöriger. Sie konnten die Bögen von 109 Angehörigen auf der Intensivstation verstorbener PatientInnen auswerten. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Angehörigen zu 88,9% umfassend informiert und zu 97,6% angemessen behandelt fühlten. Mehr als 90% der Angehörigen fühlten sich von ÄrztInnen und Pflegepersonen mit ihren Fragen, Ängsten und Sorgen ernst genommen. Als erste Eindrücke von der Intensivstation wurden der hohe technische Aufwand, das große medizinische Können, die nüchterne Umgebung, die menschliche Unterstützung und das Notfallklima genannt. Für 87,2% der Angehörigen stand die Besorgnis um ihre Verwandten im Vordergrund.
83,7% der Angehörigen fühlten sich in angemessener Weise vom eingetretenen Tod unterrichtet worden zu sein. Ebenso gaben die meisten an, dass ihre Lieben zwar in Frieden, aber nicht würdevoll sterben konnten. Obwohl nur 14% der Angehörigen beim Tod anwesend waren, wünschten sich doch 62,1% dabei gewesen zu sein. 80,7% der Befragten möchten lieber zu Hause sterben, aber nur 45,1% hatten den Wunsch, dass ihre Angehörigen zu Hause sterben hätten sollen. Die Würde des Sterbens ist für die Angehörigen in erster Linie vom Ort des Todeseintritts und dem Grad der Einsamkeit beim Sterben abhängig.28
3.2 Der erste Besuch auf der Intensivstation
Es ist „state of the art“, dass Pflegepersonen, die einen Angehörigen zum ersten Mal auf der Station empfangen, beim Namen nennen, ihm die Hand reichen und sich und ihre Aufgaben vorstellen. Anschließend bitten sie die BesucherInnen sich aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen und eine Schürze umzubinden. In speziellen Situationen müssen auch Übermäntel, Handschuhe, Mundschutz und Hauben getragen werden. Auf den meisten Stationen gibt es Kästchen, wo die BesucherInnen ihre Handtaschen sicher verstauen können.
Danach sollte mit den Angehörigen der Inhalt der eventuell gerade gelesenen Informationsbroschüre durchgegangen werden und offene Fragen besprochen werden. Bei den Erklärungen ist aber zu bedenken, dass es sich doch meist um Laien handelt, die sich noch dazu in einer großen Ausnahmesituation befinden. Das heißt, es sollen möglichst keine Fachbegriffe verwendet werden und die Erklärungen kurz gehalten werden. Anschließend sollten die Angehörigen zum Bett der PatientInnen geführt werden und nicht gleich alleine gelassen werden. Es ist ein extrem belastender Moment, zum ersten Mal die geliebte Person im hochtechnisierten Umfeld einer Intensivstation zu sehen. Durch die Schlaf- und Schmerzmittel sowie den Beatmungsschlauch in Mund oder Nase ist es den PatientInnen nicht möglich zu kommunizieren. Sie sind an viele Maschinen zur Überwachung angeschlossen und erhalten zahlreiche Infusionen und Medikamente. Zusätzlich kommen eventuell noch äußere Verletzungen, ein ungewohnter Gesichtsausdruck oder eine veränderte Hautfarbe hinzu.
3.3 Ängste der Angehörigen
"Ich möchte nichts kaputt machen.“ „Ich habe Angst an den Kabeln und Geräten anzukommen.“ „Ich möchte meinem Angehörigen nicht weh tun.“ Diese und viele andere Sorgen quälen meiner Erfahrung nach Angehörige, und sie haben oft Angst, sich ihrem geliebten Menschen zu nähern. Nicht selten erlebt man, dass sie nicht mit, sondern über die PatientInnen sprechen und in respektvollem Abstand zum Bett stehen. Deshalb ist es wichtig, den Angehörigen die Möglichkeiten zu erläutern, wie sie mit den PatientInnen Kontakt aufnehmen können. Dazu ist es wichtig ihnen einen Sessel neben das Bett zu stellen, damit sie ihren Liebsten berühren können, oder wenn möglich auch Blickkontakt aufbauen können. Im weiteren Verlauf ist es wesentlich Angehörige aufzuklären welche Aufgaben die zahlreichen Apparate ausführen und welche unterschiedlichen Bedeutungen die Alarmsignale haben.
Man überfordert Angehörige sicher, wenn man ihnen bereits beim ersten Kontakt versucht einen detaillierten Einblick in die apparative Ausstattung des Behandlungsplatzes zu geben. Wenn PatientInnen aber viele Tage, oder gar Wochen auf der Intensivstation verbringen und bestimmte Angehörige regelmäßig zu Besuch kommen, wird ihr Interesse an der Umgebung immer größer. Meist steigt bei oftmaliger Beobachtung der Tätigkeiten des Pflegepersonals und der ÄrztInnen das Vertrauen in die Behandlung. Welche Behandlung bei einer bestimmten Erkrankung normal ist, ist ebenfalls eine wichtige Information, die die Angehörigen beruhigen kann. Eine gute Struktur an Informationen ist wichtig für das Verständnis der PatientInnen und die Effizienz der Informationsvermittlung.29
Denn durch Verstehen erst kann Vertrauen wachsen und manche Ängste überwunden werden. Wenn es PatientInnen sehr schlecht geht, ist auch daran zu denken, Angehörigen eine Übernachtungsmöglichkeit anzubieten. In allen Krankenhäusern gibt es auch die Möglichkeit die Seelsorge zu bestellen. Je nach Größe des Spitals sind unterschiedliche Konfessionen vertreten.30
3.4 Die wichtige Rolle der Angehörigen
Nicht zuletzt möchte ich näher auf die wichtige Rolle die Angehörige erfüllen können, eingehen. Wenn PatientInnen nicht verbal kommunikationsfähig auf der Intensivstation liegen, sind deren Angehörige die einzige Möglichkeit nähere Informationen über die Menschen zu bekommen. In der so genannten Pflegeanamnese werden Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten der PatientInnen erfragt, um eine individuelle Betreuung gewährleisten zu können. Diese wird auf Grund ihres hohen Stellenwerts auf der Intensivstation im folgenden Kapitel ausführlicher beschrieben. Dabei ist immer zu bedenken, dass es sich um die Wahrnehmung der Angehörigen handelt und nicht um die der PatientInnen selbst.
4 Pflegeanamnese auf der Intensivstation
Die Pfleganamnese stellt das Fundament für den Pflegeprozess dar. Folgende Definition soll den Begriff verdeutlichen:
„Die Pflegeanamnese als Ausgangspunkt des Pflegeprozesses dient der Informationssammlung, um Probleme, Ressourcen und Bedürfnisse des Patienten einschätzen zu können. Sie ist Voraussetzung für die Realisierung des Pflegeprozesses und dient dazu, das Fundament für eine optimale klinische Pflegepraxis zu legen. Alle folgenden Schritte im Pflegeprozess sowie die Qualität der Pflege insgesamt hängen von der Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit der Situationseinschätzung ab.“31
Für die Praxis bedeutet das, dass sich die Pflegepersonen mit dem nächsten Angehörigen, möglichst innerhalb der ersten 72 Stunden, einen Termin für ein Pflegeanamnesegespräch ausmachen sollen. Dieses soll in ruhiger Atmosphäre, möglichst in einem separaten Raum, auf der Station stattfinden. Der im Allgemeinen Krankenhaus verwendete Pflegeanamnesebogen wurde in Anlehnung an das Selbstfürsorgedefizit von Orem erstellt. Er beinhaltet die 8 notwendigen Aktivitäten, die nach Orem die Grundlage der universellen Selbstpflege darstellen:
- Ausreichende Zufuhr von Luft
- Ausreichende Zufuhr von Wasser
[...]
1 Vgl. Russell, 1999, S. 283 ff.
2 Benzer, 1994, S. 3.
3 Vgl. Benzer, 1994, S 3.
4 Aldridge, 1999, S. 70.
5 Vgl. Aldridge, 1999, S. 74 f.
6 Vgl. Lynn-McHale, 1997, S. 106 ff.
7 Vgl. Watts u.a., 1997, S. 85 ff.
8 Vgl. Steinbichler u.a., 1996, S. 26 ff.
9 Vgl. Ambros, 2000
10 Vgl. Roth-Isigkeit u.a., 2001, S. 62 ff.
11 Vgl. McGaughey u.a., 1994, S. 186 ff.
12 Vgl. McGaughey u.a., 1994, S. 271 ff.
13 Schneider, 1992, S. 45.
14 Vgl. Schneider, 1992, S 45 f.
15 Vgl. Miller u.a., 1994, S. 711 ff.
16 Vgl. Liebl u.a., 1999, S. 14 ff.
17 Vgl. Jäger u.a., 1984, S. 37 ff.
18 Vgl. Wallace, 1986, S. 111 ff.
19 Vgl. Derham, 1991, S. 80 ff.
20 Vgl. Liedtke, 2002, S. 78.
21 Vgl. Liedtke, 2002, S. 77 ff.
22 Vgl. Besendorfer, 2002, S. 301 ff.
23 Vgl. Gustorff, 2000, S. 143.
24 Vgl. Hannich, 1984, S. 253.
25 Burchardi u.a., 2004, S. 46.
26 Schneider u.a., 1992, S. 53.
27 Vgl. Hannich u.a., 1985, S. 89 ff.
28 Vgl. Hermanns u.a., 1993, S. 75. ff.
29 Vgl. McGaughey u.a., 1994, S. 271 ff.
30 Vgl. Heller, 1994, S. 112 ff.
31 Stefan u.a., 2003, S. 15.
- Arbeit zitieren
- Mag. Johanna Scherbaum-Zwinz (Autor:in), 2007, Evaluation des Informationsstandes von PatientInnen über ihren geplanten Aufenthalt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84927
Kostenlos Autor werden



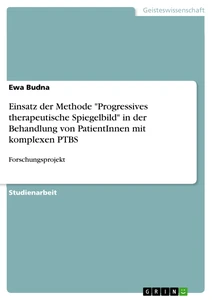







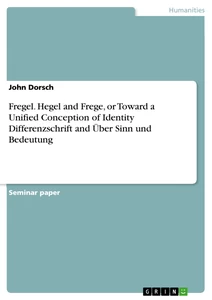


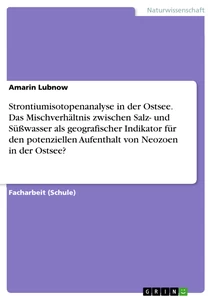







Kommentare