Leseprobe
Inhalt
Vorwort
1. Fragestellung, Lösungsansatz und Methodik
2. Obertongesang – Eine Einführung
2.1 Physikalische und physiologische Grundlagen des Obertongesangs
2.2 Obertongesang im Kontext zentralasiatischer und anderer Musiktraditionen
2.3 Phänomenologie des Obertongesangs in Mitteleuropa
3. Geschichte des Obertongesangs in Mitteleuropa
3.1 Die Bedeutung von Obertönen in der Antike und der frühchristlichen Musik
3.1.1 Die Entdeckung der Teiltöne
3.1.2 Die Annahme einer europäischen Obertonsangstradition im Mittelalter
3.1.3 Boethianische Gesänge
3.1.4 Ein Einzelfall
3.1.5 Gregorianischer Obertongesang als nachträglich erfundene Tradition
3.2 Beiträge der abendländischen Kunstmusikgeschichte zur Entwicklung einer Obertongesangstechnik
3.2.1 Obertoninstrumente
3.2.2 Polyphonie als Vorraussetzung okzidentaler Obertonmusik
3.2.3 Auswirkungen von Stimmungstemperaturen auf den Umgang mit Obertönen
3.2.4 Die Bestimmung der Obertöne durch Hermann von Helmholtz
3.2.5 Klangfarbenbewusstsein in der abendländischen Kunstmusik
3.2.6 Karlheinz Stockhausens "Stimmung"
3.3 Obertongesang im Kontext okzidentaler Kunstmusik der letzten Jahrzehnte
3.3.1 Experimente und Inspirationen - Die Wurzeln Westlichen Obertongesangs
3.3.2 Protagonisten des Westlichen Obertongesangs
3.3.3 Techniken Westlichen Obertongesangs
3.3.4 Kontextualisierungen und Stile Westlichen Obertongesangs
3.3.5. Notation von Obertönen
3.3.6 Obertongesang im Kontext von Chormusik
4. Obertongesang im Kontext des New Age
4.1 New Age und romantischer Orientalismus – Obertongesang als Weg und Sinnbild
4.2 Heilung mit Obertönen
4.3 Gruppenimprovisationen mit westlichen Obertongesangstechniken
5. Zentralasiatischer Obertongesang in Mitteleuropa
5.1 Zentralasiatische Obertonsänger als Weltmusikstars
5.2 Zentralasiatische Obertonsänger als Lehrer in Europa
5.3 Bedeutung der zentralasiatischen Obertongesangsformen für den Westlichen Obertongesang
6. Westlicher Obertongesang – Schlussfolgernde Begriffsbestimmung
7. Anhang
7.1 Interviews und Transkriptionen
7.1.1 Interview mit Jan Stanek
7.1.2 Interview mit Bodo Maas
7.1.3 Interview mit Matthias Privler
7.1.4 Interview mit Goesta Peterson
7.1.5 Interview mit Steffen Schreyer
7.1.6 Ansprache des mongolischen Obertonsängers Hosoo bei einem Konzert
7.1.7 Hosoo: „Kehlkopf-Gesangs-Workshop“
7.1.8 Wolfgang Saus: „Workshop – Grundlagenlehrgang Obertongesang“
7.1.9 Emailinterview mit Wolfgang Saus
7.2 Glossar
7.3 Quellenverzeichnis
7.4 Liste der Tonbeispiele
7.5 Liste der Abbildungen
Vorwort
Das Interesse für die Verbindung von Musik und Religion veranlasste mich nach ausgedehnten Reisen im Herbst 2002 zum Studium der Vergleichenden Musikwissenschaft und der Religionswissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Entgegen meinem Wunsch, Wirkungen von Musik zu ergründen, lehrte mich die Vielfalt an religiösen und musikalischen Phänomenen, mit der ich mich beschäftigte, eine gewisse Relativität von Absolutheitsansprüchen. Die wissenschaftliche Herangehensweise überzeugte mich von einem distanzierten und kontextbezogenen Umgang mit Quellen und Aussagen.
„Die Unwissenheit ist die Unwissenheit.
Kein Recht zu glauben leitet sich daraus ab.“
Dieser Aphorismus Sigmund Freuds drückt die essenzielle Erkenntnis meiner Studienzeit aus. Ich bereue sie nicht, da ich auf diese Weise zu einer neuen Grundlage meiner Beschäftigung mit Musik und Religion gefunden habe. Aus dem Bedürfnis, dieses Verstandene umzusetzen, entschied ich mich, in meiner Magisterarbeit die Praxis von Obertongesang in den westlichen Kulturen zu thematisieren. Ich wollte daran den bewussten Verzicht auf Wissenschaftlichkeit zugunsten beharrlichen Glaubens und den leichtfertigen Umgang mit Quellen behandeln, die Obertongesang innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem gut vermarkteten Mittel spirituellen Erlebens im Umfeld neureligiöser Bewegungen und auf dem Esoterikmarkt in Mitteleuropa werden ließen.
In den kurzen Feldforschungen, die ich zur Informationssammlung unternahm, stieß ich jedoch, neben den angenommen Anschauungen, auf eine gänzlich andere Applikation von Obertongesang. Dieser war dabei kein Mittel der Selbsterfahrung, das seinen Status durch Referenz zu traditionellen bzw. spirituellen Praktiken Asiens erhielt. Ich lernte Obertongesang als kompositorisches Element und Mittel der konkreten Gestaltung vokaler Zusammenklänge kennen, dessen Möglichkeiten gerade erst erkannt werden.
Die Aktualität der diesbezüglichen Entwicklungen bewog mich, verstärkt der Frage nach der Bedeutsamkeit von Obertongesang für die abendländische Musik nachzugehen. Die kritische Auseinandersetzung mit den subjektiven Kontextualisierungen davon rückte in den Hintergrund. Die Arbeit an Obertongesang in Mitteleuropa führte mich auf diese Weise auf wissenschaftlicher Ebene zu meinem inhaltlichen Interesse an den Wirkmechanismen von Musik zurück.
Einen aufrichtigen Dank für Inspirationen und die Ermöglichung eines noch relativ freien und selbstbestimmten Studierens möchte ich an dieser Stelle an meine beiden Professoren Gert-Matthias Wegner und Hartmut Zinser aussprechen.
Für die Unterstützung bei der Umsetzung meiner Magisterarbeit möchte ich für viele sachliche und methodische Anregungen Dr. Lars-Christian Koch, dem Examenscolloquium der Vergleichenden Musikwissenschaft und Professor Dr. Wegner danken. Für die inhaltliche Unterstützung danke ich insbesondere Wolfgang Saus. Bodo Maas danke ich für die Bereitstellung der Overtone Analyser Software, Mila Simova und Lukas Voborsky für die technische Hilfe bei der Erstellung von Fragebögen, Jan Stanek für die Bereitstellung von Audioaufnahmen, Erik Wisniewski für das Auspegeln der Tonbeispiele und Nadine Schneider für die Umsetzung der Deckblattgestaltung. Ein besonderer Dank richtet sich an Carola Gellrich für die Durchsicht der Arbeit.
1. Fragestellung, Lösungsansatz und Methodik
Mit dem Begriff Obertongesang werden Singtechniken und musikalischen Stile bezeichnet, bei denen ein einzelner Sänger bzw. eine Sängerin scheinbar zwei- oder mehrstimmig singt.[1] Bei verschiedenen Ethnien Zentralasiens stellen bestimmte Obertongesangsformen einen essenziellen Teil bestehender Musiktraditionen dar.[2] In den letzten Jahrzehnten ist jedoch auch in musikalischen[3] und esoterischen[4] Kontexten westlicher Kulturen eine zunehmende Beschäftigung mit Obertongesang zu beobachten. Diese führt insbesondere in Mitteleuropa und den USA in breitem Umfang zu musiktheoretischen und musikpraktischen Entwicklungen. Hinsichtlich dieser Entwicklungen wird sowohl von westlichen als auch von zentralasiatischen Obertonsängern von Europäischem[5] oder Westlichem[6] Obertongesang gesprochen. Diese Begriffe werden verwendet, um die sich im Westen[7] entwickelnde Obertonmusik von den in Zentralasien gebräuchlichen Techniken und Stilen abzugrenzen, die seit den neunziger Jahren im Kontext von Weltmusik auch in den westlichen Kulturen Popularität erlangen. Aus Sicht der Vergleichenden Musikwissenschaft steht jedoch in Frage, ob eine solche Differenzierung sinnvoll ist. Der Aufklärung dieser Sachlage widmet sich die vorliegende Arbeit.
Das Entstehen von dezidiert europäischen oder westlichen Formen des Obertonsingens in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa wird von Obertonsängern erklärt als:
a) Wiederbelebung einer alten, europäischen Obertongesangstradition,[8]
b) Entwicklung einer neuen Gesangstechnik im Kontext okzidentaler Musik,[9]
c) Herausbildung eines neuen Gesangstils, infolge der Verwendung von Obertongesang in einem spezifisch westlichen kulturellen Kontext.[10]
Neben diesen Erklärungen ist jedoch zu erwägen, ob der Obertongesang, wie er in den westlichen Kulturen praktiziert wird, nicht anzusehen ist als:
d) Übernahme außereuropäischer Singtechniken und Stile.
Zuerst muss somit geklärt werden, ob es sich bei der gegenwärtigen Praxis von Obertongesang in den westlichen Kulturen um eine Entwicklung handelt, die sich auf musikalischer und/oder sozialer Ebene aus der abendländischen Kulturgeschichte ableitet.
Ließe sich die unter a) aufgeführte Erklärung begründen, wäre es im Sinne einer wieder belebten Tradition gerechtfertigt, bezüglich der westlichen Obertonmusik von Europäischem Obertongesang zu sprechen. Andernfalls wäre diese Bezeichnung irreführend, da die gegenwärtigen musikalischen Entwicklungen in europäischen Ländern nicht abgesondert von denen anderer westlicher Kulturen, insbesondere den USA betrachtet werden können. Wenn also Erklärung b) oder Deutung c) begründet werden könnte, wäre es sinnvoll, von Westlichem Obertongesang zu sprechen. Diese Bezeichnung wäre dann durch Bezug auf eine besondere Gesangstechnik oder einen besonderen Gesangsstil zu definieren. Trifft hingegen Erwägung d) zu, ist es vom musikwissenschaftlichen Standpunkt unsinnig, von Westlichem Obertongesang zu sprechen, da entweder dieser Bezeichnung, in Referenz zu den zentralasiatischen Obertongesangsformen, keinerlei besondere Bedeutung zugewiesen werden könnte oder Unterschiede in der Praxis von Obertongesang nicht auf das typisch „Westliche “ daran zurückgeführt werden könnten. Stellt es sich als sinnvoll heraus, von Europäischem oder Westlichem Obertongesang zu sprechen, soll als Ergebnis der Arbeit eine Begriffsdefinition unternommen werden.
Um eine Beschäftigung mit dem Thema zu ermöglichen, werden einführend die physikalischen und physiologischen Grundlagen des Obertongesangs erläutert. Darauf folgt eine Kurzvorstellung weltweiter Beispiele der musikalischen Verwendung von Obertongesang, damit die westlichen Entwicklungen mit diesen verglichen werden können. Eine Phänomenologie der Beschäftigung mit Obertongesang in den westlichen Kulturen schließt den einführenden Teil ab, um die Relevanz der Fragestellung zu umreißen.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Geschichte des Obertongesangs in Europa. Darin werden die musikgeschichtlichen Entwicklungen chronologisch dargestellt, die zu den gegenwärtig bestehenden Obertongesangsformen in Mitteleuropa führen. Daran soll die Richtigkeit der Erklärungen a-c erörtert werden. Der sich auf die frühe europäische Musikgeschichte beziehende Teil soll insbesondere zur Überprüfung von Erklärung a) dienen.
Die Bewertung der Erklärungen b) und c), und damit die Validität des Begriffes Westlicher Obertongesang hängt in besonderem Maße davon ab, ob die Entwicklung einer Obertongesangstechnik in den siebziger Jahren im Westen sich aus der „westlichen“ Musikgeschichte ableitet, d. h. als ein Resultat dieser gedeutet werden kann.
Deshalb sollen im Weiteren wichtige Entwicklungen in der okzidentalen Kunstmusikgeschichte bezüglich ihres Einflusses auf den musikpraktischen Umgang mit Obertönen und ihres Beitrag für das Entstehen einer Obertongesangsform im Westen untersucht werden.
Der geschichtliche Abriss der Herausbildung einer Obertonmusik im Westen während der letzten Jahrzehnte soll schließlich die Schlussfolgerung ermöglichen, ob der in Mitteleuropa praktizierte Obertongesang als von den zentralasiatischen Obertongesangsformen unabhängig betrachtet werden kann. Der darin gezogene Vergleich der in Europa verwendeten Techniken mit den in Zentralasien angewandten soll Erklärung b) verifizieren.
Der Überprüfung von Erklärung c) dient zusätzlich der darauf folgende Abschnitt über Obertongesang im New Age. Schließlich soll unter Punkt 5. die Rolle der zentralasiatischen Obertongesangsformen für die Entwicklung der westlichen Obertonmusik und damit Erwägung d) näher untersucht werden.
Das umrissene Vorhaben wird hauptsächlich mit Hilfe von Literatur und Internetrecherche sowie kurzen Feldforschungen realisiert werden. Als schriftliche Informationsquellen dienen fachliterarische Werke der Vergleichenden und Historischen Musikwissenschaft sowie Obertongesangslehrbücher westlicher Verfasser und Internetlexika. Um Erklärung c) zu überprüfen, soll die Arbeit auch die Bedeutung des Obertongesangs für die diese Technik Praktizierenden eruieren. Deshalb werden auch Internetseiten über Obertongesang sowie Werke populärwissenschaftlichen und esoterischen Inhalts zur Informationssammlung verwendet.
Im Rahmen der Magisterarbeit führte der Autor zwei Feldforschungen in der Tschechischen Republik und Deutschland durch. Vom 20. 08. 2006 - 27. 08. 2006 nahm er an dem Projekt Europa Obertonchor sowie am Obertonatelier des Bohemia Cantat-Festivals in Liberec (CZ) teil. Die Ergebnisse dieses Forschungsaufenthalts aus teilnehmender Beobachtung, Teilnehmerbefragung und weiterführendem Kontakt via Email dienen der Informationssammlung. Die während der Forschung gesammelten Daten werden für die Darstellung des Entwicklungsstandes (August 2006) von Obertongesang in Mitteleuropa verwendet.
Charakteristische Interviewaussagen und Informationen der Teilnehmer und Kursleiter werden an verschiedenen Stellen der Arbeit angeführt, um Ansichten europäischer Obertonsänger zu verdeutlichen und Interpretationen bestimmter Entwicklungen zu belegen.
Vom 14. 09. 2006 - 17. 09. 2006 nahm der Autor an den 4. Internationalen Obertontagen – Lauschrausch VI in Dresden teil. In diesem Kontext besuchte er zwei Obertongesangseinführungskurse.
Die Transkription dieser Einführungen eines westlichen und eines asiatischen Obertonsängers dienen der Darstellung des Verständnisses und der Weitergabe des Obertongesangs in der okzidentalen und der asiatischen Kultur.
Tonaufzeichnungen beider Forschungsaufenthalte und andere Tonbeispiele sind der Arbeit auf einer CD beigefügt*, um bestimmte Aussagen zu verdeutlichen und Theoretisches zu belegen. Abbildungen des Programms Overtone Analyser und anderer Bildquellen werden innerhalb der Arbeit zur Veranschaulichung komplexer Inhalte verwendet.
Der Autor lernte Obertongesang vor etwa 4 Jahren im Kontext einer Feldforschung über Mantra-Meditation kennen und bemüht sich seitdem um das Erlernen der Technik. Die eigenen Erfahrungen damit und die erarbeiteten grundlegenden Fähigkeiten fließen ebenfalls in die Arbeit ein.
2. Obertongesang – Eine Einführung
2.1 Physikalische und physiologische Grundlagen des Obertongesangs
Jeder natürlich hervorgebrachte Ton besteht aus einer Grundschwingung und einer Vielzahl von höheren Frequenzen.[11] Diese werden Teiltöne, Partialtöne, Harmonische oder Obertöne genannt. Ihre Schwingungszahl steht in ganzzahligem Verhältnis zur Frequenz des Grundtones.[12] Dabei wird der Grundton bei der Nummerierung der Teil- bzw. Partialtöne und Harmonischen mitgezählt, nicht jedoch bei der Bezifferung der Obertöne. Abbildung 1 stellt eine Grundschwingung und ihre ersten vier Obertöne schematisch dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
Theoretisch schwingen in einem Ton unendlich viele Obertöne mit. Mit dem Grundton bilden sie das Frequenzspektrum eines Tones. Ihre Lautstärke nimmt jedoch in der Regel mit zunehmendem Abstand vom Grundton ab, da ihre schnellere Schwingung mehr Energie verbraucht.
Die Grundfrequenz (1 in Abb. 1) wird als Tonhöhe wahrgenommen. Die mitschwingenden Obertöne (1.-4. in Abb. 1) werden als Klangfarbe des Tons empfunden. Neben so genannten äußeren Merkmalen eines Klangs, also Begleitgeräuschen, die mit dem Ansatz und dem Verlauf des Klangs verbunden sind, resultiert die Klangfarbe eines Tones insbesondere aus der spezifischen Dynamik der mitschwingenden Harmonischen.
Die Merkmale, welche die dynamische Obertonstruktur eines Klanges betreffen, werden als innere Klangmerkmale einer Klangfarbe bezeichnet.[13] Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich Äußerungen über Klangfarbe innerhalb der Arbeit auf die inneren Klangmerkmale.
Abbildung 2 stellt das Sonagramm des Klangs eines auf dem Harmonium gespielten c dar (Tonbeispiel 1). Die unterste Linie markiert die Grundschwingung. Alle darüber liegenden Linien sind Darstellungen der mitschwingenden Obertöne. Die Farbintensität gibt Aufschluss über die Lautstärke des jeweiligen Teiltones.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2[14]
Bei einem auf einer Violine gespieltem c wäre das Lautstärkeverhältnis der mitschwingenden Obertöne ein anderes. Dadurch kann der Klang beider Instrumente unterschieden werden. Wird die Klangfarbe eines Tones bewusst verändert, werden also nicht dessen Obertöne verändert, sondern nur deren dynamisches Verhältnis zueinander.
Die Besonderheit der Frequenzspektren zweier von verschiedenen Instrumenten hervorgebrachter Töne einer Tonhöhe ermöglicht es dem Menschen, mit seinem Gehörsinn zwei Klangquellen zu identifizieren und zu lokalisieren. Kleine Schwankungen der Tonhöhe, die bei natürlich hervorgebrachten Tönen immer vorkommen, finden im gesamten Frequenzspektrum eines Tones statt.[15] Diese minimalen, parallelen Tonhöhenverschiebungen genügen dem Ohr, diese zu einem Ton mit einer Klangfarbe zusammenzusetzen und einer Klangquelle zuzuordnen.
Beim Obertongesang werden bestimmte Obertöne aus dem Frequenzspektrum eines gesungenen Grundtones derart verstärkt, dass sie als eigenständiger Ton wahrgenommen werden. Dies ist dann möglich, wenn die unter dem verstärkten Oberton liegenden Harmonischen außerdem gedämpft werden. Diese Technik des Verstärkens und gleichzeitigen Dämpfens von Obertönen wird „Filtern“ genannt.[16] Durch das Herausfiltern von Obertönen nimmt das Gehör kein durchgehendes Frequenzspektrum mehr wahr. Es identifiziert den verstärkten Oberton des Grundtones als eigenständige Klangquelle und nicht länger als Klangfarbe des Grundtones. Obwohl physikalisch nur die Glottis eines Sängers aktiv ist - also nur eine Klangquelle, werden virtuell zwei wahrgenommen.[17] Deswegen wurde eingangs Obertongesang als nur scheinbar zwei- oder mehrstimmiges Singen bezeichnet.
Abschnitt I Abschnitt II
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3[18]
Abbildung 3 veranschaulicht diese Tatsache. In Abschnitt I singt der Autor auf dem Grundton c den Vokal A. Dieser wird im Sonagramm mit seiner charakteristischen Obertondynamik abgebildet. Im Abschnitt II werden verschiedene, einzelne Obertöne nacheinander herausgefiltert. Dadurch entsteht der Höreindruck, dass über einem ausgehaltenen Bordun eine Melodie gesungen wird. Tonbeispiel 2 ist die Aufzeichnung des in Abbildung 3 veranschaulichten, gesungenen Stücks.
Ordnet man alle Obertöne eines Grundtones entsprechend ihrer Größe, erhält man die Obertonreihe eines Grundtones. Diese wird einschließlich des Grundtones auch Naturtonreihe genannt. Abbildung 4 zeigt die Obertonreihe des Tones „C bis zum 15. Oberton. Direkt unter den Tönen ist die Abweichung der Obertöne von den notierten, temperierten Tönen in Cent vermerkt.
Die ganzen Zahlen am Fuße der Abbildung geben die Schwingungszahl der Obertöne im Verhältnis zum Grundton an. Sie nummerieren außerdem die Teiltöne bzw. die Partialtöne und Harmonischen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4
Für die Melodiebildung im Obertonbereich stehen demnach prinzipiell alle Töne der Naturtonreihe zur Verfügung. Dies stellt die physikalische Grundlage des Obertongesangs dar. Wie an der Steigung der rot markierten Tonhöhenkurve zu sehen, liegen die Obertöne eines Grundtones in zunehmender Höhe bezüglich ihrer Tonhöhe zunehmend dicht bei einander. In bestimmten musikalischen Kontexten können daher nicht alle Töne der Obertonreihe verwendet werden.
Die physiologische bzw. anatomische Grundlage des Obertongesangs besteht darin, dass bestimmte Partialtöne eines Grundtones durch Resonanz im Mundraum so verstärkt werden können, dass sie als eigenständige Klangquelle wahrgenommen und separat vom Grundton empfunden werden. Im Unterschied zu Instrumenten hat die menschliche Stimme keinen feststehenden Resonanzkörper, der einen spezifischen Klang verstärkt. Durch Veränderung verschiedener Resonatoren im Mund-, Rachen- und Nasenraum kann die Vielfalt an Klangfarben geformt werden, die der Mensch beim Sprechen und Singen nutzt.
Frequenzen, die im Spektrum eines Tones besonders stark hervortreten, werden als Formanten bezeichnet.[19] Sie sind für die Klangcharakteristik eines gesungenen oder gesprochenen Tones maßgebend. Ihre bewusste Modifikation ist erlernbar. Opernsänger verstärken z. B. insbesondere Frequenzen um 3 Kilohertz. In diesem Frequenzbereich nimmt die Lautstärke des Orchesters stark ab. Durch bewusste Hervorhebung der Frequenzen um 3 Kilohertz, d. h. der in diesem Bereich liegenden Obertöne des Grundtones, kann sich die Stimme des Opernsängers bezüglich der Lautstärke gut gegen den Orchesterklang durchsetzen.[20]
Das für den Obertongesang notwendige Filtern verschiedener Obertöne wird, wie das Verändern der Klangfarbe, durch Veränderung der Resonatoren im Mund umgesetzt.
Diese werden derart genau justiert, dass nur noch eine Frequenz als Formant besonders lautstark mitschwingt. Obertongesang wird deshalb in der musikwissenschaftlichen Fachterminologie auch als Formantsingen bezeichnet.[21]
Das gesamte Frequenzspektrum eines gesungenen oder gesprochenen Tones wird zunächst im Kehlkopf erzeugt. Dieser dort entstehende Klang wird primärer Stimmschall oder Primärklang genannt.[22] Ob ein Oberton herausgefiltert werden kann, hängt auch davon ab, wie lautstark er im Primärklang mitschwingt. Eine spezifische Art der Primärklangerzeugung ist daher neben der verwendeten Technik des Herausfilterns der Obertöne bzw. Bündelns der Formanten essenzieller Bestandteil jeder Obertongesangstechnik.[23]
Musik, die durch das Herausfiltern von Obertönen umgesetzt wird, ist durch die beschriebenen physikalischen und physiologischen Grundlagen bestimmten Restriktionen unterworfen. Einerseits werden Obertöne, die sehr dicht beim Grundton liegen, als Klangfarbe wahrgenommen, da sie mit dem Grundton automatisch zu dem Frequenzspektrum eines Tones zusammengefügt werden, andererseits nimmt prinzipiell mit zunehmender Entfernung vom Grundton das Volumen der mitklingenden Obertöne im Primärklang kontinuierlich ab. Dementsprechend können diese Obertöne auch schwerer verstärkt werden. Weitere Einschränkungen sind, dass ab dem 15. Oberton die Partialtöne hinsichtlich der Tonhöhe so dicht bei einander liegen, dass es zunehmend komplizierter wird, nur einen davon zu verstärken. Außerdem können mit Hilfe der Resonatoren im Mundraum nur Formantfrequenzen von ca. 300 Hertz bis ca. 3300 Hertz gefiltert und verstärkt werden.[24] Wird ein sehr hoher Grundton gewählt, stehen dem Sänger oder der Sängerin daher nur wenige filterbare Obertöne zur Verfügung. Wird ein sehr tiefer Grundton gewählt, können die Obertöne nicht laut genug verstärkt werden. Aus diesen Parametern ergibt sich, dass für den Obertongesang eigentlich nur 10-12 Töne[25] zur Verfügung stehen. Davon können zusätzlich nicht immer alle im spezifischen musikalischen Kontext verwendet werden.
Eine Möglichkeit, die Anzahl der für die Obertonmelodie verwendbaren Obertöne zu vergrößern, ist die Erzeugung eines besonders tiefen Primärklangs, bei dem die Obertöne dennoch laut mitschwingen. Die Technik dieser Form der Klangerzeugung ist wissenschaftlich noch nicht genau erforscht.
Phonetiker gehen jedoch davon aus, dass dieser tiefe Primärklang entweder mit Hilfe einer besonderen Strohbasstechnik realisiert wird oder durch eine Beteiligung der Taschenfalten über den Stimmbändern an der Klangerzeugung.[26] Im Gegensatz zu einem natürlich intonierten Basston klingen in dem so erzeugten primären Stimmschall die Obertöne weitaus kräftiger mit. Durch die große Anzahl an filterbaren Obertönen ist es mit dieser Technik daher möglich, mehr als einen Oberton zu isolieren und somit quasi mehrstimmig zu singen.
Da neben den Obertönen auch der Grundton variiert werden kann, sind musikalisch vier grundsätzlich verschiedene Typen des Obertongesangs zu unterscheiden.[27] Bei Typ A wird auf die beschriebene Art der Grundton als Bordun gehalten und darüber in der Obertonlage eine Melodie geformt. Typ B ist, den Bordun im Obertonbereich herauszufiltern und eine Melodie aus verschiedenen Grundtönen zu singen. Diese müssen dann so gewählt werden, dass der entsprechende Obertonbordun in ihnen auch enthalten und verstärkbar ist. Des Weiteren ist es möglich, eine Melodie im Grundtonbereich zu gestalten und parallel dazu dieselbe Melodie im Obertonbereich zu verstärken – Typ C. Beispielsweise könnte aus jedem Ton der Grundtonmelodie der fünfte Oberton herausgefiltert werden, wodurch ein Sänger allein scheinbar in Quinten sänge. Schließlich ist es möglich, wenn auch technisch sehr anspruchsvoll, sowohl im Grundton- als auch im Obertonbereich eine eigenständige Melodie zu erzeugen – Typ D, also solistisch polyphon zu singen. In Tonbeispiel 3 sind alle vier genannten Obertongesangstypen auf einfache Weise der Reihe nach vorgestellt. Abbildung 4 zeigt die entsprechenden Unterschiede im Sonagramm.
Obertongesangstyp: A B C D
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5[28]
2.2 Obertongesang im Kontext zentralasiatischer und anderer Musiktraditionen
Die Praxis von Obertongesang ist innerhalb bestimmter Musiktraditionen turko-mongolischer Völker Zentralasiens historisch belegt.[29] Bei den Mongolen und Tuva, den Khakhassen, Bashkiren und Altaiern, aber auch bei den Xhosa in Südafrika werden auch gegenwärtig Obertongesangstechniken musikalisch verwendet.[30] Außerdem wird Obertongesang in bestimmten rituellen Kontexten des tibetischen Tantrismus von Lamas der Gyüto - und Gyüme- Klöster[31] und von in Bruderschaften organisierten Laiensängern auf Sardinien im Zusammenhang der österlichen Liturgie in Italien praktiziert. Hinweise lassen darauf schließen, dass Obertongesangsformen auch in Indien bekannt waren oder sind.[32]
Gemessen an der Reichhaltigkeit musikalischer Formen und der Anzahl an zumindest eine Technik des Obertonfilterns beherrschenden Musikern sind die verschiedenen Gebiete des Altaigebirges das Zentrum des Obertongesangs. Allein in Tuva[33], einer autonomen Republik Russlands mit ca. 300000 Einwohnern soll es 1600 Musiker geben, die Obertongesangstechniken beherrschen.[34] Obwohl der Großteil davon Männer sind, praktizieren gegenwärtig zumindest in der Mongolei und in Tuva auch Frauen Obertongesang. Eine offizielle Zählung von Obertonsängern in der Mongolei aus dem Jahre 1998 hält 500 Obertonsänger fest, wovon 10 Frauen sind.[35]
Der gängigste und am weitesten verbreitete Obertongesangstyp ist der unter 2.1 (A) beschriebene.[36] In den genannten zentralasiatischen Ländern ist Obertongesang daher meist gekennzeichnet durch das Herausfiltern einer Melodie im Obertonbereich aus einem als Bordun gehaltenen Grundton. Anhand verschiedener Arten der Erzeugung des Primärklangs, des Herausfilterns der Obertöne und der stilistischen Einbettung in den musikalischen Kontext lassen sich verschiedene Formen zentralasiatischen Obertongesangs unterscheiden. Als Obertongesangsform wird innerhalb der Arbeit eine in Primärklangerzeugung, Filtertechnik und Stil spezifische Art des Obertonsingens bezeichnet.
Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die formelle Unterteilung von Obertongesang bei den Tuva, da Obertongesang in der Musikpraxis dieser zentralasiatischen Ethnie hinsichtlich bestimmter Stile und Techniken am weitesten ausdifferenziert wird.[37]
Khöömei ist die Bezeichnung der Tuva für Obertongesang. Sie wird generell als Kehlkopfgesang oder Kehlgesang übersetzt.[38] Eine entsprechende Bezeichnung existiert bei den mongolischen Obertonsängern (khöömii), weshalb Kehlgesang oder khöömei im Kontext der Arbeit als Oberbegriff und Synonym für die verschiedenen Obertongesangsformen der Altairegion verwendet wird.[39]
Der Begriff khöömei wird bei den Tuva jedoch auch speziell für eine der drei Grundformen von Obertongesang verwendet. Zu diesen gehören nach der Klassifizierung Mark van Tongerens in seinem 2002 erschienenen Buch Overtone Singing noch sygyt und kargyraa.[40] Ähnliche Unterscheidung verschiedener Formen von Obertongesang lassen sich auch bei der Obertonmusik anderer zentralasiatischer Ethnien nachweisen. Die Bezeichnung sygyt benennt bei den Tuva den Singstil, bei dem der Grundton möglichst wenig zu hören ist und die Obertöne sehr scharf und laut verstärkt werden. Um dies zu erreichen, wird der primäre Stimmschall beim sygyt mit extremem Druck erzeugt. Die Zunge berührt den Gaumen wodurch der Resonanzraum im Mund zweigeteilt wird.
Beim kargyraa werden die Obertöne aus dem unter 2.1 beschriebenem tiefen Primärklang herausgefiltert. Da bei diesem Stil die Melodielinie meist in der tiefen Grundstimme liegt, werden Obertöne im kargyraa oft nach dem Verfahren von Typ B herausgefiltert.
Im khöömei als spezifischer Obertongesangsform wird eine an Vokalklängen orientierte Obertongesangstechnik angewandt, bei welcher der Grundton gut hörbar ist und die Obertöne mit moderater Lautstärke herausgefiltert werden. Die Zunge verbleibt am Boden des Mundraums.
Der Primärklang wird auch bei kargyraa und khöömei mit starkem Druck auf den Kehlkopf erzeugt. Die gedrückte Grundtonintonation kann daher als generelles Kriterium des Kehlgesangs angesehen werden kann.
Einerseits schwingen in dem so erzeugten Primärklang Obertöne besonders intensiv mit und können daher leichter verstärkt werden, andererseits klingt der Grundton dadurch im Verhältnis zum herausgefilterten Oberton leiser, was dem Klangideal der zentralasiatischen Obertonsänger entspricht. Die Obertonsänger der Altairegionen – khöömeizhi genannt – beherrschen oft zwei oder drei Obertongesangsformen. Viele von ihnen kreieren aus den vorhandenen Möglichkeiten einen eigenen Stil. Die meisten Melodien werden mit den Obertönen 8-12 gebildet unter Ausschluss des 11. Dadurch entsteht die für zentralasiatische Musik typische, pentatonische Gebrauchskala.
Obertongesang wird von den khöömeizhi dieser Regionen als Kommunikation mit der Natur verstanden. Er soll aus dem Nachahmen von Naturgeräuschen entstanden sein und stellt eine Art Antwort des Sängers darauf dar.[41] Es existieren Hinweise auf eine Verwendung des Kehlgesangs im Zusammenhang mit Schamanismus.[42] Obwohl auch gegenwärtig Obertongesang als Kommunikationsmittel zu verschiedenen Lokalgottheiten gebraucht wird, z. B. als musikalische Opfergabe an einen Flussgott, wird er in den Altairegionen nicht zu Zwecken übersinnlichen Erlebens oder spiritueller Entwicklung praktiziert.[43]
Kehlgesang wird oft von den Sängern selbst oder von Mitmusizierenden instrumental begleitet. Am häufigsten werden dafür 2-3 saitige Langhalslauten oder Pferdekopfgeigen verwendet. Die darauf gespielten, meist einfach gehaltenen, wiederholten Patterns, unterstützen den Sänger oder die Sängerin den Grundton zu halten. Nach einem kurzen Vorspiel auf dem Instrument wird eine kurze Textzeile gesungen. Diese kann einem traditionellen Lied entstammen oder improvisiert sein. Danach folgt bzw. folgen eine oder mehrere textlose Kehlgesangs -Passagen. Daran schließt sich ein instrumentales Zwischenspiel, nach dem wieder ein Textteil gesungen wird. In einem Stück werden oft verschiedene Obertongesangsformen verwendet.
Obertongesangstechniken werden in Tuva und der Mongolei mittlerweile auch an Konservatorien unterrichtet, während sie früher ausschließlich oral tradiert wurden. In den letzten Jahrzehnten entwickeln sich in Tuva und in der Mongolei neue Formen des gemeinsamen Obertonsingens mit reichhaltiger Instrumentalbegleitung, die sich für Aufführungen vor Publikum, insbesondere vor touristischem,[44] besser eignen, als der frühere einstimmige, teils unbegleitete Obertongesang.
Die von diesen Gruppen vorgetragene und vermittelte Musik kann aufgrund der vielen Neuerungen jedoch nicht im eigentlichen Sinne als traditionelle Musik der Mongolen oder Tuva gelten. Sie ist eine Reaktion auf das ausländische Interesse daran[45] und Folge der Suche nach bzw. Schaffung einer kulturellen Identität nach dem Zerfall des Ostblocks. Seit Erscheinen der ersten kommerziellen Aufnahmen des Obertongesangs der Tuva im Westen Anfang der neunziger Jahre erlangt Kehlgesang im Kontext von Weltmusik große Popularität.[46]
Der Obertongesang der tibetischen Mönche der Gyüme- und Gyüto-Klöster wird yang genannt. Er ist Teil tantrischer Zeremonien des Vajrajana-Buddhismus und soll im 15. Jahrhundert in die rituelle Praxis einbezogen worden sein.[47] Nach der Okkupation Tibets durch China wurden die Klöster im indischen Exil neu errichtet. Mit Ausnahme der solistischen Passagen des Vorsägers (umze) wird yang gemeinsam praktiziert.[48] Über die gesamte Länge eines Stücks wird ein kontinuierlicher Bordun gesungen. Dies wird mit Hilfe chorischen Atmens realisiert. Das Klangideal der oft über hundertköpfigen Chöre ist das einer einzigen, gewaltigen Stimme. Der Primärklang dieser Art des Obertongesangs erinnert an den kargyraa der Tuva. Obwohl dabei weniger Druck auf die Stimmbänder ausgeübt wird, werden beim yang noch tiefere Grundfrequenzen erreicht. Die Obertöne werden meist parallel zu den wechselnden Grundtönen herausgefiltert.[49] Dies entspricht dem unter 2.1 beschriebenen Obertongesangstyp C. Dabei filtern die Mönche des Gyüto-Klosters den 4. Oberton heraus. Sie singen also mit parallelen Terzen. Die Gyüme-Mönche singen hingegen mit parallelen Quinten. Sie filtern also den 5. Oberton heraus.[50] Das Verschmelzen des gemeinsamen Gesangs zu einer Stimme auf der Grundtonebene ist jedoch das wichtigere. Somit kommt es auch vor, dass Obertönen verstärkt werden, die nicht der parallelen Obertonmelodie angehören oder dass mehr als ein Oberton herausgefiltert wird.
Oft werden einzelne Passagen instrumental mit Zimbeln, Glocken, Trompeten und Trommeln lautstark begeleitet. Die bei den Zeremonien gesungenen Texte entstammen bestimmten Sutras, die in einer Form des Tibetischen verfasst sind, die nur den in die Tradition Eingeweihten vollkommen verständlich ist. Die Technik des yang soll auch dazu beitragen, den geheimen Inhalt dieser Sutras für Zuhörer unverständlich zu machen.
Yang wird jedoch auch praktiziert, um bestimmte tantrische Gottheiten anzurufen und sich mit ihnen zu vereinen.[51] Eine Veröffentlichung des yang- Obertongesangs tibetischer Mönche war Anfang der siebziger Jahre die erste kommerziell vermarktete und breit rezipierte LP mit einer Form zentralasiatischen Obertongesangs in den westlichen Kulturen.
Auch in Südafrika gibt es eine Form von Obertongesang. Bei den Xhosa werden Obertöne ausschließlich aus einem ungewöhnlich tiefen Primärklang herausgefiltert, dessen Erzeugung wahrscheinlich dem des kargyraa ähnelt.[52] Allerdings singen bei den Xhosa nur Frauen und Mädchen mit der dort umngqokolo genannten Technik. Meist wird umngqokolo von mehren Frauen zusammen gesungen. Es existieren wenige musikalische Grundregeln. Die Sängerinnen sind frei, verschiedene Rhythmen und Melodien in eine gemeinsame Improvisation unbestimmter Länge einzuflechten. Andere Sängerinnen können jeder Zeit hinzukommen, Teilnehmer jederzeit ausscheiden. Durch Klatschen wird ein gemeinsames Grundmetrum etabliert. Es wird ausschließlich auf Vokale, d. h. ohne Text gesungen. Meist werden über drei oder vier Grundtönen verschiedene Obertöne zu einer Melodie geformt. Der Obertongesang der Xhosa-Frauen entspricht somit dem unter 2.1 beschriebenen Typ D. Jede der Frauen improvisiert also allein ein zweistimmiges Stück, in dem der Grundton- und der Obertonmelodie eigene musikalische und rhythmische Strukturen zugrunde liegen. Die so entstehende Musik ähnelt sehr der bei den Xhosa verbreiten Mundbogenmusik.[53] Auch bei dieser werden verschiedene Obertöne eines Grundtones mit Hilfe der Resonatoren im Mundraum herausgefiltert und verstärkt.
Die einzige gegenwärtig existierende und eindeutig historisch belegbare Obertongesangstradition in Europa, ist im Kontext der österlichen Liturgie auf Sardinien in Italien aufzufinden. In den vierstimmigen polyphonen[54] Gesängen für die Karwoche wird über bestimmten lang ausgehaltenen Akkorden aus den Obertonspektren der einzelnen Grundtöne eine fünfte Stimme herausgefiltert. Diese Praxis wird auf Sardinien Singen mit Quintina genannt und wird innerhalb bestimmter Bruderschaften oral tradiert. Sie ist historisch bereits für das 17. Jahrhundert eindeutig nachgewiesen.[55]
Die erwähnten Bruderschaften sind Gruppen von Männern verschiedener Berufe, die sich für den Erhalt der sozialen Gemeinschaft und der verschiednen Traditionen ihres Dorfes engagieren.
Sie übernehmen auch die Aufgabe, die in der Liturgie erforderlichen Gesänge der jährlichen religiösen Festivitäten aufzuführen. Der Pastor, unter dessen Leitung die Bruderschaft die erforderlichen Stücke einstudiert, wählt zum Ende der Probenzeit aus allen Mitgliedern der Bruderschaft vier Solisten, welche die österlichen Messen singen. Ein oder zwei Stücke pro Messe werden vom gesamten Chor vorgetragen. Obgleich die Musik der sardischen Liturgie reich an Modulation ist, besteht das Ideal, die jeweils erklingenden Akkorde rein zu intonieren, um einen konsonanten Klang zu erzeugen. Einerseits ist es nur dadurch möglich, die Quintina stark hörbar zu machen, andererseits hilft die gemeinsam erzeugte Quintina den sardischen Sängern dabei, zu dieser reinen Intonation mit Konsonanzwirkung zu finden.[56]
Neben den Chören für religiöse Musik, Coro genannt, finden sich innerhalb sardischer Brüderschaften auch Chöre für weltliche Musik zusammen. Diese werden Tenore genannt. Sie singen maßgeblich auf Festen. Auch der Tenore -Gesang ist polyphon. Dabei sinkt bei manchen Liedern der Bass in das Register des kargyraa ab.[57] Allerdings werden dabei keine Obertöne bewusst herausgefiltert und zu einer Melodie geformt, weshalb man in diesem Falle nicht von Obertongesang sprechen kann.
Die Quintina des Coro ist jedoch eindeutig bewusst und intendiert. Im Zusammenhang mit der Passion Christi der Karwochenliturgie erklingend, hat sie für die Sänger und Zuhören eine mystische Bedeutung. Sie steht auch im übertragenen Sinne für Harmonie und wird, wenn sie ertönt, von den Anhängern der Bruderschaft gewisser Maßen als himmlische Würdigung ihrer Bemühungen empfunden.[58] Daraus lässt sich ableiten, dass die Quintina nicht vollkommen souverän von den Laiensängern der Bruderschaften umgesetzt werden kann. Dennoch ist es aufgrund der eindeutig belegbaren Tradition, der klaren Terminologie und der gegenwärtigen Praxis gerechtfertigt, bezüglich der sardischen Quintina von europäischem Obertongesang zu sprechen.
Die Fähigkeiten der sardischen Sänger, Obertöne herauszufiltern, sind jedoch bei weitem nicht so spektakulär, wie die der zentralasiatischen Obertonsänger. Außerdem ist die sardische Quintina im Vergleich zu den zentralasiatischen Obertongesangsformen wenig bekannt und erforscht. Es ist also unwahrscheinlich, dass die sardische Quintina gemeint ist, wenn bezüglich der Entwicklungen der letzen Jahrzehnte um Obertongesang in Mitteleuropa von Europäischem Obertongesang gesprochen wird.
2.3 Phänomenologie des Obertongesangs in Mitteleuropa
Entsprechend dem derzeitigen Wissenstand wird Obertongesang, abgesehen von der sardischen Obertonmusik, in Mitteleuropa erstmalig zu Beginn der achtziger Jahre praktiziert. Bis in die Gegenwart gewinnt die Beschäftigung damit zunehmend an Publizität und Popularität. Dabei können grob drei Hauptfelder unterschieden werden, in die Obertongesang in Mitteleuropa kontextualisiert wird. Erstens als Erweiterung gesangstechnischer Möglichkeiten in der abendländischen Kunstmusik, zweitens als Mittel spirituellen und gemeinschaftlichen Erlebens bzw. als therapeutisches Werkzeug und drittens als effektvolles musikalisches Mittel rezenter, populärer Weltmusik.
Eine genaue Anzahl von Sängern zu nennen, die in Mitteleuropa Obertongesangstechniken beherrschen oder sich mit Obertonmusik beschäftigen ist sehr schwierig. Das bekannteste deutsche Obertongesangsforum mit Erklärungen über die Technik und Vernetzung vieler Obertongesangslehrer, das seit einigen Jahren im Internet existiert, wird von ca. 2000 Personen am Tag besucht.[59] Dies belegt zumindest ein reges Interesse an Obertongesang in Deutschland.
Es existieren derzeit 17 Chöre in Mitteleuropa, die mit Obertongesangstechniken arbeiten. Jährlich finden mehrere Obertonfestivals statt, auf denen sowohl zentralasiatische als auch europäische Obertonsänger auftreten und zumeist auch Einführungskurse in die Technik geben. Ca. 250 Obertongesangslehrer und Obertonsänger nutzen das genannte Obertongesangsforum als Werbeplattform für ihre Kurse und anderweitigen musikalischen Angebote. Auf dem Weltmusikmarkt sind derzeit 23 Publikation zentralasiatischer Obertonsänger erhältlich,[60] die Veröffentlichungen von Obertonsängern westlicher Kulturen sind ungezählt, übersteigen diese Zahl jedoch bei weitem.[61]
Abgesehen von wenigen, älteren wissenschaftlichen Arbeiten über zentralasiatische Obertongesangstile und der Veröffentlichung einer LP mit tibetischem yang zu Beginn der siebziger Jahre , wird Obertongesang in Mitteleuropa erst Mitte der achtziger Jahre einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In den literarischen Publikationen Michael Vetters und Joachim-Ernst Berendts wird der Praxis des Obertongesangs eine spirituelles Erleben fördernde Wirkung zugeschrieben, was zu einer starken Popularisierung der Technik unter Anhängerkreisen des New Age und neureligiöser Bewegungen führt.
Diese Kontextualisierung und die sich daraus entwickelnden Theorien und Praktiken werden Anfang der neunziger Jahre in Jonathan Goldmans Veröffentlichung Healing Sounds weiter ausformuliert und verbreitet.
In den vergangenen zehn Jahren erscheinen mehrere profunde musikethnologische Arbeiten über zentralasiatischen Obertongesang. Die Publikationen Carol Peggs, Marc van Tongerens und Theodore Levins relativieren die zuvor unter westlichen Obertonsängern weit verbreitete Annahme einer primär religiös oder spirituell begründeten Beschäftigung mit Obertongesang in Zentralasien.
Der Funktionsweise von Obertongesang wird zuerst 1989 in dem Film von Tran Quang Hai und Hugo Zemp nachgegangen. Zehn Jahre später wird durch den Phonetiker Sven Grawunder ein erster Vergleich der Kehlgesangs- Techniken Zentralasiens mit den in den westlichen Kulturen entstandenen Obertongesangstechniken durchgeführt.
In den letzten Jahren erscheinen mehrere Obertongesangslehrbücher, die sich hauptsächlich dem Vermitteln der Filtertechniken widmen. In der Publikation von Wolfgang Saus Oberton singen von 2004 wird der im Westen praktizierte Obertongesang klar von den Kehlgesangs- formen unterschieden und ausdrücklich als Gesangstechnik und ohne Bezug zu außerordentlichen Wirkungen seiner Praxis behandelt.
Dennoch erschienen die meisten musikalischen Publikationen mit Einbezug von Obertongesang westlicher Sänger bislang im Bereich der esoterischen oder meditativen Musik. Dies lässt darauf schließen, dass Obertongesang in Mitteleuropa bislang insbesondere aufgrund der als besonders empfundenen Wirkung rezipiert und praktiziert wird. Die rezenten Entwicklungen im Bereich der Obertonchormusik lassen jedoch auch eine zunehmende Zahl primär an der Technik des Obertongesangs interessierter Sänger und eine zunehmende Applikation dieser Technik im Kontext der okzidentalen Kunstmusik erwarten.
Da es sich offensichtlich beim Obertongesang in Mitteleuropa um ein für den hiesigen, musikalischen Entwicklungsprozess folgenreiches Phänomen handelt, ist es für die Musikwissenschaft unumgänglich, seinen Ursprung zu klären und im Vergleich mit den zentralasiatischen Obertongesangsformen seine Eigenständigkeit zu überprüfen. Des Weiteren ist es notwendig, ein klares Vokabular zu entwickeln, um mit diesen neuen musikalischen Formen differenziert umgehen zu können. Diesen Aufgaben widmet sich die vorliegende Arbeit.
3. Geschichte des Obertongesangs in Mitteleuropa
3.1 Die Bedeutung von Obertönen in der Antike und der frühchristlichen Musik
Im Sinne der Erklärungen b) und c) der Fragestellung unter 1. kann die sich derzeit in Mitteleuropa entwickelnde Obertongesangsmusik als Westlicher Obertongesang bezeichnet werden, wenn sie bezüglich ihrer Technik und/oder ihres Stils als ein Resultat der musikgeschichtlichen Entwicklungen des Abendlandes zu deuten ist. Als Europäischer Obertongesang kann sie benannt werden, wenn sich die Existenz einer Obertongesangstradition in der okzidentalen Musikgeschichte nachweisen lässt, deren Wiederaufnahme als Grundlage der derzeitigen Obertongesangspraxis in Mitteleuropa anzusehen ist. Im Folgenden soll daher nach musikgeschichtlichen Ereignissen gesucht werden, die auf den Umgang mit Obertönen in Mitteleuropa einwirken und auf welche Charakteristika die derzeitigen Obertongesangsformen in Mitteleuropa zurückgeführt werden können.
In der Einleitung zu seiner Geschichte der Musikästhetik schreibt der Autor Enrico Fubini:
„ [ … ] die so genannte abendländische Musiktradition ist im Grunde [ … ] nichts anderes denn die Entwicklung dieser im alten Griechenland entstandenen Denkströmung. Wir können davon ausgehen, dass die Musik des Abendlandes sich weitgehend entlang eines inneren logischen Fadens entwickelt und auf diese Weise eine einigermaßen homogene Tradition darstellt, für die das griechische Denken eine determinierende Rolle spielt.“[62]
Eine Geschichte des Obertongesangs in Mitteleuropa muss daher von den griechisch-antiken Vorstellungen über Musik ausgehen, da diese, wie im Zitat angemerkt, eine weichenstellende Funktion für die okzidentale Kunstmusikgeschichte hat. Ein weiterer Grund, der für dieses Vorgehen spricht, ist die Bezugnahme gegenwärtiger Obertonsänger auf Theorien der griechischen Antike im Kontext einer angenommenen therapeutischen Wirkung[63] von Obertongesang.
Über eine mögliche bewusste Verwendung von Obertönen in der Gesangspraxis der seit über 2000 Jahren verklungenen Musik der griechischen Antike kann nur spekuliert werden, da eine lebendige Tradition dieser Musik nicht existiert. Zwar sind Abhandlungen über den Gebrauch der Stimme im Kontext der Rhetorik erhalten, in denen Singen als Mittel der Stimmausbildung empfohlen wird. Jedoch werden darin keine konkreten Gesangsübungen oder -techniken beschrieben.[64]
Durch die erhaltenen theoretischen Schriften dieser Zeit oder durch Zitate späterer Werke aus ihnen ist jedoch bereits für die griechische Antike die Kenntnis der Partialtöne eines Tones belegt. Einerseits kann das damit verbundene Wissen, wie im Weiteren deutlich werden wird, als eine Voraussetzung der Entwicklung einer Obertongesangstechnik innerhalb der abendländischen Kultur betrachtet werden. Andererseits setzt der Umgang mit den Partialtönen im Kontext der griechischen Antike Maßstäbe für ihre Behandlung in der Frühgeschichte der okzidentalen Kunstmusik. Das griechisch-antike Wissen um Teiltöne und der Umgang damit sollen daher im Folgenden vorgestellt werden.
3.1.1 Die Entdeckung der Teiltöne
Der für die Thematik der Arbeit wichtigste Denker des antiken Griechenlands ist der Philosoph Pythagoras, der ca. im 6 Jahrhundert v. Chr. gelebt haben soll. Ihm wird die Entdeckung der Harmonischen eines Grundtones zugeschrieben. Da jedoch direkt von Pythagoras keine schriftlichen Werke erhalten sind, wird im Weiteren von der Pythagoreischen Schule oder den Pythagoreern die Rede sein.[65]
Erkenntnisse über die Partialtöne einer Grundschwingung und der natürlichen Intervalle erlangte die Pythagoreische Schule durch Saitenteilungsexperimente am Monochord. Bei diesem Instrument wird über einen Resonanzkasten mit Messleiste eine Saite gespannt. Da zwischen Saitenlänge und Schwingungsgeschwindigkeit ein umgekehrt proportionaler Zusammenhang besteht, lassen sich Saitenteilungen direkt in Frequenzen umrechnen.[66] Die Töne, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundtonfrequenz sind, entsprechen den Obertönen des Grundtones. Sie sind Teil der Naturtonreihe,[67] die im Grundton ihren Ausgangspunkt hat. Intervalle, die aus Naturtönen gebildet sind, werden natürliche Intervalle genannt. Sie können durch einfache mathematische Verhältnisse dargestellt werden, die das Schwingungsverhältnis der am Intervall beteiligten Töne bezeichnen.
Die Pythagoreer stellten fest, dass alle in ihrer Musik verwendeten Intervalle auf natürliche Intervalle zurückgeführt werden können, dass also der Musik eine proportionale, mathematische Struktur unterliegt. Außerdem fanden sie heraus, dass Intervalle umso konsonanter empfunden werden,[68] je kleiner die am Schwingungsverhältnis beteiligten Zahlen sind, das sie bezeichneten.
In den Zahlenverhältnissen der musikalischen Intervalle offenbart sich den Anhängern der Pythagoreischen Schule das Sinnbild einer höheren Ordnung. Diese Ordnung bezeichnen die Pythagoreer als harmonia.[69] Sie gilt ihnen als Idealzustand des Kosmos – der Spährenharmonie und der Seele – der Leib-Seelen-Harmonie.[70]
Zwar findet die pythagoreeische harmonia ihren greifbarsten Ausdruck in den natürlichen Intervallen der Teiltöne,[71] doch die Zahlenverhältnisse, die diese Intervalle darstellen, sind den Pythagoreern die wichtigere, da übergeordnete Kategorie. Musik wird im pythagoreeischen Denken also abstrakt aufgefasst. Das wichtige ist, was sie darstellt. Die Partialtöne werden dementsprechend ausschließlich als Sinnbild der harmonia verstanden. Es resultiert daraus keine musikpraktische Orientierung an den natürlichen Intervallen oder eine Verwendung der Naturtonreihe als musikalisches Mittel. Trotz ihres Wissens um die Teiltöne entwickeln die Pythagoreer ein musikalisches Stimmungssystem, die so genannte Pythagoreische Stimmung, das sich nicht an den natürlichen Intervallen orientiert.
Stimmung wird als Fixierung von Tönen eines Musikinstruments hinsichtlich ihrer absoluten und relativen Tonhöhe verstanden. Werden bei einer Stimmung bestimmte Intervalle gezielt abweichend von ihrer natürlichen oder „reinen“ Form eingerichtet, um die Klangqualität anderer Intervalle zu verbessern, spricht man von einer temperierten Stimmung oder Stimmungstemperatur.[72]
Die Pythagoreische Stimmung ergibt sich durch Stimmung der Töne einer Skala mit Hilfe von übereinander geschichteten Quinten. Es werden dabei keine Intervalle gezielt temperiert. Dennoch ergeben sich durch die Stimmvorgabe der reinen Quinten z. B. unreine Terzen.[73] Dies wurde von den Pythagoreern toleriert, da das griechisch-antike Musikempfinden nur Oktaven und Quinten als vollkommen konsonant wertete. Obwohl bereits im vierten Jahrhundert v. Chr. Aristoxenes von Tarent die generelle Orientierung an natürlichen Intervallen vorschlägt,[74] wird darauf aufgrund der Einheitlichkeit der Intervallberechnung mit Hilfe von Quinten in der Musikpraxis verzichtet.[75]
Musiktheoretische Erwägungen und mathematische Eleganz wiegen also in der griechischen Antike schwerer als Argumente, die im Klangempfinden von Musik begründet sind. Diese Gewichtung hat Vorbildcharakter für viele Entwicklungen in der okzidentalen Kunstmusikgeschichte.
Obwohl die Pythagoreer Musik als wichtigen Teil ihrer Philosophie behandeln, schaffen sie durch die Unterordnung dieser unter die Mathematik und Philosophie eine Distanz von Musikern und Musiktheoretikern bzw. von Musik und Musikwissenschaft. Diese wird durch spätere Philosophen der griechischen Antike weiter vergrößert und führt zu einer Geringschätzung der Musikpraxis durch die Musiktheoretiker.[76] Da sich die mittelalterlichen Musiktheoretiker stark an den überlieferten musikbezogenen Ideen und Konzepten der Antike orientieren, wird diese bis ins späte Mittelalter tradiert.
Die Existenz einer Form des Obertongesangs in der griechischen Antike nach Pythagoras ist unwahrscheinlich. Erstens wird im Zusammenhang mit den Erläuterungen über die Partialtöne weder erwähnt, dass diese Harmonischen immer mitschwingen, noch dass sie auch im Gesang vorhanden sind. Zweitens führt die Praxis der Intervallstimmung über reine Quinten zu einer Temperierung der Musik, die eine Begleitung mit den nur natürlich zu intonierenden Obertönen aufgrund von Unsauberkeit ausschließt. Obgleich also bereits in der griechischen Antike ein Wissen über Obertöne existiert, wirkt der Umgang mit diesem dem Entstehen einer Form des Obertonsingens entgegen.
3.1.2 Die Annahme einer europäischen Obertonsangstradition im Mittelalter
Die einzigen derzeitig verfügbaren Informationen über Musik im abendländischen Mittelalter stammen aus dem Kontext des frühen Christentums. Da sich dessen Musiktheoretiker stark an den Denkern der griechischen Antike orientieren, wird die Distanz von Musiktheorie und Musikpraxis auch in den frühen christlichen Quellen gewahrt. Wie in der Antike, sehen sich die Musiktheoretiker im Mittelalter als die eigentlichen Musiker an und beschäftigen sich mehr mit der Symbolik und dem Sinn von Musik als mit die Musikpraxis betreffenden Fragen.
„Es besteht ein großer Unterschied zwischen Kantoren und Musikern; die ersteren singen, die letzteren wissen, woraus Musik besteht. Wer jedoch ausübt, wovon er nichts versteht, muss als Tier bezeichnet werden.“[77]
Informationen über Gesangsformen sind dementsprechend selten überliefert.
Es existieren einige Abhandlungen über die richtige Stimmgebung für die Umsetzung der Liturgie. Diese Beschreibungen der so genannten vox perfecta orientieren sich maßgeblich am antiken Stimmideal der Rhetorik, das eine klare und helle Stimme fordert. Zumeist werden darin drei Stimmlagen unterschieden – Brust-, Kehl- und Kopfstimme. Von einem Obertonregister ist nicht die Rede. Für den Choralgesang, auf den sich die meisten Zeugnisse beziehen, wird das Singen in mittlerer Tonlage gefordert – mediocriter cantare. Extreme Lagen werden negativ bewertet, da sie der Süße – suavitas Abbruch täten.[78]
Trotz näherer Ausarbeitung des antiken Stimmideals kann aus den frühchristlichen Abhandlungen über die vox perfecta wenig über die Gesangspraxis oder -didaktik dieser Zeit geschlossen werden. Eine Tradition europäischen Obertongesangs im Mittelalter belegen zu können, scheint daher aussichtslos.
Trotzdem wird unter westlichen Obertonsängern die Meinung vertreten, dass zumindest in der Gregorianik eine solche Tradition bereits bestanden habe.
„Im Grunde war ja Gregorianischer Choral Obertongesang.“[79]
„In Europa blühte der Obertongesang wahrscheinlich bis zum Aufkommen der Polyphonie und verschwand schließlich mit dem Siegeszug der Mehrstimmigkeit im 16. Jahrhundert.“[80]
„Obwohl die Kirche Musik als sinnliches Vergnügen ablehnte, hat die Schönheit des gregorianischen Gesangs mit seinen hörbaren Obertönen jahrhundertelang die Kathedralen erfüllt. Der gregorianische Gesang war zunächst einstimmig; alle Mönche sangen dieselbe Melodie mit verlängerten Vokalen. Dies wurde als „Cantus planus“ bezeichnet. Die verlängerten Vokale erzeugten Obertöne, die wie eine die Mönche begleitende Geisterstimme klangen. Im 8. und 9. Jahrhundert wurden die Obertöne in mehreren Klöstern sehr viel bewußter angestrebt, als das heute beim Singen gregorianischer Choräle der Fall ist.“[81]
Meist räumen Obertonsänger, die diese Meinung vertreten, ein, dass diese These nur durch Indizienbeweise belegt werden könne. In diesem Zusammenhang wird oft die besondere Akustik christlicher Kathedralen und Kirchen erwähnt.
„Die geometrischen Proportionen der Kirchen waren sowohl auf den tellurischen Energiefluß des Standortes als auch auf die akustische Entfaltung der Gesänge und Gebete ausgerichtet. Wer an diesen besonderen Punkten alter Kathedralen oder Klosterkirchen singt, wird sogar ohne Verwendung komplizierter Techniken sich übereinander auftürmende Obertonkuppeln erzeugen, die den gesamten Kirchenraum erfassen.“[82]
Der Autor kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass in halligen Räumen Obertöne auch unbeabsichtigt verstärkt werden können.
Durch diffuse Reflektion z. B. in großen Kirchengewölben überlagern sich die Echoeffekte einer Ausgangsschallquelle und erzeugen einen kontinuierlichen Nachhall. Da die Obertöne eines Grundtones verschiedene Wellenlängen haben, hallen sie auch in verschiedener Weise nach. Es kann somit zum zufälligen Herausfiltern einzelner Obertöne durch die besondere Raumakustik von Kathedralen und Kirchen kommen. Es kann sich dabei jedoch auch um Differenz- oder Kombinationstoneffekte handeln, die bei solcher Art stehender Klänge auch auftreten.
Im Mittelalter wurden allerdings die überakustischen Verhältnisse der großen Kirchen und Kathedralen, welche die beschriebenen Klangeffekte verursachen, nach antikem Vorbild durch Vasen, Vorhänge oder Teppiche bewusst gedämpft und dadurch transparenter gemacht.[83] Das Argument der halligen Raumakustik ist daher nicht uneingeschränkt treffend. Es kann außerdem in keiner Weise eine Obertongesangstradition frühchristlicher Musik belegen, da dafür der bewusste Umgang mit Obertönen nachgewiesen werden müsste.
Ein weiters Indiz, das für eine europäische Obertongesangstradition im Mittelalter angeführt wird, ist die starke Verwendung von Melismen auf Vokalklängen im Gregorianischen Choral.
„Obertöne entwickeln sich auf Vokalen, und gerade die in langen Melismen die Vokale dehnenden, ihnen nachhorchenden und nachspürenden Ton-Linien des alten Kirchengesangs müssen – bei entsprechendem Bewusstsein – die Obertöne fast von allein zum Klingen gebracht haben.“[84]
Wie bei dem Raumakustik-Argument wird auch hierbei das Automatische, Unintendierte des Obertonfilterns hervorgehoben – in diesem Falle bedingt durch Melismen auf Vokalklängen in Gregorianischen Chorälen. Auch die Melismen auf Vokalklängen können somit keine Obertongesangstradition belegen.
Allein die Bezeichnung cantus planus für den einstimmigen, Gregorianischen Choral spricht gegen eine intendierte Zweistimmigkeit von Grundstimme und einer als eigenständig wahrgenommenen Stimme im Obertonbereich. Ein weiteres Argument gegen einen „Gregorianischen Obertongesang“ ist die Verwendung der Pythagoreeischen Stimmung in der christlichen Musik bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.[85] Eine Obertonmelodie gesungen zu einem pythagoreeisch intoniertem Choral würde aufgrund ihrer tonalen Reinheit unsauber klingen.
Seit Mitte der siebziger Jahre experimentiert Iegor Reznikoff, Professor an der Universität Paris, auf musikpraktische Weise mit Obertongesang im Kontext frühchristlicher Musik und hat damit weltweite Beachtung gefunden.[86] Er hat jedoch selbst nach Jahrzehnte währender historischer Forschungsarbeit keine sicheren Hinweise dafür gefunden, dass in der Gregorianik oder in älterer europäischer Musik Obertongesang praktiziert wurde.[87]
3.1.3 Boethianische Gesänge
Einen Beleg für die Verwendung von Obertongesangstechniken in mittelalterlicher Musik im Abendland meint die so genannte Gesellschaft für Gregorianikforschung gefunden zu haben. Aus ihren Forschungen ergibt sich, dass der Gregorianische Choral auf Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius zurückzuführen sei. Boethius habe von 480-546 in Italien gelebt. Er ist nach Angaben der Gesellschaft für Gregorianikforschung der Schöpfer der Boethianischen Gesänge, aus denen im Späteren der Gregorianische Choral geformt worden sei. Hinsichtlich der Form der Boethianischen Gesänge stellt die Gesellschaft für Gregorianikforschung fest:
„Bei den boethianischen Gesängen handelt es sich nicht um eine reine Vokaltradition. Zwar stand der Gesang im Vordergrund, aber dazu erklang damals eine Instrumentalbegleitung und wahrscheinlich ein Bordun. Dadurch, dass die Gesänge zusammen von Männern, Frauen und Kindern gesungen wurden, waren sie von vornherein reicher im Klangspektrum. Boethius hat die Melodien in Laufe seiner Forschung immer weiter auf Mehrstimmigkeit hin konzipiert. Der Zusammenklang bestimmter Harmonien, wurde ein immer wichtigerer Faktor, dazu gehörte auch die Praxis des Obertonsingens.“[88]
Als Beleg für die angenommene Praxis des Obertongesangs in diesen Gesängen führt die Gesellschaft für Gregorianikforschung die Verwendung bestimmter Neumen in der schriftlichen Fixierung der Gesänge an. Das Quilisma stellt ihren Untersuchungen zufolge keine Angabe zur Vortragsweise dar, sondern ist ein Wiederholungszeichen, das zum Einsatz von Obertongesangstechnik auffordert.[89]
Die Bedeutung des Quilismas kann von der historischen Musikwissenschaft tatsächlich nicht klar bestimmt werden.[90] Vermutungen über seine Bedeutung weisen auch in älteren Publikationen auf die dargestellte Interpretationsweise der Gesellschaft für Gregorianikforschung hin.
„Dass nämlich das Quilisma ursprünglich nicht Tonhöhenzeichen sondern Vortragszeichen gewesen sein könnte, [ … {es}] böte sich hier aus der damaligen Gesangspraxis, die heute noch bei außereuropäischen Musikkulturen wahrnehmbar ist, die Deutung des Quilisma als kehlig-nasalen Umschlagton an, als Zeichen also, das erst mit der ausschließlichen Benutzung des Brust- und Kopfregisters der menschlichen Stimme bedeutungslos wurde.“[91]
Gegen die Annahmen der Gesellschaft für Gregorianikforschung spricht die Tatsache, dass Boethius’ Ansichten über Musiker den Urteilen der griechischen Antike entsprechen.
„Denn es ist bedeutend wichtiger und erhabener, das zu wissen, was jeder praktische Künstler tut, als selbst es zu machen. […] Um wie viel vortrefflicher ist also die Kenntnis der Musik in Bezug auf die Erkenntnis der Wissenschaft, als in Bezug auf die praktische Ausübung.“[92]
Es erscheint unglaubwürdig, dass ein Musiktheoretiker, der diese Meinung vertritt „mystisch-spirituelle Gesänge mit tief religiösem Inhalt, [deren Ziel] die Überwindung menschlicher Grenzen und das Einswerden mit der göttlichen Schöpfung waren“[93] verfasst haben soll. Schon Guido von Arezzo schreibt über Boethius, dass „dessen Bücher nur den Philosophen nützlich sind und nicht den Kantoren.“[94] Es scheint daher unwahrscheinlich, dass Boethius viel Zeit mit Komponieren und Singen und der Ausarbeitung einer besonderen Gesangspraxis, wie dem Obertonsingen zugebracht haben soll, zumal er sich auch selbst nicht konkret darüber äußert.
Die Gesellschaft für Gregorianikforschung hat bislang eine Publikation herausgegeben. Sie organisierte 2000 und 2002 zwei Festivals,[95] auf denen Rekonstruktionen der
angenommenen Boethianischen Gesänge im Konzert vorgestellt wurden. Lokalzeitungen berichteten darüber. Seitdem ist die Webseite nicht aktualisiert worden, was darauf schließen lässt, dass die Arbeit der Gesellschaft für Gregorianikforschung derzeit nicht fortgeführt wird.
Eine ernsthafte Behandlung ihrer Thesen durch Vertreter der historischen Musikwissenschaft hat nicht stattgefunden. Angesichts dessen und der dargestellten Eigenaussagen von Boethius, die zumindest hinsichtlich der Einschätzung seiner Person gegen die Annahmen der Gesellschaft für Gregorianikforschung sprechen, können deren Ergebnisse nicht als gesichert gelten. Sie können somit nicht als Beleg einer Obertongesangstradition im Mittelalter gewertet werden.
3.1.4 Ein Einzelfall
Auf die Bekanntheit von Obertongesangstechniken in der Frühzeit unserer Kunstmusik weist bislang konkret nur eine Quelle aus dem 15. Jahrhundert hin. Johannes Tinctoris, ein neapolitanischer Hofkantor, beschreibt Ende des 15. Jahrhunderts wie
„Gerhard der Brabanter, mein Landsmann am Hof des Herzogs von Burgund, unter dem rechten Porticus der berühmten Kirche zu Chartres vor meinen gegenwärtigen Augen und Ohren den Sopranpart zugleich mit dem Tenor – nicht etwa die Töne abwechselnd – auf das Vollkommenste sang.“[96]
Das beschriebene Hörerlebnis kann dadurch erklärt werden, dass der erwähnte Sänger über eine Obertongesangstechnik verfügt. Er müsste sie sogar meisterlich beherrscht haben, um die beschriebene zweistimmige Polyphonie umsetzen zu können. Das Zitat kann daher als Hinweis für eine Obertongesangstradition im Mittelalter gewertet werden. Denn es wäre zumindest ungewöhnlich, wenn der Sänger die beschriebene Fähigkeit ohne jegliches Vorbild entwickelt hätte.
Der bereits erwähnte Iegor Reznikoff fand bei seinen Forschungen heraus, dass das Repertoire der großen Graduale zumeist für den solistischen Vortrag eines Cantors oder eines Meistersängers ausgelegt war.[97] Die beschriebenen Obertongesangsfähigkeiten Brabanters könnten also auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Technik zumindest unter den professionellen Sängern dieser Zeit tradiert wurde.
Die Verwunderung, die aus Tinctoris’ Kommentar deutlich wird, weist allerdings auf die Kuriosität des Erlebten hin. D. h. dass aufgrund dieses Zitates geschlossen werden kann, dass im ausgehenden Mittelalter Obertongesang keine Alltäglichkeit war. Demnach lässt sich aus diesem Einzelbeleg weder eine bestehende noch eine erloschene Obertongesangstradition begründet ableiten. Die von Tinctoris beschriebenen Fähigkeiten Brabanters müssen somit als Einzelfall gewertet werden.[98]
Bedingt durch die Entwicklung der Polyphonie und des Kontrapunktes zu Beginn des letzten Jahrtausends, beginnt sich das Verhältnis der Musiktheoretiker zur praktischen Musik zu verändern. Die neuen musikalischen Formen verlangen insbesondere in den Bereichen der Rhythmik und der Notierung nach einer musiktheoretischen Behandlung.[99]
Die Distanz der Musiktheorie und der Musikpraxis wird durch Hinwendung der Theoretiker zu Fragen der Komposition und deren Umsetzung überwunden. Entsprechend existieren seit dieser Zeit in zunehmendem Maße musiktheoretische Abhandlungen, die Fragen der Musikpraxis und der Musikdidaktik behandeln. Wäre zu dieser Zeit eine Technik des Obertongesangs bekannt gewesen, hätte sie daher sicherlich musiktheoretische Behandlung gefunden. Außerdem wäre sie vermutlich auch musikpraktisch innerhalb der neu entstehenden Polyphonie verwendet worden.[100] Die Nichtexistenz von Referenzen[101] hinsichtlich einer Form von Obertongesang seit der anwachsenden literarischen Behandlung der Musikpraxis ist als Beleg zu werten, dass Obertongesangstechniken in der Zeit nach dem ausgehenden Mittelalter nicht bekannt waren und nicht verwendet wurden. Daraus folgt, dass es bis zu ihrer Entwicklung im Rahmen der Seriellen Musik in den letzten fünf Jahrhunderten keinen Obertongesang im kunstmusikalischen Kontext Mitteleuropas gegeben hat.
3.1.5 Gregorianischer Obertongesang als nachträglich erfundene Tradition
Aufgrund der derzeit bekannten wenigen, nur vagen Hinweise für eine Obertongesangstradition in der frühchristlichen Musik und der genannten Gegenargumente ist es unwissenschaftlich, die Existenz einer solchen Tradition anzuerkennen.
Es stellen sich somit die Fragen: Warum ist der Glaube an eine europäische Obertongesangstradition im Mittelalter unter Obertonsängern verbreitet? Warum wird, selbst im Wissen, dies nicht belegen zu können,[102] daran festgehalten?
Eine Antwort auf beide Fragen lässt sich möglicherweise durch die Anwendung der Theorie der Invented Tradition – der nachträglichen Erfindung von Tradition – auf diese Thematik erhalten. Diese Theorie wurde von den Geschichtswissenschaftlern Eric Hobsbawn und Terence Ranger in den achtziger Jahren aufgestellt.[103] Sie bezieht sich auf gegenwärtige soziale Gruppen, die sich eine traditionsreiche Vergangenheit konstruieren, um ihren gesellschaftlichen Status zu erhöhen oder zu festigen. Diese Art erfundene Vergangenheit wird Invented Tradition genannt. Sie wird konstruiert, um eine neu entstandene kollektive Identität nachträglich geschichtlich zu begründen und inhaltliche bzw. soziale Charakteristika zu rechtfertigen.
Die Praxis von Obertongesang verbreitet sich in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa.[104] Das Interesse von Seiten professioneller Musiker daran, sowohl von Sängern als auch von Komponisten, ist jedoch vergleichsweise gering.[105] Der Rückbezug dieser Technik auf die Gregorianik durch verschiedene Obertonsänger kann als Invented Tradition verstanden werden, wenn dadurch versucht wird, Obertongesang als Form europäischer Kunstmusik zu etablieren. Für diese Interpretation gibt es jedoch bislang keine Anhaltspunkte.
Ein anderer Grund, Obertongesang auf die frühchristliche Choralmusik zurückzuführen, ist die spirituell erhebende Wirkung, die dem Obertongesang von vielen Sängern zugeschrieben wird.[106]
„Ich kann es nicht anders spezifizieren. Es ist etwas Spirituelles in dem Klang.“[107]
„Und dann einfach die Leute merken, dass da einfach was Besonderes drin ist in dieser Musik. Das sie einfach als Seele angesprochen werden, über das Herz.“[108]
„Der stetige, über längere Zeit gleichbleibende Grundton beim Obertongesang führt in die Tiefe, hinter die Oberfläche der Melodie, die nach außen statt nach innen weist. Die Obertöne entfalten ihre ganze Schönheit und Macht in der Stille des eigenen Innenraumes, beim Sänger wie auch beim Zuhörer. Lenkt die Veränderung des Grundtones, die Melodie, die Aufmerksamkeit nach außen, an die Oberfläche, so führen der Klang, die Obertöne, zur inneren Wahrnehmung, zur Meditation.“[109]
Im Sinne der Invented Tradition könnte die Zurückführung dieser Gesangstechnik auf die Sakralmusik des Christentums und anderer Religionen die Legitimation des Anspruchs auf die besondere Wirksamkeit des Obertongesangs bezwecken. Diese Interpretation kann mit charakteristischen Aussagen von Obertonsängern belegt werden.
„Die verschiedenen Techniken des Obertongesanges sind jedoch nicht nur auf wenige ostasiatische Kulturkreise beschränkt. Der Obertongesang ist vielmehr eine alte heilige Gesangskunst, die einst in wahrscheinlich allen Kulturen und Religionen verwurzelt war – auch hier bei uns in Europa.“[110]
„Die Obertöne aller musikalischen Klänge reichen von der physischen in die spirituelle Welt. [ … ] die Absicht der Musik bei einem Gottesdienst besteht immer darin, durch eine Reihe von Obertönen die Schwingungsfrequenz der Gemeinde auf eine spirituelle Ebene zu heben.“[111]
Dabei wird die Bedeutung der eigenen Kultur für die gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich der Obertonmusik in den westlichen Kulturen besonders hervorgehoben:
„In einer Zeit des Umbruchs und tiefgreifenden Paradigmenwechsels ist es vielleicht mehr die unbewußte Erinnerung westlicher Sänger, die uns eine schon vergessene Welt des Klanges wieder eröffnet, als eine reine Nachahmung ethnischer Musik.“[112]
Solange keine eindeutigen Beweise für die Verwendung von Obertongesang im Kontext der Gregorianik gefunden werden, kann der Rückbezug der europäischen Obertongesangspraxis auf diese Form frühchristlicher Sakralmusik nur als nachträgliche Erfindung von Tradition verstanden werden, um seine spirituelle Wirksamkeit hervorzuheben.
Wenn die Tradition europäischen Obertongesangs in der Gregorianik als Invented Tradition verstanden werden muss, kann demzufolge nicht von einem Europäischem Obertongesang gesprochen werden. Wie erörtert, kann dieser Begriff nicht begründet durch Wiederbelebung eines alten europäischen Obertongesangsstils definiert werden. Erklärung a) der Fragestellung unter 1. muss demnach als unwissenschaftlich negiert werden.
3.2 Beiträge der abendländischen Kunstmusikgeschichte zur Entwicklung einer Obertongesangstechnik
Es bleibt zu untersuchen, ob der Begriff Westlicher Obertongesang eine sinnvolle Abgrenzung zu zentralasiatischen Formen von Obertongesang darstellt. Wie unter Punkt 1. der Arbeit formuliert, ist die Verwendung dieses Begriffes als musikwissenschaftlicher Terminus dann berechtigt, wenn technische und/oder stilistische Merkmale der in den westlichen Kulturen praktizierten Obertonmusik auf Charakteristika der okzidentalen bzw. westlichen Kunstmusik zurückführen sind.
Im Rahmen der Arbeit dient der Begriff Kunstmusik als Unterscheidung zu volksmusikalischen Traditionen, über deren Bezug zu und Umgang mit Obertönen in der Geschichte nur spekuliert werden kann. Im Gegensatz zur Volksmusik, die hauptsächlich auf das Weitergeben von Bestehendem ausgerichtet ist, zeichnet sich die abendländische Kunstmusik aus, durch die „stets weiterfortschreitende Loslösung vom Brauchtum zum bewusst geschaffenen Kunstwerk, zum opus perfectum et absolutum im Sinne einer rationalen Bewältigung immer neuer Bereiche des Tonmaterials.“[113] Dieses Streben nach Neuem und das darin innewohnende Bemühen nach bewusster und gezielter Kreation von Musik, das im angeführten Zitat des Musikwissenschaftlers Kurt von Fischer als Besonderheit der abendländischen Kunstmusik herausgestellt wird, führt im Verlauf der Musikgeschichte auch zu kompositorischen Vorgaben auf der Ebene von Klangfarbe.
Im Bereich der Vokalmusik wird dadurch die Entwicklung einer Gesangstechnik bewirkt, mit der auch Obertongesang realisiert werden kann und im Weiteren auch wird. Die Obertongesangstechnik, die in den siebziger Jahren im Westen erfunden wird, ist also durch bestimmte Entwicklungen der okzidentalen Kunstmusikgeschichte bedingt. Im Folgenden sollen daher diejenigen historischen Entwicklungen und Praktiken der abendländischen Kunstmusikgeschichte behandelt werden, die zur Entwicklung einer Obertongesangstechnik beitragen und somit als Vorgeschichte der Praxis von Obertongesang im Westen angesehen werden können.
[...]
[1] Vgl. Pegg, Carole, Mongolian Conzeptualisations of Overtone Singing, in: British Journal of Ethnomusicology, Ausg. 1, British Forum for Ethnomusicology, 1992, S. 31-54, S. 31.
[2] Siehe Kapitel 2.2.
[3] Siehe Kapitel 2.3.
[4] Siehe Kapitel 4.
[5] Bezeichnung wurde nach Angaben Goesta Petersons (Siehe Interview mit Goesta Peterson, S. 114) auch von einer mongolischen Musikgruppe benutzt.
[6] Vgl. Saus, Wolfgang, Oberton singen, Traumzeit-Verlag, Schönau im Odenwald 2004, S. 64.
[7] „Westen“ wird im Rahmen der Arbeit als Synonym für westliche Kulturen verwendet.
[8] Vgl. Riccabona, Markus, www.oberton.at/53875098340a29103/53875098340cadb1a/index.html, besucht am 20.9.2006. Der Artikel erschien erstmals unter dem Titel: Viele Stimme aus einer Kehle, in: Kunstpunkt, Zeitschrift der Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien Juni 2000.
[9] Vgl. Saus, S. 66.
[10] Vgl. Berendt, Joachim-Ernst, Das dritte Ohr, Rowohlt, Hamburg 1985, S. 299.
* Dies ist im Rahmen des Verlags der Arbeit als E-Book oder Buch durch GRIN nicht möglich. Desweiteren liegen die Rechte an bestimmten Aufnahmen nicht beim Autor. Die meisten Tonbeispiele sind jedoch als freie Samples im Internet verfügbar. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Lokalisierungsangaben der Liste der Tonbeispiele auf Seite 151.
[11] Es ist mit elektrotechnischen Mitteln möglich einen Ton zu erzeugen, der keine Obertonschwingungen aufweist. Ein solcher Ton wird Sinuston genannt, da er mit Hilfe einer Sinusfunktion abgebildet werden kann.
[12] Dies trifft für die menschliche Stimme, Chordophone und Aerophone zu. Bei Idiophonen können aufgrund der Sprödigkeit des schwingenden Materials unharmonisch mitschwingende Obertöne entstehen, d. h. dass diese Obertöne nicht in ganzzahligem Verhältnis zum Grundton stehen. Auf unharmonische Obertöne kann im Rahmen der Arbeit nicht eingegangen werden.
[13] Vgl. Stumpf, Carl, Die Sprachlaute. Nebst einem Anhang über Instrumentalklänge, Springer, Berlin 1926, S. 374. Vgl. außerdem:. Deutsch, Werner A.; Rösing, Helmut; Fördermayr, Franz, Klangfarbe, in: MGG, Sachteil Bd. 5, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 1995, Sp. 139.
[14] Sygyt Software, Overtone Analyser.
[15] Vgl. Wolfgang Saus: „Workshop – Grundlagenlehrgang Obertongesang“, S. 132.
[16] Vgl.Saus, S. 22.
[17] Vgl. Deutsch; Rösing; Fördermayr, Sp. 147.
[18] Sygyt Software, Overtone Analyser.
[19] Vgl. Sundberg, Johan, The Acoustics of the singing voice, in: Scientific American, Ausg. 236, S. 82-91, 1977, S. 84.
[20] Vgl. Interview mit Steffen Schreyer, S. 117.
[21] Vgl. Seidner, Wolfram; Seedorf Thomas, Singen, in: MGG, Sachteil Bd.8, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 1998, Sp. 1424.
[22] Vgl. Saus, S. 22.
[23] Beides wird im Zusammenhang mit den verschiedenen Techniken des Obertonsingens näher erläutert.
[24] Vgl. Saus, S. 106.
[25] Bei Frauen sind es aufgrund der höheren Stimmlage weniger.
[26] Vgl. Grawunder, Sven, Obertongesang versus Kehlkopfgesang, Diplomarbeit im Fach Phonetik, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1999, S. 55.
[27] Vgl. van Tongeren, S. 31.
[28] Sygyt Software, Overtone Analyser.
[29] Vgl. van Tongeren, Part Two: East.
[30] Vgl. Pegg, S. 32.
[31] Vgl. van Tongeren, S. 146.
[32] Vgl. Tran Quang Hai; Zemp, Hugo, Film: Le chant des harmoniques, Co-Produktion der CNRS Audiovisuell, der French Society of Ethnomusicology und des Ministry of Culture and Communication, 1989. Die Information wurde durch den Dhrupad-Sänger Ashish Sankrityayan bestätigt (Workshop FU-Berlin, WS 05/06).
[33] Der Name der autonomen Republik Tuva ist identisch mit der Bezeichnung der Ethnie, die hautsächlich dort und als Minderheit auch in den angrenzenden Ländern beheimatet ist.
[34] Vgl. Wolfgang Saus: „Workshop – Grundlagenlehrgang Obertongesang“, S. 133.
[35] Vgl. van Tongeren, S. 56.
[36] Vgl. van Tongeren, S. 31.
[37] Der Lebensraum der Tuva ist nicht auf den Staat Tuva beschränkt. Viele Tuva wohnen in der Mongolei oder in anderen Gebieten des Altaigebirges.
[38] Vgl. Hosoo, Ansprache des mongolischen Obertonsängers Hosoo bei einem Konzert, S. 119.
[39] Im Westen gastierende Obertonsänger dieser Regionen verwenden sowohl khöömei bzw. khöömii, als auch die Begriffe Kehlgesang und Obertongesang für ihre Gesangskunst. Vgl. Hosoo: „Kehlkopf-Gesangs-Workshop“, S. 120.
[40] Vgl. van Tongeren, S. 64-66. Aksenov (vgl. Tuvinskaja Narodnaja Musyka, Musyka Moskva, Moskau 1964) nennt in seiner Abhandlung über die Volksmusik der Tuva, die auf Forschungen in den vierziger und fünfziger Jahren basiert, vier grundlegende Stile: sygyt, kargyraa, borbannadyr und ezenggileer. Van Tongeren weist darauf hin, dass sich die Volksmusik der Tuva in den bis zu seiner Forschung vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben muss. Van Tongerens Unterteilung entspricht den Ergebnissen seiner Forschung.
[41] Vgl. van Tongeren, S. 56 f.
[42] Vgl. Pegg, S. 51.
[43] Vgl. Levin, Theodore; Süzükei, Valentina, Where rivers and mountains sing, Indiana University Press, Bloomington 2006, S. 26 ff.
[44] Vgl. Hosoo: „Kehlkopf-Gesangs-Workshop“, S. 126 f.
[45] Die ersten dieser Gruppen sind bereits Ende der sechziger Jahre entstanden. Vgl. van Tongeren, S. 86 f.
[46] Zu den Folgen des Erfolgs verschiedener zentralasiatischer Obertongesangsgruppen siehe auch Kapitel 5.
[47] Vgl. van Tongeren, S. 149.
[48] Vgl. Smith, Husten; Stevens, Kenneth N., Unique Vocal Abilities of Certain Tibetan Lamas, in: American Anthropologist, Ausg. 69, 1967, S. 209.
[49] Vgl. van Tongeren, S. 32 und S. 145 f.
[50] Vgl. Goldman, Jonathan, Heilende Klänge – Die Macht der Obertöne, Knaur, München 1994, S. 93.
[51] Vgl. Goldmann, S. 94.
[52] Vgl. van Tongeren, S. 158.
[53] Vgl. ebd.
[54] Zwei Stimmen gehen allerdings immer parallel, so dass man eigentlich nur von einer dreistimmigen Polyphonie sprechen kann.
[55] Vgl. van Tongeren, S. 157.
[56] Vgl. Lortat-Jacob, Bernard, Sardinia, Polyphony for Holy week, Booklet, CNRS, Musee de l`Homme, 1992.
[57] Vgl. van Tongeren, S. 156.
[58] Vgl. ebd.
[59] Vgl. Emailinterview mit Wolfgang Saus, S. 137. Vgl. außerdem: www.oberton.org.
[60] Vgl. Levin; Süzükei, S. 43.
[61] Van Tongeren (S. 276 ff.) führt eine Auswahl von über 40 Publikationen an.
[62] Fubini, Enrico, Geschichte der Musikästhetik, Metzler, Weimar 1997, S. 4.
[63] Vgl. Goldman, S. 47 ff. Siehe auch Kapitel 4.
[64] Vgl. Seidner; Seedorf, Sp. 1432 f. und Sp. 1444 f.
[65] Vgl. Fubini, S. 16.
[66] Vgl. Auenhagen, Wolfgang, Stimmung und Temperatur, in: MGG, Sachteil Bd.8, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 1998, Sp. 1832.
[67] Siehe Kapitel 2.1 Abbildung 4.
[68] Als vollkommen konsonant galten den Pythagoreern ausschließlich Oktave 1/1 und Quinte 2/3.
[69] Die harmonia wird schon vor den Pythagoreern, vor allem in der griechischen Mythologie behandelt. Erst bei den Pythagoreern wird sie mit einer Zahlengesetztlichkeit verbunden.
[70] Vgl. von Naredi-Rainer, Paul, Harmonie, in: MGG, Sachteil Bd. 4, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 1996, Sp.117 f.
[71] Vgl. Diels, Hermann; Kranz, Walter (Hg.), Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1956, 44B10.
[72] Vgl. Auenhagen, Sp. 1831 f.
[73] Diese werden auch pythagoreeische Terzen genannt. Sie sind um ein syntonisches Komma also ca. 21,5 Cent höher als reine große Terzen.
[74] Vgl. Stephani, Hermann, Zur Psychologie des musikalischen Hörens, Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1956, S. 4.
[75] Vgl. Auenhagen, S. 1833.
[76] Bereits bei Platon gilt Musik ausschließlich als Quelle der Vergnügung, die nur unter Vorsicht eingesetzt werden sollte. Im Gegensatz dazu wird die Wissenschaft von Musik mit der sophia – der Weisheit gleichgesetzt. Bei Aristoteles wird der Musikgenuss zwar positiv bewertet, doch das Musizieren als „knechtische“ Tätigkeit verworfen.
[77] Guido von Arezzo, zitiert in Fubini, S. 67.
[78] Vgl. Seidner; Seedorf, Sp. 1445 f.
[79] Interview mit Matthias Privler, S. 106.
[80] Riccabona.
[81] Goldman, S. 74 f.
[82] Riccabona.
[83] Vgl. Baumann, Dorothea, Musical Acoustics in the Middle Ages, in: Early Music, Ausg. 18, 1989, S. 199-210.
[84] Berendt, S. 299.
[85] Vgl. Auenhagen, Sp. 1833. Hermann Stephani geht davon aus (S. 3), dass die „schärferen“ Intervalle der pythagoreischen Stimmung sich besser für die Unterscheidung der in der mittelalterlichen Kirchenmusik gebräuchlichen Modi eigneten und deshalb verwendet wurden.
[86] Vgl. www.ecoledelouange.free.fr, besucht am 24. 9. 2006.
[87] Vgl. Saus, S. 62.
[88] Vgl. www.gregorianik-forschung.de/forschungsergebnisse.htm, besucht am 13. 9. 2006.
[89] Ebd.
[90] Vgl. Tack, Franz, Der Gregorianische Choral, Arno Volk Verlag, Köln 1960, S. 9.
[91] Tack, 1960, S. 9.
[92] Boethius, Manlius Torquatus Severinus, Fünf Bücher über die Musik, Leipzig 1872, S. 37.
[93] www.gregorianik-forschung.de/forschungsergebnisse.htm
[94] Arezzo, Guido von, Epistola ad Michaelem de ignoto cantu, in: Gerbert, Martin, Scriptores ecclesiastici de musica sacra notissimi, 3 Bde., St. Blaise 1784, Bd. II, S. 25.
[95] Un-erhörte Begegnungen: Die Gesänge des Boethius und Papst Gregors im Spiegel des Obertongesangs.
[96] Johannes Tinctorius, De inventione et usu musicae, in: Saus, S. 63.
[97] Vgl. www.ecoledelouange.free.fr.
[98] Dass es möglich ist, Obertongesangstechniken auch selbstständig bis zu einem hohen Niveau zu entwickeln, ist durch eine Aufnahme des texanischen Countrysängers Arthur Miles aus den zwanziger Jahren belegt. Dieser Sänger entwickelte ohne Vorbild eine eigene Obertongesangstechnik, welche er im Kontext der Countrymusik anwandte. Vgl. Saus, S. 61.
[99] Vgl. Fubini, S. 69.
[100] Durch das Beispiel der sardischen Quintina ist erwiesen, dass der Einbezug einer Obertongesangsstimme innerhalb eines polyphonen Stimmgeflechts möglich ist.
[101] Die unter 3.1.4 beschriebene Quelle muss als Einzelfall gewertet werden.
[102] Die meisten Obertonsänger, welche die These einer Obertongesangstradition im Kontext der Gregorianik vertreten, weisen selbst auf das Fehlen von Beweisen dafür hin.
[103] Vgl. Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence, The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
[104] Siehe Kapitel 2.3.
[105] Vgl. Interview mit Steffen Schreier, S.118.
[106] Siehe auch Kapitel 3.
[107] Interview mit Jan Stanek, S. 94.
[108] Interview mit Matthias Privler, S. 106.
[109] Riccbona.
[110] Ebd.
[111] Lewis, Robert, in: Goldman, S. 73.
[112] Riccbona.
[113] Von Fischer, Kurt, Das Neue in der europäischen Kunstmusik als soziokulturelles Problem, in: IRAMDA, Ausg. 25, S. 19-32, 1994, S. 20.
- Arbeit zitieren
- M.A. Alexander Jentsch (Autor:in), 2007, Obertongesang in Mitteleuropa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83717
Kostenlos Autor werden



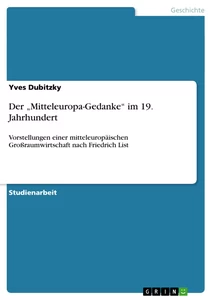


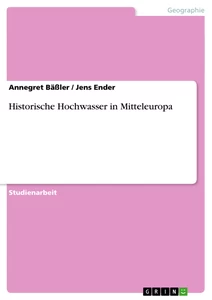















Kommentare