Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ÄSTHETIK (nach Erscheinungsjahr)
1) Warum abstrakt? Reflexionen zu einem Aufsatz von Herbert Read. In: Zeitschrift für Ästhetik 16/1 (1971) 412-21
2) Die Schichtenfolge in der Dichtung. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. Bd. XIX/2 (1974) 159-170
3) Was ist und was leistet `Schichtenpoetik`? In: Doitsu Bungaku 53 (1974) 104-110
4) Schicht, Struktur und Gattung: Zusammenhang der Begriffe. In: The German Quarterly 47/1 (1974) 35-44
5) Über ostasiatische Tuschemalerei und Kalligraphie. In: Zeitschrift für Ästhetik 22/2 (1977) 193-199
6) Das Schichtenverhältnis im Musikkunstwerk. In: Zeitschrift für Ästhetik 24/1 (1979) 5-10
7) Der Wandel unseres Kunstbegriffs. In: Acta Humanistica 16/4, Human.Ser. 14 (1988) 3
8) Das Problem der Konkreten Poesie. In: Protokoll 14 (1989) 44-62
9) Grenzen der 'Aussparung' in der Literatur. In: Acta Humanistica 18/3, For.Langs and Lit.S. 16 (1989) 145-186
10) Nachträgliche Überlegungen zur soziologischen Methode. In: Acta Humanistica 18/4, Human.S. No.16 (1989) 156-182 )
11) Nicolai Hartmann als Literaturkritiker. Vortrag auf der Tagung der Japanischen Gesellschaft für Germanistik in Tokyo gehalten am 20.5.1989
12) Was bedeutet 'schön' in der Äesthetik? In: Acta Humanistica 19/2, Human.S.17 (May 1990) 215-235
13) 'Camp' und 'Kitsch'. In : Doitsu Bungaku 86 (Frühjahr 1991) 148-156
14) Roman Ingarden (1893-1970) und seine Kritiker. Vortrag auf der Tagung der Japanischen Gesellschaft für Germanistik an der Hokkaido Daigaku am 21.9.1995
15) Fragestellungen und Themen der deutsch- und englischsprachigen Ästhetik in den letzen fünfzig Jahren. Eine Übersicht. In: Acta Humanistica 23/1, Human.S. No.21 (1996) 286-302
16) Gibt es allgemeingültige Werte für die Beurteilung von Literatur? In: Acta Humanistica 29/1, Foreign Languages and Literature S. No. 25 (1998) 20-86
17) Ästhetik, Kunstbegriff und Wertfrage.” Acta Humanistica 29:2, Humanities Series 25 (1998): 147-167
18) Hat die "Fundamentalpoetik" wirklich ausgespielt? Anwendungen für eine Theorie der Komparatistik. Zuerst als Vortrag bei der Nihon-Dokubun-Gakkai am 6.12.1997 an der Okinawa Kokusai Universität vorgetragen;in engl. Sprache unter dem Titel „On the Relationship of Comparative Literature to ‚Strata Poetics’, and Fundamental Poetics’“ in: Acta Humanistica et Scientifica Universitatis Sangio Kyotiensis, Humanities Series No. 27 (March 2000) 221-241 (S. 173)
19) Kernbegriffe der Ästhetik. Ein Vorschlag für ihre sinnvolle Verwendung im ästhetischen Diskurs in Kants Problemhorizont. In : Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks. Sonderheft des Jahrgangs 2000 der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft (2000) 155-168 (S. 178)
20) Originalität und Innovation: Zur “Abweichungspoetik” In: Acta Humanistica, Humanities S. No. 28 (2001) 84-115 (S. 187)
21) Kanon und Wert. Zur Kritik leitender Annahmen. Neun Thesen mit Kommentaren. In : Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German Studies. Bd. 27, Themat. Schwerpunkt: Wissenschaftskommunikation (2001) 71-103 (S. 202)
GATTUNGSPOETIK (nach Erscheinungsjahr)
22) Reflexion über Grundhaltungen in der Poetik. In: Seminar 1/1 (1965) 31-40 + 1/2 (1965) 125-128 (S. 219)
23) Probleme der allgemeinen Gattungspoetik. In: Pacific Coast Philology 3 (1968) 54-63 (S. 224)
24) Der Geltungsbereich unserer literarischen Sachbegriffe. In : Zur Terminologie der Literaturwissenschaft (ed. Wagenknecht, 1986) 80-104 (S. 230)
25) Chanson – Couplet – Song. Versuch einer semantischen Abgrenzung. In: Acta Humanistica, Humanities S., Vol. XXII/3 (1993) 145-166 (S. 248)
26) Das Dirnenlied. Beschreibung einer Gattung. In: Acta Humanistica, Humanities S., No. 22, Vol. XXV/1 (1995) 296-327 (S. 260)
27) Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit, Transparenz und Offenheit in “moderner Lyrik”. In: Acta Humanistica, Humanities S., No. 22, Vol. XXV/1 (1995) 296-327 (S. 275)
28) Interaktive Romane. Was wollen, was können sie sein? Vortrag auf der Tagung der Japanischen Gesellschaft für Germanistik in Tokyo am 11.5.1996 (S. 281)
29) Zur semantischen Beschaffenheit literarischer Sachbegriffe. In: Acta Humanistica, Foreign Langs. And Lit. S., No. 27 (2000) 131-142 (S. 297)
30) Gattung? Was ist in Deutschland ein “literarisches Chanson”? In: Acta Humanistica, Humanities S., No.29 (2002)147-163; engl. Cabaret Songs. In: Popular Music and Society, Vol. 25 3/4 (2001) 45-71 ausgezeichnet mit dem R. Serge Denisoff-Award for Best Article (S. 304)
LITERATURTERMINOLOGIE (nach Erscheinungsjahr)
31) Ein (digitalisierter) Thesaurus der Literaturwissenschaft? In: Acta Humanistica 16/4, Human. Ser. 14 (1987) 326-352 (S. 311)
32) Probleme beim Vergleich von Literaturterminologien. In: Akten des VII. Intern. Germanisten-Kongresses 4 (1991) 412-421 (S. 322)
Vorwort
Diese Aufsätze entstanden in einem Zeitraum von fast einem halben Jahrhundert. Die ersten wurden noch mit Schreibmaschine geschrieben und mussten deshalb mühsam gescannt und ins digitale Format übertragen werden. Da viele in Japan, wo ich 22 Jahre, und einige in den USA, wo ich 16 Jahre lehrte, veröffentlich wurden, bietet mir die Publish-On-Demand Methode eine ideale Möglichkeit, sie deutschen Lesern zugänglich zu machen. Einige habe ich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, andere nur in englischer. (Ein Band mit den englischen Aufsätzen erscheint gleichzeitig im gleichen Verlag.) Da ich nicht annehme, dass irgendjemand alle Aufsätze liest, habe ich darauf verzichtet, Verdoppelungen in den Literaturangaben zu beseitigen. Auch habe ich keine Neuerscheinungen angeführt, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich diese kannte, als ich die Aufsätze schrieb. Das vorstehende Inhaltsverzeichnis ist deshalb chronologisch angeordnet.
Ich vertraue darauf, dass der Fachmann beurteilen kann, zu welchem Grade meine Einsichten originell waren (und vielleicht noch sind). Gerade weil ich mich immer für „ausgefallene“ Themen interessiert habe, finden meine Aufsätze vielleicht noch Interesse und sind nicht veraltet. (Sie befassen sich erstmalig mit: Einer Untersuchung und Beschreibung des lit. Chansons als Gattung sowie der Abgrenzung seiner vier Haupttypen; einer Erweiterung der Staigerschen „Grundbegriffe“ auf die „publikumsbezogene Grundhaltung“, in der sich alle Gattungen unterbringen lassen, die in seinem System keinen Platz fanden; einem systematischer Vergleich und der Synthese von Ingardens und Hartmanns Schichtensystemen und deren Anwendung auf die Kunstpsychologie; der Analyse und Integration von Literaturbegriffen wie „Schicht“, „Struktur“ und „Gattung“; einem umfassenden Vergleich von Literaturterminologien über die europäischen hinaus; der schichtentheoretischen Analyse des Musikkunstwerks sowie der Beschreibung der Abstraktionsgrade in asiatischer Malerei und ungegenständlicher Kunst). Ich war nie daran interessiert „ein weiteres Buch über Goethe“ zu schreiben.
Thematisch lassen sich vier Bereiche unterscheiden, die zugleich die Entwicklung meiner wissenschaftlichen Interessen spiegeln: Aus meiner jugendlichen Begeisterung für das „literarische Chanson“, das ich gelegentlich vortrug, entstand mein Interesse für dieses als „literarische“ (?) Gattung. Nachdem ich endlich an der Göttinger Universität Professor Wolfgang Kayser überzeugt hatte, mich als Doktorand über dieses (damals noch) „unseriöse“ Thema anzunehmen, starb dieser unerwartet. Dies zwang mich, nach Kanada auszuwandern, wo – durch die Vermittlung des DAAD – Professor Reiss an der McGill University in Montreal meine Dissertation betreute. Sie wurde später als mein erstes Buch veröffentlicht.
In Kalifornien (an der University of Southern California) begann ich, mich für Gattungspoetik im Allgemeinen zu interessieren, was sich in vielen Aufsätzen und zwei weiteren Büchern manifestierte, dem Versuch einer Erweiterung von Emil Staigers „Grundbegriffen“, die auch den „Vortragsgattungen“ Raum bietet, und einer Bibliographie zu diesem Thema. Von der Poetik war es nur noch ein Schritt zur Ästhetik (besonders den Typologien und Schichtentheorien), was zu zwei weiteren Büchern (einer vergleichenden Darstellung und einer internationalen Bibliographie) führte.
Im Comparative Literature Program der New York University, wo ich anschließend lehrte, begannen mich allgemeine Beschreibungsprobleme von literarischen Phänomenen und die Erstellung von internationalen Literaturlexika zu interessieren, was sich in weiteren Aufsätzen und zur Herausgabe von zuerst einem dreisprachigen und später einem siebensprachigen Literaturwörterbuch veranlasste.
Außerdem hatte ich immer ein ausgeprägtes Interesse an den pädagogischen Forderungen meines Berufs, was sich in einem weiteren Buch und vielen Aufsätzen zur Literaturdidaktik niederschlug, die aber in diesen Band nicht aufgenommen wurden. (Ein Verzeichnis meiner Publikationen findet man in meiner dreisprachigen, dt./engl./jap., Homepage, die von meinen Studenten angefertigt wurde: http://www.kyoto-su.c.jp/~wolf)
Wegen meines Emigranten-Daseins habe ich immer wie im schalldichten Raum arbeiten müssen. Keinerlei Echo oder Anregung oder Kritik von Kollegen hat mir jemals geholfen, und wenn, dann (in Rezensionen) zu spät. Ich möchte aber meinem Freund, Ginzo Kobayashi, für seine selbstlose Hilfe im technischen Bereich danken. WR
WARUM ABSTRAKT? REFLEXIONEN ZU EINEM AUFSATZ VON SIR HERBERT READ
Sir Herbert Read (1892-1968), der mehrere nützliche Einführungen in die moderne Kunst geschrieben hat, stellte einmal in einem Artikel [2] mit dem kurzen Titel, „Why Abstract?" fünf Argumente gegen abstrakte Kunst, die ihm der Schriftleiter einer New Yorker Zeitschrift geliefert hatte, zusammen, um sie zu widerlegen.[1]
Die pädagogische Absicht, dem interessierten Laien in einfacher Sprache den Zugang zu moderner Kunst zu erleichtern (die auch andere Essays von Read auszeichnet), wird jeder begrüßen. Die Argumentation selbst kann jedoch den kaum überzeugen, der viele der Zweifel an abstrakter Kunst teilt. Ein genaues Lesen der fünf Einwände und ihrer Widerlegungen fordert deshalb Gegenargumente heraus, die hier kurz notiert werden sollen. (Sie könnten von einem anderen Leser dieser Zeitschrift wiederum korrigiert werden. Eine derartige Diskussion, in der jeder genau auf die Argumente des anderen eingeht, sollte alle Fragen klären können, die überhaupt zu klären sind, - und die übrigen deutlich abgrenzen.)
Ich übersetze jeweils zuerst den Einwand des Schriftleiters ungekürzt, dann Sir Herberts Widerlegung auf die Hauptpunkte verkürzt (kursiv) und füge schließlich meine eigenen Bemerkungen (durch kleine Buchstaben genau auf den Text bezogen) hinzu:
I. SIE (ABSTRAKTE KUNST) VERMITTELT KEINEN GEHALT (MEANING). SIE ZEIGT NUR DEN KÜNSTLER IM SELBSTGESPRÄCH.
Was ist der "Gehalt" [a] eines Gemäldes oder einer Skulptur? Kunst ist für sie [die sozialistischen Realisten] ebenso wie für Tolstoi und Ruskin ein Vehikel für irgendeine Botschaft (message) über soziale Verhältnisse, Naturphänomene oder menschliche Beziehungen; und das Kunstwerk soll unser Seinsverständnis vertiefen. Handelt es sich, dabei um einen rationalen Vorgang, die Art von Verständigung, die auf logische Sprachäußerungen [b] begrenzt bleiben sollte; oder möglicherweise um einen irrationalen Prozess [c] Äußerungen, die nur mit visuellen Symbolen [d] gemacht werden können?
Der Verteidiger der abstrakten Kunst glaubt, dass alle Kunst eine Art symbolischen Gesprächs [e] darstellt und dass selbst gegenstandsgebundene Gestaltung ihren Gehalt [f] (message) eher durch Form und Farbe als durch die Nachahmung der sichtbaren Dinge übermittelt. Er verweist darauf, dass andere Künste, wie Musik und Architektur, nichts imitieren, sondern durch abstrakte Verbindungen von Tönen, Intervallen, Proportionen und Rhythmen wirken. Es gibt keinen Grund, warum die Verbindungen von Linien und Farben auf einer Leinwand oder von Masse und Volumen in einer Skulptur nicht auf die gleiche Weise abstrakt sein sollten [g]. Es ist nur eine Gewohnheit von begrenzter historischer Bedeutung, daran festzuhalten, dass die bildenden Künste ihren Gehalt (meaning) durch die Nachbildung von zufällig durch die Natur entwickelten Formen vermitteln sollten [h]. Dann könnte die Musik mit gleicher Logik auf die Imitation von Vogellauten und Donner begrenzt werden [i]; und die Architektur auf die Nachbildung von Höhlen und Bergen[j].
Das abstrakte Kunstwerk mag rätselhaft sein, - aber es ist nicht ohne Gehalt (meaningless) [k]: es ist ein Symbol, das für die tiefsten Gefühle und Eingebungen des Künstlers stehen mag, und in dem der Beschauer seine eigenen Gefühle und Eingebungen ausgedrückt und gedeutet finden kann.
Reads erste Frage [a], eigentlich eine, „Gegenfrage", zielt bereits in das Zentrum des Problemzusammenhangs. Sie zwingt uns deshalb, sofort mit einer weiteren Gegenfrage zu antworten: Der, „Gehalt" eines Werkes der bildenden Kunst wird doch wohl nicht zuletzt von seinem Grad der Abstraktion bestimmt?
Dass alle Kunst (auch die naturalistische) von der sichtbaren Realität abstrahiert, abstrahieren muss, ist ein Gemeinplatz der Ästhetik. Wir brauchen hier nur an die Notwendigkeit der Auswahl und Betonung des Bedeutenden zu erinnern, an die abtrennende und deshalb vom „Wirrwarr der Erscheinungen" abstrahierende Funktion des Rahmens, Vorhanges, Podestes etc., an den exemplarischen und zugleich transparenten Charakter des Kunstwerkes, der durch seine einmalige Struktur unterstrichen wird, an den vom Tatsächlichen abstrahierenden Charakter jedes Stils (Personal- und Zeitstils). Dass z. B. die dynamische Steigerung barocker Gestaltung ebenso von der Wirklichkeit abweicht wie die statische Abstraktion des Kubismus, leuchtet ein. Selbst im Realismus kann die persönliche Sehweise des Künstlers, die wir Personalstil nennen, nicht ganz ausgeschaltet werden. Auch das ideale Mittelmass klassischer und klassizistischer Gestaltung entspricht nicht der immer individuell ausfallenden Wirklichkeit. Read sagt selbst zu Beginn des nächsten Abschnitts, dass es keine "naturgetreue" Abbildung der Gegenstände gibt, weil jede Abbildung bereits Interpretation ist. (Letzteres trifft übrigens auch für die künstlerische Photographie zu.)
Der Vorgang des Abstrahierens (= lat. abziehen) konnte jedoch bis zum Beginn der gegenstandslosen (= konsequent abstrakten) Kunst vielseitig aufgefasst werden. Es musste in jedem einzelnen Falle gefragt werden, was, wovon und wieweit abstrahiert wurde.
Die Frage danach, was im jeweiligen Kunstwerk (von der- Wirklichkeit) abstrahiert wird, kann mit der nach dem Gehalt identisch sein. Zumeist wird die Antwort auf Begriffe wie „das Exemplarische", das „Typische", das „uns alle Angehende" zielen.
Wovon abstrahiert wird, hängt dann vom Stoff des Kunstwerkes (d. h. von der verarbeiteten Wirklichkeit) ab: zumeist vom Banalen, Alltäglichen, Unbedeutenden, Kleinlichen.
Wieweit abstrahiert wird, bestimmt weitgehend die Gestalt des Kunstwerkes und damit zugleich seinen Stil.
Wenn aber, wie in der "gegenstandslosen" Kunst, von allem Stofflichen abstrahiert wird, weil alle Realität als banal, unbedeutend oder gar störend empfunden wird, kann auf die Frage danach, was abstrahiert wird, nur noch auf formale und allenfalls tiefenpsychologische Elemente hingewiesen werden. In der abendländischen Entwicklung wurde dieses Extrem erst im 20. Jahrhundert erreicht. Unsere Kunst hat die gegensätzlichste Entwicklung durchgemacht, von der wir wissen. Sie bemühte sich von der Renaissance bis zum Impressionismus mit größerer Konsequenz und mehr Erfolg als jede andere um die objektive Darstellung der sichtbaren Wirklichkeit; und sie entfernte sich von dieser seit etwa 1910 wiederum konsequenter als jede andere.
Wir können also den so vagen und verallgemeinernden Begriff "abstrakte Kunst" nicht diskutieren, ohne zuvor unterschieden zu haben, von welcher Art Abstraktion wir sprechen. Die zuvor benutzten Hilfsbegriffe (Inhalt, Gestalt, Gehalt) verweisen auf verschiedene zusammenwirkende Elemente oder Schichten des Kunstwerkes. Sie werden in der bildenden Kunst oft durch ähnliche ersetzt, z.B. Textur (Farben, Töne, Bewegungen, alles Material ), Struktur (als ästhetische Organisation der Texturelemente verstanden) und Expression (menschlichen Erlebens durch Textur und Struktur).
Auch diese Dreiteilung kann je nach den Bedürfnissen der zu betrachtenden Kunst differenziert werden: Gehalt oder Expression können z.B. auf Psychologisches zielen (etwa in der Kunst des Porträts, des Monologs, der Kurzgeschichte) oder auch auf Weltanschauliches (soziale, philosophische, religiöse Anliegen usw.) oder nur auf tiefenpsychologische Symbole.
Es wird immer Entscheidung (bewusste oder unbewusste) des einzelnen Künstlers bleiben, in welchen Schichten er sein Werk ansiedelt. Und es braucht wohl kaum betont zu werden, dass ein Werk nicht unbedingt an Wert verliert, wenn es von einigen Schichten absieht (abstrahiert). Ebenso sollte das Publikum in der Auswahl seiner Kunst die Entscheidung haben, auf welche Schichten es besonderen Wert legt und nicht verzichten will: z. B. auf logische Handlungsführung, psychologische Bedeutung und Konsequenz, tiefenpsychologische Symbolik, weltanschauliche Transparenz usw., oder auch allein auf sensible Textur.
Die Verwirrung setzt da ein, wo der Künstler selbst (und deshalb auch sein Publikum) sich nicht über sein Anliegen im Klaren ist, was sich häufig in den konkreten Titeln völlig abstrakter Bilder ausdrückt. Wenn man dem großenteils unbewusst schaffenden Künstler diese Unentschiedenheit gern verzeiht, so doch keinesfalls dem Kunstkritiker und -philosophen, der „mit der Zeit gehen" möchte und deshalb seine Unsicherheit hinter metaphorischem Jargon verbirgt. Denn der letztere, als Kunstwissenschaftler angesehen, verstärkt mit seinen Pseudo-Analysen beim Publikum die Zweifel, anstatt ihm zu helfen, und ermutigt andererseits bei vielen „Künstlern" die Tendenz zur Scharlatanerie.
Auch der sonst zu Recht so angesehene Herbert Read ist m. E. hier nicht sehr hilfreich. Was hilft es dem verständnislosen Publikum, von einem „irrationalen Prozess" [c] und „symbolischen Gespräch" [e] zu erfahren, die es nicht versteht? Da in gegenstandsloser Kunst bewusst jeder Bezug zur Wirklichkeit vermieden wird, kann niemand wissen, wofür die „visuellen Symbole" [d] stehen. Der Gebrauch des Wortes "Gespräch" [e] ist hier besonders verwirrend, weil dieses ein gegenseitiges Verstehen durch eine gemeinsame Sprache voraussetzt. - In einem Nebensatz [b] wird außerdem eine weittragende Behauptung aufgestellt und nie begründet: Warum sollte ein rationaler Gehalt auf logische Sprachäußerung begrenzt bleiben? Wird er in großer Kunst nicht vor allem durch Anschauung erlebt? Die Argumentation, „dass selbst gegenstandsgebundene Gestaltung ihren Gehalt eher durch Form und Farbe als durch Nachahmung der sichtbaren Dinge übermittelt“ [f], kommt mir vor, als wenn jemand sagen wollte: , Wir leben in erster Linie von Grundnahrungsmitteln, nicht von deren Zubereitung. - Also kochen wir in Zukunft nicht mehr." - Außerdem ist der Begriff „message" [f] hier wieder unscharf gesehen. Wovon spricht Read hier eigentlich: vom rein dekorativen Reiz der Farben und Formen? von der sensiblen Handschrift ihrer individuellen Anwendung? von tiefenpsychologischer Bedeutsamkeit? oder von Gehalt im gewöhnlichen Sinn?
Viele Beobachtungen weisen uns darauf hin, dass Kunstwerke umso reicher (unausschöpflich, Goethe: inkommensurabel) sind, je mehr sie an Gehalt in den oben genannten verschiedenen Bedeutungen bieten. Verfechter der konsequent abstrakten Kunst scheinen zu glauben, dass z. B. „Weltanschauung" und formale Reize sich im Kunstwerk gegenseitig ausschließen. Sie verweisen auf den Kitsch des 19. Jahrhunderts und übersehen angestrengt, dass die großen Künstler der Vergangenheit, denen auch sie ihre Bewunderung nicht versagen, mit Inhalt, Gehalt und Gestalt zugleich beschäftigt waren. Die glückliche Entsprechung und gegenseitige Steigerung dieser Elemente galt als Merkmal des großen Kunstwerkes.
Die Abbildung der Realität ist durchaus keine „Gewohnheit von begrenzter historischer Bedeutung" [h], sondern war allen echten Künstlern (Picasso, Matisse und fast alle „Klassiker" der Moderne einbegriffen) das notwendige Grundvokabular, das uns allen gemeinsam verständlich ist und deshalb als Ausgangspunkt für die Mitteilung des Einzelnen benutzt werden muss. Die uns umgebende sichtbare Welt wurde auch nicht als „zufällig durch die Natur entwickelte Formen" [h] erlebt, obwohl dagegen wissenschaftlich vielleicht nichts einzuwenden ist, sondern als unser freundliches oder feindseliges Schicksal.
Schließlich der seit Kandinsky vielfach wiederholte und dennoch falsche Vergleich mit Musik und Architektur: Die Musik war bis zum Anbruch der modernen Kunst im Wesentlichen abstrakt, d.h. nicht auf die Gegenstände unserer Umwelt und ihre Bedeutung angewiesen. Sog. „Programm-Musik", in der sichtbare Realität nachgeahmt oder angedeutet werden sollte, war immer die Ausnahme. Als aber die bisher gegenstandsgebundenen Künste zur radikalen Abstraktion tendierten, bewegte sich die Musik in die genau entgegen gesetzte Richtung: mit Tonbändern wurden Geräusche des täglichen Lebens zusammenmontiert, und diese „Musik" wurde folgerichtig „konkret" genannt. Auch die später entwickelte elektronische Musik stellt synthetisch Laute her, die an „konkrete Musik" erinnern.
Der Begriff „abstrakte Kunst" spielt also nur da eine Rolle, wo er nicht (wie in der Musik) ohnehin selbstverständlich ist: in erster Linie in den sog. , , bildenden" Künsten und in zweiter Linie auch in der Dichtung deutet er die Ausnahme von der Regel an. In den sog. „angewandten" Künsten, Architektur und Keramik, wird visuelle Realität gestaltet, nicht nachgestaltet, weshalb hier der Begriff „abstrakt" ebenfalls nicht angewandt werden kann. Architektur hat zwar mit abstrakter Kunst gemeinsam, dass sie nicht versucht, Gegenstände und ihre Bedeutung abzubilden, also auf einen inhaltlichen Lebensbezug verzichtet. Sie ersetzt diesen aber durch einen praktischen, ihren Zweck.
Dass Dichtung wesentlich abstrakter ist als Malerei, liegt nicht nur daran, dass wir sie nicht ansehen können. Es liegt vor allem am Doppelcharakter der Sprache als sinnliche Schilderung und abstrakte Aussage. Bis zum Beginn der „modernen" Dichtung galt es als charakteristisch für künstlerische Sprache, anschaulicher zu sein als etwa die wissenschaftliche. Von dem Moment an, wo Abstraktion an sich als Wert angestrebt wurde, beraubte man auch die Dichtung der sinnlich-malerischen Qualitäten. Ähnlich wie in der bildenden Kunst verschwand auch hier mit den Dingen ihr Sinn, d. h. der Sinn, den wir ihnen zu geben gewohnt waren. Nach einigen Zwischenstufen, an denen man wenigstens noch das Leiden an der tragisch empfundenen Absurdität unserer Welt ablesen konnte (Trakl, Kafka), blieben nur noch sinnlose Wortgerüste. Hinter zertrümmerten Sprachstrukturen leuchtete kein tieferer Sinn auf, sondern nur der Unsinn.
Jede Kunstart hat ihren eigenen Wirkungsbereich, in dem sie leistet, was andere nicht in dieser Vollkommenheit können. Dieser entspricht dem Material, mit dem gestaltet wird. Das Dilemma vieler moderner Künstler scheint unter anderem darin begründet zu liegen, dass ihnen das Gefühl für den besonderen Charakter ihres Mediums abhanden gekommen ist. In der verzweifelten Sucht, über bisherige, zur Vollendung getriebene Techniken hinauszukommen, versuchen sie, Wirkungen zu erzielen, die ihren Mitteln nicht angemessen sind und in den anderen Künsten viel leichter und selbstverständlicher erreicht werden. Im Bemühen um Originalität werden fortwährend Grenzüberschreitungen begangen, die in die Sackgasse der Verarmung und Absurdität führen.
Wieder müssen wir feststellen, dass Reads zuerst witzig wirkende Vergleiche (Donner und Vogellaute) [i] für das tiefere Verständnis unseres Unverständnisses wenig hergeben. - Im Schlusssatz dieses Abschnittes, der aber nicht als Schlussfolgerung bezeichnet werden kann, klingt etwas wie eine metaphysische Zielsetzung an. Auch die Pseudo-Philosophie vieler Maler seit Franz Marc ist im Grunde eine Grenzüberschreitung. (Read spricht in Abschnitt V von der „philosophischen Grundlegung" der abstrakten Kunst.) Sie wirkt sich im täglichen Kunstbetrieb noch immer da aus, wo von der „Aussage" konsequent abstrakter Gemälde gesprochen wird. Viele Maler müssen einen Mangel im rein dekorativen Gestalten gespürt haben, wenn sie immer wieder "metaphysische" Zielsetzungen angeben, wie die Hoffnung, durch die Zertrümmerung der sichtbaren Realität zur „Essenz", zum „wahren Sein" der Dinge vorzustoßen. Sie kümmern sich dabei wenig um die erkenntnistheoretische Einsicht, dass wir selbst es sind, die den Dingen Sinn geben. Die Entfremdung mit der Welt und mit sich selbst ist deshalb ein und dieselbe Sache, wie auch die Psychologen häufig überzeugend nachgewiesen haben. Die Hoffnung, „hinter" den Dingen einen tieferen Sinn zu finden, musste deshalb überall enttäuscht werden. Sie ruhte auf falschen Voraussetzungen. Die resultierende Enttäuschung aber führte häufig zu Zynismus (Dada) oder Banalität (Pop-Art).
Die Frage nach dem Gehalt abstrakter Kunst erforderte ausführliche Beantwortung; nun können wir uns kürzer fassen.
II. ES GIBT KEINE BEWERTUNGSMASSTÄBE FÜR ABSTRAKTE KUNST, WEDER FÜR IHRE BILDLICHKEIT (IMAGERY) NOCH FÜR IHRE TECHNIK. JEDER - SELBST EIN KIND - KANN EIN ABSTRAKTES BILD MALEN. REINES GEKRITZEL (DOODLING) KANN ALS ABSTRAKTE KUNST ANGEBOTEN WERDEN. DESHALB IST ES UNMÖGLICH, EIN GUTES ABSTRAKTES GEMÄLDE VON EINEM SCHLECHTEN ZU UNTERSCHEIDEN.
Was ist ein Bewertungsmassstab in der Kunst? Angeblich unsere visuellen Bildeindrücke von der äußeren Welt [a] es gibt keine Musterabbildung (standard image) der Außenwelt. Die Art, wie wir die Dinge sehen, ist ein Ergebnis unseres Lernens und unserer Interpretation[... ] eine Konvention und ändert sich von Zeitalter zu Zeitalter und selbst von Person zu Person.
Eine Art abstrakter Künstler, wie der islamische, glaubt, dass es ein Ideal der Vervollkommnung gibt, welches aber unpersönlich ist [... ] eine Frage quantitativer Harmonie, die rhythmische Folge von Linien, die Ausgewogenheit von Flächen [b].
Eine andere Art abstrakter Künstler strebt eine Gestaltung an, die auch solche konkrete Masse besitzen mag, im Wesentlichen aber Gefühl [c] ausdrückt oder unerklärbare magische[d] Eigenschaften besitzt. Es gibt Formen, die auf uns ohne rationale Begründung wirken [ e ]. Der Künstler offenbart das Geheimnis der Form (mystery of form)[f] Selbst das kritzelnde Kind vermag dies[... ]. Ein Vergleich von abstrakter Kunst mit Kindergekritzel macht diese nicht lächerlich; im Gegenteil, er verbindet sie organisch mit den Anfängen von allen bildlichen Symbolen [g].
Die Technik [... ] wird ebenso bewertet wie in gegenstandsgebundener Kunst [h]. Es ist eine Frage der Fähigkeit des Künstlers, seine Werkzeuge und Materialien zu ihrem eigenen Besten zu gebrauchen. Es gibt schlecht gemalte abstrakte Bilder, ebenso wie es schlecht gemalte gegenständliche Bilder gibt; [... ] selbst Spontaneität, die für Pinselführung in abstrakt-expressionistischen Bildern charakteristisch ist, findet sich auch in gegenstandsgebundenen Gemälden [i] Kompositionen, Farbsensibilität, Rhythmus, Bildlichkeit [i] (significant imagery) - abstrakte Kunst besitzt alle wesentlich ästhetischen Eigenschaf ten, die in der Kunst der Vergangenheit eine Rolle spielten...
Read beginnt wiederum mit einer Gegenfrage. Er beantwortet sie diesmal nicht nur unvollständig, sondern sogar falsch [a], damit er sich sofort auf den im ersten Abschnitt besprochenen Gemeinplatz der Ästhetik retten kann. Dass „unsere visuellen Bildeindrücke von der äußeren Welt" [a] jemals einen wichtigen Bewertungsmaßstab für große Kunst abgegeben haben, kann ein Kunsthistoriker wie Read nicht im Ernst glauben. Wir kennen von zu vielen großen Malern seit Michelangelo Aussprüche, in denen sie sich über den Ähnlichkeitskult des naiven Publikums lustig machen. Es gibt nicht nur einen Bewertungsmaßstab für Kunst, sondern viele, wie jeder in der theoretischen Literatur leicht nachlesen kann. Einige richten sich mehr auf die Form, andere mehr auf den Gehalt, die wichtigsten auf das Zusammenwirken beider.
Formale Qualitäten [b] und ihre Wirkung auf unser Nervensystem [e] sind von der Gestaltpsychologie (besonders von Rudolf Arnheim) genau untersucht worden. Sie sollten nicht mystifiziert werden [d]. Das „Geheimnis der Form" [f] (besser: die Wirkung der Formen) ist geklärt. Es ist aber gefährlich, dynamische Formqualitäten (wie aufsteigende und abfallende Bewegung, Über- und Unterordnung, Stärke und Schwäche, Spannung und Harmonie), die von uns schneller wahrgenommen werden können als irgendein geistiger oder emotionaler Gehalt, mit Ausdruckswerten wie Trauer, Freude, Langeweile u. a.) gleichzusetzen. Die ersten sind allgemein und können, in abstrakter Kunst isoliert, nicht mehr aussagen als formale Etüden. Zugegeben: Etüden können sehr reizvoll, anmutig oder auch witzig sein. Und warum sollten wir uns nicht an ihnen freuen, solange wir kein Bedürfnis fühlen, eigentlich menschliche oder „existentielle" Gehalte zu gestalten oder zu erleben? Wir sollten aber dann nicht von „magischen Eigenschaften" [d] sprechen, sondern z. B. nur von einer reizvollen Farbkomposition. - Dass wir immer wieder „magische" oder zumindest psychologische Eigenschaften vermuten, liegt daran, dag wir daran gewöhnt sind, in großer Kunst menschlichen Gehalt durch dynamische Gestalt zu erleben. Ein (nun wahrscheinlich altmodischer) Bewertungsmassstab schätzte das Kunstwerk danach ein, wie in ihm ein Gehalt durch die dynamischen Eigenschaften der Gestalt herausgebracht wird.
Auf die entscheidenden Unterschiede zwischen reifer Kunst und kindlichen Machwerken ist Read überhaupt nicht eingegangen [g]; und ich brauche es deshalb ebenfalls nicht zu tun.
Die Behauptung, dass die Technik in abstrakter Kunst ebenso bewertet wird wie in gegenstandsgebundener [h], erscheint besonders unsinnig, wenn wir an die Zufallsproduktionen der Action Painters oder Tachisten denken. Wo es keine „significant imagery" [j] gibt, kann diese auch nicht bewertet werden. Hier leidet die Diskussion wieder daran, dag man nicht genau weiß, wen Read eigentlich verteidigt. Der Schriftleiter hat sicher nicht an Künstlern wie Picasso gezweifelt, die erstens aus Prinzip nie ganz abstrakt gemalt und zweitens ihre Technik häufig unter Beweis gestellt haben, sondern eher an „abstrakten Expressionisten", an die auch Read zu denken scheint [i]. Deren , , Spontaneität", die sich häufig weniger in der Pinselführung als mit Spritzpistolen austobt (von anderen genügend publizierten Exzentrizitäten zu schweigen), mit der „konservativer" Künstler zu vergleichen [i], scheint mir nicht fair zu sein. Der Unterschied ist nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ nämlich der zwischen Stil und Manier, notwendigem Ausdruck und Zufall. (Dass die Übergänge, wie immer fließend sind, braucht nicht betont zu werden.)
III. SIE (ABSTRAKTE KUNST) BRINGT NEUHEIT UM DER NEUHEIT WILLEN. IHR HAUPTANLIEGEN, „ANDERS" ZU SEIN, FÜHRT ZU REINER SENSATIONSMACHE. ES GIBT EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER ECHTEN BEWEGUNG UND EINEM KULT. ABSTRAKTE KUNST IST EIN MODISCHER KULT.
Wir leben in einer revolutionären Epoche, und die Wandlungen in der Kunst sind nur Spiegelungen der Wandlungen in unserer Gesellschaft [a] Unmittelbarere Erklärungen der neuen Elemente in der modernen Kunst können in den wissenschaftlichen und technischen Entdeckungen unserer Zeit gefunden werden [ b ] [...] die Erfindung der Photographie und des Films [... ] die technischen Fortschritte in der Geschwindigkeit, die neuen Dimensionen im Raum durch das Flugzeug, die neue Formwelt, entdeckt durch das Mikroskop. Die Form selbst wurde als Leitprinzip in Natur und Universum etabliert und wurde deshalb unvermeidbar (vielleicht unbewusst) zum Hauptanliegen des Künstlers [c]... Die Behauptung, dass dieses (die symbolische Darstellung der Wirklichkeit) [d] einen Kult ausmache, geht weit an der Wahrheit vorbei [... ] Abstrakte Kunst [... ] ist eine der am weitesten verbreiteten Bewegungen in der Kunstgeschichte [e] [...] sie kann alle Variationen menschlichen Temperaments und Ausdrucks umfassen.
Hinter diesen Sätzen vermute ich folgendes Denkschema:
1. Kunst spiegelt ihre Zeit. [a] 2. Die Abstrakten haben sich durchgesetzt. [e] Also spiegeln sie unsere Zeit. [b] 3. Wer unsere Zeit bejaht, muss auch ihre Kunst bejahen; sonst ist er „von gestern". 4. Wenn einem das nicht leicht fällt, ja selbst wenn diese Kunst allen bisherigen Maßstäben ins Gesicht schlägt, kann der Fehler doch nur im eigenen Unverständnis liegen.
Mit einiger intellektueller Gewandtheit und etwas Auto-Suggestion können derartige Widerstände relativ leicht überwunden werden. -
Der Doppelsatz über die Form [c] erscheint mir in beiden Teilen zweifelhaft. Er wird nicht erläutert. Noch zweifelhafter (und ebenfalls nicht erläutert) ist die Bezeichnung „symbolische Darstellung der Wirklichkeit" [d]. Ich kann nur auf Paragraph I verweisen und wiederholen, dass solche Behauptungen dem Zweifler nicht helfen.
Wenn es nicht zu billig wäre, mit Einzelbeispielen zu argumentieren (mit denen man allerdings Bücher füllen könnte), dürfte hier zu Recht auf das nie da gewesene Maß an Scharlatanerie und Selbstbetrug in Verbindung mit abstrakter Kunst hingewiesen werden. Die praktischen Gründe dafür sind allerdings einfach: die Perfektion technischer Möglichkeiten scheint in jedem Kunstbezirk etwa im Impressionismus abgeschlossen. Abgesehen von mechanischen Erfindungen wie denen der Phonotechnik oder Farbenherstellung, wurden in unserem Jahrhundert keine wesentlichen Fortschritte mehr gemacht. Viele Künstler, die sich als Spätzeitler verstanden, haben das beklagt. Überall zeigten sich nun die typischen Zeichen nachlassender schöpferischer Kraft: ein Anwachsen der restaurativen Interessen (fast alle Stilepochen erlebten Renaissancen; man bemühte sich auch um historisch getreue Wiederherstellung früherer Leistungen), "Archaismus" und "Exotismus" (man studierte und imitierte primitive Kunstformen der eigenen Vergangenheit und fremder Kulturen). Dann aber lässt sich als Folge der Unmöglichkeit, die Vorläufer technisch zu überbieten, eine allgemeine Vernachlässigung des Technisch-Handwerklichen beobachten. Man braucht nur in unsere Kunstakademien zu schauen. Entmutigung und Desinteresse spielen zusammen. Ein Vakuum entsteht, in dem die Sucht nach Originalität, die schon vorher da war, nun ungehindert wuchert. Der Widersinn im übertriebenen Streben nach „dem Neuen" kommt schon darin zum Ausdruck, dass die Futuristen ihre Bewegung nach einer Zeitform nannten und nicht nach einer Qualität, wie die Schulen zuvor. Das Hauptanliegen ist eben nicht eine bestimmte Qualität des künstlerischen Gestaltens (wie Idealität, Realität, Impression oder Expression), sondern das „Zukünftige" als solches. Man vergleiche in diesem Sinne die Zielsetzungen von Pop-Art, Op Art u. ä. Mit dem Verblassen der handwerklichen Normen und Traditionen und dem gesteigerten Verlangen, neue Ausdrucksformen zu finden, entsteht ein häufig schrankenloser Subjektivismus, dem jede Orientierung an der (nachprüfbaren) Außenwelt zuwider ist. Bis zum Anbruch des 20. Jahrhunderts konnte man den Wert eines Kunstwerkes u. a. daran bemessen, dass man es nach seinen eigenen Intentionen befragte und diese mit der Gestaltung verglich. Wenn man aber heute nicht mehr weiß, was der Künstler gestalten wollte, kann man auch das Wie nicht bewerten.
IV. SIE (ABSRAKTE KUNST) IST LEDIGLICH DEKORATION, - NICHT GEHALTVOLLER ALS EIN MUSTER FÜR TAPETEN ODER GARDINEN. GESTALTET DER ABSTRAKTE KÜNSTLER NICHT VON ANFANG AN AUF DEN EFFEKT HIN, DEN SEINE LEINWAND AUF EINER MUSEUMSWAND HABEN WIRD, UND KAUM AUF DIE VERDICHTUNG EINES ERLEBNISSES? (MAN DENKE AN DIE ENORME GRÖSSE ABSTRAKT-EXPRESSIONISTISCHER GEMÄLDE!)
Ruskin hat einmal gesagt, dass alle große Kunst wesensmäßig dekorativ ist [... ] Was in der Geschichte der Malerei die Ausnahme darstellt, ist gerade das bei bürgerlichen Sammlern so beliebte kleine Wandbild. Der moderne Maler möchte sich von dieser Konvention des letzten und vielleicht vorletzten Jahrhunderts 1ösen und zum „großen Stil“ der großen Maler der Vergangenheit zurückkehren...
Einige abstrakte Kompositionen sind tatsächlich leer, aber nicht, weil sie abstrakt, sondern weil sie schlechte Kompositionen sind. „Verdichtung eines Erlebnisses" (intensification of experience) ist nicht eine Frage der Größe, sondern der benutzten Symbole. Jede gotische Kathedrale kann als Beispiel intensiver Größe und (als Gesamteindruck) abstrakter Raumgestaltung dienen.
Hier stört mich nur der letzte Satz. Der Schriftleiter hat ja nicht an großen Formaten als solchen Anstoß genommen, sondern an Ausdehnung die nicht durch ihren Inhalt und Gehalt gerechtfertigt wird. Deshalb ist die gotische Kathedrale, deren Größe die Einheit vieler Details ist, ein schlechtes Gegenbeispiel. Sie ist außerdem nicht mehr „abstrakte Raumgestaltung" als alle Architektur. (Siehe Paragraph I!)
V. SIE (ABSTRAKTE KUNST) ENTHÄLT KEIN MENSCHLICHES GEFÜHL, KEINE WELTANSCHAULICHEN GRUNDLAGEN (PHILOSOPHICAL FOUNDATION) UND KEINE EWIG GÜLTIGEN WERTE – IM GEGENSATZ ZU ALLER BISHERIGEN GROSSEN KUNST.
Keine Kunst könnte eine tiefere philosophische Grundlegung [a] aufweisen. Arbeiten wie Worringers [...], Kandinskys [... ], Mondrians [...], die Schriften von Gabo, Malevich, Klee tragen einen Reichtum an Gedanken über die Gesetze der Kunst zusammen, der in der Geschichte nicht seinesgleichen hat. All diese Schriften befassen sich mit „grundlegenden und dauernden Werten", und solche Werte sind menschliche. Immerhin hat der Vorwurf, abstrakte Kunst enthalte kein menschliches Gefühl, einige Überzeugungskraft, wenn man mit menschlichen Gefühlen unsere normalen täglichen Erfahrungen wie Freude und Sorgen, Hoffnung und Verzweiflung meint. Wenn Kunst derlei Gefühle „ausdrücken" sollte, [ .. .] dann wäre sie mit dem Leben selbst identisch [b]: eine Übersetzung, ein Bericht oder eine Spiegelung [... ] Das Vorhaben des Künstlers ist aber nicht, Gefühl wiederzugeben (to represent emotion), sondern es zu überwinden (transcend)[c]. Ein Kunstwerk ist dem täglichen Treiben entrückt: es ist ein Gegenstand interesseloser Betrachtung [... ] Abstrakte Kunst ist vielleicht entrückter als alle andere Kunst der Vergangenheit; sie ist vielleicht auch schöner [d].
Der letzte Abschnitt beginnt mit einer Verwechslung: Der Schriftleiter spricht offenbar von „Weltanschauung" im Kunstwerk selbst, Read von Kunsttheorie. Die letztere ist allerdings im 20. Jahrhundert beträchtlich angeschwollen (siehe Paragraph I!). Es ist unmöglich, hier auf die einzelnen Künstler und ihre Reflexionen einzugehen. Es ist auch nicht notwendig, da es unserm Schriftleiter (und allen anderen Durchschnitts-Zweiflern) nur um die Kunstwerke selbst geht.
Die letzten Sätze lenken wieder auf die Hauptfrage zurück, die nach dem Gehalt (Paragraph I). Kunst, die „unsere normalen täglichen Erfahrungen" und Gefühle ausdrückt, ist „mit dem Leben selbst identisch" [b], wird hier behauptet! Selbst falls sich das nur auf die bildende Kunst bezieht und nicht auch auf die Dichtung, bestaune man den Fehlschluss: Weil Kunst immer nicht nur menschlichen Gehalt bot, sondern vor allem ästhetische Gestalt, wollen wir jetzt keinen Gehalt mehr. Denn wenn wir Gehalt im herkömmlichen Sinn dulden, ist unsere Kunst nicht mehr Kunst, sondern nur Abklatsch des Lebens. -
Das ist reine Unlogik; und so geht es weiter: Der Künstler „repräsentiert" nicht Gefühle (das deutsche Wort „gestaltet" beinhaltet zu sehr, was ich selbst mir unter dem künstlerischen Prozess vorstelle), sondern er überwindet sie [c]. Das klingt wie ein schlechtes Zitat. Meint Read mit "transcend" sich fernhalten, d. h. dass der Künstler menschlichen Gefühlen von Anfang an aus dem Wege geht? Oder meint er wirklich „überwinden"? Im Kunstwerk? Wie aber im abstrakten Kunstwerk? Dann müssten die Gefühle doch wenigstens sichtbar (erlebbar) gemacht werden? Künstler haben doch immer Gefühle dargestellt und durch die ästhetische Gestaltung „überwunden"!
Der Artikel endet mit einem Glaubensbekenntnis in der Möglichkeitsform [d]. Auch andere Sätze standen gelegentlich im Konjunktiv. Wir müssen sie aber wörtlich" nehmen, wenn wir sie überhaupt beachten.
Wie mag dem Schriftleiter (und allen anderen Zweiflern, die diesen Aufsatz lasen) zu Mute gewesen sein? Dieser Artikel ist natürlich nur ein Beispiel für viele ähnliche. Read war noch einer der vernünftigsten Kunsttheoretiker und sehr gebildet. Er schrieb einen viel besseren Stil als die meisten seiner Kollegen. - Dienen wir eigentlich der ernsthaften modernen Kunst, wenn wir uns mit solchen „Erläuterungen" zufrieden geben? Ich meine, auch , gebildete Laien" könnten weiter kommen.
[1] Zuerst veröffentlicht in der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft XVI/1 (1971) 43-55. Der Verf. hat auch nach mehr als 3 Jahrzehnten seine Auffassungen nicht revidiert. -
[2] In: New York Times Magazine. 17. April 1960; wiedergedruckt in der Essay-Sammlung: A Letter to a Young Painter. Horizon Press, New York 1962. S. 255-264.
DIE SCHICHTENFOLGE IN DER DICHTUNG
Mehrere Probleme der Literaturtheorie, die bisher nicht befriedigend gelöst werden konnten, bieten mit Hilfe des Schichtenmodells, wie es für die Dichtung vor allem von Nicolai Hartmann und Roman Ingarden [1] entwickelt wurde, keine Schwierigkeit mehr. Dass dieses Vorstellungsmodell bisher in der Literaturtheorie nur gelegentlich respektvoll erwähnt, [2] jedoch außer von Hartmann und Ingarden nie konsequent angewandt wurde, ist umso erstaunlicher, als es in der deutschen Psychologie und Anthropologie [3] eine so bedeutende Rolle gespielt hat.
Nicht einmal Ingarden und Hartmann haben sich miteinander auseinandergesetzt; deshalb müssen diese beiden wichtigen Versuche einer "phänomenologischen Ontologie des Sprachkunstwerkes" zuerst miteinander verglichen werden, bevor man aus ihrer Synthese Schlüsse ziehen kann. Das Ergebnis dieses Vergleichs sei hier vorweggenommen, da es zu erwarten war: im Wesentlichen stimmen beide Systeme miteinander überein, wenn auch in ihnen die einzelnen Schichten der Dichtung je nach Interessenschwerpunkt verschieden differenziert werden; und nicht nur das: auch mit den bedeutendsten Schichtenanalysen der Persönlichkeit, wie denen von Rothacker und Lersch, [4] ergeben sich keinerlei Widersprüche. Wie von selbst leuchtet beim Vergleich dieser Untersuchungen ein, was alle Forscher übereinstimmend betonen: dass den Schichten der Persönlichkeit die ihrer Äußerungen und Erzeugnisse entsprechen. [5] Die Dichtung ist beides, Äußerung und Kunsterzeugnis, zugleich.
Bevor aber auf die Schichten der Dichtung eingegangen werden kann, muss zuerst die allgemeine Schichtengesetzlichkeit umrissen werden, die Nicolai Hartmann in seiner allgemeinen Ontologie und Kategorienanalyse [6] für alle Bereiche der Natur und des Geistes nachgewiesen hat, und die von Ingarden anerkannt wird. [7]
Danach ist die Welt ein Stufenreich; aber die Stufen dürfen nicht mit den Klassen der Lebewesen verwechselt werden. Die höheren Gebilde, aus denen die Welt besteht, Pflanze, Tier, Mensch und Volk, sind selber geschichtet; die Schichten, aus denen sich die Welt aufbaut, sind auch in ihnen aufzuweisen. So ist der Mensch materielles, organisches, seelisches Lind geistiges Wesen, besteht aus vier Schichten. Und auch die Menschengemeinschaft, die griechische polis z. B., hat in ihrer geographischen Lage eine materielle Struktur; sie hat ihr organisches Leben, ihre Triebe und Bedürfnisse, aus denen ihre Ökonomische Welt erwächst, und sie hat auch ein seelisches und ein geistiges Leben. Die höheren Tiere und das vorgeschichtliche geistlose Bewusstsein des Menschen haben drei Schichten, das niedere Tier und die Pflanze zwei. Der Extension nach ist die materielle Schicht die größte. Je höher die Schicht, umso weniger verbreitet ist sie. Nur auf einem kleinen Teil des anorganischen Seins haut sich das organische auf, wieder nur in den am höchsten entwickelten organischen Gebilden findet sich Seelisches, und nur in einer Art der beseelten Lebewesen gibt es Geist. [8]
Wenn alle Gefüge der niederen Schicht Elemente zum Aufbau der höheren werden, spricht Hartmann von einem „Überformungsverhältnis" (zwischen der Materie und dem Organischen). Das „Überbauungsverhältnis" zwischen den beiden nächst höheren Stufen unterscheidet sich dadurch, dass bei ihm nur ein Teil der Kategorien der niedrigeren Schicht in die höhere eindringt. Der prinzipielle Unterschied zwischen der seelischen und den beiden unteren Schichten (psychophysische Grenzscheide) besteht in der Unräumlichkeit, der Innerlichkeit der seelischen Inhalte. Das Geistige hebt sich wiederum vom Seelischen vornehmlich ab durch seine Überindividualität. [9]
Es kann hier nicht im Einzelnen verfolgt werden, welche von Hartmanns vielfältigen Kategorien sich in welchen Schichten auswirken. Wichtig ist, dass im Unterschied zu den einfachen Kategorien die Fundamentalkategorien alle vier Schichten bestimmen. Zu den letzten gehören die "kategorialen Gesetze", in deren Unterscheidung und Fixierung eine Hauptleistung dieses Systems liegt.
Die Kategorien der niederen Schichten kehren in den höheren wieder (Gesetz der Wiederkehr), wobei sie aber abgewandelt (Gesetz der Abwandlung) und durch neue vermehrt (Gesetz des Novums) werden. Besonders in den "Überbauungsverhältnissen" besteht ein gewisser Abstand zwischen den Schichten (Gesetz der Schichtendistanz). Die "Gesetze der kategorialen Dependenz" regeln das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis noch weiter: die niedere Schicht ist immer die stärkere (Gesetz der Stärke) und in sich autonom (Gesetz der Selbständigkeit), bildet aber die Materie für die höhere (Gesetz der Materie), die wiederum durch ihr "Novum" nach oben Spielraum für höhere Gesetzlichkeiten besitzt (Gesetz der Freiheit).
Letztlich ist es für unsere Fragestellung nicht wichtig, ob wir mit Hartmann in allen Einzelpunkten übereinstimmen. Auch lassen sich die vier Hauptschichten weiter unterteilen, wie Hartmann selbst es in seiner Ästhetik getan hat. Uns genügt fürs erste die Feststellung, dass unsere Welt in allen ihren Bereichen als geschichtet gesehen werden kann und dass in der Schichtung Gesetzlichkeiten aufgewiesen werden können, die sowohl für das materielle Fundament wie für den geistigen "Überbau" gültig sind, und von denen wir besonders die "Gesetze der kategorialen Dependenz" hervorheben.
Zur schnellen Einführung in die auf die Literatur bezogenen Schichtenvorstellungen und -begriffe hei Hartmann und Ingarden werden hier die wichtigsten Stichworte in Tabellenform zusammengestellt. Hartmanns Ästhetik lassen sich folgende bezeichnenden Äußerungen entnehmen, mit denen er "die Schichtenfolge in der Dichtung" zu charakterisieren versucht:
1. Realer Vordergrund; Realschicht: Wort, Schrift
Irrealer Vordergrund; Zwischenschicht; die mittleren Schichten; zweiter Vordergrund erscheinender Wahrnehmbarkeit; unmittelbar anschaulich durch Phantasie
2. Sphäre des Äußeren, der körperlichen Bewegung, Stellung, Mimik, Rede, alles Wahrnehmbaren am Menschen (entspricht in Malerei und Plastik der sinnlich vermittelten Schicht)
3. Schicht der Handlungen, des äußeren Verhaltens, der Reaktionen und Aktionen, des Gelingens und Misslingens . . . unmittelbar auch die Absichten, Konflikte, Lösungen ... die Situationen - soweit sie nicht im äußeren Beisammen der Personen aufgehen. . die Spannung der aufeinander treffenden Intentionen ... noch unter Ausschluss der Motive und Gesinnungen
4. Schicht der seelischen Formung ... moralische Eigenart und Charakter des Menschen ... was sich gleich bleibt - das Ethos des Menschen, Verdienst und Schuld im gefühlten Wertkonflikt ... moralische Seite der Situation Zwang zur freien Entscheidung ... Schicht der Gefühle und Stimmungen
5. Das Schicksal ... des Einzelnen oder vieler Personen ... das Ganze seines Lebens
Irrealer Hintergrund; Die letzten Hintergrundsschichten; ideenhaft-überempirisch:
6. Schicht der individuellen Idee ... Persönlichkeitsidee ... in der Idealität gesehene Figur ... (Hamlet, Alexei Karamasow) ... Misslingen: konstruierte Persönlichkeit, nach allgemeinen Idealen, blas wirkender Typus (der Märchenprinz, die engelhafte Jungfrau)
7. Schicht des Allgemeinmenschlichen ... der Ideen ... moralische, religiöse, politische ... metaphysische Beunruhigung ... Lebensangst.
Ingarden unterscheidet nur fünf Schichten; und diese werden nicht mit mehreren Wendungen umschrieben, sondern zumeist nur einmal benannt und dann eingehend analysiert:
1. Schicht der Wortlaute und der auf ihnen sich aufbauenden Lautgebilde höherer Stufe
2. Schicht der Bedeutungseinheiten verschiedener Stufe; Schicht der Satzsinne und der Sinne ganzer Satzzusammenhänge
3. Schicht der mannigfachen schematischen Ansichten, in welchen die im Werk dargestellten Gegenstände verschiedener Art zur Erscheinung gelangen
4. Schicht der dargestellten Gegenständlichkeiten und ihrer Schicksale, welche in den durch die Sätze entworfenen intentionalen Sachverhalten dargestellt werden
5. Schicht der ausgedrückten Idee ... metaphysischen Qualitäten ... Wesenheiten
Ein Vergleich von Hartmanns und Ingardens Aufteilungen ergibt folgendes:
a. Hartmanns Realschicht (1) wird bei lngarden, der stark linguistisch interessiert ist, nochmals aufgeteilt (1 und 2). Der Unterscheidung von Wortlauten und Bedeutungseinheiten entspräche in der Malerei etwa die von Farben und Schwarz-Weißtönungen als einfachsten Aufbauelementen einerseits und Linien bzw. den durch sie gegebenen Umrissen und Proportionen andererseits. Denn die Bedeutungseinheiten (Satzsinne) werden nur durch das syntaktische Zusammenfügen von Wortlauten ermöglicht; ebenso die Umrisse und Proportionen durch das Zusammenspiel oder "Strukturieren" von Farben und Schwarz-Weiß-Tönungen. (Diese Vergleiche mit anderen Kunstgebieten mögen hier als unverbindlich spielerische hingenommen werden, die nur anregen sollen. Da Schichtentheorien ohnehin, im Vergleich zu exakter Wissenschaft, "spekulativ" sind, ist nicht einzusehen, warum die "kategoriale Dependenz" hier nicht einen flüchtigen Hinweis auf Gemeinsamkeiten rechtfertigen sollte.) In einer noch gewagteren Parallele ließe sich auch an die Entsprechung von anorganischer und organischer Seinsweise denken. Denn ebenso wie die Wortlaute erst im Satzzusammenhang eine Funktion für die Bedeutungseinheit bekommen, ebenso wie die Farben nur in Umrissen und Proportionen in ein Verhältnis zueinander treten können, so erhält auch die anorganische Materie erst im Funktionszusammenhang des Organismus (im weitesten Sinne) Umriss, Aufgabe und Sinn.
Eine allgemeine Unterscheidung der Schichten des Materials und des strukturierten Materials ist deshalb gerechtfertigt.
b. lngardens Schicht der "dargestellten Gegenständlichkeiten und ihrer Schicksale" (4) entspricht etwa Hartmanns "mittleren Schichten" (2-5), nämlich der "Sphäre des Äußeren" (2), der Schicht der Handlungen (3), der "seelischen Formung" (4) und der Schicht des Schicksals (5), zusammen. Hier differenziert Hartmann, dem es mehr auf das Erlebnis in der Dichtung ankommt, wesentlich feiner.
Diese mittleren Schichten werden wiederum schon deshalb zu Recht unterschieden, weil sie nicht nur in der Dichtung erscheinen. Etwa in der Malerei und Bildhauerkunst ermöglicht die Strukturiertheit (2) des Materials (1) das Abbilden alles Wahrnehmbaren (3), das uns im Allgemeinen als Umwelt vertraut ist. Abbildungen sind jedoch zunächst leblos, bis durch die Kunst der Gestaltung und unsere Assoziation der Anschein von Bewegung und mit ihm von Leben (4) entsteht. Wir würden aber in Formen kein Leben "hineinsehen", wenn diese nicht wenigstens teilweise unserer vertrauten Umwelt entnommen wären, also Abbildungscharakter (3) hätten. Wiederum lässt sich durch das Abhängigkeitsverhältnis der etwas gewagte Vergleich mit den ontologischen Schichten weiterführen: ebenso wie Bewegung nur in abbildenden N) Strukturen (2) gesehen werden kann, braucht das animalisch-biologische Leben die Schichten des Organischen und Anorganischen, um überhaupt existieren zu können.
Das Psychologische oder Seelische (5) ist wiederum nur in bewegten Lebewesen möglich, sein Erscheinen in der Kunst dementsprechend nur in Material (1). das so strukturiert (2) ist, dass es Ausschnitte unserer Umwelt abbildet (3) und in diesen Bewegung (4) assoziieren lässt. (Für die Malerei bedarf es dazu keineswegs der Abbildung "bewegter" Schlachtenszenen. Der "lebendige" Blick eines Porträts genügt, um das Seelische zu vermitteln.)
Wo das Seelische nicht mehr momentär, sondern in zeitlichen Dimensionen gesehen wird, wo wir also äußere und innere Entwicklung verfolgen oder gar das Ganze eines Lebens überschauen können, lässt sich von einer weiteren Schicht (6) sprechen. Wiederum leuchtet sofort ein, dass auch hier die kompliziertere Schicht auf der einfacheren ruht: ohne die Darstellung einzelner psychologischer Momente lässt sich eine Entwicklung nicht wiedergeben. Diese Schicht ist in der Dichtung (als „Zeitkunst'') stärker entwickelt, besonders in Epik und Dramatik. Aber auch ein kurzes lyrisches Gedicht der Sappho kann das Schicksalhafte darstellen, ebenso ein Altersporträt von Rembrandt.
c. Zu Ingardens Schicht der "mannigfachen schematisierten Ansichten" (3) findet man bei Hartmann keine Entsprechung. Da die beiden Denker nicht aufeinander eingehen, können wir nur vermuten, dass Hartmann eine solche "Schicht" als den übrigen unvergleichbar zurückgewiesen hätte, da sie nicht den Phänomenen als solchen zukommt, sondern sich nur auf unser Erkennen der Phänomene bezieht (Blickpunkt). Ingardens Feststellungen über die Konkretisation des literarischen Werkes und die Rolle der „Unbestimmtheitsstellen" sind zwar äußerst wertvoll, sagen aber mehr über unser Erkennen des literarischen Kunstwerkes aus, als über dessen ontologische Struktur.
d. Ingardens Schicht der "metaphysischen Qualitäten" (5) ist bei Hartmann wiederum nochmals aufgeteilt und entspricht denen der "Individuellen Idee" (6) und des „Allgemeinmenschlichen" (7). Diese beiden "letzten Hintergrundschichten" scheinen bei Hartmann den beiden vorhergehenden zu entsprechen, indem sich jeweils die erste auf das Einzelerlebnis und die zweite auf die Erlebniskette, das Schicksal, bezieht. Sie unterscheiden sich aber durch ihren "ideenhaft-überempirischen" Charakter, also durch das, was Hartmann andernorts als Eigenschaft der ontologischen Schicht des Geistigen beschreibt [11]. Besser würde sich m. E. der Begriff des "Exemplarischen" eignen, um das Überpersonelle und Überzeitliche und deshalb Beispielhafte und uns alle Angehende zu bezeichnen, das die Gestaltung von Figuren wie Schicksalen im Goetheschen Sinne "bedeutend" machen kann. Denn auch diese Schichten sind letztlich aus der Erfahrung abgeleitet, "abstrahiert", und deshalb nicht wirklich "überempirisch". Hartmann deutet das in seiner Beschreibung des Misslingens der sechsten Schicht auch an.
e. Genau genommen, ließen sich drei Schichten des irrealen Hintergrunds unterscheiden: I. die exemplarische Figur, 2. das exemplarische Schicksal Und 3. Weltgefühl, Welterfahrung oder Welteinstellung des Dichters, die sich durch sein Werk auf andere übertragen, wie etwa Kafkas beängstigtes Weltgefühl, Brechts didaktisch-satirische Welteinstellung oder Kleists tragische Welterfahrung (oder die ganzer "Schulen" wie die des absurden Theaters). Hartmann und Ingarden haben in ihrer letzten Schicht zweifellos an diesen alles bedingenden Hintergrund gedacht, aber den möglichen exemplarischen Charakter eines Schicksals (man denke an Wallenstein, Othello, Faust usw.) nicht in Betracht gezogen.
Auch in den "letzten Hintergrundsschichten" lässt sich das ontologische Abhängigkeitsverhältnis noch zeigen: eine exemplarische Welterfahrung (9) lässt sich nur in exemplarischen Persönlichkeiten (7) oder exemplarischen Schicksalen (8) oder beidem zeigen. Persönlichkeiten und Schicksale müssen aber erst einmal als solche dargestellt werden (5 und 6), um exemplarisch wirken zu können usw.
Im Vergleich von Ingardens und Hartmanns Schichtenmodellen wurde bereits eine mögliche Synthese angedeutet, die hier ebenfalls in Tabellenform geboten wird: [12]
1. Das Material: Wort, Farbe, Ton, Stein usw. (entspr. anorgan.)
2. Das strukturierte Material (Bau, Organismus, Struktur usw.)
3. Das Abbildhafte im strukturierten Material (entspr. organ.)
4. Das bewegte Leben im (mindestens teilweise) abbildhaft strukturierten Material (entspr. biolog.-anim.)
5. Das Psychologische im lebendig erscheinenden, abbildhaft strukturierten Material (entspr. Seele)
6. Das Übergreifende (Schicksalhafte) im psychologisch, lebendig, abbildhaft strukturierten Material
7. Das Exemplarische (Überpersonale und Überzeitliche) im Psychologisch-Persönlichen usw. (entspr. Geist)
8. Das Exemplarische im Übergreifend-Schicksalhaften usw.
9. Das Weltgefühl die Welteinstellung, die Welterfahrung, die Ideen, ausgedrückt durch alle übrigen Schichten.
Denkmodelle wie das der Schichten (oder auch der Typologien) müssen ihre Daseinsberechtigung erst durch ihren Nutzen für die Lösung schwieriger Probleme erweisen, wenn sie nicht bloße "Gedankenspiele" bleiben wollen. Wir können hier nur wenige Beispiele bringen.
Zuerst wäre neu zu fragen: welche Schichten untersuchen wir, wenn wir Dichtung interpretieren? - Die Antwort muss natürlich zuerst heißen: das hängt von der zu interpretierenden Dichtung (und unseren Interessen) ab. Wir können nämlich nur Schichten betrachten, die voll entwickelt vorhanden sind. Bei den übrigen theoretisch möglichen Schichten lohnt sich allenfalls die Frage, warum sie nicht vorhanden sind.
Nur Dichtung großen Stils (Epos, Roman, Drama) entfaltet alle Schichten und auch sie nicht alle in gleicher Weise. Die Schichtenstruktur trägt zur Unterscheidung der Gattungen bei, sobald sie konstant wird: Lyrik weist z. B. häufig keine Handlung und Konflikte auf, geht also von der "Sphäre des Äußeren" (2) oder dem Abbildhaften (3) direkt zur Schicht der Gefühle und Stimmungen (4), bei uns zum Psychologischen (5). Nun wird hier allerdings nicht völlig die Schicht der Handlungen (3) bzw. des bewegten Lebens (4) übersprungen: das "sprechende Ich" des Dichters, mit dem wir uns im günstigen Falle ebenso identifizieren wie mit der epischen oder dramatischen Figur, vertritt die scheinbar fehlende Schicht; und ohne sie könnte das Sprachkunstwerk nicht mehr funktionieren. Denn wenn es auch oft den Anschein hat, so ist es doch unmöglich, dass die Dinge direkt zu uns sprechen. Sie sind tot ohne die persönliche Perspektive des "lyrischen Ichs", so sehr dieses auch mit ihnen "verschmelzen" mag. Jedoch tragen die charakteristische Art und Stärke, in denen der lyrische Sprecher noch anwesend ist, zur Unterscheidung der lyrischen Gattungen bei. Man denke etwa an Gedanken- und Gefühlslyrik wie in Sonett und Lied. [13]
Nachdem wir festgestellt haben, welche Schichten im betreffenden Sprachkunstwerk entwickelt sind, fragen wir, welches Verhältnis zueinander und welche Funktion für das Ganze sie haben. Das führt mitten in die Struktur analyse, wobei wir den Strukturbegriff wie bei Herman Meyer [14] fassen: "Form und Inhalt sind beide Material im Sprachkunstwerk ... sie gehören zur Struktur, insoweit sie miteinander in Verbindung treten und in der ästhetischen Ordnung des Werkes teilhaben, indem sie diese mitstatuieren".
Es lassen sich aber nun die Begriffe Form und Inhalt - oder Inhalt, Gehalt und Gestalt - genauer verstehen als zuvor: Nicolai Hartmann hat uns die Augen dafür geöffnet [13], dass die Form des Kunstwerks immer ''gestaffelt'' ist, d. h. dass jede einzelne Schicht des Kunstwerks ihre eigene Formung aufweist. Das zeigt sich bereits darin, dass wir nach jeder Schicht (vom Material bis zum Weltgefühl) sowohl mit WAS als auch mit WIE fragen können. Wenn wir es z. B. in der zweiten Schicht der Dichtung mit sinnvoll strukturiertem Wortmaterial zu tun haben, wäre noch immer zu fragen, wie es strukturiert ist (Stil). Die verschiedenen Schichten können überhaupt nur in einer bestimmten Form vorhanden sein. Es ist deshalb ebenso unsinnig, nach der Form eines Sprachkunstwerks zu fragen (allenfalls Formung), falls man damit nicht lediglich die metrische oder syntaktische Struktur meint, wie es naiv ist, den Inhalt mit Stoff oder Material der Dichtung zu verwechseln. Denn der Inhalt ist nach unserem Schema zumindest vierschichtig, wenn nicht fünfschichtig. Die Gestalt (besser: Gestaltung) kann sich auf das Psychologische, das Abbildhafte ebenso wie auf das Wortmaterial beziehen. Selbst der Gehalt kann nach unserem Schema vier bis fünf Schichten umfassen.
Die Strukturanalyse hat immer zu Recht das Zusammenwirken der einzelnen Schichten mehr als diese selbst betont; denn Hartmann erweist, dass "die Formung einer einzelnen Schicht, isoliert, für sich genommen, gar nicht ästhetische Form ist . . . Diese beginnt erst mit dem Hintereinander der Formung verschiedener Art". [16]
Wenn wir als Gehalt der Dichtung für einen Moment ihre drei letzten Schichten verstehen, wäre zu fragen: wie erscheint dieser in der Dichtung? Die Antwort ist: wie im Leben. Er wird zumeist nicht ausgesprochen, sondern erscheint im äußeren Verhalten des Menschen, oft nur in einem kleinen, typischen Ausschnitt seiner Welt, kurz: in dem, was die vorhergehenden Schichten zeigen. Der gute Ausdruck Transparenz ist also als ein Durchscheinen der letzten durch die vorderen Schichten aufzufassen.
Warum muss der Dichter diesen Umweg wählen, wie Goethe so nachdrücklich gefordert hat? - Weil er nur "sehen" lassen kann, was er zeigen will. Die Schichten werden nach hinten zunehmend abstrakter. Gibt er uns psychologische Begriffe, müssen wir diese mit Anschauung füllen.
Was hat es mit der spitzfindigen Unterscheidung in "Intention des Autors und Intention des Werks" auf sich, wenn wir hier "Intention" einmal im Sinne unserer neunten Schicht verstehen? - Sie erweist sich als missverständlich und irreführend, da sie die Auffassung nahe legt, in das Werk könne irgendetwas "einfließen", das nicht (bewusst oder unbewusst) vom Autor käme. Nach unseren Anschauungen von der grundsätzlichen Übereinstimmung der Schichtung im Autor und in seinem Werk ist es leicht verständlich, dass nicht nur die bewussten Schichten der Dichterpersönlichkeit sein Werk prägen, sondern (je nach Autorentyp in verschiedenem Maße) eben auch die unbewussten. Dieses unbewusste Übertragungsverhältnis lässt sich noch weiter führen, nämlich in zweifachem Sinne auf die Umwelt: ebenso wie unbewusste Umwelteinflüsse des Dichters Persönlichkeit und durch diese sein Werk prägen, wirken diese durch das Werk auf die Umwelt zurück.
Schließlich noch eine letzte Frage, in deren Beantwortung sich die pragmatisch-empirisch denkenden angelsächsischen Theoretiker weitgehend von den idealistisch-ontologisch eingestellten deutschen unterscheiden: von welchen Schichten wird der Charakter der Gattungen wie der einzelnen Werke bestimmt? Sollte z. B. die Wirkung des Sonetts auf seinen spezifischen metrischen Bau oder seine lyrisch-philosophisch-bipolare Argumentationsweise zurückgeführt werden? - Diese Frage wird zumeist so diffus wie hier gestellt und dann entsprechend einseitig beantwortet. [18] Hier müssen jedoch unterschieden werden: a. die Entstehungsbedingungen des Sonetts als Gattung in der Renaissance, b. die Gründe für die Beliebtheit und Weiterbenutzung dieser Gattung, nachdem sie einmal vorhanden war, c. die Gründe für die Wahl dieser Gattung durch einen bestimmten Dichter zur Gestaltung eines bestimmten Erlebnisses, d. die Wirkung des einzelnen Sonetts auf uns und ihre Ursachen. - Wie sofort ersichtlich, wird jede dieser Fragen in jedem Einzelfalle verschieden beantwortet werden. Selbst wenn man eindeutig historisch feststellen könnte, dass a und b nicht von außen bestimmt waren (z. B. die Unterstützung eines bestimmten Dichters, der sich dieser Form verschrieben hatte, durch einen Hof und das anschließende In-Mode-Kommen dieser Form), müsste noch in jedem Einzelfalle festgestellt werden, warum der in Frage kommende Dichter diese Form wählte, oh mehr aus äußeren oder inneren Gründen. Die ersten drei Fragen könnte man als teilweise „genetische" von der vierten unterscheiden, die "wirkungsästhetisch" ist. Aber auch die vierte lässt sich nicht generell beantworten. Wer will entscheiden, ob die Wirkung eines spezifischen Sonetts mehr auf seine metrische Struktur oder seinen Gehalt zurückzuführen ist!
Die oben angeschnittenen Fragen sollen nur als Hinweis' auf viele andere» aufgefasst werden, die mit Hilfe des Schichtenmodells geklärt werden können.
Was ist und was leistet „Schichtenpoetik“?
Abstract
Die Schichtenpoetik ist eine erst im 20. Jahrhundert bewusst entwickelte Methode des Nachdenkens über Literatur mit Hilfe eines Schichtenmodells.
Wie der Begriff selbst anzeigt, gehört sie damit in den größeren Zusammenhang der „Schichtenästhetik", die besonders von Nicolai Hartmann [1] und Roman Ingarden [2] entwickelt wurde, und den umfassenderen einer an einem ontologischen Schichtenmodell orientierten Philosophie, die bis auf Aristoteles zurückgeht, [3] im 20. Jahrhundert aber vor allem von Max F. Scheler [4] wieder aufgenommen und von N. Hartmann [5] zu einem umfassenden System ausgebaut wurde.
Aber auch von psychologischen und anthropologischen Schichtensystemen, deren Zusammenfassung und konsequenteste Entwicklung wir Erich Rothacker [6] verdanken, kann sie wertvolle Anregungen erfahren.
Die Anwendung eines Schichtenmodells auf die Literaturanalyse ist mehr phänomenologisch als erkenntnistheoretisch orientiert. Dem Poetologen, Literaturwissenschaftler oder Dichtungsinterpreten geht es weniger um philosophische Einsichten als um eine sachgerechte Erfassung des Sprachkunstwerks und aller darüber hinaus an Literatur zu beobachtenden Erscheinungen. Die Schichtenpoetik rechtfertigt sich deshalb als Instrument des Erkennens und Einordnens einzig von ihren Ergebnissen her. Der philosophische Streit um die Berechtigung von Schichtenmodellen [7] ist für sie irrelevant.
Schichtenmodelle sind Kategoriensysteme, die wir auf die Phänomene projizieren, um sie besser zu unterscheiden, und (als geisteswissenschaftliche Begriffe) nicht limitierend, sondern akzentuierend.
Sie gruppieren Merkmale der Literatur zu Schichten ganzheitlicher Strukturen, die in einem „Integrationszusammenhang" (Lersch) stehen, der dem der menschlichen Persönlichkeit vergleichbar ist. Durch diese Vergleichbarkeit der Strukturen des Sprachkunstwerks einerseits und der Dichterpersönlichkeit andererseits weisen Schichtenmodelle fortwährend über den literarischen Bereich hinaus. Sie entsprechen einem synthetischen, strukturpsychologischen Denken, das die Mitte zwischen allgemeinen Gesetzlichkeiten und individuellen Besonderheiten hält.
Wenn Schichten, als die menschliche Persönlichkeit und ihre Produkte umgreifende Kategorien, sinnvoll und ergiebig sein sollen, müssen sie sowohl ontologischen wie psychologischen Gesetzlichkeiten entsprechen, d.h. in einem doppelten Determinationszusammenhang stehen. (Jede Schicht wird durch die "unter ihr liegende" getragen, bezw. in ihrer Existenz ermöglicht, andererseits aber auch von der "über ihr liegenden" strukturell geprägt.)
Der Vorteil von Schichtenmodellen liegt in der Veranschaulichung an sich abstrakter Relationen von Merkmalen und Merkmalskomplexen. Jedoch ist eine zu große Annäherung an geologische oder biologische Vorstellungen gefährlich, weil die Begriffspaare "hoch-tief", "oben-unten", "außen-innen" oder gar "äußerlich-innerlich bezw. tief" falsche räumliche Vorstellungen und damit verbundene Wertungen für das abstrakte Schichtenverhältnis der Literatur suggerieren. Weil der Charakter von Dichtung als Kunst gerade im Erscheinen mehrerer qualitativ verschiedener Schichten hintereinander besteht, ist es am angemessensten, von vorderen, mittleren und hinteren Schichten (bezw. Vordergrunds -, Mittel- und Hintergrunds schichten) zu sprechen.
Die Verschiedenheit der bisher entwickelten Schichtensysteme (besonders von Hartmann und Ingarden) lässt es praktisch erscheinen, ein synthetisches Schichtenmodell zu entwickeln, das 1. auf dem ontologischen beruht, 2. die wertvollen Beobachtungen Ingardens und Hartmanns ausnutzt, 3. der besonders reich differenzierten Schichtung von Literatur voll Rechnung trägt und 4. zugleich diese mit der Schichtung anderer Kunstarten vergleichbar macht. Ein diesen Forderungen gerecht werdendes Modell habe ich an anderer Stelle [8] vorgeschlagen und ausführlich zu begründen versucht, weshalb ich es hier nur in einem Schema skizziere:
1) Das MATERIAL des Kunstwerks (Farbe, Stein, Ton etc., in Dichtung die Worte und Begriffe der Sprache, die bereits selbst "objektivierter Geist" ist, weshalb hier das Schichtenverhältnis besonders komplex ausfällt) entsprechend der anorganischen Schicht des ontologischen Schemas -
2) Die ORDNUNG im Material, seine Koordinierung und gegenseitige Bezogenheit der Teile, die das Erscheinen der weiteren Schichten ermöglicht und determiniert, nicht aber mit der Formung aller Schichten verwechselt werden darf –
3) Das ABBILDHAFTE im geordneten Material, die erscheinende Gegenständlichkeit, entsprechend der organischen Schicht im ontol. Schema -
4) Der Anschein von BEWEGUNG und LEBEN im (mindestens teilweise) abbildhaft geordneten Material, entsprechend der biologisch-animalischen Welt –
5) Das (noch momentäre) PSYCHOLOGISCHE im lebendig erscheinenden, abbildhaft geordneten Material, Gefühle und Stimmungen mit ihrem Ausdruckscharakter, entspr. der seelischen Schicht im ontol. Schema -
6) HANDLUNG oder das ZEITLICH ÜBERGREIFENDE im psychologisch ausdruckshaltigen, lebendig, abbildhaft geordneten Material -
7) Die Gestaltung der PERSÖNLICHKEIT im durch Handlung als zeitlich übergreifend erlebten, psychologisch ausdruckshaltigen, lebendig, abbildhaft geordneten Material -
8) Das EXEMPLARISCHE, ÜBERPERSONALE und ÜBERZEITLICHE (uns alle angehende) im SCHICKSALHAFTEN der Persönlichkeit im durch etc., entsprechend der geistigen Schicht im ontol. Schema -
9) Das allgemeine WELTGEFÜHL, die WELTEINSTELLUNG, WELTERFAHRUNG, IDEEN des Dichters, ausgedrückt durch das Exemplarische im Schicksalhaften der Persönlichkeit etc.
(Die neun Schichten dieses Modells werden von »vorn nach hinten" zunehmend abstrakter und allgemeiner. Wie ich in der Formulierung auszudrücken versuchte, ermöglicht jeweils die vordere ontologisch die nächst folgende. Zugleich aber determiniert die Formung der abstrakteren die der sie tragenden. Entscheidend für Dichtung als Sprach kunstwerke sind die Vorder- und Mittelschichten. Die Hintergrundsschichten sind ebenso sehr eine Sache der Psychologie und Philosophie wie der Ästhetik. - Dieses Modell sollte allen darstellenden Kunstarten gerecht werden.)
Die Leistungen der Schichtenpoetik sind schon jetzt überraschend und werden sich in Zukunft noch mannigfach erweitern [9]. Sie können hier nur angedeutet werden:
Nur die Schichtenpoetik (vor allem in der Ästhetik N. Hartmanns) vermochte bisher, die Dichtung als Kunst überzeugend zu definieren und von anderen Kunstarten abzugrenzen. Sowohl Ingarden wie Hartmann sehen ihr Wesen in der besonderen Art ihres Schichtenverhältnisses und dessen doppelter Determination. Hartmann gelang es, die Dichtung als in zweifacher Hinsicht (als Sprache und als künstlerische Gestaltung) "objektivierten Geist" (Scheler) in seine allgemeinen ontologischen Kategoriengesetzlichkeiten zu integrieren. Ingarden leistete besonderes in der Analyse des Existenzmodus von Literatur (in "Teilansichten" mit "Unbestimmtheitsstellen"). Beide lieferten eine Fülle phänomenologischen Beobachtungsmaterials, das sich hier nicht einmal andeuten lässt.
Der Schichtbegriff erhellt sich wechselseitig mit dem Strukturbegriff und verhilft somit der Strukturanalyse oder immanenten Interpretation [10] zu einer klaren begrifflichen Fundierung. Hier kann aus dem Vergleich mit dem Strukturbegriff der Psychologie, wie ihn besonders die sogen. Zweite Leipziger Schule (Krüger, Sander, Wellek) [11] entwickelte, noch viel gelernt werden.
Erstmalig gelang es auch mit Hilfe des Schichtenmodells, den Gattungsbegriff als relativ konstante „Schichtenhierarchie" bezw. Schichtenstruktur befriedigend zu definieren und von denen der naturwissenschaftlichen Klassen und Arten abzugrenzen. [12]
Auch die "Fundamentalpoetik“ [13] mit ihren Begriffen der "Grundhaltungen" und "Grundbegriffe" kann aus dem Schichtenmodell entscheidende Anregungen erfahren. Lassen sich doch Beziehungen zwischen der relativen Dominanz bestimmter Schichten und dem Vorherrschen bestimmter Grundhaltungen in einzelnen Kunstwerken sowie ganzen Gattungen zeigen. Die Grundhaltungen der Poetik scheinen Schichten der menschlichen Psyche zu entsprechen, die in das Sprachkunstwerk projiziert werden. Bisher war bereits gezeigt worden, dass sie auch mit den "Sprechhaltungen" der Sprechkunde verwandt sind. [14] Darin liegt kein Widerspruch, sondern eher eine Bestätigung: Müssen doch alle Impulse, die vom Menschen (als Dichter oder Sprecher) in das Sprachkunstwerk eingehen, letztlich identisch sein.
Der Formbegriff, und damit verbunden die Unterscheidung in Form (Gestalt), Stoff (Inhalt) und Gehalt, kann durch das Schichtenmodell genauer (differenzierter) gefasst werden, als bisher. Nicolai Hartmann [15] hat überzeugend nachgewiesen, dass auch die Form (besser: Formung) eines Kunstwerks geschichtet ist bezw. dass jede Schicht ihre eigene Form hat. Es ist deshalb zu ungenau, von der Form des Sprachkunstwerks zu sprechen. (Meinen wir die der sprachlichen Koordination, also des Stils? - oder die der gestalteten Anschaulichkeit, wie sie in den Beschreibungen geboten wird? - oder die der psychologischen Charakterisierung und Motivierung? oder die der menschlichen Haltung, die dahinter erscheint, des Gehalts?) -Auch der "Inhalt" umfasst etwa vier Schichten (3-6), der Gehalt genau genommen ebenfalls drei (7-9).
Aber nicht nur für die allgemeine Literaturtheorie leistet das Schichtenmodell bedeutendes, sondern auch für speziellere Probleme, von denen hier nur einige Beispiele genannt werden können:
Als ein Aspekt der geschichteten Formung erweisen sich z.B. die seit Aristoteles viel diskutierten "drei Einheiten", die dem Drama (ursprünglich der Tragödie) zur Konzentration auf eine Hauptwirkung (Katharsis) verhelfen sollen. Man müsste aber, statt nur von drei Einheiten zu sprechen, die des Sprachmaterials, des Stils, der gegenständlichen Gestaltung eines Weltausschnitts, der Personen in ihrer mimischen und sprachlichen Charakterisierung und psychologischen Motivation, ihrer Handlungen und Schicksale und schließlich deren exemplarischer Bedeutsamkeit, die wiederum eine einheitliche Weltanschauung des Dichters als Thematik und Gehalt erscheinen lässt, berücksichtigen. Die von Lessing am wichtigsten genommene Einheit der Handlung bezieht sich vor allem auf die sechste und siebente Schicht, die unmittelbar die des "Exemplarischen" tragen. Die Einheit des Ortes besagt einfach, dass im Drama kostbare Energien für die Konzentration auf höhere Schichten frei bleiben, wenn die Gegenständlichkeit der dritten nur einmal ausgeführt zu werden braucht und dann unverändert bleibt. - Die Einheit der Zeit trägt dem Verlust an Interesse Rechnung, der eintritt, wenn uns Personen in allzu langen zeitlichen Intervallen vorgeführt werden. Der Held kann sich inzwischen verändert haben. Wir kennen ihn nicht mehr so genau. Die Identifikation mit ihm ist gefährdet, wenn wir uns erst vergewissern müssen, dass er noch derselbe ist und auch seine Lage sich inzwischen nicht entscheidend gewandelt hat.
Auch die Wertkategorien, „immanenter Wahrheit" (wie "Materialgerechtheit", "Angemessenheit", "Funktionalität", "Ökonomie", „Ehrlichkeit", "Lebenswahrheit", "Echtheit" etc.) lassen sich bestimmten Schichten als Kriterien für deren Formung zuweisen.
Die oft gehörte Unterscheidung von "Intention des Autors" und "Intention des Werkes" [16], die sich auf dem Autor unbewusste Wirkungen des Werkes bezieht, wird als irreführend erwiesen und geklärt.
Der spezifische Reiz, den "Kunst des Aussparens und der Andeutung" (z.B. bestimmte Arten der Lyrik, aber auch chinesisch-japanischer Tuschemalerei [17] hat, kann mit dem Schichtenmodell zum ersten Mal befriedigend geklärt werden, - zugleich aber, wie weit die Aussparung gehen darf. Es zeigt sich, dass der Abstraktion Grenzen gesetzt sind, wo die Mittelschichten unser Assoziationsvermögen nicht mehr von den Vordergrundschichten in die Hintergrundschichten leiten können, wo also das Erscheinungsverhältnis gestört ist.
Für die Theorie sogen. "konkreter Dichtung" ergibt sich von daher ein neuer viel versprechender Ansatz.
Eine bestimmte Interpretationsmethode schwer verständlicher Dichtung, die aus anderen Werken bezw. Zeugnissen des Dichters Indizien für das Verständnis "dunkler Stellen" sucht, enthüllt sich für den Schichtentheoretiker als ein Ausfüllen der Mittelschichten, wo der Dichter versagte.
Aber nicht nur die totale Abstraktion (Ungegenständlichkeit), die mit dem Anspruch, Gehalte zu vermitteln, auftritt, sondern auch der konsequente Naturalismus, wie es ihn wohl nur als Forderung in gewissen Manifesten gab, erweist sich als künstlerischer Irrtum aus dem Versagen der Mittelschichten. Dass der konsequente Naturalismus ein Irrweg war, hat man lange gewusst und rein äußerlich aus der Unmöglichkeit seiner technischen Realisierung begründet. Dass "konkrete Dichtung" ihre (in ihrem Medium begründeten) Grenzen hat, wird ebenfalls schon zaghaft geäußert. -Für beides liefert das Schichtenmodell eine im Wesen der Dichtung selbst liegende Begründung.
Schließlich: Die mannigfachen Verbindungsmöglichkeiten der Dichtung mit Musik sowie mit der bildenden Kunst können nun erstmalig in einem Bezugssystem gesehen werden, aus dem sie selbst neue Aufklärung erfahren, und zwar durch Vergleichskategorien wie die der Gegenständlichkeit, der Ansichten und Unbestimmtheitsstellen, des Zeiterlebens und der Spannung.
Das Verhältnis der Schichtenpoetik zur strukturanalytisch orientierten Literaturtheorie ist mit diesen Andeutungen vorläufig umrissen worden. Ihr Verhältnis zur Literatursoziologie ist ebenfalls folgenreich und muss einer gesonderten Untersuchung vorbehalten werden.
SCHICHT, STRUKTUR UND GATTUNG:
ZUSAMMENHANG DER BEGRIFFE [1]
Abstract:
Aus der Überzeugung heraus, dass der Gattungsbegriff nur im Vergleich mit dem Schicht- und Strukturbegriff befriedigend erklärt werden kann, soll hier eine Abgrenzung dieser drei häufig benutzten Termini versucht werden, die zugleich ihre gegenseitige Abhängigkeit erweist.
Schicht:
Das Schichtenmodell hat erst in der Ontologie Nicolai Hartmanns [2], seine volle und konsequente Ausgestaltung erfahren. Hartmanns Kategorienanalyse stellt zugleich die Synthese aller vorhergehenden Schichtenvorstellungen dar. Da wir keine historische Darstellung geben wollen, genügt es, seine Hauptgedanken zu umreißen.
Danach ist die Welt ein Stufenreich. Die Stufen dürfen aber nicht mit den Klassen der Lebewesen verwechselt werden. "Die höheren Gebilde, aus denen die Welt besteht, Pflanze, Tier, Mensch und Volk sind selber geschichtet; die Schichten, aus denen sich die Welt aufbaut, sind auch in ihnen aufzuweisen. So ist der Mensch materielles, organisches, seelisches und geistiges Wesen, besteht aus vier Schichten. Und auch die Menschengemeinschaft, die griechische polis z. B., hat in ihrer geographischen Lage eine materielle Struktur, sie hat ihr organisches Leben, ihre Triebe und Bedürfnisse, aus denen ihre ökonomische Welt erwächst, und sie hat auch ein seelisches und ein geistiges Leben. Die höheren Tiere und das vorgeschichtliche geistlose Bewusstsein des Menschen haben drei Schichten, das niedere Tier und die Pflanze zwei. Der Extension nach ist die materielle Schicht die größte. Je höher die Schicht, umso weniger verbreitet ist sie. Nur auf einem kleinen Teil des anorganischen Seins baut sich das organische auf, wieder nur in den am höchsten entwickelten organischen Gebilden findet sich Seelisches, und nur in einer Art der beseelten Lebewesen gibt es Geist." [3]
Wenn alle Gefüge der niederen Schicht Elemente zum Aufbau der höheren werden, spricht Hartmann von einem "Überformungsverhältnis" (zwischen der Materie und dem Anorganischen). Das "Überbauungsverhältnis" der beiden nächst höheren Stufen unterscheidet sich dadurch, dass bei ihm nur ein Teil der Kategorien der niedrigeren Schicht in die höhere eindringt. "Der prinzipielle Unterschied zwischen der seelischen und den beiden unteren Schichten besteht in der Unräumlichkeit, der Innerlichkeit der seelischen Inhalte (psychophysische Grenzscheide). Das Geistige hebt sich wiederum vom Seelischen vornehmlich ab durch seine Überindividualität." [4]
Im Unterschied zu den einfachen Kategorien bestimmen die Fundamentalkategorien alle vier Schichten. Zu ihnen gehören die "kategorialen Gesetze, " in deren Fixierung eine Hauptleistung dieses Systems liegt. Es ist letztlich für uns nicht wichtig, ob wir mit Hartmann in allen Einzelpunkten übereinstimmen und wie wir seine Schichten weiter unterteilen. Aus den "Gesetzen der kategorialen Dependenz" ergibt sich aber, dass die vier Hauptschichten zwar verschieden ausdifferenziert werden können (wie Hartmann selbst in seiner Ästhetik tut) - nicht aber in ihrer Reihenfolge vertauscht werden dürfen. Denn die niedere Schicht ist immer die stärkere (Gesetz der Stärke) und in sich autonom (G. der Selbständigkeit), bildet aber die Materie für die höhere (G. der Materie), die wiederum durch ihr "Novum" Spielraum für höhere Gesetzlichkeiten besitzt (G. der Freiheit).
Es kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass diese Schichtengesetzlichkeit sich in völliger Übereinstimmung mit den wichtigsten psychologisch-anthropologischen Schichtenmodellen befindet, deren Synthese und gründlichste Ausarbeitung wir Erich Rothacker verdanken [5].
Aber nicht nur für die allgemeine Ontologie hat Hartmann das umfassendste Schichtenmodell entwickelt, sondern auch für die Ästhetik. [6] Das Kunstwerk ist Erzeugnis und Ausdruck des Menschen zugleich und deshalb ebenso geschichtet wie er. [7] Dass die Schichten des Kunstwerks feiner ausdifferenziert werden, täuscht uns nicht darüber hinweg, dass sie auf den ontologischen beruhen.
Im Sprachkunstwerk unterscheidet Hartmann, von außen nach innen fortschreitend, sieben Schichten: 1. den realen Vordergrund oder die Realschicht (Wort und Schrift); 2. den irrealen Vordergrund oder die Zwischenschicht, die auch gelegentlich "zweiter Vordergrund erscheinender Wahrnehmbarkeit, unmittelbar anschaulich durch die Phantasie" genannt wird; gelegentlich spricht er auch von den "mittleren Schichten" und unterscheidet dann die "Sphäre des Äußeren, der körperlichen Bewegung, Stellung, Mimik, Rede" von der "Schicht der Handlungen, des äußeren Verhaltens, der Reaktionen und Aktionen" (3) und von dieser die "Schicht der seelischen Formung, der Gefühle und Stimmungen" (4) und die des Schicksals (5); vom irrealen Vordergrund hebt sich der "irreale Hintergrund" (oder "die letzten Hintergrundsschichten") ab, der ideenhaft und überempirisch ist, und zwar die "Schicht der individuellen oder Persönlichkeitsidee" (6) und die "Schicht des Allgemeinmenschlichen, der Ideen" (7).
Für das Sprachkunstwerk im Besonderen (und später auch in Ausweitung für andere Kunstarten) wurde jedoch noch ein weiteres Schichtenmodell entwickelt (wahrscheinlich unabhängig von Hartmann): Der polnische Philosoph Roman Ingarden [8] unterscheidet nur fünf Schichten: 1. die der Wortlaute und der auf ihnen aufbauenden
Lautgebilde höherer Stufe; 2. die der Bedeutungseinheiten verschiedener Stufen, der Satzsinne und Satzzusammenhänge; 3. die der "mannigfachen schematisierten Ansichten, in welchen die im Werk dargestellten Gegenstände verschiedener Art zur Erscheinung gelangen", 4. die der dargestellten Gegenständlichkeiten und ihrer Schicksale, welche in den durch die Sätze entworfenen intentionalen Sachverhalten dargestellt werden; 5. die der ausgedrückten Idee, der metaphysischen Qualitäten, der Wesenheiten.
Ein Vergleich von Hartmanns und Ingardens Aufteilungen ergibt folgendes[9]:
a) Hartmanns Realschicht (1) wird bei Ingarden, der stark linguistisch interessiert ist, nochmals aufgeteilt. Der Unterscheidung von Wortlauten und Bedeutungseinheiten entspräche in der Malerei etwa die von Farben und Schwarz-Weißtönungen als einfachsten Aufbauelementen einerseits und Linien bezw. den durch sie gegebenen Umrissen und Proportionen andererseits. Denn die Bedeutungseinheiten (Satzsinne) werden nur durch das syntaktische Zusammenfügen von Wortlauten ermöglicht; ebenso die Umrisse und Proportionen durch das Zusammenspiel oder Ordnen von Farben und Schwarz-Weißtönungen. (Diese Vergleiche mit anderen Kunstgebieten mögen hier als unverbindlich spielerische hingenommen werden, die nur anregen sollen. Da Schichtentheorien ohnehin, im Vergleich zu exakter Wissenschaft, "spekulativ" sind, ist nicht einzusehen, warum die "kategoriale Dependenz" hier nicht einen flüchtigen Hinweis auf Gemeinsamkeiten rechtfertigen sollte.) In einer noch gewagteren Parallele ließe sich auch an die Entsprechung von anorganischer und organischer Seinsweise denken. Denn ebenso wie die Wortlaute erst im Satzzusammenhang eine Funktion für die Bedeutungseinheit bekommen, ebenso wie die Farben nur in Umrissen und Proportionen in ein Verhältnis zueinander treten können, so erhält auch die anorganische Materie erst im Funktionszusammenhang des Organismus (im weitesten Sinne) Umriss, Aufgabe und Sinn. Eine allgemeine Unterscheidung der Schichten des Materials und der Ordnung ist deshalb gerechtfertigt.
b) Ingardens Schicht der "dargestellten Gegenständlichkeiten und ihrer Schicksale" (Hervorhebung vom Vf.) entspricht etwa Hartmanns "mittleren Schichten" (2-5), nämlich der "des Äußeren" (2), der der Handlungen (3), der der "seelischen Formung" (4) und der des Schicksals (5) zusammen. Hier differenziert Hartmann, dem es mehr auf das Erlebnis in der Dichtung ankommt, wesentlich feiner.
Diese mittleren Schichten werden wiederum schon deshalb zu Recht unterschieden, weil sie nicht nur in der Dichtung erscheinen. Etwa in der Malerei und Bildhauerkunst ermöglicht die Anordnung des Materials das Abbilden des Wahrnehmbaren, das uns im Allgemeinen als Umwelt vertraut ist. Abbildungen sind jedoch zunächst leblos, bis durch die Kunst der Gestaltung und durch unsere Assoziation der Anschein von Bewegung und mit ihm von Leben entsteht. Wir würden aber in Formen kein Leben "hineinsehen, " wenn diese nicht wenigstens teilweise unserer vertrauten Umwelt entnommen wären, also Abbildungscharakter hätten. Wiederum lässt sich durch das Abhängigkeitsverhältnis der etwas gewagte Vergleich mit den ontologischen Schichten weiterführen: Ebenso wie Bewegung nur in abbildenden Ordnungen gesehen werden kann, braucht das animalisch-biologische Leben die Schichten des Organischen und Anorganischen, um überhaupt existieren zu können.
Das Psychologische oder Seelische ist wiederum nur in bewegten Lebewesen möglich, sein Erscheinen in der Kunst dementsprechend nur in Material, das so angeordnet ist, dass es Ausschnitte unserer Umwelt abbildet und in dieser Bewegung assoziieren lässt. (Für die Malerei bedarf es dazu keineswegs der Abbildung "bewegter" Schlachtszenen. Der "lebendige" Blick eines Portraits genügt, um das Seelische zu vermitteln.)
Wo das Seelische nicht mehr punktuell sondern in zeitlichen Dimensionen gesehen wird, wo wir also äußere und innere Entwicklung verfolgen oder gar das Ganze eines Lebens überschauen können, lässt sich von einer weiteren Schicht sprechen. Wiederum leuchtet sofort ein, dass auch hier die kompliziertere auf der einfacheren ruht: ohne die Darstellung einzelner psychologischer Momente lässt sich eine Entwicklung nicht wiedergeben. Diese Schicht ist in der Dichtung (als "Zeitkunst") stärker entwickelt, besonders in Epik und Dramatik. Aber auch ein kurzes lyrisches Gedicht der Sappho kann das Schicksalhafte darstellen, ebenso wie ein Altersportrait von Rembrandt.
Damit ist aber zugleich angedeutet, dass das Schicksalhafte, wo es exemplarisch (überpersönlich gültig) wirkt, bereits die Zeitdimension mitenthält. Wer eine exemplarische Person darstellt, und sei es in der "Momentaufnahme" eines Portraits, stellt zugleich ihr Schicksal dar, wenn nicht in den Einzelheiten, so doch im Wesentlichen. Jede Falte in einem von Rembrandt gemalten Gesicht verweist auf bereits Erlebtes oder auf Anlagen, und damit auf noch zu Erlebendes. (In der Literatur kommt der Bezug einer exemplarisch gesehenen Persönlichkeit auf ihr Schicksal und Werk besonders deutlich in Goethes Dichtung und Wahrheit zum Ausdruck.)
c) Ingardens Schicht der "metaphysischen Qualitäten" ist bei Hartmann wiederum nochmals aufgeteilt und entspricht denen der "individuellen Idee" (6) und des "Allgemeinmenschlichen" (7). Diese beiden "letzten Hintergrundschichten" scheinen bei Hartmann den beiden vorhergehenden zu entsprechen, indem sich jeweils die erste auf das Einzelerlebnis und die zweite auf die Erlebniskette, das Schicksal, bezieht. Sie unterscheiden sich aber durch ihren "ideenhaft-überempirischen" Charakter, also durch das, was Hartmann andernorts als Eigenschaft der ontologischen Schicht des Geistigen beschreibt [10]. Besser würde sich m. E. der Begriff des "Exemplarischen" eignen, um das Überpersonelle und Überzeitliche und deshalb Beispielhafte und uns alle Angehende zu bezeichnen, das die Gestaltung von Figuren wie Schicksalen im Goetheschen Sinne "bedeutend" machen kann. Denn auch diese Schichten sind letztlich aus der Erfahrung abgeleitet, "abstrahiert, " und deshalb nicht wirklich "überempirisch." Hartmann deutet das in seiner Beschreibung des Misslingens der sechsten Schicht auch an.
d) Man könnte ebenso gut drei Schichten des irrealen Hintergrunds unterscheiden: die exemplarische Figur, das exemplarische Schicksal und die Welterfahrung des Dichters, die sich durch sein Werk auf andere überträgt (wie etwa Kafkas beängstigendes Weltgefühl, Brechts didaktisch-satirische Welteinstellung oder Kleists tragische Welterfahrung, schließlich die ganzer "Schulen, " wie des absurden Theaters). Hartmann und Ingarden haben in ihrer letzten Schicht zweifellos an diesen alles bedingenden Hintergrund gedacht, aber den möglichen exemplarischen Charakter eines Schicksals (man denke an Wallenstein, Othello, Faust etc.) nicht in Betracht gezogen.
Auch in den "letzten Hintergrundsschichten" lässt sich das ontologische Abhängigkeitsverhältnis noch zeigen: Eine exemplarische Welterfahrung lässt sich nur in exemplarischen Persönlichkeiten und ihren Schicksalen zeigen. Persönlichkeiten und Schicksale müssen aber erst einmal als solche dargestellt werden, um exemplarisch wirken zu können, etc.
e) Zu Ingardens Schicht der "mannigfachen schematisierten Ansichten" findet man bei Hartmann keine Entsprechung. Da die beiden Denker wenig aufeinander eingehen, können wir nur vermuten, dass Hartmann eine solche "Schicht" als den übrigen unvergleichbar zurückgewiesen hätte, da sie nicht den Phänomenen als solchen zukommt, sondern sich nur auf unser Erkennen der Phänomene bezieht (Blickpunkt). Ingardens durch Husserls Phänomenologie beeinflusste Feststellungen über die Konkretisation des literarischen Werkes und die Rolle der "Unbestimmtheitsstellen" sind zwar äußerst wertvoll, sagen aber mehr über unsere Realisation des literarischen Kunstwerkes aus, als über dessen ontologische Struktur, (falls wir ihm überhaupt eine selbständige zuschreiben).
Im Vergleich von Ingardens und Hartmanns Schichtenmodellen wurde bereits eine mögliche Synthese angedeutet, die hier in Tabellenform zusammengefasst wird: [11]
1) Das Material: Wort, Farbe, Ton, Stein etc. (entspr. anorgan. Sein)
2) Die Ordnung im Material (Bau, Koordination, gegenseitige Bezogenheit der Teile etc.)
3) Das Abbildhafte im geordneten Material (entspr. organ. Sein)
4) Der Anschein von Bewegung und Leben im (mindestens teilweise) abbildhaft geordneten Material (entspr. biolog.-animal. Sein)
5) Das Psychologische im lebendig erscheinenden, abbildhaft geordneten Material (entspr. seelischem Sein)
6) Die Handlung oder das Zeitlich-Übergreifende im psychologisch, lebendig, abbildhaft geordneten Material
7) Das Exemplarische im Psychologischen (in Personen; in Schicht 5) und in der Handlung (in Schicksalen; in Schicht 6) (entspr. geistigem Sein)
8) Das allgemeine Weltgefühl, die Welteinstellung, die Welterfahrung, die Ideen (des Dichters) ausgedrückt durch alle übrigen Schichten.
Unser Versuch einer Synthese für das Schichtenmodell ist so weit gefasst, dass es allen darstellenden Kunstarten Raum bieten sollte.
Struktur:
Es stellt sich nun heraus, dass, was wir beim Sprachkunstwerk für gewöhnlich unter Struktur verstehen, nichts als das Zusammenwirken seiner oben erläuterten Schichten ist. Strukturanalyse ist also Schichtanalyse, und das haben Kayser und Staiger zweifellos auch gemeint, wenn sie den Strukturbegriff etwa im Sinne von Herman Meyer verstanden: "Form und Inhalt sind beide Material im Sprachkunstwerk [...] sie gehören zur Struktur, insoweit sie miteinander in Verbindung treten und an der ästhetischen Ordnung des Werkes teilhaben, indem sie diese mitstatuieren." [12] Die Gliederung in Stoff (oder Inhalt), Form (oder Gestalt) und Bedeutung (oder Gehalt) verträgt sich durchaus mit dem Schichtenmodell, ist aber im Vergleich dazu sehr grob. Nicolai Hartmann hat uns die Augen dafür geöffnet [13], "dass selbst die Form des Kunstwerks immer gestaffelt ist, d.h. jede einzelne Schicht ihre eigene Formung aufweist. Das zeigt sich bereits darin, dass wir nach jeder Schicht (vom Material bis zum Weltgefühl) sowohl mit WAS als auch mit WIE fragen können. Wenn wir es z.B. in der zweiten Schicht der Dichtung mit sinnvoll strukturiertem Wortmaterial zu tun haben, wäre noch immer zu fragen, wie es geformt ist (Stil). Die verschiedenen Schichten können überhaupt nur in einer bestimmten Form vorhanden sein. Es ist deshalb unsinnig, nach der Form eines Sprachkunstwerks zu fragen (allenfalls Formung), wie es naiv ist, den Inhalt mit Stoff oder Material der Dichtung zu verwechseln. Denn der Inhalt ist nach unserem Schema zumindest vierschichtig. Die Gestalt (besser: Gestaltung) kann sich auf das Psychologische, das Abbildhafte ebenso wie auf das Wortmaterial beziehen. Selbst der Gehalt kann nach unserer Ansicht zwei bis drei Schichten umfassen.
Die Strukturanalyse hat immer zu Recht das Zusammenwirken der einzelnen Schichten mehr als diese selbst betont; denn Hartmann erweist, dass "die Formung einer einzelnen Schicht, isoliert, für sich genommen, gar nicht ästhetische Form ist [...] Diese beginnt erst mit dem Hintereinander der Formung verschiedener Art." [14]
Wenn wir als Gehalt der Dichtung für einen Moment ihre beiden letzten Schichten verstehen, wäre zu fragen: wie erscheint dieser in der Dichtung? Die Antwort ist: wie im Leben. Er wird zumeist nicht ausgesprochen, sondern erscheint im äußeren Verhalten des Menschen, oft nur in einem kleinen, typischen Ausschnitt seiner Welt, kurz: in dem, was die vorhergehenden Schichten zeigen. Der gute Ausdruck Tran sparenz ist also als ein Durchscheinen der letzten durch die vorderen Schichten aufzufassen.
Warum muss der Dichter diesen Umweg wählen, wie Goethe so nachdrücklich gefordert hat? Weil er nur "sehen" lassen kann, was er zeigen will. Die Schichten werden nach hinten (oder innen) zunehmend abstrakter. Gibt er uns psychologische Begriffe, müssen wir diese mit Anschauung füllen.
Was hat es mit der spitzfindigen Unterscheidung in "Intention des Autors und Intention des Werks" [15] auf sich, wenn wir hier "Intention" einmal im Sinne unserer letzten Schicht verstehen? Sie erweist sich als missverständlich und irreführend, da sie die Auffassung nahe legt, in das Werk könnte irgendetwas "einfließen," das nicht (bewusst oder unbewusst) vom Autor käme. Nach unseren Anschauungen von der grundsätzlichen Übereinstimmung der Schichtung im Autor und im Werk ist es leicht verständlich, dass nicht nur die bewussten Schichten der Dichterpersönlichkeit das Werk prägen, sondern (je nach Autorentyp in verschiedenem Maße) eben auch die unbewussten. Dieses unbewusste Übertragungsverhältnis lässt sich noch weiter führen: ebenso wie unbewusste Umweltseinflüsse des Dichters Persönlichkeit und durch diese sein Werk prägen, wirken diese durch das Werk auf die Umwelt zurück.
Gattung:
Strukturen, die sich besonders gut als Ausdrucksvehikel für menschliche Standarderlebnisse eignen, werden mit leichten Abwandlungen wiederholt. Diese nennen wir Gattungen. Die Schichten des Sprachkunstwerks verfestigen sich gleichzeitig zur individuellen Struktur des jeweiligen Kunstwerks und zur relativ konstanten Gattungsstruktur, je nach unserem Blickwinkel. Gattungen sind also Gruppierungen von Dichtungen, die sich in der entscheidenden Struktur ihrer Schichten ähneln. Sie haben sich wegen ihrer besonderen Eignung zum Ausdruck menschlicher Grunderlebnisse und Grundhaltungen verfestigt. Aus ihrer relativen Konstanz, die sie mit anderen geisteswissenschaftlichen Begriffen teilen, folgt, dass sie nicht limitierende sondern akzentuierende "Idealbegriffe" sind. Die verschiedenen Gattungen sind in ihrer Struktur verschieden stark festgelegt, das Sonett z. B. stärker als der Roman.
Für ihre Schichten gilt das gleiche doppelte Bedingungsverhältnis, das auch jedes einzelne Sprachkunstwerk charakterisiert: Einerseits kann jede Schicht nur auf den unter ihr liegenden existieren; andererseits wird ihr Charakter aber durch die höheren geprägt. [16]
Nur Dichtung großen Stils (Epos, Roman, Drama) entfaltet alle Schichten und auch sie nicht in gleicher Weise. Es scheint aber, dass im Einzelwerk ebenso wie in der Gattung keine Zwischenschicht ganz ausgelassen werden darf, da jeweils die nächst höhere auf ihr aufruhen muss. Auch die Lyrik, die zumeist keine Handlung und Konflikte aufweist und von der Sphäre des Äußeren oder dem Abbildhaften direkt zur Schicht der Gefühle und Stimmungen, dem Psychologischen leitet, macht nur scheinbar eine Ausnahme. In Wirklichkeit wird auch hier die Schicht des bewegten Lebens nicht ganz übersprungen: Das "sprechende Ich" des Dichters, mit dem wir uns im günstigen Falle ebenso identifizieren, wie mit der epischen und dramatischen Figur, vertritt die scheinbar fehlende Schicht; ohne sie könnte das Sprachkunstwerk nicht funktionieren. Denn wenn es auch oft den Anschein hat, so ist es doch unmöglich, dass die Dinge direkt zu uns sprechen. Sie sind tot ohne die persönliche Perspektive des "lyrischen Ichs," so sehr dieses auch mit ihnen verschmelzen mag. Jedoch tragen die charakteristische Art und Stärke, in denen der lyrische Sprecher noch anwesend ist, zur Unterscheidung der lyrischen Gattungen bei, wie in Gedanken- und Gefühlslyrik, Sonett und Lied.
Diese "ontologisch-phänomenologische" Beschreibung der Gattung schließt die historische nicht aus; sie ergänzt und begründet sie vielmehr. Wenn man weiß, wie etwas beschaffen ist (ontologische Beschreibung) und warum (psychol.), wird darum die Frage danach, unter welchen historischen oder soziologischen Umständen es sich gerade so und nicht anders entwickelte, noch nicht überflüssig. Andererseits versteht man aber die Geschichte und Umweltbeziehung eines Phänomens nur, wenn man es zuvor selbst begriffen hat.
Vom Gattungsbegriff müssen mehrere andere, verwandte Einteilungskategorien der Literaturwissenschaft abgegrenzt werden:
1. Die allgemein-menschlichen Grundhaltungen der Welterfahrung, die sich auch in der Dichtung auswirken, seit der Romantik unterscheidet man vor allem die lyrische, epische und dramatische-, gelegentlich aber wird eine vierte geltend gemacht, z.B. die didaktische [17] ;
2. Die Auswirkungen der Grundhaltungen als ihnen entsprechende und bereits in der Sprache nachweisbare Elemente,"das Lyrische, das Epische, das Dramatische"; zu diesen subjektivierten Adjektiva gesellen sich andere, die schwer von ihnen abzugrenzen sind, z.B. "das Didaktische, Tragische, Komische, Absurde" etc.
3. Noch abstrakte Gruppierungen von Sprachkunstwerken, in denen jeweils eine der Grundhaltungen die anderen überformt, die Grundbegriffe"Lyrik, Epik, Dramatik" etc.
4. Spezifizierte Grundbegriffe in verschiedenen Graden der Eingrenzung wie "Gedankenlyrik" oder "didaktische Gedankenlyrik."
5. Auf die Gestalt zielende Sammelbegriffe, die noch nicht so stark eingegrenzt sind wie die Gattungen, z.B. "Gedicht, Theaterstück, Prosa."
6. Die Untergliederungen der Gattungen nach formalen oder gehaltlichen Gesichtspunkten, die wir Arten und (weiter untergliedert) Typen nennen sollten.
Im Sinne dieser Einteilungskategorien würde man etwa den Detektivroman als einen Typ der umfassenderen Art Kriminalroman auffassen, der sich nur durch die zentrale Figur (z.B. Sherlock Holmes) unterscheidet. Der Kriminalroman wiederum hebt sich durch Inhalt (Verbrechen) und spannende Handlung (das Rätsel: Wer ist der Täter?) von der noch umfassenderen Gattung des Romans ab. Der Roman aber gehört zu den epischen Kunstwerken, also zum Grundbegriff Epik. Diese haben gemeinsam, dass in ihnen die epische Grundhaltung (trotz der besonders im Kriminalroman reichlich nachweisbaren dramatischen Elemente) die anderen überwiegt. Durch ihre Form gehören sie gleichzeitig zum Sammelbegriff Prosa.
Die Frage, ob man aus der Überschau über die Geschichte der Gattungen ihre weitere Entwicklung voraussagen kann, muss vom Gesichtspunkt ihrer inneren Bedingtheit verneint werden. Da "Formen" nicht aus sich heraus leben, selbst wenn sie nachgeahmt werden, sondern sich mit dem "Gehalt" wandeln, müssten wir erst in der Lage sein, künftige "Gehalte" zu erraten und könnten auch dann noch nicht auf die "Formen" schließen, in denen sie sich ausdrücken werden.
Dass jedoch eine neue Welterfahrung erstaunliche Parallelen in der Umformung etwa gleichzeitiger Gattungen bewirken kann, lässt sich empirisch an den Gattungen zeigen, die "typisch" für das 20.Jh. zu sein scheinen, besonders wenn sie schon vorher existierten und sich kürzlich auf charakteristische Weise verändert haben (Kurzgeschichte, Nouveau Roman, Einakter, Theater des Absurden) [18].
ÜBER OSTASIATISCHE TUSCHMALEREI UND KALLIGRAPHIE[1]
Versuchen wir einmal, ganz ohne weltanschaulichen Hintergrund schichtenästhetisch[2] "zu begreifen, was uns ergreift" (E. Staiger):
Wenn wir chinesische und japanische Wiedergaben von legendären Landschaften und Personen [3] betrachten, die mehr als siebenhundert Jahre lang unter bewusstem Verzicht auf Farbigkeit in sparsamen Tuschkonturen ausgeführt wurden, dann unterscheiden sich diese von der etwa gleichzeitigen westlichen Malerei zuerst einmal dadurch, dass die sog. , Mittelschichten" nur in äußerster Verknappung geboten werden. Sie werden deshalb zu Recht gelegentlich als "Kunst der Andeutung" oder "Kunst der Aussparung" bezeichnet, was das gleiche bedeutet. „Ausgespart" bzw. nur „angedeutet" werden (hinter den Schichten des Materials, Papier und Tusche, und dessen Ko ordinierung in einer bestimmten Ordnung von weißen und schwarzen Flächen und Linien): die Schicht der Gegenständlichkeit, die der Bewegung und Lebendigkeit und schließlich die angedeuteten Handlungsabläufe. Es versteht sich von selbst, dass zu diesen jeweils ihr negativer Gegenpol gehört: zur Gegenständlichkeit eben die Leere, zur Bewegung und Lebendigkeit die Ruhe und Leblosigkeit, zur Andeutung von Handlung (Bewegungsabläufen) die Handlungslosigkeit (wie etwa im Still-Leben). Ebenso versteht sich, dass nur die beiden ersten Schichten tatsächlich gegeben sind (das geordnete Material), die Mittelschichten von diesen aber gerade dadurch unterschieden werden, dass sie nur durch unsere aktive Beteiligung (in Assoziation und Projektion) zustande kommen. Je „weiter hinten liegend", d. h. abstrakter, die Schicht ist, umso größer wird unsere Leistung, wenn wir sie „realisieren". Da aber in jeder Art von Kunst die Mittelschichten nur in mehr oder weniger ausgeführten Andeutungen (Ingarden: „in schematischen Ansichten mit Unbestimmtheitsstellen") gegeben sind, müssen wir immer ergänzen, wenn wir von den Vordergrundsschichten über die Mittelschichten zu denen des „Hintergrunds" (Gefühlsausdruck, Stimmung, „Weltanschauung" oder „metaphysischen Qualitäten") vordringen wollen.
Die Schichtenästhetik (zumindest in ihrer Prägung durch Nicolai Hartmann) neigt zu der Ansicht, dass gerade in dieser Tätigkeit des „Ergänzens", die nicht mit freiem Phantasieren verwechselt werden sollte, eine wesentliche Quelle des „Kunstgenusses" liegt. Umgekehrt würde sie das Kunstwerk dieser Art als einen Gegenstand definieren , dessen Vordergrundsgestaltung uns zur Realisierung einer Folge von hintereinander erscheinenden Schichten zunehmender Abstraktheit stimuliert. Dieser Vorgang ist aber durchaus nicht willkürlich in seinem Verlauf, sondern wird durch bestimmte, in den Vordergrundsschichten gegebene Leitlinien festgelegt, zumindest in gegenständlicher Kunst. Und die Tuschmalerei, von der wir hier sprechen, ist „gerade noch gegenständliche Kunst".
Es ist über die unterbrochenen (oder abgebrochenen) Konturen und über die weißen Zonen in ihr geschrieben worden, die wir ergänzen müssen, ebenso über die monochromatische oder schwarzweiße Gestaltung, in die wir Farbigkeit projizieren. Dergleichen gibt es in westlicher Kunst natürlich auch hier und da. Entscheidend ist die Frage, wieweit diese Aussparungen gehen und gehen können. - Man kann sie, wie zumeist im deutschen Schrifttum, profund beantworten - oder aber (im Sinne der Schichtenästhetik) einfach: Die Aussparungen können in jeder Schicht nur so weit gehen, dass diese den angezielten Betrachter noch eben in die nächste zu leiten vermag. Diese Grundforderung haben alle ostasiatischen Künstler (bewusst oder unbewusst) eingehalten; und dadurch unterscheiden sie sich von allen Richtungen der westlichen gegenstandslosen Kunst.
Was bedeutet sie? Nicht mehr und nicht weniger als die Verwirklichung der Einsicht, dass in der Malerei die gleichen ontologischen Gesetzlichkeiten gelten wie in der übrigen visuell erfahrenen Welt: dass Abstrakteres nur im jeweils Konkreteren erscheinen und Geistiges nicht „frei im Raume schweben" kann.
Um ein einziges Beispiel einer solchen „Schichtung" zu konstruieren, wobei wir mit der abstraktesten und allgemeinsten Schicht anfangen und uns stufenweise zu den konkretesten und speziellsten vorarbeiten: Wer etwa die metaphysischen Qualitäten „Weisheit, Weltentrücktheit, Seelenfrieden" malen will, kann das nicht direkt mit formalen Elementen tun, sondern muss sich dazu des Wesens bedienen, welches als einziges solche Qualitäten erleben und ausdrücken kann, des Menschen. Mit Farbenkonstellationen an sich verbinden wir nämlich keine metaphysischen Qualitäten, - jedenfalls nicht spontan und ohne Stichwort des Künstlers. Wenn ein Maler wie etwa Franz Marc nur Tiere malt oder ein anderer etwa nur „arkadische Landschaften", sind wir genötigt, die zuvor erwähnten Qualitäten in diese zu projizieren. Wir tun es nur, wenn wir es zuvor als kulturelle Konvention gelernt haben, jedoch kaum spontan. Denn Tiere und Landschaften können noch so „friedlich" aussehen - wir identifizieren uns mit ihnen normalerweise nicht, wie man an Kulturen ablesen kann, die noch keine „Romantik" durchgemacht haben.
In jedem Falle aber hätten wir es auch dann noch mit ausdruckshaltiger Gegenständlichkeit zu tun, die so gestaltet sein muss, dass wir die Qualitäten der letzten Schichten in sie hineinprojizieren können. Wie viel wir davon geben müssen, hängt von den angezielten Betrachtern und der Zielsetzung des Künstlers ab. Eine isolierte Figur in einer weiträumigen Landschaft (wie häufig bei C. D. Friedrich) suggeriert zunächst nur die Assoziation: Einsamkeit. Wenn die Figur uns den Rücken kehrt oder (wie so oft in ostasiatischen Darstellungen) im Halbprofil in die Landschaft schaut, assoziieren wir etwas wie , , Naturversunkenheit" oder „Meditation". Viel hängt natürlich auch von der Körperhaltung ab. Es macht einen großen Unterschied aus, ob in einem Gemälde der europäischen Romantik eine Frauenfigur aufrecht das Aufsteigen des Mondes über dem fernen Meereshorizont erwartet, oder ob auf einer japanischen Bildrolle ein rundlicher Weiser (Hotei) sich bequem gegen die Rundung seines Sackes lehnt. In die zuerst beschriebene Haltung assoziieren wir vielleicht „gespannte Ergriffenheit" bzw. „Erwartung", - in die zweite etwa „entspannte Gelassenheit" oder auch „heitere Ergebung", die bis ins Körperliche geht. - Der Eindruck der Heiterkeit kommt auch durch ein prononciertes Detail zustande: dieser Weise hat einen ausgeprägten Bauch, dessen Rundung genau der seines Sackes (und vielleicht der seines Kahlkopfes) entspricht, - auf einer berühmten Darstellung auch der des Mondes, den Hotei sitzend meditiert.
Es sind aber für die Japaner vielleicht drei (sich gegenseitig verstärkende) Elemente, die diesen Eindruck erzeugen, und nur die beiden ersten haben sie mit uns gemeinsam: einmal werden die Gestaltpsychologen uns versichern, dass runde Formen überhaupt „in sich ruhend" und deshalb „beruhigend", weil „nicht aggressiv", wirken; dazu kommt als zweites die allgemeinmenschliche Erfahrung, dass Pykniker zumeist heiterer sind als die Leptosomen (Shakespeare: Julius Cäsar, I 1: „Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein.") Darüber hinaus ist aber für den Japaner Hoteis runder Bauch (ebenso wie sein Sack) Symbol für Weisheit und Abgeklärtheit. Der gebildete Japaner wird vielleicht sogar die Situation (Reise usw.) assoziieren, in der Hotei dargestellt ist.
Worauf es uns ankommt, ist, zu zeigen, dass einerseits abstraktere Anmutungserlebnisse immer von den jeweils konkreteren Schichten abhängen, in (oder besser: hinter) denen sie erscheinen, bzw. von denen sie ontologisch , , getragen" werden, - andererseits aber die Ausführung der Mittelschichten auch von der Gabe des angezielten Betrachters abhängt, sie durch Assoziation und Projektion zu ergänzen. Fehlen darf aber keine Schicht, weil sonst das für bildende Kunst so eigentümliche Erscheinungsverhältnis unterbrochen bezw. abgeschlossen ist. Das Kunstwerk als überpersonales Gebilde reicht immer nur bis zu seiner letzten noch eben ausgeführten Schicht, wobei keine ganz übersprungen werden kann. Dahinter liegt allenfalls subjektive Spekulation oder Willkür des Betrachters.
Der Reiz einiger Meisterwerke ostasiatischer Tuschmalerei liegt nun eben darin, dass der Assoziationsfähigkeit des Betrachters maximal Raum gegeben wird (durch Aussparung), während doch zugleich an jenem Minimum an Ausführung der Mittelschichten festgehalten wird, das uns zu den Hintergrundsschichten des Gehalts leitet. Nur so kann erklärt werden, dass solche uns kulturell so fern liegenden Gebilde uns weniger „fremd" anmuten als so manche Kolossalgemälde des sozialistischen Realismus, aber eben auch als viele Schöpfungen der gegenstandslosen Kunst unserer Zeit. Zu eindeutige Ausführung der Mittelschichten wirkt leicht banal. Ihre konsequente Aussparung verunsichert. Die Stimulierung unserer Phantasie bei gleichzeitiger Vermeidung der Frustration, die durch Willkür verursacht wird, empfinden wir als lustvoll.
Um nun zu verstehen, wie eine solche Kunst „am Rande der totalen Abstraktion" möglich ist, müssen wir die zuvor unterbrochene Betrachtung eines imaginären Beispiels bis in die Vordergrundsschichten fortsetzen, wobei ein Vergleich mit der Kalligraphie aufschlussreich wird: Bewegte Gegenständlichkeit (Hotei, sein Sack und vielleicht sein Maultier in einer traditionellen Landschaft) wird durch spontan-wirkende Pinselstriche angedeutet. Sind sie aber wirklich „spontan", etwa im Sinne des Tachismus? Wenn manche „abstrakte Expressionisten" ihre spontanen Gestaltungen des „gelenkten Zufalls" mit der kühnen Pinselführung der Tuschmalerei und Kalligraphie vergleichen, übersehen sie, dass die „Spontaneität" asiatischer Künstler auf geduldigster Einübung erprobter Traditionen fußt. Sie ist zum Reflex gewordene Kunstfertigkeit, die eben wegen ihrer Mühelosigkeit dem Meister schließlich den persönlichen Stil gestattet, - aber eben erst, nachdem sich dieser die Tradition vollkommen zu Eigen gemacht hat. Nur so kann sie mit unerhörter Sicherheit aus der Fülle der im Prinzip möglichen Linien und Konturen immer die wenigen unentbehrlichen herausholen. Unentbehrlich ist aber, was uns in die nächsten Schichten leitet: nicht unwesentliches Detail, sondern nur charakteristisches oder symbolisches; Linien also, die es uns erlauben, Bewegungen zu sehen, Ausdruck zu assoziieren, Stimmung zu projizieren. Ein japanischer Tuschmaler ist technisch einem guten westlichen Karikaturisten näher als unseren „spontanen" Künstlern. In der künstlerischen Einstellung aber ist er einem traditionsverhafteten "akademischen" Landschaftsmaler mit mystischen Zügen oder selbst einem mittelalterlichen Madonnenmaler verwandter als der Kombination von schrankenlosem Individualismus und verzweifelter Originalitätssucht, die so viele zeitgenössische Künstler charakterisiert.
Immer wieder wird die Tuschmalerei wegen der offensichtlichen Ähnlichkeit der technischen Mittel mit der Kalligraphie verglichen. Dem oberflächlichen Blick muss es erscheinen, als ob sich in der letzteren rein Formales mit tiefem Gehalt direkt zum Kunstwerk verbindet. Gedichte und Sinnsprüche weiser Zen-Priester werden mit der gleichen kunstvollen „Spontaneität“ in den gleichen Medien festgehalten und (auf Rollen aufgezogen, wie diese) mit gleicher Verehrung überliefert und ausgestellt. Ja, in den meisten Fällen überschneiden oder beeinflussen sich die beiden Künste, indem sie sich entweder in einer Bildkomposition miteinander verbinden und gegenseitig ergänzen oder aber sich so aneinander angleichen, dass man auf einer Hotei-Darstellung nicht weiß, ob man das chinesische Schriftzeichen für „Mond" vor sich hat oder eine stilisierte bildliche Darstellung desselben. Die chinesischen Ideogramme sind ja aus einer Bilderschrift entstanden. Die japanischen Kanjis werden noch heute von denen, die sie lernen müssen, als abgekürzte Bildsymbole eingeprägt. - Diese Übergänge sind deshalb besonders reizvoll, weil sie zwischen zwei wesentlich verschiedenen Aussagemöglichkeiten (der bildlichen und der begrifflichen) vermitteln, indem sie beide bis zum eben noch möglichen Grad von Abstraktion (oder Aussparung) treiben und dann sich gegenseitig ergänzen.
Dennoch dürfen wir uns über die wesentlichen Unterschiede in der Schichtenstruktur von Tuschmalerei und Kalligraphie nicht täuschen lassen: Die Aussage eines philosophischen Spruchs und ihre Fixierung in schwungvollen Schriftzeichen (selbst wenn es stilisierte Bildsymbole sind) bleiben zwei verschiedene Dinge, die sich nicht auf die gleiche Weise in einem Erscheinungsverhältnis verbinden wie die Schichten der darstellenden Künste. In der Kunst , , erscheint" der Gehalt in den vorhergehenden Schichten (ohne dass Außenwissen benötigt würde, weil ja seine Erscheinungsweise der der realen Welt entspricht) und ruht zugleich ontologisch auf diesen auf. In der Kalligraphie wird er nur begrifflich (sprachlich) fixiert. Von den schönen Schriftzeichen ist er unabhängig. (Man könnte ihn ja mit Schreibmaschine daneben schreiben.) Abhängig ist er jedoch vom Zeichensystem der jeweiligen Sprache, d.h. von außen.
Der Ausländer, der japanische Kanjis nicht versteht, kann an Kalligraphie nur den ornamentalen Reiz der Schriftgestaltung genießen; den Gehalt muss er sich übersetzen lassen. Dagegen kann er die Tuschmalereien sehr wohl verstehen, abgesehen von den Beschränkungen, die uns zeitlich und kulturell entlegene Kunst immer auferlegen, und die wir zuvor schon erwähnten. Und der Gehalt der letzten Schichten wird ihm hinter den Zwischenschichten , , erscheinen", wenn diese gerade noch genug bieten, dass er sie „ergänzen" kann.
Nun mag jemand einwenden, dass der Gehalt eines Haiku auf einer japanischen Schriftrolle ja ebenfalls „erscheint", wie in anderer Lyrik auch, und keineswegs direkt ausgesprochen wird. - In diesem Fall müssen wir sofort zurückfragen: auf (oder hinter) welchen Schichten erscheint er? Doch, wie in aller Dichtung, den Mittelschichten des Sprachkunstwerks - und nicht in der graphischen Gestaltung! Oder könnte man das Haiku nicht auch in einem Buch genießen? - Also haben wir es in einem solchen Falle mit einem lyrischen Kunstwerk zu tun, das zunächst einmal völlig unabhängig in seiner eigenen Schichtstruktur ruht und nur zusätzlich in ausdrucksvollen Schriftzeichen übermittelt wird.
Schauen wir noch einmal auf zeitgenössische gegenstandslose Kunst zurück: Mit welchem Recht kann sie sich mit der Kalligraphie vergleichen? Der Hauptunterschied beruht auf dem Zeichencharakter der Sprache. Die Vordergrundsschichten der Kalligraphie sind komplexer als die der gegenstandslosen Kunst, weil Sprache an sich schon Bedeutungsträger ist, Farbe aber nicht. Wenn man Kalligraphie, etwa mit den Augen eines Ausländers, der der Sprache nicht mächtig ist, nur als graphische Gestaltung sieht, dann entspricht ihre Schichtenstruktur genau der der gegenstandslosen Malerei; d. h. sie beschränkt sich auf die beiden Vordergrundsschichten, was nichts über ihren Wert als Kunst aussagt. In beiden Fällen kann die zweite Schicht (Koordination der Bildelemente) Gestaltqualitäten von größter Intensität aufweisen, die den Betrachter als Temperamentseigenschaften beeindrucken. - Es gibt noch eine genauere Entsprechung: der Betrachter, der die Sprache nicht versteht oder (wie oft der moderne Japaner) die Schrift nicht mehr lesen kann, weiß bzw. vermutet doch, dass die eindrucksvolle graphische Gestaltung vor ihm irgendeine tiefe Bedeutung hat, die ihm nur momentan entgeht. - Das ist genau die Situation der meisten Betrachter gegenstandsloser Bilder!
Wenn aber die Kalligraphie zugleich noch als Dichtung oder Weisheit verstanden wird, dann haben wir es sozusagen mit einer Aufspaltung innerhalb der zweiten Schicht in zwei verschiedene Kunstarten zu tun, die sich gegenseitig unterstützen, etwa wie die Rezitation die Dichtung unterstützt. Die Literatur leitet dann, wo die graphische Gestaltung aufhört, in tiefere Schichten weiter. Es soll zur Vorsicht hier wiederholt werden, dass Komplexität der Schichtenstruktur nur potentiell etwas mit künstlerischer Qualität zu tun hat.
Wir sagten anfangs: „Aussparungen können in jeder Schicht nur so weit gehen, dass diese den angezielten Betrachter noch eben in die nächste zu leiten vermag". Wenn ein Betrachter nicht weiß, dass Hoteis Bauch Weisheit bedeutet, ist dieser symbolische Bestandteil des Bildes sozusagen für ihn „ausgespart". Dennoch vermögen ihn die übrigen Bildelemente weiterzuleiten. Wenn aber der Betrachter einer Kalligraphie die Schriftzeichen nicht lesen kann, geht die "Aussparung" ins Extrem, und es bleibt nichts, was ihn in das Verständnis der abstrakteren Schichten leiten könnte. Das Kunstwerk ist also für ihn in der letzten realisierten Schicht (der zweiten) beendet.
Einige wichtige Gründe für den Zauber ostasiatischer Tuschmalereien glauben wir (ohne Zen-Zitate) gezeigt zu haben. Die Bedeutung dieser Kunst liegt darüber hinaus in dem Umstand, dass sie allgemeingültige Gesetzlichkeiten hinsichtlich der Schichtung der Malerei besonders klar zur Erscheinung bringt.
DAS SCHICHTENVERHÄLTNIS
IM MUSIKKUNSTWERK[1]
Wer Musik „schichtenästhetisch" [2]betrachtet und mit anderen Kunstarten vergleicht, dem drängen sich vor allem zwei Fragen auf: 1. Ist das Musikkunstwerk ein einschichtiges Gebilde, wie Roman Ingarden [3] behauptet, 2 oder mehrschichtig, wie Nicolai Hartman [4] anzunehmen schien; - und 2. wie ist es möglich, falls Musik mehrschichtig ist, dass in ihr die Mittelschicht (der dargestellten Gegenständlichkeit) ausfallen kann, ohne dass das ontologische Trageverhältnis der übrigen Schichten zusammenbricht?
Denn soviel dürfen wir gleich feststellen: Musik, die zu malen oder zu beschreiben versucht, sog. „Programmmusik" (von Beethovens, „Pastorale" über Smetanas, „Moldau" bis zur Untermalungsmusik von Kulturfilmen), kann nicht zum Beweis für die, „Vollständigkeit" des stratologischen Verhältnisses in aller Musik herangezogen werden. Sie ist gegenüber der sog. „absoluten Musik" in der Minderzahl; und bei vielen Werken lässt sich überhaupt darüber streiten, inwiefern wir hier von einer Entsprechung zur gegenständlichen Schicht der Malerei, Bildhauerkunst und Dichtung sprechen dürfen. - Sicherlich: die Vorstellung von Gegenständlichem (Bächen, Vögeln, Kanonen oder Gewittern) braucht nicht nur durch Farbpigmente oder plastisches Material hervorgerufen zu werden. Auch die Worte der Dichtung sind als Material bereits etwas anderes: abstrakt, dynamisch und in der Zeit verlaufend, wie die Töne der Musik, - im Unterschied zu Farben und Tönen aber bereits für sich Bedeutungsträger. - Entscheidend ist jedoch, dag der größte Teil der bedeutendsten Musik sich nicht einmal vornimmt, irgendwelche Gegenstandsvorstellungen zu evozieren. Hörer, die beim Musikhören ohne visuelle Vorstellungen nicht auskommen, werden oft als "dilettantisch" bezeichnet, ihre Annäherung an Musik als "nicht sachgerecht". Zu solchen visuellen Erlebnishilfen gehört auch das faszinierte Starren auf die Bewegungen des Dirigenten oder die Hände des Pianisten. - Es führt kein Weg um die Voraussetzung, dass im musikalischen Kunsterleben das Visuelle primär keinen Platz hat, das entsprechend im Musikkunstwerk als geschichteten Gegenstand die Sphäre der Gegenstände ausfällt.
Was bleibt? - Beginnen wir "von unten", d. h. von den beiden tragenden Schichten des Materials und seiner Koordination. (Ingarden schließt diese aus dem eigentlichen Musikkunstwerk aus, weshalb er zu der Behauptung kommen konnte, dass dieses nur eine Schicht habe.) Die beiden ersten Schichten des Musikkunstwerks entsprechen in fast allen Einzelheiten denen der Malerei und Bildhauerkunst. (Der Einfachheit halber lassen wir die letztere hier außer Betracht.)
In der ersten (Material-)Schicht des Musikkunstwerks sind uns Töne gegeben, und zwar in ihren fünf Eigenschaften: Tonhöhe (oder -frequenz), -intensität (oder Lautstärke), -farbe (oder Timbre), -dauer und -richtung (die letztere spielt erst in der elektronischen Musik eine hervorragende Rolle). Ebenfalls zur ersten Schicht gehören aber die negativen Gegenpole der Töne, die als Tonlosigkeit (= Pausen) und als gegenseitige Verdeckung von Tönen (= Geräusch) auftreten und sich mit den Tönen verbinden. Den Tönen entsprechen in der Malerei die Farben mit ihren Qualitäten: Farbton (oder -frequenz), -intensität, -abschattung (oder Farbtimbre). Tondauer und -richtung finden in der Malerei natürlich keine Entsprechung, weil die letztere nicht "in der Zeit verläuft" und nur jeweils aus einer Richtung kommt. Ebenfalls zur ersten Schicht der Malerei gehört jedoch die Negation der Farben, die als Farblosigkeit (= Schwarz, Farbfrequenzen werden entweder nicht ausgesendet oder nicht reflektiert) und als gegenseitige Neutralisierung von Farben (= Grau nach der Brechung, Weiß vor der Brechung) auftreten und sich mit den Farben verbinden. (Nicht besprochen werden hier die hör- und sehphysiologischen Einzelheiten, die sich übrigens auch alle in den beiden Sinnesgebieten entsprechen, z. B. die Phänomene der "Obertöne", der "Schwebungen" oder "Vibrationen", oder die Tatsache, dass wir genau genommen weder "reine" Farben sehen noch „reine" Töne - "Sinustöne" - hören können.) Wichtig ist, zu erinnern, dass sowohl die "Regenbogenskala" (der uns sichtbaren Farbfrequenzen) wie auch die „Tonleiter" (der von uns hörbaren Tonfrequenzen) im Prinzip nur fließende Übergänge zwischen Schwingungszahlen kennen, die nur wir nach unseren Traditionen einteilen.
In der zweiten Schicht (der Koordination des Materials) im Musikkunstwerk verbinden sich die Töne horizontal" (zu Figuren, Melodien etc.) Und ,,vertikal" (zu Harmonien). In der Malerei dagegen, die nicht in der Zeit verläuft, können sich die Farben nur ”vertikal" verbinden. Das gilt jedenfalls für das Bild selbst, nicht aber - genau genommen - für den Akt des Betrachtens, der ja auch in der Zeit verläuft. Im Farbfilm lassen sich sogar Farbumbildungen im zeitlichen Verlauf zeigen, die denen der Töne in Musik näher kommen. - Dennoch gibt es genügend Parallelen: Töne verbinden sich zu Harmonien oder Dissonanzen, wie sich Primärfarben zu Sekundär- und Tertiärfarben verbinden, oder zu Grautönen. In sparsamer Verwendung bilden Dissonanzen (wie die ihnen verwandten Obertöne) und Grautöne ebenso wie Pausen und schwarze Konturen den notwendigen Hintergrund. Nur in der Konturierung durch Schatten und Begrenzung können die Farben wirken (was sogar noch für den Grenzfall des Impressionismus zutrifft); nur in der Unterscheidung des Tonträgers (als Geige, menschliche Stimme etc.) durch Obertöne und in seiner Begrenzung durch Pausen kann der Ton selbst erlebt werden. Die an und für sich dem Sinuston antagonistischen Obertöne neutralisieren ihn aber nur dann nicht, wenn sie sich ihm anschmiegen bzw. unterordnen. Ebenso neutralisieren komplementäre Pigmente ein Farbfeld nur dann nicht, wenn sie sich auf bestimmte Zonen beschränken (z. B. als Schatten) oder auf kleinere Mengen (als Abtönungen der Hauptfarben).
Das Zusammenstimmen von Tönen und Farben (sowie ihrer negativen Gegenpole) in der ersten Schicht wiederholt sich in der zweiten in Phänomenen, die wir mit Ausdrücken wie Harmonik, Melodik, Rhythmik und Timbre sowie Farbharmonie, Klangfarbe, Farbkomposition oder ähnlichen Übertragungen zu bezeichnen gewohnt sind. Auf die Entsprechungen im Einzelnen kommt es hier nicht an. Entscheidend ist, dass die komplexeren Formen ontologisch auf den einfacheren „aufruhen", die ihr Vorhandensein überhaupt erst ermöglichen: ohne Töne keine Figuren und Melodien; ohne Töne aber auch keine Akkorde und ohne Einzelakkorde keine Harmonik; auch Tempo und Rhythmus müssen sich in Tönen verwirklichen; selbst die Klangfarbe (das Timbre) ruht auf diesen ontologisch auf; die Klangfarbe der Einzeltöne zusammengenommen ermöglicht wiederum die größerer Einheiten; schließlich ermöglichen Melodik, Harmonik, Timbre, Tempo und Rhythmus ontologisch die komplexeren musikalischen Strukturen und Gattungen. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, die jedoch einmal im Zusammenhang und Vergleich mit der Schichtung anderer Kunstarten gesehen werden müssen.
Nun aber (in der dritten Schicht) spalten sich die Künste, je nachdem, ob sie zu den „gegenständlichen" oder abstrakten gehören. In den höchsten Schichten des Gehaltes brauchen Entsprechungen gar nicht erst nachgewiesen zu werden. Dort, im Bereich der „allgemeinmenschlichen" Erlebnisgehalte, sind sie selbstverständlich, weshalb sich die vergleichende Kunsttheorie fast ausschließlich für die Beschaffenheit der Vordergrund- oder Materialschichten und der von ihnen direkt abhängenden Mittelschichten interessiert. - Aus dem Fehlen der Gegenstandsschicht in der Musik ergeben sich nun einige Konsequenzen, die zwar als solche bereits bekannt - ohne das Schichtenmodell jedoch nicht befriedigend zu erklären waren: wenn wir emotionale Erlebnisse in Gefühle und Stimmungen unterscheiden, dann sind für uns die ersteren zumeist objektiver bzw. auf einen Menschen oder Sachverhalt bezogen, während die letzteren ganz allgemein bleiben und wir uns ihrer Ursachen oft gar nicht bewusst werden. Stimmungen steigen sozusagen aus den vegetativen Schichten (vor allem der endokrinen Funktionen) auf, und erst wo sie sich mit einem Gehalt verbinden, sich „vergeistigen", sprechen wir von Gefühlen. Was die Musik besonders unmittelbar und intensiver als andere Künste zum Ausdruck bringt und in uns erzeugt, sind aber eher Stimmungen als Gefühle. Da sie so allgemein bleiben, lassen sie sich nur vage mit Worten umschreiben (Allegro vivace, andante cantabile etc.), aus dem gleichen Grunde aber mit vielen Gehalten verbinden. Wo, wie in der Programm-Musik, ein Musikstück mit einem Titel versehen wird, ist dieser begrenzter als der Stimmungscharakter der Musik. Sindings „Frühlingsrauschen" könnte ebenso gut „Gebirgsbach" oder „Birkengesäusel" heißen. Wenn man den Titel zuerst hört, empfindet man dann die Musik als „passend"; umgekehrt könnte man aber von der Musik her unmöglich den Titel erraten. - Wenn nun ein „Tondichter" ein Gedicht vertont, ein anderer eine Filmmusik schreibt, geschieht immer dasselbe: eine allgemein stimmungshaltige musikalische Gestaltung wird mit einem enger umschriebenen literarischen Gehalt so verbunden, dass möglichst die eine Schicht die andere stärker herausbringt, beide sich aber gegenseitig ergänzen. Im Film oder im Tanz ist diese gegenseitige Ergänzung auch zwischen Musik- und Bildgestaltung möglich, weil eben ihr ungegenständlicher Charakter die Musik befähigt, mit anderen (darstellenden) Künsten mannigfache Verbindungen einzugehen. In diesen Verbindungen „verstärkt" die Musik potentiell in der emotionalen Schicht der anderen Kunstart angelegte Züge, lässt aber die klarer definierten der Gegenstandsschicht unangetastet. Das ist ihr möglich, weil sie selbst keine Gegenstandsschicht hat. Die künstlerische Problematik der Oper, auf die wir hier nicht im Einzelnen eingehen können, liegt genau da, wo sich die Mittelschichten der an ihr beteiligten Künste überschneiden: wo Musik, Dichtung, Spiel und Bühnenbild sich entweder nicht entsprechen oder gegenseitig verdecken. Im literarischen Chanson dominieren das Wort und sein Bedeutungsgehalt; in der Barockarie hat die Melodieführung den ersten Platz; in der Oper des Verismo ist das jedoch nicht immer entschieden. Das Kunstlied gelingt da am besten, wo sich die beiden Medien am weitesten entgegenkommen: wo stimmungshafte lyrische Andeutung durch Musik getragen und verstärkt wird. Vertonte Epik dagegen (z. B. im Rezitativ) ist beinahe so problematisch wie vertonte Dramatik (in der Oper).
Wenn auch die gegenständliche Schicht in der Musik fehlt, so wird doch die nächstfolgende der Bewegung und Lebendigkeit unmittelbarer und stärker verwirklicht als in Dichtung und Malerei. Was im Bild der Eindruck des Lebendigen an Konkretheit voraus hat, das verliert er doch wieder durch seine Zeitlosigkeit. Die Maler wählen, nicht nur für Porträts und Still-Leben, mit Vorliebe Momente zur Abbildung, die eine gewisse Ruhe und Zeitlosigkeit" suggerieren. Schlachtszenen und Amazonenjagden genießen in der Ästhetik der Malerei eine ähnliche Einschätzung wie das „Frühlingsrauschen" in der Musik. - Im Bild müssen wir Bewegung und Lebendigkeit in die abgebildeten Gegenstände „hineinassoziieren". In der Musik ist das nicht notwendig, weil die Töne selbst es sind, die sich in der Zeit (der Aufführung) bewegen, zu Melodien entfalten, in Crescendi und Decrescendi anschwellen und verhallen. Der Eindruck der Bewegtheit wird also durch die musikalische Zeitstruktur hervorgerufen und ruht deshalb direkt auf der zweiten Vordergrundschicht (der Koordination des Materials) auf. Das Ausfallen der Gegenstandsschicht bildet deshalb nur scheinbar eine Ausnahme zur ontologischen Schichtungsgesetzlichkeit, nach der jede Schicht auf der jeweils konkreteren „aufruhen" muss. Die Musik kann es sich als einzige Kunstart leisten, ungegenständlich zu sein und dennoch emotionale Erlebnisse zu vermitteln, weil ihr Medium selbst ein bewegtes ist. Bewegung aber ist ”ausdruckshaltig", weil wir gewohnt sind, sie als Äußerung des Lebendigen zu erleben. Schnelle Bewegungen bezeichnen wir deshalb als „lebhaft”. Bewegungslosigkeit wird als „leblos" empfunden. Emotionale Qualitäten projizieren wir also direkt in die (echte) Bewegtheit der Musik, ebenso wie in die (nur scheinbare bzw. ,,assoziierte") Bewegtheit gegenständlicher Darstellung. Sie können deshalb ontologisch auf der Schicht des koordinierten Materials aufruhen, wobei die Bewegtheit (Lebendigkeit) vermittelt.
Die Dichtung nimmt insofern eine Mittelstellung ein, als sie zwar einerseits in der Zeit (des Lesens oder Hörens) aufgenommen wird, diese Zeit aber nicht dieselbe ist, die im Gedichteten vergegenwärtigt werden soll (Unterschied von "Erzählzeit" und erzählter Zeit"). In der Musik sind darstellende und dargestellte Zeit identisch.
Abstrakte Malerei versucht bekanntlich ebenfalls, emotionalen Gehalt unter Auslassung der Gegenstandsschicht zu vermitteln. Sic hat es jedoch viel schwerer als die Musik, weil sie nicht Bewegung (und damit Lebensäußerung) als solche erleben lassen kann, sondern nur deren Spuren. Aus der Pinselführung mancher „abstract expressionists" lässt sich das Temperament des Künstlers zwar erraten (etwa wie aus einer Handschrift), es wird jedoch nicht mehr unmittelbar erlebt. Auch die Gestaltqualitäten von Formen, Konturen und Farbkombinationen im Bild lassen sich mit denen musikalischer Formelemente an „Lebendigkeit" nicht vergleichen.
Damit wäre das Erstaunliche an Musik auch „schichtentheoretisch" erklärt: dass sie es nämlich fertig bringt, ohne Abbildung unserer vertrauten Umwelt emotionale Erlebnisse zu ermöglichen, die denen der Literatur und Malerei nicht nur an Tiefe vergleichbar sind, sondern sie sogar zumeist an Intensität übertreffen. Und zwar handelt es sich dabei nicht nur um momentane Stimmungen (Heiterkeit, Übermut, Klage etc.), sondern innerhalb größerer Werke auch um ganze Entwicklungen von einer Stimmung in andere und um die Kontrastierung mehrerer Stimmungen.
Dass sich der emotionale Gehalt großer Musik ins Exemplarische erheben, dass er den Charakter von „Weltanschauung" annehmen kann, braucht nicht eigens gezeigt zu werden; ebenso nicht, dass die Grundgestimmtheit eines großen Musikers sein Werk über alle Schichten bis in die letzte Note bestimmen kann. Denn bei aller Verschiedenheit haben die verschiedenen hier besprochenen Kunstarten doch gemeinsam, dass ihre Schichten in einem „doppelten Integrationszusammenhang" zueinander stehen, einem ontologischen Trageverhältnis „von unten her" (bzw. von den konkreteren Vordergrundschichten zu den abstrakteren und nur, „erscheinenden" Hintergrundschichten hin) und einem Formungsverhältnis „von oben nach unten" (vom Gehalt zum Material).
Auch dass die Komplexität der Schichtung mit der künstlerischen Qualität des Kunstwerks nicht gleichzusetzen ist, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden, weil es selbstverständlich ist. (Eine missglückte „weltanschaulich" gemeinte Musik der Jahrhundertwende kann hinter einem Mozart-Menuett künstlerisch weit zurückbleiben.) Hier kam es nur darauf an, zu zeigen, dass wir im musikalischen Kunstwerk in Parallele zur bildenden Kunst mehrere Schichten unterscheiden können, und dass deren Reihenfolge den ontologischen Gesetzlichkeiten nicht widerspricht.
[1] Zuerst in Zeitschrift für Ästhetik 24/1 (1979) 5-10.
[2] Wolfgang Ruttkowski: Typen und Schichten. Zur Einteilung des Menschen und seiner Produkte. Bern-München: Francke 1978.
[3] Unters uchungen zur Ontologie der Kunst (Tübingen 1962) 1-136.
[4] Ästhetik. Berlin 1953; Hartmann ist jedoch meines Wissens auf die hier behandelte Frage des Schichtungsverhältnisses im Musikkunstwerk nie eingegangen.
Der Wandel unseres Kunstbegriffs [1]
Man hört gelegentlich den Allgemeinplatz, dass historische Erscheinungen erst dann befriedigend definiert werden, wenn ihre Zeit vorüber ist. In ihrer “vitalen Phase” existieren sie “unbewusst”, erst in der Dekadenz kommen sie zur Reflexion über sich selbst.
Auch in Hinsicht auf die Geschichte der Kunst und Kunsttheorie ist das schon mehrfach behauptet worden. Man hat zwei Phasen unterschieden: eine, in der Kunst schon existiert, jedoch nicht um ihrer selbst Willen, sondern für einen religiösen oder gesellschaftlichen Zweck (zur Bannung von Geistern, “ad majorem deum gloriam” oder zur Verherrlichung eines Fürstenhofes) - und eine zweite, in der sie sich weitgehend von äußeren Zwecken löst (“l’art pour l’art”) und zuerst sich selbst lebt. Die erste Phase wurde im Westen, aufs Ganze gesehen, erst im 19. Jahrhundert von der zweiten abgelöst. Aber selbstverständlich lassen sich Überschneidungen feststellen, die bis in unsere Zeit reichen.
Wichtiger als die Feststellung, für welchen Anlass jeweils Kunst produziert wird (für einen äußeren, wie z.B. noch heute in Kirchenbau und Kirchenmusik, oder um ihrer selbst Willen, wie weitgehend jetzt in Malerei und Dichtung) ist die, in welcher Einstellung dies geschieht. So kann ein Musikwerk zwar in Hinsicht auf eine bestimmte Verwendbarkeit geschaffen werden (z.B. als Oper, Ballettmusik oder Messe); wenn es sich als Kunstwerk ernst nimmt, wird es jedoch zugleich einen gewissen Originalitätsanspruch aufweisen. Der letztere war früheren Epochen (bis etwa zur Renaissance) weitgehend fremd. Qualität (handwerkliches Können) war wohl immer ein Kriterium für die Anerkennung des Künstlers, Originalität dagegen ist ein relativ moderner Begriff [2]. Er konnte sich erst in einem Individualismus entwickeln, den nur späte Kulturen dulden.
Wer die verzweifelte Bemühung zeitgenössischer Kunst um Originalität beobachtet, die das Kriterium der Qualität fast verdrängt hat, mag geneigt sein, Kulturkritikern zuzustimmen, die in der Emanzipation der Kunst von gesellschaftlichen oder religiösen Zwecken den Beginn ihrer Auflösung sehen. Die Spätphase der Kunstentwicklung, das “Zusichselbstkommen” der Kunst, hat aber einen ästhetischen und einen theoretischen Aspekt: Im ersten werden die mit Kunst Befassten sich des Eigencharakters künstlerischer Gestaltung auf zunächst nur intuitive Weise bewusst. Sie lernen es, das Ästhetische als solches zu würdigen und zu genießen. Im zweiten aber folgt die philosophische Klärung und Definition des Kunstbegriffs. Man lernt nun endlich auszudrücken, was Kunst ist, und nicht nur, wie sie ist. Erst diese Bewusstseinsstufe scheint mir wirklich die letzte zu sein. Ich möchte versuchen zu zeigen, dass wir erst kürzlich in sie eingetreten sind, in einer Zeit, in der es mit der Kunst im bisher geläufigen Sinne mehr oder weniger vorbei ist.
Um das zeigen zu können, muss ich zuerst verdeutlichen, dass 1. alle Kunstarten bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der nicht weit zurückliegt, etwas gemeinsam hatten, aus dem sie gemeinsam als “Kunst” im abstrakten Sinne definiert werden können; 2. gerade dieses Gemeinsame “in der Kunstpraxis” zu etwa der Zeit überholt war, als es uns ins Bewusstsein trat; 3. wir infolgedessen nun vor der Entscheidung stehen, entweder unsere “fortschrittlichsten” Kunstprodukte nicht mehr mit dem Namen “Kunst” zu benennen, oder aber unseren Kunstbegriff neu zu fassen. Dabei laufen wir allerdings Gefahr, ihn bis zur Unbrauchbarkeit zu erweitern.
Es geht mir also nicht darum, zur Kunstproduktion unserer Zeit Stellung zu nehmen, sondern nur darum, ihr Verhältnis zu unserem - ewig nachhinkenden - Kunstbegriff zu klären. Genau genommen, gibt es sogar zwei Kunstbegriffe (und Übergänge zwischen diesen). Der weitere umfasst alle dekorativen Gestaltungen, z.B. die Tätowierungen, Trachten und Moden bestimmter Völker, sowie Gebrauchsgegenstände (Keramik, Möbel etc.) soweit sie ästhetische Ansprüche befriedigen, außerdem Folklore (Tänze, Lieder etc.) und sogar besonders ausdrucksstarke Gestaltungen von Kindern. Der engere Kunstbegriff beschränkt sich auf Werke von “Spezialisten”, die bewusst und vorwiegend ihres ästhetischen Impakts wegen geschaffen wurden (Bilder, Statuen, Musikwerke, Literatur etc.), also solche, die nicht durch Zufall oder ein archivarisches Interesse in die Museen und auf Bühnen gelangen, sondern von vornherein für die Ausstellung und Aufführung geschaffen wurden.
Wie anfangs angedeutet, wird diese Unterscheidung immer problematischer, je weiter wir historisch zurückgehen und uns damit von unserer modernen Kunstauffassung entfernen. Wer will heute noch entscheiden, ob eine Maske oder Höhlenzeichnung nur magischen oder auch “künstlerischen” Absichten diente?) Auch in der Gegenwart gibt es genügend Grenzfälle. Das Programm des Bauhauses z.B., strebte ja geradezu eine neue Verbindung des “Schönen” mit dem “Zweckmäßigen” an. In der folgenden Betrachtung denken wir nur an den engeren Kunstbegriff, d.h. an Werke, die sich vorwiegend als ästhetische Erlebnisquellen verstehen. Unsere “synchrone” Unterscheidung deckt sich mit der “diachronischen” insofern, als “absolute” (d.h. von religiösen und gesellschaftlichen Belangen weitgehend abgelöste) Kunst zugleich auch die zeitlich spätere ist. Nur sie konnte sich soweit emanzipieren, dass sie möglicherweise einen anderen Namen verdient.
Worin liegt nun das Gemeinsame, aus dem die Kunst bis vor kurzem (genauer: bis zum Beginn unseres Jahrhunderts) hätte definiert werden können? Die Literatur über das Problem, was “Kunst” (als Verallgemeinerung der “Künste”) ist und wie sie definiert werden kann, ist umfangreich und kann hier nicht definiert werden. Immer wieder sind allgemeine Kriterien, die für alle Kunstarten anwendbar sein sollen, aufgestellt und wieder verworfen worden, wie z.B. “exemplarischer Ausdruck”, “Intuition”, “bedeutende Form”, “objektivierter Genuss”, “imaginierte Wunscherfüllung”, “Erlebnis”, “soziale Mitteilung”, “Harmonie”, “Einheit in der Vielheit”, “Organismus”. Keiner dieser Begriffe kann die Grundlage für eine allgemeine und umfassende Definition abgeben. Allenfalls weisen sie auf bestimmte hervorstechende Eigenschaften spezifischer Kunstarten hin.
Nachdem die Ästhetik endlich die fruchtlose Diskussion historisch bedingter und zudem vager Begriffe (wie “das Schöne”, “das Erhabene” etc.) und einseitig gewonnener Verallgemeinerungen wie der zuvor genannten aufgegeben hatte und sich der ontologischen und phänomenologischen Analyse des Kunstwerks und seiner Beziehung zum Menschen zuwandte, stellte sich heraus, dass nur die Schichtenanalyse geeignet war, die Besonderheit von Kunst im Vergleich zu anderen menschlichen Gestaltungen befriedigend zu definieren.
Dies ist aus mehreren Gründen bisher nicht soweit ins allgemeine Bewusstsein gedrungen, wie es das verdiente. Einmal wurden die Hauptwerke, in denen eine solche Beschreibung des Kunstwerks zum ersten Mal geleistet wurde, zu einer Zeit veröffentlicht, in der eine weltweite Resonanz für sie kaum erwartet werden konnte. Zum zweiten sind diese Bücher nicht eben “leichte Kost” [3]. Selbst in englischer Übersetzung fällt es dem Leser schwer, die gründlichen Analysen innerlich nachzuvollziehen. Vor allem aber nehmen die beiden wichtigsten Autoren, Nicolai Hartmann und Roman Ingarden, kaum aufeinander Bezug und haben nie versucht, ihre Systeme aufeinander abzustimmen oder wenigstens voneinander abzugrenzen. Der verwirrte Leser meint deshalb leicht, dass diese beiden großartigen Versuche einer Ontologie des Kunstwerks sich gegenseitig widerlegten und aufhöben. Wenn z.B. Ingarden behauptet, Musik [4] sei “einschichtig”, während Hartmann in ihr drei Schichten unterscheidet, muss man die Voraussetzungen beider Autoren kennen, um ihre Analysen zur Synthese zu bringen. Ich habe an anderer Stelle [5] ein Schichtenmodell vorgeschlagen und diskutiert, das allen herkömmlichen Kunstarten gerecht werden sollte und mit dessen Hilfe man gerade ihre charakteristischen Unterschiede definieren kann. Hier geht es mir zuerst darum, die Anschauungen zusammenzufassen, die alle Schichtentheoretiker, auch die psychologischen wie etwa Rothacker [6], vertreten und ausführlich begründet haben und die deshalb eine gewisse Gültigkeit und Schlüssigkeit für die Erklärung des Kunstwerks beanspruchen können.
1. Alle Schichtentheoretiker gehen davon aus, dass Kunstwerke als geschichtete Gebilde gesehen werden müssen, wenn wir sie in ihrer ontologischen Besonderheit verstehen wollen. Obwohl die verwirklichte Anzahl der Schichten innerhalb bestimmter Kunstwerke kein Maßstab für deren Qualität ist, so ist doch potentiell kein Natur- oder Nutzgegenstand dem Kunstwerk an Komplexität (oder “Tiefe”) der Schichtung vergleichbar, selbst nicht Mensch und Tier mit ihrer Fähigkeit zu mimisch-seelischem Ausdruck. Denn Mensch und Tier erscheinen nicht in geordnetem Material, sondern sind selbst in diesem gegeben. Die ersten beiden Schichten (des Materials und seiner Ordnung, vergl. das Diagramm am Ende) treten also im Kunstwerk (zumindest im darstellenden) zweimal auf: als tatsächlich vorhandene und als nochmals in diesen erscheinende. (Eine Holztür kann auf eine Holztür gemalt werden.) Durch seine komplizierte Schichtung unterscheidet sich also (zumindest potentiell) das Kunstwerk von allen anderen Gegenständen; und wahrscheinlich leitet sich unsere besondersartige Einstellung zu ihm (als Schaffende und Genießende) aus dieser ontologischen Einzigartigkeit ab.
2. Der Frage, inwiefern der Schichtenstruktur des Kunstwerks Realitätscharakter zukommt und wieweit wir diese in Kunstwerke “hineinsehen”, wird m.W. von keinem der Theoretiker besondere Wichtigkeit zugemessen. Sie ist natürlich mit einem weitreichenden Problemkreis (Idealismus-Materialismus etc.) verbunden, der in diesem Zusammenhang umgangen werden kann. Ontologische Kategorien, als projizierte oder real fundierte, leiten ihre Berechtigung in jedem Fall nur aus ihrer Erhellungskraft für bisher nicht befriedigend zu fassende Probleme ab. Tatsächlich hat aber in unserem Jahrhundert keine ästhetische Theorie unsere Fähigkeit, Kunst philosophisch zu definieren, so vorangebracht wie die ontologisch-phänomenologische.
3. In der Unterscheidung der Schichten im Einzelnen weichen die Autoren weitgehend voneinander ab. Ebenso in der Beantwortung der Frage, ob sich ein gemeinsames Schichtenmodell für alle Kunstarten erarbeiten lässt, vor dem sich diese (je nach ihrer verschiedenartigen und charakteristischen Ausfüllung und Betonung einzelner Schichten) abheben und beschreiben lassen. Ingarden bestimmt die Schichtenfolge jeder einzelnen Kunstart getrennt. Hartmann geht von einem Modell aus, worin auch ich einen größeren Nutzen sehe. Alle stimmen aber darin überein, dass (a) die Schichten sich gegenseitig ontologisch ermöglichen (“aufeinander aufruhen”), und zwar (b) jeweils die konkreteren die abstrakteren tragen, die (c) “nach hinten zu” oder “nach oben hin” immer allgemeiner werden.
Die zuletzt erwähnten kategorialen Gesetzlichkeiten sind ausdrücklicher von Hartmann behandelt worden, als von Ingarden, aber keiner der beiden Autoren zieht m.W. jemals ausdrücklich die logisch scheinende Konsequenz, dass im Kunstwerk keine Schicht ganz ausgelassen werden kann, die noch jeweils eine ”höhere” (abstraktere) ermöglichen (“tragen”) soll. Mit anderen Worten: Wo ein Kunstwerk aufhört (d.h. welche der Hintergrundsschichten dem Betrachter in diesem noch “erscheinen”), ist freigestellt. Wenn aber eine der Hintergrundsschichten (z.B. ein weltanschaulicher Gehalt) noch erlebt wird, müssen die davor liegenden und jeweils die abstraktere “tragenden” Schichten ebenfalls vorhanden sein, zumindest andeutungsweise. “Weltanschauung” kann nicht im leeren Raum erscheinen, wenn sie nicht einfach nur in Worten formuliert ist, was unkünstlerisch wäre. Sie kann nur an Personen und Schicksalen erlebt werden. Ebenso kann ein menschliches Gefühl (z.B. Begeisterung) nicht nur mit ungegenständlichen Linien und Farben dargestellt werden. Wer der Gestaltpsychologie diese Behauptung zuschreibt, missversteht sie [7]. Ein Gefühlserlebnis kann nur durch eine Auffüllung der Zwischenschichten, in denen uns Gegenstände und Personen mit ihren vertrauten Ausdrucksmitteln erscheinen, vermittelt werden.
Um uns das Trage- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen den einzelnen Schichten zu verdeutlichen, vergleichen wir kurz schichtenanalytisch einen Gebrauchs gegenstand (z.B. Stuhl) mit einem Kunst gegenstand im oben beschriebenen weiteren Sinne (z.B. Vase) und zwei Kunstgegenständen im engeren Sinn, einem Roman, als Beispiel für die besonders komplexen darstellenden Künste, und einem Musikwerk wegen seiner Sonderstellung innerhalb des Schichtenmodells. (Ich folge dabei meinem eigenen Schichtenmodell, das stärker ausgegliedert ist, als die von Hartmann und Ingarden, vergl. das Diagramm.)
1. Alle vier sind auf Material angewiesen, mit dem sie (im Unterschied zu abstrakten Konzepten) sozusagen “in der konkreten Welt verankert” sind bzw. erscheinen können. Das Material der ersten beiden Gegenstände (Holz bzw. Ton) ist auf einfache Weise gegeben. Das gleiche gilt für die Töne der Musik. Das Material des Romans sind jedoch die Worte mit ihrem Sinngehalt (nicht Papier, Tinte, Schriftzeichen oder die menschliche Stimme in der Rezitation). Die Sprache ist bereits selbst “objektivierter Geist” (Scheler [8] ). Das Erscheinungsverhältnis ist also in Literatur komplexer als in allen anderen Künsten und Gegenständen.
2. Alles Material aber treffen wir nur in einer bestimmten Ordnung an, besonders in geformten Gegenständen. In den letzteren ist es immer auf das Erscheinen der nächsten Schicht hin geformt. Diese Ordnung des Materials darf nicht mit der Formung jeder einzelnen Schicht verwechselt werden, auf die wir noch zurückkommen. Jedoch hängt diese Ordnung von beiden benachbarten Schichten ab: den Möglichkeiten des Materials (mit Eisen kann man z.B. keine Transparenzeffekte erzielen) und der Intention der nächsten Schicht. Da diese dritte Schicht nur in einer bestimmten Geordnetheit des Materials erscheinen kann, müssen wir diese Ordnung selbst als zweite Schicht ansehen, und nicht nur als eine Qualität der ersten (des Materials).
3. Was erscheint nun “hinter” den beiden ersten Schichten (des Materials und seiner Ordnung)? Genügt es zu sagen “der Gegenstand” (Stuhl, Vase, Gegenständlichkeit und Personen der Dichtung)? Auch in dieser Schicht lassen sich charakteristische Unterschiede hinsichtlich der hier betrachteten vier Objekte feststellen. Worin liegt der Unterschied zwischen einem “wirklichen” Stuhl und einem mit Worten beschriebenen oder gemalten? Den wirklich Stuhl und die Vase fassen wir als tatsächlich vorhanden auf, wenn auch z.B. einem Wesen von einem anderen Stern, das nie sitzt und nie jemanden sitzen sah, die Funktion des Stuhls durchaus unklar bleiben könnte. Die Gegenstände im Roman aber “erscheinen” uns nur “hinter” den Worten. Und das Musikstück stellt überhaupt keine Gegenständlichkeit dar. Der Gegenstand, dessen Sinn und Funktion wir nicht erkennen (wie für den “Marsmenschen” der Stuhl) bleibt auch für uns nur koordiniertes Material (zweischichtig). Auch Personen fassen wir in diesem Sinne zuerst einmal als sinnvolle und funktionierende Gegenstände auf, bis die tieferen Schichten sich uns erschließen. Personen können sich z.B. bewegen.
4. Bewegung wird zumeist als Zeichen für Lebendigkeit aufgefasst. Bewegungslosigkeit bedeutet Leblosigkeit, wenn sie nicht als nur temporäre erlebt wird. In darstellender Kunst (Dichtung und Malerei) werden alle Gegenstände und Personen in verschiedenartigen Bewegungszuständen erlebt, selbst wenn sich in Wirklichkeit nichts bewegt. Im Musikwerk wird die Bewegung (Lebendigkeit) unmittelbar im koordinierten Material (Melodien, Harmonien, Rhythmen) erlebt. Deshalb darf in ihr die Gegenstandsschicht ausfallen. Abstrakte Malerei aber kann dies nicht für sich in Anspruch nehmen. In ihr bewegt sich nichts. Bewegung verläuft in einer bestimmten Zeit. Das trifft für Musik ebenso zu wie für den bewegten Körper des Tänzers. Linien können nur Bewegungs richtungen andeuten, nicht aber den zeitlichen Verlauf wie Musik und Tanz. Hier liegen Grenzen gegenstandsloser Malerei [9]. Wir brauchen in den statischen Künsten (Malerei und Plastik) Teile unserer vertrauten Gegenstandswelt, um Bewegungsabläufe in diese hineinassoziieren zu können.
Wir entdecken noch weitere bezeichnende Unterschiede: Dichtung und Musik gestalten Bewegung (Lebendigkeit) aus sich heraus, Musik eine tatsächliche, Dichtung nur eine “erscheinende”. Stuhl und Vase dagegen können zwar von außen bewegt werden, haben aber kein eigenes Leben, keine Bewegung “in sich”. Sie existieren in der vierten Schicht nicht mehr. Ihr Dasein reicht nur von der ersten in die dritte. In Ausnahmefällen und nur andeutungsweise kann jedoch in der künstlerischen Form einer Vase und noch stärker in Architektur, durch die wir schreiten, “Bewegung” erlebt werden. In Architektur können sich sogar noch tiefere Schichten ausdrücken. Eine gotische Kathedrale kann sowohl als Zweckbau wie auch als “steingewordenes Gebet” erlebt werden.
5. Bewegung ist ausdruckshaltig (am meisten die des menschlichen Gesichts) und Ausdruck prägt den Charakter der fünften Schicht. Was wird ausgedrückt? Stimmungen und Gefühle von Lebewesen, vor allem von Menschen, also Psychologisches. Der Ausdrucksgehalt einer Landschaft beruht ja nur auf der Projektion menschlichen Erlebens in die Natur. Er ist außerdem zumeist allgemeiner. Darin liegt kein Widerspruch. Wir können allgemeinere und differenziertere Gefühle sowohl haben als auch projizieren. Die differenzierteren projizieren wir normalerweise auf unsere Mitmenschen. Noch undifferenzierter als der der Natur ist der Ausdruck abstrakter Gestaltelemente, den die Gestaltpsychologen analysieren. Man kann es einer schwungvollen Pinselkurve nicht ansehen, ob sie aus Freude oder Ärger entstand. Nur Vitalität liest man aus ihr ab. Selbst der mimische Ausdruck des menschlichen Gesichts kann missdeutet werden, besonders zwischen Menschen, die zu verschiedenen Kulturen gehören und ganz besonders, solange er nur momentär erlebt wird.
6. Denn normalerweise erleben wir Psychologisches nicht im “eingefrorenen Zustand”, sondern in Erlebnisabläufen und -entwicklungen. Wo uns Gemälde nur einen Erlebnis moment bieten, ergänzen wir automatisch das Vorher und Nachher dieses Moments (wie es dazu kam und was höchstwahrscheinlich darauf folgen wird) und projizieren so bereits die nächste Schicht, in der momentäre Ausdrucksmomente sich zu psychologischen Entwicklungen zusammenschließen, zu Entschlüssen, Handlungen, Schicksalen. Das ist nur in Kunstarten möglich, in denen Menschen und ihre Schicksale erlebbar gemacht werden (Drama, Roman, Film etc., aber auch im Gedicht, sofern dieses mehr als ein Still-Leben gibt) und in der Musik mit ihren einzigartigen Möglichkeiten direkter Darbietung von Gefühlsentwicklungen. Längst haben wir alle Kunstarten hinter uns gelassen, in denen menschliches Erleben nicht dargestellt werden kann, also die “dekorativen” Künste, zu denen unser zweites Beispiel (Vase) gehörte.
Müssen wir vorsichtshalber wiederholen, dass es sich hierbei nicht um eine wertende Unterscheidung handelt, sondern um eine strukturanalytische? Selbstverständlich ist eine gelungene Keramik ästhetisch vollkommener als ein misslungener Roman! Nur potentiell kann der Roman mehr leisten. Worin besteht nun dieses “Mehr” der Künste im engeren Sinn? Die Antwort kann nur sein: in ihrer Transparenz für weitere Schichten.
7. Hinter menschlichen Handlungen und Erlebnissen kann nämlich das aufleuchten, was diese erst zu “Schicksalen” macht, das Exemplarische, in dem wir uns alle angesprochen und dargestellt fühlen. Interessant ist immer wieder (und weder von Hartmann noch von Ingarden erklärt), dass die Musik trotz ihres abstrakten Charakters in diese Höhen des künstlerischen Erlebnisses gelangt [10]. Die Erklärung kann nur sein, dass (wie auch beim Tanz) wir, die Erlebenden und innerlich Mitwirkenden, die fehlende Person- und Gegenstandsschicht ersetzen. In den darstellenden Künsten wird diese erst vor uns hingestellt und danach (durch Identifikation) von uns “verinnerlicht”. Musik spricht uns (akustisch-motorisch) direkter an. Von ihr aus gesehen ist der Weg über die Vorstellung und Phantasie ein Umweg. Deshalb kann in diesem einen Falle das geordnete Material der Töne uns als Ausdrucksträger direkt so beeindrucken, dass wir wiederum unser Erleben in die (an sich gefühlsneutrale!) Musik zurückprojizieren. Der fatale Irrtum abstrakter Malerei und Lyrik, die diesen unmittelbaren Impakt der Musik nachzuahmen suchen, liegt im Verkennen der Möglichkeiten ihrer Medien. Farben können (zumindest auf Leinwand, anders vielleicht im Film) keine Bewegungsabläufe darstellen. Worte dagegen sind zuerst Bedeutungs träger und als Klangkörper den Tönen der Musik weit unterlegen.
Da es uns nur darauf ankommt, die Stellung verschiedener Künste und eines Gebrauchsgegenstandes innerhalb eines Schichtenmodells zu zeigen, ist es nicht notwendig, die Schichtung “nach oben hin” weiterzuverfolgen. Gehalt und Weltanschauung, die sich in Kunst aussprechen können, sind ohnehin so allgemein, dass sie sich “ästhetisch” kaum mehr auswirken. Tragisches Welterleben kann sich, ebenso wie humorvolles, in verschiedenen Gattungen entfalten.
Nachdem angedeutet wurde, wie in einem Schichtensystem, das weder mit dem von Hartmann noch mit dem von Ingarden übereinstimmt, jedoch von beiden entscheidende Anregungen erhielt, die ontologische Sonderstellung der Kunst verdeutlicht werden kann, muss nochmals gefragt werden, wieweit dieser (engere) Kunstbegriff heute überhaupt noch verbindlich ist. Man denke an zeitgenössische Kunstäußerungen, vor denen viele immer noch hilflos stehen, etwa an Formen der “konkreten Poesie” [11], der elektronischen Musik, der gegenstandslosen Malerei. Viele von diesen haben gemeinsam, dass sie (aus Gründen, die wir hier nicht untersuchen wollen, um nicht in Polemik abzugleiten) bewusst und programmatisch die Schicht auslassen oder umgestalten, die bis etwa zur Jahrhundertwende als die für ihr Medium charakteristische galt. So verzichtet die konkrete Poesie auf die Kommunikation sprachlicher Bedeutungseinheiten (in der 2. Schicht), die elektronische Musik auf die herkömmliche Formung der 2. Schicht in Melodik, Harmonik und Rhythmik, die gegenstandslose Malerei auf Darstellung der uns vertrauten Umwelt (in der 3. Schicht). Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn diese Künste jeweils bei dieser umgestalteten Schicht aufhörten und keinen Anspruch auf Transparenz für tiefere Schichten stellten; wenn also die konkrete Poesie sich damit begnügte, graphische Muster aus Silben und Worten gestalten zu wollen, in denen gelegentlich wie zufällig ein aphoristisch anmutender Sinn aufleuchtet; wenn elektronische Musik nichts anderes anstrebte, als faszinierend-neue Klang- und Geräuschmontagen vorzuführen, die gelegentlich an die Geräusche unserer tatsächlichen Welt erinnern; wenn gegenstandslose Malerei nur dekorative oder “graphologische” (im Sinne von Aufschlüssen über Temperamentsqualitäten des Künstlers) Wirkungen erzielen wollte, “Gestalt”-Wirkungen.
So ist es aber nicht. Alle diese Künste stellen gelegentlich (in Werktiteln oder Aussagen der Künstler) den Anspruch, Gehaltliches (d.h. unsere Hintergrundsschichten) erlebbar zu machen, und tragen erst damit zur allgemeinen Verwirrung des ratlosen Publikums bei. Solange letzterem nur zugemutet wird, eine eindrucksvolle formale Komposition auf sich wirken zu lassen, ist nichts dagegen einzuwenden. Das Unbehagen beginnt dort, wo unter dieser Art von Kunst Titel stehen, die tiefere Gehalte andeuten und damit deren Verständnis einfordern.
Nach der ontologischen Schichtgesetzlichkeit, die Hartmann und Ingarden wohlweislich nicht auf zeitgenössische Kunst angewendet haben, ist es unmöglich, eine Schicht ganz ausfallen zu lassen, die noch eine weitere tragen muss. “Ausfallen lassen” bedeutet aber auch, sie so stark umzugestalten, dass der Betrachter sie nicht mehr nachvollziehen kann. Denn jede abstraktere Schicht kann nur hinter einer konkreteren aufleuchten. Der Weg zu den Gehaltsschichten führt nur durch die Vordergrundsschichten, von denen sie ontologisch erst ermöglicht werden. In der Kunst kann man nichts im leeren Raum verankern und sie unterscheidet sich von der Begriffswelt (z.B. der wissenschaftlichen) darin, dass in ihr das Geistige konkretisiert und damit erlebbar gemacht und nicht einfach durch eine Konvention an gewisse konkrete Zeichen gebunden wird. Darin aber liegt wiederum die Universalität der Kunst begründet. Erlebbar ist uns (natürlich mit gewissen Einschränkungen) alles Menschlich-Vertraute. Sprachliche Begriffe und wissenschaftliche Symbole verstehen wir jedoch nur, wenn wir die Konventionen kennen, nach denen sie an die Sachverhalte gebunden sind.
Jeder originelle Künstler verändert und erweitert die Füllung der zweiten und dritten Schicht (der Formung des Materials und der in ihm erscheinenden Gegenstandswelt). Überspringen kann er sie jedoch nicht, wenn er den Erlebenden in tiefere Schichten leiten will. Wer die Konventionen des Hörens und Sehens radikal durch neue ersetzt (wie z.B. Komponisten, die nach Serienreihen komponieren, die man zwar lesend begreifen kann, nicht jedoch hörend) wird soviel Unsicherheit erzeugen, das ein Fortschreiten in tiefere Schichten des Erlebens unmöglich wird.
Unsere Betrachtungen sagen nichts über den ästhetischen Rang solcher Kunst aus, sondern nur etwas über die ontologisch bedingten Grenzen ihrer Wirkung. Auch sollen sie nicht als experimentationsfeindlich verstanden werden. Es ist immerhin möglich, dass die Experimente der “Neuerer” Erlebnismöglichkeiten vorbereiten, die wir uns noch nicht vorstellen können. Wie anfangs gesagt, hinkt der Kunstbegriff der Entwicklung immer nach.
Festzuhalten ist jedoch, dass nach den ontologischen Schichtgesetzlichkeiten bestimmte Arten zeitgenössischer Kunst das nicht leisten können, was sie sich offenbar nach dem Vorbild der “konventionellen” Kunst noch immer vornehmen und was noch immer von ihnen erwartet wird, nämlich erlebnismäßigen oder weltanschaulichen Gehalt zu vermitteln. Deshalb passt unser Kunstbegriff, wie ihn die Schichtenästhetik erst in neuerer Zeit definiert hat, nicht mehr zu vielen Kunsterzeugnissen, die wir als “zeitgemäß” oder “fortschrittlich” bezeichnen. Es ist zweifelhaft, dass er sich erweitern lassen wird, ohne an Klarheit zu verlieren. Man muss sich deshalb überlegen, ob man einen neuen Namen suchen sollte.
DAS PROBLEM DER KONKRETEN POESIE
Der polnische Philosoph Roman Ingarden [1] hat als erster eingehend beschrieben, dass jedes literarische Werk "Unbestimmtheitsstellen" enthält, die von uns, den Lesern, ergänzt werden müssen. Mit "Unbestimmtheitsstellen" meinte er inhaltliche und gehaltliche Auslassungen (Einzelheiten oder Zusammenhänge, die nicht beschrieben werden), und zwar sowohl unfreiwillige (kein Autor kann alles beschreiben) wie auch gewollte Aussparungen. Die gesamte "rezeptionsästhetische" Schule der letzten Jahrzehnte [2], besonders Wolfgang Iser [3], haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Literatur als ästhetischer Gegenstand nicht nur im Text besteht, wie noch die formalistischen Schulen glaubten, besonders der New Criticism [4] und sein deutscher Ableger, die sogen. immanente Interpretation [5]. Literatur kommt statt dessen erst in der schöpferischen Mitwirkung des Lesers (allgemeiner: Rezipienten) zustande, eben beim Ausfüllen jener zuvor erwähnten Unbestimmtheitsstellen. Der aktivierende Charakter von Dichtung liegt gerade darin, dass sie uns zum "Mitdichten auffordert.
Die Frage muss jedoch gestellt werden, wie weit dieses zweifellos richtige Prinzip getrieben werden kann bzw. wie ausgedehnt die Unbestimmtheitsstellen sein dürfen, ohne dass wir verunsichert werden, weil wir uns vom Dichter im Stich gelassen fühlen. Wollen wir beliebig viel Freiheit? Sind etwa die "offensten" Texte die besten? Oder erwarten wir vom Autor, dass er uns wenigstens so weit leitet, dass sich nicht jeder Leser seinen eigenen Reim aus einem Text machen muss? Wollen wir nicht beim Lesen eines Textes von der Voraussetzung ausgehen, dass wenigstens in großen Umrissen andere Leser den gleichen Sinn aus ihm entnehmen können (und voraussichtlich werden)? Wollen wir vielleicht bei "lyrischen" Texten (was immer das ist) sogar manchmal das Erlebnis einer Gemeinschaft von gleichempfindenden potentiellen Lesern haben, wofür wiederum zuerst gleiches Verständnis des Textes Voraussetzung ist?
All diese Fragen nach den "Grenzen der Aussparung" hat m.W. noch niemand zentral und zugleich konkret gestellt, weshalb wir es uns hier vorgenommen haben. Wenn wir uns aber nach geeigneten Literaturgattungen umschauen, an denen wir diese Grenzen der Unbestimmtheitsstellen aufzeigen können, wählen wir natürlich zuerst die, in denen die semantische Unbestimmtheit oder Offenheit am weitesten getrieben ist; und zwar nicht aus Versehen, sondern im Prinzip. Das sind zweifellos die verschiedenen Formen der sogen. "konkreten Poesie" [6] sowie verwandter Richtungen [7]. Da es uns nicht um eine erschöpfende Auseinandersetzung mit allen Formen der konkreten Poesie geht, sondern um ein besseres Verständnis unserer Rezeptionsmöglichkeiten für dergleichen Literatur, braucht es uns nicht zu bekümmern, dass wir hier nur wenige Beispiele betrachten können. Es sollen allerdings repräsentative sein! Und diese wollen wir dann mit einigen Zitaten vergleichen, in denen hervorragende Vertreter der konkreten Poesie die Wirkungsweise und -ansprüche dieser Gattung zusammengefasst haben.
Beginnen wir mit dem Vergleich von zwei motivgleichen Gedichten: einem der berühmtesten Beispiele für Erlebnislyrik goethescher Prägung und einem der ersten und bekanntesten "konkreten Gedichte" [8] (Abb. 1 und 2). Am häufig interpretierten Gedicht Ein Gleiches ist hier nur Folgendes festzustellen: 1. Es deutet - trotz seiner Kürze - einen Weltausschnitt an (Gipfel, Wald, Wipfel, Vögelein). Damit gibt es der Phantasie des Hörers wenigstens eine Richtung, innerhalb derer sie sich ziemlich frei entfalten kann. Jeder wird sich die Abendlandschaft etwas anders vorstellen. Es wird jedoch in jedem Falle eine Abendlandschaft sein. - 2. Die Person des Autors (in der Verkappung seines "lyrischen Ichs") ist auch in diesem kurzen Gedicht noch da, und zwar auf unmittelbare und mittelbare Weise: unmittelbar in dem "Du", womit der Dichter sich selbst anspricht; mittelbar in der Blickverlagerung von der Ferne der "Gipfel" zur Nähe der "Wipfel" und schließlich zu sich selbst. - 3. Das Gedicht ist inhaltlich ein "memento mori"; auch in der zunehmenden Zeilenverkürzung seiner Sprache ist das eintretende "Schweigen" gestaltet. In gelungenen Gedichten wird immer wieder festgestellt, dass sie nicht nur über ein Erlebnis reden, sondern dieses auch in der Sprachform gestalten, z.B. in charakteristischen Veränderungen der Zeilenlänge, in sogen. "beschwerten Senkungen" [9], in der Durchbrechung des Versmaßes [10], in bedeutungsvollen Pausen.
Auf bedeutungsvolle Pausen hin wollen wir uns gleich noch ein weiteres motivverwandtes Gedicht anschauen, welches in mehrfacher Hinsicht zwischen denen von Goethe und Gomringer liegt: Ingeborg Bachmanns Reklame" [11] (Abb. 3). Dieses Gedicht hat mit den meisten konkreten gemeinsam, dass man es nicht versteht, wenn man es nur hört. Denn man muss die schrifttechnische Abhebung der Reklame-Fetzen erkennen, die die persönliche Aussage der Sprecherin (sozusagen die "goetheschen Restbestandteile" des Gedichtes) umgeben. Das große Schweigen (des Todes), welches sogar den Lärm und die Hektik der Reklame auslöscht ist nun in diesem Gedicht durch das Wegbleiben der vorletzten Zeile ausgedrückt, die etwas unterbricht, woran wir uns bereits gewöhnt haben, durch das Verstummen der Reklame. Außerdem wird, wie im Goethegedicht, die letzte Zeile verkürzt. Interessant wird aber das Gedicht für uns hauptsächlich durch den Kontrast der oberflächlichen Reklame-Heiterkeit zur existentiellen Angst der Sprecherin, durch die Abhebung des Persönlichen, welches eben auch hier noch vorhanden ist, vom Bombardement durch das Unpersönliche. Und dieser für uns sinnlose Wortsalat der Reklame stellt, ebenso wie Goethes Abendlandschaft, eine Art Weltausschnitt dar; allerdings unserer modernen, nervenzerschleißenden Umwelt. Sie kann jedoch noch immer im Dichter ein (wenn auch negatives) Erlebnis auslösen, welches er in Sprache gestaltet.
In Gomringers Gedicht Schweigen [12] ist das nun anders. Ein Weltausschnitt kann mit einem einzigen Wort nicht mehr vermittelt werden. Und die Verfasser konkreter Lyrik wollen das auch ausdrücklich nicht [13]. Wenige Worte sollen "konkret", als solche, erfahren werden und nicht als Durchgangsstation zu Aussagen und Beschreibungen [14]. Wenn sie doch (syntaktisch-semantisch) zu Aussagen verbunden werden, soll dies durch den Leser geschehen, dem damit optimale Freiheit gelassen und der so zum "Mitdichten" aufgefordert wird [15].
Kommen wir also dieser Aufforderung nach! Was denken wir, wenn wir diese "Kombination" (Heißenbüttel) und "Konstellation" (Gomringer) eines vierzehnmal wiederholten Wortes betrachten? Zuerst wohl, dass hier das "Schweigen" gerade durch das Fehlen dieses Wortes ausgedrückt wird, anstatt durch das Fehlen anderer Worte, wie in den ersten beiden Gedichten. Das ist eine recht banale Beobachtung. Und es ist wohl die einzige, die jeder Leser machen kann.
Was sich anschließt - wenn sich überhaupt etwas anschließt - sind private Assoziationen, die mit dem Gedicht selbst wenig zu tun haben, durch dieses nur angeregt werden. So denke z.B. ich selbst, weil ich zufällig in Japan lebe und mich mit Zen beschäftigt habe, daran, dass alle Zen-Anhänger beteuern, man könne diesen nicht durch Worte vermitteln, sondern nur im Schweigen (der Meditation) erfahren, viele von ihnen dann aber ganze Bücher über ihn schreiben [16]. Die vierzehnfache Wiederholung des Wortes "Schweigen" ist für mich also das Geschwätz über "innere Stille" und dergleichen und das wirkliche Schweigen die Lücke im Gedicht, wo Sprache einmal aufhört. Und da diese Lücke nicht am Ende des Gedichtes steht, wie in den beiden ersten Gedichten, sondern irgendwo in der Mitte, assoziiere ich hier nicht das endgültige Schweigen (des Todes), sondern nur eine zeitweilige Unterbrechung im Redefluss, der uns immer umgibt. - Diese Überlegungen oder Assoziationen finde ich weder sehr profund, noch können sie irgendwelche Allgemeingültigkeit beanspruchen. Ein Leser, der nicht in Japan lebt und Zen studiert hat, assoziiert sicher etwas anderes, ebenso Banales.
Auch wenn etwa Helmut Heißenbüttel (in seinen "Sprechwörter" genannten Texten [17] ) ein Wort in seine Teile zerlegt, statt es nur zu wiederholen, stellen sich bei mir weder Verständnis noch Interesse ein (Abb. 4). Oder was soll die Deklination von ein solcher mann durch Franz Mon [18] dem Leser sagen (Abb. 5)? Warum muten die Assoziationen, die solche Gedichte vielleicht beim Leser auslösen, so viele als banal an, - nicht aber die durch die beiden ersten motivgleichen Gedichte ausgelösten? Daran, dass hier kein Weltausschnitt geschildert wird, kann es nicht nur liegen. Denn auch andere Gedichte Goethes bieten keinen, z.B. Wanderers Nachtlied I ("Der du von dem Himmel bist ..."). In diesem ist jedoch das zweite unterscheidende Merkmal, das "lyrische Ich" des Autors, noch da, sogar eindringlicher als in dem anderen Nachtlied. Denn auch dieses Gedicht ist ein verkappter Dialog, diesmal nicht des Sprechers mit sich selbst ("Warte nur, balde Ruhest du auch."), sondern des Sprechers mit dem "süßen Frieden", den er ersehnt ("Komm, ach komm in meine Brust!"). - Könnte es sein, dass zumindest eines dieser beiden Elemente ("Weltausschnitt" oder "lyrischem Ich") vorhanden sein muss, wenn ein Gedicht uns noch "persönlich" ansprechen soll - und nicht nur als linguistische Etude [19]. In der Lyrik des Symbolismus [20] ist das lyrische Ich ebenfalls in der Regel eliminiert. Sie bietet jedoch immer einen Weitausschnitt, wenn auch oft in ästhetischer Verfremdung [21]. Wenn man aber den Autor als Teil unserer Welt auffasst, kann eines für das andere einspringen: Die Welt wird in Lyrik doch immer "persönlich" erlebt, auch wenn sie sich "objektiv" gebärdet; und das Erlebnis des Autors wird durch die "Welt", in der er lebt, ausgelöst. Sie wird durch sein "Weltverhältnis" geprägt, auch wenn er es nicht weiß.
Wenn dem so wäre, dass konsequent "konkrete" Lyrik (d.h. solche ohne Welt- oder Autorbezug) uns innerlich kalt lässt (und die Folgenlosigkeit der konkreten Lyrik als Bewegung spricht dafür), sollten wir uns doch etwas genauer fragen, warum das so sein könnte. Denn nicht alle konkreten Gedichte sehen aus, wie die bisher besprochenen. Und auch die drei "Klassiker" dieser Richtung (Heißenbüttel, Gomringer und Mon) haben ganz verschieden geartete geliefert. Sie verstehen sich ja selbst als "Experimentatoren".
Zuerst sollten wir aus unserem Beobachtungsfeld Formen der konkreten Lyrik ausscheiden, die uns einfach deshalb kalt lassen, weil in ihnen keine sprachliche Kommunikation mehr stattfindet. Das kann zwei Gründe haben: Entweder können diese so weit zur Graphik neigen, dass sprachliche Kommunikation gar nicht mehr versucht wird. Timm Ulrichs (Abb. 6) etwa ordnet den Buchstaben e 625mal in einem Quadrat so an, dass er die changierende Wirkung von Op Art annimmt [22]. Oder Jiri Kolar (Abb. 7) schreibt den Namen Brancusi 73mal mit der Schreibmaschine übereinander, legt als Raster den Umriss einer Brancusi-Skulptur auf dieses Schriftbild und schneidet den Umriss aus [23] Beide Vorgehen können ad nauseam variiert werden.
Oder die Bedeutung von Wortfetzen und Buchstabenkombinationen bleibt so dunkel, dass man nicht weiß, ob hier Sprachsplitter nur graphisch verwendet wurden oder ob eine sprachliche Kommunikation versucht wurde. So bietet uns Luigi Ferro [24] drei untereinander angeordnete Wortreste, von denen so viel abgeschnitten wurde, dass man nur im obersten noch "Young" zu erkennen glaubt, den Rest aber nicht enträtseln kann (Abb. 8). Soll unsere Rätselei etwa als "künstlerische Mitwirkung" (Ausfüllen von "Unbestimmtheitsstellen") verstanden werden? -Oder soll hier ein "statement" über den hermetischen Charakter von Schriftsprache gemacht werden? - Will der Dichter uns nur erleben lassen, wie es ist, wenn man etwas nicht entziffern kann? - Will er sich über uns lustig machen?
Ähnliches wird erreicht (oder auch nicht erreicht), wenn Diter Rot [25] die Buchstaben t und u"frei" und in Wiederholung zu einem Gebilde vereint, das weder als sprachliche noch als graphische Gestaltung wirkt (Abb. 9).
Eindeutig ein "statement", höchst wahrscheinlich ein politisches, versucht John Furnival [26] in einer Kollage von Zeitungsdruckzeilen zu geben (Abb. 10). Diese ist jedoch so chaotisch und fragmentarisch, dass es wieder zu keiner sprachlichen Aussage kommt. Wie man in der Musik, wenn zu viele Melodien gleichzeitig gespielt werden, nur noch Geräusche wahrnimmt, so ist hier nur noch eine graphische Konfiguration zu entnehmen, nicht jedoch eine semantische. Das ist gerade dann bedauerlich, wenn eine politische Aussage versucht wird. Und die so genannte "engagierte Literatur" der Sechziger Jahre hat sich auch hauptsächlich deswegen gegen die Konkrete Poesie gewandt [27].
Man kann (und damit kommen wir zu konkreter Dichtung, die tatsächlich irgendwie auf sprachlicher Ebene kommuniziert, und nicht nur auf graphischer) Kolars Ausschneidetechnik (Cut Out) noch mit einer witzigen Pointe versehen, wie etwa Reinhard Döhl [28] das Ausschneidebild eines Apfels mit einer kleinen Unregelmäßigkeit versieht, einem Wurm in der Gestalt des Wortes "Wurm" innerhalb einer Umgebung von unzähligen Wiederholungen des Wortes "Apfel" (Abb. 11). - Wenn aber Ch.J. Wagenknecht [29] diesen harmlosen Witz mit den abgründigen Wortspielen Nestroys vergleicht, weil angeblich beide "den Betrachter im Labyrinth der Beziehungen zwischen Sprache und Welt ... verfangen" tut man m.E. diesem Gedicht zu viel Ehre an, bzw. dem geistreichen Nestroy großes Unrecht. Was wird denn durch dieses Figurengedicht ausgesagt, außer dass in einem Apfel sich manchmal ein Wurm verstecken kann und dass man auf ähnliche Weise innerhalb vieler gleichlautender Worte ein "nicht konformes" verstecken kann? -
Wagenknecht bemerkt ganz richtig: "Weil sie auf die komplexeren Ausdrucksmittel von Satz und Versbau verzichten und sich darauf beschränken, das Schriftbild einzelner Wörter zu entfalten, können diese Gedichte unmittelbar nur die einfachsten Gegenstände und Verhältnisse zum Ausdruck bringen. Nicht dieses oder jenes Schweigen, sondern Schweigen überhaupt kommt in Gomringers Gedicht zur Sprache [30]..." Dann aber fährt er fort: "Es geht in der konkreten Poesie weniger um die typographische Abbildung selbst als vielmehr um ihre Möglichkeit darum, dass sich die Sprachlosigkeit des Schweigens im Schrift und Druckbild eines wiederholten Wortes überhaupt abbilden lässt. Auch das Apfel- und Wurm-Gedicht von Reinhard Döhl erscheint als trivial nur dann, wenn man voraussetzt, dass hier am Ende nichts anderes dargestellt sein soll als eben ein Wurm in einem Apfel. Tatsächlich aber bilden diese gegenständlichen Elemente nicht den Gegenstand, sondern nur den Stoff des Gedichts, und ihre typographische Abbildung ist nicht der Zweck, sondern wieder nur ein Mittel der poetischen Konstruktion. Den Gegenstand bildet vielmehr die typographische Abbildbarkeit selbst und den Zweck der Nachweis, dass es in der Sprache zwischen Bild und Begriff mehr Beziehungen gibt, als unsere Schulweisheit und unser Sprachgebrauch sich träumen lassen. Insofern handeln alle diese Gedichte, am Beispiel einzelner Wörter, von der Sprache. Die Diktion der konkreten Gedichte ist von metasprachlicher Art: linguistisch, und insofern allerdings neu." - Das ist brillant argumentiert, jedoch nur für den linguistisch Orientierten überzeugend, und nicht einmal für den. Denn die Verhältnisse von Bild und Begriff, die in konkreter Lyrik gezeigt werden können, sind ja einfachster Art, wie alle unsere Beispiele demonstrieren.
Man kann nun dem "Cut Out" tatsächlich (zusätzlich zur linguistischen Pointe) einen Sinn geben, z.B. einen politischen, wenn man etwa wie Claus Bremer [31] - die Bergpredigt in der Form von zwei Panzern arrangiert (Abb. 12). Dieses Gebilde ist jedoch - streng genommen -kein "konkretes" Gedicht mehr, weil hier die Sprache nicht mehr als solche Anlass zur Reflexion gibt, sondern das, was sie aussagt. Die pazifistische Botschaft der Bergpredigt steht im Kontrast zur Panzerform, in der sie
angeordnet ist. Die Sprache ist hier also auf durchaus konventionelle Weise (ohne Ergänzungen durch den Rezipienten!) Durchgangsstufe für Aussagen, was die Konkretisten eigentlich vermeiden wollten. - Letztlich aber läuft auch diese Juxtaposition von Bild und Sprache auf einen Gag hinaus, der keine überraschenden Einblicke gewährt: Dass sich in unserer Welt pazifistische Ideale und Kriegstreiberei "im Raume stoßen", wissen wir. Ihre Kontrastierung in den beiden Medien (Bild und Sprache) ist kein besonders origineller Einfall.
Man kann natürlich auch mit Worten selbst (ohne die Cut Out-Methode) Bilder konstruieren, sogar mit Worten als Material und Gegenstand der Aussage. Das gelang einem unbekannten Verfasser [32], der zeigen wollte, dass Worte sowohl Trennmauern zwischen Menschen errichten können wie Brücken der Verständigung bauen [33] (Abb. 13).
Nun gibt es allerdings sogen. "konkrete Gedichte" 34, die tatsächlich etwas über unser Leben (und nicht das Leben von Worten) aussagen. Diese sind jedoch gerade deshalb nicht wirklich "konkret". Sie belassen die Worte in syntaktischen und semantischen Verknüpfungen, wenn auch den rudimentärsten. Anders könnten sie nichts über unser Leben aussagen. So wird z.B. von Wiemer (in bewusster oder unbewusster Benn-Parodie) ein ganzes Menschenleben in 33 Perfektpartizipien umrissen, die jedoch ohne Schwierigkeit in Sätze aufgelöst werden könnten (Abb. 14). (Statt "geröntgt" kann man sagen: "Dann wurde er geröntgt" etc.) Bereits durch die Anzahl verschiedener Wörter in solchen Gedichten wird gewährleistet, dass diese nicht "konkret" (als solche) auf uns wirken können, sondern als Durchgangsstation für Aussagen funktionieren. Viele solcher Gedichte kann man jedoch "sprachanalytisch" nennen, wenn sie Redeweisen zusammenstellen, die etwas über unsere Sprachverwendung - und damit über unsere Einstellung - aussagen. Als "konkret" sollte man sie aber nicht bezeichnen, weil sie semantisch festgelegt sind.
Obwohl sie ebenfalls viele Wörter enthalten, kann man von den sogen. "Wortfeldern" Max Benses, den Peter Rühmkorf den "Chefideologen des Rezesses" nennt [35], gerade nicht sagen, dass sie semantisch eindeutig sind (Abb. 15). Häufig sind sie (at random) mit dem Computer zusammengestellt, eine Methode, die Bense allen Ernstes verteidigte [36]. Jegliche syntaktisch-semantische Verknüpfung unterbleibt allerdings. Man hat oft den Eindruck, dass diese Texte nach rein mathematischen Gesichtspunkten aus einem Prosatext (etwa einer Übersetzung von D.H. Lawrence) herausgezogen sind. Weil grundsätzlich alle Wörter kleingeschrieben werden, verliert man noch stärker die Orientierung (was sicher beabsichtigt ist) und weiß nicht, ob man es mit Substantiven, Verben oder anderen Wortarten zu tun hat (sog. Ansprüchen und Programmen messen.
Wenn wir zum Schluss deshalb zusammenfassen, welche Forderungen von den entscheidenden und angesehensten Vertretern der konkreten Poesie immer wieder formuliert wurden, so lässt sich feststellen:
1. Diese Poesie soll Sprache selbst darstellen und nicht Inhalte und Aussagen.
S.J. Schmidt: "Konkrete Kunst stellt nichts dar: sie verwirklicht etwas, was es in dieser Form in der Erfahrungswirklichkeit nicht gibt. Und dieses Verwirklichte gibt seine Information nicht von allein ab, es erzählt keine Geschichten." [40] Bazon Ph. Brock: "... die heutige Poesie konzentriert Sprache auf das Wort, auf die buchstäbliche Existenz des Wortes ... es vertritt die absolute Position beziehungsloser Unmittelbarkeit Existenz ohne jeden Du-Aspekt …” [41] - Helmut Heißenbüttel: "Es scheint heute etwas in Vergessenheit geraten zu sein, dass Literatur nicht aus Vorstellungen, Bildern, Empfindungen, Meinungen ... besteht, sondern aus der Sprache, dass sie es mit nichts anderem als Sprache zu tun hat." [42] - Eugen Gomringer: "Den konkreten dichter interessiert der sprachaufbau mehr als der redefluß." [43]
Dem lässt sich entgegnen, dass dichterische Kommunikation (im Unterschied zu wissenschaftlicher, etwa der Linguistik) normalerweise nicht von sich selbst spricht, weil das nur für wenige interessant wäre, sondern fortwährend über sich hinaus weist: auf Weltausschnitte und Seelisches. Sprache, die auf nicht-wissenschaftliche Weise sich selbst darzustellen sucht, ist immer in Gefahr, der Banalität zu verfallen. Denn über Sprache kann man auf die Dauer nur mit komplexer Sprache sprechen, weil sie selbst ein äußerst komplexes Phänomen ist.
2. Alle Konkretisten scheinen darin übereinzustimmen, dass sie die bisherige Dichtungssprache reduzieren wollen, jedoch nicht darin, was nun jeweils reduziert werden müsse.
Peter Rühmkorf: "Zuerst schien es zwar, als ob (man) es nur auf die herkömmlichen Gliederungsprinzipien, auf die leeren Formalitäten der Sprachkunst abgesehen habe, dann auf die Metaphorik, dann auf die Syntax, und schließlich ... zu dem Einenletzten ... zum Elementarbaustein ... dem Wort .. Der Reduktionsprozess, der entschiedene Vorsatz, nicht Beziehungen zu stiften, sondern Beziehungen aufzulösen, ... übersprang auch noch diese Schranke. Die Wörter brachen auseinander, die Lettern waren frei." [44]
Der Reduktionsprozess begann mit dem Verschwinden des Autors aus der Lyrik im 'absoluten Gedicht", im Impressionismus. Trotz des linguistischen Interesses der Konkretisten bemerkte keiner von ihnen, dass Sprache aus kompliziert geschichteten
Elementen besteht, die sich alle auf die eine oder andere Art gegenseitig ermöglichen, bedingen und beeinflussen. Wer eine Schicht konsequent eliminiert, bringt auch die anderen zum Einstürzen, zumindest die von ihr getragenen [45]. Harald Hartung [46] stellte einmal treffend fest, dass "der Leser beginnt, die negierte Syntax als lediglich unterbrochene zu sehen und den Text wiederherzustellen. Damit widerlegt er die Tendenz des Textes. Wo mit der Grammatik 'endgültig Schluss' gemacht werden soll, erweist das attackierte System gerade seine Kraft."
3. Im Widerspruch zu den ersten beiden Forderungen steht die oft gehörte, dass die Sprachkonstellationen der konkreten Poesie für das Mitdichten der Rezipienten "offen" sein sollen. Deshalb werden ja die syntaktisch-semantischen Verbindungen der Worte ausgespart, damit der Leser sie beliebig ergänzen kann.
Helmut Heißenbüttel: "Der Autor gibt ihm (dem Leser) so etwas wie ein Muster, eine Probe. In der Tendenz, so scheint mir, wird schließlich jedoch die Grenze zwischen Autoren und Leser verwischbar sein. Jeder Leser ... hat der Tendenz nach die Möglichkeit, Autor zu werden.' [47] -Ebenso Eugen Gomringer: "Die Haltung des Lesers der Konstellation ist die des Mitspielenden, die des Dichters des Spielgebenden."[48] - Und noch einmal Siegfried Schmidt: "Automatisch beginnt der Betrachter, den Begriff in sinnvolle Texte zu überführen, möglichen Sinn in wirkliche Bedeutung zu verwandeln. Um das isolierte Wort herum komponiert er Texte ... ohne dass ein solcher Text den Anspruch erheben könnte, der richtige, der adäquate zu sein ... " [49].
Nun will man also (unter Mithilfe des Lesers) die Sprache doch zur Durchgangsstufe (transparent) für Aussagen und Bedeutungen machen. Denn der Leser wird ja die Worte "sinnvoll" verbinden, wenn das möglich ist, ihnen also einen Sinn geben, den der Autor ihnen extra nicht gab, weil er die Aufmerksamkeit nicht vom Wortmaterial auf dessen Sinn hin ablenken wollte. Wenn der Leser es darf/soll, warum dann der Autor nicht? Um den Leser nicht vorzeitig festzulegen? - Wie wir gesehen haben, legen Texte, die einigermaßen interessant sind, immer eine bestimmte (wenn auch oft nur grob umrissene) Auslegung nahe. Und das ist legitim, denn sonst brauchten wir den Autor nicht. Wir könnten, wie Bense es zu tun scheint, vom Computer eine random selection von Wörtern "ausspucken" lassen, die wir dann beliebig zu etwas Sinnvollem zu verbinden versuchten.
4. Konkrete Poesie soll nicht nur von Sprache selbst sprechen und "offen" für die Mitwirkung des Rezipienten sein, sondern auch "unpersönlich" und "objektiv".
Vergl. oben das Zitat von Bazon Brock. Auch S.J. Schmidt50 betont, dass konkrete Kunst "ihrem Begriff nach antisentimental und antiindividualistisch sein muss; denn Gefühl und Individualität streben nach dem Besonderen, dem Individuellen. Konkrete Kunst aber richtet sich ... auf das Allgemeine, das Überindividuelle."
Diese Forderung steht ebenfalls im Widerspruch zur letzten, denn diese Poesie bleibt ja gewiss nicht "objektiv", sobald der Rezipient einmal anfängt "mitzudichten". Die Anfänge dieser Entwicklung zur "Objektivität" in der Lyrik liegen, wie gesagt, im Verschwinden des Autors aus den Gedichten des Impressionismus und im sogen. "absoluten Gedicht" um die Jahrhundertwende. Es mutet eigenartig an, dass da, wo diese Tendenz zur Enthumanisierung in der konkreten Poesie ihr Extrem erreicht hat, sie in ihr Gegenteil umschlägt und nun der Rezipient eingeladen wird, seine subjektiven Assoziationen in das Gedicht zu projizieren. Denn die Aufforderung zum "Mitdichten" bzw. zur Vollendung des Gedichts ist ja nichts anderes als die Kapitulation des Autors, der den Mut (oder zumindest die Unbefangenheit) verloren hat, sich selbst im Gedicht auszudrücken. Nun muss es statt seiner der Leser tun. Wie wir in der Einleitung sagten, hat er das in begrenztem Maße schon immer getan (im Ausfüllen der "Unbestimmtheitsstellen" des Textes). Nun aber verzichtet der Autor vollständig auf die Leitung der schöpferischen Mitwirkung des Rezipienten beim "Konkretisieren" des Textes als Dichtung. Damit aber hört er auf, "Autor" im bisherigen Wortverständnis zu sein. Ein Computer könnte seine Funktion übernehmen.
5. Viele Autoren behaupten darüber hinaus, dass konkrete Poesie emanzipierend, ja revolutionär wirken soll. Durch die Umwälzung oder Ausschaltung der in unserer Sprache fixierten Bedeutungshierarchien sollen fixierte Vorstellungen und Verhaltensweisen abgeschüttelt und neue ausprobiert werden. "Sprachkritik" soll zu "Gesellschaftskritik" führen.
Eugen Gomringer: "Es scheint heute darum zu gehen, die strukturmerkmale der geistigvitalen situation unserer zeit aufzudecken, um schließlich an dieser struktur mitwirken zu können." [51] Chris Bezzel: "revolutionär ist ... eine dichtung, die im neuartigen sprachspiel diejenige gesellschaftliche umwälzung vorwegnimmt, für die alle revolutionäre arbeiten. dichtung der revolution bedeutet revolution der dichtung." [52] Während die Anhänger der "engagierten Literatur" den Konkretisten oft Mangel an sozialer Relevanz vorwarfen, spricht Siegfried J. Schmidt gerade von der "gesellschaftspolitischen Brisanz der konkreten Dichtung, die effizienter sein dürfte als die so genannter engagierter Dichtung" und darin liege, dass hier "(nicht argumentativ, sondern ästhetisch simultan) die Sprache als Ort der Führung und Verführung demonstriert wird ... Der visuelle Text zeigt implizit die Konstituiertheit, die Vorläufigkeit und Verfasstheit jeden Sinns, damit aber die Unverlässlichkeit und Zweifelhaftigkeit jeder intellektuellen und sozialen Ordnung, deren Veränderbarkeit aus ihrer gesellschaftlichen Verfaf3theit notwendig folgt. [53]
Diese anspruchsvollen Behauptungen können natürlich nur eingelöst werden, wenn die konkrete Dichtung sich zuerst einmal durchsetzt, d.h. wenn viele Menschen konkrete Gedichte lesen. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Und zum politischen Handeln neigende Menschen wären wahrscheinlich die letzten, die sich mit derartigen, absichtlich von aller Wirklichkeit abstrahierenden Gebilden befassen würden. So konnte Harald Hartung 1975 feststellen: "Die literarische Revolution (wenn man konkrete Poesie und experimentelle Literatur als solche auffasst) war Mitte der 60er Jahre abgeschlossen und von dieser 'revolution der dichtung' führt bislang kein Weg zur dichtung der revolution'." [54]
Nachdem wir festgestellt haben, dass die Programme der Konkretisten sowohl in sich selbst widersprüchlich als auch unrealisierbar sind, wollen wir uns noch eben fragen, ob vielleicht einige unserer Beobachtungen sich auf ähnliche Tendenzen in anderen Kunstzweigen übertragen lassen. Die konkrete Lyrik ist sowohl von ihren Vertretern wie auch von ihren Gegnern immer wieder mit der abstrakten Malerei verglichen worden. Und tatsächlich fallen einem überall Parallelen auf, wie z.B. im vorhergehenden Abschnitt die Beobachtung, dass auch der Betrachter eines konsequent ungegenständlichen Bildes versucht, die ihm gebotenen formalen Bildelemente zu Gegenständen zu verbinden, obwohl das der Absicht des Künstlers zuwiderläuft. Und dies, nachdem es abstrakte Kunst bereits acht Jahrzehnte gibt. -
Man macht sich aber oft nicht klar, dass Malerei sich von Literatur grundlegend in der Beschaffenheit des Materials unterscheidet. Das Material der Malerei (Farbflächen, Konturen etc.) ist als solches bedeutungsneutral, während das der Literatur (Worte) bereits selbst Bedeutungsträger ist. Tzvetan Todorov [55] sagt in der Sprache der Semiotik: "Literatur ... ist ein Zeichensystem zweiten Grades, oder anders ausgedrückt, ein konnotatives System ... hierin unterscheidet sie sich von allen anderen Kunstformen, (sie) baut ... auf einer Struktur auf, der Sprache." Und Max Scheler [56] meinte lang zuvor dasselbe, wenn er sagte, dass Sprache bereits selbst "objektivierter Geist" sei. Auch die Schichtenmodelle [57] eines Roman Ingarden oder Nicolai Hartmann haben diesen grundlegenden Unterschied zwischen den Künsten und seine Folgen ausgiebig untersucht. Aus all diesen Beobachtungen und Überlegungen heraus ergibt sich eindeutig, dass es sinnlos und unmöglich ist, Sprache analog zum Material der Malerei zu verwenden, wie z.B. Heißenbüttel sich vorgenommen hatte (s.o.). Und alle Träume von einer Erneuerung unserer Sprachverwendung durch totale Reduktion (wie von Rühmkorf oben geschildert) stellen sich als Illusion heraus. Wir sind in den Systemen unserer Sprachen gefangen, wenn wir mehr als banales Gestammel mitteilen wollen. Eine Revolution der Sprache durch Dichtung wird es nicht geben. Nur sehr begrenzt und nur im persönlichen Gebrauch können wir zu ihrer Evolution beitragen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grenzen der "Aussparung“ in der Literatur
- Das Problem der konkreten Poesie -
Aussparung als allgemeines Prinzip der Kunst.
Es sei zuerst an die wohlbekannte psychologische Tatsache erinnert, dass jegliches Wahrnehmen ein partielles ist. D. h. wir wählen von den vorhandenen, also im Prinzip wahrnehmbaren, Einzelheiten die aus, die für uns von Belang sind. Wir könnten aber, auch wenn wir es wollten, nicht alles sehen. Darauf hat die Gestaltpsychologie aufmerksam gemacht. Etwa nicht die Rückseite einer Kugel, die wir dennoch als gewölbt auffassen und nicht etwa als Kreisfläche; ebenso nicht die Schattenregionen eines Photos oder eines Chiaroscurogemäldes. - Den Inhalt dieser "Leerstellen" ergänzen wir, ohne uns dessen bewusst zu sein.
Noch viel weniger, das ist ebenfalls bekannt, kann der Künstler im Kunstwerk alles darstellen, was in der Wirklichkeit vorhanden ist, weder der "Realist" noch der "Naturalist", und selbst nicht der "Neorealist". Das trifft für die Malerei ebenso zu wie für die Literatur. Er kann es aus technischen Zwängen, hauptsächlich des Raums, sowie aus psychologischen Gründen nicht: Er selbst nimmt ja nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit wahr, und innerhalb dessen nur eine Auswahl von Phänomenen. Was der Künstler innerhalb des potentiell Vorhandenen wahrnimmt und darstellt, gibt natürlich Hinweise auf seine eigene Persönlichkeitsstruktur, sein Temperament und seine Interessen.
Aussparung als intendiertes Prinzip.
Nun hat es jedoch immer Kunstrichtungen gegeben, die sich eine vollständige Abbildung der Wirklichkeit gar nicht erst vornahmen, sondern eher deren Gegenteil: die Reduktion des Darzustellenden auf ein Minimum, das eben noch notwendig ist, um das Vorstellungsvermögen des Rezipienten zum Ergänzen des Ausgesparten zu führen; und zwar, innerhalb gewisser Grenzen, nicht zu einem willkürlichen Ergänzen, sondern zu einem "geleiteten". Diese Kunstrichtungen gebrauchen die verschiedensten Techniken der "Andeutung" und "Aussparung", des Weglassens des nicht unbedingt Notwendigen. In der Literatur denken wir sofort an gewisse Formen der Lyrik (etwa des Haiku), in der Malerei an asiatische Tuschmalerei [1], aber auch an die verschiedenen Formen und Stufen der Abstraktion in der westlichen Malerei des 20. Jahrhunderts, die schließlich in die konsequente Ungegenständlichkeit führten. Wir denken gewöhnlich nicht an das Phänomen der sogen. „konkreten Poesie", in der häufig, ähnlich wie in der ungegenständlichen Malerei, die Welt der uns umgebenden Gegenstände vollständig ausgespart wird. Weil die konkrete Poesie uns jedoch das Prinzip der Aussparung extremer und konsequenter vorführt, als irgendeine andere Literaturgattung, wollen wir auf sie später genauer eingehen. Es soll gefragt werden, ob der Technik der Aussparung in der Literatur psychologische Grenzen gesetzt sind, die bestimmte, vom Autor gewünschte und vom Publikum erwartete Arten der Kommunikation zwischen dem Kunstwerk (oder dem Künstler) und seinen Rezipienten ausschließen.
Wenn wir von "Stufen" der Aussparung sprechen, ist das natürlich nicht historisch zu verstehen, sondern eher phänomenologisch. So zeigt z. B. Gustav Rene Hocke, dass viele, ja die meisten Tendenzen der modernen Lyrik unseres Jahrhunderts bereits in manieristischen Strömungen anderer Jahrhunderte zu finden sind. [2] Die Medien haben außerdem ihre eigenen Gesetze und Zwänge. So wies etwa Oskar Walzel bereits 1929 auf den immanenten Widerspruch, der in dem Begriff "impressionistische Dichtung" steckt und der ihr aus ihrem Medium der Sprache erwächst. [3] - Ja, selbst die Gattungen innerhalb einer Kunstart eignen sich auf ganz verschiedene Weise für die Aussparungstechnik bezw. legen diese in verschiedenem Maße nahe. - So ist offensichtlich, dass etwa im Roman aus Raumgründen weniger ausgespart zu werden braucht als in den Kurzformen der Lyrik. Es muss jedoch auch jeweils gefragt werden, wieweit der Rahmen gesteckt wird, innerhalb dessen in verschiedenem Maße ausgespart wird. So mag eine kleine Skizze innerhalb eines sehr begrenzten Weltausschnitts weniger aussparen als eine mehrbändige Familiensaga, ein Still-Leben weniger als ein kolossales Schlachtengemälde. Und selbst innerhalb jeder Gattung ist die Variationsbreite der Aussparungsmöglichkeiten, dem Stil des Künstlers entsprechend, so groß, dass man kaum etwas Verallgemeinerndes darüber sagen kann.
Aussparungsmöglichkeiten in Literatur.
Bei kürzeren Literaturgattungen wie der Ballade, bei deren Beschreibung man häufig von "holzschnittartiger Umrisszeichnung" und "Helldunkel-Gestaltung", also Aussparungstechniken, gesprochen hat, lässt sich jeweils fragen, was eigentlich in jedem Falle ausgespart wird - und warum? Die erste Frage hat soziologische Bezüge: Nur weil z. B. beim Publikum eines Fontane oder Strachwitz historisches Hintergrundswissen vorausgesetzt werden durfte, konnte es in ihren "historischen Balladen" ausgespart werden. - Die zweite Frage hat mehr poetologische Relevanz: Weil etwa realistisches Detail vom Haupterlebnis der dämonisierten Natur ablenken würde, wird es z. B. in Goethes "naturmagischer Ballade", Der Fischer, ausgespart.
Wer fragt, was in einem Gedicht an Inhalt wegfällt, der fragt zugleich, wie viel potentiell abschilderbare Außenwelt übergangen wurde. Analog kann man auf die potentiell für Literatur verfügbaren Strukturelemente bezogen fragen, wie viele von diesen eingesetzt, bezw. ausgespart, sind. Wie zu erwarten, hängen diese beiden Aspekte eng zusammen. So ist z. B. den beiden eben erwähnten Balladenformen gemeinsam, das sie ein Geschehen gestalten (Das Wort "Handlung" sollten wir den größeren Gattungen vorbehalten, besonders den dramatisch strukturierten.) Wer davon ausgeht, dass das Erzählen einer Geschichte in Literatur der Normalfall ist, der könnte etwa sagen, dass in Erlebnislyrik goethescher Prägung, in der lediglich eine Stimmung ausgedrückt werden soll, das Geschehen "ausgespart" worden ist. Das ist jedoch lediglich eine Frage der Perspektive: So wie für den jungen Goethe und für die Romantiker das Fehlen von Geschehen in ihren Erlebnisliedern "normal" ist, so kann auch das Fehlen jeglicher syntaktischer Verknüpfung des Wortmaterials für den Verfasser "konkreter" Poesie normal sein.
Missverstehen von Erlebnislyrik durch Überschreiten der Grenzen der Aussparung.
Zurück zur inhaltlichen Aussparung: Wir täuschen uns, wenn wir annehmen, dass Erlebnislyrik der "vor-modernen" Art immer ganz aus sich selbst heraus zu verstehen ist, welche Behauptung, m. E. zu Unrecht, gelegentlich der Schule der "Immanenten Interpretation" unterschoben wurde. [4] Ein Minimum an biographischem Wissen brauchen wir oft, um allgemeingehaltene Formulierungen nicht zu missdeuten. - In seinem berühmten Gedicht "Auf dem See" liefert Goethe zwar selbst sehr geschickt den entscheidenden Verständnisschlüssel mit einem Wort, welches in beschwerter Senkung steht: "Hier auch Lieb und Leben ist". Um diese Zeile richtig zu verstehen, muss man "auch" betont sprechen. Von "Lieb und Leben" hat sich also der Dichter befreit und hofft, sie in einer neuen Umwelt wieder zu finden. Um eine private Freiheit handelt es sich hier also, und nicht etwa um eine politische. - Ein Beispiel für Erlebnislyrik, die missdeutet werden kann, bietet ein Fragment der Sappho: "Unter ging der Mond und die Plejaden, zur Mitte ist die Nacht, vorüber streicht die Jugend, ich aber liege allein..." Nicolai Hartmann erlebt in diesen Versen vor allem die "Sehnsucht der Liebenden [...] Wer sie nicht heraushört, dem ist mit Dichtung nicht zu helfen..." [5] Zu diesen muss ich selbst gehören, denn ich werde durch die Worte "Vorüber streicht die Jugend" [6] angeregt, ein ganz anderes Erlebnis zu assoziieren: die Frustration der alternden Einsamen. Nicht die "Sehnsucht der Liebenden" höre ich aus diesen Versen, sondern die Trauer der nicht lieben könnenden oder dürfenden. - Wo eine solche Unsicherheit in der Interpretation aufkommen kann, besonders im Bezug auf das zentrale Erlebnis, ist eben "zu viel ausgespart", als dass der Dichter uns noch sicher von der semantischen Schicht in die des Gehaltes leiten könnte. (Im Fragment beruht das natürlich auf einem Zufall.) Wo es, wie in der Lyrik, aus der Sparsamkeit der "kleinen Form" und aus künstlerischer Absicht, eben der Andeutungstechnik, nur wenige Indizien gibt, die uns von der semantischen Schicht in die folgenden leiten, ist jede Einzelheit der Form wichtig. In Roman, Novelle und Drama kann ein Detail für ein anderes einspringen, bezw. eines das andere bestätigen. Es werden so viele Indizien geboten, dass wir manche "überlesen" können, ohne den Gehalt zu verfehlen. In lyrischen Gedichten hingegen verändert oft das Verständnis eines einzigen Wortes die Interpretation des Ganzen. Das betonte "auch" im Goethegedicht ist ein Beispiel. Ein berühmteres findet man in Mörikes Gedicht „Auf eine Lampe", worüber Staiger, Heidegger und Spitzer sogar einen publizierten Briefwechsel geführt haben. [7] Dergleichen Schlüsselstellen in Lyrik sind aber auch deshalb so entscheidend, weil sie - zugleich mit ihrer gedichtinternen Integration - auch einen Außenbezug haben, wie wir gleich sehen werden.
„Objektivität" von Lyrik durch Aussparung des Bezugs auf die Person des Dichters.
Wenn auch nicht mit einem Geschehensablauf (und schon gar nicht mit einer Handlung), so haben wir es in goethescher Erlebnislyrik doch zumeist mit einem "lyrischen Vorgang" zu tun, einer bereits in der Strophengliederung angedeuteten mehrstufigen Entwicklung der Stimmung. Und nun sprechen wir von strukturellen Merkmalen, die inhaltliche und formale Aspekte vereinen. Im soeben erwähnten Goethegedicht haben wir eine dreistrophige Entwicklung von extravertierter Freiheitsekstase über introvertierte Erinnerung hin zu liebevoller Versenkung in die umgebende beseelte Natur, wobei die letzte Einstellung (Strophe) eine Verbindung der beiden vorhergehenden darstellt. - In dem Sapphogedicht, wie es uns jetzt vorliegt, und in allen Gedichten dieser Art, ist jedoch auch die seelische Entwicklung, die zu einer Stimmung hinführt, ausgespart. In den Zeilen, die uns erhalten sind, spiegelt sich nur noch ein Erlebnis, das der Einsamkeit. - In manchen Gattungen ist nun diese Beschränkung auf nur eine Stimmung zum Prinzip erhoben, z. B. im Haiku oder im malaiischen Pantun, wie es in Indonesien noch viel gesungen wird. [8] Das wohl bekannteste Beispiel für ein Haiku ist Bashos "Alter Teich in Ruh. - Fröschlein hüpft vom Ufersaum, und das Wasser tönt”. [9] - Solche Gedichte muten uns besonders dann "objektiver" an als Sapphos Fragment oder Goethes Gedicht, wenn aus ihnen - zumindest formal - auch der Dichter selbst verschwunden, d. h. ausgespart ist. - In Wirklichkeit steht er natürlich hinter solchen Zeilen. Denn Natur hat, als solche, keine Erlebnisqualität. Diese wird immer erst von uns in sie hineinprojiziert. Was in solchen Gedichten jedoch andeutungshaft gestaltet wird, soll weniger als persönliches Erlebnis genommen werden und mehr als Hinweis auf eine objektive Einsicht. "Sicht" jedoch beim Haiku nicht im Sinne von "Denken" verstanden, sondern mehr von "Sehen". Im Anschauen, in der Meditation, kann man nämlich auch einen Hinweis auf Entscheidendes erfahren, wie es sich etwa einem vom Zen geprägten Bewusstsein darstellt. Diese "Einsicht" ist allerdings gerade im Haiku häufig so andeutungshaft gegeben, dass sie vom westlichen Menschen (und wohl auch oft vom modernen Japaner) nicht mehr ohne weiteres nachvollzogen werden kann. Nur wer mit der "Anschauungsart" - ich vermeide absichtlich den Begriff "Denken" - des Zen vertraut ist, kann die Bedeutung der wenigen Zeilen ohne weiteres entschlüsseln. Manche Haikus sind darin durchaus dem "Koan" (dem Meditationsrätsel des Zen) ähnlich und zugleich gewissen "hermetischen" Gedichten. Von letzteren unterscheiden sie sich jedoch dadurch, dass ihre Rätselhaftigkeit (Dunkelheit) nicht dem frivolen Bedürfnis, "interessant" zu wirken, entspringt. -
„Verabsolutierung" von Lyrik durch Aussparung ihres Erlebnisbezugs zum Autor.
Viele Formen des Haiku können als "Bildgedichte" [10] bezeichnet werden, weil sie - in äußerster Verkürzung - ein dichterisches Bild entwerfen (Fenster, Mond, Kopfkissen, tränenbenetzte Kimonoärmel), - oder auch als "Naturgedichte", wenn sie einen Naturausschnitt andeuten (Teich und Frosch). Bild und Naturausschnitt werden aber nicht um ihrer selbst willen geboten, sondern eher zum Anlass einer - häufig versteckten - Reflexion oder Gefühlsaufwallung genommen. Der skizzierte Weltausschnitt ist also immer noch "symbolisch“ für ein Erlebnis des Dichters, wie bei Goethe oder Mörike, wenn auch verkürzter. - Wenn nun dieser Bezug zum Autor (zu seinem "Erlebnis") absichtlich abgeschnitten wird und Metaphern nur noch um ihrer eigenen Faszination willen zusammengestellt werden, also nicht mehr für etwas symbolisch sind, dann bewegen wir uns in eine neue Richtung, die in die Moderne und schließlich zum Konkretismus führt. Und obwohl nun auch noch der symbolische Bezug auf das Erleben des Dichters ausgespart wird, nennen wir gerade diese Richtung "Symbolismus". "Im Symbolismus [...] erscheint das Ich nicht auf der Bühne, der symbolische Gegenstand steht im Mittelpunkt, er ist das Hauptthema, ja die Sache selbst: in seiner Beschreibung erschöpft sich die Aussage des Gedichts" heißt es bei Heinrich Henel. [11] Wofür der symbolische Gegenstand symbolisch ist, wird nicht gesagt. Es kann auch nicht gesagt werden, weil er eben fair nichts symbolisch ist. In Frankreich vollzog sich diese entscheidende Wende bereits um 1870, in Deutschland erst um die Jahrhundertwende. Von nun an und in solchen Gedichten hat es keinen Sinn mehr zu fragen, was der Dichter uns sagen oder ausdrücken wollte. Wer auf "Sinn" und "Bedeutung" besteht, muss diese selbst in solche (”autonom" sein wollenden) Wortstrukturen projizieren. Damit schleicht sich langsam die Beliebigkeit in unser Dichtungserlebnis. Es bleibt zunehmend uns selbst überlassen, wie wir die Worte des Dichters interpretieren. Er gibt uns immer weniger Hilfe dabei. - Während der Leser eines "hermetischen" Gedichts immer noch eine Bedeutung "hinter" den dunklen Worten vermuten kann, wenn er will, ist dem Rezipienten konkreter Poesie normalerweise auch diese Möglichkeit genommen, weil sie sich (im Gegensatz zu der des Symbolismus) sprachlich sehr schlicht gibt. Allenfalls in der räumlichen Zuordnung weniger Worte auf dem Papier kann er einen Sinn vermuten, den es zu entschlüsseln gilt. Meist aber sagt der Autor selbst in der die konkrete Lyrik begleitenden Kommentarliteratur, dass es einen verbindlichen Sinn von seiner Seite nicht gibt.
Desintegration der semantischen Schicht im Symbolismus.
In den Gedichten des späten Trakl, z. B. in "Die Sonne" [12], gibt es zwar noch eine semantische Schicht (und deshalb auch andere, die von dieser ontologisch ermöglicht werden), jedoch in seltsam "ästhetisch verfremdeter" Form. Es ist zu Recht festgestellt worden, dass "Trakls Sprache [...] sich auffallend wirklichkeitsfern [gibt], scheinbar nur nebenbei verweist sie auf eine hinter ihr liegende Wirklichkeit". [13] Die Bestandteile unserer realen Welt sind zwar noch da, jedoch werden ihnen häufig Eigenschaften zugewiesen, die sie in Wirklichkeit nicht haben, bei Trakl etwa Farbqualitäten. Im "Gesang des Abgeschiedenen" ist etwa von den "kristallenen Weiden des Rehs“ die Rede. Der Grund für die Entrücktheit dieser Gedichte, ihr l'art pour l'art-Charakter, liegt darin, dass sich ihre Teile hauptsächlich aufeinander beziehen, und zwar auf ästhetische Weise, und erst in zweiter Linie auf die reale Welt. Deshalb ist die Art auflösender Metaphern (G. R. Hocke nennt sie "hieroglyphisch"), deren sie sich gern bedienen, besser als "Chiffren" bezeichnet worden. Reinhold Grimm beschreibt in Hinsicht auf Trakl: "Die Metapher verabsolutierte sich schließlich vollends, und was anfangs nur eine unerhörte Raffung logisch noch zusammenhängender Teile gewesen war, wurde zuletzt zur reinen alogischen Bildlichkeit". [14] Schichtenpsychologisch lässt sich der gleiche Sachverhalt auch so beschreiben: Die Schicht der erscheinenden Gegenständlichkeit wird unzuverlässig und trägt deshalb nicht mehr sicher in die folgenden der emotionalen Qualitäten und geistigen Gehalte. - Es ist zwar bei Trakl und anderen der Versuch unternommen worden, diese Chiffren im Gesamtwerk der Dichter zusammenzustellen und mit ihren Erlebnissen in Beziehung zu setzen, sie sozusagen psychoanalytisch zu deuten. Besonders bei surrealistischer Lyrik legt sich dieses Vorgehen nahe. Es zeigt sich aber, dass Bilder und Metaphern sich in ihrer Bedeutung verschieben und durchaus nicht immer im gleichen Sinne eingesetzt werden. Sie stehen also nicht zuverlässig "für etwas". Auch der Vergleich von Gedichtüberarbeitungen hat gezeigt, wie wenig es diesen Dichtern auf den Bedeutungsgehalt der Worte ankommt. „So heißt es in einer Gedichtzeile Trakls erst: 'Herzzerreißende Stunde sank...', dann 'Herzzerreißende Stunde stieg...' Oder: 'Alles Dunkle sang...’, dann 'Alles Dunkle sprach...', dann 'Alles Dunkle schwieg...' Mit diesen Beispielen sollte nur gezeigt werden, wie wenig der Bedeutungsgehalt des Wortes in Trakls Gedichten wiegt." [15] Ernst Howald stellt bereits für das Schaffen von Mallarme, Rimbaud und Valery fest: "Inhaltslosigkeit, d. h. Unwesentlichkeit des Inhalts für den Künstler im Gegensatz zum Bedürfnis der Mitteilung oder des Bekenntnisses beim normalen Dichter ist wichtigstes Charakteristikum absoluter Poesie." [16] - Wir wissen von den Dichtern "absoluter Poesie", dass sie ihre Gedichte immer wieder umarbeiteten, teilweise sogar, nachdem sie bereits gedruckt waren. Howald [17] führt für Mallarme ein Beispiel an ("Tristesse d'ete"), wo "die Reime stehen bleiben und ein ganz anderer Verskörper mit anderem Inhalt davor gesetzt wird“. - Da, wie Reinhold Grimm und andere [18] gezeigt haben, Trakl besonders stark von Rimbaud beeinflusst wurde und andererseits die Vertreter der absoluten Poesie ebenfalls viel voneinander entlehnt haben,[19] liegt es nahe, Trakls Umarbeitungen seiner eigenen Gedichte auf den gleichen Impuls zurückzuführen und nicht, wie z.B. Walter Killy [20], zu versuchen, hier auf einer inneren Notwendigkeit zu bestehen. Ebenso wie später den Konkretisten ist bereits diesen Dichtern die Aussage der von ihnen gewählten Worte relativ unwichtig, solange diese nur als solche faszinieren. Und deshalb können sie auch notfalls mit anderen genau entgegengesetzter Bedeutung vertauscht werden. - Insofern beginnt also bereits hier die semantische Schicht zu zerfallen. Und insofern steht diese Art von Dichtung zwischen solcher, die noch einen mehr oder weniger verbindlichen Wirklichkeitsbezug hat, und solcher, die diesen absichtlich vermeidet, der sogen. "experimentellen" oder "konkreten" Poesie. Über den nun immer beliebter werdenden Begriff des "Experiments" sagt Harald Hartung ganz richtig, er "stimuliert die Vorstellung, es gebe in der Literatur - analog zur Wissenschaft - Fortschritte. Wo literarisch 'experimentiert' wird, ist fast immer auch die Vorstellung vom Fortschritt im Spiel. Das kann zum Dogma werden, der(sic) dem Sinn des Experiments selbst kaum noch nachfragt..." [21] -
Konkrete Poesie als Beispiel extremster Anwendung des Aussparungsprinzips.
Bevor wir auf die konkrete Poesie weiter eingehen, sei nochmals darauf hingewiesen, was bereits der Titel anzudeuten versuchte: Nicht dieses Genre als solches, welches bereits weithin als passe angesehen wird, interessiert uns hier, sondern dieses nur paradigmatisch als Form der Literatur, in welcher das Prinzip der Aussparung am weitesten getrieben wurde, und zwar auf systematische und programmatische Weise. Denn natürlich lassen sich die "Grenzen" eines Prinzips (einer Technik) am besten in dessen extremster Anwendung studieren.
Nicht alle historisch feststellbaren Anwendungen dieses Prinzips können hier dargestellt werden, z. B. nicht die des Dadaismus, der häufig als Vorläufer der konkreten Poesie genannt wird. [22] Und für die extremsten Anwendungen, auf deren Besprechung wir uns hier beschränken müssen, können und wollen wir keine Beispiele bringen. Denn wer allgemeine Feststellungen an Beispielen demonstriert, der mag immer damit rechnen, dass ihm Gegenbeispiele vorgehalten werden. Er lässt sich auf endlose Argumente ein. Und solche "Gegenbeispiele", wo sie sich als stichhaltig erweisen (z. B. konkrete Gedichte, die doch noch einen Sinn enthalten, - oder auch etwa einige Jandl-Gedichte, die zwar "sinnlos" sind und sein wollen, zugleich aber amüsante Blödeleien in der Morgenstern-Nachfolge, die jedem Spaß machen), sind hier nicht gemeint. Selbstverständlich gibt es immer "Übergänge", über die man sich streiten kann. - Man kann auch über konkrete Poesie nicht sprechen, als ob es nur eine Art gäbe. Siegfried Schmidt unterscheidet in seiner kleinen Anthologie [23] z. B. visuelle Poesie in "graphisch orientierte", "begrifflich orientierte" „semiotisch-ikonische", "symbiotische und materiale"; außerdem "konkrete Dichtung" und "konzeptionelle Dichtung". (Wer vor diesen Begriffen verzagt, findet in der gleichen Anthologie hinten ein "kleines terminologisches Lexikon".)- Man kann aber wohl über Eigenschaften der meisten dieser Gedichte sprechen, die auch in der begleitenden Kommentarliteratur ihrer Autoren ausdrücklich verteidigt werden.
Aussparung von Weltdarstellung in konkreter Poesie.
Wir stoßen nun hier offensichtlich an eine Grenze der Aussparung in der Wortkunst. In konkreter Poesie sollen häufig nicht nur der Mensch (der Dichter) und sein Erlebnis ausgespart werden, sondern auch die Welt der Gegenstände, die uns umgibt. In ihren "Wortkonstellationen" erscheint kein aufs Äußerste verkürzter Naturausschnitt mehr, wie im Haiku, auch nicht in ästhetischer Verfremdung, wie im Symbolismus, oder in absichtlicher Unverständlichkeit, wie im " Hermetismus". Die Worte bleiben Worte, heißt es, und wollen als solche erfahren werden. "Konkrete Poesie verwendet Sprache als Material, das nur noch in zweiter Linie auf eine von der Sprache gemeinte Wirklichkeit verweisen will [...] Eine analoge Erscheinung finden wir in der abstrakten Malerei, in der Farbe und Form sich ja auch vom Gegenstand gelöst haben und aus sich selbst wirken." [24] - Diesen Vergleich mit der Malerei (manchmal auch mit der Musik) hört man immer wieder. Wir kommen darauf zurück. - Harald Weinrich bemerkt dazu: "Es ist folgerichtig, dass gegenüber der Eigenmacht der Worte und Wörter die Gegenstände der Dichtung verhältnismäßig unwichtig werden [...] Die Abwesenheit der Dinge ist nämlich die Voraussetzung fair die Anwesenheit der Worte. Das ist die 'condition verbale' der Literatur." [25] - Und warum ist das so? - Weil normalerweise die Aufmerksamkeit des Lesers oder Hörers sofort von der Wortschicht in die der Bedeutungen jeder Art weiterdringt. Bekanntlich hat bereits Stefan George sein eigenwilliges Schreibsystem eigens zum Zwecke entwickelt, die Aufmerksamkeit des Lesers in der Wortschicht länger festzuhalten. - Das ist berechtigt. Fast alle Dichter, die ihre Sprache lieben, möchten die Aufmerksamkeit des Lesers so lange wie möglich in der Wortschicht festhalten. - Was geschieht nun, wenn man dieses Ziel mit dem Rigorismus der Konkretisten verfolgt? Peter Rühmkopf spricht von "Schwundstufen und Dörrzonen der schönen Literatur", vom Geist der „Wortmechanik“, vom „Reduktions- und Reinigungszwang“, vom „Ziegelwandmuster der Avantgarde ", die „zur öden Addition und ins kalte Räsonnement“ führen, indem sie „das Machen verabsolutieren. Die Produktion verkehrte sich zur Reduktion" [26]. Hinsichtlich des von Rühmkopf erwähnten "Reinigungszwangs" sollte man ergänzen, dass sich in der Entwicklung der Künste im 20. Jh. zwei entgegengesetzte Tendenzen beobachten lassen: Zuerst tatsächlich das Bemühen um eine "Reinigung" der jeweiligen Gestaltungsweise innerhalb jeder Kunstart (beschrieben von Hans Sedlmayr bereits 1955) [27], dann aber das Anstreben von Wirkungen und Verfahrensweisen anderer Kunstrichtungen, besonders solcher der Musik, wie z. B. in Kandinskys Proklamationen im "Blauen Reiter Almanach"; schließlich sogar eine Tendenz zur Verschmelzung verschiedener Medien, etwa in der Konkreten Poesie von Lyrik und Graphik oder in Stockhausens „musikalischer Graphik" von Musik und Graphik. Man bekommt den Eindruck eines ins Schleudern geratenen Vehikels. Das Schlagwort vom "Verlust der Mitte" (Sedlmayr, 1948) trifft diesen Sachverhalt gut. Bodo Heimann stellte im Anschluss an die Darstellung analoger Entwicklungen für die "experimentelle Prosa" fest: "Spätzeitlich sind das Auflösen und Verschmelzen der Gattungen und Kunstformen, das rein negativ zu bestimmende, nicht zielgerichtete 'Probieren', das artistischspielerische Manipulieren und Arrangieren sprachlicher Fertigteile, besonders aber die hinter allem stehende Sinnblindheit und Gegenstandslosigkeit, wie sie sich in dem Unterfangen äußern, die Organisationsmittel der Sprache selbst auszunutzen, aus dem Vorrat der Sprache heraus zu arbeiten, sich sprachimmanent zu verhalten und zuzusehen, was das Medium hergibt. [28] Das Medium kann natürlich nichts aus sich heraus hergeben, denn - eben das besagt der Begriff - es vermittelt nur. Das zu Vermittelnde, die Realität, ist sein notwendiges Substrat, auf dem es ruht, aus dem es lebt. Wird es davon 'befreit', wird es selbst zum Gegenstand, so hebt es sich als Medium auf. Konsequenterweise hebt die Sprachimmanenz der Literatur, d. h. die Abkehr von der Realität und die Inthronisation der Sprache als oberste oder einzige Realität, sowohl Literatur als auch Sprache selbst auf..." [29] - Nun kann man den "konkreten" Einsatz der Sprache verschieden konsequent betreiben. Wer etwa einsieht, dass Worte ohne semantisches Feld oder "Bedeutungshof", wie Heißenbüttel sagt, in Dichtung gar nicht einsetzbar sind, kann dennoch ihre metaphorische Verwendung vermeiden. Dieses Bestreben finden wir teilweise bereits bei Brecht ("Die Wahrheit ist konkret.") und es ist verständlich, wenn man an den Metaphernwildwuchs in neuromantischer Lyrik zurückdenkt. - Aber auch dieses Bestreben lässt sich rein kaum verwirklichen, da viele Worte, Nomen ebenso wie Verben, selbst konventionalisierte Metaphern sind. Die Übergänge zwischen "einfacher" und metaphorischer Ausdrucksweise sind fließend. Angestrebt wird jedenfalls zumeist, dass die "Konfigurationen" von Worten nicht zu Vorstellungen oder Aussagen führen, sondern allenfalls zu überraschenden, meist ironischen Einsichten über unseren Gebrauch ebendieser Worte. Dazu Eugen Gomringer: "Den konkreten dichter interessiert der Sprachaufbau mehr als der redefluss" [30]. Und ähnlich Helmut Heissenbüttel: "Es scheint heute etwas in Vergessenheit geraten zu sein, dass Literatur nicht aus Vorstellungen, Bildern, Empfindungen, Meinungen, Thesen, Streitobjekten, 'geistigen Gegenständen' usw. besteht, sondern aus der Sprache, dass sie es mit nichts anderem als Sprache zu tun hat" [31]. - Das ist natürlich patenter Blödsinn und klingt, als ob jemand zu uns sagen würde: Brot besteht aus Mehl. Also esst rohes Mehl! - Man kann sich im Gegenteil auf den Standpunkt stellen, dass Literatur genau aus den Elementen besteht, die Heissenbüttel so umständlich aufgezählt hat, und dass Sprache hauptsächlich (wenn auch nicht nur) das Medium ihrer Übermittlung ist.
Historische Voraussetzungen.
Historisch lässt sich das Experimentieren mit der konkreten Schreibweise durch die Generation der eben Dreißigjährigen in den Fünfziger Jahren gut aus deren "Allergie gegen Inhalt", wie es Franz Mon ausdrückt, verstehen: "Wenn eines in der ersten Welle von Kunst und Literatur nach dem Kollaps des Nazismus gewiss war, so war es die Ablehnung, der Ekel vor jeder Art von Doktrinierung. Es waren aber nicht die Inhalte, es waren die Werte, um die der Bogen gemacht wurde. Wenn in den fünfziger Jahren in der Literatur und in der Kunst der Begriff "experimentell" eine Rolle spielte, so deshalb, weil er das Primat der Methode beim Entstehen von Texten gegenüber den inhaltlichen Festlegungen, den ideologiebestimmten Wertsetzungen ausdrückte. Es ging darum, dass potentielles Material befragt, dass dem Leser eine offene Struktur angeboten werden sollte, aus der er zu seinen Ergebnissen gelangte, statt dass ihm eine vorab existierende Weisheit ästhetisch eingekleidet wie eine verzuckerte Pille gereicht wurde" [32]. - Diese Äußerung erklärt fast alle wesentlichen Eigenschaften der Konkreten Poesie: ihren Verzicht auf Gegenwartsbezug, sei er politischer oder weltanschaulicher Art, ihren Experimentalcharakter, ihre totale "Offenheit". - Etwas in seiner historischen Genese zu verstehen heißt aber noch nicht, diesem blindlings die Wirkungen zuzuschreiben, die seine Autoren sich (und uns) versprachen.
Probleme und Widersprüche im Programm der Konkretisten:
Die Aussparung der semantischen und syntaktischen Sprachschichten.
Bei denen, die sich theoretisch über Konkrete Poesie äußern, d.h. bei allen ihren prominenten Autoren, lassen sich immer wieder zwei letztlich widersprüchliche Positionen beobachten: Einerseits wird betont, dass inhaltliche Assoziationen nicht mehr angestrebt, ja in Anlehnung an abstrakte Malerei nicht mehr gewünscht werden. Der Leser soll sich auf das Medium selbst konzentrieren, eben auf die Wortstrukturen. jedoch nicht auf die herkömmliche Weise, die unsere Aufmerksamkeit sofort in die hinter den Worten liegenden Schichten leitet: Also, vom Wortmaterial zu syntaktischen und semantischen Einheiten und Verknüpfungen, von letzteren zu immer komplexeren Vorstellungen, psychologischen Nuancen, Stimmungsqualitäten, geistigen Gehalten. Das Zitat von Heißenbüttel war ein Beleg für diese Einstellung. - Eugen Gomringer beschreibt die von ihm angestrebte, neue lyrische Ausdrucksweise folgendermaßen: "Der Sinn der reduzierten Sprache ist nicht die Technik der Reduktion an sich, sondern die größere Beweglichkeit und Freiheit (mit dem immanenten Zwang zur Regelung und Ordnung) der Mitteilung, die im übrigen so allgemeinverständlich wie nur möglich sei, wie Anweisungen auf Flughäfen oder Straßenverkehrszeichen." - An diesem Zitat mutet zuerst einmal komisch an, dass ausgerechnet Gomringer es wagt, "Allgemeinverständlichkeit" für seine neue Sprachgestaltung in Anspruch zu nehmen. - Dann fragt man sich, was im Zusammenhang mit dieser auf Substantive ohne syntaktische Verknüpfung reduzierten Sprache wohl mit "immanentem Zwang zur Regelung und Ordnung" gemeint sein könnte? - Die Anordnung der Worte auf dem Papier? Schließlich der missverständliche Vergleich mit den "Anweisungen auf Flughäfen oder Straßenverkehrszeichen" [33], weil diese ebenfalls auf Hauptworte ohne grammatische Integration reduziert sind: Gomringer übersieht, dass Verkehrszeichen etc. auf syntaktische Integration verzichten können, weil diese ohnehin klar ist und deshalb vom Leser automatisch ergänzt wird. "Ausgang", "Einbahnstraße", "Gepäckaufbewahrung", "Toiletten", "Gates 1-12" etc. bedeutet: Hier ist der (bezw. geht es zum) Ausgang, etc. Im konkreten Gedicht ist aber dieser syntaktische Zusammenhang nicht gegeben, sondern wir müssen ihn erfinden. [34] Nach all diesen Überlegungen können wir nur Bernd Scheffer zustimmen, wenn dieser feststellt: "Für die gesamte experimentelle Literatur [...] gilt, dass auch diese Literatur weder allein noch primär sprachtheoretisch zu erfassen ist (versus 'welt'-theoretisch). Noch beim radikalsten Text phonetischer oder visueller Poesie weist das Sprachmaterial über sich hinaus auf 'Welt'; das Sprachmaterial verliert nie seine semantische Grundfunktion; wo Sprachmaterial vorkommt, wird etwas bezeichnet; 'Sprache pur' lässt sich noch nicht einmal ausdenken. - Die häufig wiederholten Behauptungen, Nonsens-Literatur, experimentelle Literatur oder Konkrete Poesie seien sinnlos, inhaltsleer, gehaltlos, rein formal, pure Spielerei, sind nichts als ein Fehlurteil der jeweiligen Kritiker. Aber genau so falsch sind auch die zahlreichen - zustimmenden - Behauptungen, experimentelle Literatur spiele sich nur in der Sprache ab, Sprache sei die handelnde Kraft dieser Texte, das Sprachmaterial führe ein Eigenleben, die Texte hätten mit nichts anderem zu tun als mit Sprache selbst [...] Es gibt keine reine Struktur-Mitteilung. Gedichte werden eben doch nicht aus Worten gemacht, sondern aus Bedeutungen (und damit in gewisser Weise doch aus 'Ideen'). Auch Bilder werden nicht aus Einzelteilen gemacht, sondern - paradoxerweise - aus den Zusammenhängen, die schließlich erst erscheinen " [35]. - Der letzte Teil dieser Äußerung scheint direkt auf das obige Heißenbüttel-Zitat Bezug zu nehmen. -
Wenn man von der Dreidimensionalität des Wortes im Sinne der Zeichentheorie ausgeht, also von seinem semantischen, syntaktischen und pragmatischen Aspekt, dann fällt auf, dass sich kaum allgemein feststellen lässt, welcher dieser drei Aspekte von der konkreten Poesie zurückgedrängt oder vernachlässigt wird, bezw. welcher betont. Einige Autoren [36] behaupten, dass die syntaktische Dimension die semantische verdrängt. - Dem widerspricht, dass z. B. Heißenbüttel ausdrücklich die syntaktische (er nennt es "grammatische") Einbettung der Worte ausschalten will, um dem Rezipienten zu ermöglichen, selbst syntaktische Verbindungen herzustellen. - Nun gibt es zwar Gedichte, in denen eindeutig einer der drei Aspekte unterdrückt wird, - nicht jedoch, wie die Konkretisten hofften, zum Vorteil der beiden übrigen (oder eines dieser beiden). - Wenn man davon ausgeht, dass die drei Aspekte (ähnlich den Schichten des Sprachkunstwerks) in einem subtilen Verhältnis gegenseitiger Unterstützung, ja Ermöglichung, zueinander stehen, ist leicht zu verstehen, dass mit der Unterdrückung eines von ihnen auch die beiden anderen geschädigt werden: Nur in syntaktischer Einbindung kommt der semantische Gehalt eines Wortes voll (innerhalb des Satzganzen) zum Tragen. Nur im pragmatischen Bezugsfeld von Synonymen und Antonymen lässt sich der semantische Gehalt eines Wortes klar abgrenzen, etc.
"Emanzipation" durch "Sprachkritik“
Andererseits hörte man immer wieder in den Programmen der Konkretisten, dass durch die Umwälzung oder Vermeidung der Bedeutungshierarchien unserer Sprachen (also durch die Ausschaltung ihrer eingelaufenen semantisch-syntaktischen Strukturen) fixierte Vorstellungen und Verhaltensweisen abgeschüttelt und neue ausprobiert werden sollen. Also, "Sprachkritik" soll zu "Gesellschaftskritik" führen: "Es scheint heute darum zu gehen, die Strukturmerkmale der geistigvitalen Situation unserer Zeit aufzudecken, um schließlich an dieser Struktur mitwirken zu können." schrieb Gomringer [37] ; und Chris Bezzel sprach sogar von Revolution: "revolutionär ist [...] eine dichtung, die das medium sprache selbst verändert, umfunktioniert, die den hierarchischen sprachlichen charakter zerstört, die im neuartigen sprachspiel diejenige gesellschaftliche Umwälzung vorwegnimmt, für die alle revolutionäre arbeiten. dichter unter diesem aspekt ist also der, der mit poetischen mitteln im medium sprache die sprache selbst als ein menschliches zeichensystem für menschen revolutioniert. dichtung der revolution bedeutet revolution der dichtung" [38]. - Während die Anhänger der "engagierten Literatur“ den Konkretisten oft Mangel an sozialer Relevanz vorwarfen, spricht Siegfried J. Schmidt gerade von der "gesellschaftspolitischen Brisanz der konkreten Dichtung, die effizienter sein dürfte als die so genannter engagierter Dichtung" und darin liegt, dass hier "(nicht argumentative sondern ästhetisch simultan) die Sprache als Ort der Führung und Verführung demonstriert wird [...] Der visuelle Text zeigt implizit die Konstituiertheit, die Vorläufigkeit und Verfasstheit jeden Sinns, damit aber die Unverlässlichkeit und Zweifelhaftigkeit jeder intellektuellen und sozialen Ordnung, deren Veränderbarkeit aus ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit notwendig folgt" [39]. - Das sind anspruchsvolle Forderungen und Behauptungen. - Hinsichtlich ihrer Einlösung in der Praxis bemerkte 1975 Harald Hartung: "Die literarische Revolution (wenn man konkrete Poesie und experimentelle Literatur als solche auffasst) war Mitte der 60er Jahre abgeschlossen und von dieser 'revolution der dichtung' führt bislang kein Weg zur 'dichtung der revolution'." [40]
Wie steht es nun wirklich mit dem Anspruch vieler Konkretisten, mit ihren Gedichten "Sprachkritik" zu treiben? E. P. Müller stellt fest: "Die konkreten Dichter begreifen sich als Sprachkritiker. Die Umgangssprache scheint ihnen kein tragfähiges Material für ihre Aussagen zu geben. Deshalb isolieren sie einzelne Begriffe, setzen sie in neue Zusammenhänge, umgehen damit die geläufige Syntax und erzeugen Konstellationen, die sich einem tradierten Schemadenken entziehen und zum Umdenken zwingen wollen" [41]. - Es fragt sich nun nur, welcher Art die "Aussagen" sind, von denen Müller spricht. - Wenn man mehr leisten will als vereinzelte Hinweise auf unseren unreflektierten Sprachgebrauch oder auf die Fixierung bestimmter Vorstellungen und Denkformen in unserer Sprache, dann braucht man dazu Sprache in ihrer höchsten intellektuellen Potenz. Man kann also auf syntaktische Verknüpfung und komplexe Außenbezüge nicht verzichten. Das, was sich vielleicht "falsch" in unserem Bewusstsein darstellt, gehört ja selbst zur Außenwelt (etwa Gesellschaftliches). - Es muss gefragt werden, ob ein Nachdenken über unsere Welt, ja selbst über unser Manipuliertsein durch Sprache, außerhalb des eingelaufenen Systems einer Sprache überhaupt möglich ist. - Und selbst wenn es möglich wäre: ob die Kommunikation irgendwelcher Zielvorstellungen außerhalb eines differenzierten, und damit festgelegten, Sprachsystems denkbar ist.
Ein teilweises Infragestellen herkömmlicher Vorstellungen und Redeweisen ist selbstverständlich möglich. In der Philosophie ist ein „Abhorchen" der Sprache auf in ihr fixierte Denkformen immer versucht worden. Die sogen. "Soziolinguistik" lebt geradezu davon. In der Literatur hat besonders Brecht häufig eindrucksvoll demonstriert, wie man eine eingelaufene Floskel durch ihre Umkehr als solche entlarven und ihr sogar einen neuen Sinn abgewinnen kann. Sprachkritik (Wittgenstein, Kraus) und "Ideologiekritik" (z. B. in der marxistischen Literaturwissenschaft) haben entscheidend den Literaturbetrieb unseres Jahrhunderts geprägt. Ganz ohne die herkömmlichen, in der semantischen Schicht der Sprache angelegten Vorstellungen geht es aber dabei nicht. Einmal, weil Sprache ohne Bedeutung, d. h. Außenweltsbezug, sofort der Banalität anheim fällt. Die Wirkung von Musik, die ohne Bedeutung auskommt, kann Sprache ebenso wenig nachahmen wie die von Malerei, auch wenn wir metaphorisch von "Sprachmusik" und "Farbenkompositionen" sprechen. Darauf kommen wir gleich zurück. - Sprachkritik kommt aber vor allem deshalb nicht ohne die bereits ausgebildeten semantisch-syntaktischen Schichten aus, weil sich der Autor, der auf sie verzichten will (oder sie um ihren Bezug zur Außenwelt verkürzen, was auf das gleiche hinauskommt), sich selbst der Möglichkeit beraubt, uns in die oben angedeuteten "Hintergrundsschichten" von Literatur zu leiten. Aus ontologischen Gründen kann der Weg in die "tieferen" Schichten der Literatur nur durch die semantische führen. Eine Umgehungsstraße gibt es nicht. Denn die semantische Schicht (in ihrer eindeutigen syntaktischen Bestimmtheit) ermöglicht die nächstfolgende, und diese wiederum noch tiefer liegende (abstraktere), falls der Text solche aufweist. Wir sind also in den Sprachsystemen, die wir einmal haben, gefangen, sobald wir überhaupt in Sprache kommunizieren wollen.
Es war hier gelegentlich von den "Schichtenmodellen", wie sie uns hauptsächlich Nikolai Hartmann und Roman Ingarden für die Literatur entwickelt haben [42], die Rede. Und obwohl diese zur Erklärung unserer Beobachtungen nicht unerlässlich sind, haben sie sich doch als Orientierungshilfe bewährt, die uns gestattet, die ausgesparten Komponenten eines Kunstwerks klar zu benennen. In Grenzfällen, wie den extremen Gestaltungen konkreter Poesie, dienen die Schichtenmodelle auch zur Erklärung für das Nichtfunktionieren dieser Formen. Die Schichtenmodelle, oder ihre Synthese auf die ihnen gemeinsamen Grundzüge [43], sind nichts weiter als Systeme von Kategorien, die wir auf Erscheinungen innerhalb der Literatur projizieren, um diese besser zu verstehen. Sie dienen vor allem dazu zu veranschaulichen (in einem räumlichen Modell, dessen bloßen Modellcharakter man nie vergessen darf), dass bestimmte Teile des Sprachkunstwerks, die wir schon längst gewohnt sind zusammenzufassen (z. B. metrische Eigenschaften, Wortwahl und Stil, oder auch psychologische Gestaltung), andere Merkmalsgruppen (Schichten) ontologisch erst ermöglichen (tragen). Und da konkretere Merkmalsgruppen die abstrakteren erst ermöglichen, weil die letzteren in den ersteren erscheinen, können die ersteren nicht übersprungen (zumindest nicht ganz ausgelassen) werden, wenn man überhaupt zu den letzteren vordringen will. Andererseits aber prägen (formen) die abstrakteren Schichten die konkreteren, etwa so, wie sich im Alltagsleben die Stimmung eines Menschen in seiner Sprachgebung und Mimik ausdrückt. - Wie wir uns klar gemacht haben, ist das Phänomen der Aussparung notwendigerweise überall in der Kunst zu finden und an sich wertneutral. Je mehr in einer Schicht ausgespart ist (nach dem ontologischen Modell sind es hauptsächlich die Mittelschichten, die uns hier interessieren), desto mehr muss von den Rezipienten ergänzt (ausgefüllt) werden. Das geht nun normalerweise beim Kunstwerk ähnlich vor sich wie im täglichen Leben. Denn dort erwirbt der Rezipient die Fähigkeit, in den Vordergrundsschichten eines Werks Hintergrundsschichten zu erkennen. (Wir dürfen nie vergessen, dass es sich dabei um einen Projektionsvorgang handelt. Für meine Katze ist "Laokoon" nur ein kühler Steinblock.) Wie aber erleben wir emotionale und geistige Gehalte in der Umwelt, etwa in unseren Mitmenschen? - Zweifellos nicht durch minutiöse Studien, sondern durch ein intuitives Erfassen charakteristischer Details und Strukturen. Wir schließen also spontan und relativ schnell von z.T. unbewusst wahrgenommenen Einzelheiten (der Vordergrundsschichten) durch Assoziation (Erinnerung an Ähnliches, früher Erlebtes) auf größere Zusammenhänge, die bereits "tiefer" liegenden Schichten angehören, etwa psychologische Konstanten oder gar weltanschauliche Gehalte. Dieser Vorgang ist durchaus ein synthetisch-schöpferischer, jedoch nicht in dem Sinne, wie die Konkretisten es wollen. Der Unterschied ist der zwischen "gelenkter" und "freier" Assoziation. - Gelenkte Assoziation wird als lustvoll empfunden, weil sie schöpferische Kräfte (vor allem unser Vorstellungs- und Kombinationsvermögen) in uns aktiviert, ohne dass uns der Autor dabei im Stiche lässt. - Sobald der Dichter uns nicht mehr durch ein Minimum von Angaben "leitet", fühlen sich viele Menschen verunsichert. Unbestimmtheit, Vieldeutigkeit, und die daraus resultierende Beliebigkeit in der Auslegung des Kunstwerks erzeugen Unbehagen. Man fühlt sich missbraucht. Warum soll man sich anstrengen, einen "tieferen Sinn" im Werk (sei es der Literatur oder Malerei) zu finden, wenn es keinen verbindlichen gibt? - "Offenheit" des Kunstwerks darf nicht mit seiner "Transparenz" [44] verwechselt werden, "Viel deutigkeit" nicht mit "Viel schichtigkeit". Nur der jeweils zweite Begriff stellt einen unbezweifelbaren Wert dar. - Vielleicht liegt der letzte Rest des sakralen Ursprungs der Kunst darin, dass sie den Rezipienten das Erlebnis geben kann, an etwas Überpersonalem und deshalb Gültigem beteiligt zu sein. Beliebigkeit der Auslegung aber beraubt Kunst dieses Werts. Sie belässt den Rezipienten in seiner existentiellen Isoliertheit.
"Überindividueller" Charakter konkreter Lyrik.
Viele Konkretisten betonen, dass ihre Kunst "ihrem Begriff nach antisentimental und antiindividualistisch sein muss; denn Gefühl und Individualität streben nach dem Besonderen, dem Individuellen. Konkrete Kunst aber richtet sich [...] auf das Allgemeine, das Überindividuelle“ [45]. - Ist das der Grund, warum sie die meisten so langweilt? - Als Gegenthese könnte man aufstellen: Das Allgemeine, das einzig in der Kunst interessiert, ist das exemplarisch gestaltete Besondere, das der Allgemeinheit erschlossene Individuelle, eben das Menschliche! - Wir haben anfangs beschrieben, wie allmählich der Dichter im Symbolismus aus seinen Gedichten verschwindet und welche Folgen das hat. - Hugo Friedrich hat sich eingehend zu diesem Thema geäußert: "Der Begriff des Gemüts deutet auf Entspannung durch Einkehr ins Vertraute, in einen seelischen Wohnraum, den auch der Einsamste mit allen teilt, die zu fühlen vermögen. Eben diese kommunikative Wohnlichkeit ist im zeitgenössischen Gedicht vermieden. Es sieht ab von der Humanität im herkömmlichen Sinne, vom 'Erlebnis', vom Sentiment, ja vielleicht sogar vom persönlichen Ich des Dichters" [46]. - D. Brüggemann aber weist darauf hin, dass wir es hier mit einem von Anfang an unmöglichen Beginnen zu tun haben: "Der Sprecher spricht, und so sehr er sich auch bemühen mag, einen 'objektiven Prozess' zu sprechen, sosehr ist es schließlich er selbst, der 'subjektiv' eine Auswahl aus einer bestimmten Summe von Operationen trifft" [47]. Das trifft jedenfalls für unsere Erwartungen in Hinsicht auf Literatur zu. Wir verbinden diese viel stärker mit der Person des Urhebers als etwa Malerei, weil wir bereits im Medium der Literatur "Bedeutung" erwarten, die ihm ja schließlich nur der Autor verliehen haben kann. Wir müssen deshalb noch mal etwas genauer auf Unterschiede in der Materialschicht dieser beiden Kunstarten schauen.
Unterscheidung von Literatur und Malerei durch die Materialschicht.
Malerei ohne Sinn kann subtilste dekorative Reize entfalten, die Sprache nie erreichen kann, weil ihr Material anders beschaffen ist. Vom Material der Malerei (Farben, Konturen) erwarten wir noch keinen Sinn, keinen semantischen Bezug auf die Welt. Es kann deshalb rein dekorativ behandelt werden. Anders ist es bei den Worten in Literatur. Tzvetan Todorov sagt: "Literatur [...] ist [...] ein Zeichensystem zweiten Grades, oder anders ausgedrückt, ein konnotatives System [...] hierin unterscheidet sie sich von allen anderen Kunstformen, [sie] baut [...] auf einer Struktur auf, der Sprache" [48]. Max Scheler sagte einfach, dass Sprache bereits selbst "objektivierter Geist" sei. - Worte, die nicht nach syntaktischen Regeln zu sinnvoller Kommunikation verbunden werden, bringen sich gegenseitig um, sie 1öschen sich gegenseitig in ihrer Bedeutung aus. - Das zeigt sich sogar, wenn man die Gegenstandsschichten von Malerei und Literatur vergleicht, obwohl gemalte Gegenstände nicht genau den in Worten bezeichneten Gegenständen entsprechen: Wenn ein Dekorationsmaler in einem Fries auf eine Meißener Tasse Rose neben Rose malt, beunruhigt uns das nicht; es kann sehr anmutig wirken. Wenn dagegen Gertrud Stein sagt: "A rose is a rose is a rose", fragen wir uns bestürzt, was sie wohl damit meint. Wir suchen sofort nach einem "tieferen" Sinn. Und zwar nicht nach einem beliebigen, den wir diesen Worten unterlegen, sondern nach dem, den Frau Stein mit diesen Worten fassen wollte. Also, nach einem Sinn, den auch andere vor uns verstanden haben und nach uns verstehen werden; letztlich also nach einem Sinn, der uns mit anderen Menschen (zumindest mit der Autorin) verbindet. - Weil Sprache für die meisten Menschen in erster Linie Kommunikation, sinnvolle Bezüge, herstellt, deshalb scheinen m. E. so viele auf die Beliebigkeit und Unverbindlichkeit konkreter Dichtung mit Kälte zu reagieren.
Es ist also hauptsächlich die "Transparenz" ihres Materials für Bedeutung, wodurch sich Sprachkunst von den "bildenden Künsten“ unterscheidet. Die Transparenz bestimmt aber nicht nur das Verhältnis zwischen der Materialschicht (der Worte) und den tiefer liegenden, sondern auch das zwischen den letzteren. In der Sprache des Strukturalismus kann Transparenz so beschrieben werden: "Im Kunstwerk dargestellte partikuläre Realität ist nicht Abbild einer einmaligen historischen Realität, sondern das Dargestellte, das Signifikat hat selbst wieder die Struktur eines Zeichens, denn es verweist hinter das Partikuläre, hinter die Erscheinungen zurück auf 'Strukturen', welche die Realität zu einer sinnhaften Wirklichkeit machen“ [49]. Hier ist von der Sinngebung die Rede, die nicht im Material von selbst erscheinen kann, sondern die entweder der Autor (durch seine Strukturierung des Materials) leisten muss - oder aber der Rezipient. - Aufschlussreich ist eine Bemerkung Roman Ingardens zur "abstrakten" (bezw. "konkreten") Malerei, in der er darauf hinweist, dass gegenstandslose Gemälde sich als "Bilder" (d. h. in seinem Sprachgebrauch: als Kunstwerke) u. a. dadurch ausweisen müssen, dass ihre bemalte Oberfläche sich von der anderer bemalter Gegenstände unterscheidet: Sie darf nicht mehr als Eigenschaft bezw. Eigenfarbe des Gegenstandes (Gemäldes) erlebt werden, wie vielleicht die Muster auf Tarnanzügen, "sondern als etwas, was in seiner Mannigfaltigkeit und Anordnung fair sich selbst ein Ganzes für sich und als das eigentliche Objekt der Perzeption gegeben wird [...] dass die Oberfläche des Gemäldes aus dem Blickfeld des Betrachters verschwindet und der eventuell zur Sicht gelangende Untergrund sich in das Ganze des Bildes einfügt“ [50]. - Ingarden beschreibt hier das Transparentwerden einer Schicht für das Erscheinen einer anderen. Und dies ist nun, da der Maler (außer in der Glasmalerei) immer Oberflächenfarben verwenden muss, äußerst schwer zu erreichen, wenn die Pigmente nicht so arrangiert werden dürfen (wie in gegenständlicher Kunst), dass sie das Auge des Betrachters in die Ansicht von Gegenständen weiterleiten. (Die luminösen Leinwandflächen eines Mark Rothko fallen einem sofort als Versuch ein, diese Transparenz der Pigmentoberfläche zu erreichen, ohne Gegenständliches hinter ihr erscheinen zu lassen.) Normalerweise wird der Betrachter Gegenständliches in abstrakte Gemälde hineinsehen, wo immer er kann, weil er vom außerkünstlerischen Bereich daran gewöhnt ist, nach Gegenständen (im weitesten Sinne) auszuschauen. - Noch schwieriger ist es nun, in konkreter Poesie das Assoziieren von Gegenständlichem zu vermeiden, weil Worte aus sich heraus semantisch aufgeladen sind. Wortsplitter oder Buchstaben werden sofort zu Worten verbunden. Und wo das nicht möglich ist, weisen sie keinerlei ästhetischen Eigenwert auf, außer vielleicht außersprachlichem wie in Kalligraphie und Plakat-Graphik.
Sobald also eine Schicht für die nächsttiefere "transparent" wird, indem diese hinter jener - für den Leser! - "erscheint", wird die jeweils konkretere Schicht für die abstraktere zum "Material". Das bedeutet, dass sie in ihrem Eigensein nicht mehr voll gewürdigt wird, da die Aufmerksamkeit des Lesers zur "nächsten" Schicht vordringt. (Wir entsinnen uns der anfangs zitierten Bemerkung von Weinrich.) Sobald die Worte syntaktisch zueinander in Beziehung gesetzt und dadurch zu Bedeutungs trägern werden, sobald sie also die semantische Schicht „tragen", sind sie eben nur noch "Träger“ einer oder mehrerer tieferer (abstrakterer) Dimensionen, zuerst der der Bedeutungen. Diese lenkt also sofort die Aufmerksamkeit vom Wort als "magischem Gegenstand“ weg. Und eben das wollten die "poesie pure" seit Mallarme und die poesie concrete" verhindern, hauptsächlich, indem sie die Syntax in zunehmendem Maße ausschalteten. Bei Gomringer und Heißenbüttel wird diese schließlich durch "Konstellationen" ersetzt, z. T. visueller Art. Man versuchte also in derartigen Sprachexperimenten, die syntaktische Dimension (Schicht) auszusparen. - Nach den Schichtengesetzen wird damit notgedrungen auch das "Erscheinen" der von dieser getragenen Schichten verhindert, d. h. zuerst der Schicht erscheinender Gegenständlichkeit. Man kann auch sagen, dass durch die Aussparung der semantisch-syntaktischen Schicht der Rezipient gehindert wird, die von dieser getragenen Schichten auf die Wortschicht zu "projizieren“ - Wenn es aber doch zu inhaltlichen oder gar gehaltlichen Assoziationen kommt, was manchmal der Fall ist, dann ist die semantische Dimension nicht konsequent eliminiert worden. - Die konsequenten Varianten der konkreten Poesie sind deshalb die extremsten Demonstrationen des Prinzips der Aussparung in der Literatur und zeigen zugleich dessen Grenzen auf. Sie sparen nicht nur einen Teil einer Mittelschicht aus (etwa historische Hintergrundsinformation oder die Erwähnung des Autors), sondern konsequent eine Schicht als Ganze. Dadurch können sie nicht die Wirkungen erzielen, die sie sich z. T. doch vorzunehmen scheinen, z. B. "emanzipatorische" oder gar politische.
Aktivierung des Rezipienten.
Hier liegt nun ein letzter Widerspruch in den programmatischen Äußerungen vieler Konkretisten: Ein "freies" (nennen wir es ruhig: unverbindliches) Assoziieren inhaltlicher Vorstellungen durch die Rezipienten wird nun doch begrüßt: "Der Autor gibt ihm (dem Leser) so etwas wie ein Muster, eine Probe. In der Tendenz, so scheint mir, wird schließlich jedoch die Grenze zwischen Autoren und Leser verwischbar sein. Jeder Leser [...] hat der Tendenz nach die Möglichkeit, Autor zu werden" [51]. - Ebenso Gomringer: "Die Haltung des Lesers der Konstellation ist die des Mitspielenden, die des Dichters die des Spielgebenden" [52]. - Siegfried Schmidt sagt deutlicher, wie er sich diesen Sinngebungsprozess beim Rezipienten vorstellt: "Automatisch beginnt der Betrachter, den Begriff in sinnvolle Texte zu überführen, möglichen Sinn in wirkliche Bedeutung zu verwandeln. Um das isolierte Wort herum komponiert er Texte [...] ohne dass ein solcher Text den Anspruch erheben könnte, der richtige, der adäquate zu sein..."- Also handelt es sich nicht um "allgemeinen Sinn", wie Schmidt in einem anderen Zitat in Anspruch nahm, sondern um höchst subjektiven! Schmidt nennt "diesen höchst labilen semantischen Zustand auf der Schwelle zwischen Sinn und Sinnfreiheit [...] konkrete Semantik [...] das Wirkliche [...] als reine Möglichkeit"[53] . - Auch E. P. Müller stellt fest: "Alles was an diesem Gedicht (von Jandl) nun inhaltlich interpretiert wird, muss rein subjektiv bleiben. Dieser Zwang zur subjektiven Interpretation ist vom Autor beabsichtigt [...] Die Offenheit des Gedichts erlaubt es, dass es theoretisch ebenso viele Interpretationen wie Leser gibt. Das heißt aber nichts anderes, als dass der Leser auf Anregung des Autors hin das Gedicht für sich erst schaffen muss. Das heißt, dass der Leser selbst zum Autor wird" [54]. - Die Beliebtheit des Offenheitsprinzips haben wir wahrscheinlich der Rezeptionstheorie zu verdanken. Wenn man die richtige Einsicht, dass jeder Rezipient im Ausfüllen ("Konkretisieren") der "Unbestimmtheitsstellen" eines "Artefakts" das "Kunstwerk" eigentlich erst selbst schafft, auf die Spitze treibt, dann könnte das Kunstwerk am meisten geschätzt werden, welches durch größtmögliche „Offenheit" möglichst viele solcher "Konkretisierungen" zulässt [55] – Wer Gelegenheit hatte, solche "eigenschöpferischen Auslegungen" von konkreter Poesie zu beobachten [56], wird sich weigern, hier noch von Kunst zu sprechen. Letztlich handelt es sich immer um ein unverbindliches Spekulieren darüber, "woran man denken könnte, wenn man diesen Text liest" - Und wodurch werden selbst solch unverbindliche Assoziationen ermöglicht? - Entweder durch rudimentäre semantisch-syntaktische Zusammenhänge im Wortmaterial oder durch Ergänzung, Erfindung solcher Zusammenhänge durch die Rezipienten. Ohne semantische „Auslegungen" des Textes scheint es jedoch nicht zu gehen. Drum ist es inkonsequent, die Aussparung erst bis zur Ratlosigkeit bei den Rezipienten zu treiben. - Oder sollen sie dadurch "emanzipiert" werden? - Die obigen Zitate machen klar, dass der Leser konkreter Poesie, nicht etwa durch ihren Inhalt zum Revolutionär werden soll, denn den muss er sich ja zum größten Teil selbst erfinden, sondern, durch sein verändertes Verhältnis zur Sprache, das sie bewirkt. - Wer das Bewusstsein seiner Leser (und dadurch die Gesellschaft) verändern will - und nicht nur das revolutionäre Banner als Deckmäntelchen für poetologische Ratlosigkeit benutzt -, wird nicht darauf verzichten, ganz bestimmte Gehalte zu vermitteln. So war es - trotz der "Offenheit" seiner Strukturen - bei Brecht. Zwar wollte dieser sein Publikum zum Nachdenken (und, wenn möglich, auch zum Handeln) anregen, - Richtung und Resultat dieses Nachdenkens hat er sich jedoch nie durch zuviel "Offenheit" (Aussparung) aus der Hand nehmen lassen. Wenn ein Stück mit einer Frage endet (z. B. " Der gute Mensch von Sezuan"), dann strukturiert er die Handlung so, dass diese uns die (in seinem Sinne) "richtige“ Antwort eingibt. - Die Inkonsequenz in den Programmen der konkreten Poesie scheint mir darin zu liegen, dass hier einerseits die Eliminierung der außenweltlichen Sprachbezüge angestrebt wird, häufig sogar der semantisch-syntaktischen Schicht(en) des Textes überhaupt, und damit nach dem ontologischen Modell automatisch auch aller übrigen Schichten, die von dieser getragen werden können, - andererseits aber diese extreme Aussparung sofort wieder durch emanzipatorische Zielsetzungen oder durch das Anstreben von Assoziationen des Rezipienten zurückgenommen wird.
Max Bense fasste einmal in einem Satz zusammen, welches Bestreben ihn mit anderen Anhängern "experimenteller" Kunst verbindet: "Es gehört [...] zum Problem moderner Kunstproduktion, die semantische Übergangsphase zwischen dem physikalischen Träger und dem ästhetischen Zustand auszuschalten und die Ästhetik der Materialien unmittelbar ihrer Physik aufzulagern, sozusagen als materiale Kunstproduktion, nicht semantische Kunstproduktion zu sein" [57]. - Dieses Bestreben aller Konkretisten muss nach Ansicht der Schichtenästhetik fehlgehen. Gerade weil das ästhetische Erlebnis, sofern es nicht lediglich das des "designs" sein soll, welches Bense selbst säuberlich abtrennt, im "Durchgehen" (bezw. unserer sukzessiven Projektion) der Schichten besteht, von denen keine ganz ausgelassen werden darf, die noch eine abstraktere tragen soll, überzeugen Benses Vorstellungen nicht. Es wird bei ihm nie deutlich, worin der "ästhetische Zustand" letztlich bestehen soll. "Materiale Kunstproduktion" ist eben das: materiale. Sie hört bei der Schicht des geformten Materials auf, weil nur die semantische Schicht in "tiefere" führen kann. - Das bedeutet natürlich nicht, dass sie grundsätzlich weniger wert wäre als "profunde" Kunst. Vielschichtige Kunst kann nur potentiell mehr bieten als "materiale". Wenn sie misslingt, ist auch sie nicht zu retten. Und in vielschichtiger Kunst ist die Gefahr des Misslingens vielleicht wegen deren Komplexität noch größer als in nur dekorativer.
Kommentarliteratur.
Der Umstand, dass die Konkretisten so viel "Kommentarliteratur" geliefert haben und diese nicht nur für notwendig hielten, sondern (nach Schmidt) als einen Teil des dichterischen Prozesses selbst ansehen, weist darauf hin, dass sie selbst spürten, dass ihre poetischen Texte nicht auf eignen Füßen stehen können, dass sie erklärungsbedürftig, ja vielleicht sogar überredungsbedürftig sind. - Dass diese Kommentarliteratur in konventionellem Sprachstil abgefasst ist, zeigt, dass die Konkretisten ihrem reduzierten Sprachgebrauch nicht zutrauten, dass sie mit seiner Hilfe ihre neuartigen Sprachgebilde erklären können. Er bleibt hauptsächlich dem Gebrauch in der Lyrik vorbehalten, denn für die Länge eines Romans kann man ihn kaum jemand zumuten. Wo Mon und Heißenbüttel es doch versuchten [58], wurde ihnen schnell nachgewiesen, dass sie den eigenen Prinzipien untreu geworden waren, werden mussten. Im Drama aber fällt ohnehin der visuelle Aspekt "konkreter" Lyrik weg.
Den Typus des "poeta doctus" hat es natürlich schon vorher gegeben. [59] Die Reflexionen anderer Dichter, von Poe bis Valery, beschäftigten sich jedoch hauptsächlich mit der Frage: Wie entsteht ein Gedicht? Sie fühlten sich nicht genötigt, ihre Erzeugnisse selbst zu rechtfertigen. - Man kann in der thematischen Rückkoppelung auf sich selbst, die sich in den meisten Kunstarten unseres Jahrhunderts beobachten lässt, einen dekadenten Zug sehen; wenn man will, einen neurotischen. Das schließt natürlich nicht aus, dass auf diese Weise noch faszinierende Werke geschaffen werden können. Aber in der Psychologie gilt allgemein ein Außenweltsbezug (in Interessen und Energien des Menschen) als „gesund" oder, wie man jetzt lieber sagt, "angepasst". Dagegen wird ein obsessives Kreisen um die eigene Thematik und Problematik als "neurotisch " verdächtigt. - Wenn nun, seit Mallarmes "Coup de Des“ Gedichte eine Tendenz zeigen, von sich selbst zu sprechen (zumindest in der begleitenden Kommentarliteratur) und Romane über die Entstehung von Romanen geschrieben werden (Thomas Mann, Uwe Johnson, Andre Gide), andererseits Maler des "Informel" erklären, das Werk habe nichts anderes abzubilden als den Akt des Malens, und Filme über die Problematik des Filmemachens gedreht werden, fällt tatsächlich die Analogie zum Neurotiker, der "immer nur von sich selbst spricht", auf.
Gründe für die Abwendung vom Konkretismus.
Schon in den Sechziger Jahren riefen viele Gegner des Konkretismus zur Umkehr auf. [60] Und diese ist auch weitgehend erfolgt, wenn auch nicht aus der Einsicht heraus, die wir hier auseinanderzulegen suchten: dass diese Richtung bereits vom Programm her auf unrealisierbaren Voraussetzungen beruhte. - Das Publikum empfand wohl schlicht Langeweile vor dieser Art von Lyrik. Das zeigt sich am Charakter der Gegenbewegung, die den Konkretismus ablöste, der Pop-Bewegung. Diese war "wohl der massivste Vorstoß" in die genau entgegengesetzte Richtung, "bei dem so manches kulturelle Jungfernhäutchen geplatzt ist", wie sie Jost Hermand metaphorisch beschreibt. [61] - Für die Autoren stellte sich hauptsächlich das Problem der Stagnation bei einmal erprobten Mustern und Sprachschablonen. Und auf die Großformen ließen sich die konkretistischen Techniken nun einmal nicht übertragen.
Naturalismus und Konkretismus als Extrempositionen auf einem Kontinuum der Aussparungsmöglichkeiten.
Wer den Konkretismus für eine bereits im Konzept verfehlte Richtung der Literatur hält, dem drängt sich geradezu der Vergleich mit einer anderen bereits im Programm nicht realisierbaren Bewegung auf: dem Naturalismus. Ein konsequenter Naturalismus [62] einerseits und extrem "konkrete" Poesie andererseits markieren durch ihre jeweiligen Programme die beiden Grenzpunkte auf einem Kontinuum von Aussparungsmöglichkeiten, die noch ein Transparentwerden der Vordergrunds- und Mittelschichten von Literatur für Hintergrundsschichten zulassen. Im "Sekundenstil" wollte der Naturalist alles beschreiben, was in einem gegebenen Milieu wahrnehmbar sein könnte. Wenn das technisch möglich wäre, würde es uns nur verhindern, Hintergrundsschichten zu erleben. Denn auch im Alltag ermöglicht uns gerade die Tatsache, dass wir nicht alles erleben, Hintergrundsschichten zu assoziieren. Wer dem Leben zu genau abguckt, "wie es sich räuspert und wie es spuckt", dem entgehen die seelischen Hintergründe und das WARUM. Er ertrinkt in Einzelheiten. Nur das charakteristische Detail leitet in die Hintergründe des Kunstwerks. - Dass das Programm des Naturalismus auf einem Irrtum beruhte, ist längst erkannt worden. Im anderen Extrem, der konsequenten Abstraktion (dem Konkretismus), können die Hintergrundsschichten nicht erscheinen, weil die Mittelschichten fehlen, die uns in der Kunst, wie im Leben, zu ihnen leiten müssen. Im Lichte der Schichtenästhetik müssen sowohl konsequenter Naturalismus wie konsequente Abstraktion in die Gefahr geraten, dass in beiden die Gestaltung der Mittelschichten sich zu weit vom Leben entfernt: Im extremen Naturalismus überwuchern sie, in der extremen Abstraktion fehlen sie.[63]
Als Vortrag beim 14. Ferienseminar für Germanisten und Deutschlehrer in Osaka/Japan am 17.3.1989. Veröffentlicht in Acta Germanistica XVIII/3, Foreign Languages and Literature Series No. 16 (Kyoto March 1989) 145-186; und (mit Abbildungen) in: Protokoll 14 (Goethe Institu Osaka März 1989) 44-62 unter dem Titel „Das Problem der Konkreten Poesie“.
[...]
[1] Vergl. meinen Aufsatz in der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 22/2 (1977) 193-199: "Über ostasiatische Tuschmalerei“.
[2] "Über Manierismus in Tradition und Moderne". Merkur (1956) 336-363; auch in Zur Lyrik Diskussion (Hg. R. Grimm 1974) 173-207. Immerhin lässt sich vielleicht der Versuch des Soziologen Arnold Gehlen, drei "Bildformen" zu unterscheiden, auf die Literatur übertragen. Diese Bildformen ("1. die ideelle Kunst der Vergegenwärtigung, 2. realistische Kunst, 3. abstrakte Malerei") sollen groben Etappen der abendländischen Geschichte entsprechen, "in denen sich ein Wechsel der Bildrationalität vollzog". (Zeitbilder; Zur Soziologie der Ästhetik der modernen Malerei. 1960)
[3] Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. 1929:"Leichter ist allerdings die Aufgabe, nur Eindrücke zu bieten, für den Maler als für den Dichter. Der Dichter hat nur das Ausdrucksmittel des Worts und bleibt deswegen stets dem Denken nahe. Alle Anklagen, die von phänomenalistischen Denkern gegen die Sprache erhoben werden, gipfeln in dem Vorwurf, sie biete nur unbrauchbare Werkzeuge, wo es gilt, die letzten Wirklichkeiten zu packen, die Empfindungen. Folgerichtig widerspricht Wortkunst von allem Anfang an den Absichten eines phänomenalistischen Impressionismus. Es wäre nicht paradox, wenn einer behauptete impressionistische Dichtung sei eine unlösbare, mindestens eine durchaus widerspruchsvolle Aufgabe."
[4] Über das Verhältnis von Interpretation und geschichtlicher Forschung spricht sich z.B. Emil Staiger, einer der prominentesten Vertreter dieser Schule, aus in "Das Problem des Stilwandels"Stilwandel (1963) 7-24; zuerst in Euphorion, 55 (1961) 229-241.
[5] Ästhetik (1953) 176.
[6] Christa Wolf übersetzt statt "Jugend" nur "Stunde", was weniger zwingend auf Altersdepression verweist. (Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra. 1983. 146)
[7] "Zu einem Vers von Mörike. Ein Briefwechsel mit Martin Heidegger."Trivium 9 (1951) 1-16; L. Spitzer ebenda, 133-145; auch Ilse Appelbaum-Graham: in Modern Language Notes, LXVIII (1952) 328-334; und Werner von Nordheim in Euphorion L (1956) 71-85.
[8] Eine gute Beschreibung mit Beispielen findet man in Wilfred T. Neills Twentieth-Century Indonesia (New York-London 1973) 381-389.
[9] Übers. von Gerolf Coudenhove in Vollmond und Zikadenklänge (1955) 20.
[10] Vergl. über "Das Dinggedicht. Eine Kunstform bei Mörike, Meyer und Rilke." Kurt Oppert in DVLG IV (1926) 747-783; und über dessen Verwandtschaft mit dem Bildgedicht der Barockdichtung: Hellmut Rosenfeld, Das deutsche Bildgedicht (1935) 208-221.
[11] "Erlebnisdichtung und Symbolismus". DVLG 32 (1958) 71-98, S. 84; auch in Lyrikdiskussion, s.o. (1974) 218-254, S. 234f. - Dort auch aufschlussreiche Beobachtungen über das "lyrische Ich", besonders in der Auffassung der " New Critics“.
[12] Interpretiert in einem Aufsatz von E. P. Müller in Gedichte, Balladen, Songs in der Hauptschule. 1nterpretationen und Analysen (1978) 69-75.
[13] ebenda, 71.
[14] "Georg Trakls Verhältnis zu Rimbaud". GRM, NF 9 (1959) 311; auch in Lyrikdiskussion (1974) 307. 28
[15] vergl. Anm. 12, S. 71.
[16] "Die absolute Dichtung im 19. Jahrhundert“Trivium (1948) 23-52; auch in Lyrikdiskussion (1974) 46-74, S. 63.
[17] ebenda, S. 73.
[18] vergl. Anm. 14.
[19] wie Howald zeigt, ebenda S. 71.
[20] "Bestand und Bewegung in Gedichten Georg Trakls". DIE ZEIT 19 (6. Nov. 1964) 23-25; auch in Lyrikdiskussion (1974) 436-450. - Killy gibt viele Beispiele solcher Variationen und Veränderungen mit neuer Bedeutung.
[21] Experimentelle Literatur und konkrete Poesie (1975) besonders Sn. 11-23.
[22] Vergl. Reinhard Döhl: "Konkrete Literatur ". Deutsche Gegenwartsliteratur (Hg. M. Durzak 1981) 270-298.
[23] Konkrete Dichtung. Texte und Theorien. 1972.
[24] E. P. Müller ebenda (1978) 31 (Anm. 12). - Über das Konzept der "Autoreflexivität des ästhetischen Zeichens" sowie die Auffassung vom "Kunstwerk als einem autonomen Zeichen" in der Sicht der Strukturalisten, besonders Jakobsons und Mukarovskys, vergl. Lothar Fietz: Strukturalismus (1982) 49 ff.
[25] "Linguistische Bemerkungen zur modernen Lyrik ". Akzente 1 (1968) 34.
[26] "Das lyrische Weltbild der Nachkriegsdeutschen". Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden 11 (Hg. C. Arnold 1982) 18 ff.
[27] Die Revolution der modernen Kunst. 1955.
[28] Literaturhinweis bei Heimann: H. Hei6enbüttel / H. Vormweg. Briefwechsel über Literatur. 1969, 64.
[29] "Experimentelle Prosa". Die deutsche Literatur der Gegenwart (Hg. M. Durzak 1971) 230-256. – Heimann führt fort: "Was diese Texte zu reproduzieren versuchen, sind nicht die Inhalte, sondern die Strukturen des Bewusstseins. Inhaltlich sind sie offen. Indem der Bedeutungsträger fehlt, öffnen sie sich multipler Bedeutung und einer gewissen 'Jemeinigkeit' des Lesers, wobei die verschiedenen Sinnfüllungen sich indifferent zueinander verhalten, somit die pluralistische Gesamtstruktur im einzelnen wiederholen und letztlich wiederum inhaltlich eigentlich 'nichts' meinen“.
[30] zitiert nach E. P. Müller aus Helmut Heißenbüttel: Über Literatur (1966) 73.
[31] Über Literatur (1970) 207. - Vergl. auch: S. J. Schmidt: "Konkrete Kunst stellt nichts dar: sie verwirklicht etwas, was es in dieser Form in der Erfahrungswirklichkeit nicht gibt. Und dieses Verwirklichte gibt seine Information nicht von allein ab, es erzählt keine Geschichten: Es impliziert vielmehr allgemeinen Sinn, der vom Rezipienten in geeigneten interpretative Sinngebungen erst aus den Strukturen der Prasentationsmodi erhoben werden muss ". (ebenda, vergl. Anm. 23, S. 143.)
[32] "Meine 50er Jahre". Vom "Kahlschlag" zu „movens". (Hg. Jörg Drews 1980) 37-54, S. 48 f.
[33] "Das Gedicht als Gebrauchsgegenstand". 1960 (bei Schmidt Hg. 1972) 86 (Anm. 23). 29
[34] Vergl. auch Heinz Gappmayr: "Zur Ästhetik der visuellen Poesie ". Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie (Hg. Thomas Kopfermann 1974) 59.
[35] "Schönes, Verständliches, Unverständliches". Text und Kritik: Hans Arp, Heft 92 (Oktober 1986) 97f.
[36] z. B. Harald Hartung (Anm. 21) 39, der seinerseits auf P. Schneider verweist.
[37] zitiert von E.P. Müller (Anm. 12), der selbst bemerkt: "Der konkrete Dichter will mit seinen Produkten unmittelbar an unserer Gesellschaft teilhaben. Dafür scheinen ihm traditionelle poetische Formen nicht geeignet zu sein [...] Der konkrete Dichter hat über die Absicht, gesellschaftliche Strukturen in der Sprache aufzuzeigen und mitzugestalten, hinaus die Absicht, revolutionierend in dieser Gesellschaft zu wirken" (S. 31)
[38] "dichtung und revolution". Text und Kritik, Heft 25 (1970) 36; zitiert von E.P. Milller ebenda S. 31 f.
[39] Anm. 23, S. 141.
[40] Anm. 21, S. 100.
[41] Anm. 12, S. 31.
[42] Das ontologische Schichtenmodell entwickelte umfassend Nicolai Hartmann in Der Aufbau der realen Welt; Grundriss der allgemeinen Kategorienlehre. 1940; für die Künste in Ästhetik. 1953. - Speziell für die Literatur entwirft ein Schichtenmodell Roman Ingarden in Das literarische Kunstwerk. 3. Aufl. 1931; und in Das Erkennen des literarischen Kunstwerkes. 1968. - Eine kurzgefasste Anwendung der beiden Modelle auf die Literatur in meinem Aufsatz "Die Schichtenfolge der Dichtung". Zeitschrift für Ästhetik 19/2 (1974) 1959-1969. - Die russischen Formalisten unterschieden in ihren Analysen hauptsächlich die phonetische, morphologische und syntaktische Ebene in Gedichten, sowie zusätzlich Komposition und Ereignisinhalt in Prosatexten.
[43] Eine solche Synthese der wichtigsten Schichtenmodelle versuchte ich in meinem Buch Typologien und Schichtenlehren (Bern 1978), in welchem, wie aus dem Titel ersichtlich, ich auch die wichtigsten Persönlichkeitstypologien mit dem synthetischen Schichtenmodell zu koordinieren trachtete.
[44] Vergl. meinen Diskussionsbeitrag in Psychologie der Literaturwissenschaft; Ein Kolloquium (1971) 227-230.
[45] S. J. Schmidt, Anm. 23, S. 143.
[46] Die Struktur der modernen Lyrik (1956 ) 11; auch in Lyrikdiskussion (Hg. R. Grimm 1974) 210.
[47] "Die Aporien der konkreten Poesie ". Merkur 309 (1974) 155.
[48] "Das methodologische Erbe des Formalismus ". Literaturwissenschaft und Linguistik 11 (Hg. H. Ihwe 1971)
22. - Vergl. meinen Aufsatz "Das Schichtenverhältnis im Musikkunstwerk". Zeitschrift far Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 24/1 (1979) 5-10.
[49] Lothar Fietz. Strukturalismus (1982) 55.
[50] Erlebnis, Kunstwerk und Wert (1962) 62.
[51] Anm. 30, S. 236.
[52] Material I (1958) nicht zugänglich; zitiert nach Movens (Hg. Franz Mon 1960) 112.
[53] Anm. 23, S. 144. 30
[54] Anm. 12, S. 33.
[55] Vergl. über den Offenheitsbegriff bei den Strukturalisten L. Fietz 1982, Anm. 49.
[56] E. P. Müllers klare Beschreibung der Ergebnisse einer Unterrichtseinheit über konkrete Poesie am Gymnasium wirkt m. E. nicht ermutigend: "Was lernen Hauptschüler bei der Betrachtung konkreter Poesie?", vergl. Anm. 12, S. 31-35.
[57] Aesthetica (1965) 319. - Vergl. auch seine Ausführungen in Theorie der Texte (1962) 143 ff. in dem Kapitel "Über natürliche und künstliche Poesie", wo er allen Ernstes die künstlerische Berechtigung von maschinenproduzierter "Poesie" begründen zu wollen scheint.
[58] H. Heißenbüttel. D'Alemberts Ende. 1970. - F. Mon. herzzero. 1968. - Zu beiden vergl. H. Hartung 1975 (Anm. 21). Vergl. eine Tagebuchnotiz von Franz Mon: "Man muss, den Roman schreiben, der keinen Anfang und kein Ende hat. Der auch keinen leitenden Gedanken hat. Der kein Ganzes ist. Der keine Gestalt hat. Der eine Totalität ist: balancierend montiert aus den zufällig zusammengeschossenen Momenten, deren Gegenteiligkeit die Schwebe hält. Einzig dein Interesse muss dasein". (in: Jörg Drews Hg. 1980, Anm. 32, 51).
[59] Beda Allemann veröffentlichte 1966 eine aufschlussreiche Anthologie der "Texte von Dichtern des 20. Jahrhunderts zur Poetik"(Ars Poetica)
[60] z. B. Harald Hartung in Neue Rundschau 79 (1968) 480-494: "Antigrammatische Poetik und Poesie". – 1975 (Anm. 21, S. 102) stellte er dann fest: "Der Komplex der experimentellen und konkreten Poesie ist historisch geworden, wie zunehmend auch von ihren früheren Verfechtern zugegeben wird. Andererseits ist mit dem Erlahmen des experimentellen Impulses das zugrundeliegende Problem nicht aufgelöst, die Aporien bestehen fort".
[61] "Pop oder die These vom Ende der Kunst". Die deutsche Literatur der Gegenwart (Hg. M. Durzak 1971) 292.
[62] Vergl. die Diskussion und Literaturangaben von Bruno Markwardt in seinem Artikel "Poetik"im Reallexikon III/2 (Merker / Stammler et al Hg. 1966) 148 ff.
[63] Es ist immerhin auffällig, dass der hilflose Betrachter abstrakter-konkreter Kunst zumeist unbewusst die "fehlenden" Schichten zu ergänzen sucht, sobald er nur die geringste Möglichkeit hat, in die Formen eines abstrakten Bildes Abbildliches hineinzusehen. - Und das noch immer nach fast hundertjährigem Bestehen solcher Kunst. - Natürlich verabscheuen die betreffenden Künstler dieses zumeist als "unkünstlerischen" Zwang der Seh-Konvention, bemerken aber nicht, dass es tiefer begründet ist. Nämlich im Bemühen des Betrachters, zum Nachvollzug irgendeines gegebenen anspruchsvollen Bildtitels über die notwendigen Schichten zu gelangen. - Wenn ein Gemälde nur Komposition No. 7 oder auch Montage in Grau und Rosa heißt, versucht der Betrachter gar nicht erst, Gegenständliches zu entdecken. Weltanschaulich und pseudoprofund klingende Titel (z. B. The Human Condition) oder gar konkrete (Waterloo) führen aber bei den meisten Betrachtern unweigerlich zum Versuch, die Mittelschichten auszufüllen, indem sie wenigstens Andeutungen unserer konkreten Welt aufzuspüren suchen. Harald Hartung bemerkt hinsichtlich des Bestrebens, in Literatur außenweltliche Bezüge abzuschneiden: "[...]wird der Bezug der Wörter zur Realität gelbst und das Material autonom gesetzt, so ist damit noch kein Prinzip gegeben, das diese Autonomie rechtfertigt, denn selbst der ästhetische Reiz einer absoluten Wortkombination beruht doch wiederum darauf, wie viel Realität sie evoziert [...] Von der Sprache muss ein Weg zu den Sachen zurückführen, wenn Literatur ihren Anspruch, ein Medium der Erkenntnis zu sein, aufrechterhalten will. Das Vertrauen, neuentstehende sprachliche Strukturen brächten zugleich auch eine Erweiterung der Erfahrung, ist blind zu nennen [...] Der Glaube, man brauche eigentlich bloß die Wörter richtig zu setzen, um die Welt und den Menschen zu verändern, ist so ehrwürdig wie falsch". (in: "Antigrammatische Poetik und Poesie ". Geschichte der deutschen Literatur aus Methoden 11, Hg. H. L. Arnold 1972, 29 1).
- Arbeit zitieren
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Autor:in), 2007, Aufsätze und Vorträge zur Ästhetik, Poetik und Literaturterminologie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83249
Kostenlos Autor werden














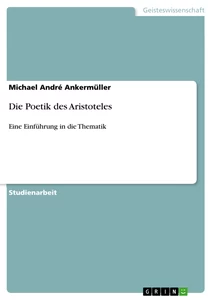





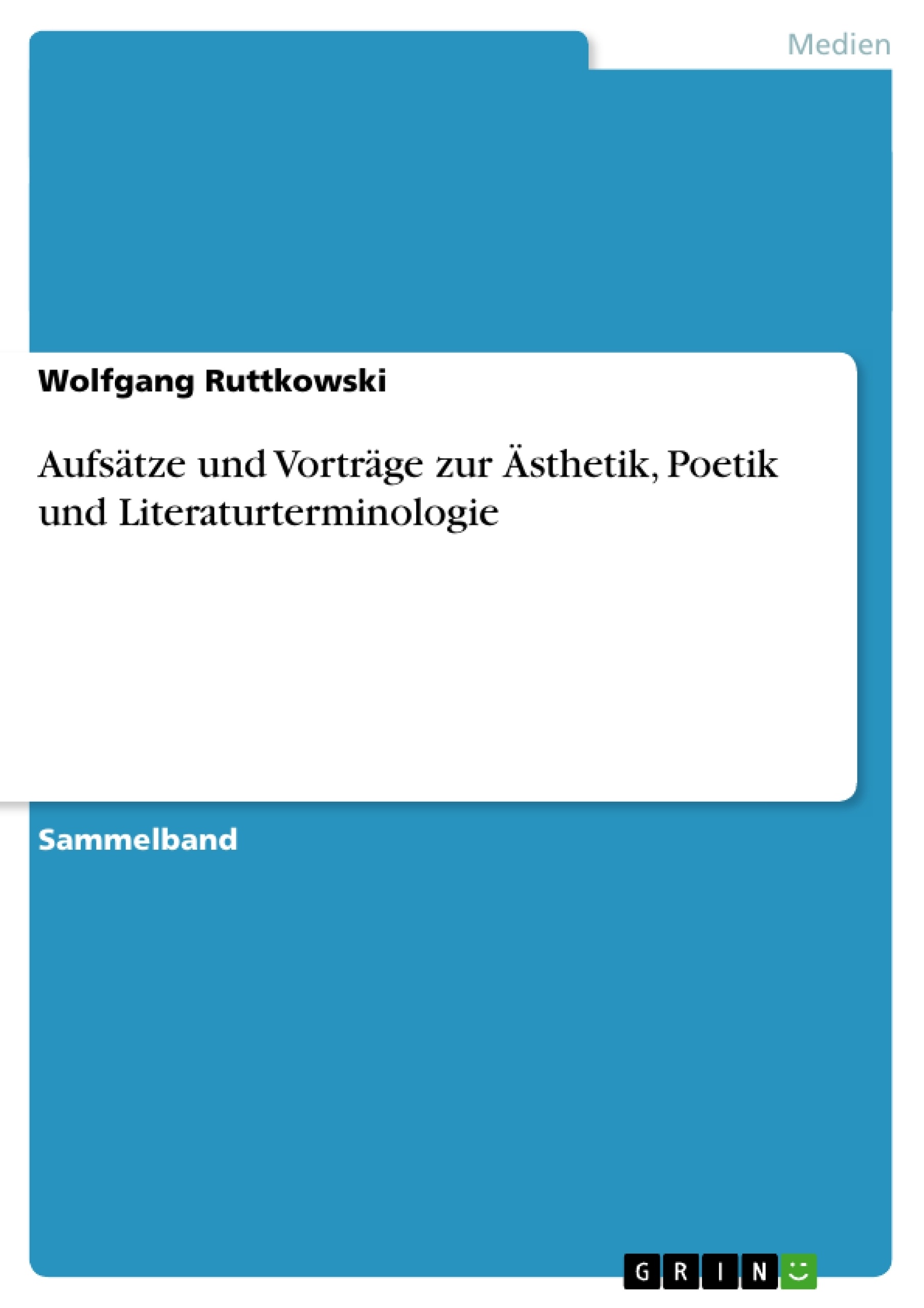

Kommentare