Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
Notationsverzeichnis
Schaubildverzeichnis
Aktualität des Gegenstands
II. Theoretische Grundlagen
1.0 Begründungen für gemeinsames Lernen
1.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse
1.2 Schulversuche
1.3 Ethisch-normative Begründungen
1.4 Gesetzliche Verankerung
2.0 Aktuell expandierende integrative Schulformen in Bayern
2.1 Übersicht
2.1 Aussenklasse
2.2 Öffnung der Förderschulen
2.3 Einzelintegration
3.0 Kooperationsklassen
3.1 Begriffsbestimmung
3.2. Rechtliche Grundlagen
3.3 Pädagogische Zielsetzung
3.4. Kooperationspartner
3.4.1 Lehrpersonal
3.4.2 Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD)
3.5 Organisatorische Rahmenbedingungen
3.6 Normative Voraussetzungen
3.7 Anforderungen an den Unterricht in Kooperationsklassen
3.8 Kriterien zur Auswahl der Kooperationsschüler
3.9 Leistungsfeststellung und –bewertung
3.10. Strukturelle Aspekte
3.10.1 Genehmigung und Einrichtung
3.10.2 Bestimmung der Lerngruppe
III. Praxis
4.0 Darstellung und Analyse der Ergebnisse zur Lehrerbefragung
4.1 Vorbemerkung
4.2. Lehrer, Schüler, Eltern
4.2.1 Beweggründe zur Übernahme einer Kooperationsklasse
4.2.2 Klassengröße
4.2.3 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
4.2.4 Soziale Integration
4.2.5 Unterstützung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch deren Eltern
4.2.6 Einstellung der Schülereltern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
4.3 Organisation
4.3.1 Zeitpunkt des Schulwechsels
4.3.2 Auswahlkriterien für eine Kooperationsklasse
4.3.3 Unterstützung der Lehrer
4.3.4 Förderung durch die MSD
4.4 Lehrplan
4.4.1 Didaktik und Methodik
4.4.2 Zeitliche Aufwendungen
4.5 Leistungserhebung
4.5.1 Curriculare Anschlussfähigkeit
4.5.2 Leistungsüberprüfung
4.6 Bewertung der Integrationsform
4.6.1 Vorzüge des Modells
4.6.2 Persönliche Belastungen
4.6.3 Verbesserungsmöglichkeiten
IV. Perspektive
6.0 Reflexion und Ausblick
V. Anhang
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Notationsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaubildverzeichnis
SB 1: Formen der Integration
SB 2: Rechtliche Grundlagen einer Kooperationsklasse
SB 3: Zusammenarbeit der Beteiligten
SB 4: Aufgabenbereiche der unterrichtlichen Zusammenarbeit
SB 5: Beweggründe, eine Kooperationsklasse zu übernehmen
SB 6: Gründe eine Kooperationsklasse zu übernehmen
SB 7: Durchschnittliche Anzahl der Schüler in Kooperations- klassen mit Maximum und Minimum
SB 8: Häufigkeitsverteilung der Klassenstärken
SB 9: Durchschnittliche Anzahl der Schüler mit sonder- pädagogischem Förderbedarf in einer Kooperationsklasse
SB 10: Schüler mit/ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
SB 11: Förderschwerpunkte
SB 12: Integration der Schüler mit sonderpädagogischem Förder- bedarf in die Klassengemeinschaft
SB 13: Unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit sonder pädagogischem Förderbedarf durch ihre Eltern
SB 14: Gründe für die nicht geleistete Unterstützung im Elternhaus
SB 15: Einstellung der Schülereltern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf zur Integration
SB 16: Vorbehalte der Schülereltern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf zur Integration
SB 17: Wechsel aus den verschiedenen Schularten
SB 18: Gütekriterien, die bei der Auswahl der Schüler eine Rolle spielten
SB 19: Ausreichende Unterstützung bei auftretenden Problemen
SB 20: Kooperationspartner
SB 21: Ausreichende Unterstützung durch die MSD
SB 22: Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung zwischen einer Kooperationsklasse und einer Regelklasse
SB 23: Eingesetzte Methodik und Didaktik
SB 24: Ausreichende Unterrichtszeit
SB 25: Gründe für den Zeitmangel
SB 26: Curriculare Anschlussfähigkeit
SB 27: Unterschiede in der Leistungsüberprüfung im Vergleich zu Regelklassen
SB 28: Genutzter Nachteilsausgleich
SB 29: Vorzüge des Modells der Kooperationsklasse für den Lehrer
SB 30: Vorzüge des Modells der Kooperationsklasse für die Schule
SB 31: Vorzüge des Modells der Kooperationsklasse für die Schüler
SB 32: Vorzüge des Modells der Kooperationsklasse für die Eltern
SB 33: Zusätzliche Belastung durch das Integrationsmodell
SB 34: Belastungsfaktoren
SB 35: Verbesserungsvorschläge
Aktualität des Gegenstands
Die Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Bayern stützt sich auf zwei Säulen. Dazu gehört die ‚stationäre’ Förderung in Förderschulen und die ‚integrative’ Förderung in der allgemeinen Schule. Der integrative Gedanke setzt sich in der Sonderpädagogik immer mehr durch und wird auch bildungspolitisch mit der Förderschule als subsidiäre Einrichtung gefordert. Neben verschiedenen Elementen rückt hier das Modell der Kooperationsklasse immer mehr in den Blickpunkt. Während es im Schuljahr 2003/2004 erst 190 Kooperationsklassen (Schor et al. 2004, S. 5) in Bayern gab, steigerte sich die Zahl im Schuljahr 2006/2007 auf 418 Kooperationsklassen (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2006, S. 2).
Die Notwendigkeit dieser Entwicklung wird im theoretischen Teil der Arbeit anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt. Die Herausbil-dung des Integrationsgedankens im Laufe der Jahre, dazu die Veränderung der Gesetzeslage in Bayern und aktuell expandierende Integrationsformen werden danach beschrieben. Im Schwerpunkt der Arbeit geht es speziell um die Integrationsform ‚Kooperationsklasse’. Nach einer Begriffs-definition wird die pädagogische Zielsetzung geklärt, die ihr, als „Klasse für besondere pädagogische Aufgaben“ (BayEUG Art. 43 Abs. 2 Satz 1), zukommt. Die Gelegenheiten der Zusammenarbeit zwischen Sonderschul-lehrern, Lehrern der allgemeinen Schule und der Mobilen Sonderpäda-gogischen Dienste (MSD) gilt es dann zu erläutern sowie organisatorische Rahmenbedingungen und normative Voraussetzungen darzustellen, die für eine pädagogisch effektive Arbeit unabdingbar sind. Anschließend wird auf die Frage eingegangen, welchen Anforderungen der Unterricht in Koopera-tionsklassen in didaktischer und methodischer Hinsicht genügen muss. Zusätzlich sind die Formen der Leistungserhebung und Leistungsbe-wertung in Kooperationsklassen, unter Berücksichtigung der Möglichkeit des ‚Nachteilsausgleichs’, zu beleuchten. Danach werden die Kriterien zur Schülerauswahl dargestellt. Zum Abschluss der theoretischen Überlegung-en ist es nötig, die strukturellen Aspekte zur Bildung einer Kooperations-klasse zum Ausdruck zu bringen, wie die Genehmigung und Einrichtung von Kooperationsklassen und die Bestimmung der Gruppengröße.
Im Praxisteil gilt es, mittels einer Lehrerbefragung, herauszuarbeiten, inwieweit die alltägliche pädagogische Arbeit in Kooperationsklassen den theoretischen Ansprüchen gerecht wird. Dazu wird die Einschätzung der Befragten anhand von Schaubildern dargestellt und analysiert. Die ver-gleichende Gegenüberstellung zwischen den gewonnenen Daten aus der Schulpraxis und den theoretischen Grundlagen gibt schließlich den Blick auf Möglichkeiten einer weiteren Optimierung frei.
II. Theoretische Grundlagen
1.0 Begründungen für gemeinsames Lernen
1.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse
Ein wesentliches Argument für den gemeinsamen Unterricht von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülern ohne sonderpäda-gogischen Förderbedarf basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass sich dadurch für alle Schüler zahlreiche Vorzüge ergeben. Dabei wird dem integrativen Unterricht vor allem eine entwicklungsfördernde Bedeutung zugeschrieben.
Bei der Ausbildung kognitiver und sozialer Fähigkeiten sind für das Kind zunächst seine Bezugspersonen von Bedeutung. Findet es in dieser Um-gebung nicht genügend Unterstützung und zeigt sich seine Umwelt als anregungsarm, so ist mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu rechnen. Damit „läuft es Gefahr, in der Entwicklung zu retardieren und grundlegende Fähigkeiten wie etwa Rollenübernahme, Ambiguitätstoleranz und Identitätsdarstellung nur unvollständig im Laufe des Lebens zu erwerben. Dies führt zu Behinderungen und Problemen im Lernen und Verhalten“ (Benkmann 1997, S. 337). Insbesondere für solche Kinder ist es wichtig in anderen Umwelten, wie Kindergarten und Schule, die Möglich-keit zu erhalten, ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten auszubauen (vgl. a.a.O., S. 340f). Hierbei konnte eine besondere entwicklungsfördernde Komponente durch Gleichaltrige anhand des Modelllernens nachgewiesen werden: „Anreize in der Welt der gleichaltriger Schulkinder bestehen darin, daß am Modell der anderen gelernt wird“ (a.a.O., S. 337). Sicherlich bietet sich die Gelegenheit dazu auch im Schulleben der Förderschule, der inte-grative Unterricht jedoch verschafft noch weitreicherende Möglichkeiten. So stellt Benkmann die Frage: „Bieten sich im gemeinsamen Unterricht nicht mehr Chancen, den Einfluß weiterentwickelter Schüler für die kog-nitive und sozial-moralische Entwicklung behinderter Kinder zu nutzen und Hilfe und Solidarität der „Stärkeren“ gegenüber „Schwächeren“ zu praktizieren und dabei zu lernen?“ (1998, S. 168f). Die Begründungen für eine gemeinsame Schule gehen allerdings noch über das Modelllernen hinaus. So macht Piaget darauf aufmerksam, dass sich durch den Umgang mit Gleichaltrigen, ebenbürtige Partner entwickeln, die gemeinsame Regeln aushandeln und immer mehr in der Lage sind, selbstbestimmt zu Handeln (vgl. Piaget zit. nach Krämer-Kilic 2000, S. 271). Auch Benkmann zeigt durch die Ideen des sozialen Konstruktivismus auf, wie nicht nur die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern alle Schüler in ihrer Entwicklung vom gemeinsamen Unterricht einen Nutzen ziehen können: „Nicht zuletzt profitieren auch entwickelte Kinder von diesen Prozessen. Wenn sie die Perspektive der „Schwächeren“ verstehen, wird ihre Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme stimuliert, die Ursprung von Selbstreflexion und Kern sozialer Intelligenz ist. Der Erwerb der Fähigkeit zur Koordination der eigenen Perspektive mit der von schwäch-eren Kindern trägt später vielleicht dazu bei, daß weniger soziale Distanz zwischen Erwachsenen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen entsteht“ (Benkmann 1997, S. 341). So weist der Autor als weiteren Aspekt der Entwicklungsförderung auf die Steigerung sozialer Lernprozesse hin. „Die Argumentation gegen eine separate Unterrichtung besagt, daß soziale Lernprozesse, wenn sie sich in sozialen Ernstsituationen zwischen Be-hinderten und Nichtbehinderten vollziehen, viel effektiver sein können als ein soziales Lernen, das in einer Absonderung der Behinderten geschieht“ (Brähler 1991, S. 75f). Nur im gemeinsamen Unterricht machen die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundlegende Erfahrung-en, indem sie Ideen und Anregungen durch leistungsstärkere Schüler erhal-ten. Außerdem können in einer gemeinsamen Schule Vorurteile abgebaut und Fähigkeiten des anderen entdeckt und gefördert werden. Darüber hinaus entstehen eine Vielzahl der Freundschaften von Kindern in der Schule. Bleiben Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hier isoliert unter sich, haben sie kaum Zugang zu der ‚Welt der Anderen’. Fraglich bleibt, ob sich dieser Mangel an Integration im nachschulischen Bereich aufholen lässt. Ergänzend merkt Brähler an, „daß sich der Behin-derte nicht selbst in die Gesellschaft integrieren kann, wenn ihm die An-nahme der Nichtbehinderten versagt bleibt“ (a.a.O., S. 75).
1.2 Schulversuche
In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Wirksamkeit integrativer Konzepte belegt. Da das Modell der Kooperationsklasse nicht in Schulversuchen erprobt wurde, soll das erfolgreiche gemeinsame Lernen an Beispielen mit ähnlicher Grundlage dargestellt werden.
Das lernzielheterogene Integrationsmodell der „Aktion Sonnenschein“ in München von T. Hellbrügge versuchte mit Hilfe von Montessori-Ma-terialien, einen gemeinsamen Zugang zu schaffen, sodass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Ent-wicklung und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam lernen konnten (vgl. Biewer 2001, S. 31f). Neben weiteren Schulversuchen kam man auch hier „zum Ergebnis, daß Unvoreingenommenheit und Natürlichkeit im Miteinander angewachsen sind, daß sich soziale Tugenden wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Annerkennung des anderen gemehrt haben. Ebenso, daß die Unterrichtsgestaltung (…) für alle Schüler förderlich gewesen ist“ (Eberhardt/Schor 1996, S. 23).
Besonders hat das Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München mit dem Schulversuch ‚Integration durch Kooperation’ zur Weiterentwicklung integrativ-kooperativer Maßnahmen im Sinne von Aussenklassen beigetragen. Die Resultate zeigen, dass die Zusammen-arbeit zwischen allgemeiner Schule und der Schule zur individuellen Lebensbewältigung so erfolgreich ist, dass „sich schulische Kooperation innerhalb eines weiteren Versuchsjahres in breitem Umfang, geradezu flächendeckend ausgebreitet hat“ (a.a.O., S. 9).
1.3 Ethisch-normative Begründungen
Schon im Alten Testament steht der Satz „ (…) und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn“ (Genesis, 1,27). Durch diesen Sachverhalt wird jedem Menschen als Geschöpf und Eben-bild Gottes, die gleiche, unantastbare Würde zugesprochen.
Aber erst die Zeit der Aufklärung forderte den Gleichheitsgrundsatz als geltendes Recht ein und erfuhr schließlich im 18. Jahrhundert seine Aner-kennung. „Seit 1789 wurde für Europa das Zusammenleben der Menschen thematisiert. Die Französische Revolution markiert den Aufbruch in eine Zeit, die dem einzelnen Menschen Brüderlichkeit im Zusammenleben mit den anderen Menschen verheißt. (…) Die Verfassungen der Demokratie, ihre Regelungen und Gesetze sind immer gerichtet auf das humane Miteinander der Menschen. Dieses Verständnis impliziert den Abbau von Vorrechten einzelner sozialer Gruppen oder Schichten, die Respektierung der Menschenwürde jedes Einzelnen, die gleichen Rechte für alle Bürger. (…) Demokratie ist kein abgeschlossener Zustand, sondern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein in der Ausbreitung begriffener Prozeß. Wir sind in unserer Gesellschaft immer noch dabei, die Ideale der Revolution zu verwirklichen“ (Muth 1997, S. 22).
Um diese Umsetzung der Demokratie weiter voranzutreiben, wurden Normen und Werte in Gesetzen festgeschrieben. So gilt als höchste Prämisse im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Art. 1 Abs. 1). Mit dieser Verankerung geht die Anerkennung von Menschenrechten einher: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußer-lichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ (a.a.O., Art. 1 Abs. 2). Die im Zusammenhang mit Integration wohl wichtigste Prämisse ist der aus christlichen Wertvorstellungen abgeleitete Gleichheitsgrundsatz, der Dis-kriminierung verbietet. Im Grundgesetz steht: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Art. 3 Abs. 3). „Letztlich ist Demo-kratisierung ein andauernder Integrationsprozeß. Deshalb kann Integration nicht als ein Problem verstanden werden, dessen Für und Wider diskutiert werden sollte, sondern sie ist eine Aufgabe, die den Menschen in einer demokratischen Gesellschaft aufgegeben ist“ (Muth 1997, S. 22).
Auch die UNESCO sprach sich in der Erklärung von Salamanca im Jahr 1994 klar für die schulische Integration aus. Sie fordert, dass die Kinder „mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, aufnehmen sollten" (Art. 2) Dies ist notwendig, „um dis-kriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heißen, um eine integrierende Gesellschaft aufzu-bauen und um Bildung für alle zu erreichen“ (Art. 2). Die Erklärung von Salamanca geht aber noch über den Integrationsbegriff hinaus und proklamiert den neuen Begriff der „Inklusion, lat. inclusio, Einschließung, Einschluss“ (Dudenredaktion 2001, S. 440). Inklusion kann als „verbes-serte, weiterentwickelte, von Fehlformen bereinigte Integration“ (Sander 2002, S. 3) angesehen werden. Sie wird demnach „als Integration aller Schüler/-innen in die allgemeine Schule verstanden und ist in der Konsequenz mit dem Verzicht auf jegliche Form von Etikettierung der Schüler/-innen mit der Auflösung der Sondereinrichtungen und der Sonder-pädagogik verbunden“ (Heimlich 2003, S. 143). Inklusion differenziert Menschen also nicht nach Behinderung und Hochbegabung oder nach Gesundheit und Krankheit. Jeder Mensch nimmt am gesellschaftlichen Le-ben im Rahmen seiner Möglichkeiten teil und bringt seine Fähigkeiten mit ein. „Als Inklusion im pädagogischen Sinne sind deshalb solche Inter-aktionen zu bezeichnen, die zur Bildung von Gemeinschaften im Sinne von Netzwerken zur Unterstützung der selbstbestimmten Teilhabe von Men-schen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen“ (a.a.O., S. 146). Diese Idealvorstellung einer Gesellschaft bedarf allerdings auch optimaler Bedingungen. Wenn es gelingen soll, alle Schüler mit sond-erpädagogischem Förderbedarf in die allgemeine Schule zu integrieren, so würde man undenkbar viele personelle und finanzielle Ressourcen be-nötigen, um jedem Schüler mit seinem individuellen Förderbedarf gerecht werden zu können. Deshalb kann Inklusion gegenwärtig lediglich als „Leitbild einer zukünftigen Integrationsentwicklung“ (a.a.O., S. 142) ge-sehen werden und dazu veranlassen, die Integrationsbemühungen zu erweitern.
1.4 Gesetzliche Verankerung
Eine vertiefte Integrationsdiskussion ergab sich 1994 als die Kultusminis-terkonferenz den Behinderungsbegriff zu Gunsten der Bezeichnung ‚son-derpädagogischer Förderbedarf’ verwarf. In der politischen Umsetzung wurde dies durch die Änderung des bayerischen Schulgesetzes von 2003 relevant. Dort wird „die sonderpädagogische Förderung von Schülern (…) im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Aufgabe aller Schulen“ (Art. 2 Abs. 1 Satz 2) erklärt.
2.0 Aktuell expandierende integrative Schulformen in Bayern
2.1 Übersicht
Dieser Primat der Integration wird in Bayern durch verschiedene Bausteine umgesetzt, die folgendes Schaubild veranschaulicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaubild 1: Formen der Integration
Im Folgenden werden die speziellen Formen der Integration in Bayern knapp referiert.
2.1 Aussenklasse
Die Grundlage zur Bildung von Aussenklassen ist der Art. 30 Abs. 1 des bayerischen Schulgesetzes: „Die Schulen aller Schularten haben zu-sammenzuarbeiten. (…) Die Zusammenarbeit zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen soll im Unterricht und im Schulleben besonders gefördert werden. (Art. 30 Abs. 1). Somit ist „eine Außenklasse (…) entweder eine Klasse einer Förderschule, die räumlich in einem Gebäude einer Volksschule untergebracht ist oder umgekehrt eine Klasse einer Volksschule, die räumlich in einer Förderschule besteht. Die räumliche Zusammenführung von Klassen der Volksschule und der Förderschule unter einem Dach ermöglicht besonders intensive Formen gemeinsamen Unterrichts und gemeinsamen Schullebens“ (KMS IV.9 - 5 O 8200 - 4.482). Eine nähere Bestimmung zur Organisation der Aussenklassen findet sich in der Schulordnung für die Volksschulen zur sonderpäda-gogischen Förderung in Bayern: „Außenklassen sollen jeweils mit einer bestimmten Partnerklasse der Gastschule in möglichst vielen Bereichen des Unterrichts und im Schulleben eng zusammenarbeiten“ (§ 26 Satz 5).
Die Aussenklasse ist, wie bereits bei den Modellversuchen aufgezeigt, eine erfolgreiche Möglichkeit „Integration durch Kooperation“ (Weigl et al. 2004, S. 7) zu verwirklichen. Im Schuljahr 2006/2007 wurden in Bayern insgesamt 125 Außenklassen gebildet (vgl. http://www.km.bayern.de/im peria/md/content/pdf/schulen/foederschule/integration__durch__kooperatio n.pdf, S. 1).
2.2 Öffnung der Förderschulen
Werden Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an Förderschulen unterrichtet, wird der Lernort Förderschule selbst zum Integrationsort. Diese Möglichkeit eröffnet sich durch das bayerische Schulgesetz: „Förder-schulen, in denen auf der Grundlage der Lehrpläne der allgemeinen Schu-len unterrichtet wird, können auch Schülerinnen und Schüler ohne sonder-pädagogischen Förderbedarf unterrichten, sofern die personellen, räum-lichen und organisatorischen Gegebenheiten dies zulassen“ (Art. 20 Abs. 5 Satz 1)
Dieses Integrationsmodell wird z.B. in Schulen zur körperlichen und motorischen Entwicklung umgesetzt. Besonders bekannt sind die erfolg-reichen Schulversuche ‚Öffnung der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Hören’. Diese zeigen auf, „wie erfolgreich das Miteinanderlernen von jungen Menschen mit und ohne Sehschädigung“ (Thienwiebel et al. 2003, S. 5) ist und das der ge-meinsame Unterricht von Schülern „mit und ohne Hörschädigung [gut] ge-lingen kann“ (Hänel et al. 2004, S. 5).
2.3 Einzelintegration
Vereinzelt werden in Bayern Schüler mit sonderpädagogischem Förder-bedarf wohnortnah in der allgemeinen Schule beschult, sofern sie nach Art. 41 Abs. 1 BayEUG „aktiv“ am Unterricht der allgemeinen Schule teil-nehmen können. Besonders häufig wird diese Form der Integration im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung angewandt. (vgl. http://www.km. bayern.de/imperia/md/content/pdf/schulen/foederschule/so_paed_entw.pdf, S.9) Wie viele Schüler sich im Schuljahr 2006/07 in Einzelintegration be-finden war, trotz vieler Bemühungen, nicht möglich zu klären.
3.0 Kooperationsklassen
3.1 Begriffsbestimmung
Kooperation, lat. cooperare, bedeutet die Zusammenarbeit von verschie-denen Partnern (Dudenredaktion 2001, S. 544). So kann die schulische Kooperation im Allgemeinen und insbesondere im Kontext der unter 2.1. genannten Aussenklassen wie folgt definiert werden: Sie meint „gemein-sames Lernen von behinderten und nicht-behinderten Schülern in päda-gogischer Verantwortung ihrer Lehrer und Eltern. Schulische Kooperation umschließt die Bereiche Unterricht, Schulleben und Freizeitgestaltung“ (Eberhardt/Schor 1994, S. 14).
Speziell „in der ‚Kooperationsklasse’ vollzieht sich gemeinsames Lernen zweier Lerngruppen aus allgemein bildender Schule und Förderschule. Im rechtlichen Sinn gilt die Kooperationsklasse als Klasse der Volksschule. In dieser Organisationsform lernen Kinder und Jugendliche in allen Phasen und an allen Lerngegenständen im Klassenverband miteinander. Es handelt sich demnach nicht um ein inhaltlich partikuläres und temporär begrenztes gemeinsames Lerngeschehen“ (Schor 2003, S. 324).
3.2. Rechtliche Grundlagen
Seit 2003 finden Kooperationsklassen ausdrücklich im bayerischen Schulgesetz Erwähnung. Eine genaue Definition der Kooperationsklasse ist im kultusministeriellem Schreiben (KMS) IV 9 - 5 O 8200 - 4.482 fest-gelegt: „Eine Kooperationsklasse ist eine Klasse einer Volksschule, die eine Gruppe von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf-nimmt. Dabei darf der Förderbedarf der einzelnen Schüler weder qualitativ noch quantitativ so hoch sein, dass ausschließlich eine Beschulung in einer Förderschule in Betracht kommt, d.h., die Schüler müssen die Anforder-ungen der Art. 21 Abs. 1 und 41 Abs. 1 BayEUG für die Unterrichtung und Förderung an der Volksschule im Wesentlichen erfüllen. Kooperations-klassen können insbesondere eingerichtet werden, wenn eine Gruppe von Schülern einer Förderschule in die Volksschule zurückgeführt werden soll und ein noch bestehender sonderpädagogischer Förderbedarf mit Unter-stützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste kompensiert werden kann“ (a.a.O., S. 2).
Damit können in diesen Klassen Schüler mit sonderpädagogischem Förder-bedarf und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, auf der Grundlage der Lehrpläne für die Grundsschule und für die Hauptschule, unterrichtet werden. Besonders geeignet ist dabei die gruppenweise Rück-führung, da gewährleistet ist, dass die sozialen Kontakte der Schüler er-halten bleiben und die Förderung durch die MSD in Gruppen ermöglicht wird. So gelingt es, jedem Schüler eine höhere Anzahl an Förderstunden zukommen zu lassen.
Um überhaupt in eine Kooperationsklasse wechseln zu können, müssen die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bestimm-te Voraussetzungen mitbringen. Früher mussten diese Schüler die Lernziele der allgemeinen Schule erreichen können. Seit der Novellierung des bayer-ischen Schulgesetzes genügt statt einer erfolgreichen Teilnahme eine „ak-tive Teilnahme“ (a.a.O., Art. 41 Abs. 1). Dieser Begriff definiert sich im bayerischen Schulgesetz durch folgende vier Parameter:
- Der Schüler muss „überwiegend in der Klassengemeinschaft unterrichtet werden [können]“ (ebd.). Das heißt, es wird vom Schüler gefordert, mehr als die Hälfte der Zeit am Unterricht der Gesamtklasse teilzunehmen. Das gilt auch für die Hauptfächer.
- Eine weitere Prämisse ist, dass er „den verschiedenen Unterrichts-formen der allgemeinen Schule folgen [kann]“ (ebd.). Er darf nicht auf Einzelzuwendung angewiesen sein und er muss mit den methodischen Formen des Unterrichts zurechtzukommen.
- Dabei gilt es für den Schüler „schulische Fortschritte [zu] erzielen“ (ebd.).
- Schließlich ist es nötig, dass der Schüler „gemeinschaftsfähig ist“ (ebd.). Das bedeutet, er muss in der Lage sein, in den üblichen Sozialformen zu lernen. Er darf außerdem Andere nicht beein-trächtigten oder durch sein Verhalten stören. Auch die Klassenstärke darf kein Problem für ihn darstellen.
Der vorhandene sonderpädagogische Förderbedarf muss durch die Unter-stützung der MSD hinreichend gedeckt werden, sollte sich aber „sukzessive verringern“ (KMS IV 9 - 5 O 8200 - 4.482, S. 6). Alles in allem dürfen für die Förderung nicht mehr Lehrerstunden aufgebracht werden, als dem Schüler in der Förderschule zustehen würden (vgl. BayEUG Art. 21 Abs. 3).
Diese rechtlichen Grundlagen einer Kooperationsklasse veranschaulicht Trossbach-Neuner:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaubild 2: Rechtliche Grundlagen einer Kooperationsklasse (2003, S. 221)
3.3 Pädagogische Zielsetzung
Das Modell der Kooperationsklasse bietet einigen Schülern mit sonder-pädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit, integrativ gefördert zu wer-den. Auch für Staatsminister Schneider ist die Kooperationsklasse ein „wichtiger Baustein in der Sonderpädagogik“ (http://www.stmuk. bayern. de/km/schule/schularten/allgemein/foerderschule/kooperationsklassen/).
Zunächst wird eine engere Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den einzelnen Erziehungswissenschaften (allgemeiner Pädagogik und Sonderpädagogik) gefördert. Die Lehrer der einzelnen Schulen haben die Chance voneinander zu lernen, da die wechselseitige Abhängigkeit vertieft und eine gewisse Professionalisierung des Lehrpersonals von allgemeiner Schule und Förderschule erreicht wird. Vor allem der Lehrer der allgemei-nen Schule erhält die Möglichkeit, andere pädagogische und didaktische Hilfestellungen kennenzulernen und evtl. im Schulalltag umzusetzen. Son-derpädagogische Inhalte werden so in der allgemeinen Schule implemen-tiert und auch Schüler ohne sonderpädagogischem Förderbedarf können von diesen gesammelten Erfahrungen und dem Austausch der Lehrer unter-einander profitieren. Dadurch wird die Vielfalt integrativer Förderung ausgebaut, sodass für Schüler ein breiteres Angebot entsteht und jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen angemessen gefördert werden kann (vgl. Schor et al. 2004, S. 4).
Es könnten durch das Errichten von Kooperationsklassen noch weitere Ziele erreicht werden. Zum einen bestehen in unserer Gesellschaft immer noch Vorurteile und Berührungsängste im Umgang mit Menschen mit Behinderung, die mit diesem Modell abgemildert werden können. Es bietet sich die Chance „eine verbesserte gesellschaftliche Integration behinderter Menschen, eine ‚humane Annahme’ durch nichtbehinderte Mitglieder der Gesellschaft [zu erreichen], wobei die gemeinsame Unterrichtung Wissens-defizite abbauen soll“ (Füssel/ Kretschmann 1993, S. 23). Zum anderen erhalten die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch den Besuch einer Kooperationsklasse wieder den Status eines Schülers der allgemeinen Schule, was zu einer Endstigmatisierung führen kann und ihnen die Aussicht bietet, den Hauptschulabschluss zu erwerben.
3.4. Kooperationspartner
Um eine möglichst hohe Qualität der integrativen Beschulung zu gewähr-leisten, müssen die Kompetenzen aller Beteiligten gebündelt werden. Die Grundprämissen einer integrativen Beschulung sind im bayerischen Schul-gesetz folgendermaßen ausgeführt: „Die Schulen aller Schularten haben zusammenzuarbeiten. (…) Die Zusammenarbeit zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen im Unterricht und im Schulleben soll besonders gefördert werden.“ (BayEUG Art. 30 Abs. 1).
Das Schaubild soll die intensive, für eine erfolgreiche Integration unabdingbare, Zusammenarbeit verdeutlichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaubild 3: Zusammenarbeit der Beteiligten (Schor et al. 2004, S. 7)
Zur Genehmigung und Einrichtung einer Kooperationsklasse muss zunächst jeweils, die Schulaufsicht von Förderschule und von allgemeiner Schule zusammenarbeiten. (a.a.O., S. 6) Insbesondere die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die personelle und organisatorische Ausstatt-ung.
Zudem ist eine Zusammenarbeit der Kollegien beider Schularten nötig. Zunächst führen die Lehrer der Förderschule eine Eignungsfeststellung der Schüler durch. Dabei werden Kinder und Jugendliche ausgewählt, die für eine Integration in Kooperationsklassen die besten Voraussetzungen haben. Im Anschluss daran müssen die betroffenen Lehrer der allgemeinen Schule Sorge dafür tragen, dass die übernommenen Schüler auf Dauer eingeglie-dert werden. Die vielfältigen Aufgabenstellungen, die auf den einzelnen Lehrer nun zukommen, lassen sich nur erfolgreich bewältigen, wenn das gesamte Kollegium intensiv und fachkompetent zusammenarbeitet.
Der Beitrag der Förderschule ist mit der Überweisung des Schülers an eine allgemeine Schule noch nicht beendet. „Die alltäglichen Anforderungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld lassen sich seit jeher nur durch die Zu-sammenarbeit verschiedener Professionen bewältigen. Im Zuge der Verän-derung in den Organisationsformen der pädagogischen Behindertenhilfe wächst der Kooperationsdruck gegenwärtig weiter an. In dem Maße, wie die sonderpädagogische Förderung nicht mehr ausschließlich in der Förder-schule stattfindet, ergeben sich neue Formen der Gemeinschaftsarbeit zwischen Förder- bzw. Sonderschullehrer auf der einen und Grundschul- bzw. Sekundarschullehrern auf der anderen Seite“ (Bundschuh et al. 2002, S. 177). In diesem Kontext kommt der Zusammenarbeit zwischen dem Lehrer der Kooperationsklasse und dem Sonderschullehrer, insbesondere über die MSD, eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Das setzt natürlich ein gewisses Maß an Kooperations- und Teamfähigkeit voraus, das oft erst in der Praxis oder durch Fortbildungen erworben werden muss.
Besonders intensiv kooperieren Lehrer, Eltern und Schüler in diesem Kontext miteinander. Das Zusammenwirken von Lehrern und Eltern wird im KMS IV 9 - 5 O 8200 - 4.482 deutlich hervorgehoben: „Vor der Bild-ung von Außen- und Kooperationsklassen sind die betroffenen Erziehungs-berechtigten beider Schulen in geeigneter Weise zu beteiligen“ (S. 7). Der rege Austausch zwischen Eltern und Lehrern soll eine Art Wechselbe-ziehung schaffen, in der die schulische Arbeit im Elternhaus des Schülers zusätzlich unterstützt und gefördert wird, wo aber auch die Anliegen der Eltern in das schulische Lernen positiv mit eingehen können.
Die getroffenen Maßnahmen aller beteiligten Partner sollen für das Wohl des Schülers Sorge tragen, um ihn bestmöglich zu fördern und dauerhaft zu integrieren. Grundlage dafür ist „die wechselseitige Willensbekundung und die verbindliche Zustimmung aller Beteiligten (…). Das gemeinsame Lernen in der Kooperationsklasse gelingt in jenem Maß, wie die Kooper-ation aller Erziehungsverantwortlichen garantiert wird“ (Schor et al. 2004, S. 7).
3.4.1 Lehrpersonal
In diesem Kooperationsverbund sind es neben den Eltern die Lehrer, die direkt an der Erziehung und Entwicklung des Kindes beteiligt sind. Zuerst einmal ist er in besonderem Maße dahingehend gefordert, der Heterogenität seiner Schülerschaft gerecht zu werden. Neben dem sonderpädagogischem Förderbedarf einiger Schüler müssen auch die Bedürfnisse der anderen Schüler erfüllt werden und diese nach ihren Möglichkeiten bestmöglich ge-fördert werden. Beispielsweise gilt es, Schüler auf den Übertritt in das Gymnasium vorzubereiten. Dazu ist ein gewisses Maß an Individuali-sierung unumgänglich, deren Umsetzung im Folgenden beschrieben wird.
- Genaue Diagnostik des Lern- und Entwicklungsstandes,
- Zurücknahme eigener Vorstellungen, um dem Schüler Raum für eigene Entscheidungen zu geben,
- Persönliche intensive Zuwendung zu jedem einzelnen Schüler und Annehmen seiner Störungen und Probleme,
- Zurückhaltung bei der Beratung und Hilfestellung, sodass der Schü-ler seinen eigenen Weg zur Selbsthilfe finden kann,
- Phantasie, Kreativität und Engagement bei der Bereitstellung päda-gogischer und therapeutischer Hilfen (vgl. Stuffer 1989, S. 39).
Die Vielfalt der Anforderungen macht eine externe Unterstützung des Lehrers notwendig. In der Theorie gibt es zwei Modelle, die abhängig vom vorhandenen Stundenkontingent zur Entlastung vorgesehen sind:
- Zwei-Pädagogen-System (sehr selten praktiziert): Beide Lehrer planen den Unterricht gemeinsam und führen ihn arbeitsteilig durch. Durch dieses sog. Team-Teaching kann innere Differenzierung gewährleistet werden und dadurch individuelle Förderung stattfinden (vgl. Bundschuh et al. 2002, S. 178).
- Stütz-Lehrer-System: Der Klassenlehrer wird stundenweise von ein-em im Rahmen der MSD tätigen Sonderpädagogen unterstützt. Der Förderlehrer ist speziell für die individuelle Förderung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuständig (vgl. a.a.O., S. 178).
Eine wünschenswerte Arbeitsweise wird von Wocken sehr treffend beschrieben: „Eine integrative, sonderpädagogische Förderung wahrt die Balance zwischen gemeinsamen und individualisierenden Lernsituationen sowie zwischen unterrichts(mit)gestaltenden und unterrichtsunterstützen-den Funktionen“ (1996, S. 375).
3.4.2 Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD)
In der Regel vollzieht sich die Förderung im Stütz-Lehrer-System über die MSD. Erst durch diese Organisationsform werden eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den Förderorten und eine Erweiterung des integrativen Schulangebots möglich. Es wird „durch ein regionales Verbundsystem (…) einer integrativen Förderung mehr und mehr Vorzug gegeben mit Unterstützung Mobiler Sonderpädagogischer Dienste (…) gegenüber einer speziellen institutionellen Förderung. Angebotsformen sonderpädagogischer Förderung kommen auch zum Kind und nicht nur umgekehrt“ (Schaar 1997, S. 410). Durch sie soll der Forderung verstärkt Rechnung getragen werden, dass „die sonderpädagogische Förderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten (…) Aufgabe aller Schulen [wird]“ (BayEUG Art. 2 Abs. 1 Satz 2).
Der Gedanke der integrativen Förderung findet im bayerischen Schulgesetz seinen Niederschlag, indem die MSD „die Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die nach Maßgabe des Art. 41 eine allgemeine Schule besuchen können“ (a.a.O., Art. 21 Abs. 1 Satz 1), unterstützen. „(…) Mobile Sonderpädagogische Dienste diagnostizieren und fördern die Schülerinnen und Schüler, sie beraten Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, ko-ordinieren sonderpädagogische Förderung und führen Fortbildungen für Lehrkräfte durch“ (a.a.O., Art. 21 Abs. 1 Satz 2). Auf dieser Grundlage kann der Sonderschullehrer den Lehrer in Grundschule und Hauptschule folgendermaßen unterstützen: Nach der Diagnose des sonderpädagogischen Förderbedarfs des Schülers werden entsprechende Fördermaßnahmen eingeleitet. Außerdem haben die MSD die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen individuell zu unterstützen, sie in Kleingruppen durch äußere Differenzierung und durch innere Differenzierung während des Unterrichts zu fördern. Weiterhin kann der Lehrer der allgemeinen Schule durch die MSD Anleitungen und Hilfen zur Förderung von Schülern mit sonder-pädagogischem Förderbedarf, zur Unterrichtsgestaltung sowie zur Um-setzung des Nachteilsausgleichs erhalten. Diese Beratung bezieht sich auf „die Herstellung geeigneter Förderbedingungen für dieses Kind, auf die Befähigung aller Beteiligten, die jeweils angemessenen Lösungen zu finden, auf die Zusammenarbeit der Beteiligten und auf die Chancen des Kindes, sich in der Regelschule zurechtzufinden“ (Reiser zit. nach Schor 2002, S. 85).
Im abgebildeten Schaubild werden die Bereiche der Zusammenarbeit im Unterricht verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaubild 4: Aufgabenbereiche der unterrichtlichen Zusammenarbeit (Schor et al. 2004, S. 33)
Der Förderumfang ist vor der Durchführung der Förderung festzulegen. (vgl. VSO-F §13). Zudem erfolgt diese Förderung durch die MSD nur soweit, wie es „im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel“ (BayEUG Art. 19 Abs. 2 Nr. 3) der Förderschule liegt. Um diese Ressourcen nicht einseitig zu vergeben, ist der Gleichheitsgrundsatz anzuwenden. Er besagt, dass pro Schüler in der allgemeinen Schule nicht mehr Lehrerstunden zur Verfügung gestellt werden können, als es in der Förderschule der Fall wäre (a.a.O., Art. 21 Abs. 3). Außerdem soll sich das Ausmaß der Förderung nach und nach verringern und eine zusätzliche Förderung durch die Volksschule stattfinden (vgl. KMS IV 9 - 5 O 8200 - 4.482, S.6). Es wird folgendes Ziel angestrebt: „Die mobile sonderpädagogische Unterstützung soll in der allgemeinen Schule vor allem ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ leisten. (…) Es gilt das Prinzip: Qualität vor Quantität! Überdies ist mit größter Sensibilität und in pädagogischer Verantwortung zu prüfen und zu ent-scheiden, zu welchem Zeitpunkt der Status der Kooperationsklasse sein Ende findet, denn sie ist ein Modell auf Zeit“ (Schor et al. 2004, S. 34).
3.5 Organisatorische Rahmenbedingungen
Damit das Integrationsmodell erfolgreich sein kann, müssen bestimmte Rahmenbedingungen für eine Kooperationsklasse gegeben sein: Der bayerische Kultusminister Schneider betont besonders das Erfordernis, eine ausreichende Stundenzahl im Bereich der MSD bereitzustellen, um eine Besserung der Rahmenbedingungen zu erreichen (vgl. http://www. stmuk. bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/foerderschule/kooperationsklassen/, S. 3).
Brähler fordert außerdem niedrige Klassenfrequenzen, angemessene räumliche und sächliche, teilweise auch behinderungsspezifische Aus-stattung der Schulen (vgl. 1991, S. 81). Dazu zählt auch, dass genügend Platz im Klassenraum vorhanden sein muss. Günstig ist auch ein separater Gruppenraum, in dem differenzierend gearbeitet werden kann oder der als Rückzugsmöglichkeit dient. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch eine Vielfalt an Förder- und Therapiematerialien zu nennen.
3.6 Normative Voraussetzungen
Grundsätzlich bedarf es der positiven Einstellung und Bereitschaft zur Integration durch die Mitschüler und deren Eltern. Sie ist eine Grundvor-aussetzung für das Gelingen der schulischen Eingliederung. Es ist enorm bedeutsam, dass alle Beteiligten Verständnis und Toleranz gegenüber den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entwickeln. Kooperative Kompetenz ist nach Wachtel/Wittrock gekennzeichnet durch:
- „Achtung der Individualität des Kollegen/der Kollegin (gegenseitige Akzeptanz),
- Annahme der eigenen Schwächen,
- Eine Konfliktfähigkeit, die Konflikte angemessen austragen und ertragen hilft,
- Einfühlungsvermögen in Menschen und Situationen,
- Zuwendungsfähigkeit und –bereitschaft“ (1990, S. 267f).
Beiderseitiges Vertrauen wird durch eine offene Kommunikation und das Zeigen der Wertschätzung der Kompetenz des Anderen gefördert. Es geht um eine offene und ehrliche Atmosphäre, in der beide Lehrer, auf der Basis ihrer jeweiligen Kompetenzen miteinander kooperieren. Dann ist es auch möglich, um Rat zu bitten und Hilfe anzunehmen. „Wenn Lehrer ihre Schwächen und Probleme nicht vertuschen müssen, können sie die Kraft, die solche Verleugnungsprozesse kosten, positiv nutzen und lernen, den Kollegen ohne Angst und mit Toleranz zu begegnen“ (Kreie 1997, S. 236). So ergibt „die Achtung der Individualität des Kollegen sowie die Versöhnung mit den eigenen Schwächen die Basis pädagogischer Professionalität. Denn über die bewusste Auseinandersetzung mit Ein-schränkungen, über die Toleranz und Akzeptanz von nicht aufhebbaren Unterschieden werden integrative Prozesse bei der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in einer Klasse erst ermöglicht“ (ebd.). Ein Lehrer stellte fest: „Es ist schwierig und anstrengend. Aber es ist gut. Ich lerne in der Zusammenarbeit so viel über mich selbst“ (a.a.O., S. 239). Dieses Weiterlernen kann für den Lehrer sehr befriedigend sein, wenn eine Überforderung vermieden wird. „Hierbei ist insbesondere dem Aspekt der Verträglichkeit Rechnung zu tragen. (…) Es ist deshalb beim gemeinsamen Lernen das Prinzip der Freiwilligkeit anzuwenden“ (Schor 2001, S. 116). Auch Brähler betont die freie Entscheidung der Lehrer für die Arbeit in Kooperationsklassen. Sie wünscht sog. Angebotsklassen (vgl. 1991, S. 81). Ein für Lehrer und Schüler produktiver Unterricht und eine gelingende Integration kann nur verwirklicht werden, wenn die Übernahme der Klasse vom Lehrer auf freiwilliger Basis erfolgte.
[...]
- Arbeit zitieren
- Melanie Schöner (Autor:in), 2007, Wie groß sind Reichweite und Wirkung von Kooperationsklassen in Bayern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83230
Kostenlos Autor werden








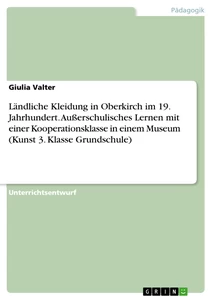





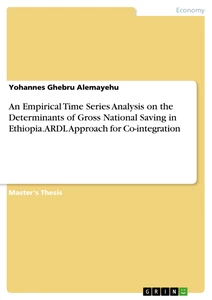





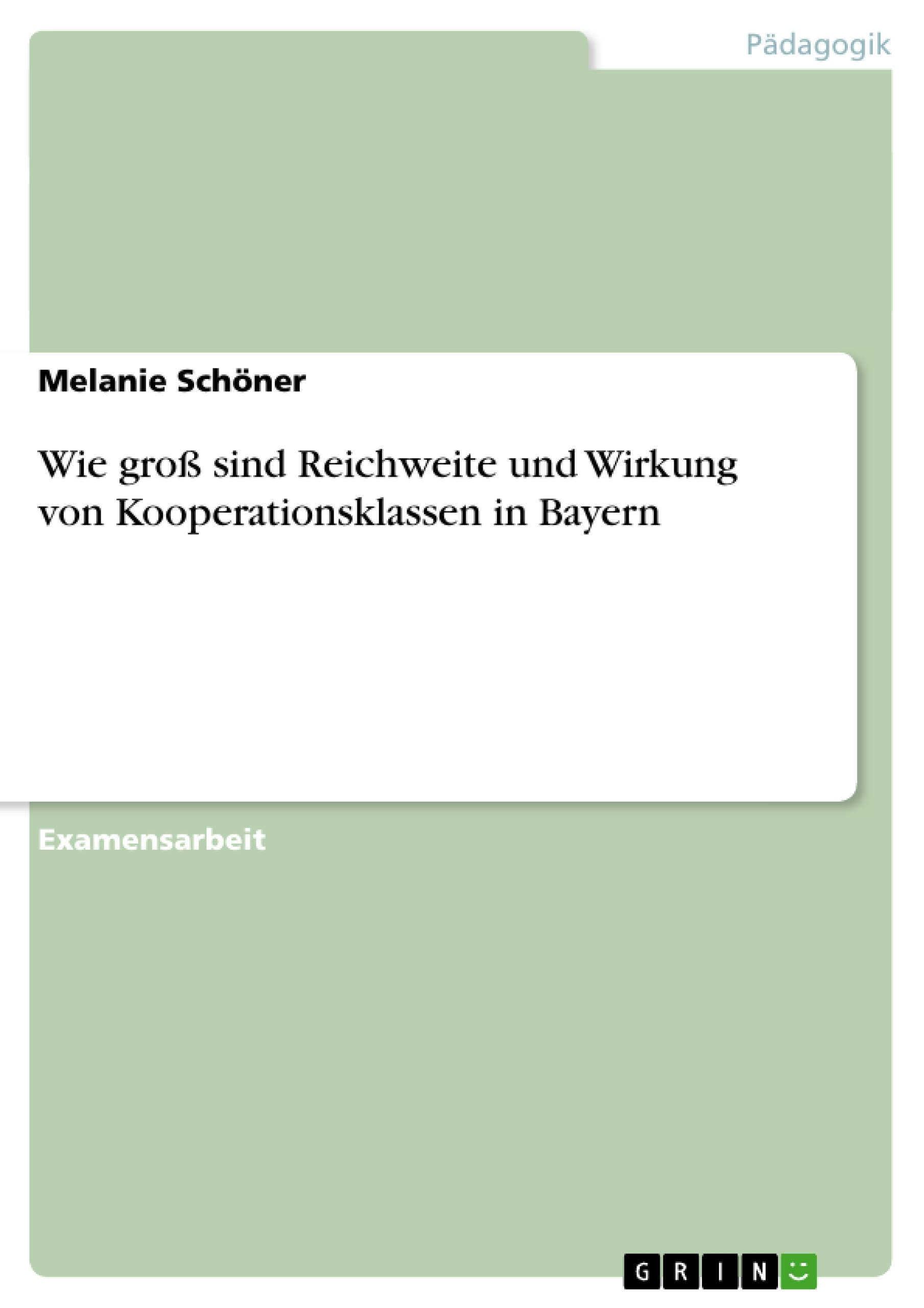

Kommentare