Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Wanderungen in die Bundesrepublik Deutschland
1.1. Aussiedler und Spätaussiedler
1.2. Asylsuchende und Flüchtlinge
1.3. Arbeitsmigranten
1.3.1. Geschichte der Arbeitsmigration nach dem zweiten Weltkrieg
1.3.2. Der politische Rahmen des Aufenthalts in Deutschland
1.3.3. Familienzusammenführung
1.3.4. Folgen und Reaktionen der Zuwanderung
2. Mehrsprachigkeit
2.1. Funktionen der Sprache
2.2. Begriffsbestimmung Mehrsprachigkeit
2.3. Spracherwerbstypen
2.3.1. Erstsprache
2.3.2. Zweitsprache
2.4. Mehrsprachigkeit durch Erst- und Zweitspracherwerb
2.4.1. Der Prozess des Spracherwerbs
2.4.2. Spezifische Phänomene bei Mehrsprachigen: Dominanz und Code-Switching
2.4.3. Der Einfluss der Erstsprache auf folgende Spracherwerbsprozesse
3. Der Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund
4. Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund
4.1. Schüler mit Migrationshintergrund in historischer Perspektive
4.2. Was ist Schulerfolg?
4.3. Schulerfolg von Schülern mit Migrationshintergrund
5. Wirkung außerschulischer Faktoren auf die Bildungschancen
5.1. Die sozio-ökonomische Situation von Familien mit Migrationshintergrund
5.1.1. Stellung auf dem Arbeitsmarkt und Entlohnung
5.1.2. Wohnsituation
5.2. Schichtspezifische Bildungsentscheidungen
5.3. Auswirkung des Migrationshintergrundes auf die Bildungsvorraussetzungen
5.4. Auswirkung der sozialen Herkunft auf die sprachliche Kommunikation
6. Der Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und sprachlichen Bildungsvoraussetzungen bei Kindern mit Migrationshintergrund
7. Die Benachteiligung von Mehrsprachigen durch die Schriftsprache der Bildungsinstitution Schule
7.1. Die zeitliche Investition in den Erwerb der Zweitsprache
7.2. Der Unterschied zwischen der lebensweltlichen Gebrauchssprache und dem Unterrichtsdeutsch
7.3. Lesekompetenz durch schriftsprachliche Sozialisation
7.4. Der Schrifterwerb unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit
7.5. Zusammenfassung
8. Bildungsbenachteiligung durch die Fixierung auf Deutsch als Unterrichtsprache
8.1. Struktur des Bildungssystems als Erklärungsfaktor
8.2. Die Rolle des Lehrers
8.3. Differenzierte Kompetenzen im Deutschen als Bildungsvoraussetzung
8.4. Die monolinguale Orientierung der Unterrichtssprache
8.5. Zusammenfassung
9. Die Sprachkompetenz als Instrument der Selektion im dreigliedrigen Schulsystem
9.1. Einschulung
9.2. Überweisung an eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen
9.3. Übergang in die Sekundarstufe
9.3.1. Benachteiligung mehrsprachiger Schüler durch frühe Selektion
9.3.2. Tendenzen der Zuweisung zu unteren Bildungsabschlüssen
9.3.3. Haupt- oder Gesamtschule als Schulen für Schüler mit geringeren Kompetenzen in der Zweitsprache Deutsch
9.4. Zusammenfassung
10. Fazit
11. Literaturnachweis
Einleitung
Die Zuwanderung verschiedener Bevölkerungsgruppen bereichert die deutsche Schule durch eine sprachliche, soziale und kulturelle Vielfalt. Trotz dieser erfreulichen Heterogenität der Schülerschaft sind nicht alle Schülergruppen gleichberechtigt an den Bildungsabschlüssen in Deutschland beteiligt, wie die PISA-Studie gezeigt hat. Der Schulerfolg in Deutschland hängt primär von der sozialen Herkunft und den sprachlichen Kompetenzen auf dem für den jeweiligen Bildungsgang entsprechenden sprachlichen Niveau (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001:379) ab.
Durch die Kopplung der sozialen Schichtzugehörigkeit und der sprachlichen Kompetenz an den Schulerfolg werden Schüler mit Migrationshintergrund doppelt benachteiligt. Wenn man bedenkt, über welchen Zeitraum Migrantenkinder bereits am Unterricht in Regelschulen teilnehmen, ist es erstaunlich, dass sie statistisch immer noch den geringsten Schulerfolg in Deutschland haben. Dies liegt nicht an der Migration an sich, denn diese haben die Kinder in der Regel nicht selbst vollzogen. Kinder mit Migrationshintergrund sind Nachkommen der Einwanderer, welche zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Zuge der Arbeiteranwerbung ab 1955 in die Bundesrepublik Deutschland kamen.
Der Erwerb der Sprache im Zielland der Migration ist die Voraussetzung zur Teilhabe am öffentlichen Leben in der aufnehmenden Gesellschaft. Lange Zeit hatten die Einwanderer allein die Verantwortung für das Erwerben der deutschen Sprache. Das seit dem 1. Januar 2005 geltende neue Zuwanderungsgesetz zeigt erstmalig einen Perspektivenwechsel, da die Migranten nun nicht mehr allein die Verantwortung für ihre Integration tragen, sondern der Staat ihnen ein einklagbares Recht auf Teilnahme an Integrationskursen zur Vermittlung der deutschen Sprache einräumt. Hierdurch demonstriert der Gesetzgeber das Erlernen der deutschen Sprache als zentrales Ziel der Integrationsmaßnahmen.
Der Spracherwerb der Migrantenkinder ist durch die migrationsspezifischen Lebensumstände geprägt. Innerhalb der Familie wird in der Muttersprache kommuniziert und im Kontakt mit deutschsprachigen Kindern ihrer Umwelt beginnt der Erwerb ihrer Zweitsprache. Das bedeutet, dass diese Kinder in der Regel mehrsprachig in das deutsche Schulsystem eintreten.
Der Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Schulerfolg wird in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Kompetenz in mehreren Sprachen grundsätzlich als positiv zu betrachten ist. Der statistisch belegte schlechtere Schulerfolg von Migrantenkindern wirft aber die Frage auf, welche Faktoren zu dieser Benachteiligung führen. Die Migration an sich kann nicht dafür verantwortlich sein. Es muss sich aber um Faktoren handeln, die spezifisch für diese Schülergruppe sind.
Als entscheidend für den geringen Bildungserfolg von Migrantenkindern werden deren sozio-kulturellen Lebensumstände und die migrationsspezifischen sprachlichen Fähigkeiten gesehen. Sprache ist ein umfassendes Phänomen und deshalb hängt der erfolgreiche Erwerb einer Sprache von vielen Faktoren ab. Es gilt mittlerweile als gesichert, dass der geringe Schulerfolg von Migrantenkindern nicht an deren mangelnden mündlichen Kommunikationsfähigkeiten in der Umgangssprache liegt. Vielmehr werden sie durch die in der Schule zunehmend verwendete Fachsprache benachteiligt.
Diese Arbeit beantwortet die Frage, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem schlechten Schulerfolg der Kinder mit Migrationshintergrund und deren Mehrsprachigkeit. Außerdem wird die Frage beantwortet, warum Migrantenkinder gerade im deutschen Schulsystem diesen geringen Schulerfolg haben. Es wird gezeigt, welche Faktoren schon vor Schulbeginn dazu führen, dass diese Schülergruppe schlechtere Bildungsvoraussetzungen hat. Was unterscheidet das soziale Umfeld dieser Schülergruppe auf die Weise, dass ihnen wichtige Voraussetzungen für den Bildungserfolg fehlen? Weiterhin wird erklärt, warum Migrantenkinder auch mit guten mündlichen Deutschkenntnissen eher untere Bildungsabschlüsse erzielen. Es wird gezeigt, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Mehrsprachige ihre sprachlichen Kompetenzen in der Schule nicht gewinnbringend nutzen können.
Während meiner Berufstätigkeit arbeitete ich in einer Kindertagesstätte, die in einem sozialen Brennpunkt liegt. Die Gruppe, in der ich beschäftigt war, wurde von neun türkischen Jungen und Mädchen und zwei marokkanische Mädchen besucht.
Die Schüler besuchten die Tagesstätte meist nach der Schule, so dass die Unterstützung bei den Hausaufgaben und gelegentlich auch das Üben vor Klassenarbeiten zu meinen Tätigkeiten gehörte. Von den elf Kindern sind acht in Deutschland geboren. Sie weisen eine gute mündliche Sprachkompetenz auf.
In sprachlicher Hinsicht fiel mir auf, dass die Schüler die Hausaufgaben zufrieden stellend erledigten, wenn die Aufgabenstellung mit ihnen besprochen wurde. Wenn sie die Aufgaben selbständig bearbeiten sollten geschah dies inhaltlich und methodisch oft sehr fehlerhaft. Ähnliches war auch beim Üben für Klassenarbeiten zu beobachten, denn obwohl die Kinder die Übungen in der Tagesstätte zufrieden stellend ausführten, wurden ihre Klassenarbeiten oft mit ausreichend oder schlechter beurteilt. Bei der Durchsicht der Arbeitshefte fiel uns auf, dass die Kinder auch die am Tag zuvor beherrschten Aufgaben falsch oder nicht, wie in der Aufgabenstellung beschrieben, ausgeführt hatten.
Die notwendige Methode war ihnen anscheinend klar, doch die betroffenen Schüler konnten die gelesenen Aufgabenstellungen nicht verstehen. Dies betraf sowohl die Kinder mit schlechteren, als auch die mit guten Deutschkenntnissen. Der gute mündliche Sprachgebrauch schien sich nicht mit den Anforderungen der Schule zu decken. Nach dem vierten Schuljahr erhielten die Kinder, trotz guter mündlicher Deutschkenntnisse, oft nur eine Empfehlung für die Hauptschule. Das traf auch für Schüler zu, bei denen meine Kollegen und ich kognitiv und sprachlich keine Probleme für eine höhere Schullaufbahn gesehen haben. Die Frage nach den Gründen für die Zuweisung zu unteren Bildungsabschlüssen hat mich schon zu Zeiten meiner Berufstätigkeit sehr beschäftigt.
Um diese Frage zu beantworten, werde ich methodisch folgendermaßen vorgehen:
Im ersten Kapitel wird das Wanderungsgeschehen in die Bundesrepublik Deutschland dargestellt. Die Migration der Eltern oder Großeltern der Schüler mit Migrationshintergrund war von finanziellen Überlegungen motiviert. Das Zusammenkommen mehrerer Faktoren führte zur Verfestigung des zunächst zeitlich begrenzten Aufenthalts. Die Darstellung der Wanderungen ist für diese Arbeit deshalb relevant, da die Lebensumstände der Gastarbeiter sich auf die aktuelle Lebenssituation der Schüler mit Migrationshintergrund auswirken, wie in Kapitel 5 gezeigt wird.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Funktion der Sprache. Sprachen können durch verschiedene Prozesse erworben werden. Die Formen der Erwerbsprozesse werden in diesem Kapitel erklärt, wobei in diesem Zusammenhang auch auf die Terminologien aus dem sprachwissenschaftlichen Bereich eingegangen wird.
Im darauffolgenden Kapitel werden die Spracherwerbsprozesse von Migrantenkindern dargestellt, denn der Migrationsprozess wirkt sich spezifisch auf den Spracherwerb aus. Kinder mit Migrationshintergrund kommunizieren in ihrer häuslichen Umwelt in der Regel in ihrer Familiensprache. Durch den Kontakt mit ihrer Umwelt erwerben sie Deutsch als Zweitsprache. Welche Wirkung die vollzogene Wanderung der Eltern und Großeltern auf den Spracherwerbsprozess der Migrantenkinder hat, wird in Kapitel 3 gezeigt.
Im Anschluss daran wird die Teilnahme der Schüler mit Migrationshintergrund aus historischer Perspektive dargelegt. Lange wurde diese Schülergruppe als randständiges Problem erachtet. Erst in den 90er Jahren wurden erste empirische Untersuchungen zum Schulerfolg von Kindern mit Migrationshintergrund durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien wiesen auf die enorme Überrepräsentanz der Migrantenkinder an unteren Bildungsgängen hin. Auf die Ergebnisse dieser Studien reagierte die Bildungspolitik mit einer Doppelstrategie. Einerseits sollten die Schüler möglichst schnell am Unterricht in der Regelschule teilnehmen, andererseits sollte ihre Rückkehrfähigkeit durch die Förderung der Familiensprache erhalten bleiben. Verschiedene Maßnahmen wurden zur Aufhebung dieser Differenz durchgeführt, aber die aktuelle Statistik zeigt eine gleich bleibende Diskrepanz zwischen den Schulabschlüssen von deutschen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund.
Die Untersuchungen im fünften Kapitel gelten der Frage, welche außerschulischen Aspekte sich auf die geringen Bildungschancen auswirken. Schüler mit Migrationshintergrund weisen eine charakteristische Lebenssituation auf. Welche unterschiedlichen Kompetenzen die soziale Herkunft bereithält, wird deshalb erläutert, da vor allem die sprachliche Prägung stark von der sozialen Schichtzugehörigkeit abhängig ist. Deshalb wird im sechsten Kapitel erörtert, wie sich die migrationsspezifischen Lebensumstände auf die Bildungsvoraussetzungen der Schüler auswirkt.
Das siebte Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, weshalb Migrantenkinder, trotz einer guten mündlichen Sprachkompetenz geringe Bildungschancen haben. Von grundlegender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Konzept der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Auf der Grundlage dieser verschiedenen Versprachlichungsstrategien werden die wesentlich längere Lernzeit von mehreren Sprachen und die schriftsprachliche Situation in den Elternhäusern von Kindern mit Migrationshintergrund untersucht.
Daran schließt sich der Inhalt des achten Kapitels an, da es sich mit der Fixierung auf die deutsche Sprache als Unterrichtsmedium und Inhalt auseinandersetzt. Die Unterrichtssprache orientiert sich nicht an der sprachlichen Heterogenität im Klassenzimmer, sondern ähnelt eher einer Fachsprache. Für mehrsprachige Schüler wird das auf unterschiedliche Weise zum Problem. Diese werden ausführlich dargelegt.
Die drei relevanten Entscheidungsstellen der Schullaufbahn eines Kindes werden im letzten Kapitel dargestellt. Es wird gezeigt, dass die mehrsprachigen Kompetenzen als wichtigstes Kriterium bei der Zuweisung zu anderen Schulformen dienen. Schüler mit Migrationshintergrund sind aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit an allen Entscheidungsstellen einer erhöhten Aussonderungsgefahr ausgesetzt. Der Übergang in die Sekundarschulform wird besonders intensiv bearbeitet, da er die wichtigste Schwelle in der Schullaufbahn jedes Schülers darstellt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich aufgrund der Lesbarkeit dieser Arbeit auf die Benennung beider Geschlechter größtenteils verzichte, jedoch auch Schülerinnen, Lehrerinnen und Migrantinnen meine, wenn ich von Schülern, Lehrern und Migranten schreibe.
1. Wanderungen in die Bundesrepublik Deutschland
Mit der Bezeichnung `Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund` ist die Gruppe der Schüler gemeint, die bereits in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben. Ihre Eltern oder Großeltern sind infolge der Arbeitsmigration nach 1950 in Deutschland eingewandert. Der Begriff Migration stammt vom lateinischen Wort "migratio" = (Aus)-Wanderung. Menschen, die durch Wanderung über Ländergrenzen hinweg ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt verändern, werden deshalb folgerichtig als Migranten bezeichnet.
Diese Wanderungen stellen kein neues Phänomen dar, denn es hat sie auch lange vor dem zweiten Weltkrieg gegeben. Schon vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland fand Arbeitsmigration nach Deutschland in großem Umfang statt, denn ab 1900 wuchs in Deutschland der Bedarf an Arbeitskräften stark an. Zum Ende des 19. Jahrhunderts zog die Schwerindustrie im Rhein-Ruhr-Gebiet vorwiegend Arbeitsmigranten aus Osteuropa an. Verstärkt wurde diese Wanderung von der zunehmenden Armut im Osten Europas, so dass über 1,2 Millionen „ausländische Wanderarbeiter“ kurz vor dem 1. Weltkrieg in Deutschland beschäftigt waren.
Deutschland ist nicht erst durch die im Folgenden explizit dargestellte Form der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte zum Einwanderungsland geworden, sondern war es schon viele Jahre vorher. Die Flucht vor Kriegen und Verfolgung, Vertreibung, wirtschaftliche Verhältnisse oder Bedrohung durch Umweltkatastrophen sind nur einige der vielfältigen Gründe für Migration.
Ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist Deutschland zum wichtigsten Ziel von Migrationsbewegungen in Europa geworden. Wie ich später noch darlegen werde, wurde die politische und gesellschaftliche Begegnung mit der Migrationswirklichkeit lange Zeit durch Ignoranz gekennzeichnet. Seit 1989 wanderten jährlich über 1 Millionen Menschen in Deutschland ein. Erst nach 1995 ist die Zahl der jährlichen Zuwanderer wieder unter 1 Million gesunken (vgl. Beger 2000:41).
Phänomene von Migration können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Eine einheitliche Definition für diese Wanderungen ist schwierig, da sie aus verschiedenen Gründen und Interessen vollzogen werden. In der Fachliteratur wird zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Wanderung, Schubkraft und Anziehungsfaktoren oder Flucht und Vertreibung unterschieden. Im folgenden Kapitel werden die drei großen Wanderungsgruppen der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt, denn „die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist seit ihrer Gründung im Jahr 1949 intensiv mit Wanderungsbewegungen verknüpft.“ (Mecheril 2004:28)
1.1. Aussiedler und Spätaussiedler
Die größte Zuwanderungsgruppe der BRD sind die Nachkommen der deutschen Siedler aus geschlossenen Siedlungen der Sowjetunion. Mit dem Begriff Aussiedler wird die Gruppe von Wanderern bezeichnet, die politisch als zurückgekehrte Deutsche gelten.
Migranten dieser Wanderungsgruppe gelten als „deutsche Volkszugehörige“ (Mecheril 2004:29), weil es sich um Nachkommen von deutschen Siedlern handelt, die in geschlossenen Siedlungen der ehemaligen Sowjetunion bzw ihren Nachfolgestaaten, Polen und Rumänien lebten. Denn „bis zur Umstellung des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts im Jahr 2000 galt als Deutscher, wer von Deutschen abstammte“ (Mecheril 2003:29).
Insgesamt wanderten zwischen 1950 und 1998 etwa 3,8 Millionen Aussiedler in die Bundesrepublik ein. Verschiedene Maßnahmen regulierten und drosselten diese Zuwanderung ab 1990, bis hin zur Schließung der Zuwanderungsgruppe Aussiedler und Einführung der Statusgruppe Spätaussiedler (vgl. Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration 2004:100).
Auf der Grundlage ihrer rechtlichen Anerkennung als Deutsche standen ihnen entsprechende staatliche Leistungen, wie beispielsweise umfangreiche Integrationsmaßnahmen, zu. Die Eingliederung dieser, als Deutsche geltenden Einwanderer, wurde als „mustergültig“ (Sechster Familienbericht 2000:59) beschrieben, denn als anerkannte Deutsche konnten sie unmittelbar nach ihrer Einwanderung am sozialen und öffentlichen Leben teilnehmen.
Im Bezug auf die sprachlichen Kompetenzen der Spätaussiedler zeigen Maas und Mehlem (2003) eine widersprüchliche Situation auf. Den Deutschkenntnissen wird seit 1997 eine besondere Bedeutung, als generelles Kriterium der Anerkennung der Spätaussiedlerschaft, beigemessen. Der Bedarf an Sprachfördermaßnahmen wuchs in der Zuwandererbevölkerung entsprechend an. Gleichzeitig haben die staatlichen Sprachfördermaßmahmen deutlich nachgelassen, so dass die bereits in Deutschland lebende jüngere Generation nur geringere Deutschkenntnisse aufweist (vgl. Sachverständigenrat für Zuwanderung und Migration 2004:102). Dadurch sind die Kinder Aussiedler/Spätaussiedler sprachlich vor ähnliche Probleme gestellt, wie die Kinder der anderen Migrantengruppen.
1.2. Asylsuchende und Flüchtlinge
Flucht ist ein weiterer Grund, welcher Menschen zur Migration bewegt. Als Flüchtling wird laut der Genfer Konvention von 1951 derjenige bezeichnet, der sich aus Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder politischen Überzeugung außerhalb der Grenzen seines Landes befindet. Diese Definition von Flucht hat allerdings ihre Grenzen, da die Ursachen für die Flucht vielschichtig sind.
Der Grund für eine Flucht in die Bundesrepublik Deutschland ist vor allem in deren demographischer Lage als Schnittstelle zwischen Ost und West zu sehen. Aber auch ihre wirtschaftliche Lage hat eine enorme Anziehungskraft, denn entscheidend für das Leben von Flüchtlingen ist die gesetzliche und politische Lage des Landes, in welches sie fliehen.
Das Asylrecht hat in der BRD einen besonderen Stellenwert (vgl. Beger 2000:31), denn es galt lange Zeit als Bestandteil der politischen Identität Deutschlands. Trotzdem wurde die Zuwanderung von Flüchtlingen durch Visumsbeschränkungen und Arbeitsverbote reglementiert.
Mit der Neuregelung des Zuwanderungsrechts, welches am 1.1.2005 in Kraft getreten ist, wurde das bis dato geltende Recht abgelöst. Die Zahl der Aufenthaltstitel hat sich auf „die unbefristete Niederlassungserlaubnis und die befristete Aufenthaltserlaubnis“ (vgl. Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 2005:1) reduziert. Je nach Zweck des Aufenthalts gibt es aber zahlreiche Unterschiede in der rechtlichen Stellung der Betroffenen. Anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten nach drei Jahren einen befristeten Aufenthaltstitel in Form einer Aufenthaltserlaubnis, der zur Erwerbstätigkeit berechtigt. Angehörige und Kinder dieser Zuwanderungsgruppen erhalten einen anerkannten Flüchtlingsstatus. Grundsätzlich soll mit der neuen Regelung (vgl. ebd. 2005:5) und der verstärkten Erteilung eines rechtmäßigen Aufenthaltes die Rechtssicherheit und die Integrationschance der Betreffenden verbessert werden.
Nach dem neuen Zuwanderungsrecht wird nur demjenigen eine Niederlassungserlaubnis erteilt, der seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt. Diese liegen vor, wenn ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde oder die erforderlichen Kenntnisse anderweitig nachgewiesen werden (vgl. ebd. 2005:6). Erstmals sieht das neue Recht einen Rechtsanspruch auf einen Integrationskurs der Zuwanderer vor. Diese Kurse bestehen aus der Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen und Grundkenntnissen der deutschen Rechtsordnung, Kultur und Geschichte. Verfügt ein Neuzugewanderter nicht über einfache mündliche Sprachkenntnisse und möchte die einen Aufenthaltstitel erhalten, so kann er zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet werden.
1.3. Arbeitsmigranten
Die Gruppe der Zuwanderer, die im Mittelpunkt der Betrachtung dieser Arbeit stehen, sind die Arbeitsmigranten. Unter dieser Bezeichnung werden meist männliche Migranten verstanden, die zum Erreichen eines gesteckten finanziellen Sparziels ihre Erwerbstätigkeit in ein anderes Land verlegen. Welchen geschichtlichen, politischen und somit rechtlichen Hintergrund diese Familien haben, wird in diesem Kapitel dargestellt.
1.3.1. Geschichte der Arbeitsmigration nach dem zweiten Weltkrieg
Seit Mitte der 1950er Jahre wurde in Deutschland die Zuwanderung von Gastarbeitern initiiert, da in einigen westdeutschen Branchen die Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden konnten. Arbeitsmigration tritt immer dann auf, wenn die expandierende Industrie mehr Arbeitskräfte fordert, als durch Bevölkerungszuwachs oder Wanderung im eigenen Land zur Verfügung stehen. Das schnelle Wachsen der industriellen Zweige, wie z.B. der Metallverarbeitenden Industrie im Ruhrgebiet, erhöhte den Bedarf an billigen Arbeitskräften.
Als Folge der unausgewogenen Altersstruktur der Bevölkerung, der Kriegstoten und –verletzten und der erhöhten Sozialleistungen, wie Arbeitszeitverkürzungen, Vorverlegung des Rentenalters und die Verlängerung der Schulpflicht, war das Arbeitskräftepotential Mitte der 1950er Jahre nahezu erschöpft (vgl. Meinhardt 2006:35). Da Arbeitsmigranten für die Arbeitgeber eine flexibel einsetzbare Arbeitskraft darstellten, schloss die Bundesanstalt für Arbeit 1955 den ersten Anwerbevertrag mit Italien ab.
„Dem ersten Anwerbevertrag mit Italien folgten 1960 Verträge mit Spanien und Griechenland, 1961 mit der Türkei, 1965 mit Tunesien und Marokko und schließlich 1968 mit Jugoslawien“ (Mecheril 2004:32).
Die Arbeitskräfte wanderten nach Deutschland ein, da sie durch ihre Arbeit in möglichst kurzer Zeit eine gesetzte Geldmenge verdienen wollten. Der Aufenthalt im Gastland war deshalb für die meist männlichen Migranten zunächst eine vorübergehende Lösung, um ein höheres Einkommen, als das im Herkunftsland erzielbare, zu erreichen.
Die Migranten wurden stark kontrolliert - eine dauerhafte Einwanderung war auch von Seiten der Bundesregierung nicht erwünscht. Organisatorisch wurde die Anwerbekampagne von 260 Mitarbeitern der Anwerbebüros übernommen, die nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit täglich bis zu 1600 Ausländer anwarben. Die Anwerbepauschale betrug 165 DM pro Kopf. Die Werbung wurde durch Filme, Plakate und Broschüren in den Anwerbeländern durchgeführt.
Der Zweck dieser geförderten Zuwanderung bestand ausschließlich in der Überbrückung temporärer und konjunktureller Engpässe auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb gingen alle Beteiligten davon aus, dass die einsetzende Arbeitsmigration nur ein vorübergehendes Problem sei (vgl. Meinhardt 2006:35). Diese Auffassung schien sich zunächst zu bestätigen, da durch die erste wirtschaftliche Rezession 1966/67 die Anzahl der Ausländer in der BRD um rund 400 000 abnahm. Im darauf folgenden Jahr 1967 war die Rezession überwunden und die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer erreichte 1973 die Menge von 2,6 Millionen Menschen.
Die Arbeitsmigranten arbeiteten in allen Industriezweigen, oft auf gering qualifizierten Arbeitsplätzen, die in hohem Maße vorhanden waren. Zumeist waren sie in Fertigungsberufen mit unattraktiven Arbeitszeiten und schweren monotonen Tätigkeiten, beispielsweise am Fließband, beschäftigt (vgl. Bouras 2006:36). Dies heißt jedoch nicht, dass sie über keine Qualifikationen verfügten. Sie hatten oft andere Berufe, für die sie aber nicht nach Deutschland geholt worden wären. Daneben gab es aber immer auch Arbeitsmigranten mit hohen Qualifikationen, die nach Deutschland kamen, um ihren Beruf in der Bundesrepublik auszuüben.
Das Ende der Expansion der Ausländerbeschäftigung war mit dem Öl-Embargo und der weltweiten Wirtschaftskrise 1973 erreicht. Deshalb erließ die Bundesregierung am 27. November 1973 den so genannten Anwerbestopp. Zunächst führte das zur Verringerung der nicht-deutschen Beschäftigten. Allerdings wuchs aufgrund des Familienzuzugs die Zahl der ausländischen Bevölkerung in der Folgezeit stetig an.
1.3.2. Der politische Rahmen des Aufenthalts in Deutschland
In der Regel erhielten die Arbeitskräfte eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung, die die Engpässe auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt bekämpfen sollte. Durch die Befristung wurden politisch zwei Ziele verfolgt. Der ständigen Niederlassung der Arbeitsmigranten sollte vorgebeugt werden und die Befristung ermöglichte den Austausch von verbrauchten Arbeitskräften durch unverbrauchte. In der Praxis stieß dieses Modell allerdings auf Probleme. Einerseits konnten die Gastarbeiter die selbst gesteckten Sparziele nicht innerhalb eines Jahres erreichen und zum anderen brachte die Rotation innerhalb der Belegschaft Nachteile im Produktionsablauf. Deshalb erließ die Bundesregierung 1971 eine Erleichterung in der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, die zur Verfestigung der Niederlassung führte.
Die Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitserlaubnis waren voneinander abhängig. Da die Einwanderung vor allem von der Deckung des wirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs motiviert war, erhielten nur “gesunde“ Arbeitsgäste eine Arbeitserlaubnis. Der politische Rahmen sah für die Gastarbeiter weder Bildungs- noch integrative Angebote, wie beispielsweise Deutschkurse, vor. Folglich mussten sich die eingewanderten Arbeitskräfte den Erwerb der deutschen Sprache selbständig und auf eigene Kosten finanzieren. Mecheril beschreibt diese Praxis so: „Konsequenterweise waren für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen keine Bildungs- aber auch keine psychosozialen Angebote vorgesehen. Wichtig war, dass sie arbeitsfähig waren“ (Mecheril 2004:35).
Rund 14 Millionen Ausländer waren seit 1955 nach Deutschland gekommen, davon waren ca. 11 Millionen wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Trotzdem stellt der Anwerbestopp, so paradox es sich anhören mag, den Beginn der faktischen Einwanderung nach Deutschland dar. Durch den Familiennachzug stieg die Zahl der Menschen aus anderen Herkunftsländern ab 1976/77 kontinuierlich an.
Im typischen Wanderungsmuster wanderten zunächst Einzelpersonen mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme in die Bundesrepublik ein. Mit Verfestigung des Aufenthalts wurden dann Familienangehörige nachgeholt. Beger betont, dass diese Form der Migration „in vielen Zielländern quantitativ am bedeutendsten ist und in Zukunft noch zunehmen dürfte“ (Beger 2004:39).
1.3.3. Familienzusammenführung
Der Nachzug ausländischer Familienangehöriger steht unter dem grundgesetzlichen Schutz von Ehe und Familie. Die rechtliche Grundlage dazu bilden für in der Bundesrepublik Deutschland lebende Personen folgende Artikel: Art.6 Abs. 1 des Grundgesetzes (Schutz von Ehe und Familie), Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Schutz von Privat- und Familienleben) und das Ausländergesetz in §§ 17-23 (vgl. Beder 2000:39).
Die derzeitigen Regelungen zum Familiennachzug im Ausländergesetz gehen allerdings von einem sehr engen Familienbegriff aus und setzen zahlreiche Bedingungen für den Nachzug. Migration zum Zweck der Familienzusammenführung spielt im internationalen Vergleich eine bedeutende Rolle. Sie bewirkt unter anderem, dass der Anteil ausländischer Staatsangehöriger an der Gesamtbevölkerung Deutschlands in den Altersjahrgängen 16 bis 25 Jahre besonders hoch ist (vgl. Beger 2000:30).
1980 lebten etwa 4,5 Millionen Menschen ohne einen deutschen Pass in Deutschland, 1995 waren es 7,2 Millionen. Das bedeutet, dass fast 12% aller in Deutschland lebenden Menschen in der einen oder anderen Form Migranten der zweiten Hälfte des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts sind. (vgl. Bade/Münz 2002:11)
Am ersten Januar 2000 ist in Deutschland das neue Staatsbürgerschaftrecht in Kraft getreten (vgl. Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration 2005), welches besagt, dass in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern mit der Geburt automatisch Deutsche sind, wenn sich ein Elternteil bei der Geburt mindestens acht Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhält und seit mindestens drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat. Die Kinder haben zusätzlich die Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern zu erwerben.
1.3.4. Folgen und Reaktionen der Zuwanderung
Die Gruppe der Menschen aus den Staaten, die von der Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 1950er Jahre angeworben wurden, machen nach wie vor den Hauptanteil der in Deutschland lebenden Zuwanderer aus (vgl. Herwartz-Emden 2003:666).
Obwohl viele Deutsche von den Gastarbeitern profitierten, änderte sich die Stimmung gegenüber den ausländischen Arbeitnehmern. Viele deutsche Arbeiter stiegen in bessere berufliche Positionen auf. Berechnungen ergaben, dass zwischen 1960 und 1970 rund 2,3 Millionen deutsche Arbeiter in Angestelltenpositionen aufsteigen konnten (vgl. Meinhardt 2006:35). Vielen Migranten gelang in den nachfolgenden Jahren der soziale Aufstieg vom ungelernten Arbeiter zum Facharbeiter oder Vorarbeiter. Verglichen mit den deutschen Arbeitern fiel ihr berufliches Weiterkommen aber weitestgehend gering aus.
Trotzdem hatte sich um 1980 die Meinung zu den in Deutschland lebenden Arbeitsmigranten innerhalb der Bevölkerung geändert. Es wurde nun vermehrt für den Rückzug der Arbeitnehmer aus anderen Herkunftsländern in deren Heimat plädiert (vgl. Herbert 2001:241).
„Die Bundesregierung verfolgte angesichts dieser Stimmungslage eine Doppelstrategie: Auf der einen Seite war ihre Politik weiterhin bestimmt vom Ziel der Begrenzung des Zuzugs, von der Ignorierung des Wanderungsprozesses, der Förderung der Rückkehrbereitschaft sowie die Aufrechterhaltung der sozialen und kulturellen Beziehungen der Ausländer/innen zu den Herkunftsgesellschaften. Auf der anderen Seite suchte sie nach Möglichkeiten zur verstärkten Integration der hier lebenden Migrantinnen und Migranten“ (Meinhardt 2006:37).
Ein wichtiger Schritt zur Integration in eine Gesellschaft ist die Möglichkeit, am Bildungssystem der aufnehmenden Gesellschaft teilzunehmen. Die Schulbildung der Kinder mit Migrationshintergrund wurde erst mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr 1960 gesichert. Aufgrund von gesellschaftlichen und politischen Versäumnissen ist jedoch ihre Teilhabemöglichkeit im Hinblick auf Bildung und Erwerbstätigkeit auch aktuell noch von schlechten Ausgangsbedingungen geprägt.
Heute leben bereits Zuwanderer der zweiten und dritten Generation in Deutschland, denn schon in den 1980er Jahren hatten die ersten Arbeitsmigranten das Rentenalter erreicht. Diese leben mit ihren Familien, die im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland eingereist waren, zusammen.
Bis zum Jahr 2005 waren die Menschen mit Migrationshintergrund allein verantwortlich für das Erlangen der zur Integration ins Zielland Deutschland nötigen Kompetenzen. Das zum 1. Januar 2005 in Kraft tretende Zuwanderungsgesetz befasst sich in den Paragraphen 43 bis 45 mit der Förderung der Integration. Dieses Gesetz demonstriert erstmalig einen Perspektivenwechsel, da die Eingewanderten nun nicht mehr allein die Verantwortung für ihre Integration tragen, sondern der Staat ihnen ein einklagbares Recht auf Teilnahme an Integrationskursen zur Vermittlung der deutschen Sprache, Geschichte und Kultur einräumt. Hierdurch demonstriert der Gesetzgeber das Erlernen der deutschen Sprache als zentrales Ziel der Integrationsmaßnahmen und damit als wesentliche Kompetenz zur Teilhabe am öffentlichen Leben der Einwanderungsgesellschaft Deutschland.
2. Mehrsprachigkeit
Sprache ist das wichtigste Mittel menschlicher Kommunikation und Teilhabe in einer sozialen Gesellschaft. Mit der Sprache erwirbt der Mensch nicht nur die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation, sondern auch soziale Normen und Verhaltensweisen sowie kulturelle Tradierung.
Um den Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Mehrsprachigkeit bei Kindern mit Migrationshintergrund zu zeigen, muss zunächst die Frage nach den Formen von Spracherwerbsprozessen geklärt werden. Anschließend werden die spezifischen Formen des Erwerbsprozesses von Kindern mit Migrationshintergrund dargestellt. Diese wachsen in den meisten Fällen mehrsprachig auf, wobei im Regelfall innerhalb der Familie die Sprache des Herkunftslandes gesprochen wird. Treten die Kinder mit ihrer Umwelt in Kontakt, sei es auf dem Spielplatz oder in vorschulischen Einrichtungen, werden sie zudem mit einer anderen Sprache konfrontiert. Wie gut die Kenntnisse in der Zweitsprache Deutsch sind, ist im Einzelfall sehr unterschiedlich.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche typischen Verläufe der Spracherwerb aufweist und ob überhaupt eine einheitliche Erwerbstheorie besteht. Um mehrsprachige Schüler in ihren Sprachkompetenzen fördern zu können, benötigt man Wissen zu den Besonderheiten und Eigenschaften der verschiedenen Formen des Spracherwerbs. Eine Grundlage dazu soll dieses Kapitel bieten.
2.1. Funktionen der Sprache
Sprache ist ein zentraler Ausgangspunkt für soziale und ethnische Zuschreibungen und Zugehörigkeiten. Sprache hat also eine individuelle Bedeutung für den Sprecher und auch für seine Umwelt, mit der er durch das Medium Sprache in Verbindung tritt. Formal gesehen handelt es sich um ein gesellschaftlich entwickeltes und geprägtes Mittel des Ausdrucks zum Austausch von Gedanken und Informationen. Oksaar (2003:15) bezeichnet die Sprache als „Zeichensystem, welches den Denk-, Erkenntnis- und sozialen Handlungsprozessen der Menschen dient“, doch sie ist weit mehr als das.
Für die Mitglieder einer Gesellschaft ist die Sprache Mittel des Ausdrucks und der Kommunikation miteinander. Der Sprecher kann sie zum Ausdruck seiner persönlichen und sozialen Identität mit dazugehörigen positiven und negativen Bewertungen (vgl. Oksaar 2003:16) verwenden. Während sie einerseits vom Sprecher benutzt wird, seine persönliche Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu demonstrieren, kategorisiert die Umwelt den Sprecher andererseits nach der von ihm gewählten Sprache bestimmten Gruppen und Schichten zu.
Das Produzieren und Verstehen der Sprache und die sprachlichen Fertigkeiten, wie Schreiben, Lesen und die mündliche Sprache sind häufig an die Situation gebunden, in der die Sprache verwendet wird. Dieser Umstand wird in der Sprachwissenschaft als Sprachwahl oder Diglossie (Bußmann 2002:167) aus gesellschaftlicher Perspektive bezeichnet. Dieser funktionale Aspekt besagt, dass die Art der Sprache bestimmten Situationen angepasst werden kann und nicht willkürlich verwendet wird. Gesellschaftliche Normen oder institutionelle Rahmen bestimmen über die Angemessenheit der Sprachwahl. Ein Sprecher ist also in der Lage, seine Sprache oder Sprachvarietät der Situation, dem Inhalt des Gesprächs, der Funktion der Kommunikation und den anderen Teilnehmern der Situation anzupassen (vgl. Myers-Scotton 2006:90ff). Dieses Wissen ist Teil unserer kommunikativen Kompetenz. Schon Kinder sind früh in der Lage, ihre Sprache der jeweiligen Situation anzupassen.
„In der Forschung besteht mittlerweile weitgehend Konsens dahingehend, dass bilinguale Kinder im Alter von weniger als zwei Jahren prinzipiell in der Lage sind, ihre Sprachen personenbezogen einzusetzen und auch ihre Sprachwahl dementsprechend zu korrigieren […]“ (Tracy/Gawlitzek-Maiwald 2000:513).
In Studien mit zweisprachig aufgewachsenen Kindern haben Tracy und Gawlitzek-Maiwald (1995:514) am Beispiel der zweijährigen Hannah gezeigt, dass diese bereits zwischen den Sprachen in der jeweiligen Gesprächssituation unterscheiden kann.
Vater: „In the Kita they call it `Frühstück`, don’t they?”
Hannah (2,9): „Und du heißt das `breakfast`.“
Trotz der Sprachmischung in der Wortstellung zeigt Hannah deutlich, dass sie zwischen den beiden Sprachen erstens unterscheiden und zweitens die Sprachen den Gesprächspartnern anpassen kann.
Die Sprachen haben für den Sprecher darüber hinaus einen symbolischen Wert. Bestimmte Werte, Emotionen und Zugehörigkeiten werden durch die Sprachwahl transportiert. Das bedeutet, dass innerhalb bestimmter Gruppen, wie Familien oder Freundeskreisen eine andere Sprachvarietät genutzt wird, als in Bildungssystemen oder in der Kommunikation mit Personen eines hohen sozialen Status. Die Sprache wird also auch von einem monolingualen Sprecher der jeweiligen Situation angepasst.
Im Migrationskontext bedeutet es zusätzlich, dass ein Sprachlerner nicht die eine deutsche Sprache erlernt. Besonders in der Bildungsinstitution Schule wird er mit einer weiteren Sprachvarietät konfrontiert wird, die sich von dem Alltagsdeutsch stark unterscheidet (vgl. Gogolin 1994)
2.2. Begriffsbestimmung Mehrsprachigkeit
Eine scharfe Abgrenzung zwischen Monolingualismus und Bilingualismus ist unter sprachwissenschaftlicher Perspektive nicht sinnvoll möglich, denn auch Kinder und Jugendliche, die in einer einsprachigen Umgebung aufwachsen, verfügen über die Kompetenz der Sprachwahl. Ein monolinguales Kind bedient sich verschiedener Varianten, wie Alltagssprache, Schriftsprache usw. Das wirft die Frage auf, ob es einen monolingualen Menschen überhaupt gibt.
Auch Kinder mit Migrationshintergrund bedienen sich verschiedener Sprachvarietäten, deshalb werden sie als mehrsprachig bezeichnet, obwohl sie meist zwei Standartsprachen sprechen. Im Folgenden wird deshalb der Begriff Zweisprachigkeit bzw Bilingualismus als Synonym zu Mehrsprachigkeit verwendet. Zwischen den prototypischen Fällen eines fast einsprachigen deutschen Kindes und eines mehrsprachigen deutschen Kindes türkischer Herkunft gibt es in der Realität viele Übergänge. Was unter dem Begriff Mehrsprachigkeit (Bilingualismus) eines Individuums zu verstehen ist, hat Weinreich für die Psycholinguistik folgendermaßen definiert:
„In der vorliegenden Untersuchung werden zwei oder mehr Sprachen als in Kontakt miteinander stehend bezeichnet, wenn sie von einunddenselben Personen abwechselnd gebraucht werden. Die die Sprache gebrauchenden Individuen sind somit der Ort, an dem der Kontakt stattfindet. Die Praxis, abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen, soll Zweisprachigkeit heißen, die an solcher Praxis bezeichneten Personen werden zweisprachig genannt“ (Weinreich 1970:15).
Bechert und Wildgen (1991) prägten die soziolinguistische Begriffsdefinition, welche die Mehrsprachigkeit als ein Gruppenphänomen beschreibt. Danach wird eine Gruppe als mehrsprachig bezeichnet, wenn zwei oder mehr Sprachen innerhalb der Gruppe gesprochen werden und dadurch in Kontakt zueinander stehen.
Die Begriffe der individuellen und kollektiven Mehrsprachigkeit bestimmen also den Ort, an dem der Sprachkontakt stattfindet. Wenn ein einzelner Mensch mehrere Sprachen benutzt, nennt man dies individuelle Mehrsprachigkeit, benutzt eine Gruppe mehrere Sprachen, spricht man von kollektiver Mehrsprachigkeit.
Ein zweites Kriterium zur Definition von Mehrsprachigkeit ist der Grad der Beherrschung der verschiedenen Sprachen. Ab welchem Grad der Sprachkompetenz ein Sprecher als mehrsprachig zu bezeichnen ist, wird in der Sprachwissenschaft kontrovers diskutiert. Die Meinungen lassen sich nach Tracy und Gawlitzek-Maiwald zwischen zwei Polen einordnen. Den einen Pol besetzt danach die idealisierte Vorstellung des amerikanischen Strukturalisten Bloomfield (1933). Danach ist bilingual die Fähigkeit, zwei Sprachen zu beherrschen und diese Fähigkeit wie die entsprechenden Monolingualen ausgebildet zu haben. Auf der anderen Seite steht die großzügige Formulierung von Macnamara (1967). Sie bezeichnet schon denjenigen als mehrsprachig, welcher eine Sprache beherrscht und in einer anderen z.B. nur eine Lesekompetenz hat.
Die vielen Definitionen, von denen ich zuvor nur die beiden Extreme genannt habe, reichen von der sicheren Beherrschung beider Sprachen zu geringeren aktiven und passiven Kompetenzen in den Standartsprachen. Zwischen diesen heterogenen Definitionsversuchen lassen sich alle Zwischenstufen einordnen. Uneinigkeit besteht darüber, ob bestimmtes sprachliches Wissen oder die Häufigkeit der Sprachverwendung über die Einordnung des Sprechers als bilingual entscheiden. Deshalb haben Tracy und Gawlitzek-Maiwald folgende Definition formuliert:
„Ein bilinguales Individuum beherrscht zwei sprachliche Kenntnissysteme in dem Ausmaß, das es ihm gestattet, mit monolingualen Sprechern der einen oder anderen Sprache in einem monolingualen Modus, d.h. in der Sprache des Gesprächspartners zu kommunizieren. Bei Bedarf, d.h. im Umgang mit mehrsprachigen Kommunikationspartnern, kann sich ein bilinguales Individuum der Ressourcen des ´bilingualen Modus` bedienen, d.h. ein beide Sprachen umfassendes Repertoire ausschöpfen, wobei es zu intensiven Formen des Mischens oder Code-switching kommen kann“(Tracy/Gawlitzek-Maiwald 2000:47).
Im Folgenden wird der Begriff des Mehrsprachigen im Sinne der Definition von Tracy und Gawlitzek-Maiwald verwendet. Ich schließe mich dieser Definition an, weil sie betont, dass es neben den Kompetenzen eines Mehrsprachigen in den jeweiligen Standartsprachen eine besondere bilinguale Kompetenz gibt, die ausschließlich mehrsprachige Sprecher haben. Ich halte die Einengung des Bilingualismusbegriffs auf eine gleich gute Beherrschung zweier Standardsprachen zwar für eine Zielformulierung, aber das Erreichen dieses Ziels ist in der Sprachpraxis eher unwahrscheinlich.
Mehrsprachige sind zwar in der Lage in beiden Sprachen zu kommunizieren, doch neben den Kompetenzen in den Standardsprachen verfügen sie über eine gemischte Sprachkompetenz, die weder die Kompetenz in der einen, noch die Kompetenz in der anderen Sprache meint. Es handelt sich vielmehr um sprachliche Transferleistungen, die beispielsweise bei der Lesekompetenz erwartet werden können (vgl. Siebert-Ott 2003:165). Ein mehrsprachiger Sprecher verfügt also nicht über die Summe der Kompetenzen zweier Monolingualer. Sondern über eine Kompetenz, die er mit anderen Mehrsprachigen, ungeachtet der jeweils gesprochenen Standartsprachen, verwendet. Der Begriff Mehrsprachigkeit wird im Folgenden generell als Abgrenzung zu Einsprachigkeit bzw. Monolingualität benutzt und als Synonym zu Zweisprachigkeit.
2.3. Spracherwerbstypen
In der Sprachwissenschaft werden drei Arten des Spracherwerbs unterschieden. Der Erst- und Zweitspracherwerb und der Wiedererwerb einer Sprache. Der Wiedererwerb einer Sprache ist im Zusammenhang der Betrachtung zum Spracherwerb von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und deren Schulerfolg eher unbedeutend, deshalb wird er hier aus der Betrachtung ausgeklammert.
Voraussetzungen für jeden Spracherwerb sind der sprachliche Input, das individuelle Sprachlernvermögen und der Antrieb bzw. die Motivation des Lerners. Der Input besteht im natürlichen Prozess aus einem akustischen Reiz, welcher mit einer Information verknüpft ist (vgl. Klein 1984:54). Dies bedeutet, dass Sprache in der Regel in und durch Kommunikation erworben wird.
Zu den kognitiven Lernvoraussetzungen bestehen fachwissenschaftlich verschiedene Theorien, wie zum Beispiel der Behaviorismus von Skinner oder der Kognitivismus nach Piaget. Sie setzen einen unterschiedlichen Schwerpunkt und beschäftigen sich beispielsweise mit der Frage, ob verschiedene Verarbeitungsstrategien für den sprachlichen Input bestehen oder ob es eine angeborene Spracherwerbsfähigkeit gibt.
Unter `Antrieb` versteht Klein (1984) die Fähigkeit eines Lerners, seine Sprachlernkompetenz auf eine bestimmte Sprache anzuwenden. Die Einstellung zur Sprache oder zu Erziehung und Beruf allgemein können abschwächend oder verstärkend auf den Spracherwerb wirken. Das Interesse des Lernenden an fremden Sprachen, seine Einstellung zur eigenen Fremdsprachenbegabung und die individuell entwickelte Lernstrategie sind wichtige Faktoren der Motivation zum Erlernen einer weiteren Sprache.
Trotz intensiver Forschung besteht aktuell keine Einigkeit über das Maß des Einflusses äußerer oder individueller Faktoren auf den Spracherwerb. In jedem Fall können die individuellen Lernvoraussetzungen, wie sozial-psychologische oder Persönlichkeitsfaktoren das Erwerbstempo und den Endzustand beeinflussen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Melanie Schaaf (Autor:in), 2006, Mehrsprachigkeit und Schulerfolg bei Kindern mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82373
Kostenlos Autor werden




















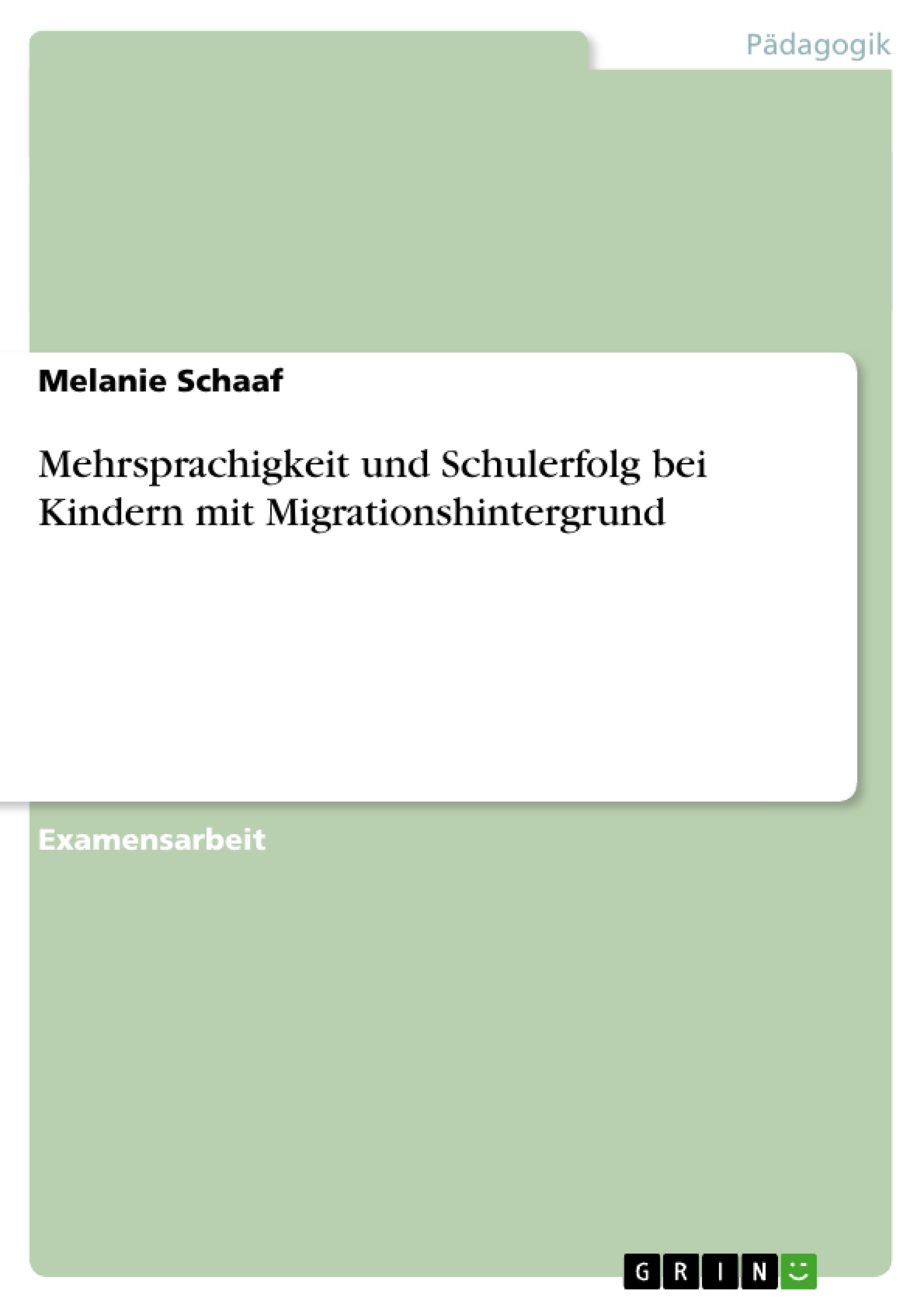

Kommentare