Leseprobe
Inhaltsangabe
1 Einleitung
2 Aktualität der Psychotraumatologie
3 Entstehung eines Traumas
3.1 Auslösende Faktoren
3.1.1 Zufällige Ereignisse
3.1.2 Man-made-desaster
3.2 Prävalenz eines Traumas
3.3 Erleben eines Traumas
3.4 Direkte Traumareaktion
3.5 Traumatischer Prozess
4 Risiko und Schutzfaktoren bei der Traumaentstehung
4.1 Risikofaktoren
4.2 Schutzfaktoren
5 Neurobiologische Grundlagen
5.1 Neuronale Netzwerke
5.2 Hormonelle Stressreaktion
5.3 Trauma und Gedächtnis
6 Kurzfristige Folgen eines Traumas
6.1 Anpassungsstörungen
7 Akute Belastungsreaktion Langfristige Folgen eines Traumas
7.1 Posttraumatische Belastungsstörung
7.1.1 Klassifikationssysteme der PTBS
7.1.2 Sonderformen nach extremer Traumatisierung
7.1.3 Kritik der PTBS
7.2 Komorbide Störungen
7.2.1 Depressionen
7.2.2 Angsterkrankungen
7.2.3 Suchterkrankungen
7.2.4 Dissoziative Störungen
7.3 Somatoforme Störungen
8 Auswirkung auf sekundär Betroffene
8.1 Beziehungsstörungen
8.2 Transgenerationale Weitergabe
8.3 Auswirkungen auf die Gesellschaft
9 Therapie der PTBS
10 Unterstützungmöglichkeiten durch die soziale Arbeit
10.1 Psychoedukation
10.2 Angehörigenarbeit
10.3 Krisenintervention
10.4 Beratung
11 Fazit
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Traumaprävalenz
Tab. 2: Akute Belastungsreaktion im DSM IV und im ICD 10
Tab. 3: Die PTBS im DSM IV und im ICD 10
1 Einleitung
Über die Medien sind täglich Bilder von Gewalt und Opfern zu sehen. Grausame Ereignisse gelangen dadurch weltweit in die Wohnzimmer der Bevölkerung.
Die erschreckenden Bilder des 11.September 2001, als in New York Flugzeuge in das World Trade Center rasten, entsetzte die Welt. Die Opfer erlitten nicht nur physische sondern auch psychische Traumata. Das griechische Wort Trauma bedeutet Verletzung oder Wunde. Diese Arbeit wird sich mit den psychischen Traumata befassen.
Ein Zusammenhang zwischen einem solchen Ereignis und den darauf folgenden psychischen Symptomen wird heute nicht mehr bestritten. In der Geschichte war dies jedoch oft umstritten und zählte jahrzehntelang zu den Diskussionspunkten der Psychiatrie. Die Entstehungsgeschichte der Psychotraumatologie wird Gegenstand des zweiten Kapitels sein.
Nach dem Tsunami im Jahre 2004 gab es daher nicht nur materielle, sondern auch psychologische Hilfen. So reisten Traumapsychologen nach Sri Lanka um Schulungsprogramme zur Unterstützung der traumatisierten Bevölkerungsgruppen durchzuführen (Wehrig/Jacob 2007, 62).
Großereignisse, wie die hier genannten, genießen eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Die meisten wirklich schwerwiegenden Ereignisse finden jedoch unbeachtet von der Öffentlichkeit, in Familien und nahen Beziehungsräumen statt (Maercker/Rosner 2006, 6).
Dabei sind die Auswirkungen bei den Kindern besonders schädigend. Hier blockieren traumatische Ereignisse Entwicklungsaufgaben, die zu jenem Zeitpunkt gelöst werden. Bei Säuglingen und Kleinkindern führt das zu Störungen der Hirn-entwicklung[1].
Kindheitstraumata werden nicht zentraler Gegenstand dieser Arbeit sein. Die vielschichtigen Auswirkungen der Traumata in der Kindheit bedürfen einer eigenen Auseinandersetzung, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.
Auswirkungen von Traumatisierung im Kindesalter reichen bis ins Erwachsenenalter. So zeigt eine Studie mit 17000 Personen aus der amerikanischen Mittelschicht, den engen Zusammenhang zwischen Kindheitstraumata und dem physischen und psychischen Gesundheitszustand im Erwachsenenalter (Felitti et al. 2007, 18). Bei der „Adverse Childhood Experiences (ACE) - Studie zu Kindheitstrauma und Gewalt“ wurden Belastungen im Kindesalter in 10 Kategorien eingeteilt. Dazu zählen unter anderem Kategorien wie emotionaler, körperlicher und sexueller Missbrauch sowie das Vorkommen von Sucht und häuslicher Gewalt. Je mehr Kategorien zutrafen, umso häufiger waren die Erwachsenen von Suchterkrankungen wie Nikotin, Alkohol, Drogen aber auch von Depressionen, Suizidversuchen, Adipositas (Fettsucht) und der Koronaren Herzerkrankung (KHK) betroffen (Felitti et al. 2007 22 ff).
Besonders die beiden letzten genannten sind ungewöhnlich. Bei adipösen Patienten fand sich ein hoher Anteil von Menschen, die in der Kindheit sexuell missbraucht wurden und als Schutzmechanismus dick wurden, um weiteren Missbrauch zu verhindern (Felitti 2007, 19 und 30).
Herzerkrankungen werden meistens mit ungesunder Lebensweise in Verbindung gebracht. Wenig bekannt ist, dass eine KHK auch bei Personen auftritt, die nicht zu den Risikopatienten zählen. Wendet man hingegen dort den Fragebogen der ACE-Studie an, finden sich hier hohe Werte.
Felitti et al. (2007, 23) gehen so weit, dass sie Kindheitstraumata mehr Gewicht bei der Entstehung koronarer Herzerkrankungen zuschreiben, als den klassischen Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung.
Hier zeigen psychische Traumatisierung Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Wie psychische Traumata Einfluss auf den Körper nehmen, wird in dieser Arbeit erläutert werden.
Bevor Traumafolgen im Einzelnen betrachtet werden können, ist es hilfreich den Mechanismus der Traumaentstehung in Kapitel 3 im Zeitverlauf zu betrachten. Bekannte Traumafolgen wie die Posttraumatische Belastungsstörung sollen mit weniger bekannten Traumafolgen dargestellt werden. Die Schwierigkeit bei den weniger bekannten Formen ist es, den Zusammenhang zum Trauma herzustellen.
Um diesen Formen mehr Raum zu geben, wurde auf eine ausführliche Darstellung von Persönlichkeitsveränderungen nach schweren Traumata verzichtet. Beispiele hierfür sind die Multiple Persönlichkeitsstörung oder die DESNOS (Disorders of Extreme Stress, not otherwise specified), die besonders nach schweren Kindheitstraumatisierungen sowie nach extremen Ereignissen wie Folter entstehen kann.
Mechanismen, die manche Opfer nach Traumata entwickeln, sollen ebenfalls nicht in dieser Arbeit thematisiert werden. Dazu zählen Mechanismen wie den engen Beziehungsaufbau zum Peiniger, auch Stockholmsyndrom genannt, sowie die Entwicklung vom anfänglichen Opfer zum späteren Täter (van der Kolk 2000, 187 f).
Ebenfalls ausgeklammert wird der Zwang, traumatische Erfahrungen zum Zwecke des Wiedererlebens zu inszenieren (Felliti et al. 2007, 29).
Intensiver betrachtet werden die Auswirkungen auf sekundär Betroffene.
Diese wurden im deutschen Film „Das Wunder von Bern“ dargestellt, der 2004 in den Kinos lief. Zwar geht es offiziell um die Fussballweltmeisterschaft 1954, viele Szenen zeigen jedoch die dysfunktionale Beziehungsgestaltung eines aus russischer Gefangenschaft traumatisierten Kriegsheimkehrer zu Frau und Kindern.
Wie häufig Traumafolgen in unserer Gesellschaft vorkommen, zeigen Untersuchungen von Polizeibeamten. Das Miterleben sowie die Zeugenschaft belastender Ereignisse führt zu einem häufigen Vorkommen Posttraumatischer Belastungsstörungen unter Polizisten (Gasch 2007, 73 f).
Zu dem gefährdeten Personenkreis zählen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste, des Militärs sowie die Notfallseelsorger (Andreatta 2006, 101). Obwohl diese Gruppen ebenfalls zu den sekundär Traumatisierten zählen, werden sie in dieser Arbeit nicht gesondert betrachtet.
Diese Arbeit dient dazu, Zusammenhänge zwischen psychischen Traumata und den physhischen, psychischen und sozialen Folgen aufzuzeigen. Dabei sollen sowohl physiologische als auch psychologische Erklärungsmodelle herangezogen werden.
Da soziale Arbeit sich mit Problemlagen von Menschen und seinen Beziehungen zu Einzelnen und zur Gruppe befasst, dienen Kenntnisse der Traumaentstehung, der Schutz- und Risikofaktoren bei der Traumatisierung sowie der Traumafolgen dem Verständnis der Klienten. Daneben können diese Kenntnisse Grundlage sein, neue Handlungsansätze zu entwickeln.
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die weitreichenden Auswirkungen der Traumata auf Individuum und Gesellschaft aufzeigen. Daraus ergeben sich Überlegungen zur Verbesserung des Opferschutzes, sowie Ansätze auch außerhalb des therapeutischen Settings eine Traumaentstehung zu verhindern, beziehungsweise deren Bewältigung zu ermöglichen. Hilfen sind daher nicht auf den Bereich der Therapie beschränkt, sondern sind auch durch politisches und gesellschaftliches Handeln bereitzustellen. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die weibliche Personenbezeichnung verzichtet.
2 Aktualität der Psychotraumatologie
Psychotraumatologie, die Lehre von den seelischen Verletzungen gibt es in Deutschland erst seit ca. 10 Jahren als eigenständige Fachrichtung. Die Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie beispielsweise aus der Neurophysiologie, der Psychopathologie und der Psychologie werden hier verknüpft. Sie dienen der Praxis der Medizin, der Sozialarbeit, der Psychologie, der Justiz und der Pädagogik (Von Hinckeldey/ Fischer 2002, 9).
Die Menschheit wurde seit ihrem Bestehen mit belastenden Ereignissen konfrontiert. Schon früh finden sich detaillierte Beschreibungen von Reaktionen infolge von Kriegstraumata beispielsweise in „Illias“, verfasst von Homer im 8.Jh. vor Chr. (Shay in Fischer & Riedesser 2003, 33).
Der Weg, ein belastendes Erlebnis als Auslöser für psychische und physische Störungen auch in der Gesellschaft anzuerkennen, dauerte jedoch lang .
Die Frage war, ob das Ereignis selbst Auslöser der Störungen ist oder aber andere Faktoren verantwortlich waren. Dazu zählte in der Person begründete Empfindlichkeiten, bestehende Vorerkrankungen oder sogar die Unterstellung einer Simulation (van der Kolk et al. 2000, 71 f).
Zwei Personengruppen führten immer wieder zu Untersuchungen von Traumafolgestörungen, zum einen die Kriegsheimkehrer, zum anderen sexuell misshandelte Frauen und Kinder. Bekannteste Beschreibung für Letzteres findet sich in dem Krankheitsbild der Hysterie.
Die Hysterie, aus dem griechischen Wort Hystera (Gebärmutter) galt jahrelang als typisch weibliche Erscheinung und wurde mit der Simulation assoziert.
Erst Charcot (in van der Kolk et al. 2000, 76), ein Neurologe an der Salpeterie in Paris, untersuchte die Symptomatik und stellte einen Zusammenhang zwischen erlebten Traumata und den Symptomen her. Damit entzog er den Boden für die vermeintliche Simulation (van der Kolk et al. 2000, 74 und 76; Herman 2003, 21 f).
Neben Charcot beschäftigten sich vor allem Janet und Freud (in van der Kolk et al. 2000, 76 f), zwei seiner Schüler intensiv mit der Hysterie. Beide kamen unabhängig zu der gleichen Schlussfolgerung, dass erlebte belastende Ereignisse zu diesen Symptomen führten. Freud widerrief jedoch nach einem Jahr diese These und ging stattdessen von Phantasien der Patientinnen aus. Dies entsprach auch eher seiner Theorie von dem Ödipuskomplex (van der Kolk et al. 2000, 76 f; Hermann 2003, 41 f und 47; Huber 2003, 25).
Janet (in van der Kolk et al. 2000, 76 ff) blieb bei der Annahme, dass traumatische Ereignisse die Auslöser sind. Viele seiner Arbeiten, die lange in Vergessenheit gerieten, zählen heute zu den Grundlagen in der Psychotraumatologie. So entdeckte er den Zusammenhang zwischen der Unfähigkeit, von traumatischen Erfahrungen zu berichten und dem Wiedererleben der Situation in Form von Bildern und Reaktionen. Als Erklärung führte er den Begriff der Dissoziation (Abspaltung) ein. Er beschreibt, dass der Verstand als Schutzmaßnahme die Erinnerungen abspaltet, dissoziiert.
Kriege und Unglücksfällen führten zu den gleichen Symptomen. Diese wurden auch hier nicht mit den belastenden Ereignissen in Verbindung gebracht. Vielmehr ging man von organischen Ursachen aus. Beispiele hierfür sind die Bezeichnungen wie „railroad-spine-syndrome“ von Erichson im Jahre 1866 (in van der Kolk et al. 2000, 72), „Traumatische Neurose“ von Oppenheim im Jahre 1889 (ebd.) sowie „irritable heart“ und „shell shock“ von Myers in den Jahren 1870 und 1915 (ebd.).
Sowohl im ersten als auch im zweiten Weltkrieg war die Anerkennung als Opfer mit Entschädigungs- bzw. Rentenansprüche schwierig. Man verdächtigte die Betroffenen zu simulieren oder feige zu sein. (Hausmann 2006, 12; van der Kolk et al. 2000, 74 ff). Dies führte in Deutschland dazu, dass die Ablehnung von Rentenansprüchen, aufgrund einer Traumatischen Neurose, in der Reichsversicherungsordnung von 1926 festgeschrieben wurde (Venzlaff in van der Kolk et al. 2000, 74 f).
Besonders unrühmlich ist die Tatsache, dass es auch für Holocaustüberlebende schwierig war, Entschädigungsansprüche durchzusetzen, da die Symptome den Erbanlagen oder der Konstitution zugeschrieben wurden (Fischer/Riedesser, 2003, 31).
Der in die USA emigrierte Psychoanalytiker Eisler (in Teegen 2003, 16) reagierte auf diese Praxis mit der Frage :
“Die Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen können, um eine normale Konstitution zu haben?“
(in Teegen 2003, 16)
Bis in die 80er Jahre kämpften Naziopfer um ihre Entschädigung. In einem Fall zog sich das 40 Jahre hin und war mit 21 medizinischen Untersuchungen verbunden (Löwe et al. 2006, 185).
Erst nach dem Vietnamkrieg führte das Engagement der Kriegsveteranen im Jahr 1980 zu der Aufnahme des “posttraumatischen Syndroms“ in das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III (DSM III). Damit wurde endgültig anerkannt, dass belastende Ereignisse zu kurzfristigen und langfristigen Schäden führen können (Hermann 2003, 44). Seitdem wurden Diagnosekriterien überarbeitet und finden sich heute sowohl im amerikanischen DSM IV als auch im ICD 10 (International Classification of Diseases der WHO, welche in Deutschland für die Klassifikation von Erkrankungen gültig ist).
Erst 11 Jahre nach der Einführung der Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im DSM III wurde in Deutschland der erste Artikel zu diesem Krankheitsbild von Dressing und Berger 1991 veröffentlicht (in Frommberger 2004, 412).
Seit Einführung des Symptomkomplexes fand eine enorme Weiterentwicklung statt. Das betraf beispielsweise die Erkenntnis, dass auch nach lebensbedrohlichen Erkrankungen, Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung auftreten.
Bestimmte Berufsgruppen, wie Feuerwehrleute, Polizisten, Journalisten und Sanitäter wurden als potentiell gefährdet entdeckt, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln.
Forschungen aus der Neurobiologie zeigen die fehlgesteuerten Abläufe des Gehirns sowie der hormonellen Stressreaktion. In der psychosomatischen und der psychiatrischen Medizin wurden bei vielen Erkrankungen Traumata in der Vorgeschichte der Patienten entdeckt (Maercker/ Ehlert 2001, 12 ff).
3 Entstehung eines Traumas
In der deutschen Sprache steht verwirrenderweise für den Begriff des psychischen Traumas sowohl das Ereignis, das zum Trauma führt, als auch die Verletzung selbst. Um es auf die physische Ebene zu übertragen, gibt es keine Unterscheidung zwischen einem Unfall, also dem Geschehen und der Unfallverletzung, der Folge.
Nicht jeder Unfall führt zur Verletzung und nicht jedes Ereignis führt zum psychischen Trauma (von Hinckeldey/ Fischer 2002, 11 f). Belastende Ereignisse führen demnach nicht zwangsläufig zur seelischen Verletzung.
Die Entstehung eines Traumas hängt von mehreren Faktoren ab. Außerdem entsteht ein Trauma nicht an einem einem Zeitpunkt, sondern im Zeitverlauf.
Zu den auslösenden Faktoren müssen subjektive und soziale Faktoren hinzukommen (Fischer & Riedesser 2003, 63 f).
Auslösende Faktoren betreffen Art, Dauer und Schwere des Ereignisses. Subjektive Faktoren sind in der betroffenen Person begründet, in dem persönlichen Erleben und dem vorhandenen Handlungsrepertoire. Soziale Faktoren beziehen sich beispielsweise auf das Vorhandensein einer unterstützenden Beziehung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorraussetzung zur Entstehung ist ein belastendes Ereignis, der Auslöser. Kennzeichen eines äußerst belastenden Ereignisses ist die Unkontrollierbarkeit der Situation verbunden mit Todesangst. Sie kann nicht mit den vorhandenen Copingstrategien bewältigt werden.
Das DSM IV formuliert ein belastendes Ereignis folgendermaßen:
“Das traumatische Ereignis beinhaltet das direkte persönliche Erleben einer Situation, die mit Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu tun hat oder das Miterleben eines unerwarteten und gewaltsamen Todes, schweren Leids oder Androhung des Todes oder Verletzung eines Familienmitgliedes oder einer nahestehenden Person“ (DSM IV)
In Deutschland ist das ICD 10 gültig. Hier findet sich nachfolgende Definition:
„Ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes (kurz oder lang anhaltend), das fast bei jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde” ( ICD 10)
3.1 Auslösende Ereignisse
Es gibt verschiedene Kategorien für die Ereignisse, die traumatisch wirken können. Eine Möglichkeit ist die Einteilung nach dem Zeitfaktor. Die Dauer der traumatischen Situation führt entweder zum Typ I oder Typ II Trauma. Zum Typ I, einem kurzzeitigen, einmaligen Ereignis, gehören Naturkatastrophen, technische Katastrophen oder kriminelle Gewalt. Bei Typ II handelt es sich um wiederholte oder lang andauernde Geschehen. Beispiele hierfür wären Geiselhaft, Krieg, Kriegsgefangenschaft, Folter oder wiederholter sexueller Missbrauch (Hausmann 2006, 43).
Die Unterscheidung nach dem Verursacher ist die andere Unterscheidungsmöglichkeit. Hierbei differenziert man die zufälligen Ereignisse von den durch Menschen hervorgerufenen Ereignissen, den man-made-desastern. Die länger andauernden sowie die durch Menschen hervorgerufenen Ereignisse zeigen sich als besonders traumatisierend (Nyberg 2005, 25; Hausmann 2006, 42).
3.1.1 Zufällige Ereignisse
Kennzeichen für diese Ereignisse sind, dass diese in der Regel nicht bewusst hervorgerufen werden können. Zufällige Ereignisse sind in der Regel besser zu verkraften. Huber (2003, 76) führt dies darauf zurück, dass die Menschen offen darüber reden und die Integration ins Leben somit erleichtert wird.
Zu dieser Gruppe gehören Flutkatastrophen, Erdbeben, Brände, Stürme, Unglücksfälle wie beispielsweise das Zugunglück von Enschede im Jahre 1998.
3.1.2 Man- made-desaster
Man-made-desaster bergen eine hohe Gefahr, Traumafolgestörungen zu entwickeln. Der Grund liegt in der Zerstörung des Vertrauens in andere Menschen. Besonders schwerwiegend ist es, wenn der Täter aus der Familie oder näheren Freundeskreis kommt (Huber 2003, 76 f).
Zu dieser Kategorie zählen: Kriegserlebnisse, Folter, Attentate wie der 11.September 2001, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Geiselnahme, Entführung, Überfall oder Amoklauf.
3.2 Prävalenz der Traumata
Die Prävalenz (Vorkommen) eines Traumas ist zum Teil von der Art des Ereignisses abhängig.
Verschiedene Studien untersuchten die Prävalenz eines Traumas in Bezug auf das Ereignis. Dabei zeigen bestimmte Ereignisse eine höhere Wahrscheinlichkeit eine PTBS zu entwickeln als andere.
Tab. 1: Traumaprävalenz
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Darstellung
Den in der Tabelle fettgedruckten Zahlen ist zu entnehmen, dass erlittene Folter die höchste Wahrscheinlichkeit hat, eine Folgestörung zu verursachen, gefolgt von Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch.
Außergewöhnlich ist auch das Ergebnis von dem Erdbeben in Armenien. Es widerspricht der These, dass zufällige Ereignisse zu einer geringeren Anzahl von traumatisierten Personen führen (Kapitel 3.1). Andererseits ist die Entstehung von vielen Faktoren abhängig, was eine Erklärung für diese hohe Zahl sein könnte.
Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass viele Menschen in ihrem Leben ein belastendes Ereignis erfahren, aber nur ein Teil von ihnen ein Trauma entwickelt. So erleben zwar 61% aller Männer ein belastendes Ereignis, jedoch sind nur 8% von den Traumafolgen betroffen. Frauen erleben zwar seltener ein belastendes Ereignis, nämlich 51%. Aber von diesen leiden dann 20% unter den Traumafolgen.
Nicht nur die Art des Traumas, sondern auch dessen Schwere und Dauer nehmen Einfluss auf die Traumaentstehung (Maercker/ Rosner 2006, 11 f; Huber 2003, 75).
3.2 Erleben eines Traumas
Zu dem objektiv nachprüfbaren Ereignis, dem Auslöser, muss eine subjektive Erlebensweise hinzukommen. Denn ein Trauma entsteht in der “Relation von Ereignis und erlebendem Objekt“ (Fischer & Riedesser 2003, 62).
Das Ereignis allein führt nicht automatisch zur Traumatisierung. Sondern die Art und Weise wie die betroffene Person dieses Ereignis erlebt.
In einer traumatischen Situation kommt es über die Sinnesorgane zu Stressreaktionen des Körpers. Selye (in Fischer&Riedesser 2003, 81) definiert Stress als leistungssteigernde Anpassung des Körpers, der Problemlösungen möglich macht. In diesem Fall nennt er ihn „Eustress“. Länger andauernde und überdimensionale Aktivierung führt jedoch zum schädigenden „Distress“. Kennzeichen von Distress ist die Unkontrollierbarkeit. Erleben Menschen solche unkontrollierbaren Stress-situationen fühlen sie sich hilflos. Wiederholte Erfahrungen, dass jede Anstrengung umsonst ist, führt schließlich zur Resignation. Hier beginnt die erlernte Hilflosigkeit nach Seligmann (in Ruegg 2006, 83).
Die Kontrollmöglichkeit ist eines der Parameter für die Entstehung eines Traumas. Ehlers (in Ruegg 2006, 117) stellte bei ihren Untersuchungen von vergewaltigten Frauen fest, dass die Bewahrung der Kontrollmöglichkeit - wie sich wehren oder Taktik überlegen können - hilfreich für die Verarbeitung des Geschehens ist. In einer Situation, in der die Betroffenen von Emotionen überrollt werden und Angst und Hilflosigkeit dominiert, entsteht die traumatische Situation. Fischer/ Riedesser definieren diese folgendermaßen:
„ vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst und Weltverständnis bewirkt.“ (Fischer/ Riedesser 2003, 82)
Fischer/ Riedesser (2003, 85) beschreiben die traumatische Erfahrung mit Hilfe eines Situationskreises. Die Wechselwirkung zwischen Umweltfaktoren (bedrohlichen Situationsfaktoren) und subjektivem Erleben und Handeln (individuellen Bewältigungsmöglichkeiten) mündet schließlich in der ausweglosen Situation (schutzlose Preisgabe), die traumatisierend ist.
In der nachfolgenden Abbildung (Abb.2) soll die Wechselwirkung zwischen der Einwirkung der Situation und der persönlichen Erlebensweise dargestellt werden.
Abb.2: Wechselwirkung zwischen Umweltfaktoren und subjektiven Faktoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: eigene Darstellung nach dem Situationskreismodell von Fischer &Riedesser 2003, 84 f)
Die Abbildung zeigt: Die Situationsfaktoren (1) sind für den Betroffenen weder zu verstehen noch mit den bisherigen Erfahrungen zu bewältigen (2). Die Kampfreaktion (3) ist wirkungslos und die weitere Einwirkung der Umgebungsfaktoren (4) führt zur Wahrnehmungsveränderung – zum Tunnelblick (5). Eine Flucht (6) ist ebenfalls nicht möglich (7), so dass die Situation als ausweglos (8) erlebt wird und nur noch die Dissoziation (Derealisation/Depersonalisation) und /oder Pseudo- oder Leerlaufhandeln möglich ist.
Unter Pseudohandeln wird die Handlung in der Phantasie verstanden und Leerlaufhandeln beinhaltet scheinbar sinnlose motorische Bewegungen. (Fischer & Riedesser 2003, 84 f).
Die Dissoziation ist zunächst ein Schutzmechanismus des Körpers, was dem Betroffenen hilft sich geistig wegzuschalten. Die Betroffenen berichten z.B. dass sie „neben sich“ als Beobachter stehen. Oder aber, dass sie die Situation als unwirklich erleben (Huber 2003, 56 ff).
Huber benutzt den Begriff „Traumatische Zange“ (Huber 2003, 38), um die traumatische Situation zu beschreiben: Das Gehirn wird dabei mit den Reizen völlig überflutet und kommt zu dem Schluss: Alles ist vorbei. Die fehlende Möglichkeit zu kämpfen oder zu fliehen führt zu „freeze und fragment “ (Huber 2003, 43). Freeze bedeutet einfrieren und zeigt sich dadurch, dass der Betroffene wie gelähmt ist und unfähig zu handeln. Diese Lähmung ist vergleichbar mit der Tierwelt, wo manche Tiere sich bei Gefahr totstellen. Dies geschieht mit Hilfe von Opiaten, die während der Situation vermehrt ausgeschüttet werden und den Schmerz betäuben. Die Person steht „neben sich“ und nimmt weder sich (Depersonalisation) noch die Umwelt (Derealisation) wirklich wahr (Huber 2003, 43 f und 56).
Fragmentieren bedeutet, dass die Sinneseindrücke und eigene Emotionen in Bruchstücke geteilt und weggedrückt werden, um diese aus dem Bewusstsein zu verbannen (Huber 2003, 43).
3.4 Direkte Traumareaktion
Mit dem Ende der traumatischen Situation endet objektiv die Bedrohung des Opfers. Hier beginnt die direkte Traumareaktion, in der das Opfer das Geschehen zu begreifen versucht. Die Betroffenen stehen unter Schock. Das zeigt sich sehr unterschiedlich: Durch Schreien, durch Aggressionen oder auch durch Lähmung und außergewöhnliche Ruhe (Lassogga/ Gasch 2002 38 ff).
Diese sensible Phase, stellt die Weichen dafür, ob es zu einem traumatischen Prozess oder zur Genesung kommt (Fischer &Riedesser 2003, 95 f).
Horowitz (in Fischer&Riedesser 2003, 96) entwickelte ein Stressreaktionsmodell anhand dessen der Ablauf der Traumareaktion ersichtlich ist. Dieser Zyklus der Traumaverarbeitung ist in der nachfolgenden Abbildung (Abb.3) dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Zyklus der Traumaverarbeitung
Quelle: Fischer & Riedesser 2003, 98
Der Verlauf geht vom 1.Quadranten auf der linken Seite im Uhrzeigersinn zum vierten Quadranten. Die erste Phase, die Realisation des Geschehen äußert sich durch Aufschrei beziehungsweise Überflutung. Darauf folgt die Phase der Vermeidung, der Verleugnung (II). Das bedeutet, dass die Betroffenen das Geschehen nicht wahrhaben wollen und deshalb versuchen, die Erinnerungen zu vermeiden. Die unwillkürliche Überflutung von Erinnerungen in Form von Bildern und Gedanken (Intrusionen) folgt in der Phase III. Erst wenn Vermeidung und Intrusionen dosiert möglich sind, beginnt die Verarbeitung (Phase IV).
Vermeidung und Intrusionen sind beide nötig, um eine Verarbeitung in die Wege zu leiten. Intrusionen sollen kognitive Verarbeitungsprozesse anregen. Jedoch bergen sie die Gefahr der Retraumatisierung. Dies versucht die Vermeidungsstrategie zu verhindern, indem sie überwältigende Gefühle blockiert. Dieses Hin- und Herbewegen zwischen den Phasen führt zur schrittweisen Bearbeitung und schließlich zur Integration in das Leben des Betroffenen. Nur wenn diese dosierte Bewältigung gelingt, kommt es zur Genesung, ansonsten beginnt der traumatische Prozess (Fischer/ Riedesser 2003, 97 ff; Butollo et al.1999, 93 f).
3.5 Traumatischer Prozess
Nach dem Modell von Horowitz (Abb.3 in Kapitel 3.4) liegt die pathologische (krankmachende) Reaktion in extremer Vermeidung oder in extremer Intrusion. Das Ungleichgewicht beziehungsweise die überdimensionalen Erlebensweisen in den jeweiligen Phasen wirken pathogen. Bering et al. (Bering et al. 2002a, 4) modifizierten ein Modell von Post et al., welches Symptomentwicklungen der Übererregung oder dem übermäßigen Vermeidungsverhalten zuschreibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 4: Begleiterkrankungen durch den traumatischen Prozess
Quelle: Bering et al. 2002a, 4
Demnach zeigen Patienten bei vorwiegender Übererregung (obere Hälfte der Abb.4) Suchtentwicklungen (Selbstmedikation), aber auch Impulsstörungen (Aggressionen und Überreaktionen) sowie Angst und Panikstörungen.
Das Vermeidungsverhalten (untere Hälfte der Abb.4) zeigt in extremem Ausmaß Somatisierungsstörungen, Depressionen bis hin zum Verlust von Gefühlen. Die jeweiligen Entwicklungen sind als Kompensationsversuche zu sehen, die anfangs hilfreich erscheinen, aber im Laufe der Zeit jedoch destruktiv wirken.
Nathan (in Fischer und Riedesser 2003, 124 f) untersuchte Patienten einer psychosomatischen Station auf den Entwicklungsverlauf von Traumata und entdeckte typische Verlaufsmuster. Diese Muster werden traumakompensatorische Schemata genannt:
So versucht der Sucht-Verlaufstyp mit Hilfe von Drogen oder Alkohol intrusive Erinnerungen zu unterdrücken.
Selten fand sich der PTBS- Angsttyp, da die Angststörung in der Regel schon früh behandelt wird.
Der PTBS-Vermeidungstyp versucht Angstzustände zu verhindern. Der Zusammenhang zwischen der vorhandenen Angstsymptomatik und dem auslösenden Ereignis ist jedoch nicht mehr nachvollziehbar.
Amnesie (Gedächtnisverlust), Derealisation und Depersonalisation sind die Hauptsymptome bei dem Dissoziationsverlaufstyp. Hintergrund hierfür sind vor allem Kindheitstraumata (in Fischer und Riedesser 2003, 125 f) .
Daneben existiert noch eine gesellschaftlich anerkannte Form der Kompensation: der leistungskompensatorische Verlaufstyp. Mit Hilfe von übermäßigem Arbeiten gelingt es den Betroffenen oft über Jahre, sich vor intrusiven Erinnerungen zu schützen. Jedoch treten hier somatoforme Störungen in Form von Schmerzzuständen und depressiven Verstimmungen auf.
Eine weitere Form ist der dissoziationsarme Typ mit neurotischer Konfliktverarbeitung. Dieser berichtet wenig von Dissoziationen. Neurotische Konfliktsverarbeitungsmuster, die bereits in der Kindheit entstehen, erschweren hier die Verarbeitung von Traumata (in Fischer & Riedesser 2003, 126 f).
Pathogene Entwicklungen sind auch durch dysfunktionale kognitive Bearbeitungsmuster bestimmt. Nach Ehlers (in Butollo et al. 1999, 125) geschieht das bereits während des Traumas durch den Verlust der inneren Autonomie und der daraus empfundenen Handlungsunfähigkeit. Wichtig ist aber auch, welche Bedeutung der Betroffene dem Geschehen im nachhinein zumisst und mit welchen Gedanken er das Trauma bearbeitet. Interpretiert er das Geschehen als repräsentativ für sein Weltbild, kommt er zum Ergebnis, dass die Welt insgesamt böse und gefährlich ist. Das führt zu erhöhter Wachsamkeit und misstrauischer Anspannung (in Butollo et al. 1999, 125 ff).
Schädigend ist es auch, wenn die betroffene Person eigene Handlungsweisen während des Traumas verurteilt und seiner Person die Verantworung für das Geschehen zuschreibt. Die daraus entstehenden Scham- und Schuldgefühle können den Bearbeitungsprozess negativ beeinflussen. Vor allem deshalb, weil dadurch nicht der unterstützende Kontakt gesucht wird, sondern die Betroffenen sich zurückziehen (Butollo et al. 1999, 131 ff).
Aber auch die Bewertung der Intrusionen können die Bearbeitung erschweren. Zu wissen, dass diese Erlebnisse normal sind und zum Prozess dazugehören, wirkt entlastend (Butollo et al. 1999, 127 f).
Hilfreich ist insgesamt eine neutrale Sichtweise, welche die Erfahrung nicht verallgemeinert, sondern einordnet als erlebte Ausnahmesituation, die nicht in Verbindung mit dem Selbstwert steht (Hausmann 2006, 46; Fischer/Riedesser 2003, 74, 99 und 129; Butollo et al. 1999, 125 ff).
Das Trauma erschüttert das Selbst in einer Tiefe, die eine Reorganisation notwendig macht (Butollo et al. 2002, 91). Das Selbstverständnis muss neu aufgebaut werden. Hier können nahestehende Personen unterstützend wirken, denn nach Buber (2006, 32) entsteht das Ich in der Begegnung mit dem Du. Persönliche Beziehungen können deshalb modulierend den Bearbeitungsprozess fördern.
Die Anerkennung als Opfer sowie Wiedergutmachungen durch die Gesellschaft führen zur subjektiven Beendigung der Traumatischen Situation. Dadurch ist die Würde des Opfers sowie die Gerechtigkeit (Weltverständnis) wiederhergestellt (Fischer & Riedesser 2003, 63 f und 75; Maercker und Müller in Maercker /Rosner 2006, 12).
Nicht nur für die kognitive, sondern auch für die emotionale Bearbeitung ist die Unterstützung durch andere Menschen essentiell.
Der Umgang mit den intensiven Gefühlen kann dabei extreme Ausmaße annehmen. Entweder versuchen Betroffene Emotionen auszuweichen (Vermeidungsverhalten), was bis zum Verlust der Emotionsfähigkeit führen kann, oder aber sie entladen sich in unkontrollierten Wutausbrüchen und Aggressionen (Monson et al. 2006, 106).
Der Umgang mit Emotionen wird schon in der Kindheit gelegt. Die Fähigkeit zur Selbstberuhigung entsteht während des Bindungsverhalten im ersten Lebensjahr. Durch die Erfahrung der Sicherheit und des Trostes bei der Mutter entwickelt das Kind das Zutrauen in sich selbst und die Fähigkeit sich selbst zu beruhigen, aber auch mitzufühlen (Brisch und Bartholomew/ Horowitz in Huber 2003, 89 f und 92). Ist dieses sichere Bindungsverhalten nicht vorhanden, erschwert dies den Umgang mit den überwältigenden Emotionen.
Angehörige müssen belastbar sein, um mit den Betroffenen zusammen diese Gefühle aushalten zu können (Fischer & Riedesser 2003, 158; Butollo et al. 2002, 119).
Ein Trauma entsteht in einem Prozess, der von vielen Einflussfaktoren geprägt ist. Das sind zum einen die objektiven Situationsfaktoren des belastenden Ereignisses, aber auch die subjektiven Faktoren während und nach dem Ereignis, sowie die sozialen Faktoren, die modulierend oder schädigend und somit aufrechterhaltend in den Prozess eingreifen (Abb. 1 in Kapitel 3).
4 Risiko und Schutzfaktoren bei der Traumaentstehung
Da nicht jeder ein Trauma nach einem belastenden Ereignis entwickelt, sollen nun Risiko und Schutzfaktoren benannt werden, die Einfluss auf die Traumatisierung beziehungsweise auf deren Bewältigung nehmen. Diese finden sich sowohl bei den auslösenden als auch subjektiven und sozialen Faktoren.
4.1 Risikofaktoren
Schädigende Einflussmöglichkeiten lassen sich einordnen in prätraumatische (vor dem Trauma vorhandene), peritraumatische (während des Traumas entstandene) und posttraumatische (nach dem Trauma entstandene) Risikofaktoren.
a) Prätraumatische Risikofaktoren
Zu den prätraumatischen Risikofaktoren zahlen beispielsweise das Lebensalter bei der Traumatisierung (Kapitel 1), niedrige Intelligenz, wodurch kognitive Bearbeitung erschwert ist, sowie weibliches Geschlecht. Der Grund für Letzeres ist nicht geklärt. Huber (2003, 83) vermutet, dass dies auf die sexuelle Gewalt zurückzuführen ist, von der vorwiegend Mädchen und Frauen betroffen sind. Dagegen spricht, dass Bering et al. (2006, 61) bei Banküberfällen ebenfalls ein erhöhtes Risiko der Traumatisierung bei Frauen nachweisen konnten.
Fischer/Riedesser (2003, 150 f) sehen den Persönlichkeitsstil als wichtigen Faktor, weil daraus sich die Copingstrategie entwickelt.
Weitere Stressoren wie vorhandene körperliche oder psychische Erkrankungen sowie familiäre Vorbelastungen beispielsweise durch Holocausterfahrungen zählen ebenfalls zu den prätraumatischen Risikofaktoren (Hausmann 2006, 84 f).
b) Peritraumatische Risikofaktoren
Zu diesen zählen die Traumaschwere, Traumadauer sowie der erlebte Kontrollverlust (Huber 2003, 83; Kontrollverlust in Kapitel 3.3).
Bering et al. (2006, 62) zählen außerdem die erlebte Dissoziation dazu. Bei einer Metaanalyse von Brewin et al. (in Bering et al. 2006, 63) wird diese jedoch nicht unter den 14 wichtigsten Risikofaktoren aufgeführt.
[...]
[1] Kühn, M. (2007): Wir können auch anders. Anmerkungen zu einem interdisziplinierten Verständnis von Trauma in Kindheit und Pädagogik. Vortrag bei dem Seminar : Traumata und die Folgen – posttraumatische Belastungsstörungen als Herausforderungen in der Jugendhilfe an derSchnittstelle zur Psychiatrie vom 16. – 18.4.07 in Silberbach unter www.traumapädagogik.de vom 30.06.07, 1 - 13
- Arbeit zitieren
- Diplom- Sozialpädagogin/ Diplom-Sozialarbeiterin Christa Dangendorf (Autor:in), 2007, Trauma und die Folgen. Ursachen und Auswirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81590
Kostenlos Autor werden















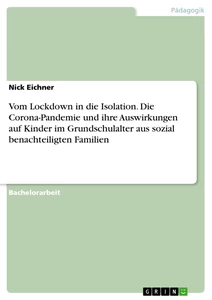

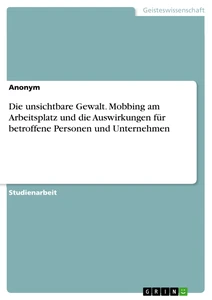



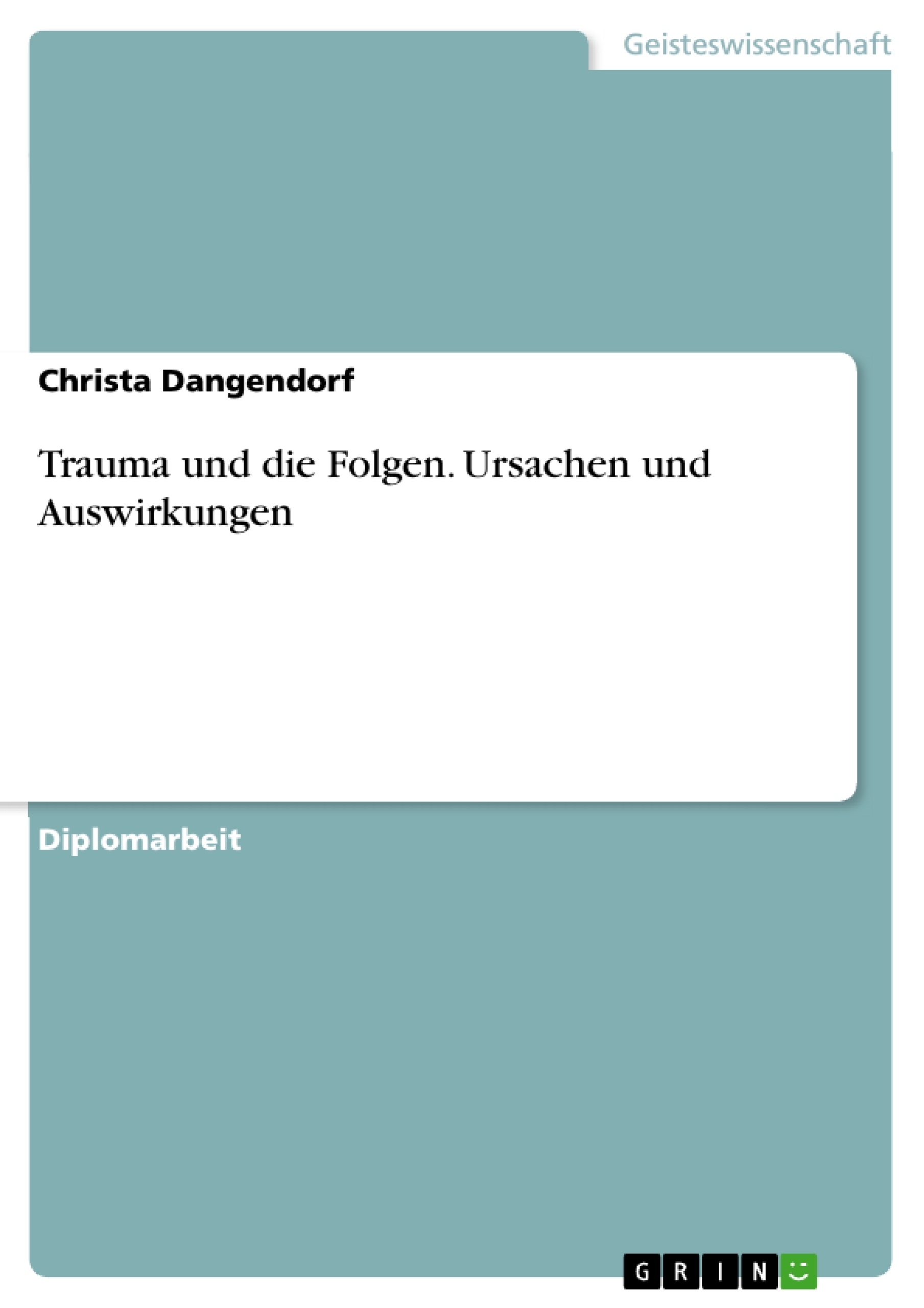

Kommentare