Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1 Der Begriff des Absurden in der Philosophie
1.1 Lexikalische und philologische Annäherung
1.2 Ontologische Deutung
1.2.1 Das Absurde zwischen Religion und Existentialismus
1.2.2 Glauben weil es absurd ist (Kierkegaard)
1.2.3 Der Verlust metaphysischen Sinns (Nietzsche)
1.2.4 Die absurden Mauern (Camus)
1.3 Dialektische Deutung
1.3.1 Aufklärung als Absurdität
1.3.2 Der moderne Mensch
1.4 Ambivalente Begriffswelt: Grenzen der Sprache
1.5 Das ästhetische Prinzip und die Musik
2 Das Absurde in Literatur und Theater
2.1 Anfänge und Entwicklung
2.1.1 Das Tragisch-Absurde: Shakespeare & der Manierismus
2.1.2 Die vielfältigen Formen des Absurden
2.1.3 Franz Kafka – die Verkörperung des Absurden
2.2 Das Existentialistisch-Absurde
2.2.1 Indifferenz – Niedergang von Subjekt und Erzählung
2.2.2 Das Absurde als das Unberechenbare bei Sartre
2.2.3 Objektivierung der Handlung bei Camus
2.3 Das Theater des Absurden
2.3.1 Bildungskultur ad absurdum
2.3.2 Reduktion von Handlung und Figuren
2.3.3 Sprachentwertung
2.3.4 Der Sinn des Absurden
3 Das Absurde im Film
3.1 Die Lächerlichkeit des modernen Menschen
3.1.1 Chaplin, Keaton und die Stummfilmkomödie
3.1.2 Kubricks Komödie der Selbstvernichtung
3.2 Absurde Tendenzen im europäischen Kino
3.2.1 Verdinglichung und Stillstand bei Antonioni
3.2.2 Die Nouvelle Vague bricht mit der klassischen Erzählung
3.2.3 Jean-Luc Godards Spiel mit filmischen Zeichen und Sinn
3.2.4 Zufall und Sinnestäuschung bei Buñuel
3.2.5 Skandinavische Absurde: Befreiung und Groteske
3.3 Roman Polanskis absurde Genre-Parodien
3.4 Kriterienerstellung für die Filmanalyse
3.4.1 Zwischen Tragödie, Komödie und Existentialismus
3.4.2 Der gleichgültige Held
3.4.3 Kunst und insbesondere Musik als Fluchtmöglichkeit
3.4.4 Sprachentwertung
3.4.5 Zufälligkeit und Verkehrung der Handlung
3.4.6 Subjektverlust und Schuldmotiv
3.4.7 Subtile Dekonstruktion von Wirklichkeit
3.4.8 Demontage der Mythen
3.4.9 Verweigerung einer eindeutigen Sinnvorgabe
4 Einordnung des Coen-Werkes
4.1 Raum für Irritationen – Biographisches
4.2 Zum Begriff der Postmoderne
4.2.1 Auf den Spuren von Nietzsche, Kafka, Beckett
4.2.2 Funktionalität statt Sinnproduktion
4.2.3 Zur Differenzierung filmischer Selbstreferentialität
4.2.4 Die Coens thematisieren die Oberflächenlogik
4.3 Im Zeichen des Absurden: Das Werk der Coens
4.3.1 Der absurde Held
4.3.2 Kafkaeske Konstruktionsmuster
4.3.3 Im Labyrinth der Zeichen
4.3.4 Demontage der Mythen
4.3.5 Der verhinderte Autor
4.3.6 Auflösung der Wirklichkeit
4.3.7 „Am Randes des Nichts“: Verweigerte Sinnvorgabe
5 Filmanalyse: The man who wasn’t there
5.1 Produktionsnotizen
5.2 Struktur und Synopsis
5.3 Prüfung der Kriterien des Absurden
5.3.1 Tragik-Komische Annäherung: Die absurde Perspektive
5.3.2 Kausale Annäherung: Im Strudel des Irrationalen
5.3.3 Selbstreferentielle Annäherung: Nur scheinbar ein Noir
5.3.4 Existentielle Annäherung: Der gleichgültige Held
5.3.5 Sprachkritische Annäherung: Worte ohne Sinn
5.3.6 Musische Annäherung: Flucht in die Musik
5.3.7 Fatalistische Annäherung: Verdinglichte Schuld
5.3.8 Subjektivistische Annäherung: Erkenntnisunfähigkeit
5.4 Kafka, Camus, Coens: Ein Deutungsversuch
5.4.1 Abwesenheit von Sinn: the medium is the message
5.4.2 Auflösung im Zeichensystem: der Hyperrealismus
5.4.3 Amputation der Sinne: Künstlichkeit kein Kunstfehler
Resümee und Ausblick
Anhang: Sequenzprotokoll
Primärquellen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Das Thema des Absurden ist nicht neu, und doch könnte man zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Gefühl bekommen, das Absurde habe Konjunktur. THE MAN WHO WASN’T THERE (2001) von Joel und Ethan Coen ist dafür ein Beispiel. Das postmoderne Kino, das seit jeher Seherfahrungen rekapituliert, ist zu einem absurden Spiel mit Zitaten und Versatzstücken der Filmgeschichte geworden, in dem die Künstlichkeit als Selbstzweck erscheint und in dem jeder Sinn negiert scheint. Ausgangspunkt dieser cineastischen Entwicklung sind die 1960er Jahre, in denen das Fernsehen in die Haushalte kam und über die Lorenz Engell schreibt:
Der gesellschaftliche Sinnhaushalt hat sich in diesem Zeitraum regelrecht verkehrt. In einem ästhetischen Kontext, der offenbar von den Phänomenen der Sinnzerstreuung, Sinnvernichtung, und Sinn-Negation eher geprägt ist als von der traditionellen Sinnerzeugung, muß sich wohl auch die filmhistorische Konstruktion von Sinnzusammenhängen nach ihren Verfahrensweisen und ihrem Stellenwert fragen lassen. (Engell 1992, S. 289)
Mit THE MAN WHO WASN’T THERE scheint die postmoderne Selbstreflexivität endgültig einen Punkt erreicht zu haben, der kaum mehr zu steigern ist. Dem gegenüber steht ein Held, der kaum mehr eine emotionale Identifikation erlaubt und der in seiner Indifferenz an den Helden in Camus’ Schlüsselroman Der Fremde erinnert. Es ist der Aspekte einer gleichgültigen Kunstfigur und jene Frage nach dem Sinn, die eine Verbindung zum Absurden herstellen.
Denn das Wesen des Absurden ist die Frage nach Sinn bzw. Nicht-Sinn, die sich der Mensch wohl seit jeher stellt. Die Mechanismen, mittels derer Sinn konstruiert wird, dessen illusionären Charakter und die in den widersprüchlichen Sinndiskursen begründete Absurdität der gesellschaftlichen Ausrichtung aufzuzeigen, ist das Anliegen vieler Künstler des Absurden gewesen. Dabei ist das kulturelle Zeichen, mit dem ein Sinn konstituiert wird, jene Einheit, die das Absurde in Frage stellt, und die in der Postmoderne angesichts der medialen Explosion zum Gehalt der Verhandlungen geworden ist.
Doch wenn es dem Absurden noch darum ging, hinter die Zeichen zu schauen, um auf das Absurde, das Nichts hinter all den Begriffen und Bildern zu verweisen, geht es in der Postmoderne nur noch um den ironischen Zugriff auf eine Welt, die angesichts ihrer vielen Diskurse den Blick für alle Erkenntnis verstellt hat. Das Prinzip Sinn hat ausgedient und die Auswirkungen dieser kontinuierlichen Entwicklung auf das Innere des Menschen hat das Absurde immer darzustellen versucht. Daher liegt es auf der Hand, die philosophische Deutung und die künstlerische Umsetzung ausgehend von den Anfängen des Absurden bis zu einem Film wie THE MAN WHO WASN’T THERE nachzuvollziehen, um zu verstehen, worum es den Coen-Brüdern in ihrem Kino geht.
Die Schwierigkeit dieser Untersuchung liegt darin begründet, dass das Absurde keine Epoche bzw. Gattung ist, wie etwa die Romantik oder der Surrealismus. Einzig das Theater des Absurden hat sich als eine eigenständige Gattung etabliert, die das Absurde im Namen trägt. Seit den griechischen Dramatikern gab es aber immer wieder Epochen, in denen Denker und Künstler das Absurde ins gesellschaftliche Bewusstsein rückten, so zu Zeiten Shakespeares Ende des 16. Jahrhunderts; so mit Dostojewski, Strindberg und Nietzsche in der Mitte bzw. gegen Ende 19. Jahrhunderts; im 20. Jahrhundert schien die Thematik des Absurden gar nicht mehr von der Bildfläche verschwinden zu wollen, von Kafka ausgehend über die Existentialisten in den 30er Jahren bis hin zu dem Theater des Absurden in den 60er und 70er Jahren. Es wird eine der Fragen dieser Arbeit sein, womit dies zusammenhängt.
Dabei wären vielfältigste Erscheinungsformen, Motive und Einflüsse zu nennen, die alle auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt mit dem Absurden in Verbindung stehen, ohne die das Absurde nicht zu denken wäre und die man trotzdem selten auf einen Nenner bringen kann. Deshalb hat es sich der erste Teil dieser Arbeit zum Ziel gesetzt, das Absurde in der Philosophie, in der Literatur, im Theater und im Spielfilm aufzuzeigen, wobei es vor allem darum geht, die Kriterien für die Filmanalyse herzuleiten, aber auch darum, dem Leser ein Gefühl für das Absurde zu vermitteln, ihn zu sensibilisieren für diesen so wagen Begriff, um im zweiten Teil die Einflüsse auf die Postmoderne und ihre Kunst erkennen zu können. Konkret sollen diese schließlich an dem Werk der Coen-Brüder aufgezeigt, und an ihrem Spielfilm THE MAN WHO WASN’T THERE nachgewiesen werden.
1 Der Begriff des Absurden in der Philosophie
1.1 Lexikalische und philologische Annäherung
Umgangssprachlich wird das Wort absurd im Sinne von „lächerlich“ gebraucht (Esslin 1967, S. 16), oder als Synonym für „verrückt“ oder „unzumutbar“ (Hildesheimer 1976, S. 174). Von Absurdität reden wir in der Regel, wenn eine „Unangemessenheit zwischen Möglichkeit und Ziel“ besteht (Janke 1982, S. 82).
Nach Kluges Etymologischen Wörterbuch ist das Wort Ausdruck für etwas „Widersinniges“ (Görner 1996, S. 1). William J. Jonas konnte das Wort absurd in der Bedeutung von „ungereimt“ in deutschen Texten des frühen 17. Jahrhunderts orten (ebd.). Anders Heinsius vermerkte 1818 in seinem Volkstümlichen Wörterbuch der deutschen Sprache, dass absurd gleichbedeutend mit „ungereimt“ und „abgeschmackt“ sei (ebd.). Das moderne Lexikon definiert absurd als „sinn- und vernunftwidrig, ungereimt, unlogisch“ (Bertelsmann 1998, S. 13), „dem gesunden Menschenverstand widersprechend“ (Fremdwörterbuch 1990, S. 24).
Der Begriff absurd ist als Lehnwort um 1600 ins Deutsche eingegangen und geht hervor aus dem lateinischen absurdus („grell, misstönend, sinnlos, unbegabt“), das sich wiederum von surdus („taub, unempfindlich, lautlos“) ableitet (Pongs 1990, S. 5) und allgemein auf ein lautmalerisches susurrus („Zischen“) zurückgeführt wird. Es stand ursprünglich für einen Misston im musikalischen Kontext (Görner 1996, S. 1), ein Laut, der dem Ohr zuwider war, ein Verstoß gegen Harmonie oder Komposition (Haug 1966, S. 15). Daher wird das Absurde auch als Disharmonie mit dem Vernünftigen und Angemessenen definiert (Esslin 1967, S. 16).
Absurd ist also ursprünglich ästhetischer Qualität und zeugt von einer primär sinnlichen Erfahrung (Görner 1996, S. 1). Bezeichnenderweise wurde das Dissonante, das einen unstimmigen Zusammenklang von Tönen (Schwingungen) bezeichnet und nach der Harmonielehre Auflösung fordert (Fremdwörterbuch 1990, S. 192), in der Moderne nicht nur anerkannt, sondern sogar Zeichen des guten Geschmacks. Theodor W. Adorno bezeichnet die Dissonanz als „Signum aller Moderne“ (Adorno 1995, S. 29), womit sich bereits die Verwandtschaft zwischen Moderne und Absurdem andeutet.
Vilém Flusser führt seine philosophische Autobiographie Bodenlos (1992) mit drei Deutungen des Wortes absurd ein. Er deutet es als ursprünglich „bodenlos, im Sinn von ‚ohne Wurzel’. Etwa wie eine Pflanze bodenlos ist, wenn man sie pflückt, um sie in eine Vase zu stellen. Blumen auf dem Frühstückstisch sind Beispiele eines absurden Lebens“ (Flusser 1992, S. 9). In der Regel sieht Flusser das Wort aber in der Bedeutung von „sinnlos“: „Etwa wie das Planetensystem bodenlos ist, wenn man fragt, warum und wozu es sich um die Sonne dreht in der gähnenden, abgründigen Leere des Weltalls.“ Der Lauf auf ihren Bahnen sei ein Beispiel absurden Funktionierens, wobei man verleitet wäre, das Planetensystem mit unseren Verwaltungssystemen zu vergleichen. Die sinnlose Kreisbewegung mit dem Nichts als Hintergrund sei die Stimmung des absurden Lebens (ebd.). Zuletzt stellt Flusser das Wort absurd in den Bereich der Logik. Etwas „ohne vernünftige Basis“ führe zum absurden Denken: „Man hat dabei das schwindelnde Gefühl, über einem Abgrund zu schweben, in dem die Begriffe ‚wahr’ und ‚falsch’ nicht funktionieren“ (ebd.). Die Stimmung des bodenlos-absurden deutet er als jene, in der Religionen entstanden sind, um in der Bodenlosigkeit Halt zu geben. Aber sie gefährde auch die Religionen, denn der Halt werde darin von der „ätzenden Säure der Bodenlosigkeit zerfressen“ (ebd., S. 10).
Die Redewendung, etwas ad absurdum führen bezeichnet eine Methode, bei der man die Unhaltbarkeit einer Auffassung beweist, indem man zeigt, „daß sich aus ihr sinnlose oder selbstwidersprüchliche Folgerungen zwingend ergeben“ (Hügli/Lübcke 1997, S. 23). Der Begriff Absurdität könnte als die einfache Substantivierung einer absurden Situation bzw. eines absurden Sachverhaltes betrachtet werden, während das Absurde jene philosophische Position, bzw. künstlerische Richtung benennt, die in dieser Abhandlung besprochen wird.
1.2 Ontologische Deutung
1.2.1 Das Absurde zwischen Religion und Existentialismus
Der Mensch begreift jetzt, daß er ein bloßer Zufall ist, ein völlig zweckloses Geschöpf, welches das Spiel zu Ende spielen muß – ohne irgendeinen Grund. (zit. nach Haug 1966, S. 10)
Drückt sich in dieser Auffassung eines englischen Malers die Position des Absurden aus? Wie ist eine solche Ansicht zu werten; erscheint das Unsinnige als Positivität oder als Negativität?
Eines wird in der vielfältigen Literatur zu dem Thema deutlich: Bei Interpreten, Philosophen und Künstlern des Absurden liegt oft nur ein Gleichklang des Wortes vor, trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte und Bedeutungsgehalte. Das Absurde ist durch Definitionen nicht festlegbar. Es ist nicht in Begriffe zu bannen und zu kontrollieren. Es kann nicht nur das Resultat gedanklicher Anstrengung sein, nicht nur das Ergebnis philosophischer Bemühungen, es ist auch ein Lebensgefühl: „Das Absurde ist einer der wenigen Begriffe, in denen Alltagserfahrung und philosophische Sprache sich zwanglos begegnen“ (Kühneweg 2000).
Picard versteht unter dem Absurden noch eine „alogische Gewißheit“ im religiösen Sinne, eine „positive Qualität“, die über dem Logischen und primär Wahrnehmbaren „ein besonderes Vermögen signalisiert, durch das der Mensch sogar erst seine eigentliche Bestimmung erlangt“ (Picard 1978, S. 6). Ionesco verbindet den Terminus mit dem Verlust von religiösem Halt: „Absurd ist etwas, das ohne Ziel ist ... Wird der Mensch losgelöst von seinen religiösen, metaphysischen oder transzendentalen Wurzeln, so ist er verloren, all sein Tun wird sinnlos, absurd, unnütz, erstickt im Keim“ (zit. nach Esslin 1967, S. 16). Das Absurde ist Konstrukt, so Haug, der den Widerspruch im modernen Absurdismus darin sieht, dass „der vermeintlich unmittelbare Ausdruck der Enttäuschung an Struktur schlechthin … selber konstruiert ist“ (Haug 1966, S. 36).
Drei Positionen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Da man das Absurde nicht greifen, nicht anfassen kann, liegt es nahe, es nicht in der Welt, sondern vielmehr im Denken zu suchen, wie auch Goethe das Wuchern der Phantasie als Quelle ausmachte: „Die Einbildungskraft lauert als der mächtigste Feind, sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Trieb zum Absurden“ (zit. nach Görner 1996S. 13). Konkret bestimmt Görner: „Das Absurde ist eine Verhältnisbestimmung. Es gibt nichts ‚an sich’ Absurdes, sondern nur Beziehungen, die man als absurd deutet“ (Görner 1996, S. X).
Eine Annäherung an das Absurde gewährt das biblische Buch Hiob. Hiob versteht angesichts der scheinbaren Willkür die Welt nicht mehr, er spottet Gott und verflucht sein Leben. Er leidet, verfällt in Gleichgültigkeit:
Mir ist jetzt alles gleich, drum sprech ich’s aus,
selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere:
Daß ich im Recht bin, hilft mir nichts bei ihm;
Ob schuldig oder nicht – er bringt mich um!
Wenn plötzlich eine Katastrophe kommt
Und Menschen ohne Schuld getötet werden,
hat Gott für ihre Ängste nur ein Lachen.
(Hiob 9.21-23)
Dermot Cox behauptet in The Triumph of Impotence. Job and the Tradition of the Absurd (1978), Hiob sei der erste gewesen, der das Absurde im Glauben entdeckt habe (vgl. Görner 1996, S. 136). Ionesco weist gar auf eine Verbindung des biblischen Mythos zum Theater des Absurden hin:
Der Wert von Becketts Endspiel zum Beispiel liegt darin, daß es dem Buch Hiob näher steht als dem Boulevard-Theater oder den chansoniers. Dieses Werk hat über den Abgrund der Zeit hinweg, durch die vergänglichen Phänomene der Geschichte hindurch eine weniger vergängliche archetypische Geschichte wieder entdeckt, eine Ursituation, aus der alle anderen sich ableiten … Ja, König Salomon ist der Führer der Bewegung, der ich folge; und Hiob, jener Zeitgenosse Becketts. (zit. nach Esslin 1967, S. 360)
Goethe, der sich vom Buch Hiob zur Einführungswette im Faust inspirieren ließ, verbindet das Absurde mit etwas Unbestimmtem, mit Unwissen, was er geradezu als eine Bedrohung ansah: „Nichts schrecklicher kann dem Menschen geschehen, als das Absurde verkörpert zu sehen“ Der Grund für die Goethesche Aversion könnte in seinem tiefen Unbehagen gegen alles Inkongruente gelegen haben, so Görner (zit. nach Görner 1996, S. 12). Genau dort beginnt nämlich die Problematik des Absurden, „was irrational und – sagen wir es ruhig: schlechterdings absurd wird, ist die Sehnsucht nach dem Erfassen des Unfaßlichen“ (zit. nach Haug 1966, S. 100).
Zur eigentlichen Auseinandersetzung mit dem Absurden kam es insbesondere durch Sören Kierkegaard, dem Vater der Existenzphilosophie, und durch Friedrich Nietzsche, der entscheidende Aspekte der existentialistisch-absurden Denkrichtung vorwegnahm. Der Existentialismus behauptet die Beziehungs- und Bindungslosigkeit der Existenz, die Absurdität des Seins. Weil der Mensch nicht von einer absoluten Idee, einer Wesenhaftigkeit außerhalb der individuellen Existenz gelenkt wird, erscheint das Dasein als absurd, als widersinnig und sinnlos. Nachdem die Religion und der Gottesbegriff ihren Wert als Sinngarant eingebüßt haben, erkennt der moderne Mensch die reine Zufälligkeit des Universums. Er ist auf sich selbst zurückgeworfen, ohne den Grund seiner Existenz zu begreifen. Es könnte, sagt Heidegger, an Stelle des Seins auch Nichts sein. Angesichts dessen erfährt der Einzelne, schon bevor er sich denkend zurechtzufinden sucht, Ekel, Langeweile, Angst.
1.2.2 Glauben weil es absurd ist (Kierkegaard)
Soviel ich das Leben betrachte, ich kann keinen Sinn hineinbringen. Ich glaube, mir hat ein böser Geist eine Brille auf die Nase gesetzt, von deren Gläsern das eine in ungeheurem Maßstab vergrößert, während das andere im selben Maßstab verkleinert. (Sören Kierkegaard: zit. nach Haug 1966, S. 19).
Im Sinne von Fritz Haug, der das Absurde als „Theologie der Enttäuschung“ (Haug 1966, S. 15) bezeichnet, wird für den Theologen Kierkegaard der christliche Glaube zum Auslöser und Angelpunkt seines verzweifelten Ringens um Erkenntnisfähigkeit. Er sah eine offenbare Absurdität in der Verbindung der zeitlich begrenzten Erscheinung Christi zur ewigen Wahrheit. Das Ereignis stehe für den zeitlich Existierenden außerhalb jedes Fassungsvermögens. Eine solche Möglichkeit kann weder gedacht werden, noch kann sie Wirklichkeit und Sinn stiften, sie kann nur mehr im unbegründbaren, das Denken suspendierenden „Sprung“ in den Glauben, angeeignet werden (vgl. Kierkegaard 1989, S. 42ff).
Kierkegaard folgt damit dem Credo quia absurdum (Ich glaube, weil es absurd ist). Der Ausspruch, der die Vorrangigkeit des Glaubens gegenüber der Vernunft einräumt, wird Tertullian, dem Kirchenschriftsteller des zweiten Jahrhunderts, zugeschrieben, und bezeichnet den Glauben an einen Gegenstand oder Vorgang, der aller logischen und realen Erfahrung widerspricht (vgl. Picard 1978, S. 5).
Für Kierkegaard wird die biblische Geschichte des Abraham zum Beispielfall eines Glaubens im Absurden. Die Frage, was Abraham antrieb, seinen Sohn zu opfern, ist Ausgangspunkt seiner Überlegungen: „Er glaubte kraft des Absurden; denn von menschlicher Berechnung konnte da nicht die Rede sein, und das war ja das Absurde, dass Gott, als er das von ihm forderte, im nächsten Augenblick die Forderung widerrufen sollte“ (Kierkegaard 1992, S. 31).
Das Absurde ließe sich also nach Kierkegaard als eine Abkehr vom Verstehen und dem gleichzeitigen Übergang ins Paradox des Glaubens betrachten. Es gehöre nicht zu den Unterscheidungen, „die innerhalb des dem Verstande zugehörigen Bereichs liegen“ (1992, S. 42). Es steht im Zusammenhang mit dem „absoluten Paradox“, dem Bewusstsein, dass jeder Versuch einer Welterkenntnis oder Weltklärung auf die Grenzen des Denkbaren stößt: „Es gibt eine Weltanschauung, derzufolge das Paradox höher steht als jedes System“ (Kierkegaard 1992, S.141). Für ihn ist die „höchste Leidenschaft des Verstandes, den Anstoß zu wollen, obgleich der Anstoß in dem einen oder anderen Sinne sein Untergang sein muß. Das also ist das höchste Paradox des Denkens, etwas entdecken zu wollen, was es nicht selbst denken kann“ (Kierkegaard 1989, S. 36). Das Denken findet keinen Halt in den Widersprüchen des Daseins, es entgeht dem Absurdismus nur unter der Bedingung, dass es sich im Glauben aufhebt. In seiner späteren Auffassung wertete Kierkegaard das Absurde nicht mehr nur als Prädikat, sondern geradezu als Bedingung. Der Glaube wäre „obsolet“, so Kierkegaard, wenn es das Absurde nicht gebe (vgl. Görner 1996, S. 16).
1.2.3 Der Verlust metaphysischen Sinns (Nietzsche)
Mit Friedrich Nietzsche kam ein prinzipiell neues Deutungsmuster des Absurden zur Geltung, das für die Moderne konstitutiv wurde. Das Absurde verstand er nicht mehr als Ergebnis, sondern als Ausgangspunkt des Denkens, nicht die Objektivität bestimmt den Kern des Subjektiven als absurd, sondern das Subjekt verwirft die Welt als chaotisch und sinnlos (vgl. Görner 1996, S. 20).
Nach Bianca Rosenthals Abhandlung Die Idee des Absurden: Friedrich Nietzsche und Albert Camus (1977) ergibt sich für beide Autoren ein gemeinsamer Ansatzpunkt aus dem Verlust religiöser Formen. Nietzsche und Camus lehnen die Formel credo quia absurdum als Selbstbetrug ab. Nach ihnen könne nur eine gottlose Welt als wirklich absurd erlebt werden. Der Nietzsche-Satz, „Gott ist tot!“ (Nietzsche 1990, Bd. 2, S. 466), ist nicht nur als eine objektive, auf das Ersterben Gottes im europäischen Bewusstsein bezogene Feststellung zu sehen, sondern als die Zusammenfassung eines Prozesses, in dessen Verlauf schließlich jede Geisteshaltung, Ideologie und Philosophie verworfen, jeder Wert negiert wird, bis zuletzt kein Wert mehr als absolut gilt. Das Phänomen des Absurden resultiert aus der Verneinung Gottes und damit der Verwiesenheit des Menschen auf sich selbst.
Es gebe keinen verpflichtenden Daseinssinn. Das Resultat dessen wird von Nietzsche als „Nihilismus“ bezeichnet, der Zustand der Überzeugungslosigkeit nach Entwertung aller religiösen Glaubensinhalte, Autoritäten und moralischer Gebote, bis hin zu einem Bewusstsein, das die Nichtigkeit und Sinnlosigkeit alles Seins anerkennt. Nietzsche: „Der philosophische Nihilist ist der Überzeugung, daß alles Geschehen sinnlos und umsonstig ist“ (zit. nach Rosenthal 1977, S. 37).
Die Welt begegne uns nie, wie sie wirklich ist, so Nietzsche, sie sei immer nur Interpretation. Wir sehen die Welt nur von einem bestimmten Ausschnitt her. So beurteilen wir uns falsch, was zu einer Fälschung des Gesamtbildes führt. Der Mensch legt einen Sinn in die Welt, wobei dieser Sinn einzig durch seine eigene Lage bedingt ist. Damit hebt Nietzsche jede absolute Erkenntnis auf:
Wie weit der perspektivische Charakter des Daseins reicht oder gar, ob es irgend einen anderen Charakter noch hat, ob nicht ein Dasein ohne Auslegung, ohne „Sinn“ eben zum „Unsinn“ wird, ob, andererseits, nicht alles Dasein essentiell ein auslegendes Dasein ist – das kann, wie billig, auch durch die fleißigste und peinlich-gewissenhafteste Analysis und Selbstprüfung des Intellekts nicht ausgemacht werden: da der menschliche Intellekt bei dieser Analysis nicht umhin kann, sich selbst unter seinen perspektivischen Formen zu sehen und nur in ihnen zu sehen. (Nietzsche 1990, Bd. 2, S. 615f)
Die unaufhebbare Selbstbezüglichkeit des Menschen wird für Nietzsche zum Angelpunkt der Sinnfrage. Der Mensch trifft in allem, worauf er fühlend und denkend stößt, immer nur auf sich selbst. Metaphysisch betrachtet entspricht dem, was wir als wahr betrachten, Nichts: „Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?“ (Nietzsche 1990, Bd. 2, S. 465).
Das Denken im Absurden stellt sich als radikaler Bruch mit der Wertehierarchie der antiken Bildungswelt dar. Es verkündet eine prinzipielle „Wertirrationalität des Weltlaufes“ (zit. nach Haug 1966, S. 31). Nietzsche sagt, „an sich hat keine Moral Wert“ (Nietzsche 1990, Bd. 4, S. 333). „Sind nicht alle ‚Werthe’ Lockmittel, mit denen die Komödie sich in die Länge zieht, aber durchaus nicht einer Lösung näher kommt“? (zit. nach Lütkehaus 1999, S. 305).
Sobald man erkenne, dass die Welt kein Ziel verfolgt, müsse man ihre Unschuld anerkennen, die Tatsache bejahen, dass sie nicht von unserem Urteil abhängig ist. „Wenn ein Philosoph Nihilist sein könnte, so würde er es sein, weil er das Nichts hinter allen Idealen des Menschen findet. Oder noch nicht einmal das Nichts, – sondern nur das Nichtswürdige, das Absurde“ (Nietzsche 1990, Bd. 4, S. 326f).
Im „An-sich“ gibt es nichts von „Kausal-Verbänden“, von „Notwendigkeit“, von „psychologischer Unfreiheit“, da folgt nicht „die Wirkung auf die Ursache“, da regiert kein „Gesetz“. Wir sind es, die allein die Ursachen, das Nacheinander, das Füreinander, die Relativität, den Zwang, die Zahl, das Gesetz, die Freiheit, den Grund, den Zweck erdichtet haben; und wenn wir diese Zeichen-Welt als „an sich“ in die Dinge hineindichten, hineinmischen, so treiben wir es noch einmal, wie wir es immer getrieben haben, nämlich mythologisch. (Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 557)
1.2.4 Die absurden Mauern (Camus)
1942 stellt Albert Camus abermals die grundlegend Frage nach dem Sinn des Seins und beginnt sein Werk Der Mythos von Sisyphos: Ein Versuch über das Absurde (1942) mit dem Satz: „Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord“ (Camus 1998, S. 10). Dabei gehe es um die grundlegende Frage nach dem Sinn der Existenz, alles andere käme später. Sein oder Nichtsein? – die schon von Hamlet gestellte Frage wird für Camus zum Leitfaden, die existentielle Situation des Menschen zu untersuchen.
Ihn beschäftigt die Tatsache, dass seit jeher alle Bemühungen des Menschen um eine absolute Erkenntnis vergeblich waren, der Verstand aber stets aufs Neue die Frage nach dem Absoluten aufwirft. Das Absurde ist bei Camus nicht gleichzusetzen mit dem Sinnlosen an sich, sondern beruht auf dem Widerspruch zwischen bewusstem Verlangen und gleichzeitigem Abgewiesenwerden: „Das Absurde entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt“ (Camus 1998, S. 35).
In dem Problem, dass der Mensch trotz seines Wissens um die Erfolglosigkeit, genau danach immer wieder verlangt, vergleicht Camus ihn mit Sisyphos, dem griechischen Helden des Absurden[1]. Das Herabrollen des Steins vom Gipfel verbildlicht für Camus das Scheitern des Menschen an einer Welt, die sich seinem Zugriff entzieht, sich in keiner Weise aus sich selbst erschließen lässt und damit jeden Sinnanspruch zurückweist. Er bedient sich der Metapher absurder Mauern, die für die Eingeschlossenheit des menschlichen Verstandes stehen.
Für Camus ist das Absurde nicht nur abstrakte Philosophie, sondern in erster Linie emotionale Qualität. Es ist ein Gefühl, das sich ausdrückt durch gedankliche Leere, Überdruss, Grauen oder Ekel. Das erste Anzeichen aber ist die Langeweile, womit die „Kette alltäglicher Gebärden zerrissen ist“:
Dann stürzen die Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus – das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages aber steht das ‚Warum’ da, und mit diesem Überdruß, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. ... Der Überdruß ist das Ende eines mechanischen Lebens, gleichzeitig aber auch der Anfang einer Bewußtseinsregung. (Camus 1998, S. 20)
In dieser Bewusstseinsregung, so Camus, kündigt sich ein Mangel an Sinn an, was schließlich in eine Befindlichkeit führe, in der der Mensch die Situation, in der er sich befindet, als völlig absurd wahrnimmt. Er verliert den Halt, die Welt wird ihm fremd und er stößt an die Mauern, die ihn in seinem Sinnverlangen abweisen, das Denken kann ein absolutes Sinnverlangen nicht befriedigen. Das Absurde entsteht aus dem Widerspruch polarer Ansichten, die jeweils für sich Gültigkeit besitzen, und doch nicht ohne ihren Gegensatz verstanden werden können, ja nicht einmal existieren würden.
Die offensichtlichste Absurdität ist für Camus der Tod. Das ganze Leben, alles Handeln, ist auf die Zukunft ausgerichtet, so als gebe es den Tod nicht. Und doch bringt uns jede Sekunde ihm näher, sowohl emsiges Treiben als auch totale Passivität. Die Tatsache, dass alles Streben angesichts der Gewissheit des Todes sinnlos wirkt, lässt die Frage nach dem Wozu und Warum aufkeimen. Thomas Bernhards Zitat beschreibt die Situation als eine komisch-absurde: „es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“ (zit. nach Berger 1999).
Nach Camus lässt sich das Absurde nicht überwinden, in Scheinsicherheit oder in einem anderen Sinn aufheben. Jede Form der Leugnung des Absurden, alle Versuche, es durch eine Ideologie, durch Metaphysik oder Theologie aufzuheben, seien Formen der Selbstleugnung. Die Unvereinbarkeit von Vernunft und Wirklichkeit ist für Camus die einzige Gewissheit, die zählt:
Ich kann in dieser Welt alles widerlegen, was mich umgibt, mich vor den Kopf stößt oder begeistert, nur nicht dieses Chaos, diesen König Zufall und diese göttliche Gleichwertigkeit, die aus der Anarchie erwächst. Ich weiß nicht, ob diese Welt einen Sinn hat, der über mich hinausgeht. Aber ich weiß, daß ich diesen Sinn nicht kenne und daß ich ihn zunächst unmöglich erkennen kann. (Camus 1998, S. 57)
Der absurde Mensch gewinne seine Lebenskraft gerade aus dem Widersinnigen schlechthin, aus der ständigen „Auflehnung“. Sie gebe dem Leben seinen Wert, so Camus, gleichzeitig beginnt in ihr die Erfüllung: „Der Mensch wird hier endlich den Wein des Absurden finden und das Brot der Gleichgültigkeit, mit dem er seine Größe speist“ (Camus 1998, S. 58).
Leben heißt: das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt: ihm ins Auge sehen. Im Gegensatz zu Eurydike stirbt das Absurde nur, wenn man sich von ihm abwendet. Eine der wenigen philosophisch stichhaltigen Positionen ist demnach die Auflehnung. Sie ist eine ständige Konfrontation des Menschen mit seiner eigenen Dunkelheit. Sie ist der Anspruch auf eine unmögliche Transparenz. Sie stellt die Welt in jeder Sekunde in Frage. (Camus 1998, S. 59f)
Im letzten Satz des Sisyphos heißt es: „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“ (Camus 1998, S. 128). Er geht nicht mehr auf ein von außen gesetztes Ziel zu, sondern setzt sich sein Ziel im Gehen des Weges selbst – Weg und Ziel fallen zusammen. Eine Sinngebung seines Handelns gelingt ihm, indem er sich von allen Bedingungen distanziert, die er nicht selber gesetzt hat. Der absurde Mensch tut nichts für die Ewigkeit und ist gleichgültig gegenüber Zukunft, Plänen, Entwürfen, Interessen des Alltags, den hierarchischen Unterschieden unter Menschen, dem Streben anderer (vgl. Pieper 1994, S. 13f).
Camus sieht das Erlebnis des Absurden als verlorene Einheit, als Bruch mit der Welt. Seitdem der Mensch versucht hat, die Welt in seinem Verlangen nach Wissen zu transzendieren, ist er abgetrennt vom Grund des Daseins. Das Streben nach etwas Absolutem hat den Menschen von seinem Ursprung entfernt. Nachdem er erfahren hat, dass es kein Absolutes gibt, wird ihm der Fehltritt einer Weltzersplitterung bewusst. „Das Absurde“, so Camus, „ist die Sünde ohne Gott“ (Camus 1998, S. 47). Die Camus-Forscherin Pieper schreibt: „Der Preis der Sünde ohne Gott ist die Einsamkeit. Einsamkeit als Name für den Zustand der Vereinzelung, der Isolation, der Disparatheit, kurz der äußersten Ferne von der Geborgenheit des ursprünglichen Zustands der Einheit“ (Pieper 1984, S. 84).
1.3 Dialektische Deutung
1.3.1 Aufklärung als Absurdität
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer haben die Wechselbeziehung zwischen Aufklärung und mythischem Denken aufgezeigt. Ihr Schlüsselwerk Dialektik der Aufklärung (1944) ließe sich auf zwei Thesen bringen, wie es im Vorwort heißt: „schon der Mythos ist Aufklärung, und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück“ (Adorno/Horkheimer 1992, S. 6):
Ursprünglich lebte der Mensch unmittelbar, d. h. er nahm eine Wirklichkeit mit seinen Sinnen wahr, ohne dass für ihn ein Grund bestand, zwischen Geist (Subjekt) und Materie (Objekt), zwischen Körper und Seele zu unterscheiden. Den Riten der Naturvölker lag eine geradezu magische Verbindung zur Natur zugrunde, was sich beispielsweise darin ausdrückte, dass sie Regen und Wind anbeteten. Diese Vorstellung trennte das mythische Denken, das Zeichen und Symbole anstelle des schlechthin Unbekannten setzte, die zunehmend mächtiger wurden. Irgendwann waren sie fixiert im Mythos, der Adorno/ Horkheimer zufolge bereits Aufklärung ist, da es ihm darum geht, dem Menschen die Furcht vor dem Unbekannten zu nehmen.
Die als Aufklärung bezeichnete Epoche des 18. Jahrhunderts zerstörte den mythischen Stoff, um ihn durch Wissen zu ersetzen. Je mehr die Illusion eines Gottes entschwand, desto mehr glaubte der Mensch sich als freies Individuum, an logische und sich wiederholende Gesetzlichkeiten. Die Wissenschaft gab das empirisch Messbare für die Wirklichkeit aus, sie trennte die Materie vom Leben und Geist und zersplitterte so das mythische, ganzheitliche Denken in Einzeldisziplinen. Nach dem amerikanischen Philosophen Ken Wilber entstand dadurch,
eine dualistische, Trennung setzende Ontologie, und zwar deshalb, weil in der objektivierenden Beschreibung der gesamten Wirklichkeit … kein Platz mehr blieb für das Subjekt dieser Beschreibung… die Natur war zwar ein harmonisches Ganzes, erkannt wurde sie jedoch von einem Subjekt, das in ihr keinen Platz fand. (Wilber 2001, S. 173)
Mit der Aufklärung hat sich der Glaube verbreitet, man könne die Welt bis ins kleinste Atom rational erklären. Raum, Zeit und Kausalität wurden zu Gesetzten von allgemeiner Gültigkeit, die dazu dienten, die bloße Erscheinung zur einzigen und höchsten Realität zu erheben.
Mit Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie (1915), welche die Vorstellung von Raum und Zeit veränderte, vor allem aber mit Werner Heisenbergs Unschärfe- bzw. Unbestimmtheitsrelationen (1927), wonach es unmöglich ist, gleichzeitig Ort und Impuls eines Teilchens zu erfassen, geriet die Sicherheit einer physischen Realität und einer linearen Kausalität ins Wanken. Der Mensch kann keine objektiven Messungen vornehmen, ohne dass dabei die Messung den zu beobachtenden Gegenstand verändert, was genaue Vorhersagen über die den exakten Verlauf einer Bewegung unmöglich macht. Die Bedeutung der Erkenntnis markiert den Bruch im Selbstverständnis der Naturwissenschaften. Wenn der Mensch bis dahin davon ausgegangen war, mit seinen Urteilen die Natur in einer gesetzmäßigen Ordnung erfassen zu können, so war er widerlegt. Das Unschärfeprinzip ist nicht nur eine Grenze der menschlichen Erkenntnis, sie legt vielmehr in der chaotischen Struktur der Natur selbst beschaffen. Heisenberg hatte die Allgemeingültigkeit des Kausalitätsprinzips widerlegt. Da sich in der Quantenwelt Dinge ohne Grund ereignen können, war das Gesetz von Ursache und Wirkung außer Kraft gesetzt, ebenso die Vorstellung von Determinismus, der kausalen Vorbestimmtheit eines Geschehens (vgl. Heisenberg 1984; Fischbach 1986).
Ein absolutes Abbild der Wirklichkeit, eine widerspruchsfreie Anwendung der Begriffe Raum, Zeit und Kausalität, waren mit Heisenberg unmöglich geworden. Mit der Moderne geht „die Entdeckung einher, wie wenig wirklich die Wirklichkeit ist“ (Lyotard 1999, S. 42). Die „grundsätzliche Nichterkennbarkeit der Welt“ (Breuer 1987, S. 205) hatte enorme philosophische Konsequenzen:
Die Auffassung von Indeterminiertheit bestimmter Ereignisse bedeutet zum einen, dass die Zukunft sich auf den Zufall gründet, zum anderen wird damit die Problematik des freien Willens aufgeworfen, nach Hassenstein ist der Zufall ein Gegenspieler von Willensfreiheit: „Freiheit bedeutet, daß man denken kann, was man selbst will. Unfreiheit, wenn sich dem Bewußtsein bestimmte Inhalte aufdrängen; und daran ändert sich nichts, wenn die sich aufdrängenden Gedanken zufällig sind“ (zit. nach Fischbach 1986).[2] Bereits Nietzsche nannte den Glauben an die Freiheit des Willens eine Illusion (vgl. Nietzsche 1990, Bd. 1, S. 32), „niemand ist für seine Taten verantwortlich, niemand für sein Wesen“ (Nietzsche 1990, Bd. 1, S. 56).
1.3.2 Der moderne Mensch
Trotzdem ist in der modernen Gesellschaft alles geregelt und determiniert: Kapital existiert als unsichtbare Macht in allen Lebensbereichen. Die Entwicklung in der Moderne wurde immer wieder mit dem Einfluss von Industrialisierung und Kapitalismus in Verbindung gebracht. Was Marx in den Begriffen Entfremdung und Warenfetischismus zu beschreiben suchte, dachte Lukács in seiner Verdinglichungstheorie weiter: Indem der Mensch sich selber als Ding betrachtet, das zum Zwecke verbesserter Wertproduktion dem herrschenden gesellschaftlichen Prinzip angeglichen und optimiert werden muss, verdinglicht er sich selbst.
Die Prinzipien der ökonomischen Vorgänge, Profitdenken und Rationalität, werden vom Bewusstsein aufgenommen, verinnerlicht und in Bereiche übertragen, die keinen unmittelbaren Bezug zur Ökonomie haben. Als Hauptmerkmal des Rationalisierungstypus ergibt sich die Reduktion von Qualitativem auf pure, austauschbare Quantitäten. Menschen werden zu Mitteln, um einem Zweck außerhalb des Individuums zu dienen, der Aufrechterhaltung der Kapitalverhältnisse, der Profitmaximierung. Das Prinzip dieser auf Kalkulation eingestellten Rationalisierung ist heute in nahezu alle Lebensbereiche gedrungen, Leistungsfähigkeit zum maßgebenden Wert geworden.
Adorno und Horkheimer haben darauf hingewiesen, dass der Rationalismus, als ein Herrschaftsinstrument nicht nur die Natur, sondern auch das Subjekt selber unterjocht, es zum Objekt gesellschaftlicher Prozesse werden lässt. In dem Glauben, das Mythische überwunden zu haben, unterwirft sich der Mensch den neuen Göttern Industrie und Technik, ohne ein Prinzip aufzuweisen, das diesen Kategorien einen Sinn verleihen könnte (vgl. Adorno/Horkheimer 1992). Der „Niedergang des Individuums“ sei nicht auf die Technik oder die Produktion an sich zurückzuführen, so Horkheimer, sondern auf die Formen, in denen sie stattfinden:
Die menschliche Mühe, Forschung und Erfindung ist eine Antwort auf die Herausforderungen der Notwendigkeit. Dieses Gefüge wird nur dann absurd, wenn die Menschen Mühe, Forschung und Erfindung zu Idolen machen. ... Während die Vorstellung von vollendeter Erfüllung und uneingeschränktem Genuß eine Hoffnung nährten, die die Kräfte des Fortschritts entfesselte, führt die Anbetung des Fortschritts zum Gegenteil des Fortschritts. (Horkheimer 1991, S. 157)
Die Aufklärung, in der die Menschen mittels ihrer Vernunft zu Herren über die Natur aufstiegen, hat sich selbst ad absurdum geführt, so Adorno/Horkheimer:
Die Absurdität des Zustandes, in dem die Gewalt des Systems über die Menschen mit jedem Schritt wächst, der sie aus der Gewalt der Natur herausführt, denunziert die Vernunft der vernünftigen Gesellschaft als obsolet. (Adorno/Horkheimer 1992, S. 45)
„Nicht als Weltanschauung löst das Absurde die rationale ab; jene kommt in diesem zu sich selbst“, so Adorno (1965, S. 222). Ratio ist vollkommen instrumentell geworden, sie hat sich zu blinder Herrschaft verselbstständigt und damit jeden Sinn eingebüßt. Irrationalität bestimmt das Schicksal des Menschen.
Die Erfahrungen des Faschismus wurde als Konsequenz der Manipulierbarkeit des Menschen im Spätkapitalismus verstanden. „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde für eine ganze Generation das Absurde in klassischer Weise thematisch“, schreibt Haug (1966, S. 23). Es wurde zum irrationalen Widerpart von historischer Unvernunft. Die moderne Kunst verfügt Adorno zufolge über kein geeigneteres Mittel für die Verdeutlichung dieser Situation, als die des Absurden: „Nach dem Zweiten Krieg ist alles, auch die auferstandene Kultur zerstört, ohne es zu wissen; die Menschheit vegetiert kriechend fort nach Vorgängen, welche eigentlich auch die Überlebenden nicht überleben können“ (Adorno 1965, S. 192).
Der Abwurf der amerikanischen Atombombe in Japan hatte gezeigt, dass es möglich ist, die gesamte Menschheit innerhalb kürzester Zeit zu vernichten. Der begeisterte Kommentar Trumans nach dem Abwurf über Hiroshima belegt jene Tollheit: „This ist the greatest thing in history“ (zit. nach Damian 1977, S. 32). Die durch den Kalten Krieg reale nukleare Bedrohung war bezeichnend für die Situation des Menschen, der im Namen des Fortschritts auf die planmäßige Selbstzerstörung zuzusteuern schien. Die endgültige „Machtergreifung durch das Absurde“ (Esslin) beruhte insbesondere auf der Tatsache, dass die Welt nach dem Faschismus gleich wieder in ihre früheren Formen zurückfiel.
Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung der Nachkriegsjahre und der Undurchschaubarkeit von ökonomischem System und politischem Apparat, wich der Glaube an Selbstverwirklichung einem Gefühl des Ausgeliefertseins. Hier setzt sich das Absurde vom philosophischen Standpunkt des Existentialismus ab. Deren These, man solle sein, was man ist, war fragwürdig geworden in einer mit Irrationalitäten durchsetzen Welt, in der Sinn – außer in der Profitlogik – nicht zu finden ist, „in der die kapitalistische Tauschverhältnisse gewissermaßen hochgerechnet werden zu einer Austauschbarkeit aller Phänomene und Diskurse – auch aller kategorialer Annahmen der traditionellen marxistischen Gesellschaftsanalyse: die in der ‚Bombe’ vollendete Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige Arbeit läßt jegliche Dialektik der Produktion in sich zusammenstürzen“, so Baudrillard (zit. nach Scherpe 1997, S. 270).
Daraus folgt ein Bewusstsein der „objektiven Ironie“ und der „radikalen Indifferenz“, so Klaus R. Scherpe (1997, S. 271), „die Herstellbarkeit der Katastrophe ist die Katastrophe.“
Für Adorno ist das Absurde keine grundsätzliche Frage des Daseins, sondern Resultat der historischen Entwicklung: „Die geschichtliche Unausweichlichkeit dieser Absurdität läßt sie ontologisch erscheinen“, so Adorno, „das ist der Verblendungszusammenhang der Geschichte selbst“ (1965, S. 233). „Der Widerspruch zwischen rationaler Fassade und unabdingbar Irrationalem ist selber bereits das Absurde“, sagt Adorno (1965, S. 220), dessen Theorie der Moderne folgerichtig in der Überzeugung gipfelt, das Absurde sei die einzige künstlerisch adäquate Form für die Darstellung der Zerrüttung dieser Welt.
Die philosophische Position des Absurden steht zusammenfassend für alles Widersprüchliche, für die Dualismen des Lebens: für Zeitlichkeit und Ewigkeit, Leben und Tod, Sinnverlangen und Sinnabweisung, Bewegung und Stillstand, Aktivität und Passion, Linearität und Kreislauf, Rationalität und Irrationalität, Wahrheit und Lüge. Das Absurde bewegt sich zwischen den Gegensätzen, in einem unbestimmten Niemandsland, in dem sich die Gegensätze gegenseitig aufheben. Und genau darin liegt wohl auch der Grundzweifel im Absurden Denken, nämlich ob aus einer holistischen Sicht die Gegensätze und die ihnen entsprechenden Werte und Wahrheiten überhaupt existieren, oder ob sie nicht vielmehr nur die oberflächliche und begrenzte Perspektive des Menschen repräsentieren.
Der Weltlauf ist ein großes Naturschauspiel, in dem es keinen Zweck und keine Kausalität gibt – das Ausgeliefertsein des Menschen an Zufall und Chaos. Es kann keine objektiven Erkenntnisse geben, nur Gedankenspiele, die keinen Absolutheitsanspruch besitzen. Deshalb schlägt Aufklärung in Mythologie zurück (vgl. Heisenberg 1984; Adorno/Horkheimer 1992; Wilber 2001).
1.4 Ambivalente Begriffswelt: Grenzen der Sprache
Sprache bestimmt unser Denken und unsere Wahrnehmung, sie strukturiert Realität. Sie ordnet nach Saussure begriffliche Zeichen (Signifikant) in Analogie zu den bezeichneten Sachen (Signifikat) und deren Anordnung in der gedeuteten Wirklichkeit (Kontext). Sätze existieren nur als eine Struktur, eine Verbindung von Benennungen; die Bedeutung liegt nicht im Begriff, sondern erst im Kontext, z.B. in der Erfahrung, die hinter dem Wort steht (vgl. Picard 1978, S. 8).
Unser Sprachsystem ist aber nicht als statische Einheit zu verstehen. Es verhält sich vielmehr dynamisch, wobei Veränderungen von ideologischen Konflikten herbeigeführt werden. Wertgegensätze artikulieren sich in rivalisierenden ideologischen Dialekten, wobei Worte wie normal, Freiheit oder Fortschritt mit widersprüchlichen Bedeutungen belegt werden, mit denen sich der Einzelne identifiziert, ohne über seinen Standpunkt (die Relevanz) oder das semantische Verfahren (den Kode) nachzudenken. Er hält die begrifflichen Abstrakta für natürlich, für real existierende Formen, für allgemeingültige Bestandteile eines nicht hinterfragbaren Sprachgebrauchs.
Der kommerzielle Diskurs (Reklame) aber lässt qualitative Wertunterschiede gleichgültig und indifferent erscheinen, gebraucht Worte als Instrumente des Verkaufs, ohne dass ihr etwas an deren semantischen Bedeutungen liegen würde. Die ideologische Dialektik geht dagegen von einem absoluten Dualismus in der Sprache aus, neigt zu einer Gegenüberstellung von Werten, unterscheidet Demokratie von Totalitarismus, Sozialismus von Kapitalismus, wahr von falsch. Da sich ideologische Auseinandersetzungen nur des unmittelbaren Nutzens der sprachlichen Zeichen bedienen, den Sinn auf sprachlicher Ebene aber zerstören, ahmen sie die kommerzielle Rhetorik der Werbung nach. Ein Wort wird solange manipuliert, bis es eine widersprüchliche Bedeutung annimmt, ambivalent wird, wobei erst die vom Markt geschaffene Indifferenz eine solche Entwicklung zulässt, da sich alles Handeln am Tauschwert orientiere, wie Zima beschreibt:
Da die Ideologien jedoch außerstande sind, die Gesetze des Marktes und der Vermittlung außer Kraft zu setzen, diskreditieren sie sich schließlich gegenseitig. … Dadurch daß die Ideologie nur den unmittelbaren Nutzen, den instrumentellen Charakter (würde Horkheimer sagen) der sprachlichen Zeichen und der semantischen Unterschiede anerkennt, gleicht sie sich der Rhetorik der Werbung an. Wie diese verknüpft sie unvereinbare lexikalische und semantische Werte miteinander. Indem sie die Gerechtigkeit mit der Willkür der Macht, die Demokratie mit der Diktatur und die Freiheit mit der Unterwerfung identifiziert, erzeugt sie, der Werbung gar nicht unähnlich, semantische Ambivalenzen, die mit der Zeit in den alltäglichen Sprachgebrauch eindringen und dort die letzten Spuren von Sinn tilgen (Zima 1983, S. 30).
Das Resultat ist eine Situation, in der die lexikalischen und semantischen Grundlagen der Sprache erschüttert sind.
Inhaltslosigkeit und Widersinnigkeit der Worte sind in den 1920er und 30er Jahren so einflussreich, dass Grundvoraussetzungen des Sprachsystems in Frage gestellt sind. Das Widersprüchliche wurde so lange in seine gegensätzlichen Momente getrieben, bis die Unterscheidung zwischen den Extremen belanglos wurde. Der Surrealist André Breton beschreibt die Entwertung der Worte als Folge ideologischer Konflikte so:
Die Wörter, die sie [die Werte] bezeichneten, wie zum Beispiel Recht, Gerechtigkeit, Freiheit, hatten beschränkte, widersprüchliche Bedeutungen angenommen. Ihre Elastizität wurde von beiden Seiten so gut ausgenutzt, daß es gelang, sie auf alles mögliche anzuwenden, bis sie genau das Gegenteil von dem ausdrückten, was sie ursprünglich bedeuteten. (zit. nach Zima 1983, S. 15)
Die Manipulation der Sprache, die sich in der Ignoranz gerade jener humanistischen Werte zeigte, die sie propagandistisch vermittelte, trug zwingend zur Entwertung der semantischen Inhalte und damit zur Zerstörung jedes Sinnes bei, nicht nur nach Ansicht der Surrealisten ist die Sinngebende Wirklichkeit ein Konstrukt aus Diskursen.
Ludwig Wittgenstein ging es im Tractatus Logico-Philosophicus (1921) dann auch darum, Sprachkritik zu betreiben, in einer Zeit, die zunehmend vom Gefühl der Sinnlosigkeit menschlichen Tuns bestimmt war (vgl. Görner 1996, S. 67). Seine Philosophie trennte den Sinn von der Wahrheit. Sätze der Logik demonstrierten ausschließlich die logischen Eigenschaften der Sätze an sich, sie seien nicht allgemeingültig, sondern zeigen nur die strukturelle Korrespondenz von Sprache und Welt auf. Logik sei nur die Form der Abbildung, quasi eine „Nullmethode“, in der sich Sätze als Konstrukt selbst spiegeln, das „Gerüst der Welt“ (Wittgenstein 1996, S. 153ff, 6.121-6.126).
Wir sind gefangen in diesem Gerüst, können nicht über die Grenzen hinaus, womit sich die in der Philosophie so zentrale Frage nach dem Sinn erübrigt. Über die Welt können wir nicht sinnvoll sprechen, da wir nicht aus der formal-strukturellen Sprachidentität herauskönnen in die Distanz eines außerhalb unserer sprachlich verfassten Welt: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (ebd., S. 148, 5.6).
Wittgenstein betreibt die Auflösung von Zeichenverbindung, da er die Beziehungen von Zeichen zum Bezeichnetem als bedeutungslos feststellt. Von dem Moment an, wo man beweisen will, dass es kein privilegiertes Signifikat gibt und das Spiel des Bezeichnens keine Grenzen mehr hat, müsste man letztlich den Begriff an sich und das Wort des Zeichens zurückweisen, zeigt Derrida die Absurdität der Situation auf (vgl. Derrida 1999, S. 118). Die konsequente Folgerung zieht Wittgenstein mit der Selbstaufhebung seiner eigenen Sätze, indem er sich gezwungen sieht, sie vom ersten Satz für unsinnig zu erklären, er betreibt eine „reductio ad absurdum “ wie Bezzel (1988, S. 86) schreibt. „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“ (Wittgenstein 1996, S. 166, 7).
Camus sah das Stillschweigen ebenso als einzig sinnvolle Haltung, allerdings unter der Prämisse, dass es seinerseits keine Bedeutung hätte: „die vollkommene Absurdheit versucht, stumm zu bleiben“ (Camus 1953, S. 14f). Dass der Sinn für den Menschen keine von der Sprache unabhängige Wesenseinheit ist, macht Camus bewusst: „Wenn unsere Sprache sinnlos ist, ist alles sinnlos; wenn die Sophisten recht haben, ist die Welt ohne Sinn“ (zit. nach Zima 1983, S. 150). Camus stimmt darin überein mit Parains[3] Grundgedanken,
daß die Sinnlosigkeit der Sprache genügt, um alles sinnlos und die Welt absurd werden zu lassen. Unsere Kenntnis ist nur mit Hilfe von Wörtern möglich. Ist deren Unzulänglichkeit einmal nachgewiesen, dann ist unsere Verblendung endgültig. (zit. nach Zima 1983, S. 150)
1.5 Das ästhetische Prinzip und die Musik
Die Moderne lässt sich nicht nur am Zerfall von Weltbildern ablesen, sondern an der „Ausdifferenzierung der Wertsphären Wissenschaft, Moral und Kunst“, stellt Habermas (1994, S. 185) fest. Im Bewusstsein des Absurden ist die große Harmonie gebrochen; der Begriff absurd wird damit seiner ursprünglichen Bedeutung gerecht, der Dissonanz im musikalischen Kontext. Da es dem Wesen der Kunst inne liegt, ästhetische Harmonie herzustellen, sahen viele Denker des Absurden in ihr einen erlösenden Ausweg.
Für Albert Camus ist Kunst mehr als das bloße Abbilden der Wirklichkeit, sie müsse vielmehr eine Korrektur der Realität sein und Einheit herstellen. Das Kunstwerk sei nicht Flucht vor dem Absurden, sondern selbst ein absurdes Phänomen, an dem die Überlegung stehen bleibt:
Das Kunstwerk entsteht aus dem Verzicht des Verstandes, das Konkrete zu begründen. Es bezeichnet den Triumph des Sinnlichen. Das klare Denken ruft es hervor, leugnet aber gerade in diesem Akt sich selbst. Es wird nicht der Versuchung nachgeben, dem Beschriebenen einen tieferen Sinn unterzulegen, den es für unberechtigt hält. … Wenn die Welt klar wäre, gäbe es keine Kunst. (Camus 1998, S. 102f)
Die Kunst sei eine „rettende, heilkundige Zauberin“, sagt Nietzsche, „sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben läßt“ (Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 417f). Rachel Bespaloff sieht in der Kunst das einzig wirksame Mittel, „um dem Absurden eine Bedeutung aufzuzwingen und das Chaos in ein Objekt von Schönheit zu verwandeln.“ Das Absurde gilt ihr als etwas, mit dem wir nicht leben können, das uns auferlegt wurde wie ein unerträgliches Licht; „nur das schöpferische Bild … kann die zerstörerische Wahrheit, die es zum Erscheinen bringt, kompensieren“ (zit. nach Haug 1966, S. 24).
Besonderer Kraft wird der Musik zugesprochen, da sie „zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller Erscheinung das Ding an sich darstellt. Man könnte demnach die Welt ebenso wohl verkörperte Musik … nennen“, so Schopenhauer (1997, S. 388). Für Nietzsche ist die Musik der beste Beweis dafür, dass der Glaube, kausales Denken reiche bis in die tiefsten Abgründe des Seins, nur eine Wahnvorstellung ist. Was hätte man von Musik erfasst, wenn man ihren Wert danach bemisst, wie viel von ihr gezählt, berechnet oder in Formeln gebracht werden könne, „wie absurd wäre eine solche wissenschaftliche Abschätzung der Musik! Was hätte man von ihr begriffen, verstanden, erkannt! Nichts, geradezu nichts von dem, was eigentlich an ihr Musik ist!“ (Nietzsche 1990, Bd. 2, S. 615).
Es ist diese Widersprüchlichkeit, die die Musik zur wohl merkwürdigsten Kunstgattung macht, geradezu prädestiniert dazu, das Absurde zu tragen. Anders als Malerei oder Poesie stellt sie die Welt nicht dar: „Ein Akkord bedeutet nichts, eine Melodie hat keinen Sinn“, schreibt der Spiegel, „in ihrem Kern ist Musik reine Mathematik“ (Bethge 2003, S. 130). Doch so sinnentleert die Aneinaderreihung von Tönen scheint, verwandelt sich Musik in Gefühl und damit in etwas für den Menschen Sinnvolles.
2 Das Absurde in Literatur und Theater
2.1 Anfänge und Entwicklung
… was Fliegen sind
Mutwill’gen Knaben, das sind wir den Göttern:
Sie töten uns zum Spaß. (William Shakespeare: König Lear, IV, 1)
2.1.1 Das Tragisch-Absurde: Shakespeare & der Manierismus
In Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) benennt Nietzsche den dionysischen Chor als Ursprung des Tragischen. Der Rausch des Dionysos vereine sich in der Tragödie mit dem Maß des Apollos. Bereits mit Euripides, dem dritten großen Dramatiker Griechenlands, beginnt eine Entwicklung, die von vom Tragischen abkehrt. Nietzsche nennt ihn einen „sokratischen Denker“ (vgl. Hocke 1991, S. 455): „Die optimistische Dialektik treibt mit der Geißel ihrer Syllogismen die Musik aus der Tragödie: d. h. sie zerstört das Wesen der Tragödie, welches sich einzig … als sichtbare Symbolisierung der Musik, als die Traumwelt eines dionysischen Rausches interpretieren läßt“ (Geburt, Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 460).
In Die Welt als Labyrinth (1956) erkennt Gustav René Hocke im modernen Manierismus des 16. und 17. Jahrhunderts das Absurde. Form der Bühne, Theaterstil und dramatische Abläufe bildeten ein Ganzes von Dissonanzen. Mit Raum und Zeit wird gespielt, beides wird in ein Labyrinth von Geschehen verwandelt. Mit der „Preisgabe des Kausalitätsprinzips“ wurden die Figuren ambivalent, es gibt nicht determinierte Sprünge, irrationale Impulse, unmotivierte Handlungen, alogische Voraussetzungen (vgl. Hocke 1991, S. 457ff).
Entscheidend für die Entwicklung ist die Tatsache, dass der Glaube an eine Auflösung menschlicher Konflikte in der Welt der Götter allmählich seine Bedeutung verliert. An die Stelle der göttlichen Ordnung tritt schon bei Euripides Tyche, der Zufall, der sinnlos und willkürlich, ohne Bezug auf Götter waltet. „Verzweiflung, verzweifeltes Fragen nach Sinn und Ziel, nach dem Wesen der Götter treten hervor ... Die Grenzen des Menschen und seine Verlorenheit werden schaurig offenbar“ (Jaspers 1947, S. 42). Hamlets Wort, „Time is out of joint” (Shakespeare 1993, Hamlet I, 5), drückt den Übergang aus.
Es ist die Situation des Menschen, die im Hamlet (1601) zur Darstellung kommt, das Schauern an der Grenze des menschlichen Denkens. Hamlet ist befangen im Wissen um sein Nichtwissen. Die Einsicht in die Begrenztheit der menschlichen Vernunft macht den Shakespearischen Helden handlungsunfähig. Sein unentschlossenes Zögern geschieht Nietzsche zufolge aus dem Motiv der Erkenntnis um die Sinnlosigkeit eines jeden Handelns. Er vergleicht Hamlet mit dem dionysischen Menschen:
Beide haben einmal einen wahren Blick in das Wesen der Dinge getan, sie haben erkannt, und es ekelt sie zu handeln; denn ihre Handlung kann nichts am ewigen Wesen der Dinge ändern, sie empfinden es als lächerlich oder schmachvoll, daß ihnen zugemutet wird, die Welt, die aus den Fugen ist, wieder einzurichten. Die Erkenntnis tötet das Handeln, zum Handeln gehört das Umschleiertsein durch die Illusion – das ist die Hamletlehre, ... der Einblick in die grauenhafte Wahrheit überwiegt jedes zum Handeln antreibende Motiv, bei Hamlet sowohl als bei dem dionysischen Menschen. Jetzt verfängt kein Trost mehr, die Sehnsucht geht über eine Welt nach dem Tode, über die Götter selbst hinaus, das Dasein wird, samt seiner gleißenden Widerspiegelung in den Göttern oder in einem unsterblichen Jenseits, verneint. In der Bewußtheit der einmal geschauten Wahrheit sieht jetzt der Mensch überall nur das Entsetzliche oder Absurde des Seins … (Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 417f)
Während die Entschlossenen in ihrem gedankenlosen Gehorsam befangen sind durch die Enge ihrer Illusion, wie Jaspers schreibt, stellt Hamlet unablässig Fragen. Doch es bleibt beim Nichtwissen, beim ständigen Fühlen der Grenzen und der Frage: „Ist an der Grenze das Nichts?“ (Jaspers 1947, S. 33).
„Der Rest ist Schweigen“ (Hamlet V, 2) – in den letzten Worten Hamlets kommt die absurde Haltung Hamlets endgültig zum Tragen, der Wahrheitswille zu einem erlösenden Stillstand (vgl. Lüthi 1966).
Hamlet sei eine „Tragik der versagten Tragik“, sagt Janetzki (zit. nach Hocke 1991, S. 462). Die klassische Bühne war eine Metapher für Willensfreiheit. Der Held stand vor der Wahl zwischen zwei gegensätzlichen Werten, zwischen irdischer und absoluter Ordnung. Die tragische Situation wandelt sich in eine absurde, wenn beide Alternativen gleichermaßen grotesk sind. So entdecken die manieristischen Stücke das Widersprüchliche und Doppeldeutige in allem, typisch für ein Wirklichkeitserlebnis, in dem die Grenzen zwischen Wachen und Träumen, zwischen Sein und Schein, zwischen Wahr und Falsch nicht mehr existieren – „im daidalischen Zerrspiegel erscheint die Welt als Absurdum“, so Hocke. Deshalb die Vorliebe zur Tragikkomödie. Görner schreibt: „Im Absurden vereinigen sich komische und tragische Momente“ (Görner 1996, S. IX).
Nietzsche benannte „das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen und das Komische als die künstlerische Entladung vom Ekel des Absurden“ (Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 417f).
Exemplarisch für die absurde Lebensauffassung Shakespeares steht König Lear (1606). Absurder Höhepunkt ist Glosters Versuch, sich von einem Abgrund zu stürzen, der gar nicht existiert. Der Autor bedient sich hier einer Landschaft, die nur die Illusion eines Blinden ist, ein Abgrund auf leerer Bühne. Im Gegensatz zum naturalistischen Theater, das den realen Tod noch durch einen falschen darzustellen versuchte, wird in dieser Parabel auf leerer Bühne Selbstmord gespielt – der Tod ist nur noch Zeichen (vgl. Kott 1964).
In Shakespeares Stücken sei „ein tiefes Gefühl der Nichtigkeit und Absurdität des menschlichen Daseins“ zu finden, so Martin Esslin (1967, S. 341). Shakespeare ersetzt eine evidente Weltanschauung durch eine närrische, die einzige, die imstande ist, in das Absurde zu blicken.
Das Europa des Absurden entstand in der Shakespeare-Zeit. Die Verzerrungs-Technik nahm in den folgenden Generationen zu. Der Mensch wird in diesen ingeniösen Dichter-Laboratorien zu einer ‚Karikatur’ seiner selbst, aber auch des Universums. Langsam fallen dann die restlichen orthodoxen oder heterodoxen religiösen Gewandungen fort. … Die Brücke reicht zum intellektuell-moralistischen Sophismus des Protagoras ebenso hinüber wie zu den moralistisch-surrealistischen Monologen der Hyper-Verfluchten Samuel Becketts. (Hocke 1991, S. 460).
Der Unterschied zur vollendeten Kunst des Absurden lässt sich letztlich noch an der tragischen Lösung in Shakespeares Stücken festmachen. Doch wie Adorno feststellt, ist „aus den großen Dramen Shakespeares so wenig herauszupressen, was sie heute die Aussage nennen, wie aus Beckett. Aber die Verdunklung ihrerseits ist Funktion des veränderten Gehalts. Negation der absoluten Idee“ (Adorno 1995, S. 47).
2.1.2 Die vielfältigen Formen des Absurden
Zweihundert Jahre nach Shakespeare verschärft sich die Zeitkritik in den Stücken Georg Büchners zu „nihilistischer Nüchternheit und die Lust am Phantasieren zur absurden Farce“ (Görner 1996, S. 26). Büchner bringe als erster einen Ton in die Weltliteratur, der seitdem unüberhörbar ist, so Pongs, „den Aufschrei der Kreatur gegen die Sinnlosigkeit des Daseins“ (Pongs 1990, Bd. 1, S. 165). Immer geht es um das Scheitern des Menschen an sich selbst. Er zeigt passiv leidende Helden, die in einer entheiligten Welt in den Untergang getrieben werden. Woyzeck (1837) offenbart die Welt als Kabinett des Absurden, in dem der einfältige und triebabhängige Held aus häuslicher Führsorge zum Spielball wissenschaftlicher Experimentierlust wird, ein fremdbestimmtes Objekt, das schließlich im Wahn seine untreue Frau ermordet (vgl. Görner 1996, S. 31f).
Doch als „Schlüsseldatum“ in der Geschichte des Absurden bezeichnet Görner die Uraufführung von Alfred Jarrys Ubu roi am 10. Dezember 1896 in einem Pariser Theater. Ubu, der sich zum König von Polen ernennt, willkürlich quält und tötet, ist eine stark vereinfachte, lächerliche Karikatur, stets folgerichtig im Widersinn seines Handelns. Das Bühnenbild war nach kindischer Naivität stilisiert, die Darsteller sollte man in ihren hölzernen Kostümen für Spielzeugpuppen oder Marionetten halten (vgl. Görner 1996, S. 43/Esslin 1967, S. 369). Der französische Schriftsteller erschuf an der Grenze zum Wirklichen eine Wirklichkeit mit Hilfe von Zeichen und wurde damit zum Wendepunkt und zum Vorläufer des Absurden Theaters (vgl. Görner 1996, S. 45).
Anton Tschechow entdeckt die Absurdität des Alltags, ein Konglomerat von feststehenden Gewohnheiten, die jede Erlebnisfähigkeit verhindern. Bei den Figuren in Drei Schwestern (1901) ist keine bestimmende Haltung, kein Impuls zu finden, sie versuchen lediglich, die auf sie zukommenden Gegebenheiten zu ertragen, ohne dabei selbst zu handeln. Tschechow sucht weder nach der tragischen Lösung, noch nach der endgültigen Verzweiflung. Er greift in seinen „Pseudokomödien“ vielmehr zu einer Art Ironie, „der man das Rückrad genommen hat“, so Stein (1960, S. 311) in seinem Aufsatz Das Tragische und das Absurde. Sein Bemühen liegt darin, einem tragischen Gegenstand eine Lösung durch Komik aufzupfropfen, wobei wir jegliche Sicherheit verlieren. Unter solcherart Humor bleibe das Lachen nicht mehr nur im Halse, sondern in den Eingeweiden stecken (vgl. ebd., S. 303ff).
Um die Jahrhundertwende geht es Schriftstellern nicht mehr um die Überlieferung von Mythen, die ihre Funktion der Wahrheitsvermittlung eingebüßt haben, sondern vielmehr darum, mit Hilfe mythischer Überreste psychologische Bewusstseinszustände zu entwerfen. Mythen wurden auch als „die kollektiven Traumbilder der Menschheit“ bezeichnet (vgl. Esslin 1967, S. 359).
Der Schwede August Strindberg verlegt in dem dreiteiligen Stück Nach Damaskus (1898-1901) in einem allmählichen und fast unscheinbaren Prozess die Schauplätze von einer Wirklichkeit oberflächlicher Erscheinungen in jene traumhafter Bewusstseinszustände. Diese Verschiebung bildet sogleich den Übergang von Tradition zu Moderne, von der realistischen Darstellung von Erscheinungen zur expressionistischen Projektion innerer Welten. Strindbergs Held, Der Unbekannte, trifft auf mythologische Archetypen der verschiedensten Religionen; doch haben sie ihre ursprüngliche Symbolik verloren, sind nur Überbleibsel verlorener Wahrheitsgewinnung. Zurück bleibt ein begriffliches Labyrinth, in dem leere Symbole und Begriffe herumgeistern, die weder Sinn noch Ziel stiften. Strindbergs Symbole reißen sich los „von den empirischen Menschen und werden zu einem Teppich verwoben, in dem alles symbolisch ist und nichts, weil alles alles bedeuten kann“ (Adorno 1965, S. 216).
In Ein Traumspiel (1902) unternimmt Strindberg gar nicht den Versuch, eine objektive Wirklichkeit darzustellen, beschränkt sich auf das Spiel mit Mythos und Wissen und behandelt die Schwierigkeiten, im Wirrsal der Widersprüche zu leben, welche weder in diesem, noch in jenem Weltbild aufzulösen sind. Was Strindberg andeutet, ist die Tatsache, dass nicht eine erkenntnisreiche Zeit den Mythos abgelöst hat, sondern ein nachmythischer Zustand absoluter Ungewissheit: „Ansichten? Nein, ich hüte mich vor Ansichten. Ich hatte einmal ein paar, aber sie wurden sofort widerlegt; Ansichten werden sofort widerlegt – vom Gegner natürlich!“ (Strindberg 1984, Ein Traumspiel, S. 331).
Aus dem Erleben des Ersten Weltkriegs entwickelten sich als Vorboten des Absurden Theaters Dadaismus und Surrealismus, Camus zufolge „Humor und Kultus des Absurden“ (Camus 1953, S. 96). Dadaisten stellten der vermeintlichen Rationalität die bewusste Irrationalität entgegen, wobei ihr wichtigstes Ausdrucksmittel die Provokation ist[4]. Mit dem Bestreben der surrealistischen Bewegung, innere Zustände durch ihre Vergegenständlichung darzustellen, wurde bereits ein zentrales Merkmal des Absurden vorweggenommen. Ziel dieser Bewegung war jener Punkt, an dem „Leben und Tod, Wirklichkeit und Einbildung, das Mitteilbare und Nichtmitteilbare, Oben und Unten aufhören, als Widersprüche gesehen zu werden“ (Pongs 1990, Bd. 3, S. 847).
Der Unterschied zwischen den künstlerischen Formen des Surrealismus und des Absurden liegt neben den abweichenden Darstellungsmitteln in erster Linie in der Frage nach dem Sinn. Es gehört zur Wirkungsweise der absurden Kunst, dass sie den Rezipienten dazu bringt, nach dem Sinn zu fragen. Der Künstler des Absurden drückt das Sinnlose aus, weil er die Verhältnisse als widersinnig interpretiert hat. Und doch liegt dem Irrationalen etwas Rätselhaftes inne, das den Künstler zur ästhetischen Umsetzung inspiriert, weniger eine Intention.
Was der Surrealismus zu leisten habe, konnte Yvan Goll dagegen genau sagen: „die Negation der Wirklichkeit, die Entmachtung der ‚Helden’“ (zit. nach Görner 1996, S. 50). Der absurde Künstler dagegen kennt kein Dogma: „Das Absurde … hat es nie zu einem ‚Absurdismus’ gebracht“, schreibt Görner (1996, S. 51). Seine Faszination lässt sich vielleicht erklären aus einem Denken, das sinnlos hin und her taumelt, aus Enttäuschung am Realen ebenso wie am Denken selber. Die Kunst des Absurden treibt die eigenlogischen Widersprüche des Lebens auf die Spitze, zeigt die Leere, ohne dass es über ein Programm verfügt, sie zu überwinden. Sie bedient sich bestehender Formen und Anschauungen, um ihre Gesetzte und Erklärungsmechanismen zu parodieren und ad absurdum zu führen.
2.1.3 Franz Kafka – die Verkörperung des Absurden
Wir sind, mit dem irdisch befleckten Auge gesehn, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, daß der Blick es immerfort suchen muß und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Was soll ich tun? oder: Wozu soll ich es tun? sind keine Fragen dieser Gegenden. (Franz Kafka 1993, Oktavhefte, S. 54)
In Franz Kafkas Prosa dominieren Angst- und Schuldgefühle, wobei die Ursache nicht genau zu orten ist; sie ist gesichtslos. Keiner der sensiblen Helden ist ein Ausnahmemensch oder scharf profilierter Charakter, sondern wir begegnen dem Durchschnittstypus, der den unbegreiflichen Ereignissen ohnmächtig und mit einem erstaunlichen Mangel an Gefühl begegnet. Jedes Mal lässt ein unvorhergesehner Wechsel in den Lebensbedingungen den planvoll eingerichteten Lebensbau, den alles bestimmenden Ordnungszusammenhang, einstürzen. Die Welt nimmt ein fremdes Aussehen an.
Insbesondere der Widerspruch zwischen dem Irrationalen in der Thematik und dem Realismus in der Darstellung verweist auf das Absurde, das Kafkas Werk „in seiner Gesamtheit darstellt“ (Camus 1998, S. 141). Alles ist so angelegt, dass der Leser das Fiktive, das Unwahrscheinliche des Geschehens in seinem fiktiven Charakter vergisst (vgl. Nagel 1974, S. 110). Es scheint ein Paradox: Je ungewöhnlicher die Ereignisse werden, desto spürbarer wird das Natürliche der Erzählung. In der Verwandlung (1912) ist niemand über das Unerklärbare erstaunt. Es stellt sich als etwas Tatsächliches, als folgerichtig und natürlich dar, nur die veränderten Lebensumstände geben Anlass zur Sorge. Der vollkommene Mangel an Erstaunen ist typisch für die Kunst des Absurden: „Nicht das Ungeheuerliche schockiert, sondern dessen Selbstverständlichkeit“, so Adorno (1992, S. 254).
Samsa kümmert bei seiner Verwandlung in einen Käfer, was der Chef über seine Abwesenheit denkt. Dass ihm Insektenbeine wachsen, der Rücken zum Panzer wird, verwundert ihn nicht wirklich, verursacht lediglich einen leichten Kummer. „Kafkas ganze Kunst liegt in dieser Nuance“, so Camus (1998, S. 134).
Der Rezipient sieht sich in eine Welt versetzt, in der ihm sein gewohntes Realitätsbewusstsein fast unbemerkt abhanden kommt. Kafkas Literatur entspricht der „Liquidation des Traums durch dessen Allgegenwart“, so Adorno (1992, S. 270). Bert Nagel kommt zu dem Ergebnis, das Absurde sei in der Sicht des Dichters das Normale, das immer und überall sich Ereignende. Es wird nicht von außen eingeführt, sondern gilt als immanent. Kafka erfindet nicht, sondern er zeichnet gleich einem Mikroskop auf, enthüllt und vergrößert, was gemeinhin nicht zur Kenntnis genommen wird, dass die Welt aus den Fugen ist, dass ihre verfehlte Einrichtung irreparabel, nicht wieder ins Lot zu bringen ist (vgl. Nagel 1974/Wernicke 1994).
Die Welt Kafkas ist in keinem Sinne mehr vorkonstituiert, die gewohnten Voraussetzungen gelten nicht mehr, die erkenntnistheoretischen Kategorien, die einen einheitlichen Welt- und Erkenntniszusammenhang stiften, sind außer Kraft gesetzt. Durch die Aufhebung des gewohnten Wirklichkeitsbewusstseins kommen die Helden Kafkas zu der Einsicht in die Undurchschaubarkeit der Existenz. Dieses Klarwerden bedeutet also eigentlich den Verlust der Klarheit. Konfrontiert mit dem Ganzen, wird alles unüberschaubar. Der Mangel an Lösungen, das Vieldeutige und Versperrte sowie die fehlende Kausalität der Vorgänge lassen das Leben insgesamt absurd erscheinen. Kafka zeigt das „Sisyphus-Gespenst frustrierten Menschentums“ auf (Nagel 1974, S. 114).
Menschen, denen über der Unerkennbarkeit eines Lebenssinns alles sinnlos geworden ist, die sich nicht mehr zurechtfinden können, weil sie in schreckhaftem Erwachen die bloße Scheinsicherheit ihrer wohlgeregelten Lebensordnung durchschaut haben. Mit diesem Erwachen zur bedrohlichen Absurdität ihrer Existenz sind die Jedermannsgestalten Kafkas mit einem Mal Einsame geworden (Nagel 1983, S. 312).
Kafkas Welt wirkt wie ein Apparat, wie ein perfekt funktionierendes System, dem der Mensch ausgeliefert ist. Das gleichzeitige Unterstellen und Verschweigen der Schuld steigert die Absurdität. Das Leben erscheint als Strafsystem und permanentes Gericht. Der Grund der Strafe liegt aber nicht in dem Übertreten einer Regel, die Regel existiert vielmehr gar nicht. Der Held ist auf der Suche nach der Regel, und da er sie nicht findet, hat er permanent das Gefühl, eine Regel verletzt zu haben. Daher das Schuldgefühl, aus dem Bestrafung als eine Art alptraumhafte Phantasie hervorbricht. Ionesco sieht im Schuldthema einen Gewissenskonflikt:
Dieses Thema: der im Labyrinth verirrte Mensch, der den Faden der Ariadne nicht besitzt, ist das Urthema … im Werk Kafkas. Wenn der Mensch keinen Leitfaden hat, so bedeutet das, daß er ihn nicht mehr haben wollte. Daher rührt sein Schuldgefühl, seine Angst, die Absurdität der Geschichte. (zit. nach Esslin 1967, S. 366)
Folgen wir Ionesco, so ist die Schuld bei Kafka nicht in einem ethischen Sinne zu verstehen, sondern sie besteht vielmehr darin, dass die Figuren sich selbst, wenn auch unbewusst, zum Instrument ihres eigenen Untergangs machen, dass sie von dem linearen Weg abgekommen sind. Das Schuldbewusstsein trägt dann wesentlich zur Lähmung bei, doch geben Kafkas Figuren nie auf, rappeln sich immer wieder auf gegen das Ausweglose. Das Misslingen gestaltet sich als unendlicher Kampf.
So liegt dem Roman Das Schloß (1922) die Vorstellung des Labyrinths zugrunde. Der Held K. dreht sich immerfort im Kreise, kommt trotz des mühevoll langen Weges nicht von der Stelle (Nagel 1974, S. 122). Kafka zeigt das Sich-Bewegen ohne Bewegung. Seine Helden, obwohl immer in Bewegung, können nicht ankommen, da es kein Ziel gibt bzw. das Ziel nicht erkennbar ist. Eine zunächst logisch anmutende Situation führt in die totale Ratlosigkeit und Unsicherheit. „Da alle assoziierbaren Bedeutungen letztlich undurchdringlich bleiben, herrscht das lähmende Gefühl labyrinthischer Sinnlosigkeit vor“, so Emrich (zit. nach Nagel 1974, S. 111).
Die religiöse Thematik spielt eine wesentliche Rolle in Kafkas Werk, aber in jenem Sinne, der den Mythos zum Symbol der Verklärung macht. Da die göttliche Weltordnung unter Anklage steht, wird auch das Strafgericht über den Menschen, das Recht als solches fragwürdig. Adorno ist überzeugt, dass Kafkas Helden schuldig werden, „nicht durch ihre Schuld – sie haben keine –, sondern weil sie versuchen, das Recht auf ihre Seite zu bringen“ (1992, S. 281). Und Recht-Haben, steht niemandem zu. Dem schlechthin Unerforschlichen ist mit menschlicher Vernunft nicht beizukommen.
Alles bei Kafka scheint von der „Aura der unendlichen Idee“ durchdrungen, doch „nirgends öffnet sich der Horizont“, so Adorno: „eine Parabolik, zu der der Schlüssel entwendet ward; selbst der, welcher eben dies zum Schlüssel zu machen suchte, würde in die Irre geführt, indem er die abstrakte These von Kafkas Werk, die Dunkelheit des Daseins, mit seinem Gehalt verwechselte. Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden“ (Adorno 1992, S. 251). Kafkas Texte sind unendliche Verschleppungen, ein „Verlangen, kein linearer Sinnproduzent“ (Vorauer 1997, S. 195).
Klaus R. Scherpe schreibt, Kafkas Literatur habe die „Dialektik der Aufklärung“ in ein grauenhaftes „Märchen für Dialektiker“ verwandelt: „In Kafkas Erzählungen ist die Ausnahme von vornherein die Regel, die Umkehrung des Gedankens immer schon mitgedacht“ (Scherpe 1997, S. 283f). Erkenntnisse werden relativiert, indem jede Aussage durch eine Gegenaussage ungültig gemacht oder wieder zurückgenommen wird. Die Prosa produziert keinen Sinn, sondern bringt vielmehr einen Mangel ans Licht. Nicht die Wahrheit, sondern das Nichts, das Absurde steht hinter den ständig sich selbst widersprechenden Aussagen. „Was der dialektischen Theologie Licht und Schatten war, wird vertauscht. Nicht wendet das Absolute dem bedingten Geschöpf seine absurde Seite zu, … sondern die Welt wird als so absurd enthüllt, wie sie dem intellectus archetypus wäre“, so Adorno, „das Subjekt objektiviert sich, indem es das letzte Einverständnis aufkündigt“ (1992, S. 280).
2.2 Das Existentialistisch-Absurde
Die Wörter waren verschwunden und mit ihnen die Bedeutung der Dinge, ihre Verwendungsweisen, die schwachen Markierungen, die die Menschen auf ihrer Oberfläche eingezeichnet haben. Ich saß da, etwas krumm, den Kopf gesenkt, allein dieser schwarzen und knotigen, ganz und gar rohen Masse gegenüber, die mir Angst machte. (Jean-Paul Sartre 1999, Der Ekel, S. 144)
2.2.1 Indifferenz – Niedergang von Subjekt und Erzählung
Kafkas Werk wurde in den 30er und 40er Jahren aktueller denn je. Dichter und Philosophen machten ihn angesichts Faschismus und Krieg zum „Propheten“ der negativen Zeiterfahrung. Im Schlagwort „kafkaesque“ fasste der Existentialismus seine Leitvorstellungen zusammen (vgl. Beicken 1974, S. 189).
Schriftsteller wie Kafka diskreditieren bestimmte Gegensätze und Werte. Im modernen Roman rückte an die Stelle der Zweideutigkeit die Ambivalenz, woraus sich die Unmöglichkeit erklärt, zwischen Erscheinung und Wesen zu unterscheiden. Die Protagonisten verlieren ihren Wirklichkeitssinn:
Bei Kafka, in dessen Romanen die Helfer zugleich Widersacher sind, die Hüter der moralischen Instanz pornographische Schriften lesen und die Göttin der Gerechtigkeit als Göttin der Jagd erscheint, wird die Lüge schließlich ‚zur Weltordnung gemacht’, und die Schrift verliert sich in einer karnevalistischen Welt voller Masken. … Hinter den Erscheinungen und den Masken tauchen immer neue Masken auf: nie ein Gesicht, eine eindeutige Aussage oder eine Wahrheit. (Zima 1983, S. 34f)
Robert Musil nennt sein Roman, Der Mann ohne Eigenschaften (1930/32): Bei den Vorbereitungen zum 70. Dienstjubiläum des Kaisers kommt es zum riesigen Leerlauf, da die Protagonisten keine Relevanzkriterien finden können, welche es rechtfertigen würden, eine Idee oder Lösung der anderen vorzuziehen. Eine der direkten Folgen dieser Erkenntnis ist die Handlungsunfähigkeit. Ulrich, der Held des Romans, nennt die „moralische Ambivalenz“ das Schicksal seiner Generation. Die Sprache des Romans entspricht dieser Ambivalenz: Die Relativierung aller Werte führt dazu, dass „jeder Satz die Möglichkeit seiner Umkehr“ in sich trägt, so K.M. Michel (zit. nach Pongs 1990, Bd. 3, S. 649).
Ist Relevanz, die Grundlage einer jeden Subjektivität und Handlungsfähigkeit, entzogen, erlischt ebenso die Ambition auf Bedeutsamkeit, wie es dann in Moravias Die Gleichgültigen (1929), Sartres Der Ekel (1938) und Camus Der Fremde (1942) zu sehen. In allen drei existentialistischen Romanen nimmt die Krise der Worte und Werte extreme Formen an, was sich im Übergang von Ambivalenz zur Indifferenz (Gleichgültigkeit) ausdrückt. Dabei geht nicht nur der Glaube an jede ideologische Haltung verloren, sondern auch der an die Sprache und ihre Funktion als Instrument des narrativen Erzählens. Wenn Worte ihren Wert verlieren, werden die ihnen entsprechenden Ereignisse indifferent, da jede Handlungen nur in einer semantisch sinnerfüllten Wirklichkeit denkbar ist, d.h. in einer Wirklichkeit, die auf einer bestimmten Relevanz von Werten begründet ist.
Der indifferente Held verkörpert keine ideologischen Standpunkte, keine positive oder negative Taten, verfolgt kein Ziel. Da Subjektivität, das Wesen des traditionellen Erzählers, hier nicht auszumachen ist, stellt Indifferenz den Heldenbegriff in Frage, da für jede Darstellung der Wirklichkeit immer ein (ideologisch geprägtes) Subjekt verantwortlich ist. Sind Semantik und Subjektivität in Frage gestellt, erscheint jede Geschichte willkürlich und damit problematisch, wie Zima beschreibt:
In einer Situation, in der die Unterschiede und Gegensätze (wie schön/häßlich, gut/böse, Demokratie/Diktatur) fragwürdig werden, stößt der Diskurs als narrative Struktur, die deutliche Relevanzkriterien voraussetzt, auf Hindernisse. Denn es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, wenn man nicht weiß, wo Wahrheit und Lüge, das Gute und das Böse, der „Held“ und der „Antiheld“ zu finden sind. (Zima 1983, S. 151)
Im Existentialismus verliert die Suche nach der wahren Geschichte, nach dem Wesen der Wirklichkeit, ihren Sinn, da alle Geschichten, ja alle kausalen Ketten gleichwertig indifferent sind. Das Subjekt verliert seine Rolle als Aussage- und Handlungsinstanz und die Fähigkeit zur Selbstdarstellung. Ereignisse stehen nicht mehr in kausalem Zusammenhang, für die ein Subjekt verantwortlich wäre (vgl. Zima 1983, S. 38).
Exemplarisch für diese Entwicklung ist Alberto Moravias Die Gleichgültigen. Der Tauschwert ist der „geheime Drahtzieher“ der Romanhandlung, alles andere ist Schein und hat keinerlei Wert. Moravia zeigt, wie alle Versuche scheitern, gegen die Absurdität ökonomischer Gesetze vorzugehen, der Verdinglichung zu entrinnen. Der Subjekt-Begriff wird in Frage gestellt; wir haben es mit einem „Prozess ohne Subjekt“ zu tun (Zima 1983, S. 133).
Die Suche nach individuellen Werten wird unmöglich in einer Welt, die vom Tauschwert und seiner semantischen Entsprechung, der Indifferenz beherrscht wird. Dies erklärt, weshalb der existentialistische Roman keine tragische Struktur haben kann. Die Tragödie setzt neben dem Handeln einen Konflikt divergierender Werte voraus, religiöser, moralischer oder politischer Natur. In Moravias Die Gleichgültigen wird deutlich, dass hier niemand an tatsächliche Werte glaubt. Moravia sagt deshalb:
Ich erkannte, daß die Tragödie unmöglich geworden war in einer Welt, in der, wie es schien, die nichtmateriellen Werte keine Daseinsberechtigung mehr hatten, und in der das moralische Bewußtsein sich dermaßen verhärtet hatte, daß die ausschließlich von den Trieben beherrschten Menschen Automaten immer ähnlicher werden. (zit. nach Zima 1983, S. 139)
Die Protagonisten sind außerstande, autonom zu handeln. Die Verkettung der Ereignisse ist Folge ihres affektiven, gesellschaftlich angepassten Handelns, hinter dem immer der Profit steht.
2.2.2 Das Absurde als das Unberechenbare bei Sartre
Der historische Übergang von Ambivalenz zu Indifferenz stellt sich in Jean-Paul Sartres Der Ekel als Bedrohung dar und ist verantwortlich für das Ekelgefühl bei dem Helden Antoine Roquentin (vgl. Zima 1983). Ihn befällt es „wie eine Krankheit“, die er sich nicht erklären kann. Sein fundamentaler Angstzustand ist zunächst gegenstandslos. Über einer Wurzel kommt ihm dann die Erleuchtung, dass Wirklichkeit nicht mit Hilfe von Begriffen und Maßen erfasst werden kann, Existenz vielmehr ein begriffloses Erleben ist: „die Vielfalt der Dinge, ihre Individualität waren nur Schein, Firnis.“ Zurück blieb nur eine „wabbelige Masse“, „obszöne Nacktheit“ (Sartre 1999, S. 145). Die rationale Welt der Quantitäten, der Mengen, Massen, Skalen und damit die Menschenkultur bricht in ihrer Willkürlichkeit zusammen, sie verbleibt nicht bei den Dingen - Existenz wird zu einer Wirklichkeit ohne sprachliche Relevanz.
Eine Welt ohne Sprache empfindet Roquentin als starke Bedrohung, wobei die eigentliche Bedrohung darin liegt, dass die Dinge ihre Beständigkeit verlieren, da es Grundlage jeder Kultur ist, die Wirklichkeit mit Hilfe einer bestimmten Semantik zu ordnen. Es geht nicht um die Dinge an sich, sondern um ihre Bedeutung für Subjekt und Gesellschaft, insofern ihre Funktion darin besteht, in ihrer alltäglichen Vertrautheit gegen das Unerwartete, Ungewisse abzuschirmen (vgl. Dangelmayr 1988, S. 257).
Die Natur ist indifferent, feindselig und bedrohlich, es kann alles geschehen. Da Worte und Dinge ihre Beziehung zueinander verlieren, werden die Dinge unbeherrschbar. Das Subjekt gerät in einen Zustand der Orientierungslosigkeit, bei gleichzeitiger Angewiesenheit auf die Beherrschbarkeit der Dinge: „ich begriff plötzlich, daß die Existenz absurd war.“[5]
Ohne etwas deutlich zu formulieren, begriff ich, daß ich den Schlüssel meines Ekels, meines eigenen Lebens gefunden zu hatte. Tatsächlich geht alles, was ich anschließend erfassen konnte, auf diese fundamentale Absurdität zurück. Absurdität: wieder ein Wort; ich schlage mich mit Wörtern herum; dort im Park berührte ich das Ding. Aber ich möchte hier die Absolutheit dieser Absurdität festhalten… ich habe vorhin die Erfahrung des Absoluten gemacht: des Absoluten oder des Absurden. Diese Wurzel, es gab nichts, in bezug worauf sie nicht absurd war. (Sartre 1999, S. 147)
Kennzeichnend für alles Existierende ist die fehlende Erklärbarkeit und Zwecklosigkeit, es „entsteht ohne Grund, setzt sich aus Schwäche fort und stirbt durch Zufall“ (Sartre 1999, S. 152).
Eine Ausflucht ist für Roquentin die menschliche Kultur, ihre Sprache und ihr Rationalismus. Das wird klar, als er feststellt, dass ein Kreis nicht absurd ist, da er sich aus der Umdrehung einer Geraden um ihren Endpunkt erklärt, „aber ein Kreis existiert auch nicht“ (Sartre 1999, S. 147)[6]. In Roquentins Augen erscheinen Rationalismus und Kultur, mit deren Hilfe der Mensch die Natur beherrscht, als Ausweg aus dem Absurden. Nur ist dieses Mittel, durch die Ambivalenz der Sprache zerstört. Daher erklärt sich die pedantische Neigung zum Ordnen und Klassifizieren, wie es die ersten Romanzeilen nahe legen:
Das beste wäre, die Ereignisse Tag für Tag aufzuschreiben. Ein Tagebuch zu führen, um klarzusehen. Sich nicht die Nuancen, die Kleinigkeiten entgehen zu lassen, auch wenn sie nach nichts aussehen, und sie vor allem einzuordnen. (Sartre 1999, S. 9).
Das Tagebuchschreiben dient ihm dazu, die absurde Natur (Dinge) der rationalen Kultur (Zeichen) zu unterwerfen, aus dem natürlichen Chaos zu führen, Ordnung in die unstrukturierte und bedrohlich empfundene Wirklichkeit zu bringen und Sinn zu produzieren.
Roquentin ist sich allerdings bewusst, dass die Sinnhaftigkeit einer Erzählung von dem Erzähler selber abhängt, da dieser Unterscheidungen definiert. Wie festgestellt, ist es nur innerhalb eines ideologischen Diskurses möglich, sein Leben oder das anderer als Einheit darzustellen. Begriffe sind semantische Zugriffe auf die Welt, und deshalb ist in der Sprache immer schon Welterklärung in irgendeiner Weise vorhanden. Hier sieht sich das erzählende Subjekt einer Wirklichkeit gegenüber, die sich immer wieder einem ordnenden Diskurs entzieht und dadurch sein wichtigstes Instrument, die Sprache, als fragwürdig erscheinen lässt. Roquentin unterscheidet sich radikal von traditionellen Romanfiguren, bei denen vornherein eine Wertehierarchie, eine Relevanz gegeben ist, deren Sinn nie in Frage steht. Ihm ist der Wirklichkeitsbegriff problematisch geworden, was seine Verwandtschaft zu K. erkennen lässt. Die Anstrengungen, sich in der Wirklichkeit zu orientieren, die disparaten Fakten des Alltags zu ordnen, werden von der Angst getrieben, sich zu verlieren (vgl. Zima 1983, 67).
Reflektierend begreift Roquentin seinen Ekel und unterscheidet sich dadurch von Kafkas Helden, die ihren Zustand nie begreifen können. Er ist „an der letzten Station der Einweihung ins Mysterium des Absurden“, so Haug, „ein Niemand geworden, der alles Was und Noch-nicht abgebaut hat, dessen Ich erloschen ist, bloßes sich perpetuierendes Bewußtsein“ (Haug 1966, S. 55).
2.2.3 Objektivierung der Handlung bei Camus
Das Problem der Indifferenz tritt am deutlichsten zutage in Albert Camus’ Roman Der Fremde. Die Titelfigur Meursault unterscheidet sich klar von seinen Vorgängern: Während Michele in Die Gleichgültigen seine Indifferenz noch als störend empfindet, gegen sie ankämpft, während Roquentin in Der Ekel die Gleichgültigkeit als merkwürdig und erschreckend erscheint, ist Camus’ Held gleichgültig, ohne dies thematisieren zu müssen. Der Zustand der Indifferenz ist bei ihm vollkommen immanent und natürlich geworden.
Während bei Kafka und Sartre noch ein suchendes Bewusstsein vorausgesetzt wird, das hinter dem Schein einer ambivalenten Wirklichkeit eine andere Wahrheit vermutet, bringt die Gleichgültigkeit des Helden Meursault einen Verzicht auf die Suche mit sich, in dem zugleich Bewusstsein und Innerlichkeit des Helden an Bedeutung verlieren. Bei Meursault drückt sich „das Lebensgefühl apathischer Bindungslosigkeit angesichts des Absurden“ aus, schreibt Daus (zit. nach Poppe 1993, S. 17). Als Ergebnis seines absurden Denkens stellt sich völlige Gleichgültigkeit allen gesellschaftlichen Werten gegenüber ein. Teilnahmslos berichtet der Ich-Erzähler sein Erleben, als ginge es ihn gar nichts an. Schon die ersten Worte des Romans machen dies deutlich: „Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß nicht“ (Camus 1994, S. 7).
Meursault ist nicht der einzige Gleichgültige in dem Roman. Die Indifferenz ist in seiner Welt eine kollektive Erscheinung. So zählt in den Augen seines Arbeitgebers die versäumte Arbeitszeit, selbst bei den alten Freunden der Mutter zweifelt Meursault am Mitgefühl: „Ich hatte sogar den Eindruck, daß diese in ihrer Mitte aufgebahrte Tote ihnen nichts bedeutete“ (Camus 1994, S. 16).
Meursault unterscheidet sich wesentlich von den anderen durch seine Einstellung zur Indifferenz, die er bewusst akzeptiert und durch seine Tat, die aus der Indifferenz hervorgeht. Er lehnt den Schein als Selbstbetrug ab und erkennt den illusorischen und willkürlichen Charakter ideologisierter Wertmuster. Er erkennt „in der Gleichwertigkeit aller Werte und Wörter, die geheime Wahrheit seiner Gesellschaft, eine Wahrheit, die niemand auszusprechen wagt und die von Ideologen aller Art bekämpft wird“ (Zima 1983, S. 163).
Die Entfremdung zwischen Erzähler und Subjekt erklärt sich aus der Tatsache, dass Meursault nicht als selbstständiger Akteur handelt. Camus Misstrauen der wahren Erzählung gegenüber führt dazu, dass die Geschichte als Zielgerichteter Prozess ersetzt wird durch eine fatale Abfolge von intentionslosen Ereignissen: Zufällig und grundlos, ohne jegliche Motivation tötet Meursault einen Araber. Er schießt, weil die Sonne in des Arabers Messerklinge so funkelte und wegen der Hitze. Das Verbrechen ist völlig ziel- und zwecklos – die Tat eines absurden Menschen.
Camus objektiviert die Handlung in einem bis dahin unbekanntem Maße. Das reduzierte Subjekt, unfähig zum autonomen Entscheiden und Bewerten, fällt der Fatalität zum Opfer, die es zu einem passiven Zuschauer macht. Hierin drückt sich Nietzsches Philosophie aus: ein Ereignis verursacht das andere, wobei der Zufall den gesamten Handlungsablauf beherrscht. Meursault handelt als ein Objekt der absurden Natur, wobei Natur hier im Sinne von Fatalität zu verstehen ist, als Naturereignis im intentionslosen und akzidentellen Lauf der Dinge.
Die Tat Meursaults spielt sich nicht nur jenseits von Gut und Böse, sondern jenseits von Intentionalität, Absichtlichkeit und Willensfreiheit ab. Die Passage verweigert Ursache, Motivation, Kausalität und Sinn der Tat:
Mein ganzes Sein hat sich angespannt, und ich habe die Hand um den Revolver geklammert. Der Abzug hat nachgegeben, ich habe die glatte Einbuchtung des Griffes berührt, und da, in dem zugleich harten und betäubenden Knall, hat alles angefangen. (Camus 1994, S. 73)
Der Zufall, der den Tod herbeiführt, bezeugt keine andere Notwendigkeit als diejenige des bloß Möglichen, des Absurden selbst: „Ich hätte so gelebt, und ich hätte auch anders leben können. Ich hätte das eine getan, und ich hätte das andere nicht getan. … Nichts, nichts wäre von Bedeutung“ (Camus 1994, S. 141f).
Die Justiz fasst die Handlung als Ergebnis eines geplanten Handlungsablaufs auf, als Absicht, für die ein schuldiges strafbares Subjekt verantwortlich ist. Der Staatsanwalt geht von christlich-humanistischen Werte- und Relevanzkriterien aus, mit deren Logik er dem sinnlosen Akt einen fiktiven Sinn zuweist. Das Gericht ist bemüht, aus Meursault den Außenseiter, eine unmoralische Instanz zu machen, da Gleichgültigkeit das gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet. Der Richter tritt als Vertreter einer Kultur (Ideologie und Moral) auf, die die Idee der wahren Geschichte verteidigt. Die Justiz stilisiert den Gleichgültigen zu einem ideologischen Subjekt.
Camus stellt die bürgerliche Ideologie und Geschichtsschreibung sowie deren Schlüsselbegriffe in Frage: der Glaube an das verantwortliche Subjekt mit einer Absicht und die Darstellbarkeit der Wirklichkeit als eindeutige teleologische Erzählung. Meursault ist ohne Innerlichkeit und folglich ohne Geschichte, die ja voraussetzen würde, dass ein Subjekt wertet und seine Werturteile im Laufe der Zeit ändert. Das „Heute … vielleicht auch gestern“ zu Beginn des Romans wirkt bereits wie eine Zeitangabe ohne wirklichen Bezug, ohne Referenten. Es kündigt die totale Zeitlosigkeit, in der das absurde Bewusstsein lebt. Der Fremde lebt in einer mythischen Gegenwart, ohne eine Sinn gebende Vergangenheit. Meursault lädt den Zorn der Ideologen auf sich, weil er die Vertauschbarkeit der Relevanzkriterien zur Schau stellt, die Grundlagen ihrer Dialektik und den Sinn ihrer Welt, erschüttert. Der Untersuchungsrichter sperrt sich mit dogmatischem Eifer gegen diese Erkenntnis: „‚Wollen Sie’, hat er ausgerufen, daß mein Leben keinen Sinn hat?’“ (Camus 1994, S. 84).
Vom Erzähler wird alles mit nüchterner Ironie wiedergegeben, die sich vom ideologischen Eifer des Priesters und Staatsanwalts abhebt. Reflexivität, Innerlichkeit und Wertung sind auf ein Minimum beschränkt. Ihm liegt nichts daran, seine Taten psychologisch zu erklären, irgendetwas zu rechtfertigen, den Mangel an Trauer zu verstehen, der ihm vorgeworfen wird. Ebenso neigt er dazu, das Benehmen anderer wertfrei zu beschreiben, statt es zu be- oder verurteilen.
Nach seinen Motiven befragt, die ihn veranlassten, den Araber zu töten, antwortet Meursault mit dem Hinweis auf den Einfluss der Sonne. Indem er sich auf diese Erklärung beschränkt, lehnt Meursault die Rolle des verantwortlichen Subjekts ab. Als Scheinsubjekt ist er für seine Geschichte nicht verantwortlich, er registriert lediglich die Ereignisse, als handle es sich um die Geschichte eines Fremden. Camus macht in einer mythologisierten Darstellung Sonne und Wasser zu den Triebfedern des Handelns: die Sonne symbolisiert das destruktive Prinzip, den Tod, das Wasser lebenserhaltende Einflüsse. Sonne und Wasser, Tod und Leben bilden ein Ganzes, in dem alles bzw. nichts wert hat. Auf die Verbindung von Natursymbolik und Marktgesetzen weist Zima (1983, S. 187) hin: „Die naturbedingte, blinde Kausalität, die Meursaults Handeln beherrscht, ist eine mythische Darstellung der Verdinglichung in der spätkapitalistischen Gesellschaft.“
2.3 Das Theater des Absurden
Die Welt erscheint mir mitunter leer von Begriffen und das Wirkliche unwirklich. Dieses Gefühl der Unwirklichkeit, die Suche nach einer wesentlichen, vergessenen, unbenannten Realität, außerhalb derselben ich nicht zu sein glaube, wollte ich ausdrücken – mittels meiner Gestalten, die im Unzusammenhängenden umherirren und die nichts ihr eigen nennen, außer ihrer Angst, ihrer Reue, ihrem Versagen, der Leere ihres Lebens. Wesen, die in etwas hineingestoßen sind, dem jeglicher Sinn fehlt, können nur grotesk erscheinen, und ihr Leiden ist nichts als tragischer Spott. Wie könnte ich, da die Welt mir unverständlich bleibt, mein eigenes Stück verstehen? Ich warte, daß man es mir erklärt. (Eugene Ionesco: zit. nach Hildesheimer 1976, S. 173)
2.3.1 Bildungskultur ad absurdum
Der Stil der Existentialisten lässt noch deren Überzeugung ahnen, logische Abhandlungen könnten gültige Lösungen erbringen. Sie stellen die als absurd wahrgenommene Welt noch in traditionelle künstlerische Formen dar, durch eine diskursive, logische und relativ kohärente Handlung. Hier liegt ein Widerspruch, den die Dramatiker des absurden Theaters zu überwinden suchten. Sie verzichten darauf, über die Absurdität der menschlichen Existenz zu diskutieren, sondern stellen sie in poetischen Bildern als konkrete Gegebenheit dar. Es werden keine konkreten Probleme angeschnitten, noch eindeutige Lösungen geliefert.
Das Theater des Absurden diskutiert keine ideologischen, philosophischen oder religiösen Weltanschauungen, versucht nicht, eine Welt der Wirklichkeit darzustellen, wie die naturalistische Dramenform. An ihre Stelle tritt ein Spiel mit Paradoxien, Allegorien und Bildungsresten, die die Absurdität einer jeden Ideologie, Philosophie oder Wissenschaft offen legen. Hat der Existentialismus, so Adorno,
Philosophie als poetischen Vorwurf ausgeschlachtet, so präsentiert Beckett, gebildeter als irgendeiner, ihm die Rechnung: Philosophie, Geist selber deklariert sich als Ladenhüter, traumhafter Abhub der Erfahrungswelt … Auf die Ermunterung mitzuhalten, antwortet er mit Parodie, der der Philosophie, die seine Dialoge ausspuckt, nicht anders als der der Formen. Parodiert ist der Existentialismus selber; von seinen Invarianten nichts übrig als das Existenzminimum. … Er zuckt die Achseln über die Möglichkeit von Philosophie heute, von Theorie überhaupt. Die Irrationalität der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase ist widerspenstig dagegen, sich begreifen zu lassen ... (Adorno 1965, S. 191f)
Jede Ideologie oder Deutung der menschlichen Existenz, jeder noch so ambitionierte Versuch einer Welterklärung, ja fast jeder Diskurs erscheint Samuel Beckett absurd. Das Absurde Theater begreift den Zustand der Entfremdung als gesellschaftliche Wirklichkeit, und macht die Absurdität der menschlichen Situation durch eine Form der Aussage sichtbar, die völlig mit dem Ausgesagten übereinstimmt. Mit den Mitteln der Satire und der Farce entlarvt es das Scheinleben des Menschen, der seine eigene Wirklichkeit nicht erkennt, nicht erkennen will.
Jedes Festhalten an einem Denksystem, welches die Welt und die Stellung des Menschen darin erklären wollte, wirkt wie eine naive Illusion, eine Flucht vor der Wirklichkeit. Der Rumäne Eugène Ionesco schreibt: „Da das Wissen vom Leben getrennt ist, schließt die Kultur uns nicht mehr ein (oder jedenfalls nur einen unbedeutenden Teil von uns), denn sie bildet einen ‚sozialen’ Zusammenhang, in dem wir nicht integriert sind“ (zit. nach Esslin 1967, S. 424). Bereits Nietzsche sagte, der moderne Kulturmensch sei nur noch „Konterfei der ihm als Natur geltenden Summe von Bildungsillusionen“ (Nietzsche 1990, Bd. 3, S. 420).
„Ich interessiere mich für die Form einer Idee, auch wenn ich nicht an sie glaube“ (zit. nach Birkenhauer 1971, S. 9), sagt Beckett, der einmal „die unendliche Nichtigkeit … von allem, was nicht Kunst ist“ verkündete (zit. nach Haug 1966, S. 25). Bei ihm wird Theater zu einem „aller Spiegelbildlichkeit ledigen Spiel mit Elementen der Realität“ (Adorno 1965, S. 198), dessen Dramaturgie darin besteht, alle Geschichtsreste und Sinnfetzen, untereinander ad absurdum führen zu lassen. Sein Werk ist voll mit literarischen, theologischen, philosophischen, sozialen, historischen und mythologischen Anspielungen, welche nichts mehr bedeuten, sondern in ihrer willkürlichen Anordnung das Bildungschaos repräsentieren, das in der Blindheit seiner Figuren Pozzo im Godot und Hamm im Endspiel eine konkrete Metapher findet.
Was Beckett an Philosophie aufbietet, depraviert er selber zum Kulturmüll, nicht anders als die ungezählten Anspielungen und Bildungsfermente, die er im Gefolge der angelsächsischen Tradition der Avantgarde … verwendet. Ihm wuselt Kultur wie dem Fortschritt vor ihm das Gekröse von Jugendstilornamenten, Modernismus als das Veraltete an der Moderne. Die regredierende Sprache demoliert es. Solche Sachlichkeit tilgt bei Beckett den Sinn, der Kultur war, und dessen Rudimente. (Adorno 1965, S. 188)
Die Realität im Theater des Absurden ist nicht naturalistische Wirklichkeit, sondern Daseinsgefühl. Die Stücke sind nach außen projizierte Gemütszustände, Gleichnisse für den „seelischen Innenraum“ (Poppe 1998, S. 22). Sie bringen die Einsicht zum Ausdruck, dass es keine Einsicht in die Dinge gibt, keine endgültigen Wahrheiten oder absoluten Wertesysteme. Das Absurde zeigt den Menschen isoliert in einer bedrohlichen und verfallenen Welt, aus der es keinen Ausweg gibt. Die Figuren kennen keine Ideale, haben weder Ziel noch Halt. Es erfasst sie eine namenlose Angst und Verzweiflung vor der inneren Leere, die ihr Denken und Tun beherrschen.
2.3.2 Reduktion von Handlung und Figuren
Das Theater des Absurden besitzt keine Handlung im traditionellen Sinne. Es wird weder eine geschlossene gegenständliche Welt dargestellt, noch ein logisch fortschreitendes Geschehen. Stattdessen gibt es Nonsens, gedankliche Akrobatik und Dialoge ohne Ziel – eine Komposition von Bildern, die sich nicht zu einer Geschichte zusammenfügen. Die klassischen Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung sind aufgehoben. Das absurde Theater zeigt keine Entwicklungslinie, sondern einen kreisförmigen Aufbau, dessen Entwicklung in der Steigerung der desolaten Ausgangssituation liegt. Doppelung, Parallelität, Kreisbewegung, Rückwendung des Endes in den Anfang sind die Strukturmerkmale.
[...]
[1] Der griechische Mythos stammt aus dem 11. Gesang von Homers Odyssee. Die Götter hatten Sisyphos dazu verurteilt, einen Felsblock unablässig auf den Berg zu wälzen. Wegen seines Gewichtes rollte der Stein kurz vor dem Gipfel immer wieder hinab. Die Gründe für die Bestrafung waren Verachtung der Götter, Hass gegen den Tod und Liebe zum Leben (vgl. Ranke-Graves, S. 194ff).
[2] Auch neueste Ergebnisse aus der Gehirnforschung zweifeln die Freiheit des Willens an, wie aus dem Artikel, „Wir können nicht anders“, aus der FAZ (4.11.2003) hervorgeht. Die Hirnforscher Wolf Singer und Gerhard Roth haben demnach herausgefunden, dass neuronale Prozesse für unser Denken und Handeln verantwortlich sind, womit eine Änderung des gängigen Strafrechts diskutiert werden müsse. Denn bisher wird schuldig gesprochen, weil man davon ausgeht, das denkende Subjekt hätte auch anders handeln können, als tatsächlich geschehen (vgl. Lüderssen 2003).
[3] Der französische Philosoph Brice Parain war Lektor von Jean-Paul Sartre, sowie Darsteller des Philosophen in Jean-Luc Godards Film VIVRE SA VIE/ DAS LEBEN DER NANA S. (1962).
[4] Hugo Ball berichtet z.B. von einer simultanen Rezitation drei verschiedener Gedichte, was ein undeutliches Gemurmel ergab. Diese Vorführung sollte „den Widerstreit der vox humana mit einer sie bedrohenden, verstrickenden und zerstörenden Welt, deren Takt und Geräuschablauf unentrinnbar sind“ zeigen (zit. nach Esslin 1967, S. 377).
[5] Textpassage war in der ursprünglichen Fassung vom Lektor gestrichen worden, deshalb im Anhang der Ausgabe (vgl. Sartre 1999, S. 234). – Zudem sei hier an die von Vilém Flusser gebrauchte Definition erinnert, die das Wort „absurd“ mit „Entwurzlung“ beschreibt (vgl. 1.1), so dass die Bank über der Baumwurzel der wohl symbolischste Ort ist, an dem Roquentin seine Entwurzlung und Bodenlosigkeit bewusst werden kann.
[6] Wie F. Jeanson bemerkt, unterscheidet Sartre sich hier wesentlich von Camus: „Camus würde der Kreis selbst als absurd erscheinen: als ein vergeblicher Versuch, eine nichtrationale Welt zu rationalisieren, als das Produkt eines Geistes, der unfähig ist, sich den Dingen anzupassen. Damit würde er das Absurde im menschlichen Handeln selbst – ohne Rücksicht auf dessen Beschaffenheit – ansiedeln, während Sartre es ausschließlich auf die dinghafte Welt der Existenz bezieht, weil gerade in dieser Welt das Menschliche untergeht, sich zwischen den Dingen verliert“ (zit. nach Zima 1983, S. 190).
- Arbeit zitieren
- Christian Schumacher (Autor:in), 2004, The man who wasn’t there (Coen, 2001), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81541
Kostenlos Autor werden


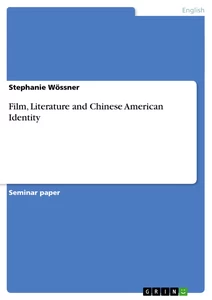









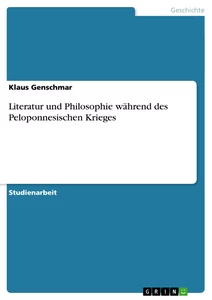









Kommentare