Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Theoretischer Bezugsrahmen
1.1 Theorien zur Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption
1.1.1 Der aktive Mediennutzer
1.1.1.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
1.1.1.2 Kritik und Erweiterungen
1.1.2 Der Unterhaltungsbegriff innerhalb der Rezeptionsforschung
1.2 Das integrative Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten
1.3 Erklärungsansätze und Befunde zum Sad Film Paradoxon
1.3.1 Das Genre ‚Sad Film’
1.3.2 Differentielle Medienwirkung und Rezipientenmerkmale
1.3.2.1 Gender
1.3.2.2 Persönlichkeitseigenschaften
1.3.2.3 Alexithymia und Filmpräferenz
1.3.3 Erklärungsansätze in Bezug auf affektive und kognitive Aktivität
1.3.3.1 Identifikation
1.3.3.2 Empathie
1.3.3.3 Stellenwert der Protagonisten
1.3.3.4 Stimmungsregulation
1.3.3.5 Evolutionspsychologische Perspektive
1.3.3.6 Kognitive Kontrollprozesse medieninduzierter Emotionen
1.3.3.7 Prozesse des sozialen Vergleichs
1.3.3.8 Einstellungen zum Mitgefühl
1.3.3.9 Meta-Emotionen
1.3.3.10 Perspektive des ‚Terror Managements’
1.3.4 Zusammenfassung: Der Stand zum Sad Film Paradoxon
2 METHODE
2.1 Fragestellung und Begründung für die Wahl einer qualitativen Untersuchungsmethodik 50
2.2 Die besonderen Merkmale qualitativer Forschung
2.2.1 Prinzipien und Regeln im Rahmen qualititativer Untersuchungen
2.2.2 Gütekriterien innerhalb qualitativer Forschung
2.2.3 Qualitative Datenerhebung mit halb-strukturiertem Leitfaden
2.3 Ablauf der Untersuchung
2.3.1 Begründung für die Art des Untersuchungsablaufes
2.3.2 Stichprobe
2.3.3 Untersuchungsfilm
2.4 Datenauswertung im Rahmen qualitativer Forschung
2.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
2.4.2 Vorgehen bei der Datenauswertung
2.4.3 Explikation des Kategoriensystems
2.5 Zusammenfassung: Methode
3 Ergebnisse
3.1 Begründung für die Art der Ergebnisdarstellung
3.2 Einzelfallbeschreibungen
3.3 Darstellung der ausgewerteten Daten
3.4 Motivklassen und geschlechtsspezifische Unterschiede
4 Diskussion
4.1 Modalitäten: Entertainment durch traurige Filme?
4.2 Motive: Gratifikationen durch traurige Filme?
4.3 Fazit
4.3.1 Resumée
4.3.2 Grenzen der Arbeit und Ausblick
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
LITERATUR
ANHANG
Anhang A
Anhang B
Anhang C (Interviews)
Einleitung
„Ich sehe traurige Filme dann gerne, wenn sie tragisch gut gemacht sind. [...] Wenn man die Tiefen nicht hat, kann man die Höhen nicht beurteilen, und wenn man nicht weiß, was traurig bedeutet. Er [der Film] lässt mich an andere Menschen erinnern z. B., und das sensibilisiert mich dann eben […].“
(Rezipient trauriger Filme / Interviewperson, männlich, 30 Jahre alt)
Unterhaltung und damit verbundener Spaß scheinen allgemein favorisierte Freizeitthemen innerhalb der modernen Kultur zu sein, und Unterhaltung hat innerhalb der Medien damit eine zentrale Funktion. Zahlreiche Möglichkeiten bieten sich, um sich ausreichend zu ‚‚entertainen’’. Viele Menschen weltweit nutzen hierfür die Medien: sie sehen bspw. in ihrer Freizeit Filme im Fernsehen, gehen ins Kino, oder scheuen nicht den Gang zu einer Videothek, um sich Filme für den häuslichen Zeitvertreib auszuleihen, indem sie dadurch Zerstreuung und Vergnügen suchen. Unschwer lässt sich beobachten, wie die Faszination von Filmen, ob als ästhetisches Kulturgut oder als eher unreflektierte Freizeitbeschäftigung genutzt, heutzutage ein weit verbreitetes Phänomen darstellt, das sich durch eine breit gestreute Akzeptanz als Unterhaltungsmöglichkeit auszeichnet.
Unter dem Begriff Unterhaltung/Entertainment wird im Rahmen zahlreicher kommunikationswissenschaftlicher und medienpsychologischer Untersuchungen zur Mediennutzung und Medienwirkung auch die Rezeption von Filmen subsumiert. Insbesondere für die Erforschung der Motive im Rahmen des Uses-and-Gratifications-Ansatzes stellt sich die Frage nach dem Nutzen von Unterhaltung für das Individuum. Geht es den Zuschauerinnen und Zuschauern tatsächlich nur um Zerstreuung und einen größtmöglichen hedonistischen Gewinn? Die Palette an speziellen Filmgenres scheint unendlich zu sein und die Zuschauerinnen und Zuschauer wenden sich selektiv den Fernsehformaten und Kinoprogrammen zu. Diese beinhalten jedoch neben bspw. Komödien, Krimis oder Actionfilmen, auf der anderen Seite Romanzen, Dramen oder Tragödien, die zum einen oft keinen „leicht verdaulichen Stoff“ bieten und eine Unterhaltungsform liefern, die häufig auf Herzensleid und unausweichlichem Scheitern der Protagonisten beruht und oft noch nicht einmal mit einem Happy-End belohnt.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben bei der Rezeption dieser Art von Filmen mit traurigem Inhalt intensive Gefühle, die normalerweise als unangenehm beurteilt werden: Trauer, Verzweiflung, Angst, Hoffnungslosigkeit. Der kommerzielle Erfolg der ‚Tearjerker’[1] (amerikanischer Begriff für ‚Schnulzen’) oder Dramen und Tragödien in Fernsehen und Kino zeigt, dass die Rezipienten diese Art des Mediums als Entertainment wahrnehmen und folglich Filme, die traurige Gefühle auslösen, gezielt aufzusuchen scheinen. Dieses „Paradoxon“ wird seit Anfang der 90er Jahre in mehreren Studien im Rahmen medienpsychologischer Forschung untersucht und als Sad Film Paradoxon bezeichnet. Hauptaugenmerk wurde vor allem auf die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Geschlechterunterschieden, Empathieerleben (Mills, 1993; Oliver, 1993; Oliver, Sargent & Weaver, 2000) und dem Bewertungskonzept der Meta-Emotionen (Mayer & Gaschke, 1988) gelegt. Insbesondere Oliver (1993) untersuchte verschiedenste Ansätze zur Erklärung der Nutzung unterhaltender Medienangebote mit traurigem Inhalt wie bspw. Stimmungsregulationstheorien und inwiefern diese das Paradoxon des Vergnügens an traurigen Filmen erklären können. Inwieweit Rezipienten ihr subjektives Erleben während der Rezeption beschreiben und wie sie sich selbst die Frage nach den Gratifikationen beantworten, die sie aus diesem Medienangebot erhalten bzw. warum sie gezielt nach diesem Medium greifen, ist auf diesem qualitativen Weg bisher noch nicht untersucht worden.
In einem Artikel in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung (Westerhoff, 2007, 24./25. Februar) wurde erst kürzlich darüber berichtet, wie Filme mit Themen wie Liebesleid, Krankheit oder Tod von amerikanischen Psychologen gar im Rahmen einer Filmtherapie eingesetzt werden und sich positiv auf die Psyche ihrer Patienten auswirken sollen. Die Wirksamkeit der Filmtherapie ist jedoch noch nicht empirisch belegt. Neben dem Wie der Wirkweise, ist diesbezüglich ebenso wenig bekannt, was und welche Motive und Gratifikationen dazu führen, dass Filme mit traurigen Inhalten sogar eine heilsame Wirkung erzielen können.
Diese Arbeit soll deshalb einen explorativen Beitrag im Rahmen einer Diplomarbeit für dieses noch relativ junge und wenig erforschte Themengebiet innerhalb der Medienpsychologie leisten und widmet sich mithilfe einer qualitativen Einzelfallstudie unter anderen der Frage, warum sich Personen mit dieser Art von Filmen mit traurigen Inhalten „‚entertainen’“. Zum anderen geht es aber auch um die Frage, wie die Rezipienten diese Art des Mediums wahrnehmen und welchen Nutzen sie aus der Rezeptionssituation ziehen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei das persönliche Erleben und dessen subjektive Bedeutungszuschreibung bzgl. der Selektion und Rezeption trauriger Filme. Des weiteren sollen sich dadurch zusätzlich auch Hinweise ergeben, was der Einzelne überhaupt unter einem „traurigen“ Film versteht. Da hier davon ausgegangen wird, das Themen wie Tod / Sterben, bzw. Krankheit zentrale Elemente trauriger Filme darstellen, wird der Umgang mit diesen Themen eruiert.
Ausgehend von der Tatsache, dass Filme im allgemeinen und traurige Filme im besonderen ein emotionalisierendes Medium darstellen, das unser Erleben und Verhalten beeinflusst, stellt sich die Frage nach den affektiv-kognitiven Aktivitäten der Zuschauer während des Rezeptionsprozesses eines traurigen Filmes.
Bezüglich der selektiven Zuwendung zu diesem speziellen Medium stellt sich ebenso die Frage: wer schaut traurige Filme? Gibt es Ansätze, die auf einen eventuellen Zusammenhang zwischen vorherrschenden Persönlichkeitsmerkmalen und der Nutzung des Mediums ‚Sad Film’ hindeuten könnten? Sind Unterschiede im Selektions- bzw. Rezeptionsverhalten bezüglich dieses tragischen Genres zwischen Frauen und Männern erkennbar?
Zunächst ist es jedoch notwendig, in Kapitel 1, dem theoretischen Teil der Arbeit, eine kurze Einführung in grundlegende Theorien der Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption zu geben. (Aufgrund des begrenzten Umfangs einer Diplomarbeit musste die Auseinandersetzung mit den allgemeinen Theorien zur Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption möglichst knapp gehalten werden). Des weiteren wird das Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten vorgestellt, woraufhin ein Überblick zu bisherigen Erklärungsansätzen und empirischen Befunden zum Sad Film Paradoxon folgt. Dabei wird auf die Rezeptionssituation der Unterhaltung Bezug genommen und die Befunde im Rahmen allgemeiner Ansätze zum Rezeptionsverhalten dargestellt. Schließlich wird ein Ausblick auf die Untersuchung der vorliegenden Arbeit gegeben.
Kapitel 2 liefert einen Überblick über die zum Einsatz kommende Methodik und die Beschreibung des Untersuchungsablaufs. Die Datenerhebung- und Auswertung erfolgte durch den Einsatz eines qualitativen Interviews als Datenerhebungsinstrument und einer inhaltsanalytischen Auswertung. An dieser Stelle soll auch das dabei zum Einsatz kommende Kategoriensystem expliziert werden.
In Kapitel 3 werden die gewonnenen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und zudem anhand von Einzelfallbeschreibungen präsentiert.
In Kapitel 4 erfolgt eine Interpretation und Diskussion der Ergebnisse und Grenzen der Arbeit sowie ein Ausblick auf wünschenswerte Entwicklungen für die Rezeptionsforschung und das Sad Film Paradoxon.
1 Theoretischer Bezugsrahmen
1.1 Theorien zur Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption
Inwieweit sich Menschen für ein bestimmtes Medium oder einen speziellen Inhalt wie bspw. eine traurige Liebesgeschichte innerhalb des Mediums „narrativer Film“ (Vorderer, 1992, S. 50) entscheiden, und welche kurzfristigen und/oder auch längerfristigen Wirkungen damit verbunden sind, wird im Rahmen medienpsychologischer Forschung seit mehreren Jahrzehnten untersucht. Nach Meyen (2004) haben die wissenschaftlichen Debatten über Medienwirkungen in Bezug auf die Wirkungen einen „blinden Fleck“ – es werde nicht genügend erforscht, wie und warum Menschen überhaupt Medien nutzen. Mit Bezug auf Hasebrink (2003, zitiert nach Meyen, 2003) geht Meyen von einem Prozess der Mediennutzung aus, der als übergeordnete Kategorie von Hasebrink verwendet wurde und differenziert wird in (a) Medienauswahl, (b) Medienrezeption und (c) Medienaneignung. Die Auswahl eines bestimmten Medienangebots zielt auf eine prä-kommunikative Phase, in der sich beim Rezipienten Selektionsmotive und eine bestimmte Art der Zuwendung zum spezifischen Medium ausbilden. Während der Medienrezeption, der kommunikativen Phase, fragt die Forschung, welche kognitiven und emotionalen Prozesse ablaufen, bzw. „[...] was während des Kontakts zwischen Medienangebot und Nutzer passiert“ (Meyen, 2003, S.10). In der prä-kommunikativen Phase wird nach den Konsequenzen für das Individuum durch das spezifische Medienangebot gefragt. Die Erkenntnisse, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnen werden sollen, beziehen sich gleichsam auf alle Phasen des Selektionsprozesses bzgl. der Rezeption trauriger Filme. Es ist jedoch die prä-kommunikative Phase, in der Rezipientinnen und Rezipienten[2] zu ihren Motiven und subjektiven Theorien im Rahmen der vorliegenden Arbeit befragt werden.
Bezüglich der individuellen Mediennutzung wurde vor allem bezüglich des Uses-and-Gratifications-Ansatzes, der sich in den 1970er Jahren entwickelte, nach Ursachen für den Gebrauch von Medienangeboten gesucht und das Individuum als aktiver Nutzer dieses Mediums gesehen, der bestrebt ist, dadurch seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es sind die Motive, die als Ursache der Mediennutzung eine zentrale Rolle innerhalb dieses Ansatzes des aktiven Mediennutzers spielen.
1.1.1 Der aktive Mediennutzer
1.1.1.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
Dieser Ansatz fragt nicht „Was machen die Medien mit den Rezipienten?" – wie dies im Wirkungsparadigma der 1920er bis 1960er Jahre in der Forschung gefragt wurde (vgl. Vorderer 1992) – sondern umgekehrt: „Was machen die Rezipienten mit den Medien?". Der ‚Uses-and-Gratifications-Approach’ entwickelte sich als Forschungsansatz, bei dem die Wiederentdeckung des Rezipienten im Vordergrund steht. Meyen (2004) definiert diesen Ansatz als handlungstheoretischen bzw. motivationalen Ansatz im Vergleich zum . verhaltenstheoretischen Wirkungsansatz, aus dessen Perspektive die Mediennutzer lediglich auf die Medienbotschaften reagieren. Die ursprüngliche theoretische Formulierung und Modellierung wurde von Katz und Blumler (1974, zitiert nach Meyen, 2004) umgesetzt. Damals wie heute stehen menschliche Bedürfnisse, die individuelle Erwartungen generieren im Mittelpunkt, wobei sich der Rezipient aktiv, rational und zielgerichtet dem Medium zuwendet, um durch dieses eine Belohnung zu erhalten: die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Es wurde konstatiert, dass der Mensch explizit benennbare Bedürfnisse hat und sich mit ganz bestimmten Erwartungen im Hinblick auf das gewünschte Ziel einem entsprechenden Medium zuwendet. Weiterhin wird innerhalb dieses Ansatzes beobachtet, dass die einzelnen Medien dabei zum einen untereinander und Programminhalte innerhalb eines Mediums, zum anderen aber auch mit anderen Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung miteinander konkurrieren.
Im Nutzen- und Belohnungsansatz kommt der Frage, warum der einzelne Rezipient sich einem ganz bestimmten Medium oder Programminhalt zuwendet, eine zentrale Bedeutung zu, ebenso ist dies in der vorliegenden Arbeit der Fall.
1.1.1.2 Kritik und Erweiterungen
Der zentrale Bedürfnisbegriff stellte sich innerhalb der Uses-and-Gratifications-Theorie als theoretisches Problem heraus (vgl. Bonfadelli, 2004). Vorderer (1992) bezieht in seiner Kritik diesen Aspekt auf eine „eklatante Theorieschwäche [..]“ die sich vor allem in dem „Versuch einer funktionalen Zurückführung der Mediennutzung auf – als zugrundeliegend konstatierte – Bedürfnisse“ manifestiere (Vorderer, 1992, S. 28). Diese Theorieschwäche und theoretische Beliebigkeit der Uses-and-Gratifications-Theorie wurde wiederholt kritisiert.
Ein weiterer Versuch, den Bedürfnis-Begriff innerhalb des Nutzen-Belohnungs-Ansatzes genauer zu differenzieren, erfolgte durch Rosengreen (1985, zitiert nach Bonfadelli, 2004). Er konzipierte zur Analyse der Nutzung von TV-Nachrichten eine vierpolige Typologie (vgl. Bonfadelli, 2004) in Umweltorientierung, Parasoziale Beziehungen, Sozialer Integration und Para-Orientierung.
Nicht in das Theoriekonzept des Nutzen- und Belohnungs-Ansatzes mit einbezogen wird die Annahme, dass soziale und psychologische Ursprünge der Bedürfnisse existieren, die Erwartungen nach sich ziehen und an die Medien gestellt werden. Bezogen auf die Motivation zur Fernsehnutzung (Schmitz et al, 1993) spielen neben diesen Erwartungen die individuelle und situative Motivation, eingebettet in einen sozialen Kontext, eine zentrale Rolle. Palmgreen (1984) versuchte, die Entstehung von Nutzungsmotiven aus den Bedürfnissen heraus in das Zentrum seines Modells zur Erklärung von Fernsehnutzung zu stellen, wobei diese Bedürfnisse wiederum aus verschiedensten psychologischen und sozialen Einflussfaktoren entstehen. Dabei handelt es sich um ein Prozessmodell, dem zufolge das „Produkt von Vorstellungen (Erwartungen) und Bewertungen die Suche nach Gratifikationen beeinflusst, die dann auf die Mediennutzung einwirkt“ (Palmgreen, 1984, S. 56).
In diesem integrativen Gratifikationsmodell der Massenmediennutzung (vgl. Palmgreen, 1984) werden sowohl bewusste als auch unbewusste Auslöser für die Bedürfnisse dargestellt, aus denen die Nutzungsmotive entstehen. Das Modell trägt nicht nur dem Kritikpunkt am Uses-and-Gratifications-Ansatz Rechnung, dass sich Rezipienten ihrer Motive immer vollständig bewusst sein sollen, sondern ebenso der Kritik in Bezug auf die Qualität der Bedürfnisbefriedigung, die in Palmgreens Modell explizit differenziert wird und einen wichtigen Platz innerhalb seiner Theorie einnimmt.
Bezüglich des Problems der Motivnennung werde nach Zillmann (1994) der Rezipient vermutlicher Weise nur das sagen, was ihm früher einmal an Motiven beigebracht worden sei (vgl. auch Vorderer, 1992). Mit Bezug auf Groeben und Vorderer (1988, zitiert nach Vorderer, 1992) spricht Vorderer in diesem Zusammenhang von „sozialer Erwünschtheit“ und „Überschätzung der befragten Person“ (Vorderer, 1992, S. 34 ff.).
Es wurde mehrfach kritisiert, dass die Publikumsaktivität in diskutierter Theorie zu unklar definiert sei, nicht als zielorientiert dargestellt und generell überbetont würde (vgl. z. B. Bonfadelli, 2004 und Vorderer, 1992). Levy und Windahl (1984, zitiert nach Bonfadelli, 2004) differenzierten die Publikumsaktivität in zwei Dimensionen: Selektivität, Involvement und Nützlichkeit – wonach sich das Publikum orientiert – auf der einen Dimension und in Sequenzphasen der Aktivität während einer Kommunikation, die wiederum umrahmt wird von einer prä- und einer postkommunikativen Phase als eine andere Dimension.
Letztere Unterteilung wurde in dieser Arbeit bereits oben erwähnt. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Untersuchung bezieht sich hinsichtlich der Untersuchung von Rezeptionsmodalitäten bei der Rezeption trauriger Filme auf die Analyse der Aktivitäten in der Phase ‚während der Kommunikation´ (vgl. Abb. 1). Im Rahmen einer qualitativen Befragung wird eine kleine Stichprobe von Personen jedoch nicht nur zu ihrem Rezeptionserleben zu einem ausgesuchten traurigen Film befragt, sondern zusätzlich auch zu ihrem eigenen Medienauswahl-Verhalten und Nutzen der Beschäftigung mit traurigen Filminhalten im allgemeinen. Somit werden auch die beiden anderen Phasen der Kommunikationssequenz ausgehend von unten aufgeführtem (vgl. Abb. 1) Modell berücksichtigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Formen von Publikumsaktivität
Rubin diskutiert 1994 die aktuelle Forschungslage zur Mediennutzung im Lichte des Nutzen- und Belohnungs- Ansatzes und betont in diesem Zusammenhang Alternativen und Interaktion (im Rahmen von Abhängigkeit an Medien allgemein):
Dependency on a medium results from motives or strategies for obtaining gratifications and restricted functional alternatives. Social and psychological attributes (e.g. health, mobility, interaction, life satisfaction, economic security) affect the availibility of alternatives, media motives or orientations, and dependency on a medium. (Rubin, 1994, zitiert nach Zillmann & Bryant, 1994, S. 428)
1.1.2 Der Unterhaltungsbegriff innerhalb der Rezeptionsforschung
Da das Sad Film Paradoxon ein Phänomen im Rahmen der Rezeption von Unterhaltung durch Kino und Fernsehen darstellt, scheint es sinnvoll, das bisherige Verständnis bzw. einige bisherige Theorien und Modellierungen von Unterhaltung an dieser Stelle zu explizieren.
In jüngerer Zeit stellte Früh (2002) ein Rahmenmodell der Unterhaltung auf, das Unterhaltung als Ganzes theoretisch darzustellen versucht und diese in ihrer Entstehung und mit Fokus auf das Unterhaltungserleben von Rezipienten von der prä- bis einschließlich post-kommunikativen Phase erklärt (vgl. Früh, 2006). Seine Grundthese geht u.a. davon aus, dass „ […] Unterhaltung am überzeugendsten als kognitiv-affektives Erleben des Rezipienten“ zu konzipieren sei (Früh, 2006, S.42). Begleitende Kognitionen und Affekt während der Unterhaltung durch traurige Filme bestimmen den Fokus der vorliegenden Arbeit.
Vorderer, Klimmt und Ritterfeld (2004) stellen Unterhaltung als komplexes Modell dar, indem im Kern „Enjoyment“ festgemacht wird, welches durch verschiedene Motivkomplexe und Voraussetzungen zur Nutzung von Seiten des Individuums wie bspw. Spannungserleben und Empathie entsteht und in dem ebenso Motive wie Stimmungs-regulation oder Eskapismus integriert sind. Nach den Autoren des Modells führen letztere wiederum zu spezifischen (Lern- und Katharsis-)Effekten, die sich u.a. in Gefühlen von Spannung, Kontrolle oder Erlebnisweisen im Rahmen einer Nachdenklichkeit und Melancholie manifestieren. Diese Erlebnisweisen scheinen für die Unterhaltungs-phänomene des Sad Film Paradoxons besonders fruchtbar zu sein.
In diesem Zusammenhang sei zudem eine Konzeptualisierung von Nabi und Krcmar (2002) erwähnt, wobei das ‚Enjoyment’ an Medienangeboten als Einstellung dargestellt und als Moderatorvariable zwischen der eigentlichen Medienzuwendung und dem damit verbundenen Effekt fungiert. Dabei beziehen die Autoren Reaktionen und Effekte aus den Bereichen Affekt, Kognition und Verhalten in ihr Modell von Enjoyment innerhalb der Unterhaltung mit ein.
Nach Mikos (2006) ist die Suche nach einem theoretischen Modell von Unterhaltung „sinnlos, da das Erlebnis selbst offenbar noch nicht Unterhaltung ist, sondern erst durch eine positive Bewertung [...] zu Unterhaltung wird“ (Mikos, 2006, S. 139). Mikos stellt „Überlegungen zur Unterhaltung als Rezeptionskategorie“ (Mikos, 2006, S. 127) auf und unterstreicht bei seiner Aufstellung verschiedener Genres die Tatsache individueller Rezeptionserlebnisse bei unterschiedlichen Genres und Formaten. Er konstatiert:
[...] Melodramen, Horrorfilme[...] strukturieren die kognitiven und emotionalen Aktivitäten des Publikums auf je unterschiedliche Weise vor. [...] die verschiedenen Erlebnisformen [...] scheinen jedoch eines gemeinsam zu haben: Sie stellen ein Rezeptionserlebnis dar, das von den Zuschauern positiv bewertet wird. (Mikos, 2006, S. 137)
Früh (2002) wirft die Frage auf, wie viel Unterhaltung ein Spielfilm enthält und erklärt, dass Medienangebote überhaupt keine Unterhaltung repräsentieren, sondern nur Unterhaltungspotenziale darstellen.
Nach Vorderer (1992) „fallen wohl die meisten der im Fernsehen ausgestrahlten (narrativen) Filme in den Bereich der Unterhaltungs- bzw. Populärkultur“ (Vorderer, 1992, S. 50). Wie viel Unterhaltungspotential (Früh, 2002) ein Spielfilm aus dem Genre „Sad Film“ bzw. Melodram / Tragödie darstellt und welche kognitiven und emotionalen Aktivitäten die Rezipienten dabei entfalten während sie sich dabei „entertainen“, ist wie bereits erwähnt u.a. Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Vorderers Begriff des „narrativen Films“ (Vorderer, 1992, S. 50) wird für diese Arbeit übernommen und an einigen Stellen wieder auftauchen.
Im nächsten Abschnitt soll zunächst ein Konstrukt vorgestellt werden, das zum Verständnis der Aktivitäten im Rahmen von Rezeptionsprozessen beitragen soll. Dieses Konstrukt liefert zudem die Basis zum Verständnis des Untersuchungsvorgehens für die vorliegende Arbeit.
1.2 Das integrative Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten
Suckfüll hat 2004 ein integratives Konstrukt im Rahmen der Medienwirkungsforschung entworfen, wobei sie die Prozesse, die während des konkreten Filmerlebens entstehen, analysierte. Dieses Konzept soll im Rahmen der Analyse dieser Arbeit als Grundlage für die Auswertungsmethode dienen und bereits an dieser Stelle expliziert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung. 2: Theoretische Konzeption der Rezeptionsmodalitäten (nach Suckfüll, 2004).
Nach Suckfüll manifestieren sich im Laufe der Mediensozialisation bei den Zuschauern bestimmte individuelle Modalitäten (vgl. Suckfüll 2004). Diese werden über die wiederholte Hinwendung zu individuell ausgewählten Medienformaten eingeübt und beeinflussen wiederum die Auswahlentscheidungen. Somit wird davon ausgegangen, dass Rezipienten diejenigen Medienangebote auswählen, von denen sie glauben, dass sie ihren bereits entwickelten Rezeptionsmodalitäten entsprechen. Die Auseinandersetzung mit dem aktuell ausgewählten Medienangebot führt zu einem Kompetenzempfinden und wird somit positiv erlebt, so dass dieses Erlebnis gerne wiederholt wird. Dabei geht Suckfüll im Rahmen des Nutzen- und Belohnungsansatzes davon aus, dass Menschen zielgerichtet, jedoch den individuellen Motiven und Erwartungen entsprechend, aus dem Medienangebot auswählen. Rezeptionsmodalitäten entstehen innerhalb eines Prozesses und beschreiben einerseits die Aktivitäten von Rezipienten während der eigentlichen Phase der Rezeption von Medienangeboten, andererseits bedingen sie Auswahlentscheidungen mit.
Das Konstrukt Rezeptionsmodalitäten basiert auf der Annahme einer transaktionalen Beziehung zwischen Rezipient und Medienangebot im Sinne der der Unterhaltungstheorie Frühs (2002, 2003). Anders als beim ursprünglichen Nutzen- und Belohnungsansatz wird hier auf die Wechselbezüglichkeit von Rezipientenmerkmalen und Medienmerkmalen fokussiert und – wie oben bereits beschrieben - werden Person, Medienangebot und Situation durch emotionale und kognitive Aktivitäten einem bewertenden Prozess unterzogen. Dabei trägt die Person Prädispositionen an das Medienangebot heran.
Wenn Rezipienten ein spezifisches Genre an Unterhaltung auswählen, von dem sie glauben, dass es ihren Rezeptionsmodalitäten entspricht, so führt dies nach Suckfüll zu einem Kompetenzempfinden und wird positiv erlebt. Auf diese Weise werden die bei der Rezeption von traurigen Filmen zugrunde liegenden Modalitäten und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit den darin enthaltenden Thematiken vom Rezipienten ebenso als Kompetenz empfunden und positiv bewertet (vgl. Suckfüll, 2005). Somit wird aufgezeigt, wie allgemeine Motive für die Selektion von Medienangeboten ausgebildet werden und warum bestimmte Genres präferiert werden. Wie auch in den hier aufgeführten Theorien bereits mehrfach angeklungen, hängt die Nutzung von Medienangeboten von mehreren Variablen im Sinne von Prädispositionen wie bspw. Persönlichkeitsfaktoren ab und mit soziodemographischen und psychographischen Merkmalen der Rezipienten zusammen.
Rezeptionsmodalitäten sind nach Suckfüll medienübergreifend relevant, d.h. dass ein Rezipient, der viel fernsieht, für das Fernsehen individuelle Modalitäten ausbilden wird, die er für andere fiktive Medien ebenfalls anzuwenden versucht. Beispielsweise sei demnach der Transfer einer für das Fernsehen ausgebildeten Herangehensweise auf das Kino durchaus möglich, denn Rezipienten, für die z. B. „die in den Medien [Verf.: bzw. im Fernsehen] auftretenden Menschen im Vordergrund stehen, können auch im Kino auf ihre Kosten kommen“ (Suckfüll, 2004, S. 112). Dabei ist weniger die Angemessenheit der Situation als vielmehr die kognitive Verfügbarkeit ausschlaggebend. Die Modalitäten werden dahingehend verstanden, als dass sie im Laufe des Rezeptionsprozesses wechseln oder sich phasenweise überlagern können. Zudem kann es passieren, dass in bestimmten Phasen keine dem Zuschauer zur Verfügung stehende Modalität greift. Medienwirkung ergibt sich demnach dadurch, dass spezifische Gestaltungsmerkmale eines entsprechenden Mediums, wie bspw. eines narrativen Filmes, interdependent mit individuellen Rezeptionsmodalitäten auftreten (vgl. Abb.2).
Zur Abgrenzung zum Begriff der Motive, die individuell zur Selektion bestimmter Genres oder Unterhaltungsformate zum Einsatz kommen, spricht Suckfüll von einer wechselseitigen Beziehung dieser zu den Rezeptionsmodalitäten:
Die Rezeptionsmodalitäten fungieren potenziell als Selektionskriterium. [...] Der Rezipient tritt mit einem ihm bewussten Motiv, das in Befragungen ohne weiteres angegeben werden kann, an das Medienangebot heran (vgl. Kap. 1.2.3). Die während der Rezeption eingesetzten Modalitäten sind nicht unabhängig von solchen allgemeinen Motiven, die die Angebotsselektion wesentlich mitbestimmen. [...] Wenn ein Zuschauer z.B. distanziert an ein bestimmtes Medienangebot herangeht und aus professionellem Interesse über die Umsetzung nachdenkt, wird diese Formierung wiederum in die Formierung von übergeordneten Rezeptionsmotiven einfließen. (Suckfüll, 2004, S. 118)
Inwieweit diese Motive allerdings tatsächlich bewusst und somit kommunizierbar sind, wurde jedoch bisher durch mehrere Stimmen im Rahmen der Debatte um den Uses-and-Gratifications-Ansatz inkonsistent zu Suckfülls Meinung im Hinblick auf die Bewusstheit von Rezeptionsmotiven begründet. Somit scheint noch keine Klarheit bezüglich dieses Gegenstandes der Medienwirkungsforschung zu bestehen.
Suckfüll betont, dass Involvement, bzw. eine derart intensive Wahrnehmung der Medieninhalte, bei denen es zu intensivsten kognitiven und emotionalen Prozessen im Verlaufe der Rezeption kommt, so dass das Bewusstsein der fiktionalen Rezeptionssituation aufgehoben zu sein scheint (vgl. Vorderer, 1992), bei der Charakterisierung von Mediennutzung eine Rolle spielt. Es handelt sich bei den Rezeptionsmodalitäten jedoch um „Differenzierungen von involvierter Rezeption“ (Suckfüll, 2004, S. 128). Beispielsweise differenziert Suckfüll in Ideensuche und Identifikation. Da ihrer Meinung nach das Konstrukt des Involvement noch unausgearbeitet ist, definiert sie dieses als in erster Linie „interdependentes, zwischen Medium und Rezipient vermittelndes „prozessorientiertes Konstrukt“ (Suckfüll, 2004, S. 109) und gibt ihm mit dem Begriff der Rezeptionsmodalitäten einen neuen Namen. Diese schließt unterschiedliche Formen von Involvement und Distanzierung ein. Letzteres Motiv wurde durch Vorderer 1992 im Rahmen einer motivationspsychologischen Erklärung für die Rezeption von Fernsehfilmen eruiert und soll dem Bewusstsein des Rezipienten für die Fiktionalität von Medieninhalten Rechnung tragen, wobei der Rezipient zudem als eher „unbeteiligter Beobachter“ (Vorderer, 1992, S. 83) verstanden wird, der überwiegend am Aufbau und der Machart des Filmes interessiert ist.
Suckfüll hat die Rezeptionsmodalitäten theoretisch fundiert und validiert (vgl. Suckfüll, 2003). Ihr Modell enthält sieben Modalitäten, die wiederum eine Zusammenhangsstruktur ergeben. Zwischen einigen dieser Modalitäten bestehen Korrelationen, die höchste zwischen den Modalitäten bzw. Faktoren ‚Ideensuche’ und ‚Identifikation’. Weiterhin steht ‚Produktion’ in Beziehung zu ‚Spiel’ und die Modalität ‚Präsenz’ zur Modalität ‚Kommotion’. ‚Narration’ ergibt sich als siebte Modalität. Dabei hat Suckfüll im Laufe des Rezeptionsverlaufs eines Filmes aus dem Genre Tragödie physiologische Messungen vorgenommen. Diese hat sie an zuvor bestimmten Stellen des Filmes mit spezifischen wiederkehrenden inhaltlichen Merkmalen oder den Momenten des Auftretens der Protagonisten erhoben. Die Reaktionen der Probanden auf diese Merkmale wurden methodisch als Parameterschätzungen im Rahmen eines zeitreihenanalytischen Verfahrens analysiert. Ein Vergleich der Ergebnisse der Einzelfallanalysen nach Rezeptions-modalitäten ergab bspw., dass Personen, die die Modalität ‚Narration’ dominant nutzten, signifikant auf bestimmte Strukturen bzgl. der Filmhandlung, bzw. Erzählung reagierten.
Die Modalität Narration bezeichnet eine kognitive Auseinandersetzung mit der Erzählung derart, als dass der Zuschauer nach der Botschaft des Filmes sucht, wobei ggf. durch intensives Nachdenken der Sinn des Filmes zu erschließen versucht wird. Bei der Modalität ‚Spiel’ – und auch ‚Produktion’ – löst sich der Zuschauer von dieser sehr kognitiven Modalität der ‚Narration’. Allerdings zeigten Suckfülls Analysen, dass die Modalitäten ‚Spiel’ und ‚Narration’ eng zusammenhängen. Dies verweist nach Suckfüll auf eine „kognitive Anstrengung, die mit der Konstruktion alternativer Welten einhergeht“ (Suckfüll, 2004, S. 156).
Spiel erläutert die Autorin allerdings eher dahingehend, als dass sich mehr auf einer kognitiven als auf einer emotionalen Herangehensweise an die Filminhalte angenähert wird. Allerdings entsteht hier im Sinne einer ‚Identitätsarbeit’ (vgl. Vorderer, 1992) durch den Rezipienten eine Konstruktion eines persönlichen, eigenen Filmes im Rahmen eines Spiels, wobei das Geschehen auf der Leinwand / dem Bildschirm durch eigene Vorstellungen oder Ideen verändert wird.
Durch die Modalität Produktion vergegenwärtigen sich die Zuschauer auf imaginative Weise, wie es bspw. überhaupt zu der ‚Produktion’ des Filmes gekommen ist.
Durch Ideensuche finden die Zuschauer, durch das im Film gezeigte, Anregungen für ihr eigenes Leben. Zusammen mit der Modalität Identifikation sieht Suckfüll diese wieder im Rahmen einer Identitätsarbeit bzw. Identitätsstabilisierung (Suckfüll, 2004, S. 154).
Die Identifikation vollzieht sich durch den Vergleich der eigenen Person der Rezipienten mit den Figuren im Film.
Präsenz steht für eine Modalität, die eine Art tiefes Involvement, ein regelrechtes ´Eintauchen in die Filmhandlung´, charakterisiert.
Kommotion schließlich meint einen Modus, in dem die Zuschauer ihre Gefühle während der Rezeption regelrecht ausleben, indem sie gegebenenfalls ihren Emotionen, wie Traurigkeit, durch Weinen Ausdruck verleihen.
Der Hauptfokus von Suckfülls Ansatz liegt in der Untersuchung von Rezeptionsmustern und entsprechenden Aktivitäten, bzw. Modalitäten, wie dies auch in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, und die bezogen auf einen spezifischen Film untersucht wurden. Des weiteren sollten jedoch auch individuelle Motive erhoben werden. Dabei wurde sich auf Suckfüll (2004) bezogen. Sie fordert, dass Befragungen zu Nutzungsmotiven generell an konkrete Angebote geknüpft werden sollten, wobei es sich von Vorteil erweisen sollte, wenn „Befragungen an tatsächliche Situationen von Mediennutzungen“ (Suckfüll, 2004, S. 37) geknüpft würden. Die Befragten erbringen beim Verbalisieren ihrer persönlichen Erlebnisweisen während eines Filmes ‚Abstraktionsleistungen’, die unterstützt werden können, indem sie sich bestenfalls „[…] unterschiedliche Nutzungssituationen vor Augen führen; sich fragen, welche Bedürfnisse jeweils wirksam wurden; sich dann überlegen, wie häufig wohl welches Bedürfnis von Bedeutung ist […].“(Suckfüll, 2004, S. 37). Dabei stelle sich, nach Suckfüll, die individuelle Bedeutsamkeit des Bedürfnisses bei der Nutzung eines Mediums – bspw. eines traurigen Filmes – für die Rezipienten heraus. Basierend auf dieser These wurde die dieser Arbeit zugrunde liegende Untersuchung aufgebaut. Die genaue Untersuchungsdurchführung wird im Kapitel 2 expliziert werden.
Insgesamt handelt es sich nach Suckfüll bei der Rezeption von Unterhaltung „um ein sehr persönliches, in unterschiedlicher Weise gestaltbares, positiv empfundenes Erleben“ (Suckfüll, 2004, S. 166.) Diesem „sehr persönlichen“ Erleben und dem Paradoxon des ‚Sad Films’ auf die Spur zu kommen ist das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit.
1.3 Erklärungsansätze und Befunde zum Sad Film Paradoxon
1.3.1 Das Genre ‚Sad Film’
Im Rahmen der Selektion und Rezeption von Unterhaltung wird zumeist davon ausgegangen, dass diese aus hedonistischen Gründen motiviert ist. Somit ist ein Phänomen, das innerhalb der Rezeptionsforschung besonders verwundert, jenes, dass Menschen es als reizvoll bzw. unterhaltend und positiv bewerten, Medienangebote zu wählen und zu rezipieren wie z. B. Filme aus dem Genre Drama oder auch Informationssendungen mit tragischem Inhalt. Im Sinne des Nutzen- und Belohnungsansatzes – wie weiter oben erläutert – suchen einige Rezipienten dieses Genre also gezielt auf und versprechen sich davon entsprechende Gratifikationen, die nicht so nahe auf der Hand zu liegen scheinen.
Eine weitere Unsicherheit ergibt sich aus dem Begriff des Genres Drama per se. Der wissenschaftliche Terminus ‚Sad Film Paradoxon’ wurde in den 90er Jahren durch Arbeiten von Mary Beth Oliver hervorgerufen, die mit „sad films“ – traurigen Filmen – von Spielfilmen ausging, die im anglo-amerikanischen Sprachraum als „Tearjerker“ bezeichnet werden und einem separaten Genre, dem des ‚Liebesfilms’ zugeordnet werden können. Im Rahmen ihrer Untersuchung zum Paradoxon im Jahre 1993 ließ Oliver innerhalb einer Voruntersuchung eine amerikanische Schulklasse befragen bzw. auflisten, welche Filme bei ihnen traurige Gefühle auslösen. Dabei wurde sowohl auf eine Differenzierung von weiblichen und männlichen Vorstellungen zu diesem Genre verzichtet, als auch in eine Unterscheidung von Filmen, die mit einem guten versus einem tragischen Ausgang enden. Demnach beziehen sich die bisherigen Arbeiten zum Sad Film Paradoxon auf ‚Tearjerker’ mit relativ unspezifischer Thematik und der Vermutung, dass es sich dabei zumeist um „Herzschmerz“-Themen im Rahmen von Liebesgeschichten handelt.
Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive steuern Genres Erwartungen von Rezipienten (vgl. Gehrau, 2003). Dabei nutzen die Zuschauer in der Kommunikation über Medienangebote verstärkt Genrebezeichnungen, um in Selektions- und Rezeptions-situationen aufkommende Unsicherheit zu reduzieren. Genrezuordnungen bieten demnach „Anschlussmöglichkeiten an bereits gemachte kognitive und emotionale Erfahrungen (Gehrau, 2003, S. 227).“
Abbildung 3 dieser Arbeit zeigt eine Darstellung aktueller Media-Daten in Bezug auf die Anzahl erstaufgeführter Langfilme in der deutschen Kino- und Fernsehlandschaft für die Jahre 2001 bis 2005. Dabei wird von elf verschiedenen Genres plus ‚Sonstige’ ausgegangen. Es ist ersichtlich, dass Dramen den größten Anteil an den gesamten Erstaufführungen der jeweiligen Jahre ausmachen, bei relativ stabilem Trend zwischen 31.9 % und 38.8 %, gefolgt von Komödien. Die Abbildung soll zum einen veranschaulichen, dass, ausgehend von den Erstaufführungen der letzten Jahre, aktuell ein großes Interesse des Kino- und Fernsehzuschauers an Dramen zu bestehen scheint, worauf die Filmindustrie mit Neuproduktionen entsprechend reagiert, und zum anderen, dass anhand dieses Beispiels zu erkennen ist, dass für dieses Genre häufig keine Differenzierungen vorzuliegen scheinen (und dennoch jeder mit dem Begriff des Dramas im Rahmen von Spielfilmen etwas verbinden kann.). ‚Melodramen’, ‚Dramen’, ‚Tragödien’ oder einfach ‚traurige Filme’ lösen vermutlicher Weise jedoch alle weniger Empfindungen wie Spaß oder Freude beim Zuschauer aus, als die dominierende Emotion Traurigkeit. In dieser Arbeit wird mangels einer einheitlichen Definition bzgl. narrativer Filme mit trauriger Handlung von einer Sorte von Filmen innerhalb des Oberbegriffs ‚Drama’ die Rede sein, die die Protagonisten in einer tragischen, aussichtslosen Situation zeigen und dessen Ausgang kein ‚Happy-End’ bietet. Ausgehend von diesem Verständnis dreht sich das zentrale Hauptthema weniger um Liebesbeziehungen als vielmehr um die Themen Krankheit / Tod / Sterben, mit denen die Protagonisten konfrontiert sind. Im Rahmen der Befragungen von zwölf Rezipienten trauriger Filme, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, sollen weitere Hinweise auftauchen, was die jeweiligen Befragten unter diesen verstehen.[3]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten´
Abbildung 3: Erstaufgeführte Langfilme 2001-2005 nach Genres
Im Mittelpunkt der Exploration geht es allerdings um die Frage, warum Menschen überhaupt Zeit mit scheinbar amüsierendem Entertainment verbringen und dies insbesondere mit Filmen mit traurigem Inhalt wie Tragödien. Ein handlungsbeschreibendes Charakteristikum der Tragödie ist nach Zillmann (1998): „(…) the display of grave misfortunes that befall good, admired and beloved protagonists who are considered utterly undeserving of their deplored fate” (Zillmann, 1998, S. 1). Zillmann verweist hier auf Identifikation und Gefühle wie Mitleid bzw. auf die Fähigkeit empathischer Gefühle von Seiten der Rezipienten.
Da es in den Folgekapiteln der Theorie vor allem um die Erklärung emotionaler Medienwirkung und zum anderen um den Einfluss medialer Angebote auf die Stimmung geht, ist ebenso eine Definition von Mills (1993) zu erwähnen, die auf das Emotionserleben der Zuschauer und insbesondere auf die Fähigkeit des Genres zielt, traurige Gefühle beim Publikum zu erzeugen: „A tragedy has a dreadful, disastrous, deplorable conclusion that causes viewers to feel mournful and melancholy“ (Mills, 1993. S. 255). Wie oben bereits erwähnt, werden im anglo-amerikanischen Sprachraum ‚Tearjerker’ als Spielfilme bezeichnet, die negative Gefühle wie ‚Herzschmerz’ oder (Liebes-)Kummer thematisieren. Sie können bei den Rezipienten starke affektive Reaktionen auslösen, die trotz negativer Konnotationen von den Rezipienten als Gratifikation erlebt werden (vgl. Oliver, 1993).
Nachdem nun die zugrunde liegende Vorstellung eines traurigen Filmes, die für diese Untersuchung relevant ist, erklärt worden ist, soll nun zunächst eine Annäherung an die Erklärung des Paradoxons vorgenommen werden. Dabei werden Theorien vorgestellt, die in Bezug auf allgemeine Medien- und Unterhaltungsmodelle die Entstehung trauriger Emotionen und den damit ebenfalls einhergehenden Kognitionen bei der Suche nach Gratifikationen durch Medieninhalte beleuchten. Dabei sollen die in diesem Zusammenhang vermuteten Motive für die Nutzung dieses Mediums herausgearbeitet werden.
Zusätzlich versucht diese Arbeit neben der Exploration von Motiven und Erlebnisweisen trauriger Filme einen Beitrag zu leisten, inwieweit Persönlichkeitsvariablen als Antezedenzien von Selektionsprozessen im Hinblick auf die Auswahl von Filmen mit traurigen Inhalten eine Rolle spielen könnten und sich geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Motive für dieses Medium ergeben. Bisherige Befunde auf diesem Gebiet hat vor allem Oliver (1993 und Oliver et al, 2000) erbracht, die im Rahmen eines differentiellen Medienwirkungsansatzes im nachfolgenden vorgestellt werden.
1.3.2 Differentielle Medienwirkung und Rezipientenmerkmale
Ausgehend von einer rezipienten-orientierten Perspektive im Rahmen des Nutzen- und Belohungsansatzes, kann angenommen werden, dass ein Mediennutzer zum einen bei der Auswahl der Medien bestrebt ist, seine Bedürfnisse zu befriedigen und zum anderen den Medienverarbeitungsprozess zu beeinflussen.
Modelle und Theorien aus dem Bereich der Persönlichkeitspsychologie bieten Anhaltspunkte für die Spezifizierung der Person im Rezeptionsprozess. Bereits an dieser Stelle soll darauf hin gewiesen werden, dass die Person und ihr individueller Rezeptionsprozess als Grundlage der Untersuchung des Erlebens von Unterhaltung bisher in den medienpsychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen in eher geringem Ausmaß und – bezogen auf das Sad Film Paradoxon – noch gar nicht zur Anwendung gekommen ist. Ansätze zur Erklärung des Paradoxons, ausgehend von spezifischen Rezipientenmerkmalen ergeben sich aus den nun folgenden.
1.3.2.1 Gender
Geschlechter-Stereotype bzgl. emotionalem Erleben implizieren häufig, dass Frauen generell emotionaler sind als Männer. Nach Birnbaum (1980) variieren Gender-Stereotype jedoch je nach Art der Emotion. Trauer, Angst und Freude werden eher mit dem weiblichen Geschlecht und Wut eher mit dem männlichen als mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert. Die Entwicklung dieser Stereotypen beginnt bereits in der frühen Kindheit (‚Jungs weinen nicht’ z. B.). Geschlechter-unpassende Gefühle scheinen negativ im Sinne einer Meta-Emotion bewertet zu werden (zum Ansatz der Meta-Emotionen vgl. 1.3.3.9). Oliver (1993) vermutet, dass Männer, die sich mit ihrer typisch männlichen Rolle stark identifizieren, traurige Gefühle als negative Erfahrung erleben bzw. bewerten und daher traurige Filme eher zu meiden scheinen.
Demnach sind nach Oliver nicht nur Gender– Unterschiede sondern ist Gender– Identität ein wichtiger Prädiktor für das Gefallen an Filmen mit traurigen Inhalten. (vgl. Oliver, 1993 und Oliver, Weaver & Sargent, 2000). Oliver verwendet den Begriff Gender-Identität in Anlehnung an Eagly (1987, zitiert nach Oliver et al, 2000), der davon ausgeht, dass Individuen dasjenige Verhalten zeigen, das mit entsprechenden durch die Individuen internalisierten sozialen Erwartungen und Normen konsistent ist. Diese sozialen Erwartungen können eben auch geschlechtstypisch sein, wobei er davon ausgeht, das Individuen mit weiblicher Identität – egal ob Frau oder Mann – besondere Emotionalitäts- und Empathiefähigkeiten aufweisen. Oliver, Weaver & Sargent (2000) setzten u.a. zur Bestimmung dieser Geschlechtsidentität einen Fragebogen mit skalierten Maßen zur Erfassung dieser sowie eine Skala ein, die das allgemeine Vergnügen an traurigen Filmen wiedergab. Sie schlussfolgerten in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2000, dass Zuschauer-reaktionen auf traurige Filme eine Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen der Zuschauer und spezifischen Filminhalten widerspiegeln, und dass diese Art von Filmen bevorzugt von Personen mit weiblicher Geschlechtsidentität geschaut wurden. Allerdings sei dies vor allem dann der Fall, wenn der Film ein typisch „weibliches“ Thema behandelte, wie bspw. Liebeskummer oder Beziehungsprobleme. Dabei betonten Oliver et al jedoch, dass ihre Ergebnisse aufzeigten, dass Männer diese Genre nicht abzulehnen scheinen, sondern dass Frauen dieses Genre einfach ganz besonders gerne mögen.
1993 hatte Oliver in ihrer Untersuchung zur Ergründung des Sad Film Paradoxons anhand einer Skala zur Erfassung des Enjoyment-Erlebens von traurigen Filmen belegen können, dass Frauen signifikant häufiger traurige Filme sehen, dabei von intensiveren Gefühlen von Traurigkeit berichteten als Männer und dabei diese Art von Filmen insgesamt positiver im Hinblick auf ihren Unterhaltungswert beurteilen. Diese Bewertung vollzieht sich nach Oliver (1993) mit Bezug auf Mayer und Gaschke (1988) auf eine meta-emotionale Bewertung der eigenen Gefühle, auf die weiter unten noch genauer eingegangen wird. In Olivers Untersuchung konnten signifikante Korrelationen zwischen Femininität, Traurigkeits-Orientierung und Empathie mit hohen Werten auf einer 15-stufigen Skala, die das Enjoyment trauriger Filme wiedergab, ermittelt werden. Hohe Werte in dieser Skala sind demnach verbunden mit Persönlichkeitsmerkmalen wie Empathie, Femininität und Traurigkeits-Orientierung. Dabei ist jedoch kritisch anzumerken, dass die Traurigkeits-Orientierung mit nur einem einzigen Fragebogen-Item erhoben wurde.
Oliver (2000) spricht somit im Zusammenhang von geschlechtsspezifischem Rezeptions-erleben, und im Hinblick auf eine meta-emotionale Bewertung der Inhalte, von dem Phänomen des „respondent gender gap“ (Oliver, 2000, S. 215): Aufgrund des unterschiedlichen Sozialisationsprozesses von Frauen und Männern, lernen Männer eher mediale Angebote wie narrative Filme, die Action und Gewalt beinhalten oder Kampf- und wettstreitbetonte Sportangebote zu suchen. Das Rollenbild von Frauen orientiere sich weniger am konfrontativem als an einem sozialen Rollenbild. Die Autorin erklärt weiterhin, dass Frauen allgemein eher Medienangebote selektierten, die im Rahmen der Sportunterhaltung im Bereich Ästhetik und Stil anzusiedeln sind und narrative Filme aus den Sparten Tragödien, Melodramen oder Tearjerkern, die zum einen als typisch weibliche Filme mit entsprechenden Themen ausgelegt werden und traurige Geschichten beinhalten, und zum anderen eher von Frauen „ertragen“ werden, da es ihnen anscheinend besser gelingt, die primär negative Trauer in ein positives Unterhaltungsgefühl auf eine meta-emotionale Ebene zu überführen (vgl. hierzu auch Gehrau, 2006).
Diese Tatsache erklärt jedoch nicht das Paradoxon, warum Menschen Gratifikationen erhalten, indem sie sich solchen Unterhaltungsangeboten zuwenden, die auf tragische oder melodramatische Darstellungsweise damit verbundene Themen wie bspw. unüberwindbares Liebesleid, Verlust von Familienangehörigen, Tod oder eigener Krankheit beinhalten, und entsprechend noch nicht einmal ein ‚Happy-End’ aufweisen. Inwieweit diese Gratifikationen auf welche Weise während und nach der Rezeption von narrativen Filmen, die Geschichten mit einer oder mehrerer dieser Thematiken erzählen, entstehen, und inwieweit diese Geschichten auf individuelle Weise von Frauen und wie von Männern bewertet werden, möchte diese Arbeit zusätzlich aufzeigen.
1.3.2.2 Persönlichkeitseigenschaften
Schmitz, Alsdorf, Sang und Tasche untersuchten 2003 spezifische Rezipientenmerkmale hinsichtlich der Fernsehmotivation, wobei die Bedeutung der Variablen Neurotizismus, Extraversion und Lebenszufriedenheit sowie familiale Merkmale in Bezug auf die Art des Fernsehkonsums bestätigt werden konnten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eine in diesem Zusammenhang von den jeweiligen Personen bei sich selbst festgestellte Belastung, die nicht durch effektive Coping-Stile bewältigt werden kann, zu eher eskapistisch geprägten Motiven der Fernsehnutzung führt (vgl. Schmitz, Alsdorf, Sang & Tasche, 1993, S. 14).
Mit dem Hauptfokus auf die Persönlichkeitseigenschaft Extraversion sind nach Arendt (2006) – in Anlehnung an Eysencks Persönlichkeitsfaktoren – Modell PEN: Psychotizismus, Extraversion und Neurotizismus (Eysenck und Eysenck, 1987) – die Faktoren Extraversion / Introversion zentral ausschlaggebend für das Bedürfnis nach externaler Stimulation. Eysenck entwickelte einen theoretischen Bezugsrahmen, der die Gründe für extravertierte / introvertierte Haltung durch physiologische Erregungs-unterschiede zurückführt, die biologisch determiniert sind. Diese Bedürfnisse können bspw. durch Medienangebote befriedigt werden. Arendt untersuchte experimentell das Unterhaltungserleben von Extravertierten versus Introvertierten, wobei sie – ausgehend von einem relativ kleinen Sample – belegen konnte, dass erstere ein besseres Unterhaltungserleben bei einem reizstarken und Introvertierte ein besseres Unterhaltungserleben bei einem reizschwachem Film empfinden. Nach Arendt begibt sich der als aktiv, sorglos und sensationshungrig beschriebene Extravertierte in die Geschichte eines Filmes hinein und versucht so, seine Grenzen auszutesten. Für den als eher ruhigen, zurückhaltenden und vor allem kontrollierten Introvertierten geht es vor allem darum, ein Gefühl des Kontrollverlusts während des Rezeptionserlebens zu verhindern. Arendt verwendete für ihre Untersuchung Filme aus den Genres Action und Krimi. Inwieweit introvertierte oder extrovertierte Menschen Filme mit traurigem Inhalt erleben ist bisher noch nicht untersucht worden.
Basierend auf einem umfangreicheren Datenvolumen wurden die oben erwähnten drei dominierenden Persönlichkeitsfaktoren als Manifestationen für Bedürfnisse und Motive für allgemeine Mediennutzung von Weaver untersucht (vgl. Weaver, 1991 und Weaver, Brosius & Mundorf, 1993). Nach Weaver fungieren Persönlichkeitscharakteristika als Mediatoren der Selektion spezifischer Medieninhalte. Ein für diese Arbeit besonders interessanter Aspekt ist Weavers Beleg, dass Personen mit hochgradiger Neurotizismusausprägung, ausgehend von seiner Probandengruppe, Fernsehserien aus der Sparte ‚Drama’ präferierten im Vergleich zu Menschen mit geringerer Neurotizismus-ausprägung, die sich vor allem für Situations-Komödien interessierten. Weiterhin waren es diejenigen Personen mit hohen Werten in Psychotizismus, die ebenfalls letzteres Fernsehformat bevorzugten. Bezogen auf die Selektion von narrativen Filmen selektierten sie im Vergleich zu allen anderen bevorzugt Tragödien. Inkonsistent zu den Befunden und Erklärungsansätzen zu Empathie innerhalb des Rezeptionserlebens – in dieser Arbeit unter 1.3.3.2 dargestellt – zeigte sich Weavers Befund, dass eine hohe Psychotizismus-Ausprägung mit der Präferenz für tragische Filminhalte korreliert, da Personen mit psychotischer Persönlichkeitsakzentuierung neben der Neigung zu impulsivem und unangepasstem Verhalten als eher wenig empathisch charakterisiert werden. Weiterhin zeigte sich, dass sie neben der Präferenz für Tragödien, zusätzlich Horrorfilme präferierten. Ebenso inkonsistent zu Arendts Untersuchung waren es die Extravertierten, die eine leichte Präferenz für Komödien zeigten, die Untersuchung jedoch insgesamt zu dieser Personengruppe wenig signifikante Befunde aufweisen konnte. In einer ähnlichen Untersuchung von Weaver et al (1993), bei der zusätzlich zur Relation von Persönlichkeitseigenschaften und der Selektion von narrativen Filmen, eine Probandengruppe mit amerikanischen Studenten mit der einer Gruppe von deutschen Studenten verglichen wurde, ergab sich ein widersprüchliches Ergebnis. Insgesamt konnte Weaver Neurotizismus, Extraversion und Psychotizismus als Mediatorvariablen nachweisen; allerdings resultierte dieses Mal der Effekt, dass die Probanden mit hohen Psychotizismuswerten, eine Abneigung gegenüber Tragödien zeigten (sowohl bei den amerikanischen als auch bei den deutschen Probanden).
In Bezug auf Neurotizismus zeigte sich nach Weaver überraschenderweise kein signifikanter Effekt. Dies ist deshalb überraschend, da im Lichte bisheriger Forschung gerade Menschen, die mit negativen Gefühlen wie sozialer Isolation und Einsamkeit als auch mit substantiellen Ängsten und Emotionalität (vgl. Weaver, 2000) zu kämpfen haben, stark motiviert sind, die Massenmedien zu nutzen. Somit bleibt die Nützlichkeit der Erforschung von Neurotizismus im Zusammenhang mit Medienkonsum nach Weaver bestehen:
[...] it is particularly surprising in light of recent research suggesting that socially isolated and lonely individuals are strongly motivated to use the mass media (Finn und Gorr, 1998; Perse and Rubin, 1990). Unfortunately, a reasonable rationale to accommodate these null effects is not readily apparent and the utility of neuroticism for media research remains to be established”. (Weaver & Mundorf, 1993, S. 313)
Einen weiteren Befund einer positiven Korrelation von Neurotizismus und Fernsehkonsum erbrachte Hall (2005), der sich jedoch nur bei den Männern zeigte. Erwähnenswert ist Halls Befund, dass sich nur bei denjenigen, die neben einer hohen Neurotizismusausprägung ebenso hohe Psychotizismuswerte erreichten, eine negative Korrelation mit Romanzen zeigte. Jedoch blieb ein signifikanter Zusammenhang zu „serious films“ (Hall, 2005, S. 385) wie Dramen ebenfalls aus.
Daher möchte diese Arbeit neben der Exploration von Motiven für die Selektion trauriger Filme zusätzlich weitere Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zu den Persönlichkeitseigenschaften Extraversion und Neurotizismus erhalten.
1.3.2.3 Alexithymia und Filmpräferenz
Alexithymia ist eine Persönlichkeitsdimension bei Personen mit einer relativ hohen Anzahl an physischen und psychischen Auffälligkeiten (vgl. Berenbaum, 1993). Das hauptsächliche Defizit besteht aus der verminderten Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu beschreiben. Es wurde erforscht, dass Alexithymia mit erhöhter Depressivität verbunden ist, vermehrtem Aufkommen von Ängsten, einer verringerter Fähigkeit Wut zu äußern und insgesamt einer auffälligen Unterdrückung von Gefühlen. Das Ziel der Studie von Berenbaum war es, ein Verständnis bzgl. der Beziehung zwischen der Fähigkeit, eigene Emotionen zu identifizieren und der Art der „emotion arousing experiences“ (Berenbaum, 1993, S. 174) – besonders emotionsaktivierenden Erfahrungen – zu bekommen, die Menschen mit Alexithymia dann vorziehen.
Auf der Basis bisheriger Forschung, dass es einen Zusammenhang zwischen Gender, Persönlichkeit und Filmpräferenzen gebe, ging Berenbaum davon aus, dass Filmpräferenzen Emotionserleben wider spiegeln. Filme, die Emotionen wie Freude, Trauer, Angst und Ärger erzeugen, kamen in der Untersuchung zum Einsatz. Dabei gelangte Berenbaum zu dem zentralen Ergebnis, dass insbesondere Personen, die Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu identifizieren, eher Filme mit negativer Valenz bzw. traurigen Inhalten wählen. Personen mit Alexithymia scheinen demnach durch die Auseinandersetzung mit tragischen Filminhalten eine Art Erfolgserlebnis beim Erkennen von Emotionen zu erleben, welches entsprechend als angenehm erfahren wird und ein Motiv der Medien-, bzw. Filmselektion von diesen Personen darstellt.
Im Bereich der Erforschung von möglichen Zusammenhängen zwischen Persönlichkeits-faktoren und Unterhaltungserleben zeigt bereits eine oberflächliche Sichtung publizierter Arbeiten hierzu, dass – und wie bereits oben erwähnt – innerhalb der allgemeinen Unterhaltungsforschung wenig und im Rahmen der Forschung zum Sad Film Paradoxon noch gar keine Suche nach diesen Zusammenhängen statt gefunden hat. Zudem ergeben sich doch recht widersprüchliche Ergebnisse in diesem Bereich, so dass sich weitere Forschung als nützlich erweisen könnte.
1.3.3 Erklärungsansätze in Bezug auf affektive und kognitive Aktivität
Die folgenden Theorien zeigen Erklärungsansätze zum Verständnis einer mehr oder weniger gezielten Suche nach traurigen Emotionen während der Rezeption von Unterhaltung auf. Hierbei greifen kognitive und affektive Aktivitäten ineinander. Ausgehend von dieser kognitiv-affektiven Erklärungsperspektive soll im folgenden auf den Einfluss von Medieninhalten und insbesondere Medieninhalte mit traurigem Inhalt und Theorien zur Regulierung von Stimmungszuständen eingegangen werden, um spezifischere Ansätze zur Erklärung des Sad Film Paradoxons aufzuzeigen.
1.3.3.1 Identifikation
Die wohl älteste Erklärung für die Anziehungskraft von Tragödien ist die sogenannte Katharsis – Doktrin (vgl. z. B. Mills, 1993 und Oliver, 1993). Demzufolge setzen sich Menschen Tragödien und Dramen in der Kunst gerade deswegen aus, weil unerwünschte Erfahrungen gezeigt und dabei unangenehme Gefühle geweckt werden, wobei sich diese als nützlich erweisen sollen. Nach Aristoteles (1961, zitiert nach Oliver, 1993) kann diese Hypothese als Katharsis-Effekt beschrieben werden: das Publikum sucht Erfahrungen mit aversiven Gefühlen wie Mitleid und Furcht im Theater auf, um sich dadurch von eigenen unangenehmen Gefühlen zu „reinigen“. Für diesen so oft zitierten Ansatz ist bis heute kein systematischer, wissenschaftlicher Beweis in der psychologischen Literatur zu finden (vgl. Mills, 1993).
Im Hinblick auf ein Rezeptionserleben, welches häufig durch Dramen dahingehend begleitet wird, dass die Zuschauer ihren Gefühlen durch Weinen Ausdruck verleihen, bzw. diesen ‚freien Lauf’ lassen, sprechen Efran & Spangler (1979) von einer Art physiologischer Katharsis: Nach ihrer Zwei-Phasen-Theorie vollziehe sich eine physiologische Katharsis, weil die Forscher darlegen konnten, wie sich nach einem auslösenden Ereignis die entstandene Anspannung von einigen ihrer Probanden als angenehm im Sinne von Freude, bei den anderen als unangenehm im Sinne von Verlust-Gefühlen beschrieben wurde. In beiden Fällen führte jedoch das einsetzende Weinen zu einer Reduktion der verursachten Anspannung der Probanden. Demnach weinen Menschen nur in einer zweiten Phase, einer Phase der Erholung, die auf eine Phase der Anspannung folgt. Diese Anspannung wird demnach durch ein Ereignis ausgelöst, welches das Sympathische Nervensystem aktiviert, das wiederum durch die Aktivität des Weinens im Sinne eines parasympathischen ‚Rebound’– Effektes bewirkt, dass die Spannung gelöst und das Individuum dadurch kathartisch von der Anspannung entlastet wird. Demnach könnten Filme mit traurigen Inhalten den Rezipienten womöglich als ein mediales Hilfs- oder Heilungsangebot dienen, da hier davon ausgegangen wird, dass geweinte Tränen somit immer ‚Tränen der Freude’ sind – unabhängig von der Art des zuvor erlebten Ereignises.
Oatley (1994) interpretierte das Katharsis-Konzept Aristoteles’ mit Fokus auf dessen Begriff der ‚Mimesis’, womit er die ‚Nachahmung’ der Wirklichkeit innerhalb der Kunst beschreibt: „Aristotele´s notion was that a play is not so much an imitation – it is a simulation of human actions“ (Oatley 1994, S. 66). Oatley unterstreicht in diesem Zusammenhang die Rezeptionsaktivität der Identifikation und die spezielle Art der “involvierten Rezeption“, die als Simulationen in der Vorstellung der Medienrezipienten so ablaufen „wie Computersimulationen auf Computern laufen“ (Vorderer, 1994, S. 334).
Der Rezipient ist nicht nur Zeuge des Geschehens in der Narration eines Buches oder eines Filmes, denn nach Oatley begleiten neben identifikatorischen zudem empathische Prozesse die Rezeption. Er meint mit Identifikation nicht nur bloße ‚Nachahmung’, sondern versteht sie als „temporäre Übernahme (adopting) von Handlungszielen und -plänen“ (Vorderer, 1994, S. 334). Dabei empfinden bspw. die Leser eines Buches Emotionen in Abhängigkeit davon, auf welche Ereignisse die Pläne im Laufe der Narration stoßen. Die Geschichte hat dabei die Funktion, einen ‚Simulationsprozess’ vorzugeben, dessen Kern die Identifikation mit einem oder mehrerer Charaktere innerhalb der Geschichte ausmacht (vgl. Oatley, 1994).
An anderer Stelle spricht Oatley in diesem Zusammenhang davon, dass der Rezipient bzw. Kinogänger auf passive Weise ein Treffen im Sinne einer ‚one-way affair’ mit den Charakteren auf der Leinwand herbei führe, auf die er keinen Einfluss habe, die jedoch deshalb so faszinierend für den Zuschauer sei, da keine Verantwortung wie im realen Leben eingegangen werden müsse:„[...] we (die Zuschauer) feel emotions in our meetings with characters of the story world, perhaps most esspecially the emotions of sympathy“ (Oatley, 1999, S. 445).
Cohens (2001, zitiert nach Green, Brock & Kaufman, 2004) Definition von Identifikation bspw. expliziert die kognitive Arbeit des Rezipienten im Sinne einer ‚Verbindung’ zwischen dem Filmzuschauer und den Charakteren im Film: „[...] a process that consists of increasing loss of self-awareness and its temporary replacement with heightened emotional and cognitive connections with a character“ (Cohen, 2001 zitiert nach Green et al, 2005, S. 318). Kann Identifikation mit den Charakteren innerhalb eines tragischen Filmes und die damit verbundenen positiven Emotionen mit diesen Personen als eine Möglichkeit der Gratifikation bei der Rezeption trauriger Filme betrachtet werden?
Ausgehend von der Tatsache, dass Identifikation bisher noch nicht explizit operationalisiert werden konnte, versuchten Konijn und Hoorn (2005) diesen Erklärungsansatz der Identifikation mit einem Modell zu theoretisieren, wobei sie als zentralen Rezeptionsprozess den des Wechsels zwischen Involvement und Distanz zu den Charakteren in der Geschichte annehmen. Ihrer Ansicht nach hat die Wahrnehmung von fiktiven Personen sehr viel mit der von echten Personen im Alltagsleben gemeinsam. Wie Oatley gehen sie davon aus, dass die affektiven Reaktionen der Rezipienten nicht nur „bloße Reflektionen der Emotionen der fiktiven Charaktere“ (Konijn & Hoorn, S. 110) sind, sondern dass die Rezipienten ihre eigenen Emotionen erleben, die im Sinne von kognitivem und emotionalem Involvement, und je nach einem bestimmten Grad von Distanz einen individuellen „level of psychological investment in another ‚person’ (Konijn & Hoorn, S. 110) ausmacht. Dieser „level“ variiert also je nach einem bestimmten Grad von Distanz. Die Art von Involvement ist so zu verstehen, dass es Identifikation und Empathie beinhaltet. Hierbei ist zudem grundlegend, wie viel Ähnlichkeit der Zuschauer zwischen sich selbst und dem / den Protagonisten in der Geschichte entdeckt.
Dieses Modell definiert drei Phasen der Beschäftigung mit fiktiven Personen: Enkodierung, Vergleich und Reaktion. Zwischen Involvement und Distanz besteht eine wechselhafte Beziehung. Je nach Grad an positiver Valenz, Relevanz und Ähnlichkeit in der Phase des Vergleichs der Enkodierung ergibt sich eine entsprechende Wertschätzung der fiktiven Person als Reaktion des Rezipienten. Dabei gehen die Art der realistischen Darstellung, das moralische Verhalten der Charaktere und deren Ausmaß an Schönheit in die Bewertung mit ein.
Wissenschaftliche medienpsychologische Modelle, die diese Art der kognitiven Auseinandersetzung mit fiktiven Medieninhalten beleuchten, existieren bisher nur wenige, so auch im Rahmen möglicher Erklärungsansätze im Rahmen des Sad Film Paradoxons. Im Rahmen dieser Arbeit sollen auf qualitativem Wege u.a. Ansätze exploriert werden, die aufzeigen, inwieweit Involvement-Erleben wie bspw. jenes der Identifikation eine Rolle bei der Rezeption trauriger Filme spielen.
1.3.3.2 Empathie
Wie in den bisher vorgestellten Theorien bereits angeklungen, spielen emotionale, kognitive und – aus der Kombination dieser beiden – dispositionale Elemente der Empathie bei den Reaktionen der Zuschauer auf Medieninhalte eine Rolle. Inwieweit die soeben diskutierte Identifikation zumindest ein brauchbares Konzept für die Erklärung von Involvement -Erleben in Bezug auf tragische Medieninhalte sein kann, diskutiert Zillmann (1994). Er kommt zu dem Schluss, dass es sich im Rahmen von emotionalen Involvement-Prozessen weniger um Identifikation als viel mehr um empathische Reaktionen handelt, die teils selbstreflexiv zum Ausdruck kommen, teils von positiven, affektiven Dispositionen gegenüber anderen Personen herrühren. Er sieht im Vergleich zu Oatley den Zuschauer als Zeugen des Geschehens. Empathische Reaktionen hängen nach Zillmann (2000) von positiven affektiven Dispositionen gegenüber anderen Personen ab. Mit Bezug auf seine Drei-Faktoren Theorie der Empathie erklärt Zillmann die empathische Reaktion weiterhin als bewusst und erlernt. Nach dieser Theorie kehren negative, affektive Dispositionen gegenüber den Charakteren diese negativ empfundenen empathischen Empfindungen in eine hedonistische Richtung um: „[...] the stronger negative sentiments, the more intense the counterempathic reaction“ (Zillmann, 1994, S.44). Dabei spielt das moralische Urteil eine erhebliche Rolle – genau wie im PeFIC-Modell von Konijn und Hoorn (2005). Die Korrektur der Disposition in Richtung positiver Bewertung fällt umso stärker aus, je tragischer und ungerechter das Schicksal der Protagonisten ist.
Empathische Empfindungen im Sinne von „Mit-Emotionen“ bzw. „‚Kommotionen“, die durch Medien vermittelt werden, ergeben sich nach Scherer (1998) unter der Bedingung, dass die Protagonisten des Filmes durch die Rezipienten als sympathisch eingeschätzt und / oder eine Identifikation mit diesen möglich ist. Die zentrale affektive Komponente dieses Empathie-Mechanismus sei letztlich das Nachvollziehen der Bewertung des durch den Protagonisten erlebten Ereignisses durch den Rezipienten.
Dass Menschen mit hoher Empathie Filme mit traurigen Inhalten als angenehme Unterhaltung erleben, konnte unter anderem Oliver (1993) zeigen. In diesem Zusammenhang setzte sie Skalen zum allgemeinen Enjoyment von Filmen ein, einen Empathiefragebögen und Skalen zur Erfassung von traurigen Emotionen auf Tearjerker. Sie entdeckte zusätzlich Zusammenhänge zwischen Empathie und bspw. fiktionalem Involvement und Menschlichkeits-Orientierung. Somit konnte sie zeigen, dass unter gewissen Umständen, traurige Gefühle durch Tragödien umso stärkere Gratifikationen mit sich bringen können:„The idea that sad responses to tragedy may heigthen gratification also implies that individual differences associated with greater emotional responsiveness to others´ suffering should be predictive of greater enjoyment of this type of entertainment fare” (Oliver, 2003, S. 336).
1.3.3.3 Stellenwert der Protagonisten
Green, Brock und Kaufmann (2004) erklären sich die Hinwendung zu tragischen Geschichten ebenfalls mit Fokus auf die Charaktere einer Geschichte, mit denen der Zuschauer – ausgehend von ihrer „Transportation Theory“ – verbunden ist. Als zentrale Elemente ihrer Theorie heben sie das ‚Eintauchen’ des Zuschauers in eine narrative Welt und die Konsequenzen dieses Prozesses hervor; ‚Selbst-Transformation’ ist für sie äquivalent zum oben erläuterten Empathie-Begriff. Somit erklären sie Medien-Enjoyment als eine Erfahrung, die mit kognitivem, emotionalem sowie symbolischem Involvement einhergeht. Ihren Erklärungsansatz von „Transport“ in eine narrative Welt vergleichen sie mit Flow-Erlebnissen (Csikszentmihalyi, 1989), die Menschen Zustände höchster Konzentration bei Aktivitäten wie dem Lesen bspw. erleben, und der als sehr angenehm erlebt wird. Für Green et al sind positive Inhalte einer Geschichte im Rahmen ihrer Theorie nicht zwingende Voraussetzung des Phänomens der angenehmen Unterhaltung. Mit Bezug auf traurige Inhalte und insbesondere Inhalte zum Thema Tod sprechen die Autoren von einer Art „Enjoyment from traveling to the dark side“ (Green et al, 2004, S. 316). Mit Bezug auf Nell (2002, zitiert nach Green et al, 2004) sei das Verleugnen des eigenen Todes, bzw. der Wunsch nach Unsterblichkeit evolutionär bedingt. Der Zuschauer identifiziere sich mit dem Helden der Narration, der unsterblich erscheint, und auch, wenn dieser am Ende sterbe, bliebe der Zuschauer doch unversehrt. Die Beziehung zu den Personen in der Geschichte ist – ähnlich wie bei Zillmann – für sie Voraussetzung für einen Prozess der Identifikation mit den Charakteren. In einigen Fällen können die Charaktere sogar als Freunde wahrgenommen werden (Green & Brock, 2000 zitiert nach Green et al, 2005).
Die „Beziehung“ zu Charakteren innerhalb eines Medieninhalts kann sogar das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigen. Die Theorie des ‚Bedürfnisses nach Zugehörigkeit’ von Baumeister & Leary (1995) – und deren Begriff des „need to belong“ kann als ein weiterer Erklärungsansatz gelten, weshalb sich Menschen bei der Zuwendung zu traurigen Medieninhalten gut fühlen. Die Autoren gehen davon aus, dass Menschen stets motiviert sind, interpersonale Beziehungen zu formen und aufrecht zu erhalten. Übertragen auf die Zuwendung zu traurigen Filmen, wäre dies eine weitere Möglichkeit zu verstehen, welche Gratifikation sich hinter dem Konsum dieses Genres verbirgt, denn in Situationen, in denen Menschen nicht die Möglichkeit haben, in Interaktion mit anderen Menschen zu treten, würden sie dieses Bedürfnis eventuell in der Art einer Parasozialen Beziehung[4] befriedigen und dies dann eventuell auch über Tearjerker oder Tragödien.
1.3.3.4 Stimmungsregulation
Wenn Menschen äußern, dass sie sich gut unterhalten fühlen, so zeigt diese Aussage einen psychischen Prozess an, der zum einen eher emotionaler als kognitiver Natur und – wie in den o.a. Theorien bereits angeklungen – vermutlicher Weise auf positive Erlebnisse gerichtet zu sein scheint. Im Rahmen der so genannten Stimmungsmanagement-Forschung (z.B. Zillmann, 1988; Knobloch, 2003) betrachtet Zillmann mit seiner Mood-Management-Theorie (Zillmann, 1988) den Menschen als ein hedonistisches Wesen, das stets motiviert ist, schlechte Stimmung zu vermeiden bzw. gute Stimmung zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Im Rahmen der Unterhaltung durch Medien reagieren Menschen auf diese Motivationen, indem sie eine Art der Unterhaltung wählen, die negative Emotionen möglichst vermindert und positive Emotionen verstärkt, mit dem resultierenden Gefühl von Belohnung. Dieser Ansatz steht im klaren Gegensatz zu Vorderers (1996) Erklärung für die Hinwendung zu traurigen Filmen im Sinne einer Identitätsarbeit und durch Prozesse kompensatorischer Abwärtsvergleiche, wie sie unter 1.3.3.7 noch beschrieben werden. Die Belohnung fällt umso stärker aus, je mehr sich die Zuschauer mit den Protagonisten der Geschichte identifizieren (Zillmann & Bryant, 1985). Wenn der Zuschauer zusätzlich die Hauptfigur als moralisch gut bewertet, und dieser Charakter noch mit einem als moralisch schlecht bewerteten Gegenspieler in Relation gesetzt wird, scheint dies nach Ansicht der Autoren als besonders belohnenswert empfunden zu werden (Affective Disposition Theory).
Zillmann nimmt 1985 mit seinem erregungstheoretischen Modell bzw. der Theorie des Erregungstransfers („excitation transfer“) an, dass die durch Medienkonsum erzeugte Erregung erst danach – nach einem Film bspw. – langsam abnimmt, so dass nach diesem Medienkonsum noch Erregungspotenziale vorhanden sind, die zusätzliche Erregung verstärken können. Die residuale Erregung eines positiven Ausgangs der Geschichte resultiert in einer umso intensiveren Folge-Emotion. Zillmann sieht diesen Vorgang als ein Resultat kognitiver Anpassung in dem Sinne, als dass „Residual excitation from empathic distress should manage to intensify the cognitively determined minimal satisfaction reaction and elevate it to one of considerable enjoyment” (Zillmann, 1980 zitiert nach Zillmann, 1998, S. 6).
Die Affective-Disposition-Theorie und die Erregungstransfer-Theorie sind nach Zillmann (2003) neben der Anwendung für Erklärungen für die Auswahl aus den Genres Thriller oder Horror, ebenso anwendbar auf das Genre des ‚Sad Film’. Die mit diesem Genre einhergehenden negativen Gefühle sind im Verlauf der Handlung dahingehend erträglich, bzw. werden in Kauf genommen, da die Gratifikationen am Ende des Filmes umso angenehmer und entspannter vom Zuschauer wahrgenommen werden. Denn es ereigne sich ja eine Auflösung des Konfliktes des Protagonisten, mit dem der Zuschauer mitleide – sofern es ein ‚Happy-End’ gibt, wie so häufig bei den beliebten Tearjerkern. Jedoch stellt sich nach diesem Erklärungsansatz die Frage, wer dann demnach Filme mit tragischer Handlung und zusätzlich traurigem Ende, also rundum melodramatische, traurige Filme schaut? Oliver (1993) konnte konträr zu Zillmanns theoretischer Erklärung des ‚Erregungstransfers’ im Rahmen ihres Annäherungsversuchs zum Verständnis des Phänomens zeigen, dass das Enjoyment, bzw. die Hinwendung zu traurigen Filmen unabhängig davon geschieht, ob sie ein gut ausgehendes Ende der Geschichte bieten, oder nicht.
Zillmanns weitere Erklärungsansätze beziehen sich auf das zentrale Element Aristoteles: das ‚Hervorbringen von Mitleid’, das Zillmann bestätigt und in dem er eine weitere wichtige Funktion von traurigen Filmen bzw. Tragödien darin sieht: Menschen werden sich auf diese Weise ihrer Vulnerabilitäten, Sehnsüchte und ihres emotionalen Befindens bewusst:
Tragic drama´s capacity for honing our empathic sensitivities and for making us cognizant of our vulnerabilities, compassions, and needs for emotional wellness – a capacity that tragedy seems to posses to a greater degree than alternative dramatic forms. (Zillmann, 1998, S. 9)
Unter gewissen Umständen kann es also vorkommen, dass Menschen nicht hedonistisch, sich jedoch im Sinne von „counterhedonistic selections“ der Medienunterhaltung widmen (Zillmann, 2000b in Oliver, 2003). Zillmann verweist auf die Nützlichkeit der Informationssuche als mögliches Motiv für die Selektion eines bestimmten Unterhaltungsangebots. Zillmann unterscheidet zwischen spontanem und zielgerichtetem Hedonismus . ‚Spontaner Hedonismus’ bezieht sich demnach auf sofortiges Gratifikationsstreben, wohingegen ‚Zielgerichteter Hedonismus’ bedeutet, dass ein Zuschauer seinen negativen Stimmungszustand auf einen späteren Zeitpunkt ausdehnt, um im Sinne einer Selbstreflexion zu einer zufriedenstellenden Lösung eines persönlichen Anliegens zu kommen. Diese Erklärung gilt nach Zillmann jedoch nur für Ausnahmen, und der eigentliche Anreiz der Medienselektion Ziele auf sofortiges „mood repair“, (Oliver, 2003, S. 103) nach einem Film bspw.; Zillmann konstatiert, dass „To the extent that the control of external stimulation is limited to enterainment offerings, individuals arrange [...] their exposure so as to minimize aversion and maximize gratification – both [...] in terms of time and intensity“ (Zillmann, 1988, S. 151). Trotz einiger Grenzen seiner Mood Management-Theorie passiert die Zuwendung zu bestimmten Medien im allgemeinen unbewusst und – vorausgesetzt dass es keine Alternative externaler Stimulations-möglichkeiten zu denen der Medien gibt und nur hedonistische Ziele als zentrale Determinante der Medienauswahl in Frage kommen (vgl. Zillmann, 2000).
Im Vergleich zum Mood Management im Sinne der Stimmungsregulation verfolgen Knobloch-Westerwick & Alter (2006) den Ansatz des Mood Adjustment (Stimmungsanpassung) mit Fokus auf die Erklärung zur Hinwendung zu eher unangenehmen Medieninhalten. Die Stimmungsanpassung vollziehe sich in Richtung des eigenen gewünschten Verhaltens einer antizipierten sozialen Situation (vgl. Knobloch-Westerwick & Alter, 2006). Zusätzlich konnten sie empirische Beweise erbringen, dass Männer in Bezug auf ihren emotionalen Zustand sofort handeln möchten, um ihre Stimmung zu regulieren und sich dies in ihrer Medienselektion auswirkt. Frauen hingegen scheinen dies vermeiden zu wollen. Somit scheinen die Geschlechter unterschiedliche Stimmungslagen zu favorisieren. Das Material, das Probanden, nachdem sie sich mit einer Provokation auseinandersetzen mussten, auswählten, bestand allerdings aus Zeitungsartikeln mit entweder positivem oder negativem Nachrichteninhalt. Insgesamt suchten diejenigen, die Vergeltung gegenüber dem Provozierenden erzielen wollten, Artikel mit negativem Inhalt aus. Insbesondere waren dies Probanden des männlichen Geschlechts, und es schien, als seien Frauen eher geneigt, ihren Ärger, der durch andere provoziert wurde, verjagen zu wollen und im Rahmen der Medienselektion positivere Inhalte zu bevorzugen.
Doch auch im Rahmen der Stimmungsregulationsansätze ist keine einheitliche Antwort auf die Frage zu finden, welche affektiven Zustände als Prädiktoren für die Auswahl der Zuschauer für traurige Filme oder andere tragische Unterhaltungsangeboten gelten können.
1.3.3.5 Evolutionspsychologische Perspektive
Affektive Reaktionen auf Unterhaltungsangebote bzw. das emotionale Erleben von Unterhaltung im allgemeinen hat aus Sicht einer evolutionspsychologischen Perspektive insofern eine lebenserhaltende Funktion, als dass Emotionen funktional als „evolvierte Anpassungen“ (Schwab, 2001. S. 68) konzeptualisiert werden. Diese werden als lebenserhaltendes Verhalten in bedrohlichen, sich wiederholenden Situationen in der Lebenswelt unserer Vorfahren eingesetzt (Tooby & Cosmides, 1990, zitiert nach Schwab, 2001). Forscher sprechen von einer „Evolution des Unterhaltungsmotivs“ (Schwab, 2001 S. 67), wobei in diesem Zusammenhang in erster Linie positive Emotionen gemeint sind. Bei negativen Emotionen bestehe jedoch dieser adaptive Wert und das Phänomen, dass durch Emotionen physiologische, kognitive und soziale Kompetenzen erweitert werden (Fredrickson, 1998, zitiert nach Schwab, 2001) in einem direkten Nutzen und nicht wie bei positiven Emotionen, bei denen der Anpassungswert „vielmehr im Ausbau der Ressourcen des Einzelnen über die Zeit“ gesehen wird (Schwab, 2001, S. 68).
Nach Schwab (2001) lässt sich medienvermitteltes emotionales Erleben auf der Basis verschiedener Module, die sich während der Ontogenese in der jeweiligen aktuellen Umwelt ausgeformt haben sollen, konzeptualisieren (vgl. auch Suckfüll, 2006). Ein Modul bezieht sich auf eine Art „innerer Repräsentanzenwelt“, wobei die Möglichkeit eines Probehandelns als kognitives ‚Werkzeug’ beschrieben wird, das durch eine Emotion ‚getriggert’ wird, und das die Möglichkeit bereit stellt, auf bereits entwickelte Emotionsprogramme zurückzugreifen. Die Antworten dieses Programms könnten in die zukünftige Planung und Rückbesinnung einerseits und in die Bewertung der Vergangenheit des jeweiligen Individuums andererseits einfließen. Das Probehandeln wird in einem – mit diesem Modul verbundenen – weiteren Modul „der externalisierten Simulation (‚Spiel’)“ in eine „manipulierbare Umwelt verlagert“ (vgl. Schwab, 2003, S. 56) . Filmvermitteltes Erleben von Unterhaltung wird vor diesem Hintergrund als „emotionales Planspiel“ beschrieben (Schwab, 2003, S. 56). Die Beschäftigung mit dieser evolutionären Funktion des Unterhaltungsstrebens im Rahmen einer Motivation, sich unterhalten zu wollen, mache den positiven Wert von Emotionen allgemein und damit verbunden auch die Entstehung trauriger Emotionen im Lichte einer „Erweiterung des Denk- und Handlungsraumes“ (vgl. Schwab 2001, S. 68) verständlich.
1.3.3.6 Kognitive Kontrollprozesse medieninduzierter Emotionen
Ein weiterer Versuch, um die Frage zu beantworten, warum Menschen durch negative Emotionen bei der Rezeption von Unterhaltungsangeboten mit entsprechenden Gratifikationen belohnt werden können, bietet ein dynamischer Betrachtungsansatz von Unterhaltung durch Früh (2000), der Unterhaltungserleben als integrativen Prozess von kognitiven Informationsverarbeitungsprozessen, gekoppelt mit Verarbeitungsprozessen von Emotionen auf unterschiedlichen Ebenen und auf Basis eines multiplen Appraisal-prozesses (vgl. auch Schramm & Wirth, 2006) erklärt. Neben einer distanzierten Bewertung des eigenen Fühlens auf Meta-Distanz erfolgt aber auch eine Verarbeitung ohne reflektierte Metabewertungen. Durch Informationsverarbeitungsprozesse wird die ursprüngliche Emotionalität der Mikroebene kognitiv ausselektiert oder uminterpretiert (vgl. Früh, 2000). Diese Verarbeitung kann sich z. B. auch auf das Wissen um ein kommendes ‚Happy-End’ beziehen oder um die Tatsache, dass das tragische Schicksal des Protagonisten vom Zuschauer und dessen Wissen um die Fiktionalität der Filmgeschichte als „übertrieben“ kommentiert werden kann. Das Erleben des traurigen Schicksals wird somit für den Rezipienten erträglicher.
Dezidiert negative Gefühle können hiernach auf einer Mikroebene durch kommentierende oder elaborative Prozesse mit einem positiven Erleben auf einer Makoreben einhergehen. Insgesamt geht Früh davon aus, dass sich Unterhaltung immer erst auf einer Meta-Ebene entfaltet. In seiner „Molaren Theorie der Unterhaltung durch das Fernsehen“ (Früh, 2000) spielen Kontrollprozesse eine zentrale Rolle. Früh geht von mehreren Phasen des Rezeptionsprozesses über die Zeit aus und stellt ein „Modell des triadischen Fittings“ zwischen Person, Situation und Medienangebot auf. Die Person ‚Rezipient’ hat dabei immer das Ziel „Verhalten auf unterschiedliche (bewusste oder unbewusste) Ziele hin zu optimieren.“ (Früh, 2000, S. 143) Diese können neben einem hedonistischen Nutzen auch Ziele von Lernen, sozialer Integration oder Altruismus sein. Letztere Ziele lassen sich eventuell besonders durch zahlreiche narrative Filme, die menschliche Schicksalsschläge thematisieren, befriedigen. Nach Früh habe das Individuum beim selbst gewählten Handlungsziel ‚Unterhaltung’ objektiv vorfindbare Bedingungen hinsichtlich (a) der Zweckdienlichkeit interpretiert und (b) dabei kontrolliert, wie selbstbestimmt und souverän es mit der Handlung umgehen kann. Ein wesentliches Merkmal der Unterhaltung ist nach Früh die Tatsache, dass unbegrenzte Risiken eingegangen werden können. Weiterhin seien bei negativem Ausgang der (Film-)Handlung die Konsequenzen durch das eventuell tragische Ende „des Spiels ‚Unterhaltung’ begrenzt [...]“ (Früh, 2002, S. 147).
1.3.3.7 Prozesse des sozialen Vergleichs
Eine einflussreiche Theorie aus der Sozialpsychologie besagt, dass Individuen dazu tendieren ihre Bewertung der Realität von einem Vergleich mit anderen Individuen abhängig zu machen: die Theorie Sozialer Vergleichsprozesse nach Festinger (1954). Demnach würden Rezipienten von Tragödien im Sinne eines ‚Abwärts-Vergleichs’, bzw. einer so genannten „downward comparison“ mit den Protagonisten mitleiden, und sich gut fühlen, da es ihnen ja zumeist besser erging als jenen. Jedoch kam Mills zu dem Ergebnis, dass sich die Probanden in der Gruppe des hochtragischen Filmes im Vergleich zu denen, die den weniger tragischen Film sahen, am Ende des Filmes schlechter fühlten. Dieser Befund stellt einen Widerspruch zum Erklärungsansatz des Sozialen Vergleichsprozesses dar. Dieser Vergleich bezieht sich im allgemeinen auf Fähigkeiten oder persönliche Meinungen der eigenen mit denen anderer Personen (vgl. Festinger 1954), wobei bei letzteren nur in Bezug auf Fähigkeiten ein Anreiz zum Vergleich ‚nach oben’ besteht, im Sinne einer „upward comparison“. Somit konstatiert Festinger: “[...] the differences [...] with respect to opinions and abilities lie in the unidirectional push upward in the case of abilities, which is absent when considering opinions and in the relative ease of changing one´s opinion as compared to changing one´s performance.” (Festinger, 1954, S. 138). Somit könnten mediale Informationen ebenso relevant für die Bewertung der Angemessenheit der eigenen Meinung eines Individuums sein. Im Falle von Tragödien ist dies jedoch vor allem dann verständlich, wenn man diesen Vergleich ‚nach unten’ („push downward“) vollzieht. Zumindest sollte jedoch die Vergleichsinformation nicht zu sehr von der eigenen abweichen.
Mares und Cantor (1992) stellten einer Gruppe älterer Menschen experimentell vor die Wahl, entweder einen Film zu sehen, der einen alten, einsamen Menschen als Hauptfigur zeigte oder einen anderen Film, der einen sozial integrierten Menschen darstellte. Es zeigte sich, dass diejenigen Alten, die sich selber als nicht einsam im Vergleich zu denen bezeichneten, die sich als einsam beschrieben, ersteren Film als unangenehmer empfanden als die entsprechende Vergleichsgruppe. Nach der Theorie der sozialen Vergleichsprozesse wollten sich die Einsamen eventuell mit dem Schicksal des einsamen Hauptcharakters des Filmes aufwerten, bzw. wollten die Bedrohung, die von dem sozial integrierteren Mann ausging, vermeiden. Diese Studie von Mares und Cantor kann als Beleg für kompensatorische Abwärtsvergleiche angesehen werden (vgl. auch Schemer, 2006). Hierbei setzen Senioren als Coping-Verhalten für ihre Situation vermutlicher Weise Medieninhalte aus dem TV-Programm ein, um durch einen „Abwärtsvergleich“ ihre eigene und unter Umständen selbstwertbedrohliche Lebenssituation aufzuwerten. Oliver (1993) sieht den Genuss der traurigen Schicksale anderer ebenfalls als einen Erklärungsansatz für das vermeintliche Paradoxon der Beliebtheit von Filmen mit traurigem Inhalt.
Im Kontext von sozialen Abwärtsvergleichsprozessen spricht Vorderer von „Identitätsarbeit“ (Vorderer, 1996, S. 324) und versucht auf der Basis eines weiteren Erklärungsansatzes, der auf zweckorientierte Anreize rekurriert, Unterhaltungsrezeption im allgemeinen und Unterhaltungsangebote wie bspw. Tragödien oder Formate, die negative Empfindungen hervorrufen und von Rezipienten freiwillig konsumiert werden, im Besonderen zu verstehen. Dabei haben diese Rezipienten nach Vorderer selbst keinen „positiven (tätigkeitszentrierten) Anreiz“ (Vorderer, 1996, S. 321) dabei. Er geht davon aus, dass dieser demnach außerhalb der Handlung liegen muss. Nach Vorderer wird die Zuwendung zu belastenden Unterhaltungsangeboten durch den Zusammenhang von Rezeptionshandlungen und Selbst-Konzept verständlich. Rekurrierend auf Festingers´ Vergleichs-Theorie spricht Vorderer von „maximalem Informationsgewinn über die eigenen Leistungen und Einstellungen“ (Vorderer, 1996, S. 323). Wie bspw. durch den Ansatz des Downward-Vergleichs und den der Identitätsarbeit dargestellt, gibt es eine Reihe theoretischer Argumente und empirischer Evidenzen gegen die Annahme, dass sich Individuen nur mit explizit positiven Medienangeboten ‚‚entertainen’’ und rein hedonistisch motiviert sind.
1.3.3.8 Einstellungen zum Mitgefühl
Wie in den bisher aufgeführten Theorien zum Ausdruck kam, scheint es sich bei den affektiven Reaktionen oder Aktivitäten nicht immer um rein emotionales Reagieren oder Erleben zu handeln. Kognitive Prozesse können dabei als zentrale ‚Bausteine’ von Emotionen angesehen werden. Bei den explizit kognitiven Emotionstheorien werden Emotionen als „kognitive, informationsverarbeitende Prozesse“ (Wünsch, 2006, S. 107) definiert, wobei ein Reiz im Sinne eines Bewertungsprozesses hinsichtlich verschiedenster Merkmale bewertet wird. Bewertungsprozesse werden im allgemeinen gleichgesetzt mit der kognitiven Aktivität bei der Entstehung von Einstellungen.
Nach Eagly und Chaiken 1993 (zitiert nach Nabi & Crzmar, 2004) ist der kognitive Prozess der ‚Bewertung’ die entscheidende Eigenschaft von Einstellungen i. S. einer „critical feature of attitudes“ (Eagly und Chaiken, 1993, zitiert nach Nabi & Crzmar, 2004): Wenn ein Mensch demnach eine Einstellung zu etwas entwickelt, so geht es zentral um die Valenz eines bestimmten Objektes. Nach Zanna und Rempel (1988, zitiert nach Nabi & Crzmar, 2004) liegt die kognitive Aktivität hierbei vor allem darin, dass ein Glauben an dieses Objekt durch direkte oder indirekte Erfahrung mit diesem entwickelt wird.
In diesem Zusammenhang interpretierte Mills (1993) im Rahmen des Attitude-Interpretation-Ansatzes die Anziehungskraft trauriger Filme bzw. Tragödien im Lichte des Konzeptes der kognitiven Fähigkeit der Einstellungsentwicklung. Demnach haben Menschen, die sich Tragödien zuwenden, die Einstellung entwickelt, dass es (moralisch) gut ist, wenn sie sich traurig fühlen, sobald sie eine andere Person leiden sehen und sich in diese Person einfühlen. Mills geht davon aus, dass Menschen gegenüber ihren Gefühlen im allgemeinen individuelle Einstellungen entwickeln. Die traurigen Emotionen, die Zuschauer bei der Rezeption von Filmen mit traurigem Inhalt an sich wahrnehmen, interpretieren sie wiederum als positive Erfahrung im Sinne einer guten Tat.
Mills erbrachte empirische Beweise für diese Hypothese und zusätzlich für das Phänomen, dass Menschen, die diese Einstellung teilen, hoch-tragische Filme im Vergleich zu weniger tragischen Filmen bevorzugen. Ausgehend von Selbst-Bewertungen der eigenen Empathie-Fähigkeit als indirektes Maß, inwieweit eine gute Einstellung hinsichtlich der eigenen traurigen Gefühle als Reaktion auf den Anblick eines leidenden Charakters eines narrativen Filmes besteht, entwickelte Mills ein neues Maß zur direkteren Einstellungsmessung gegenüber Gefühlen bei der Konfrontation einer leidenden fiktionalen Figur. Allerdings konnte er nicht herausfinden, warum es zu signifikanten Korrelationen der Empathie-Selbstbewertungen und dem Reiz von hoch-tragischen Filmen kommt.
Mills kam durch drei Studien im Rahmen seiner Untersuchung zu dem Resultat, dass die Anziehungskraft von Tragödien dadurch zu erklären ist, dass es Menschen gibt, die die Einstellung haben, dass es (moralisch) gut sei, mit dem Schicksal einer anderen Person mitzufühlen, und dadurch traurige Gefühle zu erleben. Diese Personen erhalten entsprechend positive Gratifikationen durch die Rezeption tragischer Filmhandlungen im Vergleich zu Filmhandlungen, die weniger tragisch sind. In zwei Studien mit jeweils unterschiedlichen Filmen resultierten signifikante Korrelationen zwischen einem indirekten (evaluierten) Einstellungs-Maß hinsichtlich der (selbsteingeschätzten) Empathiefähigkeit und einem Maß für die Anziehungskraft bzw. den Reiz an Tragödien. Wie viel Empathie bzw. welche traurigen Gefühlen und Gedanken und wie hoch das Ausmaß an Mitleid tatsächlich war, konnte ebenfalls jedoch nicht erklärt werden. Mills’ Resultat erscheint inkonsistent zur Erklärung der Anziehungskraft von Tragödien im Rahmen des oben erklärten ‚sozialen Abwärts-Vergleichs’, nachdem sich Menschen durch die Auseinandersetzung mit traurigen Schicksalen auf der Leinwand deshalb besser fühlten, da es ihnen ja im Vergleich zu diesen zumeist doch besser erging.
1.3.3.9 Meta-Emotionen
Wie bereits an einigen Stellen dieser Arbeit erwähnt, explorierte Oliver (1993) das Sad Film Paradoxon mit dem Einsatz von Skalen zur Erfassung des allgemeinen ‚Enjoyments’ von Filmen, der Empathiefähigkeit und u.a. einem Maß zur allgemeinen Traurigkeits-orientierung. Zentral war jedoch der Einsatz einer Skala zur Erfassung von Meta-Emotionen bei ihren Probanden. Nach Oliver sind es Emotionen auf einer übergeordneten Ebene, die mit einer evaluativen Funktion die direkten Gefühle von Traurigkeit als positiv und damit angenehm für den Rezipienten erfahrbar machen. Das Rahmenkonzept, das sich hinter dieser Annahme verbirgt, ähnelt dem Konzept der bereits erwähnten Meta-Kognitionen. Das Gefühl von Traurigkeit während der Rezeption von Tearjerkern ist nach Oliver zentral, und diese Traurigkeit sei zudem eine soziale Norm. Besonders das weibliche Geschlecht lerne dieses Stereotyp im Laufe der Sozialisierung: dass es sozial erwünscht ist, empathisch mitzufühlen. Insbesondere Frauen bewerten demnach auf einer übergeordneten Ebene positiv, dass sie mit den leidenden Protagonisten mitfühlen.
Dieser Bewertungsprozess während aufkommender Emotionen geht auf Mayer und Gaschke (1988) zurück, die in Bezug auf zentrale Gefühle wie Freude, Wut, Traurigkeit und Überraschung (vgl. Mayer & Gaschke, 1988, S. 102) die allgemeine Stimmung dahingehend beschreiben, als dass diese erlebt wird „ [...] on both a direct and a reflective level. At the direct level, mood appears to be perceived along pleasant-unpleasant and arousal-calm dimensions (Russell, 1978; Russell & Bullock, 1986; Wundt, 1897) or their rotated variants (Diener & Emmons, 1984; Watson and Tellegon, 1985).” (Mayer & Gaschke, 1988, S. 102).
Die Autoren beschreiben Meta-Emotionen im Rahmen von Stimmungsregulations-prozessen, wobei sie “meta-mood experiences” (Mayer & Gaschke, 1988, S. 102) als Produkt dieser Regulationsprozesse ansehen, und diese Emotionen auf einer Meta-Ebene grundlegende Emotionen kontrollieren, bewerten und dadurch auch verändern können. Somit geben Meta-Emotionen dem Individuum hinsichtlich folgender Aspekte Auskunft:
(1) Kontrollierbarkeit
(2) Typikalität
(3) Klarheit
(4) Stabililität
(5) und Akzeptanz der aktuellen, direkt erlebten Emotion.
In diesem Rahmen könnten auch Medien-Emotionen, wie durch Filminhalte verursachte Trauer, positiv bzw. angenehm im Sinne eines Bewertungsprozesses erlebt werden. Dieser Bewertungsprozess ist den Rezipienten zumeist jedoch nicht bewusst.
Das unmittelbare Erleben von Emotionen vollzieht sich nach Mayer und Gaschke (1988) auf einem direkten Level, Meta-Emotionen auf einem reflektiven Level. Dabei erstellten die Forscher eine Skala zur Erfassung von Meta-Emotionen und konnten zudem nachweisen, dass Meta-Emotionen sich ja nach Stimmung verändern, dass Meta-Emotionen und Emotionen signifikant unterschiedlich hinsichtlich der Valenzdimension unangenehm / angenehm erlebt werden, und sich gegenseitig bedingen. Des weiteren könnten Meta-Emotionen grundlegende Stimmung, bzw. Gefühle wie bspw. Traurigkeit verändern.
Bei der Unterhaltungsrezeption stößt das Konzept von Mayer und Gaschke (1988) auf fruchtbaren Boden, sowohl bezüglich des Verständnisses der Hinwendung zu traurigen, und ebenso angst- und spannungsauslösenden Filmen aus den Genres Thriller und Horror. In ihrer Untersuchung zum Sad Film Paradoxon 1993 berief sich Oliver diesbezüglich durch Anwendung der Skalen zum Erleben von Meta-Emotionen von Mayer und Gaschke auf die Erklärung einer übergeordneten Emotionsebene im Hinblick auf die Erklärung des Paradoxons. Dabei kam sie zu dem konsistenten Ergebnis, dass neben dem Ausmaß trauriger Gefühle bei der Rezeption von Tearjerkern im selben Ausmaß Vergnügen von ihren Probanden mit einer Präferenz für dieses Genre erlebt wurde. Oliver betont und geht somit konträr zu den Stimmungsregulierungs-Ansätzen davon aus, dass negativer Affekt nicht immer als negativ oder verbesserungswürdig von den Betroffenen angesehen wird.
1.3.3.10 Perspektive des ‚Terror Managements’
Ein ganz anderer Erklärungsversuch, um dieses scheinbare Paradoxon zu ergründen, ergibt sich aus der „Terror Management Perspective“ (Goldenberg, Pyszczynski, Johnson, Greenberg & Solomon, 1999). Die sozial-psychologische Theorie des Terrormanagements (Greenberg, Pyszczynski & Solomon, 1986 in Goldenberg et al, 1999) nimmt an, dass Individuen hoch motiviert sind, ihre eigene Sterblichkeit zu leugnen und dabei komplexe Strategien entwickeln (vgl. Goldenberg et al, 1999, S. 314). Als Rahmentheorie für menschliches Sozialverhalten wird davon ausgegangen, das eine tief verankerte Angst vor der Endlichkeit des Menschen zu Verhalten motiviert, das dazu dient den eigenen Tod zu verleugnen. Somit ist der Mensch nur vor dem Terror seiner Angst vor dem Tod geschützt, indem er ein Gefühl von Selbstwert, vor allem hinsichtlich einer kulturellen Zugehörigkeit aufrecht erhält. Diese These wurde im Rahmen zahlreicher Befunde bestätigt.
Die zentralen Hypothesen der Theorie sind durch die ‚Furcht-Puffer-Hypothese’ und die ‚Mortalitätssalienz-Hypothese’ formuliert. Erstere besagt, dass wenn der Selbstwert oder die kulturelle Weltsicht gestärkt werden, es zu einer Herabsetzung des Angstniveaus kommt. Mortalitätssalienz bedeutet, dass die eigene Sterblichkeit kognitiv verfügbar ist, was gleichzeitig dazu führt, das ein Bedürfnis nach Schutz erhöht wird.
Goldenberg et al nennen u.a. den klasssischen Befund der Terror Management Theorie, dass gruppenbezogene Kognitionen in Richtung der Verteidigung und Stützung von Eigengruppen beeinflusst werden, wenn Personen in Mortalitätssalienz gebracht werden (vgl. Goldenberg et al, S. 318.) Des Weiteren wurden Befunde repliziert, die aufzeigen, dass Mortalitätssalienz zu Aggression, Nationalismus, Stereotypisierung und Problemlösen führen (für einen Überblick siehe Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997, zitiert nach Godenberg et al, 1999).
Ausgehend von dieser Theorie versuchen die Autoren den Reiz von Tragödien dahingehend zu erklären, als dass dieses spezielle Genre Individuen dazu veranlasst, sich stellvertretend mit tragischen Themen dieser Art auf eine relativ sichere Weise zu beschäftigen. Die Autoren erbrachten den experimentellen Beweis, dass sich Personen, nachdem sie an ihre Sterblichkeit erinnert werden, mit erhöhter Emotionalität und stärkerem Interesse auf eine tragische im Vergleich zu einer weniger tragischen Geschichte reagierten. Dabei wurde die Mortalitätssalienz – die kognitive Verfügbarkeit der eigenen Sterblichkeit – als unabhängige Variable zuvor manipuliert, indem einer der beiden Gruppen instruiert wurde, eigene Emotionen hinsichtlich der Vorstellung des eigenen Todes zu beschreiben. Die Vergleichsgruppe ließen sie offene Fragen zu einem neutralen Thema beantworten. Daraufhin reagierte die Mortalitäts-Gruppe mit deutlicherem emotionalen Affekt auf die tragische Geschichte und fanden die nicht-tragische Geschichte uninteressanter als die Probandengruppe ohne Mortalitäts-Salienz. Da die Probanden der Untersuchung auch ohne ein Treatment der Mortalitäts-Salienz eine Präferenz für tragische im Vergleich zu neutraler Literatur zeigten, gehen Goldenberg et al davon aus, dass sich Menschen in ihrem Alltag konstant mit existentiellen Fragen beschäftigen und sich dabei implizit um effektive Terror Management-Strategien bemühen. Diese Art der Beschäftigung mit existentiellen Fragen vollzieht sich nach Meinung der Forschergruppe demnach im Sinne einer unbewussten affektiven Reaktion.
Dabei glauben die Autoren, dass dabei eine potentielle Emotion durch Gedanken an den eigenen Tod antizipiert wird und sich Menschen implizit auf diese Weise stellvertretend auf dieser Gefühlsebene mit dem Thema auseinandersetzen: „We believe that this is because of an implicit affective response, an anticipation of potential emotion brought on by thoughts of one´s death; individuals attempt to cope with this implicit affect through safe vicarious emotional expression.” (Goldenberg et al, S. 325). Somit könnte die Rezeption trauriger Filme eine Coping - Strategie für den Umgang mit Angst, bzw. der spezifischen Angst vor dem Tod darstellen, indem sich Personen innerhalb eines kontrollierten Rahmens und stellvertretend mit entsprechenden Themen beschäftigen können.
1.3.4 Zusammenfassung: Der Stand zum Sad Film Paradoxon
Betrachtet man zusammenfassend die oben aufgeführten Erklärungsansätze und Befunde zum Sad Film Paradoxon, ist zum einen erkennbar, dass sich bei vielen Theorien und Modellen zum Erleben von Medieninhalten Kognition und Emotion keineswegs gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr untrennbar zu sein scheinen, indem sie prozesshaft ineinander greifen. Zum anderen zeigt sich im Hinblick auf das Verständnis des Sad Film Paradoxons und der damit verbundenen Frage, welchen Nutzen bzw. welche Gratifikationen Zuschauer von traurigen Spielfilmen und den damit einhergehenden negativen Emotionen, erhalten, dass bisherige Forschung insgesamt nur ansatzweise und im Rahmen von Medienwirkungsmodellen, die sich mit hedonistischen Motiven auseinandersetzen, dieses Paradoxon zu ergründen versuchen. Im Rahmen von Stimmungsregulations-Theorien legt Zillmann (1988, 2000) die Hinwendung zu traurigen Filminhalten als Ausnahme dar. Er erklärt, dass unter der Prämisse eines aufgeschobenen, zielgerichteten hedonistischen Gratifikationsstrebens, durch die Hinwendung zu diesem Medium eine Möglichkeit geboten wird, ggf. Selbstreflexion zu üben. Aus einer Perspektive, die davon ausgeht, dass Menschen im allgemeinen stets das Thema Tod „verdrängen“, können Filme mit diesbezüglichem Inhalt im Rahmen eines geschützten, kontrollierbaren Erfahrungsraumes dazu dienen, sich entsprechend – und wohl zumeist – ‚unbewusst’ mit damit verbundenen Emotionen auseinander zu setzen.
Zudem zeigen einige Erklärungsansätze, dass die Protagonisten, die in tragischen Filmen häufig ein hoffnungsloses Schicksal erleben, dabei jedoch eine ‚Projektionsfläche’ für individuelle Merkmale der jeweiligen Zuschauerin oder des jeweiligen Zuschauers darstellen können, die oder der sich wiederum mit den Protagonisten vergleicht, um eventuell festzustellen, wie gut es ihr / ihm selbst geht. Daraus ergeben sich demnach wiederum positive Gratifikationen, und je sympathischer der Protagonist dem Zuschauer ist, desto intensiver kann der positive Nutzen ausfallen.
Wie ausführlich dargestellt wurde, gibt es eine Reihe theoretischer Argumente und empirischer Evidenzen für die Annahme, dass Individuen in vielerlei Hinsicht Gratifikationen aus dem Erleben negativer Emotionen erhalten, wie beispielsweise im Rahmen einer Identitätsarbeit oder der Möglichkeit eines Sozialen Abwärtsvergleichs. Ebenso scheinen Menschen mit individuellen Ausprägungen bestimmter Persönlichkeitsmerkmale unterschiedliche Arten der Gratifikation zu suchen. Im Rahmen einer eher abnormen Persönlichkeitsstruktur, der Alexithymie, scheinen bestimmte Filminhalte, intensive Emotionen wie Traurigkeit zu ‚triggern’ und dabei von besonderem Nutzen im Hinblick auf ein damit verbundenes Kompetenzerleben, zu sein.
Im Rahmen von Erklärungen zu kognitiven Kontrollprozessen während der Rezeption von Fernsehfilmen wird vermutet, dass durch traurige Filminhalte übergeordnete Ziele, wie soziale Integration oder Lernen, auf angenehme, spielerische Art und durch einen souveränen Kontroll-Status des Zuschauers vor dem eigenen Bildschirm, erreicht werden können. Doch diese Erklärungsversuche bleiben teilweise Erklärungsansätze oder sind bisher noch nicht direkt empirisch belegt worden.
Die eigentliche Sad Film Paradoxon-Forschung an sich geht auf wenige Arbeiten, die von Oliver 1993 und 2000 bisher durchgeführt wurden, zurück. Sie erbrachte empirische Beweise und Erklärungen im Rahmen von Geschlechter-Identität. Sie zeigt auf, dass Weiblichkeit mit der Freude an traurigen Filmen korreliert. Des Weiteren bezieht sich dies auf eine besondere Ausprägung der Empathie und einer allgemeinen Traurigkeits-Orientierung der Rezipienten. Dabei entwickelte sie eine Skala zur Erfassung des allgemeinen ‚Enjoyments’ trauriger Filme. Das Rezeptionserleben trauriger Filme erklärt sie mit Bezug auf einen meta-emotionalen Ansatz. Dabei rekurriert sie auf die Bewertung der eigenen Gefühle der Rezipienten, die ihr Mitgefühl mit den traurigen Schicksalen als sozial erwünscht und dieses Gefühl somit auf einer übergeordneten Ebene als gut bewerten. Auch hierzu entwickelte sie eine Skala, die eine Palette von definierten Emotionen zur Selbst-Bewertung der eigenen Gefühle der Probanden zur Verfügung stellt. Dabei kamen jedoch nur Filme mit spezifisch weiblichen Themen und insgesamt einem Überschuss an Filmen aus dem Genre Liebesfilm zum Einsatz.
Wie bereits schon mehrfach angeklungen, gibt es unter dieser Vielzahl an Erklärungsansätzen eher wenige empirische Belege zur Erklärung dieses noch relativ jungen Forschungszweiges des Sad Film Paradoxons. Einige Forscher betonen weiteren Forschungsbedarf vor allem hinsichtlich eines Modells, das übergeordnet verschiedenste bisherige Erklärungsansätze plausibel macht und zueinander in Beziehung setzt. Dabei könnten sowohl Merkmale des Rezipienten, als auch Merkmale, die sich aus der Erzählweise der Geschichte und der Rezeptionssituation ergeben, in Betracht gezogen werden.
Als offensichtlichste Lücke scheint im Rahmen aller hier vorgestellten Ansätze und Theorien, die Tatsche zu sein, dass bisher keine qualitative Untersuchung im Rahmen des Sad Film Paradoxons vorgenommen wurde, um dadurch ggf. weitere Hypothesen und Erklärungsmodelle zu generieren. Gerade im Hinblick auf die geringe Anzahl an Erklärungsversuchen und Evidenzen zu diesem Unterhaltungsphänomen, würde diese Art der Untersuchung, die auf induktive Weise explorativ nach dem Warum des Paradoxons fragt, weitere Erkenntnis zu tage fördern. Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll durch einen qualitativen Untersuchungsansatz und der Auswertung von insgesamt 12 Einzel-Interviews das subjektive Erleben der Rezipienten während einer tragischen Filmgeschichte beleuchtet und zusätzlich aufgezeigt werden, wie sich diese Personen selbst die Frage nach den Gratifikationen beantworten, die sie aus diesem Medienangebot erhalten. Des Weiteren ist es wünschenswert zu erfahren, was sie bei der Rezeption eines traurigen Filmes erleben, bzw. welche Gefühle und Gedanken sie berichten und welche Motive ihrer Meinung nach generell hinter ihrer persönlichen Auswahl von Filmen mit tragischen Geschichten stehen.
Im nun folgenden methodischen Teil der Arbeit werden die Hauptfragestellungen, die der vorliegenden qualitativen Arbeit zum Sad Film Paradoxon zu Grunde liegen, im Rahmen der oben bereits angesprochenen Lücken und Erweiterungsforderungen aufgeführt. Das folgende zweite Kapitel wird neben der Präsentation der Entwicklung der Fragestellung, die Auswahl der Instrumente der Datenerhebung- und Auswertung sowie die entsprechende Stichprobe explizieren und den Ablauf der Untersuchungssituation veranschaulichen.
2 Methode
2.1 Fragestellung und Begründung für die Wahl einer qualitativen Untersuchungsmethodik
In den vorausgegangenen Kapiteln dieser Arbeit wurden zentrale Theorien, empirische Befunde und Erklärungsansätze zum ersten Verständnis des Sad Film Paradoxons im Rahmen der Medienunterhaltungsforschung dargestellt. Bisherige Forschung zum Zweig des Sad Film Paradoxons innerhalb der Medienpsychologie zentriert sich vor allem auf Arbeiten, die anhand von Skalen ein Gefallen von Rezipienten an traurigen Filmen misst und entsprechende korrelationsstatistische Ergebnisse liefert, die auf Persönlichkeitsmerkmale wie Empathie oder Geschlechtszugehörigkeit zurückgreifen. Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit expliziert, scheint sich das Paradoxon des Unterhaltungserlebens trauriger Filme jedoch nicht erst bei der eigentlichen Rezeption zu ergeben, sondern ausgehend von der Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig dazu entscheiden, gezielt nach einer melodramatischen Filmgeschichte im Kino zu suchen. Die Motive hierfür liegen noch im Dunkeln.
Das wohl konsistenteste Ergebnis bisheriger Forschung zum Sad Film Paradoxon bezieht sich auf den Unterschied von Frauen und Männern bzgl. der Auswahl trauriger Filme, wobei es die Frauen sind, die sich besonders gerne und häufiger als Männer mit traurigen Filmthemen unterhalten lassen. In diesem Zusammenhang sind jedoch gerade die Motive und das Rezeptionserleben von Männern, die traurige Filme regelmäßig rezipieren, im Vergleich zu den Frauen besonders interessant. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher noch genauer als in bisherigen Untersuchungen zum Sad Film Paradoxon dem Warum und individuellen Gründen nachgegangen und dabei stets dem weiter oben diskutierten Uses-and-Gratifications-Ansatz gefolgt werden, der auf Nutzungsmotive und entsprechende Gratifikationen abzielt und im Rahmen dessen gefragt wird, was die Menschen mit den Medien ‚anstellen’ und wozu (und eben nicht gefragt wird, wie die Medien die Menschen beeinflussen).
Somit zielen die Ergebnisse dieser Arbeit zum einen auf die unterschiedlichen, individuellen Motive für tragische Filminhalte von Rezipienten dieses Genres im allgemeinen und hinsichtlich eventueller Unterschiede zwischen Frauen und Männern im speziellen. Des Weiteren ergibt sich hieraus, dass bisherige Evidenzen hinsichtlich Geschlechterstereotypen im Rahmen des Sad Film Paradoxons geprüft werden, wie sie bspw. bereits durch Oliver (1993, 2000) beleuchtet wurden. Die für diese Untersuchung erforderliche Stichprobe der Interviewten setzt sich demnach aus derselben Anzahl an Männern wie Frauen zusammen.
Ausgehend von Suckfülls (2004) Annahme, dass sich während der Rezeption von Filmen so genannte ‚Modalitäten’ ausbilden, die in einem wechselseitigen Verhältnis zu Motiven für die individuelle Medienauswahl stehen, sollen auch diese bei der Untersuchung der speziellen Rezeptionssituation im Rahmen von tragischen Filminhalten untersucht werden. Es wird angenommen, dass sich diese Motive aus sehr persönlichen Sicht- und Erlebnisweisen des einzelnen Rezipienten ergeben und durch eine individuelle Mediensozialisation entstanden sind (vgl. Suckfüll, 2004). Damit liegt der Ansatz einer qualitativen Einzelfallerhebung dieser Motive nahe, wobei es vor allem diese Motive sein werden, die ausreichend differenziert durch persönliche Aussagen von Probanden gewonnen und analysiert werden.
Die Möglichkeit der Untersuchung dieser Rezeptionsmodalitäten – Kommotion, Präsenz, Identifikation, Ideensuche, Produktion, Narration und Spiel (wie sie bereits unter 1.2 aufgeführt und erläutert wurden) – während der Rezeption von Filmen steht neben der Identifizierung von Motiven an zweiter Stelle im Hinblick auf das Ziel dieser empirischen Untersuchung. Diese Modalitäten, die nach Suckfüll (2004) die kognitiven und emotionalen Aktivitäten bei der Rezeption von Medien im allgemeinen modellieren, sollen auch die Grundlage der Untersuchung dieser Arbeit bilden, wobei im Rahmen eines Untersuchungsfilmes mit tragischen Inhalten analysiert werden sollte, ob und wie viele der sieben bereits identifizierten Modalitäten, bei der Rezeption eines Filmes mit traurigen Inhalten durch die Rezipienten ausgebildet werden. Des weiteren wäre es wünschenswert, weitere Modalitäten bei den einzelnen Rezipienten und bei diesem speziellen Rezeptionserlebnis zu tage zu fördern.
Während der Aufbereitung des bisherigen Forschungsstandes wie er im vorherigen Kapitel expliziert wurde, ergaben sich die folgenden Hauptfragestellungen dieser Arbeit, die an einer Stichprobe von sechs Männern und sechs Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren im Rahmen einer qualitativen Einzelfallanalyse zu beantwortet versucht werden sollen.
- Was sind Motive und damit verbundene Gratifikationen der Rezeption von Filmen mit traurigem Inhalt (Dramen / Tragödien)?
- Welche Art von Rezeptionsmodalitäten kommen bei der Rezeption trauriger Filme (Dramen / Tragödien) zum Einsatz?
- Welche Rolle spielen dabei Persönlichkeitsvariablen als Antezedenzien von Selektionsprozessen: Sind hierbei geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar?
Antworten hierauf sollen sich dadurch ergeben, dass am Beispiel eines ausgesuchten tragischen, narrativen Filmes erstens allgemeine Motive und damit verbundene Gratifikationen von Zuschauerinnen und Zuschauern tragischer Filme erörtert und zweitens individuelle Rezeptionsweisen im Sinne von Modalitäten analysiert werden sollen, um einer Erklärung für das Selektionsverhalten für dieses Genre näher zu kommen. Vieles zum Verständnis des Paradoxons ist noch offen, so dass zunächst die subjektive Sichtweise der jeweiligen Untersuchungsteilnehmer von zentraler Relevanz ist und sich diesbezüglich ein qualitatives Erhebungs- und Auswertungsinstrument anbietet. Zudem handelt es sich bei der Erforschung dieses Themas im Rahmen einer Rezeptionsforschung um einen relativ jungen Forschungszweig, bei dem es durchaus üblich und relevant ist, methodisch explorativ vorzugehen.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Arbeit aufgrund ihrer methodischen Konzeption als qualitative Erhebung im Rahmen einer Diplomarbeit mit geringer Stichprobengröße und halbstrukturiertem Interviewaufbau keinerlei Ansprüche auf statistische Repräsentativität erheben kann. Es soll daher versucht werden, bisherige Befunde zu erhärten und ggf. weitere Aspekte aufzuwerfen und neue Hypothesen durch diesen Ansatz zu generieren, die daraufhin Ergebnisse liefern könnten, die durch Untersuchungen mit ausreichender Stichprobengröße weitere Ergebnisse generalisieren könnten.
Als qualitative Datenerhebungstechnik kommt in diesem Rahmen ein halbstrukturiertes Interview zum Einsatz. Die gesamte Methodik und der genaue Ablauf der Untersuchung von der Auswahl der Erhebungstechnik über die Durchführung der Interviews bis zur Datenaufbereitung und Datenanalyse wird auf den nun folgenden Seiten dieses zweiten Kapitels begründet und erläutert.
[...]
[1] Die bisherigen empirischen Untersuchungen zum Sad Film Paradoxon von Oliver (1993) basierten auf dem Verständnis zum Begriff des „Sad Film“(trauriger Film), der diese kommerziellen ‚Tearjerker’ i. S. von ‚Schnulzen’ oder Liebesfilmen meint. Diese Arbeit bezieht sich auf Filme mit traurigem Inhalt aus dem Genre Drama / Tragödie, unabhängig von dieser speziellen Thematik des Liebesfilms.
[2] Anm. zur Schreibweise: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Folge von Rezipienten, Zuschauern, Protagonisten etc. die Rede sein; dies schließt selbstverständlich immer die weibliche Form ein. Bezüglich der dieser Arbeit zugrunde liegenden Stichprobe von Frauen und Männern, wird jedoch an entsprechender Stelle die korrekte Kennzeichnung wie bspw. Rezipientin und Rezipient eingeführt.
[3] Es sei angemerkt, dass fortlaufend von ‚traurigen Filmen’ ‚Tragödien’ oder ‚Filmen mit traurigen Inhalten’ die Rede sein wird.
[4] Zum Konstrukt der „Parasozialen Beziehung“ bzw. der Vorstellung einer „emotionalen Beziehung zwischen Zuschauer und Bildschirmakteur“ vgl. z. B. Bente, 1997, S.44-48.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Ruchlak (Autor:in), 2007, Selektionsmotive für traurige Filme und Analyse der spezifischen Rezeptionsmodalitäten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80387
Kostenlos Autor werden




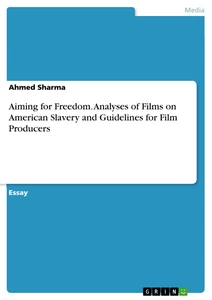






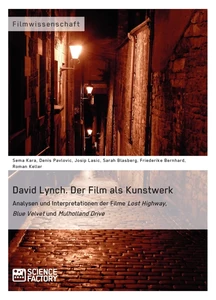





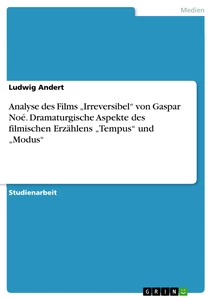



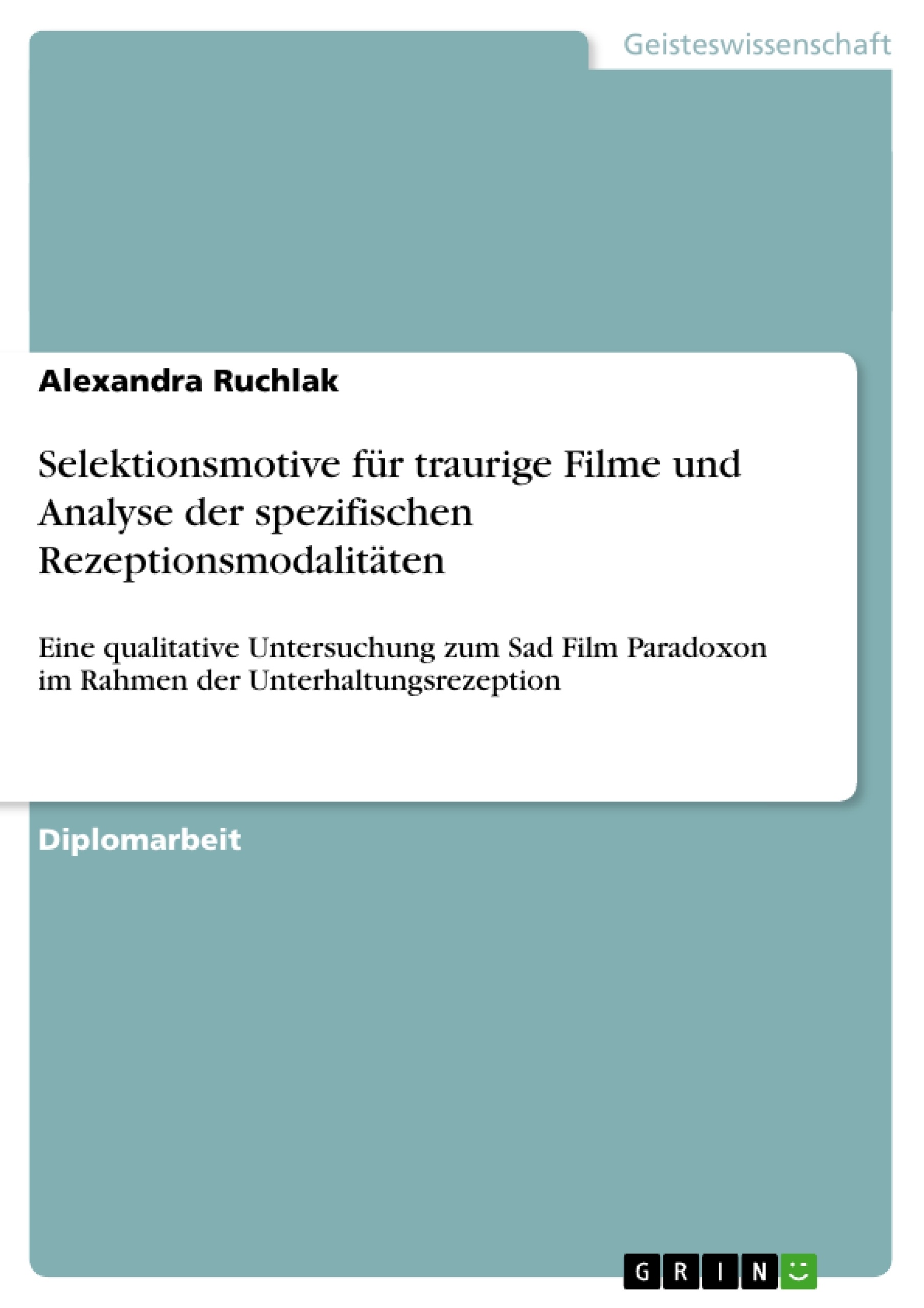

Kommentare