Leseprobe
Einleitung
Mit Immanuel Kant und Gottlob Frege stehen zwei Philosophen im Zentrum der folgenden Arbeit, deren Werke die sich anschließende philosophische Entwicklung nachhaltig beeinflusst haben.
Im erkenntnistheoretischen Bereich wird die von Kant 1781 in der Kritik der reinen Vernunft entwickelte Konzeption einer transzendentalen Verfasstheit des Subjekts, welche die Bedingungen der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse a priori bereitstellt, allgemein als die Theorie des transzendentalen Idealismus bezeichnet, der zur kopernikanischen Wende in der Philosophie geführt hat. Ihren Hauptgedanken erläutert Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage:
„Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntniß müsse sich nach den Gegen-ständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntniß erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntniß richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben sind, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“[1]
Stein des Anstoßes dieser Überlegungen war der skeptische Zweifel David Humes, der behauptete,
„daß wir die Möglichkeit der Kausalität, d. i. der Beziehung des Daseins eines Dinges auf das Dasein von irgendetwas anderem, was durch jenes nothwendig gesetzt werde, durch Vernunft auf keine Weise einsehen.“[2]
Die Lösung der Frage, wie der Mensch trotzdem berechtigterweise behaupten kann, dass alle Gegenstände der Erfahrung notwendigerweise unter dem Prinzip der Kausalität stehen, führt zu einer Philosophie, die
„als eine neuartige Lösung des Grundproblems aller abendländischen Philosophie bezeichnet werden [kann] — des Problems des Verhältnisses von Denken und Wirklichkeit“[3]
Ihr zentraler Aspekt ist hierbei,
„daß das Denken vermittelst der Zeit und des Raumes die Erscheinungswirklichkeit hervorbringt, während das wahre Sein uns für immer unbekannt bleibt.“[4]
Stegmüller beschreibt dies folgendermaßen:
„Wirklichkeitserkenntnis besteht nicht darin, daß sich die Eigenschaften einer bewußtseinstranszendenten Welt in unserem Bewußtsein widerspiegeln; vielmehr ist die sog. `wirkliche Welt´ — d. h. die einzige uns bekannte empirische reale Welt, von der wir sinnvoller Weise sprechen können — in ihren Grundbeschaffenheiten das Konstitutionsprodukt unseres eigenen (raumzeitlichen) Anschauungsvermögens und unseres Verstandes.“[5]
Weiter schreibt er:
„Nur wenn das Universum keine bewußtseinstranszendente Realität ist, sondern eine Leistung des transzendentalen Subjekts darstellt, wird es nach Kant verständlich, daß wir über dieses Universum zutreffende und zugleich erfahrungsunabhängige Aussagen machen können.“[6]
Diese Überlegungen Kants prägen die gesamte sich anschließende Entwicklung in der Philosophie. Stegmüller schreibt hierzu weiter:
„Von den vielen historischen Fäden, die von der heutigen Philosophie in die philosophische Vergangenheit führen, zeichnet sich die Beziehung zur kantischen Philosophie durch besondere Wichtigkeit aus. Kants Deutung der Wirklichkeitserkenntnis und seine Kritik an der rationalen Metaphysik bilden einen Einschnitt in der Geschichte der Erkenntnistheorie und Metaphysik. Es gibt nur wenige philosophische Standpunkte in der Gegenwart, die nicht unter anderem auch durch die Art ihrer Auseinandersetzung mit dem kantischen Standpunkt charakterisiert wären.“[7]
Diese Auseinandersetzung kann hierbei einerseits zu einer Weiterführung der Ideen Kants führen, kann aber auch in ihre Negierung münden. Aber selbst diejenigen Philosophen, welche die Konzeptionen Kants ablehnen „haben bestimmte Fragestellungen Kants übernommen und bauen auf seinen Gedanken auf.“[8]
Zweifellos hat Gottlob Frege von den Fragestellungen und Ausführungen Kants Notiz genommen. So geht er in den Grundlagen der Arithmetik mehrere Male explizit auf Kants Unterscheidung zwischen synthetischen und analytischen Urteilen sowie auf die Definition der arithmetischen Urteile als synthetische Urteile ein.[9] Gerade in dem Interesse an der Definition der Urteile der Arithmetik sieht Sluga ein verbindendes Element in den Überlegungen von Kant (sowie Leibniz) und Frege und schreibt:
„Like Leibniz and Kant before him, Frege is interested in the study of logic and the foundations of mathematics because they allow one to ask in a precise form what can be known through reason alone.”[10]
Weiter heißt es:
„The basic issue of his Foundations of Arithmetic is the question whether or not arithmetical truths are analytic or not.“[11]
Trotz dieses gemeinsamen Themas (bei dem Kant und Frege zu verschiedenen Lösungen kommen) sieht Michael Dummett Frege keineswegs als einen Philosophen an, der das Erbe Kants lediglich verwaltet oder modifiziert. Vielmehr schreibt er ihm einen ähnlich fundamentalen Einfluss wie Kant selbst zu wenn er schreibt: „he achieved a revolution as overwhelming as that of Descartes.“[12] Diese Wertschätzung Dummetts gründet in mehreren Verdiensten Freges, die recht vielschichtig sind. Im Rahmen des als Logizismus bezeichneten Versuchs einer logischen Letztbegründung des Begriffs der natürlichen Zahl versucht er, ein „logisches Modell für die Arithmetik“[13] zu konstruieren, in dem er zeigen will,
„daß die einzelnen Zahlbegriffe (d. h. die Begriffe der Null, der Eins, der Zwei usw.), aber auch der allgemeine Begriff der natürlichen Zahl, ferner der Begriff des Nachfolgers einer Zahl sowie die verschiedenen Operationen an Zahlen auf rein logische Begriffe zurückgeführt werden können. In einem zweiten Schritt leitet er die Sätze der Arithmetik aus Sätzen der formalen Logik ab.“[14]
Ein zentrales Dokument dieser Versuche ist das Buch Grundlagen der Arithmetik. Diesen Untersuchungen gehen Überlegungen zu einer angemessenen Möglichkeit der Darstellung der logischen Verhältnisse voran, denn schon fünf Jahre vor Erscheinen der Grundlagen der Arithmetik 1884 moniert Frege die „Unzulänglichkeit der Sprache“[15] bei der Darstellung verwickelter logischer Beziehungen und entwirft deswegen in der Begriffsschrift ein neues Notationssystem dieser logischen Verhältnisse, die nun in einer Aussagen- und Quantorenlogik ihren Ausdruck finden. Durch Einführung einer mehrstelligen Relationenstruktur an Stelle der herkömmlichen Subjekt-Prädikat-Struktur erweitert Frege die klassische Logik des Syllogismus um die Möglichkeit der Darstellung und Handhabung wesentlich komplexerer logischer Verwicklungen, als es bislang der Fall war. Er führt den Allquantor ein und beschränkt sich bei den aussagenlogischen Verknüpfungen auf den wenn ... dann -Junktor, durch den sich unter Verwendung der Negation alle anderen Junktoren darstellen lassen. Kurt Wuchterl schreibt hierzu
„Frege gelingt es, neben der Aussagenlogik auch die Prädikatenlogik 1. Stufe mit Identität, die gesamte Relationenlogik und die Prädikatenlogik höherer Stufe (in der Quantoren auch auf Prädikate angewandt werden) als Kalküle darzustellen.“[16]
Zudem erlauben die neuen formalen Mittel
„eine saubere Trennung der Subsumtion eines Gegenstandes unter einen Be-griff und derjenigen eines Begriffs unter einen anderen Begriff; dies ermöglicht die Unterscheidung von Begriffen verschiedener Stufen.“[17]
Die Missachtung dieser beiden Differenzierungen hat, so Wuchterl, „in der Logik und in der Erkenntnistheorie viel Verwirrung gestiftet.“[18]
Diese und ähnliche Überlegungen sind es, aufgrund derer Frege von vielen Autoren als der größte Logiker seit Aristoteles gewürdigt wird.[19]
Eine der Neuerungen, die Frege in der Begriffsschrift einführt, ist die Strukturierung des Urteils in Funktion und Begriff. Sie soll die herkömmliche Strukturierung des Urteils in Subjekt und Prädikat, die bis dahin als repräsentativ für die logische Struktur des Urteils gilt, ablösen. Hierzu bemerkt Frege, dass sich die Logik „bisher immer noch zu eng an Sprache und Grammatik angeschlossen hat.“[20] Weiter schreibt er: „Insbesondere glaube ich, dass die Ersetzung der Begriffe Subject und Praedicat durch Argument und Function sich auf die Dauer bewähren wird.“[21] Entsprechend heißt es in § 3 der Begriffsschrift: „Eine Unterscheidung zwischen Subject und Praedicat findet bei mir nicht statt.“[22] Mit dieser Neustrukturierung eines Satzes in die Bestandteile Argument und Funktion meint Frege einer Aufgabe der Philosophie Rechnung zu tragen, die er darin sieht
„die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem sie die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die Beziehungen der Begriffe fast unvermeidlich entstehen.“[23]
Ein Beispiel soll die Neuerung verdeutlichen. Ein Satz besteht als Funktion nach Frege aus einem ergänzungsbedürftigen Funktionsausdruck und einem Eigennamen, der die Argumentstelle der Funktion belegt. Entsprechend lässt sich ein Urteil wie „Das Buch ist grün“ ansehen als ein gesättigter Funktionsausdruck, bestehend aus der Funktion „x ist grün“ und dem Eigennamen eines Gegenstandes, nämlich „Das Buch“. Mit der Einsetzung dieses Eigennamens in die Argumentstelle der Funktion ergibt sich für diese Funktion ein Funktionswert, nämlich der des Wahren oder des Falschen. Was genau es hiermit auf sich hat, das wird an anderer Stelle ausführlich erläutert. Wichtig zu erkennen ist, dass die Kopula ist hier keine explizite Bedeutung erlangt, ihr keine besondere Funktion zugewiesen wird. Sie wird mit dem Prädikatsnomen zusammengefasst und als Teil des Funktionsausdruckes begriffen.
Für Immanuel Kant ist demgegenüber die Subjekt-Prädikat-Struktur des Satzes ein zentrales Element seiner erkenntnistheoretischen Überlegungen. In ihr spiegeln sich nach seiner Auffassung die Strukturen des Denkens wider, lässt sich das Grundschema des Denkens erkennen, das in dem Unterordnen von Begriffen besteht. Hierbei kommt insbesondere der Kopula ist als Repräsentant des synthetischen Vermögens des Subjekts eine tragende Rolle zu. Sie bestimmt die Art des Verhältnisses von Subjekt- und Prädikatbegriff und damit der entsprechenden Vorstellungen. Die Form des Urteils besteht in der Form der Kopula, die Materie des Urteils in den durch sie aufeinander bezogenen Begriffen. Zugleich verkörpern die Variationen der Kopula als die allein möglichen Formen reinen Denkens auch die Grenzen des Verstandes in formaler Hinsicht; er kann der Form nach nur die Urteile fällen, die in der Kopula zutage treten. Dies wiederum hat innerhalb der kantischen Erkenntnistheorie Auswirkungen sowohl auf die Anzahl und den Inhalt synthetischer Urteile a priori als auch auf die Struktur der mit Bewusstsein wahrgenommenen Welt. Somit kommt der Subjekt–Prädikat-Struktur des Satzes in den Überlegungen Kants eine bedeutende Rolle zu. Kant steht hierbei in einer Tradition, in der die
„Unterscheidung zwischen Subjekt und Prädikat von einer Synthese aus[ging], die den Merkmalen des Subjekts mit dem Prädikat ein weiteres hinzufügt, das Subjekt wurde dabei selbst als Summe von Merkmalen verstanden. Bei Frege ist dagegen von einer solchen Zusammensetzung nicht die Rede.“[24]
Entsprechend spricht Frege nicht mehr von Vorstellungen, die im Urteil miteinander verknüpft werden, sondern es ist vielmehr ein von den Subjekten unabhängig existierender Gedanke, der erfasst und ausgedrückt wird und dessen Ausdruck in die Bestandteile Funktion und Argument zerlegt werden kann.[25] In seiner Schrift Der Gedanke heißt es:
„Der an sich unsinnliche Gedanke kleidet sich in das sinnliche Gewand des Satzes und wird uns damit faßbarer. Wir sagen, der Satz drücke einen Gedanken aus.“[26]
Mit der Strukturierung des Urteils in Funktion und Argument scheinen also weitreichende Konsequenzen in Bezug auf den Erkenntnisprozess verbunden zu sein, die zu einem eigenständigen erkenntnistheoretischen Modell führen; dieses Modell darzustellen und den erkenntnistheoretischen Erwägungen Kants gegenüberzustellen, die er insbesondere in der transzendentalen Ästhetik und transzendentalen Analytik der Kritik der reinen Vernunft äußert, ist ein zentrales Anliegen dieser Arbeit. Hierbei soll sich zeigen, inwiefern Freges Überlegungen denen Kants widersprechen bzw. mit ihnen vereinbar sind.
Will man das angesprochene erkenntnistheoretische Modell Freges erstellen, so ist hierbei die Lehre von Sinn und Bedeutung sprachlicher Ausdrücke von zentraler Bedeutung. In ihr setzt sich Frege detailliert mit den semantischen Konsequenzen seiner Neuerungen im logischen Bereich (und damit mit dem auch für Kant so wichtigen Aspekt des Verhältnisses von Wirklichkeit und Denken) auseinander und legt hierbei einen Grundstein der sprachanalytischen Philosophie. Deswegen wird die Erörterung der Sinn- und Bedeutungslehre Freges ein wichtiger Baustein dieser Arbeit sein, deren Aufbau sich folgendermaßen gestaltet:
In Teil I wird zunächst kurz der skeptische Zweifel David Humes skizziert, der Kant nach seinen eigenen Worten aus seinem dogmatischen Schlummer weckte und ihn zur Ausarbeitung der in der Kritik der reinen Vernunft dargelegten Transzendentalphilosophie veranlasste. Ihr schließt sich eine ausführliche Besprechung der kantischen Urteilslehre mit ihrer Differenzierung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen sowie eine Erörterung der in der transzendentalen Ästhetik und transzendentalen Analytik der Kritik der reinen Vernunft entworfenen transzendentalen Verfasstheit des Subjekts an. Auf diesem Wege soll dann ein Bild vom erkennenden Subjekt im Sinne Kants entstehen, in dem u. a. geklärt wird, welche erkenntnistheoretisch relevanten Prozesse und Dispositionen mit dem Urteil bei Kant verknüpft sind und welche Bedeutung hierbei seiner Subjekt-Prädikat-Struktur zukommt.
Nach einer Zusammenfassung der in Teil I gewonnenen Erkenntnisse wird in Teil II zunächst kurz auf die Probleme eingegangen, mit denen sich Frege konfrontiert sieht. Die sich anschließende Erarbeitung der Konzeption des erkennenden Subjekts im Sinne Freges wird eingeleitet durch die Erläuterung der Strukturierung des Urteils in Funktion und Argument. Ihr schließt sich die Erörterung der Lehre von Sinn und Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, des ganzen Satzes sowie seiner Teile (Eigenname und Funktionswort) an, die u. a. zu dem erkenntnistheoretisch wichtigen Begriff vom Gedanken führt. Es folgt die Besprechung weiterer relevanter Begriffe wie z. B. das Verhältnis von Begriff und Gegenstand oder die Differenzierung zwischen subjektiven und objektiven Vorstellungen. Den Abschluss von Teil II bildet eine zusammenfassende Darstellung der Stellung des Urteils innerhalb des Erkenntnisprozesses bei Frege sowie der Konsequenzen, die sich aus seiner Strukturierung in Funktion und Argument ergeben.
In Teil III erfolgt dann der abschließende Vergleich der Auffassungen Kants und Freges und es wird ein Fazit gezogen in Hinblick auf die Frage nach der Verträglichkeit bzw. Gegensätzlichkeit der erkenntnistheoretischen Grundpositionen der beiden Philosophen.
I) Immanuel Kant
1) Der skeptische Zweifel David Humes
Es war David Hume, dessen skeptischer Zweifel, so Kant
„mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab.“[27]
Hauptsächlicher Gegenstand dieses Zweifels war der Begriff der Ursache. Allgemein wurde angenommen, dass das Ursache-Wirkungsverhältnis als ein tatsächlich existierendes von den Menschen wahrgenommen wird. Doch Hume zweifelt an dieser selbstverständlich scheinenden Annahme und schreibt:
„Angenommen, ein Mensch von ausgezeichneten Fähigkeiten der Vernunft und der Überlegung würde plötzlich in diese Welt gestellt, so würde er freilich sofort eine stetige Folge von Gegenständen und Ereignissen beobachten; aber irgend etwas weiteres zu entdecken, wäre er nicht imstande. Er würde anfangs durch keinen Denkakt imstande sein, die Vorstellung von Ursache und Wirkung zu fassen, weil die besonderen Kräfte, durch welche alle Naturvorgänge sich vollziehen, niemals den Sinnen erscheinen.“[28]
Ein Ursache-Wirkungsverhältnis würde die angenommene Person also zunächst nicht wahrnehmen, vielmehr ein scheinbar regelloses Aufeinanderfolgen von bestimmten Ereignissen. Nimmt man aber weiter an
„daß er mehr Erfahrung gewonnen und lange genug in der Welt gelebt hat, um den ständigen Zusammenhang gleichartiger Gegenstände oder Ereignisse beobachtet zu haben — was ist die Folge dieser Erfahrung?“[29]
Sie besteht für Hume darin, dass die entsprechende Person „unmittelbar das Dasein des einen Gegenstandes aus dem anderen [ableitet].“[30] Grundlage für diese Folgerung ist die empirisch wahrgenommene wiederholte Aufeinanderfolge bestimmter Ereignisse. Hume nennt das Prinzip, nach dem dieses Folgern stattfindet, das Prinzip der Gewohnheit oder Übung.[31] Der Mensch (oder die Vernunft) begnügt sich aber nicht damit, eine bloße sich wiederholende Abfolge bestimmter Ereignisse zu attestieren; vielmehr schließt er auf eine Kraft, die ein bestimmtes Ereignis aufgrund eines anderen Ereignisses herbeizwingt. Diese Kraft ist das Ursache-Wirkungsverhältnis, das als reales Prinzip der uns umgebenden Natur verstanden wird. Hume aber zeigt auf, dass der Mensch eine solche Kraft nirgendwo wahrnimmt und wahrnehmen kann, da sich die Naturkräfte, wie bereits geschrieben, unseren Sinnen, unserer Wahrnehmung entziehen. In einem Zwischenfazit seiner Abhandlung schreibt Hume:
„Wir haben vergebens nach einer Vorstellung von Kraft oder notwendiger Verknüpfung in all den Quellen gesucht, aus denen sie unserer Ansicht nach abfließen konnte. Es zeigt sich, daß wir in Einzelfällen der Wirksamkeit von Körpern auch mit äußerster Genauigkeit der Prüfung nie etwas anderes entdecken können, als daß ein Ereignis dem anderen folgt.“[32]
Weiter heißt es:
„Alle Ereignisse erscheinen durchaus unzusammenhängend und vereinzelt. Ein Ereignis folgt dem anderen; aber nie können wir irgendein Band zwischen ihnen beobachten. Sie scheinen zusammenhängend, doch nie verknüpft: Und da wir keine Vorstellung von etwas haben können, das nie unseren äußeren Sinnen noch dem inneren Gefühl sich darbot, so scheint die notwendige Schlußfolgerung zu lauten: daß wir überhaupt gar keine Vorstellung von Verknüpfung oder Kraft besitzen, und daß diese Wörter gänzlich ohne Sinn sind, ob sie nun in philosophischen Gedankengängen oder im gewöhnlichen Leben angewandt werden.“[33]
Was mit diesen Wörtern bezeichnet wird, das ist nichts anderes als das Empfinden, das ein Mensch hat, wenn er aufgrund des Prinzips der Gewohnheit beim Auftreten eines bestimmten Gegenstandes ein darauf folgendes Ereignis erwartet. Der Geist wird aus Gewohnheit veranlasst
„beim Auftreten des einen Ereignisses dessen übliche Begleitung zu erwarten und zu glauben, daß sie ins Dasein treten werde.“[34]
Und dieses in der Gewohnheit gegründete Gefühl, diese in der Gewohnheit gründende Vorstellung ist Basis für die Vorstellung von der notwendigen Verknüpfung. Hume schreibt:
„Diese Verknüpfung also, die wir im Geist empfinden (! T.S.), dieser gewohnheitsmäßige Übergang der Einbildung von einem Gegenstand zu seinem üblichen Begleiter ist das Gefühl oder der Eindruck, nach dem wir die Vorstellung von Kraft oder notwendiger Verknüpfung bilden.“[35]
In diesem Sinne sind Wörter wie Kraft oder notwendige Verknüpfung nicht ohne jede Bedeutung, und als Fazit lässt sich hieraus folgern:
„Behaupten wir also, daß ein Gegenstand mit einem anderen verknüpft ist, so meinen wir nur, daß sie in unserem Denken eine Verknüpfung eingegangen sind und die Ableitung veranlassen, durch die sie zu Beweisen ihres beiderseitigen Daseins werden.“[36]
In ähnlicher Weise drückt es Hume später nochmals so aus:
„Wir empfinden ein neues Gefühl oder einen Eindruck, nämlich eine gewohnheitsmäßige Verknüpfung im Denken oder in der Einbildung zwischen einem Gegenstand und seiner üblichen Begleitung.“[37]
Und dieses Gefühl, so Hume weiter „ist das Urbild jener Vorstellung [der notwendigen Verknüpfung], die wir suchen.“[38]
In einem zusammenfassenden Satz lässt sich aus Humes Überlegungen das Fazit ziehen, dass wir
„über den ständigen Zusammenhang gleichartiger Gegenstände und die daraus folgende Herleitung des einen aus dem andern hinaus [...] keinen Begriff irgend einer Notwendigkeit oder Verknüpfung [haben].“[39]
Diese Folgerung, dieses skeptische Fazit Humes nennt Kant „übereilt und unrichtig“.[40] Gleichwohl ist es dieser skeptische Zweifel, der, wie bereits erwähnt, Kant aus seinem, wie er es nennt, dogmatischen Schlummer reißt und dessen Erörterung zu jener vielzitierten kopernikanischen Wende in der Philosophie führt. Warum Kant die Schlussfolgerung Humes als falsch bezeichnet und worin die kopernikanische Wende besteht, das soll im folgenden Kapitel erörtert werden.
1.1) Die Aufhebung des Zweifels in der kopernikanischen Wende
Die Konsequenzen, die Hume aus seinen Überlegungen zieht, sind deswegen falsch, weil er schon zur Erklärung des Begriffs der notwendigen Verknüpfung von der bis dato üblichen Vorstellung ausgeht, „alle unsere Erkenntniß müsse sich nach den Gegenständen richten.“[41] Unter dieser Voraussetzung, so Kant, müssen „alle Versuche über sie [die Gegenstände] a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntniß erweitert würde“[42] scheitern. Ein Gesetz wie das der Kausalität kann, mit anderen Worten, als eine Bedingung, unter der alle Gegenstände der Erfahrung `immer schon´ stehen, nicht aus der Erfahrung abgeleitet werden. Geht man davon aus, dass sich unsere gesamte Erkenntnis einschließlich der Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten tatsächlich nur aus der Erfahrung ableiten lässt, so ist es nicht möglich, zwingend zu behaupten, dass alle Vorgänge in der Natur immer und notwendig in einem Verhältnis von Ursache und Wirkung stehen. Dass aber eine solche Behauptung eine Erkenntnis a priori ist und als solche nicht von der Erfahrung abgeleitet sein kann, das begründet Kant folgendermaßen:
„Erfahrung giebt niemals ihren Urtheilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit (durch Induction), so daß es eigentlich heißen muß: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. so, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig.“[43]
Die Aussage, dass alle Ereignisse der Natur notwendig nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung verbunden sind, ist ein solches Urteil von strenger Allgemeinheit und somit, wie bereits gesagt, eine Erkenntnis a priori.
Die Möglichkeit von Sätzen bzw. Urteilen als solchen von strenger Allgemeingültigkeit lässt sich nun nicht erklären, wenn man mit Hume davon ausgeht, dass sich unsere Erkenntnis ausschließlich nach den Gegenständen der Erfahrung richten muss, also wesentlich induktiv ist.
„Man versuche es daher einmal, ob wir nicht [...] damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntniß richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll.“[44]
Mit diesem Satz führt Kant den entscheidenden Perspektivwechsel in die Erkenntnistheorie ein und ist sich der herausragenden Bedeutung dieses Perspektivwechsels wohl bewusst, wenn er schreibt:
„Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“[45]
Mit Bezug auf das Problem von Sätzen bzw. Urteilen, die wie das Kausalitätsgesetz von strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit und somit Erkenntnisse a priori von Gegenständen sind heißt dies, dass das erkennende Subjekt diese Erkenntnisse nicht auf induktivem Wege gewinnt, indem sie aus der Erfahrung abgelesen werden, sondern dass es diese Eigenschaften den Gegenständen der Erfahrung selbst zuweist. Nur auf diesem Wege, so Kant, lassen sich Sätze von strenger Allgemeinheit, also Erkenntnisse a priori erklären, und dass das Gesetz von Ursache und Wirkung eine solche Erkenntnis ist, daran besteht für Kant kein Zweifel:
„Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Object der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.“[46]
Dies führt zu der Aussage, dass wir „von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen.“[47] Diese Theorie wiederum ist für Kant nur unter der Annahme möglich, dass wir
„von keinem Gegenstande als Ding an sich selbst, sondern nur so fern es Object der sinnlichen Anschauung ist, d. i. als Erscheinung, Erkenntniß haben können.“[48]
Von den Dingen an sich, als Ursache der Erscheinungen, können wir nichts weiter sagen, als dass sie existieren müssen, denn sonst, so Kant „würde der ungereimte Satz daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint.“[49]
Ist nun mit dem Gegenstand der Erfahrung `lediglich´ die Erscheinung gemeint, mit der das Subjekt konfrontiert wird, so lässt sich denken, dass es möglich ist, dass der Verstand als ein Vermögen dieses Subjekts auf einem noch näher zu bestimmenden Wege diese Erscheinungen, die in ihrer Gesamtheit die vom Subjekt wahrgenommene Erscheinungswelt und damit die es umgebende Natur ausmachen, seinen Gesetzen gemäß strukturiert. Eine Form der Strukturierung könnte hierbei die sein, dass alle Veränderungen notwendig im Rahmen eines Ursache-Wirkungsverhältnisses stehen.
Nachdem Kant einmal die Möglichkeit von Erkenntnissen a priori von Gegenständen erkennt, stellt sich ihm die Frage, ob noch mehr solcher Aussagen möglich sind, und tatsächlich gelingt es ihm, weitere solcher Sätze ausfindig zu machen. Auf sie wird an anderer Stelle eingegangen. An dieser Stelle ist die Überlegung wichtig, dass sich für Kant in einem Urteil der Form „Wenn x geschieht dann muss y folgen“ eine allgemeine Struktur erkennen lässt, die aus einem verbindenden Element, in diesem Fall wenn ... dann, und einer bestimmten Urteilsmaterie, die über dieses Element in Beziehung zueinander gesetzt wird, besteht. Neben den verbindenden Elementen wenn ... dann und entweder ... oder, deren Materie ihrerseits wieder aus Urteilen besteht, ist die Kopula ist in ihren jeweiligen Modi von entscheidender Bedeutung. Sie stellt ein zentrales Element in den Überlegungen dar, wie Subjekt und Prädikat eines Satzes (bzw. die Begriffe, für die sie stehen) aufeinander bezogen werden können. Vorgreifend lässt sich sagen, dass für Kant diese Überlegungen deswegen von Bedeutung sind, weil er davon ausgeht, dass die Subjekt-Prädikatstruktur des Satzes identisch ist mit der logischen Struktur, sich in ihr die Strukturen des Verstandes offenbaren. In der Urteilstafel zeigt sich das Ergebnis dieser Überlegungen. In ihr, so Kant, ist „die Function des Denkens [...] unter vier Titel gebracht [...], deren jeder drei Momente unter sich enthält.“[50]
Die Art und Weise also, wie in einem Urteil vermittelst der Kopula Subjekt und Prädikat aufeinander bezogen werden, offenbart die Funktionen des Denkens oder, anders ausgedrückt, die Struktur des Verstandes.
Wie sich noch zeigen wird, sind es in den erkenntnistheoretischen Überlegungen Kants genau diese Verstandesstrukturen, die die Natur als Erscheinung, die Erscheinungswelt, gewissen Gesetzmäßigkeiten unterwerfen, indem sie auf diese Erscheinungswelt angewandt werden. Die Kausalitätsstruktur eines Urteils ist hierbei einer jener Momente des Denkens, und ihre Anwendung auf das Anschauungsmaterial, auf die Welt der Erscheinungen, führt zwangsläufig zu einer Sicht der Dinge, in der alle Erscheinungen in einem Ursache-Wirkungsverhältnis stehen müssen.
Die hier aufgestellten Behauptungen stellen freilich nur eine erste Skizzierung einer Theorie dar, die Ottfried Höffe mit den Worten Vaihingers die Theorie des A priori[51] nennt und die es im folgenden ausführlich darzustellen gilt. Sie ist für ein Verständnis der Urteilslehre Kants bzw. der Erkenntnisprozesse, die das Urteil ausmachen oder ihm zugrunde liegen unerlässlich.
Nun nennt Kant eine Erkenntnis a priori auch ein synthetisches Urteil a priori, und dieser Begriff ist zentral in den Überlegungen Kants. Bevor er jedoch in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, soll auf eine generelle Unterscheidung der Urteile eingegangen werden, die schon durch den Ausdruck synthetisch angedeutet ist. Den synthetischen Urteilen setzt Kant die analytischen entgegen; die einen nennt er Erkenntnisurteile, die anderen Erläuterungsurteile. Bevor also der spezielle Begriff des synthetischen Urteils a priori geklärt wird, soll auf einer allgemeineren Ebene zunächst die fundamentale Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen thematisiert werden.
2) Analytische und synthetische Urteile
2.1) Analytische Urteile
Inhaltlich, so Kant, gibt es zwischen Urteilen einen Unterschied
„vermöge dessen sie entweder bloß erläuternd sind und zum Inhalte der Erkenntniß nichts hinzuthun, oder erweiternd und die gegebene Erkenntniß vergrößern; die ersteren werden analytische, die zweiten synthetische Urtheile genannt werden können.“[52]
Als Beispiel für ein analytisches Urteil nennt Kant den Satz „Alle Körper sind ausgedehnt.“[53] In diesem Begriff wird über den Körper nichts ausgesagt, was nicht durch den Begriff des Körpers selbst schon gegeben wäre. Es gehört zu den wesentlichen, den definierenden Eigenschaften des Körpers, ausgedehnt zu sein. Entsprechend schreibt Kant:
„Analytische Urtheile sagen im Prädicate nichts als das, was im Begriffe des Subjects schon wirklich, obgleich nicht so klar und mit gleichem Bewußtsein gedacht war. Wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so habe ich meinen Begriff vom Körper nicht im mindesten erweitert, sondern ihn nur aufgelöset, indem die Ausdehnung von jenem Begriffe schon vor dem Urtheile, obgleich nicht ausdrücklich gesagt, dennoch wirklich gedacht war; das Urtheil ist also analytisch.[54]
Analytische Urteile zeichnen sich also dadurch aus, dass sie einen bestimmten Be-griff erläutern, indem sie seine Bestandteile bzw. einen seiner Bestandteile herausstellen. Der Prädikatbegriff des analytischen Urteils ist ein solcher, der zu den (notwendigen) Eigenschaften des Subjekts zählt.
2.2) Synthetische Urteile a posteriori
Im synthetischen Urteil hingegen ist das Verhältnis von Subjekt und Prädikat ein anderes; der Prädikatbegriff wird nicht bereits im Subjektbegriff mitgedacht und nur noch aus demselben extrahiert, sondern dem Subjektbegriff wird eine Eigenschaft zugesprochen, die nicht notwendig Bestandteil seiner Definition ist. Kant schreibt:
„Dagegen enthält der Satz: einige Körper sind schwer, etwas im Prädicate, was in dem allgemeinen Begriffe vom Körper nicht wirklich gedacht wird; er vergrößert also meine Erkenntniß, indem er zu meinem Begriffe etwas hinzuthut, und muß daher ein synthetisches Urtheil heißen.“[55]
Im genannten Beispiel, der Zusprechung der Eigenschaft der Schwere zu einigen Körpern, gründet sich die Erweiterung der Erkenntnis auf Erfahrung, denn
„indem ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so finde ich mit den obigen Merkmalen [sc. der Ausdehnung, der Undurchdringlichkeit, der Gestalt etc.] auch die Schwere jederzeit verknüpft und füge also diese als Prädicat zu jenem Begriffe synthetisch hinzu.“[56]
Ein Urteil dieser Art klassifiziert Kant als ein synthetisches Urteil a posteriori. Hierdurch wird ausgedrückt, dass es
„die Erfahrung [ist], worauf sich die Möglichkeit der Synthesis des Prädicats der Schwere mit dem Begriffe des Körpers gründet, weil beide Begriffe, obzwar einer nicht in dem anderen enthalten ist, dennoch als Theile eines Ganzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Verbindung der Anschauungen ist, zu einander, wiewohl nur zufälliger Weise, gehören.“[57]
2.3) Synthetische Urteile a priori ... und die Möglichkeit der Metaphysik
Die Aussage, dass Alles, was geschieht, eine Ursache hat bezeichnet Kant als ein synthetisches Urteil a priori. Der Terminus a priori drückt aus, dass sich das Urteil in seiner behauptenden Kraft nicht auf Erfahrung stützt: „Bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hülfsmittel ganz und gar.“[58]
Hume hatte festgestellt, dass wir lediglich sehen oder wahrnehmen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas geschieht und unmittelbar darauf wieder etwas und so fort. Wir können hierbei aber in keiner Weise sehen oder wahrnehmen, dass ein bestimmtes Ereignis die Ursache für ein in der Zeit unmittelbar darauf folgendes darstellt; somit ist ausgeschlossen, dass es sich bei dem vom Hume angesprochenen Kausalitätsgesetz um ein synthetisches Urteil a posteriori handelt, und das schlichtweg deswegen, weil Erfahrung zur Aufstellung eines solchen Satzes nicht berechtigt. Die Überlegung, dass es sich hierbei eventuell um ein analytisches Urteil handeln könnte, schließt Kant mit folgender Begründung aus:
„Man nehme den Satz: Alles, was geschieht, hat seine Ursache. In dem Be-griff von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht etc., und daraus lassen sich analytische Urtheile ziehen. Aber der Begriff einer Ursache liegt ganz außer jenem Begriffe, und zeigt etwas von dem, was geschieht, Verschiedenes an, ist also in dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten.“[59]
Trotzdem wird das Urteil gefällt und ist hierbei offensichtlich synthetischen Charakters, gründet sich aber gleichwohl nicht auf Erfahrung; folglich muss es als ein synthetisches Urteil a priori klassifiziert werden. Die Frage, die sich nun stellt ist folgende:
„Wie komme ich denn dazu, von dem, was überhaupt geschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen und den Begriff der Ursache, ob zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar nothwendig gehörig zu erkennen?“[60]
Wenn man von der besonderen Form des Kausalitätsurteils absieht und man zugleich zeigen kann, dass es noch mehr synthetische Sätze a priori gibt, so lässt sich die gestellte Frage auf eine allgemeinere Ebene heben; die Frage, die sich dann stellt, ist die,
„worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Begriff von A ein demselben unbekanntes Prädicat B aufzufinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet?“[61]
In den Prolegomena schreibt Kant hierzu:
„Die eigentliche, mit schulgerechter Präzision ausgedrückte Aufgabe, auf die alles ankommt, ist also: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“[62]
Im Rahmen der Beantwortung der so vorgelegten Frage entwirft Kant das System einer Transzendentalphilosophie, „die vor aller Metaphysik nothwendig vorhergeht.“[63] Wieso aber bringt Kant hier den Begriff der Metaphysik ins Spiel? Warum ist die Beantwortung der Frage, wie synthetische Urteile a priori möglich sind von entscheidender Bedeutung für die Metaphysik?
In der Vorerinnerung der Prolegomena schreibt Kant, metaphysische Erkenntnis müsse „nicht physische, sonder metaphysische, d. i. jenseits der Erfahrung liegende, Erkenntniß sein.“[64] Zwangsläufig stellt sich an dieser Stelle die Frage, woraus eine Erkenntnis entspringen soll, wenn sie jenseits der Erfahrung liegt, also unseren Sinnen sich zu entziehen scheint? Kant selbst betont:
„Was die Quellen einer metaphysischen Erkenntniß betrifft, so liegt es schon in ihrem Begriffe, dass sie nicht empirisch sein können.“[65]
Als Wissenschaft einer den Sinnen nicht zugänglichen Welt oder Dimension können sich also metaphysische Erkenntnisse nach Kant auch nur auf solche Quellen stützen, die nicht in der den Sinnen zugänglichen Welt vorzufinden und somit empirisch sind, sondern eine andere Quelle muss ihr Ursprung sein. Kant schreibt:
„Also wird weder äußere Erfahrung, welche die Quelle der eigentlichen Physik, noch innere, welche die Grundlage der empirischen Psychologie ausmacht, bei ihr zum Grunde liegen.“[66]
Daraus folgert Kant, da die Welt der Sinne für eine metaphysische Erkenntnis und damit für die Metaphysik an sich nicht von Bedeutung ist: „Sie ist also Erkenntniß a priori, oder aus reinem Verstande und reiner Vernunft.“[67]
Metaphysische Erkenntnis ist somit Erkenntnis a priori, ihre Quellen liegen im Verstand und in der Vernunft. Hieraus folgt weiter, dass die Wissenschaft der Meta-
physik aus lauter Urteilen a priori bestehen muss, in denen die Erkenntnisse a priori vermittelt werden:
„Metaphysische Erkenntniß muß lauter Urtheile a priori enthalten, das erfordert das Eigenthümliche ihrer Quellen.“[68]
Nun wurde bereits gesagt, dass Erkenntnis nach Kant nur in synthetischen Urteilen zustande kommen kann, analytische Urteile hingegen sind lediglich Erläuterungsurteile, die das Wissen nicht erweitern, sondern lediglich deutlich machen.[69] Soll also die Metaphysik eine Wissenschaft sein, die in mehr als nur der Zergliederung bereits vorhandenen Materials besteht und Erkenntnisse liefert, so ist es nötig, dass der Hauptteil dieser Wissenschaft aus synthetischen Urteilen a priori besteht, in denen allein Erkenntnis a priori stattfinden kann. Und die Möglichkeit dieser Urteile muss zunächst erwiesen werden.
Mit der Frage „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“[70], von der Kant schreibt, dass „alle Metaphysiker [...] von ihren Geschäften feierlich und so lange suspendiert [sind], bis sie die Frage [...] beantwortet haben“[71] wird also zugleich die Frage beantwortet, wie Metaphysik möglich sei. Wer die Quellen synthetischer Sätze a priori aufdeckt, der deckt zugleich die Quellen metaphysischer Erkenntnis auf. Deswegen misst Kant dieser Frage eine solche Bedeutung bei.
Zu ihrer Beantwortung entwirft Kant wie bereits erwähnt in systematischen Zügen eine Transzendentalphilosophie, in der es um die Hervorbringung transzendentaler Erkenntnisse geht. Hierunter versteht Kant diejenigen Erkenntnisse
„dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden oder möglich sind.“
Eine transzendentale Erkenntnis und Transzendentalphilosophie insgesamt lässt sich also im Sinne Kants immer auffassen als „eine Theorie der Möglichkeit a priorischer Erkenntnis, kurz `eine Theorie des A priori´“[72]
Dieser Theorie soll nun intensiv nachgegangen werden. In ihr werden aus kantischer Sicht die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung dargelegt, wird eine transzen-dentale Verfasstheit des Subjekts entworfen, die für das Verständnis von Erkenntnis und damit dem Erkenntnisurteil grundlegend ist. Es gilt, die Strukturen a priori herauszustellen, die nach Kant dem Erkenntnisvermögen aller Menschen zugrunde liegen und als solche Erkenntnisse a priori von Gegenständen ermöglichen. Diese Strukturen finden sich sowohl in der Sinnlichkeit als auch im Verstand, den beiden Grundkomponenten der Erkenntnis. Ihre Struktur a priori herauszuarbeiten und sie dabei gegen die Materie abzugrenzen, die diese Struktur dann in der Erfahrung ausfüllt ist die Aufgabe der folgenden Ausführungen.
3) Form und Inhalt — Zur Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens
3.1) Form und Inhalt der Sinnlichkeit
Bei der Erörterung der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori und damit der Möglichkeit der Erkenntnisse von Gegenständen a priori muss beachtet werden, dass es, so Kant
„zwei Stämme der menschlichen Erkenntniß gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden.“[73]
Dies bedeutet:
„Sofern nun die Sinnlichkeit Vorstellungen a priori enthalten sollte, welche die Bedingung ausmachen, unter der uns Gegenstände gegeben werden, so würde sie zur Transzendental-Philosophie gehören.“[74]
Die Überlegung ist also die folgende: Wenn es sinnliche Eigenschaften in der Erfahrung gibt, die ganz so wie das Kausalitätsgesetz von allen Gegenständen der Erfahrung ausgesagt werden müssen und unter denen alle Gegenstände der Erfahrung notwendig stehen, so müssen sie aufgrund der strengen Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit zu den Bedingungen a priori von Erfahrung gehören und wären somit Gegenstand der Transzendentalphilosophie, der es um die Erklärung der Möglichkeit von Erkenntnissen a priori geht.
Von zwei Eigenschaften lässt sich nun tatsächlich sagen, dass sie notwendig allen Gegenständen der Erfahrung zukommen müssen; es sind Raum und Zeit. Alle Gegenstände der äußeren Sinne befinden sich zwanghaft in einem Raum-Zeitkontinuum, und kein Gegenstand kann auch nur gedacht werden, der nicht diesen Eigenschaften unterliegt. Höffe nennt dies ein negatives Argument zur Bestätigung des transzendentalen Charakters von Raum und Zeit und fügt ihm ein positives hinzu. Er schreibt:
„Auf das erste negative Argument folgt ein positives: Raum und Zeit sind notwendige Vorstellungen. Denn wir können uns zwar Raum und Zeit ohne Gegenstände oder Erscheinungen vorstellen, aber nicht, daß kein Raum oder keine Zeit sei. Selbst im Bereich der Sinnlichkeit gibt es etwas, das man nicht erst aufgrund empirischer Wahrnehmung, sondern schon `im voraus´ kennt. Raum und Zeit verdanken sich der a priorischen Struktur des erkennenden Subjekts.“[75]
Die Möglichkeit dieses Phänomens, dass nämlich alle Gegenstände der Wahrnehmung den Bedingungen von Raum und Zeit unterliegen, erklärt Kant durch ein Modell, in welchem er Raum und Zeit als Anschauungsformen des äußeren und inneren Sinnes deutet, die als solche einer Welt der Erscheinungen, und nicht einer Welt von Gegenständen, so wie sie unabhängig von unserem Dasein existieren, zugrunde liegen.[76] Dies soll näher erläutert werden.
In § 1 der Transzendentalen Ästhetik schreibt Kant:
„Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntniß auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. Diese findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiederum uns Menschen wenigstens nur dadurch möglich, daß er das Gemüth auf gewisse Weise afficire. Die Fähigkeit (Receptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. “[77]
Das Verhältnis von wahrnehmendem Subjekt und wahrgenommenem Objekt stellt sich für Kant also folgendermaßen dar: Es gibt eine vom Subjekt unabhängige und für sich existierende Welt von Gegenständen, von Objekten, die das Gemüt des Menschen `affizieren´, also Reize auslösen oder hervorbringen, die das sind, was Kant als Anschauungen bezeichnet. Was der Mensch wahrnimmt und worauf sich all sein Denken richtet, das ist somit eine Welt der Erscheinungen; er ist immer nur mit der Wirkung des Gegenstandes auf das Gemüt, niemals aber mit dem Gegenstand selbst beschäftigt. Diesen Gegenstand selbst, von dem nichts weiter ausgesagt werden kann, als dass er existiert bzw. existieren muss, da der Mensch ohne ihn nicht zu Anschauungen kommen würde, nennt Kant das Ding an sich.
Anschauungen sind also als Vorstellungen der Teil der Erkenntnis, der durch einen direkten Bezug zu den Gegenständen, den Dingen an sich, zustande kommt. Wie verhält es sich nun mit den Vorstellungen des Raumes und der Zeit? Werden auch sie durch die Affizierung des Gemüts durch die Dinge an sich hervorgebracht? Kant verneint diese Frage und nennt sowohl den Raum als auch die Zeit „eine nothwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt.“[78] Um diese These zu erhärten, führt er die reine Mathematik als eine Wissenschaft an, deren Möglichkeit nur erklärt werden kann, wenn auch ihr Raum und Zeit als Vorstellungen a priori zu Grunde liegen; denn nur so lässt sich nach Kant ihre „durch und durch apodiktische Gewißheit, d. i. absolute Nothwendigkeit“[79] erklären, womit die reine Mathematik
„auf keinen Erfahrungsgründen beruht, mithin ein reines Product der Vernunft, überdem aber durch und durch synthetisch ist.“[80]
Verdeutlichen lässt sich diese Aussage am Beispiel der geometrischen Sätze der Mathematik, die als Grundsätze eine allgemeine Notwendigkeit mit sich führen. In ihnen werden Aussagen über Gegenstände der Erfahrung getroffen, die notwendig auf diese Gegenstände zutreffen noch ehe sie in der Erfahrung gegeben sind. Dies ist nur möglich und verständlich, wenn die Geometrie ihre Sätze bzw. ihre Begriffe „vorher in der Anschauung, und zwar a priori, mithin einer solchen, die nicht empirisch, sondern reine Anschauung ist“[81] aufstellt bzw. konstruiert; denn alle Aussagen, die die Geometrie von den Verhältnissen der Teile der reinen Anschauung trifft, müssen notwendig auf die Vorstellungen zutreffen, die diese reinen Anschauungsformen dann ausfüllen. Ohne die Möglichkeit der Konstruktion ihrer Begriffe in der reinen Anschauung wäre Geometrie als Wissenschaft mit Sätzen von apodiktischer Gewissheit nicht möglich.
Allerdings führt der Begriff einer Anschauung a priori gewisse Schwierigkeiten mit sich, denn er besagt ja, dass eine Anschauung stattfindet, ohne dass es Gegenstände gibt, die angeschaut werden, und somit schließt sich die folgende Frage an: „Wie ist es möglich, etwas a priori anzuschauen?“[82] Es scheint
„unmöglich, a priori ursprünglich anzuschauen, weil die Anschauung alsdann ohne einen weder vorher, noch jetzt gegenwärtigen Gegenstand, worauf sie sich bezöge, stattfinden müßte und also nicht Anschauung sein könnte.“[83]
Apodiktische Aussagen der Geometrie über Gegenstände der Anschauung, ohne dass diese Gegenstände überhaupt gegeben sind; es gibt nur einen Weg, das Zustandekommen einer solchen Möglichkeit zu erklären:
„Es ist also nur auf eine einzige Art möglich, daß meine Anschauung vor der Wirklichkeit des Gegenstandes vorhergehe und als Erkenntniß a priori stattfinde, wenn sie nämlich nichts anderes enthält, als die Form der Sinnlichkeit, die in meinem Subject vor allen wirklichen Eindrücken vorhergeht, dadurch ich von Gegenständen afficirt werde.“[84]
Wie bereits erwähnt, müssen konsequenterweise alle Gegenstände der Erfahrung, alle Gegenstände der Wahrnehmung den Formen der Sinnlichkeit, darin sie vorkommen entsprechen, und hieraus folgt,
„daß Sätze, die blos diese Form der sinnlichen Anschauung betreffen, von Gegenständen der Sinne möglich und gültig sein werden, imgleichen umgekehrt, daß Anschauungen, die a priori möglich sind, niemals andere Dinge als Gegenstände unserer Sinne betreffen können.“[85]
Somit ist also auch die Möglichkeit der Geometrie und ihrer gesetzesmäßigen Aussagen nur unter der Annahme reiner Anschauungsformen a priori möglich, womit umgekehrt die Existenz der allgemeinen Sätze der Geometrie eine Bestätigung für die Existenz von Anschauungsformen a priori ist.
Die Lehre der transzendentalen Ästhetik von Raum und Zeit als den Anschauungsformen, darin die Welt der Erscheinungen sich notwendig befinden muss, ist also von größter Wichtigkeit für das Verständnis der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori als Aussagen von Gegenständen a priori, denn es ist
„nur die Form der sinnlichen Anschauung, dadurch wir a priori Dinge anschauen können, wodurch wir aber auch die Objecte nur erkennen, wie sie uns (unserem Sinne) erscheinen können, nicht wie sie an sich sein mögen; und diese Voraussetzung ist schlechterdings nothwendig, wenn synthetische Sätze a priori als möglich eingeräumt, oder, im Falle sie wirklich angetroffen werden, ihre Möglichkeit begriffen und zum voraus bestimmt werden soll.“[86]
[...]
[1] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Zweite Auflage 1787. In: Kants gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. III. Berlin: Reimer 1911, S. 11. (B XVI) Im Folgenden werden Zitate aus diesem Werk mit KrV angegeben.
[2] Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. In: Kants gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. IV. Berlin: Reimer 1911, S. 253-383, hier S. 310. Zitate aus diesem Werk werden im Folgenden mit Prolegomena angeführt.
[3] Grayeff, Felix: Deutung und Darstellung der theoretischen Philosophie Kants. Ein Kommentar zu den grundlegenden Teilen der Kritik der reinen Vernunft. Zweite Auflage mit einem Sachregister von Eberhard Heller. Hamburg: Meiner 1977, Einleitung, S. XX.
[4] Ebd. S. XXI.
[5] Stegmüller, Wolfgang: Hauptströmungen der Philosophie. Eine kritische Einführung. Bd. I. Fünfte, erweiterte Auflage. Stuttgart: Kröner 1975, Einleitung S. XXVII.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Vgl. hierzu: Frege, Gottlob: Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Auf der Grundlage der Centaurenausgabe herausgegeben v. Christian Thiel. Hamburg: Meiner 1988, S. 14 f., S. 40, S. 92-94 et al.
[10] Sluga, Hans D.: Gottlob Frege. London: 1980, S. 59.
[11] Ebd.
[12] Dummett, Michael: Frege: Philosophy of Language. Second Edition. London: 1981, S. 665.
[13] Stegmüller: Hauptströmungen, S. 436.
[14] Ebd.
[15] Frege, Gottlob: Begriffsschrift und andere Aufsätze. Zweite Auflage. Mit E. Husserls und H. Scholz´ Anmerkungen. Herausgegeben von Ignacio Angelelli. 5. Nachdruck der 2. Auflage. Hildesheim: Georg Olms Verlag 1998, S. X.
[16] Wuchterl, Kurt: Handbuch der analytischen Philosophie und Grundlagenforschung. Von Frege zu Wittgenstein. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt 2002, S. 56.
[17] Ebd., S. 57.
[18] Ebd.
[19] So schreibt Franz von Kutschera: „Gottlob Frege gilt heute zu Recht als die zentrale Figur unter denen, die zur Begründung der modernen Logik beigetragen haben, und es ist auch nicht übertrieben, wenn man ihn als den bedeutendsten Logiker nach Aristoteles bezeichnet.“ Kutschera, Franz von: Gottlob Frege. Eine Einführung in sein Werk. Berlin, New York: de Gruyter 1989, S. 1. Zu Freges Begriffsschrift schreibt Bochenski: „Seine Begriffsschrift kann nur mit einem Werk in der ganzen Geschichte der Logik verglichen werden, mit den ersten Analytiken des Aristoteles.“ Bochenski, J. M.: Formale Logik. Freiburg, München 1956, S. 313.
[20] Frege: Begriffsschrift, S. XIII.
[21] Ebd.
[22] Ebd., S. 2.
[23] Ebd., S. XII.
[24] Mayer, Verena: Der Wert der Gedanken. Die Bedeutungstheorie in der philosophischen Logik Gottlob Freges. Frankfurt am Main: Lang 1989 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie: Bd. 276), S. 69.
[25] Gerold Prauss spricht in diesem Zusammenhang von dem elementaren Unterschied zwischen einer bloßen Rezeptivität des Denkvermögens bei Frege und einer Spontaneität desselben bei Kant. Prauss, Gerold: „Freges Beitrag zur Erkenntnistheorie. Überlegungen zu seinem Aufsatz `Der Gedanke´. In: Allgemeine Zeitschrift für philosophische Forschung. 1976/1, S. 34-61, hier S. 49 f.
[26] Frege: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung. In: Logische Untersuchungen. Hrsg. und eingel. von Günther Patzig. 4., durchges. und bibliogr. erg. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 1993, S. 30–53, hier S. 50.
[27] Prolegomena, S. 260.
[28] Hume, David: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hrsg. v. Raoul Richter. Hamburg: Meiner 1973, S. 54.
[29] Ebd.
[30] Ebd.
[31] Vgl. Ebd., S. 55.
[32] Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, S. 89.
[33] Ebd., S. 90.
[34] Ebd., S. 91.
[35] Ebd.
[36] Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, S. 91.
[37] Ebd., S. 95.
[38] Ebd.
[39] Ebd., S. 99.
[40] Prolegomena, S. 258.
[41] KrV, S. 12 (B XVI).
[42] KrV, S. 12 (B XVI).
[43] Ebd., S. 29 (B 4).
[44] Ebd., S. 12 (B XVI).
[45] KrV, S. 12 (B XVI).
[46] Ebd., S. 12 (B XVII).
[47] Ebd., S. 13 (B XVIII).
[48] Ebd., S. 16 (B XXVI).
[49] Ebd., S. 17 (B XXVI).
[50] KrV, S. 86 (B 95).
[51] Höffe: Immanuel Kant, S. 67.
[52] Prolegomena, S. 266. Die Differenzierung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen beruht somit nicht auf formalen, sondern auf inhaltlichen Aspekten.
[53] Ebd.
[54] Prolegomena, S. 266. Dies führt zu dem Problem, ob sich immer zweifelsfrei feststellen lassen kann, inwieweit ein vorliegendes Urteil analytisch oder synthetisch ist, denn nicht immer wird man auf Anhieb wissen, ob ein Prädikatbegriff schon im Subjektbegriff mitgedacht ist oder nicht, und selbst eine eingehende Analyse kann hierüber noch Zweifel lassen.
[55] Ebd.
[56] KrV, S. 35 (B12).
[57] Ebd.
[58] KrV, S. 35 (B 12).
[59] Ebd., S. 35 (B 13).
[60] Ebd.
[61] KrV, S. 35 (B 13).
[62] Prolegomena, S. 276.
[63] Ebd., S. 279.
[64] Ebd., S. 265.
[65] Ebd.
[66] Ebd.
[67] Ebd., S. 266.
[68] KrV, S. 35 (B 13).
[69] Ebd.
[70] Ebd., S. 39 (B 19).
[71] Prolegomena, S. 278.
[72] Höffe: Immanuel Kant, S. 67.
[73] KrV, S. 46 (B 29).
[74] Ebd.
[75] Höffe: Immanuel Kant, S. 77.
[76] Hierbei ist die Zeit in einem gewissen Sinne noch grundlegender als der Raum, denn es lässt sich wohl eine Zeit denken, die ohne Raum existiert; sich aber einen Raum vorzustellen, der nicht in der Zeit besteht, ist unmöglich.
[77] KrV, S. 49 (B 33).
[78] KrV, S. 57 (B 46).
[79] Prolegomena, S. 280. Hier muss angemerkt werden, dass sie ihre Objekte selbst hervorbringt und ihren Begriffen erst im Nachhinein in der Anschauung ein korrespondierender Gegenstand gegeben werden muss. Ein Ding an sich ist zur Hervorbringung des mathematischen Begriffes also zunächst nicht nötig.
[80] Ebd.
[81] Ebd., S. 281.
[82] Prolegomena, S. 281.
[83] Ebd.
[84] Ebd., S. 282.
[85] Ebd.
[86] Prolegomena, S. 283.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Thomas Sent (Autor:in), 2005, Subjekt-Prädikat, Funktion und Argument, Sinn und Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80093
Kostenlos Autor werden




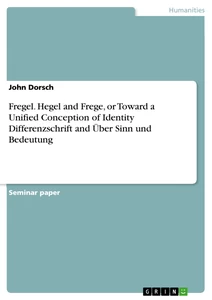















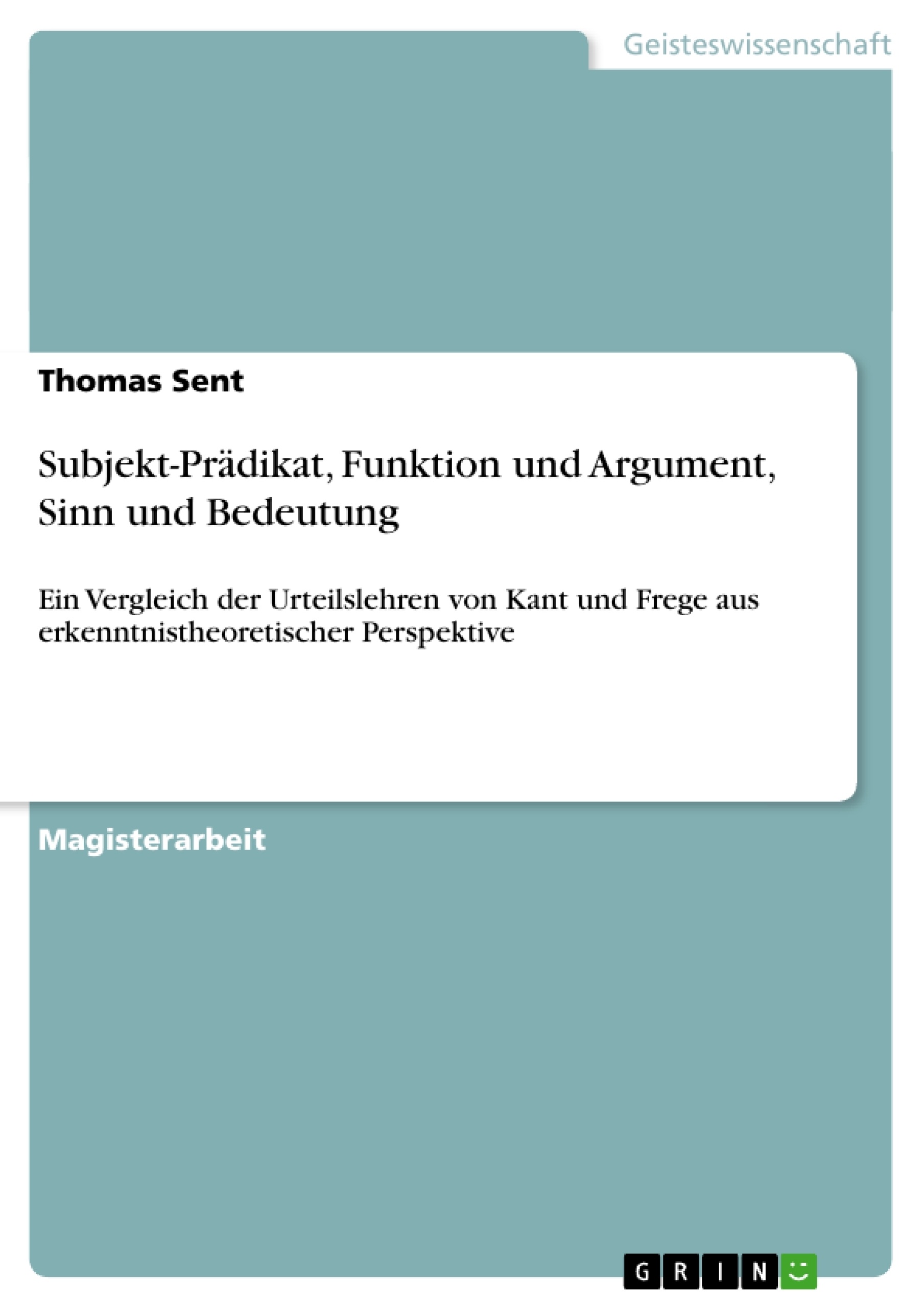

Kommentare