Leseprobe
Inhalt
Vorwort
Einführung. Kulturwissenschaft und Poetik
I Ähnliche Netze und mannigfaltige Gewebe
II Das Anderswo des Meeres und der Wüste
III Der Fleck oder: der Rest ist das Zentrum
Nachwort
Bibliographie
Abbildung Titelseite vgl. Fußnote 118.
Vorwort
Astronautin in einem R aum Z eit-Experiment: „So schön, so wunder-, wunderschön. Poesie! Man hätte einen Dichter schicken sollen.“
Contact, USA 1997, nach: Carl Sagan, Contact (1985).
Im Folgenden werden keine hermeneutischen Spuren verfolgt. Im Zentrum meiner Untersuchung stehen kanonisch etablierte Metaphern des Raumes in literarischen Texten sowie die intertextuelle Struktur der sich durch sie formierenden Metaphernkonstellationen. Hierbei sind auch assoziative Bezüge zu geisteswissenschaftlichen Texten von Bedeutung. Im direkten Nebeneinanderstellen entsprechender Textstellen verschiedener Genres sowie innerhalb eines Genres wird die sinnstiftende Aussagekraft solcher Konstellationen deutlich. Ein Exposévorschlag in Blumenbergs Metaphorologie war hierzu Initiation:
Die alte Schicksalsmetapher vom Schiff auf dem Meere fließt hier mit dem neuen Bewußtsein von der Entropie des Weltgeschehens zusammen, das die Gestalt der Reisemetapher aufnimmt, die bei der Odyssee Homers ihren ewigen Quell hat, aber nun die Gegenform der Heimkehrlosigkeit, der Irreversibilität, der Nicht-Kreisförmigkeit erreicht hat. Das ist beinahe schon das Exposé einer, noch zu leistenden, sehr reizvollen Sonderuntersuchung.[1]
Um im Sinne der Topologie eine Orientierung innerhalb der modernen Literatur zu ermöglichen, beschränkt sich meine Untersuchung auf die Metaphernkonstellationen Netz – Gewebe, Meer – Wüste und Fleck – Rest.
Einführung. Kulturwissenschaft und Poetik
Zu jeder Zeit gibt es eine Orthodoxie, ein Meinungssyssystem […] Es ist nicht eben verboten, dies oder jenes zu sagen, aber es ist unschicklich es zu sagen.
Orwell, Nachwort zu Farm der Tiere .
Kulturwissenschaftliche Überlegungen über die Poesie und das Poetische beschäftigen sich zum einen mit dem mannigfaltigen Übergang von der Ökonomie des Wortes und der Metapher zur Ökonomie der Metaphernkonstellation. Zum anderen sind sie ein Versuch, Literatur- und Kulturwissenschaft als ein doppeltes Verhältnis von intertextuellen Spuren und innerhalb der in den genannten Ökonomien sich verändernden Strukturen des Textes zu denken. Nicht der Begriff der interdiskursiven Formationen desselben Sagens und Aussagens ist ihr methodischer Gegenstand, sondern der Begriff der gleichen Konstellation des ähnlichen Meinens und Erinnerns im Diskurs der Poesie hinsichtlich der Art und Weise der Manifestation signifikanter topologischer Metaphern in moderner Literatur.
Nach dem Scheitern der Enzyklopädisten um Diderot verdunkelte sich in den frühen Anfängen der Moderne nicht nur für Literaturwissenschaftler und Historiker die lichte Tradition der gesicherten Lesbarkeit historischer Texte durch Kanonisierung und Kommentierung. „Weil im Gedächtnis notorisch Platzmangel herrscht,“[2] wurde für die Kulturwissenschaft jede Geschichte des Textes zu einem dichten undurchdringlichen Gewebe, d. h. einem Fetzen notwendiger Datenkompression. Spuren signifikanter Brüche und Reste, d. h. des Abfalls transportieren dann Informationen über Gedanken, Assoziationen und deren Kopien denn kodierte Botschaften vom Sinn eines Textes:
Hatte man auf dem Boden der Tradition des Gedächtnisses von der Einschreibung und Speicherung her bestimmt, so wird es nun im Rahmen des historischen Bewußtseins von der Tilgung, der Zerstörung, der Lücke, dem Vergessen her definiert. […] Während man bei Buchstaben und Texten von der vollständigen Reaktivierbarkeit einer vergangenen Mitteilung ausging, kann an Spuren immer nur ein Bruchteil vergangenen Sinns restituiert werden. […] Dank seiner Andacht zum Unbedeutenden verwandeln sich dem Kulturhistoriker [Kulturwissenschaftler] Abfall in Information.[3]
Die strukturale Analyse des poetischen Textes, seiner diskursiven Arrangements und Metaphernkonstellationen ist eine Methode, assoziative Gedanken mittels Episteme der Philosophie und Poesie sichtbar zu machen. Vielleicht identifiziert Descombes deshalb in seinem Buch mit dem vielsagenden Titel Das Selbe und das Andere ausgerechnet den Philosophie lehrer in einem Theater stück Molièrs’ als Erfinder der strukturalistischen Methode:
Der Erfinder der strukturalistischen Methode ist wahrscheinlich jener Philosophielehrer, den Molière im Bourgeois gentilhomme [Der Bürger als Edelmann] (II. Akt, 5. Szene) auftreten läßt. […] „Ich will“, sagt er, „nur diese wenigen Worte in dem Brief, doch sollen sie modisch gewendet und schön arrangiert sein, wie es sich gehört. Ich bitte Euch, mir eine wenig die verschiedenen Weisen [je diskursive Metaphernkonstellationen] zu zeigen, nach denen man sie setzen kann.“[4]
Den Rest der sinnstiftenden und assoziativen Macht des Poetischen vergleicht Bataille mit einem sich ins Befremdliche auflösende Sagen, dessen Bilder immer schon mit ähnlichen Assoziationen beladen sind. Den sich darin offenbarenden, alle Diskurse beherrschenden und stets selben Rest – das Unbekannte an sich – versteht er gleichsam als „Erfahrung Gottes – oder des Poetischen – […]. Aber das Unbekannte verlangt zuletzt die ungeteilte Herrschaft.“[5] Im poetisch-dramatischen Ausdruck der inneren Erfahrung als Nähe dieses Unbekannten sieht Bataille den wesentlichen Unterschied zum strengen Diskurs, vor allem zur Philosophie:
Der Diskurs kann, wenn er will, zum Sturm blasen. […] Der Unterschied zwischen innerer Erfahrung und Philosophie liegt vor allem darin, daß die Aussage in der Erfahrung nichts als ein Mittel ist und sogar ebenso ein Hindernis wie ein Mittel; was zählt, ist nicht mehr der ausgesagte Wind, sondern der Wind. In diesem Punkt erblicken wir die […] Bedeutung des Wortes dramatisieren: es ist der zum Diskurs hinzutretende Wille, nicht bei der Aussage stehenzubleiben, den eisigen Wind spüren zu lassen, [… sondern] indem sie das Heulen des Windes nachahmt.[6]
Einer der assoziativsten und in diesem Sinne informativsten Begriffe vom Hinübergleiten des Diskurses in die innere Erfahrung der Poesie ist für Bataille das Wort Schweigen. Danach bricht er seinen Text Die innere Erfahrung ab, um in kursiver Schrift das wüstenhafte Schweigen etwas aussagen zu lassen.
Das Schweigen ist ein Wort, das kein Wort ist, […] I ch unterbreche von neuem den Verlauf der Darlegung. Ich nenne keine Gründe dafür [schweigt] . […] Es ist schwer, verständlich zu machen, in welchem Ausmaß die Wüste fern ist, in der meine Stimme endlich so wenig Sinn tragen würde […] Die Poesie ist trotz allem der beschränkte Teil – an den Bereich der Wörter gebunden. […] Und in dem Ausdruck ihrer selbst ist sie letztlich gezwungenermaßen nicht weniger Schweigen als Sprache. […] Die Erfahrung kann nicht kommuniziert werden, wenn Bande des Schweigens, des Zurücktretens, der Distanz nicht diejenigen verwandeln [ausdrücken], die sie ins Spiel bringt.[7]
Eine ähnliche Aussage, sinnstiftende Phänomene des Poetischen innerhalb der strengen geisteswissenschaftlichen Diskurse zu zeigen und zu analysieren, verfolgt Derrida in Die Metapher im philosophischen Text. Danach scheint die Metapher an sich den Gebrauch der philosophischen Sprache in ihren eigen poetischen Dienst zu stellen. Der sicher epistemologisch gemeinte Satz: „Die Seele besitzt Gott in dem Maße, als sie am Absoluten teilhat.“[8] ist eine fast stumme Formel, entsprungen einem endlos erklärenden Diskurs, die kaum etwas aussagt, aber dennoch ein umherirrendes Flüstern dramatisiert. Nachdem die Inschrift des Seins im ersten an das Dasein gerichtete Wort Gottes ausgelöscht wurde, ließen die Metaphern metaphysischer Diskurszentren jede Philosophie blind werden gegenüber ihren Resten im Anderen, d. h. im Poetischen. Der strenge Diskurs versucht seither, Metaphern epistemologischer Reste nach ihren anhängenden Diskursen zu klassifizieren. Und um die Metapher nicht als bloßes rhetorisches Stilmittel beherrschen zu müssen, wurde sie als Ausdrucksmodus der Idee privatisiert, ohne wirklich zwischen der Idee für sich und der Geschichte der sie ausdrückenden Begriffe zu unterscheiden.[9] Hier entsteht für Derrida ein Paradox. Eine Philosophie, die nicht ohne Zentren auskommen kann, ist selbst Teil ihrer eigenen metaphorischen Rede.
Einerseits ist es unmöglich, die philosophische Metaphorik als solche von außen in den Griff zu bekommen, indem man sich eines Metaphernbegriffes bedient, der ein philosophisches Produkt bleiben wird. Einzig die Philosophie scheint eine gewisse Autorität über ihre metaphorischen Erzeugnisse zu besitzen. Andererseits aber, aus dem gleichen Grund, versagt sich die Philosophie das, was sie sich zu geben vermag. Indem ihre Werkzeuge ihrem Bereich angehören, ist sie außerstande, ihre allgemeine Tropologie und Metaphorik zu beherrschen. Sie würde sie nur im Umfeld eines blinden Flecks oder eines Zentrums von Taubheit wahrnehmen. […] Der Philosoph wird hier niemals das finden, was er hineingelegt hat oder zumindest was der Philosoph glaubt [meint], hineingelegt zu haben.[10]
Derridas Schlußfolgerung ist epistemologisch relevant. Weder die Rhetorik noch eine Metadiskurs kann die Metapher positiv definieren. Stets ist es ein sich historisch und mannigfach diskursiv konstituierendes „begriffliches Netz […]. Das Definierte ist also im Definierenden der Definition mit eingeschlossen.“[11] Das implizite topologische Problem eines Möbiusschen Verhältnisses des Drinnen-und-Draußen-Seins möglicher Bedeutungen wurde anhand Saussure und Foucault im ersten Teil diskutiert.
Eine ähnliche im historischen Diskurs verankerte Position vertreten Blumenbergs Metaphorologie und Whites Metahistory. Danach haftet jedem Begriff ein epistemologischer Rest, eine Lücke an, die durch Metaphern ausdrücklich substituiert wird. Jenseits des Begriffes sind Metaphern „Sinn- oder Denk figuren, die – komplementär zu […] erkenntnistheoretischen Grundbegriffen – das gesamte Sinnuniversum eines Textes bzw. Autors vorstrukturieren.“[12] Der Struktur nach sind Metaphernkonstellationen und diskursive Formationen dasselbe. Die Heideggersche Gefahr der Einengung des Denkens wird offensichtlich. Fohrmann erkennt sie in der sowohl diskursiven als auch interpretatorischen Beliebigkeit des radikalen Eklektizismus der Postmoderne.
Ein jüngerer amerikanischer Kollege meldete sich [eine Tagung 1993] zu Wort […]: „It is time for radical eclecticism!“ […] Ist das Pochen auf Radikalität nicht nur ein rhetorischer Trick, seitdem nicht nur bei Jacques Derrida zu lesen ist, daß es weder die Basis noch die Wurzel gibt, sondern nur das Flottieren und provisorische Arretieren der nicht beendbaren Signifikantenkette? Was ist mit Eklektizismus überhaupt gemeint? […] Wenn radikaler Eklektizismus angesagt ist, warum hat er dann bei der Formulierung dieses Satzes keine Rolle gespielt? [… So] fragte ich, ob mit dieser […] Aussage etwas gemeint sein könnte, was für die Situation der Literaturwissenschaft [ähnlich der Philosophie …] vor der Jahrtausendwende zutreffend sei. […] Beobachtungen zweiter Ordnung könnten allerdings etliche Symptome benennen, die in diese Richtung verweisen.[13]
Solche Beobachtungen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Im kulturwissenschaftlichen Diskurs der Intertextualität lassen sich anhand der Konstellationen topologischer Metaphern anschauliche Beispiele für die Symptome eines geisteswissenschaftlichen Eklektizismus finden. Gleiche Konstellationen sind nicht erst im Beginn der modernen Literatur ausmachen, weil das Poetische selbst, im essentiellen Unterschied zum strengen Diskurs, nichts bedeutsames Aussagen kann, sondern zum Leser stets durch etablierte Diskurse seiner historischen Epoche hindurch spricht.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen fragt sich Flusser in Die Schrift bezüglich der sich beschleunigt entwickelnden Kulturtechniken der Medien, welcher Art das Schreiben eine Zukunft hat ? Oder hat „die Bindung des Denkens an Sprachen unsere außerordentliche Abstraktionsfähigkeiten verkümmern lassen?“[14] Ist unser Alphabet nicht mehr in der Lage, unabhängig von sich verselbständigenden Maschinencodes etwas neues sinnvolles zu sagen? Oder liegt es im Wesen unseres Denkens, durch die als Schrift sichtbaren Diskurse zum Piktoralen und zum Ideogramm zurückzukehren. Flusser prognostiziert diese Möglichkeit technizistisch im Diskurs des Computerinterface oder, metaphorologisch genauer, im Bild der Möbiustopologie:
Das Alphabet ist […] zu einem Hilfscode geworden […]. Am Ausgang der Schriftkultur wendet sich das Alphabet sein Gegenteil. Es wurde von den Bildern [Piktogramme, Hieroglyphen] ausgesandt, um diese zu überholen, und es kehrt jetzt zu ihnen zurück, um sie wieder herzustellen. Sieht man die Schriftkultur in ihrer Gesamtheit als eine einzige, dreitausend Jahre lang laufende Zeile, so erkennt man sie als eine Schleife [einseitige Schleife, Möbiusband], die von Bildern ausgeht, um [gewendet] zu ihnen zurückzukehren.[15]
Eine andere, wenngleich ähnlich reduktionistische Prognose wagt Derrida im Geiste seiner Logozentrismuskritik. Er sieht den Übergang von der Gutenberggalaxis zur Turinggalaxis sowohl im piktoralen Denken zwischen den Zeilen als das Ende des Buches, als auch im Ende der jahrtausendewährenden linearen Schrift, d. h. im Anfang der zeilenlosen Schrift. Gemeint ist nicht der Computercode selbst, sondern die sich unter dem Einfluß der Computermedien prinzipiell neu organisierenden und piktoral formierenden Diskursgeflechte.[16] An genau diesem Paradigmenwechsel bringt Derrida den Schriftsteller als Wächter des Buches ins Spiel, gerade weil „das Ende der Schrift durch die Schrift geht.“[17] In erkennbaren epistemologischen Verbindungen zwischen strengem Diskurs und Poesie, an der Schwelle zur ausdrücklichen Entfremdung des Sinns manifestiert sich ein Glaube der Kulturwissenschaft daran, das durch Diskursordnungen allein nicht zu beherrschende Sagen des Selben als das Befremdliche, das Unverständliche, d. h. als das Poetische wieder in die Schrift und somit in den Diskurs des geisteswissenschaftlichen Denkens integrieren zu können. Wenn in diesem Denken Diskurstheorie und Metaphorologie dasselbe sind, das heißt nicht, das gleiche, dann ist vorliegende Arbeit Ausdruck dieses Glaubens.
I Ähnliche Netze und mannigfaltige Gewebe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gaffarel, Celestial Alphabet Event, in: Rothenberg 1995, 793.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daniel, Vernetzung, in: Gomringer 1994, 71.
Um die assoziative Aussagekraft der Intertextualität des gleichen Meinens eines ähnlichen Gedankens anhand zentraler topologischer Metaphern in den Blick zu bekommen, bedarf es einer geordneten Gegenüberstellung von Textpassagen* aus Poesie und Literaturphilosophie. Methodisch bilden diese beiden Diskursfelder die größtmögliche Schnittmenge zugleich nicht eindeutiger und sinnstiftender Aussagen. Diese Schnittmenge formiert vielfältige, d. h. nicht prägnante oder vage Formen, die als Metaphernkonstellationen deshalb so ausdrucksmächtig sind, weil ihre wesentliche Unschärfe stets Diskursivierungen oder Interpretationen zugleich erzwingt und ermöglicht.[18] Abhängig sind sie von den epochal geschlossen organisierten symbolischen Ordnungen der Geisteswissenschaften und ihren Dispositiven der exakten Wissenschaften und der Technik. Gemeinsam formieren und deformieren sie synchron und anti-genealogisch – aber dennoch historisch – sich verändernde Informations- und Wissensnetze. Um sich im durch sie determinierten Denken orientieren zu können, schreiben Autor und Leser beispielsweise physische und digitale Zettelkästen.
Wann Shakespeares Sommernachtstraum geschrieben und uraufgeführt wurde, ist nicht geklärt. Bis 1970 versucht Arno Schmidt, den darin nicht beschriebenen Traum des Webers Zettel als die Struktur eines beliebig vernetzten Zettelganzen abzubilden. Ähnlich verbalinspiriert entwirft James Joyce in Finnegans Wake schon 1939 eine Art vorbabylonischer Ursprache und nimmt so entscheidende Tendenzen der literarischen Postmoderne, die mit dem Poststrukturalismus zwischen dem Ende des zweiten Weltkrieges und den Studentenunruhen von 1968 beginnt, vorweg. Das grundlegend gleiche Merkmal beider Denk- und Schreibsysteme ist zum Einen die Absage an den Fortschrittsglaube der Moderne und die Möglichkeit, einen neuen literarischen Stil schaffen zu können. Zum Anderen gaben sich beide der verführerischen weil sinnstiftenden Kombinatorik der Intertextualität und Interdiskursivität hin.
Zettel: Ich hab’ ein äußerst rares Gesicht [orig. vision] gehabt ! Ich hatt’ nen Traum – ‘s geht über Menschenwitz, zu sagen, was es für ein Traum war. Der Mensch ist nur ein Esel [setzt sich zuvor selbst einen Eselskopf auf], wenn er sich einfallen läßt, diesen Traum auszulegen. Mir war, als wär’ ich – kein Menschenkind kann sagen, was. […] der Mensch ist nur ein Hanswurst, wenn er sich unterfängt, zu sagen, was mir war, […] seine Zunge kann’s nicht begreifen, […], was mein Traum war. [Sommernachtstraum, Akt 4. 1]
– (Vor=allim aba weiß Ich: wo Ich nachzuseh’n habe !). – […] es war […] (M)ein Drang: aus, scheinbar desparat=isoliertn BruchStückn, ein consequentes unwiderlegbares Ganzes zu erbasteln. […] SpezialFall des ‘Künstlers’ als Projektivisten […] zur […] Servierung seiner VisionsFelder. […] wie […] das Innersde der, microko(s)mischn, MenschnEinheit […] als macrokosmisch= fernSde RundumCulisse abbilden solle ?[19]
Neben der Forderung nach Dezentralisierung der Geisteswissenschaften, stellt Francis Bacons Neues Organon, die Große Erneuerung der Wissenschaften von 1620 eine Kritik an die klassische Philosophie und Schulmetaphysik dar, weil sie außerstande ist, über Maß oder Zahl ihrer Objekte etwas auszusagen. Zugleich gilt Bacon als Vater der Philosophie als experimenteller Wissenschaft, deren Wissenszuwachs gleichbedeutend mit Machtzuwachs sei.[20] Gogol kritisiert auf ähnliche Weise in Die toten Seelen aus dem Jahre 1842 das ”patriotische“ Bildungsbürgertum seiner Zeit. Charakteristisch für diese Epoche ist die organische Netzmetapher für die von diesen Bürgern überwachte Stadt. In Wind, Sand und Sterne beschreibt Saint-Exupéry 1939 Städte in fraktaler Selbstähnlichkeit wiederum als Spinnen inmitten eines Straßennetzes: „Städte in der Ebene, deren jede in einem Straßennetz sitzt wie eine Spinne.“[21] Und Lowrys Unter dem Vulkan liefert 1947 mit Spinntzel zudem einen postmodernen Neologismus für Gogols Bürgerpatrioten.
Die, welche die Wissenschaften bearbeiten, waren entweder Empiriker oder Dogmatiker. Jene sammeln und verbrauchen nur, wie die Ameisen; letztere aber, welche mit Vernunft beginnen, ziehen wie die Spinnen das Netz [nebst einem Zentrum] aus sich selbst heraus. Das Verfahren der Bienen steht zwischen beiden; diese ziehen den Saft aus Gärten und Feldern. [Gemeint ist die antike Geisteslandschaft Arkadien …] Ähnlich ist das Geschäft der Philosophie.[22]
Der Autor wird sich auch noch Vorwürfe seitens der so genannten Patrioten zuziehen, die ruhig zu Hause hocken […] sobald aber etwas geschieht, […] wenn irgendein Buch erscheint, das manch bittere Wahrheit enthält – so kommen sie aus allen ihren Ecken angelaufen wie die Spinnen, wenn sie sehen, daß eine Fliege in ihr Netz geraten ist.[23] [V]erfolgt von anderen Spinntzeln, in jeder Straße.[24]
Solche organisch-topologischen Metaphern der Art wie die Spinnen werden zunehmend abgelöst von rein topologischen Metaphern. Ein entscheidender Einfluß sind sicher mathematisch-physikalische Schriften jener Zeit. Pierre Laplace, ein Pionier der Topologie, veröffentlicht zwischen 1799 und 1852 seine bahnbrechende fünfbändige Arbeit Mécanique céleste. Sie enthält jedoch, und darauf ist er stolz, keine Abbildungen, sondern nur Analysis über Vektor-Differential-Operatoren. Sein Einfluß auf bildende Kunst und Poesie verzögert sich notwenig. Ein anderer Pionier auf diesem Gebiet ist ein halbes Jahrhundert später der letzte Universalgelehrte Henri Poincaré.
Einen leidlichen Grad an metaphorischer Abstraktion markiert die Metapher des Fadens eines Gewebes, nicht eines Netzes. Herders Briefe zur Beförderung der Humanität, erschienen 1793 bis 1797, geben seiner Vermutung Ausdruck, nach der das akademische Geschick eines Gelehrten davon abhängt, welcher Art seine Gedanken im Futur 2 immer schon verwoben sein werden mit den Gedanken anderer Gelehrten vor ihm. 1808 meint Goethe, allerdings viel pathetischer, im ersten Teil des Faust das gleiche:
„Liesest du die Alten also? Wendest du sie also an?“ […] Dies Gefühl also, nach welchem er [Petrarca] ganz unter den Alten lebte, webte den Faden seiner Begebenheiten und ward, wie man sagt, der Schmied seines Glücks.[25]
Wie spricht ein Geist zum andern Geist. Umsonst, daß trocknes Sinnen hier/ Die heil’gen Zeichen dir erklärt. […] War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, […]. Mir wird so licht! […] Wie alles sich zum Ganzen webt,/ Eins in dem andern wirkt und lebt![26]
In Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung von 1819 findet sich nun eine kaum noch organisch angebundene Metapher des Geflechts. Seine Polemik gegen Hegels Wortgeflechte, einschließlich der privatisierten Unterstützung von Goethe und Jean Paul, endet ausgerechnet mit einem Verweis auf Hegels Albernheit. In diesem Sinne versteht Eco 1988 im Foucaultschen Pendel eine derart verworrene Argumentationen zugleich amüsant und erkenntniserweiternd:
Jedoch die größte Frechheit im Auftischen baren Unsinns, im Zusammenschmieren sinnleerer, rasender Wortgeflechte, wie man sie bis dahin nur in Tollhäusern vernommen hatte, trat endlich im Hegel auf und wurde das Werkzeug der plumpesten allgemeinen Mystifikation, […] ein Denkmal deutscher Niäserie [Albernheit] bleiben wird.[27]
Alles wurde säuberlich in Karteien verzettelt. […] Auch das verquasteste Manuskript brachte mir noch mindestens zwanzig neue Kärtchen für meine Vernetzungen ein. […] Keine Information ist weniger wert als die andere. […] Zusammenhänge gibt es immer, man muß sie nur finden wollen.[28]
Tennyson nutzt die bewährte Gewebemetapher 1832 in seiner Ballade The Lady of Shalott, um Phänomene der Repräsentation zu verdeutlichen, verknüpft mit antiken Bildern wie Platons Höhlengleichnis. Gleichzeitig deutet er spätere Diskurse der Psychoanalyse an, beispielsweise den Eintritt in die symbolische Ordnung nach dem Zerfall des identischen Subjekts im Spiegelstadium. Danach wird beispielsweise in Adornos Minima Moralia von 1951 die Schrift zur bedrohlichen Spur, die den Autor auszulöschen scheint. In Kulturkritik und Gesellschaft aus dem Jahre 1977 ist es gar der ideologisch-philosophische Diskurs der Moderne insgesamt, der aus seinen traditionellen Identitäten und ontologischen Differenzen entlassen wird. Danach beginnt seine Kritik der Massen- und Medienkultur als Kulturpessimismus oder Negative Dialektik die klassische Geschichtsphilosophie zu unterminieren. Adornos Kritik bezieht sich vor allem auf die Produktion des Immergleichen der Kulturindustrie und der Philosophie seit der Aufklärung. Der Fortschritt der modernen Geisteswissenschaft erweist sich innerhalb der so genannten Post- oder Cybermoderne dann als relativ im Verhältnis zu den von Adorno ausgemachten allgemeinen Rückbildungstendenzen der Netzgesellschaft ohne positive Zentren.
There she waves by night and day
A magic web with colours gay.
She has heard a whisper say,
A curse is on her if she stay to look down to Camelot.
[…] And moving thro’ a mirror clear […]
Shadows of the world appear. […]
To weave the mirror’s magic sights, […]
The sun came […] Of bold Sir Lancelot.
[…] As he rode down to Camelot […]
He flash’d into the cristal mirror, […]
She look’d down to Camelot.
Out flew the web and floated wide;
The mirror crack’d from side to side;
’The curse is come upon me,‘ cried the Lady
[…] Down she came and found a boat […].
She loosed the chain, and down she lay.[29]
Je dichter das Netz, das der Natur übergeworfen wurde, desto mehr beansprucht ideologisch das Denken, das jenes Netz spinnt, seinerseits Natur, Urerfahrung zu sein. […] Der philosophische Fortschritt äfft, weil er, je dichter er die Begründungszusammenhänge fügt, […] immer mehr Identitätsdenken wird. Er überspinnt die Gegenstände mit einem Netz, das, indem es die Lücken dessen verstopft, was es nicht selbst ist, vermessen anstelle der Sache selbst sich schiebt.[30]
In seinem Text richtet sich der Schriftsteller häuslich ein. […] Aber er hat keinen Speicher […]. Am Ende ist es dem Schriftsteller nicht einmal im Schreiben zu wohnen gestattet.[31]
[...]
[1] Blumenberg 1998, 29.
[2] A. Assmann 1996, 105.
[3] A. Assmann 1996, 106f.
[4] Descombes 1981, 99. Bemerkung von mir.
[5] Bataille 1999, 16.
[6] Bataille 1999, 26f.
[7] Bataille 1999, 31, 48.
[8] Derrida 1988, 208.
[9] Vgl. Derrida 1988, 215 bis 217.
[10] Derrida 1988, 221f.
[11] Derrida 1988, 223.
[12] Fohrmann 1995, 245f.
[13] Fohrmann 1995, 331f. Bemerkung von mir.
[14] Flusser 1987, 35.
[15] Flusser 1987, 134. Bemerkung von mir.
[16] Vgl. Derrida 1983, 16ff, 154f.
[17] Derrida 1976, 117.
* Links: historisch geordnetes Zitat, rechts: ein späteres metaphorologisch ähnliches Zitat.
[18] Vgl. Krois 2003.
[19] Schmidt 2002, 31, 1180f.
[20] Bacon 1870, 69.
[21] Saint-Exupéry 1988, 220.
[22] Bacon 1870, 148. Bemerkung von mir.
[23] Gogol 1952, 233f.
[24] Lowry 1994, 48f.
[25] Herder 1971, 277.
[26] Goethe 1986, 15. Goethes angeblich letzten Worte: „Das Zweifelnde und das Nichts Bezweifelnde. Mehr Licht!“ Tatsächlich bat er um seinen Nachttopf. Vgl. Hans Halter, Ich habe meine Sache hier getan. Leben und letzte Worte berühmter Frauen und Männer, 2007. (http://www. spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,475300,00.html.)
[27] Schopenhauer 1995, 579f.
[28] Eco 1993, 266f.
[29] Tennyson 1899, 28f.
[30] Adorno 1977, 462, 636.
[31] Adorno 1982, 108f.
- Arbeit zitieren
- Dr. des. Robert Dennhardt (Autor:in), 2003, Die Mannigfaltigkeit des Selben im Diskurs der Moderne (Teil 2), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79549
Kostenlos Autor werden









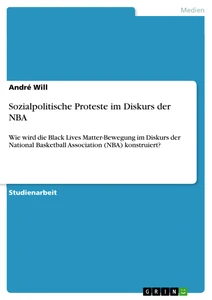
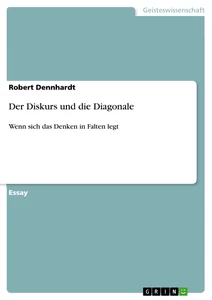







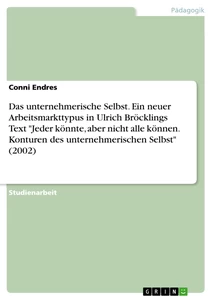

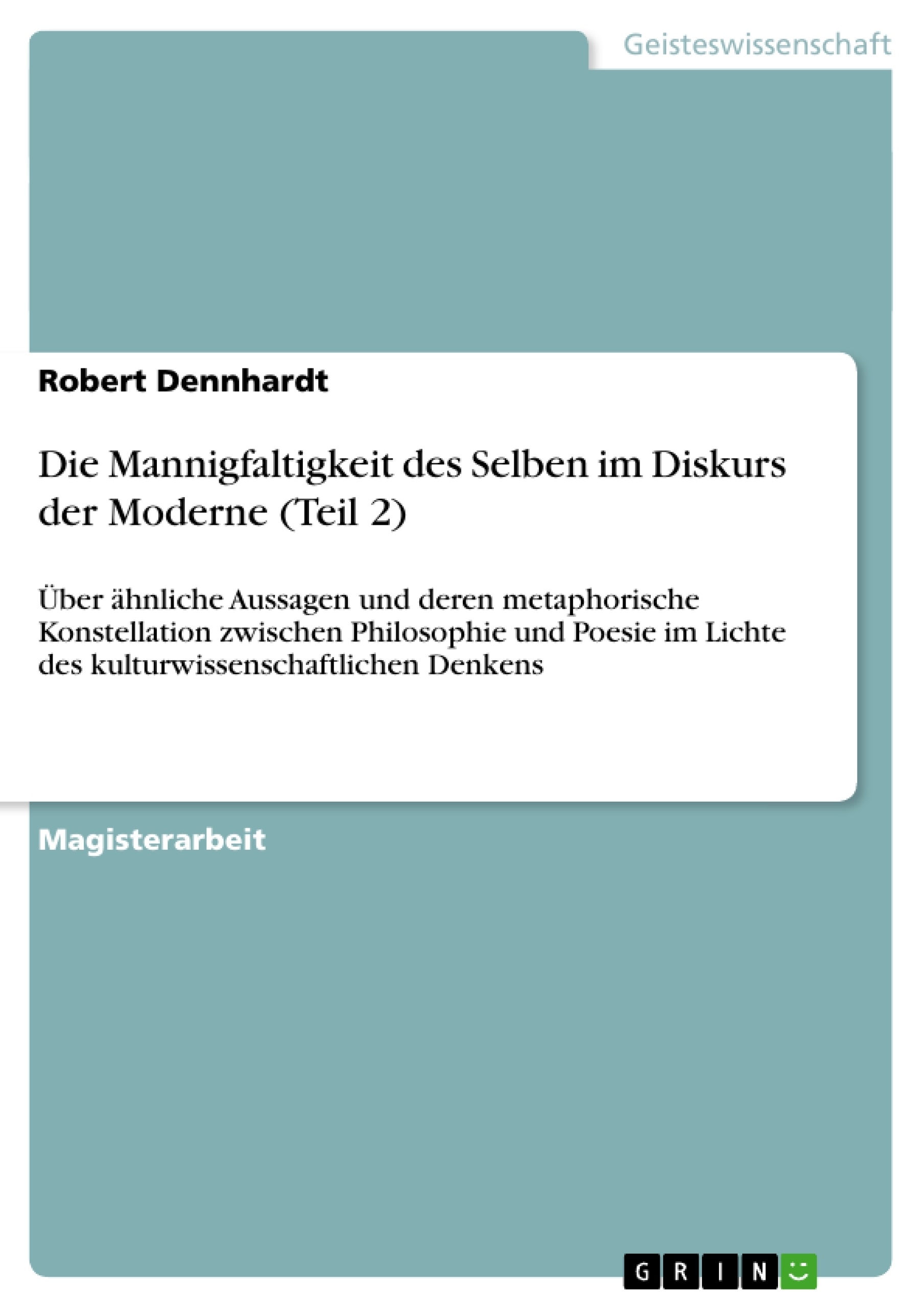

Kommentare