Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffliche Überlegungen
2.1 Alkoholismus
2.2 Psychose
2.2.1 Schizophrenie
2.2.2 Affektive Störungen
2.2.2.1 Depression
2.2.2.2 Manie
2.3 Komorbidität
3 Prävalenz
3.1 Prävalenz
3.2 Prävalenz der Psychosen
3.2.1 Prävalenz der Schizophrenie
3.2.2 Prävalenz der affektiven Störungen
3.3 Prävalenz von Alkoholismus und Psychose
3.3.1 Alkoholismus und Schizophrenie
3.3.2 Alkoholismus und affektive Störungen
4 Entstehungsmodelle
4.1 Zufallsmodell
4.2 Interaktionsmodell
4.2.1 Substanzmittelmissbrauch erhöht das Risiko psychiatrischer Erkrankungen
4.2.2 Psychiatrische Erkrankungen erhöhen das Risiko für Abhängigkeitserkrankungen
4.2.2.1 Stigmatisierungsmodell
4.2.2.2 Sozialwissenschaftliche Faktoren
4.2.2.3 Kommunikativer Faktor
4.2.2.4 Selbstmedikationshypothese
4.2.2.5 Existenz eines gemeinsamen Faktors
4.3 Doppeldiagnosen als eigenständiges Krankheitsbild
5 Problematik
5.1 Problematik der Feststellung
5.2 Problematik der Behandlung
6 Notwendigkeit spezialisierter Behandlungsmodelle
6.1 Versorgung psychisch Kranker und Alkoholkranker
6.1.1 Versorgung psychisch Kranker
6.1.1.1 Ambulante Versorgung
6.1.1.2 Stationäre Versorgung
6.1.1.3 Komplementäre Versorgung
6.1.2 Versorgung Alkoholkranker
6.1.2.1 Ambulante Versorgung
6.1.2.2 Stationäre Versorgung
6.1.2.3 Komplementäre Versorgung
6.2 Versorgung von Doppeldiagnose-Patienten
6.2.1 Versorgung im internationalen Raum
6.2.1.1 Ambulante Versorgung
6.2.1.2 Stationäre Versorgung
6.2.1.3 Komplementäre Versorgung
6.2.2 Versorgung in der BRD
6.2.2.1 Ambulante Versorgung
6.2.2.2 Stationäre Versorgung
6.2.2.3 Komplementäre Versorgung
6.2.3 Versorgung in Franken
6.2.3.1 Ambulante Versorgung
6.2.3.2 Stationäre Versorgung
6.2.3.3 Komplementäre Versorgung
6.3 Charakteristika der Behandlungsprogramme
6.4 Koordination der Behandlung
7 Kritische Wertung der Ergebnisse
8 Konsequenzen für die Soziale Arbeit
9 Zusammenfassung
10 Literaturverzeichnis
Erklärung zur Diplomarbeit
Danksagung
1 Einleitung
In vielen Einrichtungen für psychisch Kranke gilt eine zusätzliche Suchtmittelproblematik als Ausschlusskriterium, eine Aufnahme des Patienten wird abgelehnt. Dennoch sind immer wieder Patienten mit der Zusatzdiagnose Suchtmittelabhängigkeit in Einrichtungen für psychisch kranke Menschen zu finden, da vor der Aufnahme die Suchtstörung nicht bekannt ist oder verharmlost wird. Auch umgekehrt haben suchtspezifische Einrichtungen mit Patienten zu tun, die zusätzlich an einer psychischen Störung leiden. Beim gleichzeitigen Vorhandensein einer psychischen Störung und einer Suchtmittelerkrankung spricht man von Doppeldiagnose oder Komorbidität.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem speziellen Ausschnitt der Komorbidität von Sucht und psychischer Erkrankung, nämlich mit Alkoholismus und Psycho- se.
Während meines Jahrespraktikums 1999/2000 in einer Therapeutischen Wohn- gemeinschaft für psychisch kranke Menschen sah ich mich erstmals mit dem Begriff der Komorbidität konfrontiert. Im Verlauf meines Praktikums stieß ich immer wieder auf diagnostische Unklarheiten, welche die Arbeit mit Komorbidi- tätspatienten erschwerte, da die Zielgerichtetheit der Behandlung nicht eindeu- tig festlegbar erschien. Die Verschwommenheit des Begriffes stellte den Anreiz für diese Untersuchung dar.
Da die therapeutische Grundhaltung bei der Behandlung einer psychischen Er- krankung anders ist als die einer Suchtstörung (Schneider und Pichelt-Welle, 1994) wurde in den letzten Jahren mehrfach versucht Behandlungsprogramme zu entwickeln, die ermöglichen sollen beiden Störungen gerecht zu werden.
Ziel dieser Arbeit ist, neben einer inhaltlichen Präzision des Begriffes Komorbi- dität, Erklärungsansätze zur Entstehung von Doppeldiagnosen darzustellen, die Problematik der Diagnostik und der Behandlung von Doppeldiagnosen zu ver- anschaulichen und die sich daraus entwickelten konzeptionellen therapeuti- schen Überlegungen zu erörtern. Dabei geht es in dieser Arbeit nicht um alko- holinduzierte Psychosen, wie beispielsweise die Alkoholhalluzinose, sondern nur um Alkoholismus und Psychosen als zwei eigenständige Krankheitsbilder.
Da in der deutschen Sprache noch immer hauptsächlich die rein männliche Form in der Schreibweise gebraucht wird wurde auf eine ständige Berücksichtigung beider Geschlechter zugunsten der Lesbarkeit verzichtet.
2 Begriffliche Überlegungen
Da die Diagnosen von psychischen Erkrankungen anhand der beiden Klassifi- kationssysteme ICD-10 oder des DSM-IV gestellt werden richtet sich vorliegen- de Arbeit nach den Bestimmungen der ICD-10, welche in Deutschland verbind- lich ist.
2.1 Alkoholismus
Der Begriff „Alkoholismus“ wurde erstmalig 1849 von Magnus Huss verwandt. In der Folgezeit gab es eine Reihe weiterer Definitionsversuche, die Alkoholis- mus als Laster, Willens- und Charakterschwäche, erlerntes Fehlverhalten und Symptom einer zugrunde liegenden psychischen Störung (Schmidt, 1999) be- zeichneten.
1960 definierte Keller Alkoholismus als „eine psychogene Abhängigkeit von oder eine physiologische Süchtigkeit nach Ethanol, die sich äußert in der dau- erhaften Unfähigkeit des Alkoholikers entweder den Anfang des Trinkens oder seine Beendigung, wenn er einmal angefangen hat, zu kontrollieren (...)“ (Kel- ler,1960, S. 127; aus dem Englischen übersetzt von der Verfasserin dieser Ar- beit) und kommt dem heutigen Verständnis von Alkoholismus recht nah.
Jellinek beschrieb den Alkoholismus 1946 erstmals als Krankheit und versteht unter Alkoholismus jeglichen Gebrauch von alkoholischen Getränken, der dem Individuum oder der Gesellschaft oder beiden einen Schaden zufügt. Bis zur Anerkennung des Alkoholismus als Krankheit in der BRD dauerte es allerdings bis 1968. Trotzdem gilt Alkoholismus oftmals noch immer als Charakterschwä- che.
Nach Feuerlein (1989) gibt es unter klinischen Gesichtspunkten fünf Definitionskriterien für Alkoholismus:
- abnormes Trinkverhalten (nach Menge und Modalität des Alkoholkon- sums)
- somatische (körperliche) alkoholbezogene Schäden
- psychosoziale alkoholbezogene Schäden
- Entwicklung von Toleranz und körperlichem Entzugssyndrom
- Entwicklung von „Entzugssyndromen auf der subjektiven Ebene“ (Kon- trollverlust, gesteigertes Verlangen nach Alkohol, Zentrierung des Den- kens und Strebens auf Alkohol; „psychische Abhängigkeit“).
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fällt unter den Begriff des Alkoholismus einerseits der „schädliche Gebrauch“ (früher als Missbrauch bezeichnet) als auch das „Abhängigkeitssyndrom“, was in den folgenden Rahmen erläutert und voneinander abgegrenzt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling, 1999, S. 91-92
Rahmen 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling, 1999, S. 92-93
2.2 Psychose
In der traditionellen psychiatrischen Klassifikation wird zwischen exogenen und endogenen Psychosen unterschieden. Im Folgenden sollen jedoch nur die en- dogenen Psychosen beschrieben werden, also nicht diejenigen, deren Ursache erkennbarer Organ- bzw. Hirnveränderungen sind, sondern die, die „ohne er- kennbare organische Grundlagen“ (Fröhlich, 1997) auftreten. Die endogenen Psychosen wiederum wurden in affektive und schizophrene Psychosen unter- gliedert. Diese Aufteilung geht auf Kraepelin zurück, der die Psychosen in die „Dementia praecox“ und das „manisch-depressive Irresein“ unterteilte. Der Beg- riff der „Schizophrenien“ löste später den der ,,Dementia praecox" ab und fasste psychotische Störungen mit einer ungünstigen Prognose zusammen. Bei der zweiten Erkrankungsgruppe, dem „manisch-depressiven Irresein“, später als affektive Psychosen bezeichnet, ging Kraepelin von einem günstigen Verlauf aus (Krabbe, 1997).
Moderne Klassifikationsschemata wie die ICD-10 nehmen heute allerdings Ein- teilungen nach phänomenologischen Kriterien wie Symptomatik, Verlauf oder Schweregrad vor. Außerdem wurde der Ausdruck Krankheit durch Störung er- setzt.
2.2.1 Schizophrenie
Kraepelin prägte 1898 die Bezeichnung „Dementia praecox“ in einer Arbeit über „Die Diagnose und Prognose der Dementia praecox“. In dieser Arbeit beschrieb er Schizophrenie als eine Krankheit, „die sich durch Auftreten bei meist jugend- lichen, bis dahin gesunden Personen, Fehlen einer äußeren Ursache und vor allem durch späteren Verfall und Defekt auszeichnete“ (Peters, 1997, S. 463). Symptome für dieses Krankheitsbild sind nach Kraepelin „Wahn, Halluzinatio- nen, Affektstörungen und Stereotypien“ (Peters, 1997, S. 463), jedoch charakte- risierte er die Dementia praecox hauptsächlich durch Verlauf und Ausgang (Olbrich, 1999).
Bleuler führte 1911 den Begriff Schizophrenie ein, der den der Dementia praecox aufhob, da „weder eine Demenz im üblichen Sinne eintritt noch stets von praecox (frühzeitig) gesprochen werden kann“ (Peters, 1997).
Nach Bleuler umfasst Schizophrenie „eine Gruppe endogener Psychosen, de- ren Grundsymptome auf ein Nichtzusammenpassen, auf eine Spaltung des Denkens und Handelns hindeuten. Störungen aus dem Formenkreis der Schi- zophrenie äußern sich nach Bleuler u.a. in schwerwiegenden Beeinträchtigun- gen des Denkens einschließlich der Sprache, z.B. übertriebenes Symbolden- ken, Begriffskontaminationen, Zerfahrenheit, Konzentrationsstörungen, in Be- ziehungs- und Verfolgungsideen, vorwiegend akustischen Halluzinationen, zeitweilige Verstimmungen, Ängsten oder inadäquaten Affekten, bei akuten Formen meist ohne nachfolgende intellektuelle Beeinträchtigungen, bei chroni- schen gelegentlich mit Anzeichen herabgesetzter intellektueller Leistungsfähig- keit in umschriebenen Bereichen und affektiven Veränderungen“ (Fröhlich, 1997, S. 359).
In Rahmen 3 sind die Kriterien einer Schizophrenie gemäß ICD-10 Bestimmungen aufgelistet.
Rahmen 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling, 1999, S. 104-105
2.2.2 Affektive Störungen
Bereits in der Antike gab es Beschreibungen affektiver Erkrankungen. Hippokrates benannte diese im 4. Jahrhundert v. Chr. Melancholie und Manie (Berger, 2000).
Jules Falret bezeichnete die Tatsache, dass Patienten zwischen depressiven und gehobenen Stimmungslagen zyklieren können als folie circulaire. 1880 kam es zu der Einführung des Begriffes Zyklothymie durch Kahlbaum „um zu verdeutlichen, dass Manien und Melancholien unterschiedliche Zustände nur eines Krankheitsbildes darstellen“ (Berger, 2000, S. 484).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts benannte Kraepelin dieses Krankheitsbild „manisch-depressives Irresein“ und schloss auch die unipolaren Depressionen mit ein. Später wurde hierfür der Ausdruck „affektive Psychose“ verwandt.
2.2.2.1 Depression
Das Wörterbuch Psychologie definiert Depression folgendermaßen:
„Depression oder depressive Störungen im klinischen Sinne äußern sich in länger anhaltenden, wiederholte Episoden depressiver Verstimmung, die mit oder ohne direkten Bezug zu tatsächlichen oder vorgestellten Problemen bzw. momentanen Hilflosigkeitserfahrungen auftreten und mit Beeinträchtigungen der Denk- und Handlungsfähigkeit und einer Vielzahl psychischer und somatischer Symptome einhergehen können“ (Fröhlich, 1997, S. 117).
Nach Davison und Neale (1998) ist Depression gekennzeichnet durch „starke Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Gefühle der Wertlosigkeit und Schuld, sozialen Rückzug, Schlafstörungen, Verlust von Appetit und sexuellem Verlangen oder Verlust von Interessen und Freude an alltäglichen Handlungen“ (Davison und Neale, 1998, S. 252).
Im folgenden werden die diagnostischen Kriterien der Depression nach der ICD-10 beschrieben. Je nach Art und Schwere der vorliegenden Symptome erfolgt eine Einteilung in eine leichte (F32.0), mittelgradige (F32.1) und schwere depressive (F32.2) Episode. Zwischen den in der ICD-10 genannten Sympto- men einer depressiven Episode, dargestellt in Rahmen 4, und der im DSM-IV bezeichneten Major Depression besteht zwar keine identische, jedoch eine all- gemeine Übereinstimmung, weshalb auf eine Darstellung der DSM-IV-Kriterien verzichtet wird.
Rahmen 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling, 1999, S. 139
Die ICD-10 verweist in diesem Zusammenhang auf das somatische Syndrom, welches ebenfalls anhand des folgenden Rahmens kurz dargestellt wird. Zur Diagnose des somatische Syndroms müssen wenigstens vier der folgenden Symptome feststellbar sein (Dilling, 1999).
Rahmen 5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling,1999,S.140
Die ICD-10 weist darauf hin, dass die beschriebenen Kategorien nur für eine einzelne depressive Episode verwendet werden sollen. Treten weitere depressive Episoden auf sind diese den rezidivierenden depressiven Störungen (F33) zuzuordnen (Dilling, 1999).
2.2.2.2 Manie
Manie ist in der klassischen Beschreibung und Klassifikation von Psychosen die Bezeichnung für ein Zustandsbild, welches durch das Vorherrschen einer un- begründet heiteren, optimistischen Stimmungslage gekennzeichnet ist. Diese geht einher mit Gefühlen des uneingeschränkten körperlichen Wohlbefindens, der Selbstüberschätzung sowie mit einem allgemein gesteigerten Aktivitäts- drang, was nicht selten in unkontrollierten, enthemmten Verhaltensweisen und erhöhter Irritierbarkeit, Reizbarkeit und gelegentlicher Agitiertheit mündet (Fröh- lich, 1997).
ICD-10 als auch DSM-IV verlangen eine mindestens eine Wochen andauernde Episode zur Diagnose der Manie. Für die Diagnosestellung der Manie müssen mindestens drei der folgenden Merkmale vorhanden sein und „eine schwere Störung der persönlichen Lebensführung verursachen“ (Dilling, 1999, S. 134- 135).
Rahmen 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilling, 1999, S. 132-133
In der ICD-10 sind drei Haupttypen der Manie zu finden, welche die Schweregrade zum Ausdruck bringen:
- Hypomanie (F30.0)
- Manie ohne psychotische Symptome (F30.1)
- Manie mit psychotischen Symptomen (F30.2)
2.3 Komorbidität
Teils durch die Einführung von Klassifikationssystemen, teils durch die Öffnung der Langzeitkrankenhäuser aufgrund der Psychiatrie-Enquête stieg in den letz- ten Jahren die Zahl der Psychose-Sucht-Fälle drastisch an (Drake et al., 1994). Die Psychiatrie-Enquête von 1975 war eine Veröffentlichung des Deutschen Bundestages zur Lage der Psychiatrien in Deutschland. Es wurden Ideen ent- wickelt, die zur Verkleinerung der großen Anstalten hin zu gemeindenahen und überschaubaren Institutionen führten. Patienten, welche zuvor langfristig hospi- talisiert wurden, werden heute vermehrt ambulant oder in gemeindenahen Ein- richtungen behandelt und haben dadurch leichteren Zugang zu Alkohol und Drogen als früher; zusätzlich stieg in den letzten Jahren die soziale Akzeptanz und Einnahme von Drogen massiv an (Maß und Krausz, 1993).
Psychose-Sucht-Erkrankungen werden allgemein mit dem Begriff Komorbidität bezeichnet, der erstmals von Feinstein in den 70er Jahren eingeführt wurde um die klinische Bedeutung zusätzlicher Diagnosen bei chronisch verlaufenden Erkrankungen zu untersuchen (Feinstein, 1970). In der Psychiatrie taucht ne- ben dem Begriff „Komorbidität“ oftmals auch die Bezeichnung „Doppeldiagnose“ auf.
Bachmann und Moggi (1993) grenzen die beiden Begriffe, die in der psychiatri- schen Literatur häufig synonym verwendet werden, folgendermaßen voneinan- der ab: Eine Doppeldiagnose liegt dann vor, wenn Patienten gleichzeitig an ei- ner schweren psychiatrischen Erkrankung als auch an einer Suchtkrankheit leiden (Bachmann und Moggi, 1993), während Komorbidität das Auftreten meh- rerer psychischer Störungen wie z.B. Depression, Anorexie oder Panikattacken ohne Suchtmittelproblematik bezeichnet (Penick et al., 1990). Hierbei stellt sich allerdings die Frage, worunter Bachmann und Moggi Suchterkrankungen ein- ordnen, da in der ICD-10 beispielsweise das Abhängigkeitssyndrom im Kapitel der psychischen Störungen erscheint.
Maier, Linz und Freyberger (1997, S. 75) beschreiben Komorbidität als „die Ko- existenz von zwei oder mehr Störungen mit unterschiedlichen, krankheitsspezi- fischen Ätiologien und Pathophysiologien (...)“. Sie merken jedoch an, dass der Ausdruck „im Kontext psychiatrischer Störungen nicht ganz zutreffend“ sei, da Ätiologie und Pathophysiologie bei den meisten psychiatrischen Störungen unbekannt seien. Sie weisen darauf hin, dass der Begriff „duale Diagnose“ adäquater sei, sie aber in ihrer Arbeit beide Begrifflichkeiten, duale Diagnose und Komorbidität, synonym verwenden.
Wittchen und Vossen (1995) definieren Komorbidität als das Auftreten von mehr als einer spezifisch diagnostizierbaren psychischen Störung bei einer Person in einem definierten Zeitintervall .
Des weiteren lässt sich Komorbidität in interne und externe Komorbidität aufteilen. Interne Komorbidität liegt vor, wenn „das Auftreten von Diagnosen aus derselben diagnostischen Klasse (z.B. soziale Phobie und Agoraphobie)“ gemeint ist, während externe Komorbidität „das Auftreten von Störungen aus verschiedenen diagnostischen Klassen (z.B. Alkoholabhängigkeit und Angststörung)“ (Driessen, 1999, S. 2) bezeichnet.
Driessen, Dierse und Dilling (1994, S. 35) definieren den Begriff Komorbidität wie folgt: „Es handelt sich um psychiatrisch relevante Störungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten vor Beginn oder während des Verlaufs der Abhängigkeit auftreten können.“
Die Definition von Gold und Slaby vereinigt beide Begriffe: „Die Begriffe Komorbidität oder Doppeldiagnose meinen das Vorhandensein von zwei (oder mehreren) separaten diagnostischen Entitäten in einer Person. Im Bereich der Drogenmedizin spricht man von Komorbidität beim Vorliegen einer Störung durch psychotrope Substanzen und einer weiteren psychiatrischen Störung, z.B. einer depressiven Episode“ (Gold und Slaby, 1991).
3 Prävalenz
Der Begriff Prävalenz bezeichnet die Anzahl der Krankheitsfälle in einem definier- ten Zeitraum (Peters, 1997). In den folgend dargestellten Untersuchungen werden häufig die Begriffe Punktprävalenz, Lebenszeitprävalenz, 3-oder 6-Monatspräva- lenz oder Jahresprävalenz verwandt. Unter Punktprävalenz ist der Anteil Erkrank- ter zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verstehen, meist ist damit der Zeitpunkt der Untersuchung gemeint. Oft wird auch die Zahl der Erkrankungen in einem be- stimmten Zeitraum genannt, wie die Jahresprävalenz und die 3- oder 6-Mo- natsprävalenz. Hierbei handelt es sich um die letzten 3, 6 oder 12 Monate vor dem Untersuchungszeitpunkt. Lebenszeitprävalenz bezeichnet die Anzahl der Fälle derer, die einmal im Leben erkrankten.
Bezüglich psychischer Erkrankungen existieren zahlreiche Prävalenzstudien. Die Prävalenzraten verschiedener Erhebungen weisen teilweise gravierende Unter- schiede auf, beispielsweise wurde bei Alkoholabhängigen eine Lebenszeitpräva- lenz für Depression von 3-98% berichtet. Nach Weiss et al. (1992) liegen die Feh- lerquellen für unterschiedliche Prävalenzen beim Zeitpunkt des Interviews, bei den Interviewtechniken und diagnostische Kriterien und den Abstinenzkriterien. Miss- verständliche oder unzulängliche Interpretationen sorgen zusätzlich für Verwir- rung. So vergleicht beispielsweise Uchtenhagen (1995) die von der US- amerikanischen Epidemiologic Catchment Area-Studie (Regier et al., 1990) ermit- telten Prävalenzraten für Alkoholismus in der Allgemeinbevölkerung mit verschie- denen Erhebungen zur Prävalenz für Alkoholismus bei Schizophrenen. Er folgert daraus, dass keine gravierenden Unterschiede bezüglich der Prävalenz vorliegen. Allerdings umfassen die Zahlen der ECA-Studie Abhängigkeit und Missbrauch, während die übrigen von Uchtenhagen angeführten Studien meist nur den Miss- brauch von Alkohol bei Schizophrenen angeben.
Nachfolgend werden verschiedene Prävalenzstudien zur Thematik der Komorbidität dargestellt.
3.1 Prävalenz des Alkoholismus
Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren liegt der Alkoholmissbrauch in der BRD bei 5%, die Abhängigkeit bei 3% der Bevölkerung (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Alkoholkonsum in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Münchner Follow-up-Studie (MFS) von Bronisch und Wittchen (1992) ermittelte eine Lebenszeitprävalenz für Alkoholismus in der Allgemeinbevölkerung von 13%. Männer wiesen eine deutlich höhere Rate auf (21%) als Frauen (5,1%). Die Studie basiert auf den Kriterien des DSM-III (American Psychiatric Association, 1980), Untersuchungsinstrumente waren eine deutsche Version des „DiagnosticInterview-Schedule“ (DIS) nach Robins et al. (1989) und der Münchner Alkoholismus Test (MALT) von Feuerlein et al. (1979).
Vergleichbar mit den Ergebnissen der MFS sind die der US-amerikanische Epi- demiologic Catchment Area (ECA)-Studie von Regier et al. (1990). In dieser Stu- die wurden über 20 000 Menschen der US-amerikanischen Bevölkerung in Haus- halten und Institutionen befragt. Die ermittelte Lebenszeitprävalenz für Alkoholis- mus liegt bei 13,5% (Alkoholmissbrauch 5,6%, Alkoholabhängigkeit 7,9%). Auch hier basieren die Diagnosekriterien auf dem DSM-III, Untersuchungsinstrument war ebenfalls der DIS.
Die Nachfolgestudie National Comorbidity Survey (NCS) von Kessler et al. (1994), basierend auf DSM-III-R-Kriterien (American Psychiatric Association, 1987), un- tersuchte 8098 nicht-hospitalisierte Personen der US-amerikanischen Bevölkerung und fand eine Lebenszeitprävalenz für Alkoholmissbrauch von 9,4% (12,5% Män- ner und 6,4% Frauen) und für Alkoholabhängigkeit von 14,1% (20,1% Männer und 8,2% Frauen). Als Untersuchungsinstrument wurde eine modifizierte Form des „Composite International Diagnostic Interview“ (UM-CIDI) der World Health Orga- nisation (1990) verwandt.
3.2 Prävalenz der Psychosen
3.2.1 Prävalenz der Schizophrenie
Die World Health Organisation (WHO) berichtet von einer Lebenszeitprävalenz für Schizophrenie von 1,1% (WHO, 2001). Signifikante Geschlechterunterschiede wurden keine gefunden, allerdings beginnt die Krankheit bei Frauen später und hat eine günstigere Prognose.
Regier et al. (1990) berichten aufgrund der ECA-Studie von einer 6-Monatspräva- lenz von 0,8% und einer Lebenszeitprävalenz von 1,4%. Die 6-Monatsprävalenz als auch die Lebenszeitprävalenz für schizophreniforme Störungen liegt bei 0,1%. Ermittelt wurden die Prävalenzraten durch Interviews mit dem DIS, basierend auf den DSM-III-Kriterien.
In der National-Comorbidity-Survey-Studie (Kessler et al., 1994) werden Schizophrenien nicht explizit aufgeführt. Sie erscheinen unter nicht-affektive Psychosen gemeinsam mit schizophreniformen Störungen, schizo-affektiven Störungen, Wahnstörungen und a-typischen Psychosen. Die Jahresprävalenz liegt bei 0,5%, die Lebenszeitprävalenz bei 0,7%. Als Diagnoseinstrument wurde eine modifizierte Form des CIDI, basierend auf DSM-III-R-Diagnosen eingesetzt.
3.2.2 Prävalenz der affektiven Störungen
Der Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ des bundesweiten Gesundheitssurveys (Wittchen et al., 1999) untersuchte die Prävalenz von affektiven, somatoformen und Angststörungen in Deutschland, basierend auf DSM-IV-Kriterien und unter Verwendung des CIDI. Die ermittelte Monatsprävalenz für affektive Erkrankungen liegt bei Männern bei 4,75% und bei Frauen bei 7,82%. Die Untersuchung wies einen signifikanten Prävalenzunterschied zwischen den alten und den neuen Bun- desländern nach. Demnach liegt die Monatsprävalenz affektiver Störungen in den neuen Bundesländern bei 4,82%, in den alten Bundesländern bei 6,65%.
Im World Health Report der WHO (2001) wird eine Punktprävalenz der unipolaren depressiven Episode von 1,9% bei Männern und 3,2% bei Frauen angegeben. Die Jahresprävalenz liegt bei 5,8% bei Männern und 9,5% bei Frauen. Die Punktprä- valenz für bipolare Störungen ist mit 0,4% beziffert. In einem internationalen Ver- gleich (Goldberg und Lecrubier, 1995) liegt die Prävalenz für Depression bei 10,4%, variiert aber zwischen 2,6% (Nagasaki, Japan) und 29,5% (Santiago, Chi- le). Diagnoseinstrument waren der CIDI, Diagnosekriterien die der ICD-10.
Die ECA-Studie (Regier et al., 1990) berichtet von einer Lebenszeitprävalenz für affektive Störungen von 8,3%, die 6-Monatsprävalenz liegt bei 5,8%. Ermittelt wurden diese Raten mit dem DIS, diagnostische Kriterien waren die des DSM-III.
Die NCS-Studie (Kessler et al., 1994) gibt eine Lebenszeitprävalenz für eine „major depressive episode“ von 17,1% (21,3% Frauen und 12,7% Männer) an, die Jahresprävalenz liegt bei 10,3% (12,9% Frauen und 7,7% Männer). Die Prävalenzraten für manische Episoden liegen bei 1,6% und weisen keine geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Untersuchungsinstrument war eine modifizierte Form des DIS, der auf Diagnosekriterien des DSM-III-R basiert.
3.3 Prävalenz von Alkoholismus und Psychose
3.3.1 Alkoholismus und Schizophrenie
Wagner, Schwoon, Krausz und Hilge (1992) legen Daten aus einer Erhebung in der Psychiatrischen Klinik des Universitätskrankenhauses Eppendorf vor. Die Gesamtstichprobe setze sich zusammen aus 372 Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung, einer Alkohol- oder Drogenpsychose oder einer Abhängigkeitsproblematik. Die Diagnosen basieren auf Kriterien der ICD-9 (Degkwitz et al., 1980), Untersuchungsinstrument war ein Testpaket bestehend aus einem halbstandardisierten Interview, der „Paranoid Depressivitäts-Skala“ (PD-S) nach von Zerssen (1976), dem „Frankfurter Beschwerde-Fragebogen“ (FBF) nach Süllwold (1977), dem MALT und einem daran angelehnten Rating. Von 108 (29%) Alkoholabhängigen fanden sich bei 25% Symptome einer Schizophrenie.
Die amerikanische Studie ECA (Regier et al., 1990) belegt, dass bei einer Le- benszeitprävalenz für Schizophrenie oder eine schizophreniforme Störung zu 33,7% auch Alkoholismus vorhanden ist. Die Lebenszeitprävalenz für Schizophre- nie bei Alkoholikern liegt bei 3,8%, welche unter Verwendung des DIS und anhand von DSM-III-Kriterien ermittelt wurde.
Soyka, Albus und Kathmann (1992) untersuchten 447 schizophrene Patienten und 52 Patienten mit einer affektiven Psychose im Bezirkskrankenhaus Haar. Im fol- genden wird jedoch nur auf die Ergebnisse der Gruppe der schizophrenen Patien- ten eingegangen. Die Diagnosekriterien wurden nach der ICD-9 gestellt, als Un- tersuchungsinstrumente dienten der MALT und das in der Klinik verwandte Doku- mentationssystem, welches sich nach „Standards für die Katamnesen von Abhän- gigen“ der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie richtet. Von den 447 Patienten hatten 192 (42,9%) eine Lebenszeitprävalenz für Suchter- krankungen, davon 34,6% eine Lebenszeitprävalenz für Alkoholmissbrauch (ein- schließlich Abhängigkeit) und davon 13,4% eine Alkoholabhängigkeit. Auffällig ist, dass bei 46,0% der Männer ein Alkoholmissbrauch vorliegt, während bei den Frauen die Prävalenzrate mit 21,9% signifikant niedriger ist. Die 3-Mo- natsprävalenz für Alkoholmissbrauch liegt bei 71,5%.
Geiselhart und Maul (1993) veröffentlichten eine Studie des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Weinsberg, die den Alkoholmissbrauch bei Patienten mit endogener Psychose untersucht. Sie verwandten dabei die Daten des Fallregisters von Erstaufnahme-Patienten mit ICD-9-Diagnosen. Sie ermittelten einen Alkoholmissbrauch bei Schizophrenen von 4,6%. Dass diese Zahl im Vergleich zu anderen Arbeiten relativ niedrig ist, begründen sie mit unterschiedlichen Untersuchungsansätzen. In ihrer Studie wurde nur eine klinisch relevante Alkoholproblematik berücksichtigt. Die im Vergleich dazu ermittelte Zahl von Patienten mit affektiven Störungen und Alkoholmissbrauch lag bei 1,3%.
Mueser et al. (1990) sichteten verschiedene Prävalenzstudien zum Substanz- missbrauch bei Schizophrenen. In Tabelle 2 werden die Studien dargestellt, die alkoholspezifische Untersuchungen vorlegten oder solche, die eine klare Abgren- zung zwischen Alkohol und den übrigen Drogengruppen vornahmen. Obwohl die Studien z.T. nicht nur Schizophrenie, sondern auch andere psychische Erkran- kungen und Alkoholmissbrauch untersuchten sind in der folgenden Übersicht nur die Schizophreniefälle angeführt.
Tabelle 2: Schizophrenie bei Alkoholismus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diagnostische Kriterien: DSM-II = Diagnostic Manual of Mental Disorders, 2nd ed. (American Psychiatry Association, 1986); DIS = Diagnostic Interview Schedule (Robins et al., 1981); RDC = Research Diagnostic Criteria (Spitzer et al., 1978)
N: S = Schizophrenie; SA = Schizoaffektive Störung; m = männlich; w = weiblich
Definition Missbrauch: A = Abuse/Missbrauch; D = Dependence/Abhängigkeit; MHDS = Manitoba Health and Drinking Survey (Murray, 1978); U = Use/Gebrauch CPS = NIMH Community Support Program Evaluation (McCarrick et al., 1985)
3.3.2 Alkoholismus und affektive Störungen
Schneider et al. (2001) untersuchten in ihrer Studie (Multicentre Study of Psychi- atric Comorbidity in Alcoholics, MUPCA) 556 Patienten aus 25 Behandlungszent- ren Deutschlands bezüglich der 6-Monatsprävalenz von Komorbidität bei Alkoholi- kern. Diese Zentren versorgen eine Einwohnerzahl, die etwa 10% aller Einwohner Deutschlands entspricht, und behandeln jährlich über 15 000 Patienten mit alko- holbedingten Störungen. Von diesen wurden nur Patienten mit Diagnosen nach ICD-10- oder DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) ausgewählt und mit der Kurzfassung des Diagnostischen Interviews bei psychischen Störungen (Mini-DIPS) nach Markgraf (1994) und standardisierten psychosozialen Interviews befragt. Dabei wurde festgestellt, dass 24,3% der Alkoholabhängigen zusätzlich an einer affektiven Störung leiden. Die rezidivierende Depression bildete hierbei die größte Untergruppe mit einer 6-Monatsprävalenz von 11,0%, die 6-Monats- Prävalenz der Dysthymia lag bei 8,8% und die der depressiven Episode bei 3,4%.
Arolt und Driessen (1996) untersuchten 400 Patienten zweier Lübecker Allge- meinkrankenhäuser bezüglich der Prävalenz für Alkoholismus als auch für psychi- atrische Komorbidität. Die Patienten wurden mit dem CIDI befragt, die Diagnose- stellung erfolgte nach den Kriterien des DSM-III-R. Eine Lebenszeit-prävalenz für Alkoholismus konnte bei 18,8% der Befragten ermittelt werden, die Punktpräva- lenz lag bei 11,3%. Bei den Patienten mit einer Lebenszeitdiagnose Alkoholismus wurde in 41,3% der Fälle eine zusätzliche psychiatrische Lebenszeitdiagnose er- mittelt, bei den Patienten mit einer aktuellen Alkoholismus-Diagnose zu 44,4%. Bei einer Lebenszeitdiagnose für Alkoholismus lag die Punktprävalenz für affektive Störungen bei 16%, die Lebenszeitprävalenz bei 18,7%. Für einzelne Major De- pression Störungen wurde eine Punkt- und Lebens-zeitprävalenz von 5,3% ange- geben bei einer Lebenszeitdiagnose Alkoholismus. Die Punkt- und Lebenszeitprä- valenz der rezidivierenden Major Depression bei einer Lebenszeitdiagnose Alko- holismus wurde für 9,3% angegeben. Die Prä-valenz für die Lebenszeitdiagnose Dysthymie beziffert sich auf 8%, die Punktprävalenz bei 5,3%.
Die Lebenszeitprävalenz für affektive Störungen bei Alkoholismus liegt nach Regier et al. (1990) bei 13,4%; die Lebenszeitprävalenz für Alkoholismus bei affektiven Psychosen wird für 21,8% angegeben. Als Untersuchungsinstrument wurde der DIS verwandt, diagnostische Kriterien waren die des DSM-III.
In der folgenden Übersicht nach Bronisch (1985) sind verschiedene klinische Studien zum Thema Depression bei Alkoholabhängigen zusammengefasst.
Tabelle 3: Depressive Störungen bei Alkoholismus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diagnostische Kriterien Depression: Depressionswert des MMPI-D = Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Hathaway & McKinley, 1943); Depressionswert nach Raskin = (Raskin, 1969); Beck = (Beck, 1970); Depressionswert nach Zung = (Zung, 1965); HRSD = Hamilton Rating Scale for Depression (Hamilton, 1960); DSM-III-R = Diagnostic Manual of Mental Disorder, 3rd revised ed. (American Psychiatric Association, 1987); SADS = Scale for Affective Disorders and Schizophrenia (Endicott & Spitzer, 1978)
Diagnostische Kriterien Alkoholismus: MAST = Michigan Alcoholism Screening Test (Selzer, 1971); SADQ = Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (Stockwell et al., 1983)
Wie der Tabelle zu entnehmen ist gibt es deutliche Unterschiede bezüglich der ermittelten Prävalenzraten, welche zum Teil auf dem Zeitpunkt der Untersuchung basieren (Soyka et al., 1996). Höhere Prävalenzraten wurden vor allem nach star- kem Alkoholkonsum und während Entzugsbehandlungen festgestellt (Soyka et al., 1996). Auch die nicht genaue Bestimmung des Abhängigkeitsstadiums erschwert die Vergleichbarkeit der Daten (Driessen, Dierse und Dilling, 1994). Des weiteren ist auch das Geschlecht ein wichtiger Faktor für die Ermittlung von Prävalenzraten, da depressive Störungen vermehrt bei Frauen auftreten während Männer häufiger eine Alkoholabhängigkeit entwickeln (Bromet et al., 1990).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein häufiges gemeinsames Auftreten von Alkoholismus und Psychose gegeben ist. Wie es zu diesem Zusammenhang der beiden Krankheitsbilder kommt wird im folgenden Kapitel anhand verschiedener Erklärungshypothesen zur Entstehung von Komorbidität dargestellt.
4 Erklärungsmodelle
Im letzten Kapitel wurden Zahlen zum gleichzeitigen Auftreten von Alkoholis- mus und Psychose genannt. Diese belegen ein erhöhtes Vorkommen der bei- den Erkrankungen in den letzten Jahren. In der psychiatrischen Literatur wer- den unterschiedliche Modelle zur Entstehung von Komorbidität beschrieben. Vor Beginn genauerer Ausführungen dieser Erklärungsmodelle muss erwähnt werden, dass keines dieser Modelle empirisch be- bzw. widerlegt wurde (Bachmann et al., 1997a). Keines der Modelle darf isoliert betrachtet werden, sondern im Kontext eines multifaktoriellen Entstehungsmodells, das mehrere Faktoren berücksichtigt; Überschneidungen zwischen den einzelnen Modellen sind möglich.
4.1 Zufallsmodell
Bei der Hypothese der Zufallsassoziation (Maier et al. 1997; Driessen, 1999) handelt es sich um das Vorkommen zweier Syndrome aufgrund eines Zufalls. Dass die beiden Erkrankungen zufällig und unabhängig voneinander auftreten ist empirischen Studien zufolge jedoch eher unwahrscheinlich. Begründet se- hen Modestin und Attinger (1992) diese Unwahrscheinlichkeit im erhöhten Sub- stanzmittelmissbrauch bei psychisch Kranken verglichen mit dem geringeren Konsum in der Allgemeinbevölkerung, was gegen das zufällige gemeinsame Auftreten beider Störungen spricht.
4.2 Interaktionsmodell
Interaktionsmodelle beschreiben eine gegenseitige Beeinflussung beider Stö- rungsbilder und nehmen an, dass ein oder mehrere Faktoren die beiden Stö- rungen bedingen. Langzeitlich kommt es zu Wechselwirkungen der beiden Er- krankungen. Nachfolgend beschriebene Entstehungshypothesen stellen zwar eigenständige Ansätze dar, können jedoch prinzipiell als Interaktionsmodell ge- sehen werden, da ihr Inhalt eine gegenseitige Beeinflussung durch einen oder mehrere Faktoren ist.
[...]
- Arbeit zitieren
- Franziska Boes (Autor:in), 2002, Alkoholismus und Psychose, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7937
Kostenlos Autor werden
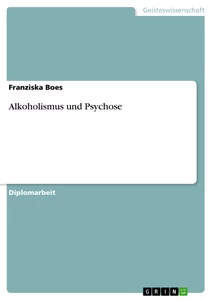





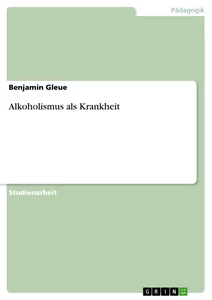



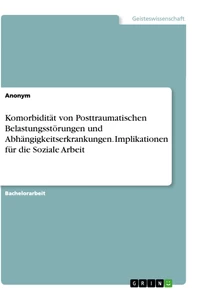









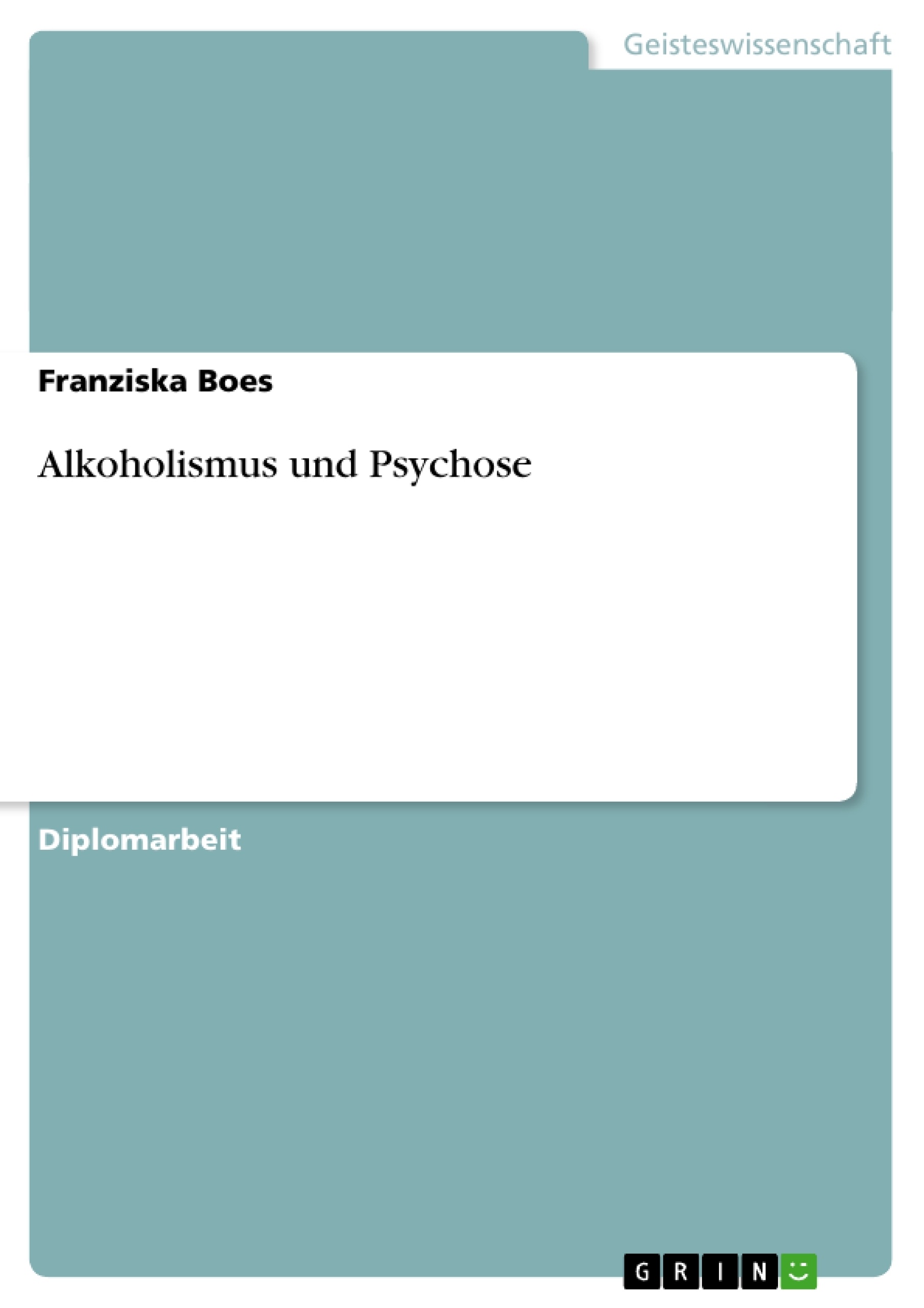

Kommentare