Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Literaturanalyse: Begriffsbestimmungen und Forschungsstand
1.1 NutzerInnenperspektive und NutzerInnenzufriedenheit
1.1.1 NutzerInnenperspektive
1.1.2 NutzerInnenzufriedenheit
1.2 Zur Situation sterbender Kinder und ihrer Eltern
1.2.1 Epidemiologische und statistische Daten
1.2.1.1 Todesursachen
1.2.1.2 Lebenslimitierende Erkrankungen im Kindesalter
1.2.2 Auswirkung der lebenslimitierenden Erkrankung eines Kindes auf die Familie
1.3 End-of-Life Care and Palliative Care
1.3.1 End-of –Life Care
1.3.2 Palliative Care
1.3.3 Palliative Care im Kindesalter
1.4 Das ambulante Versorgungssystem für sterbende Kinder
1.4.1 Stationäre Versorgung sterbender Kinder und Jugendlicher
1.4.2 Die ambulante Versorgung sterbender Kinder
1.4.2.1 Ambulante Kinderkrankenpflegedienste
1.5 Beratung in der Pflege
2. Das methodische Vorgehen
2.1 Die Methode der Grounded Theory
2.2 Die Untersuchung
2.2.1 Das Forschungsproblem
2.2.2 Das Ziel und die Fragestellung
2.2.3 Die Literaturanalyse
2.2.4 Die Interviews
2.2.4.1 Die StudienteilnehmerInnen
2.2.4.2 Themenbezogene Instrumente zur Datenerhebung
2.2.4.3 Der Interviewleitfaden
2.2.5 Die Evaluation
2.2.5.1 Die Auswertung
2.2.5.2 Die Reflexion
3. Die fallimmanente Auswertung: Die Fallportraits
3.1 Fallportrait 1 (F1): Familie B.
3.1.1 Fallverlauf
3.1.2 Falldiskussion
3.1.3 Fazit
3.1.4 Memo 1
3.2 Fallportrait 2 (F2): Frau B.
3.2.1 Fallverlauf
3.2.2 Falldiskussion
3.2.3 Fazit
3.2.4 Memo 2
3.3 Fallportrait 3 (F3): Herr und Frau F.
3.3.1 Fallverlauf
3.3.2 Falldiskussion
3.3.3 Fazit
3.3.4 Memo
3.4 Weitere Fallbeispiele
3.4.1 Fall 4: Frau C.
3.4.2 Fall 5: Frau D.
3.4.3 Fall 6: Frau E.
3.4.4 Memo 4
4. Die fallübergreifende Auswertung
4.1 Auswertung der Fragen
4.1.1 Die Auswirkungen der lebenslimitierenden/tödlichen Erkrankung des Kindes auf das Leben der Eltern (und der Familie)
4.1.2 Die Kontaktaufnahme zu ambulanten Dienstleistungsangebote
4.1.3 Der Kontakt zur ambulanten Kinderkrankenpflege
4.1.4 Wünsche und Erwartungen der Eltern anhand ihrer Erfahrungen
4.2 Die Erwartungen der Eltern als Prozess
4.3 Die Entwicklung des Kategoriesystems
5. Die Reflexion
5.1 Vergleich der Auswertungsergebnisse mit der Literaturanalyse
5.2 Folgerungen aus den Auswertungsergebnissen für die ambulante Pflege sterbender Kinder und ihrer Eltern
6. Die berufspädagogische Reflexion
6.1 Das deutsche Krankenpflegegesetz
6.2 Analyse von Literatur- und Curriculumsinhalten
6.2.1 Berufspädagogische Fachliteratur
6.2.2 Curricula der Pflegegrundausbildung
6.2.3 Curricula der Fachweiterbildung
6.2.4 Curricula der Hochschulbildung
6.3 Resümee
Abschluss
Literatur
Einleitung
Aufgrund aktueller Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland vollziehen sich unterschiedliche Wandlungen in der Versorgung gesunder, kranker, pflegebedürftiger und auch sterbender Menschen (Statistisches Bundesamt 1998).
Vor allem das Prinzip "Ambulant vor Stationär" bewirkt in der Gesundheitsversorgung nachhaltige Veränderungen für NutzerInnen und PraktikerInnen. Es verschieben sich die Bedingungen der Dienstleistungen und damit auch ihre Anforderungen und Möglichkeiten. Für die PraktikerInnen heißt dies u.a., zunehmend die Orientierung an den Wünschen der NutzerInnen auszurichten und für die NutzerInnen bedeutet dies, mehr Mitspracherecht und Wahlmöglichkeiten zu haben. Daher werden Aspekte wie z.B. Beratung und neue Handlungsbedarfe aber auch Versorgungsdefizite zukünftig von besonderer Wichtigkeit für alle Beteiligten (Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2000/2001).
Viele sterbende oder schwerstkranke Menschen fühlen sich nicht nach ihren Wünschen versorgt, obwohl die so genannte Palliativversorgung in Deutschland in den letzten Jahren an Relevanz und Interesse gewonnen hat (Vollmann 2001). Gerade in der ambulanten Versorgung sterbender Kinder[1] werden immer wieder Defizite, besonders in der Pflege, diagnostiziert (Wingenfeld 2005). Deswegen ist es wichtig zu erfahren, welche Versorgungsangebote werden wirklich benötigt, sind effektiv wie auch effizient und von den NutzerInnen gewünscht.
Diese Arbeit soll die Sichtweisen, Interessen, Erwartungen und Erfahrungen von Angehörigen sterbender Kinder als NutzerInnen ambulanter gesundheitsbezogener Dienstleistungen besonders der ambulanten Kinderkrankenpflegdienste zum Gegenstand haben.
Das Ziel der Arbeit ist es, zu ermitteln, aufgrund welcher Erwartungen und Erfahrungen welche Hilfsangebote der ambulanten Versorgung, unter spezieller Berücksichtigung der Pflege von Angehörigen/Eltern sterbender Kinder als wirksam, hilfreich und sinnvoll wahrgenommen werden, so dass auch Aussagen zur NutzerInnenzufriedenheit abgeleitet werden können. Daraus können zum einen bestehende Versorgungsbedarfe aus der Sicht der NutzerInnen analysiert und reflektiert und zum anderen Pflegende ihr berufliches Handeln als professionelles Handeln besser begründen sowie umsetzen, wenn sie wissen, welche Erwartungen von NutzerInnen an ihre Dienstleistungen gestellt werden.
Dazu soll die Arbeit folgende Fragen untersuchen:
1) Welche Erwartungen haben Eltern sterbender Kinder an ambulante Palliativpflege?
2) Welche positiven und negativen Erfahrungen haben Eltern sterbender Kinder mit ambulanter Palliativpflege?
Um diese Fragestellung bearbeiten zu können wurde die qualitative Methode der Grounded Theory gewählt. Es sollen leitfadengestützte Interviews mit Eltern sterbender oder gestorbener Kinder, die ambulante Palliativpflege bzw. Kinderkrankenpflege in Anspruch genommen haben geführt und ausgewertet werden.
Die erste Auswertung soll fallimmanent als Fallportrait stattfinden. Anschließend soll eine fallübergreifende Auswertung sowie eine Reflexion die Untersuchung abrunden. Zum Abschluss der Arbeit soll eine berufspädagogische Reflexion der Ergebnisse erfolgen, indem geprüft wird, ob die Erkenntnisse der Untersuchung Inhalt der Aus- und Weiterbildung in der Pflege sind.
Um beide Geschlechter in diverse gewählte Begrifflichkeiten einbinden zu können, wird in dieser Arbeit das so genannte große I benutzt.
1. Die Literaturanalyse: Begriffsbestimmungen und Forschungsstand
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der themenbezogenen Literaturanalyse dargestellt werden. Diese sind parallel zum Forschungsverlauf erhoben worden und beeinflussen diesen ebenso wie auch die spätere Kategoriebildung in der Auswertung.
Die Literaturanalyse dient der theoretischen Sensibilisierung, um von einer Idee zu einer Untersuchung mit entsprechenden Ergebnissen zu gelangen. Hier werden ausgewählte Aspekte als grober Überblick beschrieben. Hierzu werden zugleich einerseits der Problemhintergrund, der Forschungsstand und die Relevanz für Pflegewissenschaft und Public Health beleuchtet und andererseits spezifische für die Fragestellung wesentliche Aspekte hervorgehoben und kurz analysiert. So ist ein knapper Aufgrund als Hintergrund der Arbeit sowie zur Analyse der Fallportraits gegeben.
1.1 NutzerInnenperspektive und NutzerInnenzufriedenheit
1.1.1 NutzerInnenperspektive
Als NutzerIn des Gesundheitswesens wird jede Person betrachtet, die Zugang zum System der gesundheitlichen Versorgung hat, unabhängig davon, ob dieser Zugang aktuell in Anspruch genommen wird oder nur fakultativ besteht (Sachverständigenrat für Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (SVR) 2000/2001). Die Rolle der NutzerInnen gesundheitsbezogener Dienstleistungen stellt sich auf unterschiedlichen Ebenen dar. Akut oder chronisch erkrankte Personen, welche bedarfsgerechte und wirksame Behandlungen in Anspruch nehmen, stellen die NutzerInnen auf der Mikroebene dar. Personen, die sich gegen das Risiko Krankheit absichern und gegen dadurch entstehende Kosten absichern möchte, sind NutzerInnen auf der Mesoebene. Auf der Makroebene agieren Personen als BürgerInnnen, die funktionierende Versorgungsstrukturen, gesundheitsförderliche Lebensbedingungen sowie Partizipation an Entscheidungen einfordern. Um die Positionen der PatientInnen, BürgerInnen und Versicherten zusammenfassend zu benennen hat der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen den Begriff des Nutzers/der Nutzerin eingeführt (SVR 2003; Dierks/Schwartz 2003). Findet er in der internationalen Diskussion schon seit den 1990er Jahren Anwendung (user), beginnt sich der Begriff NutzerIn zunehmend, zusätzlich bedingt durch die Gesundheitsreform der Krankenkassen im Jahr 2000, auch in Deutschland durchzusetzen (Schaeffer 2004).
Die Sichtweise der NutzerInnen wird für die Dienstleistungen im Gesundheitswesen und einer bedarfs- und bedürfnisgerechten Versorgung immer wichtiger, da sie als Grundlage von Versorgungsqualität angesehen wird (SVR 2003; Müller/Thielhorn 2000).
Ist es in vielen Ländern längst selbstverständlich die PatientInnen- bzw. die NutzerInnenperspektive in das Versorgungsgeschehen einzubeziehen, wird in Deutschland seit Jahren die Ermangelung dessen kritisiert (Schaeffer 2004), obwohl auf die Bedeutung der Sicht der PatientInnen für die Qualität im Gesundheitswesen seit längerem und in zunehmendem Maße hingewiesen wird (Straub 1993, Köck/Ebner 1996, Ovretveit 1992).
Der Sachverständigenrat für Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen spricht sich schon in seinem Gutachten von 2000/2001 für mehr PatientInnenenorientierung aus. Gleichwohl wird auf politischer Ebene gefordert den ‚Patienten in den Mittelpunkt’ (SVR 2003, 39) zu stellen. Im Rahmen der Gesundheitsreform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Gesundheitsreform) wurde erstmalig im Jahre 2000 der Versuch unternommen die Eigenverantwortung und Kompetenz der PatientInnen (und Versicherten) zu stärken. Ziel ist es PatientInnen weniger als passive LeistungsempfängerInnen, sondern als Ko-ProduzentInnen der Leistungserbringung zu sehen (Donabedian 1992; Trummer at al. 2002; Schaeffer (2004). Gerade um das individuelle Erleben von Krankheit und Versorgung, das subjektive Wohlbefinden und die persönliche Krankheitsbewältigung zu erfahren, sei es, nach Estorf-Klee (1998), unerlässlich die Sicht der PatientInnen/NutzerInnen miteinzubeziehen. Da sie die Leistungen am eigenen Leib erfahren und über großes Erfahrungswissen über sich und ihre Krankheit verfügen, können sie selbst am besten Lösungen entwickeln, welche sich an ihren Bedürfnissen orientieren (Estorf-Klee 1998).
1.1.2 NutzerInnenzufriedenheit
Knop (2002) konstatiert, dass es zunehmend wichtiger wird, die Bedürfnisse der PatientInnen zu erkennen, welche die Zufriedenheit der PatientInnen mit einschließt. Laut Müller und Thielhorn (2000) wird die Zufriedenheit der PatientInnen zum Ziel gesundheits- und personenbezogener Dienstleistungen.
Blum (1998) führt an, dass gerade vor dem Hintergrund eines verschärften Wettbewerbs und eines umfassenden Qualitätsmanagements die KundInnenorientierung[2] zusehends an Bedeutung gewinnt, jedoch weiterhin ein expertInnenzentrierter und statischer Qualitätsbegriff vorherrsche. Qualität wird jedoch im Sinne von KundInnenzufriedenheit bestimmt. Qualität besteht, seines Erachtens, in der Erfüllung von PatientInnenanforderungen, welche ermittelt werden müssen, indem die Erwartungen, Ansprüche und Relevanzen der PatientInnen identifiziert und/oder ihre Erfahrungen bzw. Zufriedenheit mit dem Versorgungsprozess erhoben und vorhandene Verbesserungsvorschläge einbezogen werden (vgl. Blum 1998).
NutzerInnenzufriedenheit ergibt sich unter anderem als Situationseinschätzung aus der Erfüllung ihrer Erwartungen und Interessen im Vergleich zu den Erfahrungen, Erleben und Wahrnehmungen eines Dienstleistungsservices. Sie ist in diesem Zusammenhang als subjektiver Abgleich von Erwartungen und Erfahrungen der NutzerInnen mit Dienstleistungsangeboten zu verstehen. Erwartungen sind als Produkt prozesshafter Entwicklungen zu betrachten und sind Folge der bewussten oder unbewussten Reflexion von Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund können Erwartungen von DienstleistungsnutzerInnen nicht als isoliertes oder feststehendes Geschehen betrachtet werden, was bedeutet, dass Aussagen zu Erwartungen an Dienstleistungen nur im Kontext der Erfahrungen der NutzerInnen aussagekräftig reflektiert werden können. Gegenüber gesundheitsbezogener Dienstleistungen sind auch die Überzeugungen der NutzerInnen im Zusammenhang zu ihrer gesundheitlichen Versorgung relevant (Müller/Thielhorn 2000; Wingenfeld 2003).
Die NutzerInnenperspektive und –zufriedenheit gewinnt aufgrund der Importanz für das gesundheitsbezogene Versorgungsnetz auch in der Forschung zunehmend an Relevanz. Dabei sind, nach Aust (1994), Detailfragen und konkrete Erfragung von Kriterien der Zufriedenheit allgemein wesentliche Aspekte, um aussagefähige und nutzbare Antworten in NutzerInnenbefragungen zu erhalten. Dies bedeutet, dass konkret nach Zufriedenheit mit der Dienstleistung gefragt und eine ebenso konkrete Antwort zugelassen werden muss. Daher ist es wichtig, dass Fragen nicht zu allgemein formuliert werden, damit der/die Untersuchende erfahren kann, was mit der Zufriedenheitsäußerung gemeint ist und weshalb die Befragten zu dieser Einschätzung kamen (Wingenfeld 2003).
Für die Forschung ist es relevant, dass Erwartungen das Ergebnis verarbeiteter Erfahrungen sind, welche abhängig vom Verarbeitungs- und Bewältigungsprozess sind. Im Rahmen des Entwicklungsverlaufes verändern sich Charakter und Voraussetzungen der Erwartungen (Wingenfeld 2003). Dies impliziert, dass die Messung von unbeeinflussten Erwartungen nicht möglich ist, da diese schon durch unterschiedliche Wahrnehmungen geprägt wurden. Erwartungen entwickeln sich prozesshaft in Auseinandersetzung mit der gegebenen Situation weiter.
Auch in der aktuellen Forschung bleiben die NutzerInnen dieser Dienstleistungen, im Gegensatz zu den AkteurInnen des Versorgungswesens, trotz der oben angeführten Reformimpulsen im Gesundheitswesen nach mehr PatientInnen- oder KundInnenorientierung, weitgehend unberücksichtigt (Schaeffer 2000). Es gibt einige wenige Studien zur Zufriedenheit mit in Anspruch genommenen Dienstleistungen, welche lediglich eine begrenzte Aussagekraft besitzen, da sie sich nur mit Teilaspekten der Versorgungsnutzung auseinandersetzen (vgl. Schaeffer 2000). Laut Schaeffer (2000) bleiben dadurch die weitergehende Problemsicht, das Erleben des Versorgungsgeschehens und die Qualitätsbeurteilung der NutzerInnen gänzlich unbekannt.
Zur NutzerInnenperspektive sowie Konzeptentwicklung in der Versorgung sterbender Kinder gibt es in Deutschland bisher wenig Literatur (Wingenfeld/Mikula 2002; Wamsler et al. 2005), wohingegen es bezüglich der allgemeinen Versorgung sterbender oder schwer kranker erwachsener Menschen weitaus mehr Untersuchungen und Erkenntnisse vorliegen (Feldmann 1997, Lademann 2000, Ewers/Schaeffer 2003, Schaeffer/Günnewig/Ewers 2003).
International gibt es einige wenige Studien, die sich, allerdings in der stationären und nicht ambulanten Versorgung, mit der Einbeziehung der Eltern befassen (Holm/Patterson/Gurney 2003; Martinson/Yee 2003).
1.2 Zur Situation sterbender Kinder und ihrer Familien
1.2.1 Epidemiologische und statistische Daten
1.2.1.1 Todesursachen im Kindesalter
Nach Student und Student (2004) macht der Tod von Kindern knapp 1 Prozent aller Todesfälle in westlichen Industriestaaten aus, wobei es in Deutschland ca. 7000 Kinder sind, die jährlich sterben. Im Jahr 2001 starben, Angaben des Statistischen Bundesamt (2003) zufolge, in Deutschland 5.054 Kinder im Alter unter 15 Jahren, was bezogen auf die Bevölkerung dieser Altersgruppe 40 Kindern je 100.000 Einwohner entspricht. Starben fast zwei Drittel aller Kinder im Säuglingsalter (Statistisches Bundesamt 2003) stellen jenseits des ersten Lebensjahres, tödliche Unfälle und onkologische Erkrankungen die häufigsten Todesursachen dar, gefolgt von kardiovaskulären, neuromuskulären und genetisch bedingten Erkrankungen (Friedrichsdorf/Zernikow 2005; Student 2004).
1.2.1.2 Lebenslimitierende Erkrankungen im Kindesalter
Gegenwärtig leben in Deutschland mehr als 22.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebenslimitierenden oder terminalen Erkrankung, bei denen es keine realistische Hoffnung auf Heilung gibt und betroffene Kinder und Jugendliche mutmaßlich vor Erreichen des Erwachsenenalters sterben werden (Friedrichsdorf/Zernikow (2005). Jedes Jahr sterben 1500-3000 von ihnen, 540 davon an den Folgen von Krebserkrankungen. Genauere statistische Angaben sind nicht verfügbar, da zum einen an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche in einem gesonderten Register (Kinderkrebsregister) aufgenommen werden und zum anderen keine allgemein akzeptierte Definition der lebenslimitierenden Erkrankung im Kindesalter jenseits von Krebserkrankungen vorhanden ist (vgl. Friedrichsdorf/Zernikow (2005) , Statistisches Bundesamt, OECD). Zudem bietet die nach Krankheitsgruppen gegliederte Todesursachenstatistik diesbezüglich nur grobe Anhaltspunkte (Schwartz et al. 1998).
1.2.2. Auswirkung der lebenslimitierenden Erkrankung eines Kindes auf die Familie
Die Betreuung eines schwerkranken, sterbenden Kindes bringt für die gesamte Familie oftmals schwerwiegende Veränderungen mit sich (Henkel et al. 2005) und stellt eine große Belastung für alle Familienmitglieder dar.
Erkrankt ein Kind schwer stellt dies insbesondere für die Familienangehörigen eine starke emotionale Belastung dar und löst unter anderem Gefühle der Verzweiflung, Auflehnung, Angst und Resignation aus (Iskenius-Emmler 1988).
Die Trauer beginnt für Eltern eines tödlich erkrankten Kindes mit Mitteilung der Diagnose. Für Eltern eines beginnt der Trauervorgang (Bowlby 1983; Iskenius-Emmler 1988). Die Eltern sind vor die Aufgabe gestellt dem schwer erkrankten Kind und seine Geschwistern emotionale Unterstützung im Trauerprozess zu gewähren und sich zudem mit der eigenen Trauer auseinandersetzen. Darüber hinaus empfinden sie Wut und Schuldgefühle bei der Erkenntnis das Schicksal ihres Kindes nicht steuern zu können (vgl. Bürgin 1984, in Iskenius-Emmler 1988). Iskenius-Emmler (1988) schätzt insbesondere die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts der schweren Erkrankung ihres Kindes als die größte Belastung im Prozess der Trauerarbeit ein.
Sind Kinder und Jugendliche sterbenskrank, wird dies als besonders sinnlos und tragisch empfunden, was häufig eine soziale Isolation der betroffenen Familie zu Folge hat. Freunde, Bekannte ziehen sich oft aus Angst vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und Unsicherheit im Umgang mit der Familie zurück (Henkel et al. 2005; Iskenius-Emmler 1988).
Die Eltern sind zudem vielfach finanziellen Nöten ausgesetzt. Sind oftmals beide Elternteile berufstätig oder ein Elternteil alleinerziehend, besteht die Problematik ob und wie im Weiteren die Berufstätigkeit und die erforderliche Betreuung des Kindes in Einklang zu bringen sein werden (Henkel et al. 2005).
Die erkrankten Kinder und Geschwister sind zudem, in Relation zu ihrem Alter und ihrer Entwicklung, großen Belastungen ausgesetzt. Diese hier darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, ist zudem nicht Hauptaspekt dieser Arbeit und kann bei Interesse nachgelesen werden (vgl. Mikula/Wingenfeld 2002; Wingenfeld/Mikula 2002).
1.3 End-of-Life Care und Palliative Care
1.3.1 End-of-Life Care
End-of-Life Care ist der international verwendete Begriff für die Versorgung von Menschen, die sich an ihrem Lebensende befinden (Ewers/Schaeffer 2005).
Es existieren unterschiedliche Auffassungen über die Definition (Ewers/Schaeffer 2005), vielfach wird End-of-Life Care mit Palliative Care gleichgesetzt. Payne et al. (2004) zum Beispiel bezeichnen End-of-Life Care als aktuell verwendeten Begriff, der die Bezeichnung Palliative Care, welcher im englischsprachigen Raum in den 1980er Jahren bis zum Jahr 2000 Aktualität besaß, ablöst. Kennzeichnet Palliative Care ein Versorgungskonzept und professionelle Strategie im Umgang mit Menschen, die unter den Bedingungen lebensbedrohlicher Erkrankungen und den individuellen Auswirkungen leben, besitzt End-of-Life Care, nach Auffassung von Ewers und Schaeffer (2005) größere Reichweite und Palliative Care stellt einen Teilbereich dar (vgl. Lynn et al. 2000; Singer/Bowman 2002).
Nach ihrer Auffassung steht End-of-Life Care für alle praktischen, politischen und wissenschaftlichen Aktivitäten unterschiedlicher Akteure auf der Mikro-, Meso- oder Makroebene mit dem Ziel die Lebens- und Sterbensbedingungen in einem konkreten gesellschaftlichen Umfeld zu gestalten und zu verbessern (vgl. Schaeffer/Ewers 2005). Bemühungen bürgerlicher Hospizbewegungen werden ebenso wie die professionellen Leistungsanbieter mit eingeschlossen, jedoch geht End-of-Life Care noch weit darüber hinaus und nimmt auch übergeordnete politische und wissenschaftliche Aktivitäten ins Visier. Singer und Bowman (2005) unterscheiden bezüglich der oben angeführten Ebenen zwischen einer klinischen (Mikroebene), einer organisatorischen (Mesoebene) und einer bevölkerungsbezogenen Ebene (Makroebene) der Auseinandersetzung mit der Versorgung am Lebensende.
In vorliegender Arbeit soll hauptsächlich den klinischen Aktivitäten die Aufmerksamkeit zuteil werden, welche, nach Schaeffer und Ewers (2005) alle Maßnahmen beinhalten, die darauf ausgerichtet sind das direkte Versorgungshandeln am Ende des Lebens zu verbessern und die dafür notwendigen Wissensgrundlagen zu schaffen und zu erweitern. Dies impliziert die Aktivitäten aller AkteurInnen, wie zum Beispiel Pflegende, ÄrztInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen, die in persönlichem Kontakt zu schwerkranken und sterbenden Menschen und deren Angehörigen stehen.
In diesem Sinne stellt Palliative Care ein Versorgungskonzept auf der klinischen Ebene bzw. auf der Mikroebene von End-of-Life Care dar und soll im Folgenden näher erläutert werden.
1.3.2 Palliative Care
Der Begriff „Palliativ“ leitet sich vom lateinischen „Pallium“, was Mantel bedeutet, ab. Unter „Care“ wird in der deutschen Sprache „Versorgung“ verstanden (Pleschberger/Heimerl 2005). Palliative Care wird in oftmals mit dem Terminus Palliativmedizin übersetzt, anstelle von Palliativversorgung[3]. Sowohl die Palliativmedizin als auch die Palliativpflege stellen jedoch lediglich eine Teildisziplin des umfassenden Konzepts von Palliative Care da (Heller 2000).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit ihrer Definition von Palliative Care aus dem Jahr 1990 breite Zustimmung in der Literatur erfahren. Diese wurde 2002 überarbeitet und lautet wie folgt:
„Palliative Care ist ein Ansatz mit dem die Lebensqualität von PatientInnen und ihren Familien verbessert werden soll, wenn sie mit einer lebensbedrohlichen Krankheit und den damit verbundenen Problemen konfrontiert sind. Dies soll durch Vorsorge und Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen und fehlerlose Einschätzung und Behandlung von Schmerzen und anderen physischen, psychosozialen und spirituellen Problemen erfolgen“(WHO 2002, Übersetzung von Pleschberger/Heimerl 2005, 18).
Obwohl es in jedem Land unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bezüglich Palliative Care gibt, ist ein Grundkonsens über zentrale Konzeptionsmerkmale erkennbar, welche entscheidend auf die WHO-Definition zurückzuführen sind. Die zentralen Kernelemente der Palliative Care-Philosophie sind (in Anlehnung an Pleschberger 2001):
- Tod und Sterben werden als normale Prozesse verstanden
Tod und Sterben werden als normale zum Leben gehörende Prozesse konzeptualisiert und als integraler Bestandteil der Einrichtungen des Gesundheitswesens verstanden. Tod soll in diesen nicht länger als Feind betrachtet werden, es muss sich der Tatsache gestellt werden, dass ein immer größer werdender Teil an Krankheiten chronisch progredient verläuft (WHO 1990). Durch das Konzept von Palliative Care wird der Sterbeprozess weder beschleunigt, noch verzögert (ebd.).
- Die Lebensqualität sterbender Menschen steht im Mittelpunkt
Palliative Care hat zum Ziel die Lebensqualität schwer erkrankten Personen zu erhöhen, wobei Linderung von Schmerz und anderen belastenden Symptomen im Mittelpunkt steht. Grundsätzlich schließen sich kurative und palliative Aspekte nicht aus sondern werden als komplementäre Interventionsstrategien betrachtet (WHO 1990).
Palliative Maßnahmen unterscheiden sich dabei von den kurativen nur durch ihre unterschiedliche Intention und Zielsetzung.
- Die ganzheitliche Versorgung erfolgt durch ein multiprofessionelles Team
Da physische, psychische, soziale und spirituelle Aspekte gleichermaßen in die Versorgung mit einzubeziehen sind, ist ein multiprofessionelles Team für die Palliativversorgung unverzichtbar. Laut WHO kommt/müsste den Pflegenden, durch ihre Nähe zu den PatientInnen, im multiprofessionellen Team eine koordinierende Funktion zu/zukommen. Dazu müssten den Pflegenden jedoch autonome Handlungsmöglichkeiten eingeräumt werden (WHO 1990)
- Palliative Care ermöglicht PatientInnen so lange wie möglich ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen
Palliative Care möchte es PatientInnen ermöglichen so lange wie möglich ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen, wobei die Ziele einer jeden PatientIn zum Maßstab genommen werden und respektiert werden.
- Angehörige (Familie, Bezugspersonen) werden in die Palliativversorgung mit einbezogen und unterstützt
Die Familien (Bezugspersonen) der PatientInnen wird in die Palliativversorgung mit einbezogen. Laut WHO (1990) wird die Mitarbeit der Familien erwartet, erhalten wiederum im Rahmen der Palliative Care Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Belastungen und in ihrer Trauer.
- Zielgruppe
Palliative Care ist ein Versorgungskonzept für Menschen mit infauster Diagnose. Die Palliativversorgung ist an keine bestimmte Altersgruppe oder bestimmtes Krankheitsbild geknüpft.
Im englischsprachigen Raum hat sich Palliative Care in den letzten 30-40 Jahren entwickeln und etablieren können und stellt eine wichtige Disziplin des Gesundheitswesens dar, wohingegen sich die Entwicklung in Deutschland noch in den Anfängen bewegt (Davy/Ellis 2000).
1.3.3 Palliative Care im Kindesalter
Im englischsprachigen Raum wird unter der Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen bzw. Paediatric Palliative Care die aktive und umfassende Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Kindern verstanden, welche die physische, emotionale, soziale und spirituellen Bausteine/Aspekte miteinander verbindet. Schwerpunkt ist einerseits die höchstmögliche Lebensqualität für das Kind und andererseits die umfassende Unterstützung für die Familie. Zur Versorgung gehört die Therapie belastender Symptome, Angebote zur Entlastung und medizinisch-pflegerischer und psychosozialer Betreuung bis zum Tod und darüber hinaus (Friedrichsdorf/Zernikow 2005).
Betrifft die Palliativversorgung Erwachsener fast ausschließlich an Erkrankte, die an den Folgen von Krebserkrankungen sterben werden, stellt sich die Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Kindern anders da. Pädiatrische palliative Versorgung widmet sich Kindern, die unter den Bedingungen lebenslimitierender Erkrankungen leben und Kindern, die von einer potentiell tödlichen Krankheit betroffen sind, bei der Heilung möglich, aber eher unwahrscheinlich ist (Friedrichsdorf/Zernikow 2005). Die Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen kann sich dementsprechend über viele Jahre erstrecken.
Die Palliativversorgung von Kindern stellt unter anderem die rasante Entwicklung von Kindern eine besondere Herausforderung dar (Henkel/Zernikow 2005). Grundsätzlich sind fundierte Kenntnisse über die Entwicklung von Wahrnehmung, Denken und Kommunikation von Kindern und Jugendlichen evident, wobei der jeweilige Entwicklungsstand eines Kindes maßgeblich die Versorgung beeinflusst. Nach Henkel und Zernikow (2005) muss die Kommunikation grundsätzlich auf die ganze Familie ausgerichtet sein, da die „existenziell notwendigen Bezugspersonen“ (ebd., 95), in der Regel sind dies die Eltern, für die Versorgung eines Kindes unverzichtbar sind. Die Familie bildet eine Kommunikationseinheit, welche beim Säugling oder Kleinkind eine noch stärkere Ausprägung findet als bei einem Jugendlichen.
Grundsätzlich bedürfen Kinder und Jugendliche in der Palliativphase, ebenso wie Erwachsene, einer ganzheitlichen pflegerischen, medizinischen und psychosozialen Betreuung (Henkel et al. 2005). Im Unterschied zu Erwachsenen sind sie in der Palliativphase zum Teil noch bis kurz vor dem Tod in der Lage aktive soziale Kontakte zu gestalten, so gehen einige so lange wie möglich zur Schule (18%) und treffen sich mit ihren Freunden (55%). Charakteristisch ist, dass Kinder und Jugendliche ihr übliches soziales Leben so lange wie möglich aufrechterhalten wollen (Henkel/Zernikow 2005).
Palliative Care von Kindern folgt dem Primat der häuslichen Versorgung. Können somit die belastenden Trennungen von den Eltern vermieden werden und die elementaren Bedürfnissen nach Sicherheit und Geborgenheit berücksichtigt werden (Davies/Howell 1999), können darüber hinaus Ressourcen des sozialen Netzes, wie zum Beispiel Entlastung durch Familienangehörige und Freunde, genutzt werden (Knigge-Demal 2003). Zudem richtet sich Palliative Care auf die Versorgung auf die gesamte Familie aus und leistet umfassende Unterstützung (ACT/RCP 1997). Kinder mit tödlich verlaufenden Erkrankungen stellen eine besonders vulnerable Patientengruppe dar und sind in vielen Lebensbereichen von ihren Eltern abhängig (Lovetown/Carter 1999; McQuillan/Finlay 1996). Somit ist die Stabilität die Familiensystems die Basis für eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Betreuung. Das bedeutet, dass sich Versorgungsangebote einerseits an Bedarf und Bedürfnissen der Kinder als PatientInnengruppe orientieren müssen, andererseits jedoch auch die Problemlagen und Anliegen der Eltern und gegebenenfalls der Geschwister berücksichtigen müssen (Wingenfeld 2002).
1.4 Das ambulante Versorgungssystem für sterbende Kinder
Die palliative Versorgung von Kindern und ihren Familien findet in Deutschland in Kinderkliniken, Kinderhospizen beziehungsweise Kurzpflegeinrichtungen oder im häuslichen Umfeld statt (Henkel et al. 2005)
Da die Aufmerksamkeit der Versorgung dem ambulanten Bereich – und hier insbesondere der ambulanten Kinderkrankenpflege – gelten soll, werden im Folgenden die hiesigen stationären Strukturen lediglich knapp umrissen.
1.4.1 Stationäre Versorgung sterbender Kinder und Jugendlicher
Im Gegensatz zu Kliniken zur stationären Versorgung Erwachsener, sind Kinderkliniken hierzulande keine Palliativstationen angegliedert. Schwerstkranke Kinder sterben auf Intensivstationen oder Stationen der Normalversorgung beziehungsweise peripheren Stationen (Henkel et al. 2005).
In Deutschland gibt es derzeit (Stand 2005) acht stationäre Kinderhospize, wobei diese im Vergleich zu Süd- und auch zu Ostdeutschland deutlich unterrepräsentiert sind. Dortiger Schwerpunkt ist die Kurzzeitpflege ist, welche für maximal vier Wochen pro Jahr in Anspruch genommen werden kann (Henkel et al. 2005). Kinderhospize haben somit eine familienentlastende Funktion, da die Eltern je nach Wunsch, die Möglichkeit haben, die Pflege ganz oder teilweise auf die Pflegenden zu übertragen. Maximal vier Wochen im Jahr kann diese Entlastung in Anspruch genommen werden. Zudem können die Familien die Terminalphase mit ihrem Kind dort verbringen oder mit ihrem gestorbenen Kind zum Abschiednehmen das Hospiz aufsuchen.
1.4.2 Die ambulante Versorgung sterbender Kinder
Erfolgt die palliative Betreuung, je nach individuellem Betreuungsbedarf, über niedergelassene KinderärztInnen oder in auf spezielle Erkrankungen ausgerichtete Ambulanzen von Kinderkliniken, bieten hierzulande zudem 19 ambulante Kinderhospizdienste betroffenen Familien Unterstützung an. Zumeist Ehrenamtliche betreuen Kinder und Jugendliche und ihre Familien zu Hause, wobei sie unter anderem organisatorische Aufgaben, wie zum Beispiel die Koordination von Terminen, übernehmen und sich um Geschwisterkinder kümmern.
Hauptsächlich übernehmen jedoch ambulanten Kinderkrankenpflegeverbände die häusliche Betreuung.
1.4.2.1 Ambulante Kinderkrankenpflegedienste und Palliativversorgung
Verglichen mit der Verbreitung von Einrichtungen, die die ambulante Versorgung erwachsener kranker und/oder alter Menschen zum Ziel haben, ist die Anzahl ambulanter Kinderkrankenpflegeverbände in Deutschland gering (Knigge-Demal 2003). Existieren in diesem Bereich ca. 10.000 ambulante Pflegedienste, wird die Anzahl ambulanter Kinderkrankenpflege von ca. 100 (Dobke et al. 2001) bis 136 Diensten (Wamsler et al. (2005) angegeben.
Daten über Gründe der Anspruchnahme ambulanter Kinderkrankenpflege sind nicht verfügbar. Laut Knigge-Demal (2003) ergaben nicht repräsentative Befragungen von Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen in der ambulanten Pflege, dass der Pflegebedarf der Kinder und Jugendlichen häufig aus chronischen Erkrankungen oder Behinderungen resultiere.
In den Jahren 2000-2002 wurden mehr als 4.200 Kinder und Jugendliche zu Hause betreut (vgl. Wamsler et al. 2005) und im Jahr 2003 haben 828 pflegebedürftige Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 15 Jahren, im Rahmen der Pflegestufe III, ambulante Pflege in Anspruch genommen (gbe-bund.de).
Das Leistungsspektrum ambulanter Kinderkrankenverbände umfasst zum Teil auch sehr spezifische Leistungen wie z.B. die Betreuung beatmeter Kinder oder PatientInnen mit Heimdialyse. Genauere Angaben über die Anzahl aller Spezialdienste für Kinderkrankenpflege hierzulande, gibt es jedoch nicht (vgl. Hackmann (2005).
Die Angaben darüber wie viele ambulante Kinderkrankenpflegeverbände Palliativversorgung anbieten variieren stark. Gibt es in Deutschland, laut Henkel und Zernikow (2005), derzeit 68 ambulante Kinderkrankenpflegedienste, welche über Erfahrungen bezüglich der Palliativversorgung von Kindern und Familien verfügen werden, werden im Wegweiser Hospiz und Palliativführer 48 ambulante Kinderkrankenpflegedienste diesbezüglich für Deutschland ausgewiesen (Sabatowski et al. 2005). Eine Befragung unter allen 136 deutschen ambulanten Kinderkrankenpflegediensten ergab wiederum, dass 34 ambulante Kinderkrankenpflegedienste über Erfahrungen in der Betreuung sterbender Kinder verfügen (Wamsler et al. 2005). Aus der geringen Zahl der ambulanten KInderkrankenpflegedienste, die Palliativversorgung anbieten, lässt sich schließen, dass eine flächendeckende Palliativversorgung von Kindern nicht gewährleistet ist.
Im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder Polen gibt es hierzulande (außer in Modellprojekten) keine multiprofessionellen Palliativteams zur ambulanten Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Dort stehen ambulante Kinderkrankenpflegeteams, im onkologischen Bereich auch Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen der jeweiligen Kinderklinik, betreuen die Kinder und Jugendlichen zu Hause und stehen den Eltern anleitend und beratend zur Seite. Bei Bedarf wird ein Pädiater/eine Pädiaterin oder ein psychosozialer Mitarbeiter/eine psychosoziale Mitarbeiterin hinzugezogen (Henkel et al. 2005).
Ist die Finanzierung ambulanter pflegerischer Leistungen im Sozialgesetzbuch V und XI (vgl. Hackmann 2005; Simon 2005) festgehalten, zeigen Untersuchungen zudem, dass es hinsichtlich der Finanzierung der ambulanten Palliativversorgung von Kindern bundesweit keine einheitlichen Finanzierungsmodelle vorhanden sind, da eine kostendeckende Finanzierung nur für Kinder besteht, die stationär in Kinderkliniken betreut werden (Wamsler et al. 2005). Da ambulante Kinderkrankenpflegedienste überwiegend Kinder betreuen, die sich nicht in der Lebensendphase befinden, verfügen sie in der Regel nicht über vertragliche Vereinbarungen mit den Kostenträgern, so dass die Vielzahl als Einzelfälle abgerechnet werden (vgl. Wamsler et al. 2005).
1.5 Beratung in der Pflege
Im Gesundheitswesen steigt der Beratungsbedarf, bedingt durch die gesellschaftlichen, demographischen, politischen und ökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre (vgl. Buck 1997 in Wörmann 2003; Mertin et al. 2005) kontinuierlich an. Diese Veränderungen haben, laut Wörmann (2003), zur Folge, dass PatientInnen, Pflegebedürftige und Angehörige als NutzerInnen von Gesundheitsleistungen
- viel Informationen benötigen
- mit einer großen Auswahl von Angeboten konfrontiert sind
- selbständig entscheiden und handeln müssen
- in vielen Situationen auf sich alleine gestellt sind.
Insbesondere die Förderung der Selbstbestimmung und die Übernahme von Eigenverantwortung des Patienten/der Patientin muss von Pflegenden verstärkt wahrgenommen und aufgegriffen werden (Mertin et al. 2005).
Ein einheitlicher Beratungsbegriff existiert nicht, er findet in der Literatur in vielfältiger Weise Verwendung. Gemeinsam ist aber allen Definitionen, dass die Informationsweitergabe durch beratende Personen zugrunde liegt, die zur Lösung von bestehenden Problemen oder Konflikten beitragen soll, die von den Rat- und Hilfesuchenden nicht selbständig bewältigt werden können (Sander 1999; Alterhoff 1994) Beratung geht darüber hinaus Ratschläge zu erteilen, sondern stellt eine komplexe Tätigkeit mit umfassenden Anforderungen zur begleitenden Problembewältigung bzw. einer möglichen Situationsveränderung sowie Entlastung dar. Beratung bezieht das Erkennen von Problemen bzw. Konflikten, Be- bzw. Überlastung, Hilfe- und Informationsbedarf sowie emotionale, praktische und edukative Unterstützung wie auch Informationswiedergabe im Rahmen eines umfassenden Problemlösungsprozess mit ein (Buijssen 1996).
Mit der Novellierung des Krankenpflegegesetze 2004 wurde vonseiten der Gesetzgeber zum ersten Mal die Fähigkeit zur Beratung als Ausbildungsziel in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung festgeschrieben (vgl. Bundesgesetzblatt 2003b).Welchen Stellenwert Pflegende im Feld der Beratung einnehmen können ist jedoch bislang nur wenig erforscht worden (Köberich et al. 2006). Es besteht jedoch ein Konsens, dass gerade die Pflege, als Berufsgruppe mit großer PatientInnennähe und dem damit verbundenen Einblick in die persönliche Situation der Person, prädestiniert sei, dem Beratungsauftrag zu entsprechen (vgl. Wörmann 2003).
Ist Beratung im pflegerischen Kontext von jeher wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Pflegenden (Köberich et al. 2006; Koch-Straube 2001), wird diesem Bereich sowohl innerhalb des Gesundheitswesens als auch innerhalb der Berufsgruppe der Pflegenden selbst noch immer wenig Aufmerksamkeit zuteil (Köberich et al. 2006). Das bisherige – eher implizite – Verständnis von Beratung wird von Pflegenden beinhaltet bislang die Vermittlung von Informationen[4] und Anleitung pflegepraktischer Tätigkeiten ((Klein et al. 2001; Wörmann 2003). Beratung erfolgt in der Regel, als Alltagsberatung, „nebenbei“ (Klein et al. 2001, in: Koch-Straube).
Um dem zunehmenden pflegerischen Beratungsbedarf entsprechen zu können sind jedoch pflegespezifische Beratungskonzepte unerlässlich. Existieren im Bereich der Psychologie, der Sozialarbeit/Sozialpädagogik unterschiedliche Beratungskonzepte, sind bezüglich der Pflege bisher keine Konzepte vorhanden (Straube-Koch 2001). Koch-Straube (2001) plädiert dafür sich bestehender Konzepte anderer Disziplinen anzunehmen um zu prüfen, ob sie sich eignen die Besonderheiten der Pflege zu implementieren, sie jedoch nicht unreflektiert zu übernehmen, da der Beratungsbegriff anderer Wissenschaftsdisziplinen nicht uneingeschränkt auf das pflegerische Handlungsfeld übertragbar ist (Mertin et al. 2005).
In der Pflege findet Beratung unter anderem im Kontakt zwischen Pflegenden und Gepflegten statt, wobei dieser Kontakt „in einer Phase akuter Erkrankung oder chronischer Belastungen, in der Stress und Angst erleben werden“ (Straube 2001, 61), entsteht, im Versuch die Belastungen zu überwinden. In dieser Phase hoher Irritation und Sensibilität ist ein Teil der Erlebens- und Verhaltensmuster vorübergehend oder dauerhaft unbrauchbar geworden und neue müssen entwickelt werden.
Eltern wollen und müssen immer mehr in den Pflegeprozess integriert werden. Dazu benötigen sie Unterstützung, Begleitung und Beratung um ihr Kind zukünftig versorgen zu können. Somit ist Beratung der Eltern in der Kinderkrankenpflege unabdingbar. Die Integration der Eltern in die Versorgung ihres kranken Kindes erfordert einen aktiven Umgang und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse des kranken Kindes/Jugendlichen und der gesamten Familie (Bachmann 2001).
Übernahmen die Pflegenden in früheren Zeiten die komplette Pflege von kranken Kindern/Jugendlichen benötigen sie heute Beratungs- und Anleitungskompetenz um belastende Situationen derart zu gestalten, dass sowohl die Eltern als auch die betroffenen Kinder Prävention und Entlastungsmöglichkeiten erfahren und ihre Bewältigungsstrategien gestärkt werden (ebd.). In der Regel haben die Eltern eine hohe Expertise in der Versorgung ihrer Kinder, benötigen aber in neuen oder schwierigen Pflegesituationen Anleitung und Beratung oder ergänzende Pflegeangebote für ihr Kind (Knigge-Demal 2003).
Ist die Beratung ein ganzes zentrales Element von Palliative Care, benötigen auch pflegende Angehörige Unterstützungsangebote in Form von Beratung und Begleitung (Wild 2005). In der professionellen pflegerischen Unterstützung eines sterbenden Kindes und seiner Familie ist eines der vorrangigen Ziele das elterliche Vertrauen in die eigene Pflegekompetenz zu stärken und damit auch einem Gefühl von Ohnmacht und Überforderung entgegenzuwirken (Trapp 1994). Die Angehörigen benötigen während des Krankheitsgeschehens kontinuierlich Unterstützung und Anleitung um Situationen einschätzen zu lernen und sind zudem auf zusätzliche Angebote für ihr Kind angewiesen (Knigge-Demal 2003; Davies/Howell 1999). Darüber hinaus ist es Aufgabe Pflegender über die Problematik zu informieren, die offene Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern zu fördern und eine Auseinandersetzung mit Krankheit und Sterben in kindgerechter Form zu unterstützen (Goldman 1998; Mikula/Wingenfeld 2002).
[...]
[1] Der Begriff Kinder impliziert Kinder aller Alterstufen, somit auch die Jugendlichen, und wurde aus Gründen des besseren Leseflusses gewählt.
[2] Die Grundsatzdebatte, ob PatientInnen KlientInnen oder KundInnen darstellen, soll hier nicht aufgegriffen werden, vergleiche hierzu Schaeffer (2004).
[3] Im Verlauf der Arbeit findet vorrangig der deutsche Begriff Palliativversorgung und Palliativpflege Anwendung.
[4] Auch im institutionalisierten Bereich, z.B. in Pflegebüros, Patientenberatungsstellen, wird unter Beratung bislang lediglich die Vermittlung von Informationen verstanden (Wörmann 2003).
- Arbeit zitieren
- Diplom-Berufspädagogin für Pflegewissenschaft Katja Burkhardt (Autor:in), 2006, End-of-Life Care aus der NutzerInnenperspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79126
Kostenlos Autor werden



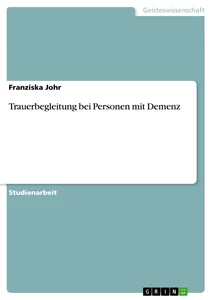
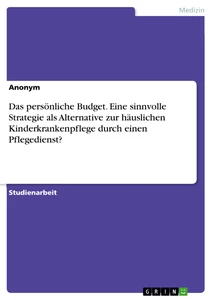
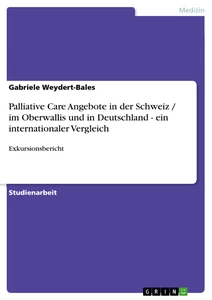

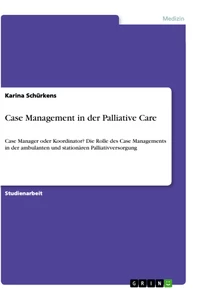



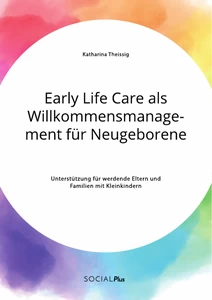



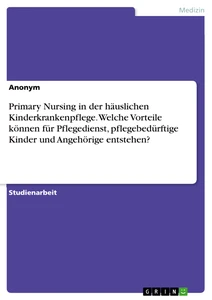






Kommentare