Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rahmenbedingungen des Computerspiels
2.1. Die alltägliche Lebenswelt (reale Welt)
2.2. Die mentale Welt und die Traumwelt
2.3. Die Spielwelt
2.4. Die virtuelle Welt
2.5. Die virtuelle Spielwelt
3. Interaktions- und Kommunikationsformen beim Computerspiel
3.1. Mensch-Computer-Interaktionen
3.1.1. Die Mensch-Computer-Interaktion als grundlegende Basis
3.1.2. Die simulierte Interaktion: Der Computer als Spielpartner
3.2. Computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktionen
3.2.1. Der Mensch als virtueller Spielpartner
3.2.2. Der Mensch als virtueller Kommunikationspartner
3.2.2.1. Computervermittelte Interaktions- und Kommunikationsprozesse
3.2.2.2. Virtuelle Identitäten als subjektive Vorgegebenheiten
3.2.2.3. Virtuelle Rollen als objektive Gegebenheiten
4. Untersuchungsdesign – methodisches Vorgehen
4.1. Forschungsdesign: Auswahl des Messinstruments
4.2. Operationalisierung: Konstruktion des Kategoriensystems und des Interviewleitfadens
4.3. Gütekriterien: Bestimmung der Reliabilität und Validität
4.4. Stichprobe: Auswahl der Untersuchungseinheiten und Kategorisierung der Computerspiele
4.5. Datenerhebung: Durchführung der Interviews und methodenkritische Anmerkungen
4.6. Datenauswertung: Methodische Vorgehensweise
5. Darstellung der Ergebnisse
5.1. Rahmenbedingungen der Interaktion und Kommunikation auf virtuellen Spielplätzen
5.1.1. Grenzen, Bedingungen und Anforderungen des Computers
5.1.2. Wesensmerkmale einer virtuellen Spielwelt
5.2. Mensch-Computer-Interaktionen auf virtuellen Spielplätzen
5.2.1. Kriterien einer funktionierenden Mensch-Computer-Interaktion
5.2.2. Kriterien einer erfolgreichen simulierten Interaktion
5.2.2.1. Das gewollte „Hineinnehmen“ des Spielers in das virtuellen Geschehen
5.2.2.2. Anforderung und Beschaffenheit der virtuellen Akteure
5.3. Gemeinsam genutzte virtuelle Spielplätze
5.4. Zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation auf virtuellen Spielplätzen
5.4.1. Computervermittelte Kommunikationsprozesse zwischen den Spielern
5.4.2. Virtuelle Identitäten und virtuelle Rollen
6. Fazit und Ausblick
7. Literaturverzeichnis
Anhang 1: „Exkurs: Die mediale Welt und ihr Einfluss auf Computerspiele“
Anhang 2: „Kategoriensystem und fokussierte Theorieaspekte“
Anhang 3: „Interviewleitfaden und Vorabfragebogen“
Anhang 4: „Durchführung der Probeinterviews“
Anhang 5: „Exkurs: Beschreibung der untersuchten Computerspielkategorien“.XXI
Anhang 6: „Darstellung der Interviewpartner“.
Anhang 7: „Virtuelle Spielergemeinschaften am Beispiel der Gilden innerhalb Online-Rollenspiele“
Anhang 8: „Verhältnis der virtuellen Welt zur medialen Welt und zur Spielwelt“.
1. Einleitung
Heute, im Jahre 2007, haben Computer- und Videospiele einen festen Platz in der Angebotspalette, direkt neben den Spielfilmen und Musikalben. Die Vielfalt des Angebots ist nahezu unüberschaubar und wöchentlich kommen neue Computer- und Videospiele hinzu. Die Spiele selbst werden immer ausgefeilter, ansehnlicher, komplexer und anspruchsvoller. Man schaue sich nur die Grafik- und Soundentwicklung an, einige aktuelle Computerspiele[1] präsentieren sich schon wie ein Spielfilm. Aber auch die Handlungsmöglichkeiten weiten sich immer mehr aus: Einerseits innerhalb des Spiels, wo das Spielgeschehen immer vielfältiger beeinflusst werden kann. Andererseits außerhalb des Spiels, gemeint sind die neueren Entwicklungen im Netzwerk- und Internetbereich. Die Möglichkeiten, gemeinsam in einer computergenerierten Welt zu spielen und in der realen Welt doch getrennt zu sein, nehmen stetig zu.
Diese Arbeit versteht sich als eine explorative Vorstudie, die versucht, eine mitgebrachte Landkarte anhand des vorliegenden Terrains und den gemachten Beschreibungen einiger Computerspieler abzugleichen und insbesondere, die aus ihrer Sicht markanten Punkte in die Landkarte zu integrieren. Die Landkarte selbst versucht einen möglichst umfassenden Blick auf die verschiedenen, potentiell möglichen Interaktions- und Kommunikationsformen zu werfen. Zu diesem Zweck wird ein Theorierahmen entwickelt, der gewährleistet, die einzelnen Charakteristika und Anforderungen der jeweiligen Interaktions- und Kommunikationsformen anhand einer empirischen Erhebung herausarbeiten zu können. Es soll mit anderen Worten ein Bedeutungshorizont abgesteckt werden, der die verschiedenen Interaktionsformen bei Computerspielen erfasst und sie je nach ihren Merkmalen und ihrer Relevanz strukturell gliedert.
Betrachtet man die verschiedenen Interaktions- und Kommunikationsformen während eines Computerspiels, so steht man vor einem vielschichtigen Problem. Zum einen kann man das Phänomen Computerspiel grundlegend in der Schnittmenge zweier Theoriebereiche beschreiben, da es sowohl den Merkmalen eines Spiels wie auch den Bedingungen des Computers unterliegt. Beide Bereiche setzen einen prinzipiellen Rahmen für die Interaktions- und Kommunikationsprozesse. Hieraus resultiert zum anderen eine Vielzahl von differenten Anforderungen an den Spieler und an das Computerspiel. So gilt es als Erstes die Bedienung des Computerspiels zu verstehen, bevor man sich überhaupt auf irgendeine spielerische Interaktion einlassen kann. Bei diesen spielerischen Interaktionen gilt es zudem zu unterscheiden, ob man sie allein vor dem Computer ausführt, oder ob das Spiel gemeinsam mit anderen Menschen genutzt wird. Denn in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit sich die spielerischen Interaktionen mit anderen Menschen von denen unterscheiden, die man mit dem Computer ausführt. Abschließend interessiert noch, welchen Stellenwert die Kommunikationen zwischen den Menschen ein nimmt und auf welche Art kommuniziert wird.
So hält Thomas Köhler gerade ein exploratives Forschungsdesign für angemessen, da „bei der Erforschung computervermittelter Kommunikation […] die Komponente des Einflusses des Untersuchers auf den Gegenstand durch die schnell wachsenden persönlichen Erfahrungen des Untersuchers erweitert [wird]. Diese persönlichen Erfahrungen sind insofern anderer Gestalt als bei herkömmlichen Objekten […], weil die CvK[2] eine neue Interaktions-, Kommunikations- und Sozialsituation darstellt, mit der die Untersucher keine längerfristigen selbstsozialisatorischen Erfahrungen machen konnten.“[3] Einen weiteren Grund für ein nicht-standardisiertes Vorgehen ersieht man an den heutigen Diskussionen in der Medienlandschaft. Aussagen wie: Computerspiele machten einsam, machten aggressiv, schwächten die Emotionalität oder verbesserten die kognitiven Fähigkeiten ziehen allesamt den Beigeschmack einer einseitigen, stereotypen Analyse nach sich. Solche Aussagen gehen implizit davon aus, dass Computerspiele etwas mit dem Menschen machen, ihn verändern und dieser wiederum nur passiv und widerstandslos konsumiert. Doch wenn man sich die grundlegenden Theorien der Mediennutzung ansieht, so erkennt man, dass sie eher davon ausgehen, dass der Mensch keine passive Auftreffscheibe von Medienbotschaften ist, sondern sie aktiv verarbeitet, modifiziert und in seine Lebenswelt integriert.[4]
2. Rahmenbedingungen des Computerspiels
Bevor jedoch auf die diversen Interaktions- und Kommunikationsformen beim Computerspiel eingegangen wird, erscheint es angebracht, den Rahmen, in der sie sich vollziehen genau abzustecken. Aus diesem Grund erfolgt vorerst eine analytische Aufgliederung unserer Lebenswelt in verschiedene Sub-Welten, anhand derer die verschiedenen Rahmenbedingungen eines Computerspiels beschrieben werden.
Alfred Schütz entwickelte in Anlehnung an Edmund Husserls Phänomenologie[5] das soziologische Konzept der Lebenswelt. Die Lebenswelt ist der Schauplatz unserer Handlungen - die fraglos gegebene Wirklichkeit. Die Wirklichkeit selbst existiert aber nicht von sich aus, „[…] sondern nur durch das wechselseitig aneinander orientierte und interpretierte Handeln von Individuen.“[6] Die Wirklichkeit bzw. die Lebenswelt ist also keine private, sondern eine intersubjektive und damit auch eine soziale Lebenswelt. „Die alltägliche Wirklichkeit der Lebenswelt schließt also nicht nur die von mir erfahrene ‚Natur’, sondern auch die Sozial- und Kulturwelt, in der ich mich befinde, ein.“[7]
In Auseinandersetzung mit Max Weber und Ludwig von Mises geht Schütz davon aus, dass der Mensch erst im Umgang mit Dingen und in der Interaktion mit anderen Menschen die Welt versteht. Der Sinn der Handlung entsteht somit aus dem Handeln selbst. Unter Handlung versteht er sowohl die abgeschlossene Handlung, wie auch die gerade ablaufende Handlung. „Das Handeln wird in seinem Ablauf von einem Entwurf geleitet und somit im Unterschied zum bloßen Verhalten im Voraus geplant. In einem solchen Entwurf aber wird stets eine zukünftig abgeschlossene Handlung als Zielpunkt vorgestellt. Der Handlungsentwurf ist abhängig vom Wissensstand zum Zeitpunkt des Entwerfens. Dieses Wissen verändert sich im Zuge des Handelns, so dass die Sinndeutung der entworfenen Handlung und die Sinndeutung der vollzogenen Handlung niemals übereinstimmen können.“[8] Ebenso können auch die Mitmenschen nichts von der Spannweite des Handlungsentwurfs wissen; daher auch die divergierenden Sinndeutungen verschiedener Personen für ein und dieselbe Handlung.
Grundlegend nutzen wir nach Schütz drei Verfahren, um unsere Lebenswelt auszulegen: Wissensvorräte, Erfahrungen und Typisierungen. „Sowohl im Entwerfen unseres zukünftig vorgestellten Handelns als auch in der Deutung der vollzogenen Handlung bringen wir immer schon sozial erworbenes Wissen und gesellschaftlich etablierte Deutungsmuster zur Anwendung.“[9] Diese sozialen, intersubjektiv geteilten Deutungsmuster bzw. Erfahrungsmuster entstehen aufgrund interaktiver Prozesse, die die subjektiven Erfahrungsschemata über Zeichensysteme (beispielsweise die Sprache) wechselseitig aufeinander abstimmen. „Die ‚Struktur der Sozialwelt’ ist das Resultat dieser interaktiven Prozesse: Sie ist gegliedert durch intersubjektiv geltende Handlungs-, Situations- und Personentypologien, die unser gemeinsames (kulturelles) Wissen von der Welt ausmachen.“[10] Die Sprache ist dabei das wichtigste Kommunikationsmittel, um subjektive Erfahrungen und intersubjektive Wirklichkeiten zu konstruieren.
Die Lebenswelt „[…] ist die ‚ausgezeichnete Wirklichkeit’ (‚paramount reality’), in der wir von einem eminent ‚praktischen Interesse’ geleitet sind, unsere grundlegenden Lebenserfordernisse zu bewältigen, und in der ausschließlich ‚Kommunikation möglich ist’.“[11] Aber menschliches Handeln, Denken und Erleben ist nicht nur auf diese alltägliche Lebenswelt beschränkt, sondern sie ist gegliedert „[…] in verschiedene geschlossene Sinnprovinzen (‚finite provinces of meaning’) vom Traum, über die Religion, die kindliche Spielwelt bis etwa zur Wissenschaft abspielt. […] Jeder dieser idealtypisch abgegrenzten vielfachen Wirklichkeitsbereiche (‚multiple realities’) zeichnet sich durch einen spezifischen ‚Erkenntnisstil’ aus […].“[12]
Im Folgenden sollen die für die Bereiche des Computers und des Spiels entscheidenden Areale der Lebenswelt (Subwelten) beschrieben werden[13]:
2.1. Die alltägliche Lebenswelt (reale Welt)
Was A. Schütz die „alltägliche Lebenswelt“ nennt, nennen Peter Berger und Thomas Luckmann kurz „Alltagswelt“[14]. Sie ist die oberste Wirklichkeit und man erlebt sie für gewöhnlich im vollwachen Zustand. So werden die Mitmenschen des Alltags anders erlebt als beispielsweise die Gestalten in nächtlichen Träumen. „Die Wirklichkeit der Alltagswelt ist um das ‚Hier’ meines Körpers und das ‚Jetzt’ meiner Gegenwart herum angeordnet. Dieses ‚Hier’ und ‚Jetzt’ ist der Punkt, von dem aus ich die Welt wahrnehme.“[15] Andere Wirklichkeiten (z.B. die Traumwelt oder die Spielwelt) erscheinen gegenüber der Alltagswelt als fest „umgrenzte Sinnprovinzen, als Enklaven in der obersten Wirklichkeit. Ihre Grenzen sind markiert durch fest umzirkelte Bedeutungs- und Erfahrungsweisen. Die oberste Wirklichkeit umhüllt sie gleichsam von allen Seiten und das Bewusstsein kehrt immer wieder von einer Reise zu ihr zurück. […] Für alle Enklaven, das heißt für alle Bereiche geschlossener Sinnstruktur, ist charakteristisch, dass sie die Aufmerksamkeit von der Alltagswelt ablenken. […] Die Alltagswelt-Wirklichkeit behält – das muss ausdrücklich betont werden – ihr Übergewicht auch noch nach solchen Sprüngen. Dafür sorgt schon die Sprache.“[16] Die Sprache ist dabei nicht nur Kommunikationsmittel, sondern sie setzt auch die Ordnung, die einem in der Alltagswelt sinnhaft erscheint. „Ich lebe an einem Ort, der geographisch festgelegt ist. Ich verwende Werkzeuge, von Büchsenöffnern bis zu Sportwagen, deren Bezeichnungen zum technischen Wortschatz meiner Gesellschaft gehören. Ich lebe in einem Geflecht menschlicher Beziehungen, von meinem Schachklub bis zu den Vereinigten Staaten, Beziehungen, die ebenfalls mit Hilfe eines Vokabulars geregelt werden. Auf diese Weise markiert Sprache das Koordinatensystem meines Lebens in der Gesellschaft und füllt sie mit sinnhaltigen Objekten.“[17] Die gesamte Alltagswelt erscheint als eine „Wirklichkeitsordnung“, d.h. die Phänomene scheinen nach einem Muster festgelegt zu sein, das unabhängig davon ist, wie man es selbst erfährt. „Die Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint bereits objektiviert, das heißt konstituiert durch eine Anordnung der Objekte, die schon zu Objekten deklariert worden waren, längst bevor ich auf der Bühne erschien.“[18]
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Lebenswelt bzw. die Alltagswelt der geordnete und fassbare Wirklichkeitsbereich des Menschen ist, „[…] an dem er in unsausweichlicher, regelmäßiger Wiederkehr teilnimmt, den er als schlicht gegeben vorfindet und als fraglos erlebt. Sie ist die ‚phänomenale Wirklichkeit’ des Menschen, also die sinnvoll geordnete Welt der Erscheinungen. […] Die Lebenswelt bildet den Rahmen für die ‚sinnvolle’ Ordnung von Wahrnehmungen und Handlungen. Sie bildet kein umfassendes Ganzes, sondern gliedert sich in ein Netz von Welten (und Subwelten), die sich vielfach überschneiden und überlagern […].“[19]
Von dieser alltäglichen Lebenswelt aus beginnt der Mensch seine „Reise“ zu anderen Subwelten und kehrt auch immer wieder zu ihr zurück. Mit Realität ist aber nicht die „wahre Wirklichkeit“ gemeint, sondern dass ein Subjekt etwas Wahrgenommenem den Status der Realität zuweist. „Die reale Welt ist, wie jede andere Welt auch, eine Konstruktionsleistung des menschlichen Gehirns, das diese Welt durch eine spezifische Ordnung der Reizeindrücke hervorbringt.“[20] Trotz allem hat die reale Welt grundlegend etwas mit „Wirklichkeit“ zu tun. Denn eine „wirkliche“ Gefahr (z.B. ein realer Bus, der schnell auf einen zufährt) zieht auch meist realen Konsequenzen nach sich, während man in der virtuellen Welt eben virtuelle Konsequenzen spürt.
Die reale Welt selbst kann man in weitere zwei Bereiche einteilen: auf der einen Seite die „Umwelt“, also die Dinge um uns herum, die wir außerhalb von uns erfahren und auf der anderen Seite die „Körperwelt“, also unseren eigenen Körper. Die Umwelt können wir mit unseren fünf Sinnesorganen (Auge, Nase, Ohr usw.) erfahren, die Körperwelt zusätzlich noch mit speziellen Körperempfindungen (z.B. Gleichgewichtssinn, Schmerzrezeptoren usw.).[21]
2.2. Die mentale Welt und die Traumwelt
Beide Subwelten können als Areale der Körperwelt gesehen werden, da wir sie nicht mit unseren fünf Sinnesorganen wahrnehmen. Die mentalen Prozesse laufen in unserem Inneren ab und werden auch dementsprechend registriert. Wenn man sich etwas vorstellt, das nicht zur aktuellen Wahrnehmung gehört, befindet man sich schon in der mentalen Welt. Alle Vorstellungen, Handlungsplanungen, Gedanken über zukünftige Ereignisse, Tagträumereien und Phantasieentwürfe fallen in diese Kategorie. Die Traumwelt (z.B. der Nachttraum) unterscheidet sich in einem Punkt grundlegend von der mentalen Welt: Die Vorstellungen der mentalen Welt werden vom Menschen bewusst gesteuert, die Ereignisse eines Traums laufen jedoch unterbewusst ab und können nur sehr bedingt bzw. gar nicht gesteuert werden. Zudem kann über die mentale Welt leichter kommuniziert werden als über die Traumwelt, aber in ihrem Facettenreichtum unterscheiden sie sich kaum. Bei Phänomenen wie Halluzinationen oder unsichtbaren Spielgefährten stoßen wir auf die Grenze zwischen realer und mentaler Welt bzw. Traumwelt. Solche Grenzproblematiken (sie gibt es auch zwischen den anderen Subwelten) sind aber nicht zu vermeiden, da es sich grundlegend um eine analytische Trennung handelt. Jedenfalls sichert die mentale Welt und auch die Traumwelt einen geistigen Freiraum, den die reale Welt nicht bieten kann. Die mentale Welt nimmt zudem eine gewisse Sonderstellung ein: bei jedem sinnhaften Handeln erfolgte im Prinzip eine Planung, ein Handlungsentwurf, und dieser geschieht für gewöhnlich in der mentalen Welt. Folglich ist ein permanentes hin und her pendeln zwischen der realen Welt (bzw. einer der folgend beschriebenen Welten) und der mentalen Welt für das menschliche Dasein charakteristisch. Die im Laufe der Sozialisation gespeicherten Wissensvorräte bzw. Erfahrungen und den daraus resultierenden Typisierungen verschiedener Lebensweltaspekte bilden die Basis der individuellen mentalen Welten und wahrscheinlich auch der jeweiligen Traumwelten. Da die Konstruktionen der mentalen Welt frei disponibel sind und zudem noch flüchtig, haben Menschen seit jeher „[…] Objektivationen ihrer mentalen Welt (ge)schaffen, also Gegenstände, die vom rein Subjektiven abgelöst sind und so als Hinweisreize für vergesellschaftete Vorstellungen verwendet werden können. Von den ersten Höhlenzeichnungen der Menschheit über Texte, Fotos, Filme bis hin zu ausgefeilten Computersimulationen spannt sich das Bemühen der Menschheit, die Vorstellungswelt objekthaft deutlich und intersubjektiv verständlich werden zu lassen.“[22] Folglich sind die nachfolgend beschriebenen Subwelten (Spielwelt, mediale Welt und virtuelle Welt) im Prinzip Objektivationen der mentalen Welt.
2.3. Die Spielwelt
Die reale Welt bildet die Basis für die Spielwelt insofern, dass wir es auch hier mit einer Welt der Dinge (Umwelt) zu tun haben. Auch die Prozesse der Wahrnehmung und das Handeln vollziehen sich in beiden Welten ähnlich. „Die Spielwelt wird als eine eigene Welt insofern deutlich, als sie einen Kontrast zu den Festlegungen und Verbindlichkeiten der realen Welt bildet. […] Die Spielwelt schafft dabei die Rahmenbedingungen für die Ausfaltungen von Vorstellungskraft und Phantasie. Spielwelt und mentale Welt unterscheiden sich in ihrem sinnlichen Charakter. In der mentalen Welt spielen sich Vorstellungskraft und Phantasie im Kopf ab. Die Spielwelt wird auch für Außenstehende sichtbar und als Welt des Spiels verstehbar. Die mentale Welt eines Menschen bleibt einem anderen prinzipiell verschlossen.“[23] Die Spielwelt schafft sozusagen eine Verbindung zwischen unseren phantasievollen Vorstellungen (mentale Welt) und unserer realen Welt: „Spiel ist als äußere Realität inszenierte Phantasie. Es nimmt also eine eigentümliche Zwischenstellung ein, entspringt und dient vielfach der inneren Welt, bedient sich aber realer Handlungen und Gegenstände.“[24]
Jedoch das Spielverhalten des Menschen bereitet der Wissenschaft einige Probleme. So ist umstritten, was das Spiel eigentlich ist, ebenso, welche Ursachen und Funktionen es hat. „Spiel ist eine sehr variable Aktivität, die sich schwer definieren lässt. Wer sich nicht nur mit dem Spiel von Tieren, sondern mit dem von Menschen beschäftigt, sieht sich zudem mit zahlreichen kulturellen Schattierungen des Phänomens konfrontiert – mit Fußball und Bergsteigen, Kartenspiel und Roulette, […] Witz und Humor […], Tanz und Gesang, […] Malerei […] oder dem selbstvergessenen Burgenbauen eines Kindes am Strand.“[25] Nach Schmidtchen und Erb stellt „[…] das Spiel ein von Freude und Ausgelassenheit begleitetes Konglomerat menschlicher Verhaltensweisen dar, die freiwillig und spontan initiiert werden. Spiel ist ein dynamischer Prozess, der neben bestimmten Verhaltensweisen auch ganz bestimmte Einstellungen beinhaltet. Dabei bezieht sich die Einstellungskomponente auf emotionale Aspekte der intrinsischen Motivation, der Spontaneität und der Freude.“[26]
Die klassische Spieldefinition von Johan Huizinga bietet einen Überblick über die formalen Kennzeichen des Spiels: „Der Form nach betrachtet kann man also das Spiel zusammenfassend eine freie Handlung nennen, die als ‚nicht so gemeint’ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als anders als die gewöhnliche Welt herausheben.“[27]
Hierauf baut die phänomenologische Spielforschung auf, die das Spiel „[…] als ein eigenes, aus sich selbst verständliches und nicht weiter reduzierbares Urphänomen“[28] betrachtet. H. Scheuerl nennt sechs Momente zur Wesensbestimmung des Spiels[29]:
a) „Moment der Freiheit“: Die Freiheit des Spiels zeigt sich zum einen in der Möglichkeit, wählen zu können und zum anderen in der Freiheit „[…] von den Bedürfnissen des Daseinskampfes, von der Not des Sich-Wehrens. […] Es ist ohne Verantwortung und ohne Konsequenzen.“[30] Nach J. Huizinga: „Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Handeln. Befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr. Höchstens kann es aufgetragenes Wiedergeben eines Spiels sein.“[31]
b) „Moment der inneren Unendlichkeit“: Scheuerl geht zudem davon aus, dass das Spielbedürfnis des Menschen zwar ermüden kann, aber niemals gesättigt wird. Dies liegt in seinem inneren Wesen, eben der Befreiung von Zwecken und Trieben, der Freiheit vom Streben nach Bedürfnisbefriedigung, der Suche nach Entspannung. Spiel will gerade die Spannung erhalten. Aus diesem Grund gibt es für Scheuerl im Spiel selbst keine Tendenz, die danach trachtet, den Spielzustand aufzuheben. In jedem Spiel existiert dieses Element der Spannung. Für J. Huizinga bedeutet Spannung: „Ungewissheit, Chance. Es ist ein Streben nach Entspannung. Mit einer gewissen Anspannung muss etwas glücken. […] In dieser Spannung werden die Fähigkeiten des Spielers auf die Probe gestellt: seine Körperkraft, seine Ausdauer, seine Findigkeit, sein Mut, sein Durchhaltevermögen und zugleich auch seine geistigen Kräfte […].“[32]
c) „Moment der Scheinhaftigkeit“: Schon für J. Huizinga ist „Spiel […] nicht das ‚gewöhnliche’ oder das ‚eigentliche’ Leben. Es ist vielmehr das Heraustreten aus ihm in eine zeitweilige Sphäre von Aktivität mit einer eigenen Tendenz.“[33] Spiel muss aber nicht immer gleichbedeutend mit Spaß sein: Ob ein Spiel Spaß macht oder ernsthaft betrieben wird, ist von außen nicht immer klar ersichtlich und kann auch während des Spiels wechseln. Ein gewisser Ernst ist aber unabdingbar, damit die Illusionswelt des Spiels bzw. ihre Scheinhaftigkeit aufrechterhalten wird. „So ist die Freiheit vom Triebdruck und Zwecken zugleich eine Freiheit vom Zwange der Realität, und die Freiheit zur Hingabe an eine Scheinwelt ist identisch mit der […] Freiheit zur Hingabe an Wirkungen von ‚innerer Unendlichkeit’. Der eine Gedanke ist die Kehrseite des anderen.“[34]
d) „Moment der Ambivalenz“: Nach Scheuerl ist die Offenheit des Spielausgangs, also dass die konkurrierenden Kräfte der Spieler nicht von vornherein genau festgelegt sind, sondern in einem Zwischenraum hin- und herpendeln können, unabdingbar für die Spannung im Spiel, da bei einer zu großen Einseitigkeit (beispielsweise, dass die Gegner sich in ihrer Stärke beträchtlich unterscheiden) schnell Langeweile entstehen kann. Mit diesem Moment der Ambivalenz bezieht sich Scheuerl auf Frederik J.J. Buytendijks und Helmut Plessners „Sich-halten im ‚Zwischen’ in jeglicher Hinsicht“[35]. Dieses „Zwischen steht zwischen der Scheinhaftigkeit des Spiels und der Wirklichkeit, die immer wieder ins Spiel hineinwirkt. Zudem sollte dieser Schein nicht mit äußeren Zwecken verbunden werden, da man sonst in den Bereich des Falschspielers, des Betrugs gelangt, da die Scheinhaftigkeit des Spiels und seine Ambivalenz nur noch zum Schein gewahrt wird und die Wirklichkeit (hier aufgrund der materiellen Zwecke) eine zu große Priorität erlangt.[36]
e) Moment der Geschlossenheit: Jedes Spiel benötigt einen Spielplatz und Spielregeln. Hierzu schreibt J. Huizinga: „Das Spiel sondert sich vom gewöhnlichen Leben durch seinen Platz und seine Dauer. Seine Abgeschlossenheit und Begrenztheit bildet sein drittes Kennzeichen.“[37] „Jedes Spiel spielt sich immer im Rahmen genau festgelegter Grenzen von Zeit und Raum ab […] innerhalb seines Spielraums, seines Spielplatzes, der materiell oder nur ideell, absichtlich oder wie selbstverständlich, im voraus abgesteckt worden ist.“[38] Neben dem Kinderspielplatz und Fußballplatz gibt es noch ganz andere (Spiel-) Plätze, z.B. die Arena, der Gerichtshof oder der Bundestag, sie alle haben die Funktion eines „geweihten Bodens“, abgesondert, in sich geschlossen und mit eigenen Regeln versehen. „Innerhalb des Spielplatzes herrscht eine eigene und unbedingte Ordnung. […] Es schafft Ordnung, ja es ist Ordnung. In die unvollkommene Welt und in das verworrene Leben bringt es eine zeitweilige begrenzte Vollkommenheit.“[39] Diese Ordnung ist ebenfalls grundlegend, denn die kleinste Abweichung kann das Spiel zerstören bzw. es verderben. Aus diesem Grund wurden Spielverderber schon immer härter bestraft und missachtet als Falschspieler, da der Falschspieler die Spielregeln wenigstens noch zum Schein erhält und somit die ‚Heiligkeit’ des Spiels wahrt. Im Zusammenwirken von Regeln und Glück bzw. Zufall entsteht auch die Spannung. Die Regeln beziehen sich grundlegend auf die Rahmenbedingungen des Spiels (beispielsweise die Teilnehmerzahl, erlaubte Spielhandlungen oder Spieldauer), sie sollen den Zufall im Spiel regeln. Der Zufall ist dabei entscheidend für die Spannung, da niemand wissen kann, wer Glück hat und wer nicht. Aber ohne Regeln würde auch keine Spannung entstehen, da das Spiel nur noch vom Zufall abhängig wäre und die Berechnungen bzw. Handlungen der Spieler (ihre eigentliche Aktivität) keinen Sinn mehr ergeben würde.[40]
f) „Moment der Gegenwärtigkeit“: Dies betrifft die Zeitstruktur des Spiels, also wie die Zeit von Spielern und Zuschauern erlebt wird. Da das Spiel spannungsreich und folglich undeterminiert sein muss, müssen auch die Spielhandlungen bzw. Spielbewegungen einen kurzfristigen Charakter haben. Die Wirkungen der Spielhandlungen müssen relativ schnell absehbar sein, ebenso wie genügend Raum für überraschende Wechsel und Wendungen gegeben sein muss. Keine Spielphase darf die folgende Spielphase eindeutig determinieren. Erst diese kurzfristigen und wechselhaften Spielbewegungen haben die Eigenschaft, den Spieler und seine Aufmerksamkeit völlig in Beschlag zu nehmen und werden als „zeitlose Gegenwärtigkeit“[41], als „ein gegenwärtiges, in sich unendliches Spielen von Wirkungen, denen man sich zeitenthoben hingibt“[42], erlebt.
Als grundlegende Funktion des menschlichen Spiels nennt J. Huizinga zwei Aspekte: „Das Spiel ist ein Kampf um etwas oder eine Darstellung von etwas. Diese beiden Funktionen können sich auch vereinigen, in der Weise, dass das Spiel einen Kampf um etwas ‚darstellt’, oder aber ein Wettstreit darum ist, wer etwas am besten wiedergeben kann.“[43] Nach Werner Paul Mayer[44] scheinen alle sechs phänomenologischen Wesensbestimmungen des Spiels auch auf das Computerspiel zuzutreffen. Im Rahmen dieser Arbeit und insbesondere anhand der empirischen Auswertung soll aber noch geklärt werden, inwieweit diese Momente zutreffen bzw. inwieweit sie vom Computer modifiziert werden.
Anzumerken ist noch, dass jedes Spiel grundsätzlich wiederholbar ist. „Das Spiel nimmt sogleich feste Gestalt als Kulturform an. Wenn es einmal gespielt worden ist, bleibt es als geistige Schöpfung oder als geistiger Schatz in der Erinnerung haften, es wird überliefert und kann jederzeit wiederholt werden […].“[45] Die Wiederholbarkeit und die zuvor angesprochene Geschlossenheit ist aber nicht nur auf zeitliche und räumliche Strukturen bezogen, sondern auch auf die Geschlossenheit der Gruppe und die Wiederholbarkeit ihrer Zusammenkünfte, für die bestimmte Spiele Erkennungszeichen sind und auf diese Weise verdeutlichen, wer dazu gehört und wer nicht. „Die [vorübergehende] Spielgemeinschaft hat allgemein die Neigung, eine dauernde zu werden, auch nachdem das Spiel abgelaufen ist. […] Das Gefühl aber, sich gemeinsam in einer Ausnahmestellung zu befinden, zusammen sich von den anderen abzusondern und sich den allgemeinen Normen zu entziehen, behält seinen Zauber über die Dauer des einzelnen Spiels hinaus. Der Klub gehört zum Spiel wie der Hut zum Kopf.“[46] Zudem umgibt sich ein Spiel gern mit einem Geheimnis, dass nur der Spielgemeinschaft vorbehalten ist. Die Absonderung von den Gesetzen und Gebräuchen des normalen Lebens zeigt sich daran, ebenso wie an gewissen Verkleidungen und Maskierungen. Man denke nur an die speziellen Fußballtrikots.
Zusammenfassend kann man in Anlehnung an Gregory Bateson sagen, dass das Spiel „[…] weniger eine spezifische Tätigkeit [meint], denn einen Handlungsrahmen, der markiert, dass für die Geschehnisse innerhalb dieses Rahmens die alltagsweltliche Handlungsverstärkung außer Kraft gesetzt ist.“[47]
2.4. Die virtuelle Welt
Der technische Generator dieser Welt ist der Computer, der sich wiederum aus den zwei Komponenten „Hardware“ und „Software“ zusammensetzt. Nur dieser Verbund schafft das, was Achim Bühl eine „universale Maschine“[48] nennt und vielfach als analoge Verkörperung des formalen Modells einer „Turingmaschine“[49] gesehen wird, da der Computer im Prinzip alles simulieren kann, was auch berechenbar ist und sich der Mensch vorstellen kann.[50]
Im „Lexikon zur Soziologie“ findet sich unter dem Begriff „Simulation“: „dynamisches Modell eines Gegenstandsbereiches, insbesondere des zeitabhängigen Verhaltens von Systemen, wobei in einer analogen Abbildung […] reale Vorgänge nachgeahmt werden. Das Modell kann allerdings nur einen Teil der realen Eigenschaften und des realen Verhaltens repräsentieren, so dass stets geprüft werden muss, inwieweit die Ergebnisse der Simulation auf die Realität übertragen werden können.“[51] Prinzipiell ist auch eine direkte Simulation der realen Welt mit Hilfe des Computers unmöglich. Die Gegebenheiten der realen Welt müssen immer in die Programmsprache des Computers umgewandelt werden. Von daher durchläuft jede Simulation zumindest die mentale Welt des Programmierers und in diese Denkarbeit fließt zwangsläufig Imaginäres ein, da die reale Welt nicht nach einer formalisierten Programmiersprache aufgebaut wurde. „It is important to note, that at the very heart of successful simulation there must be unreality, if it were possible to deal with reality itself, there would be no need for simulation. […] to simulate is to attain the essence of, without reality […].”[52] Von daher geht es der Simulation nicht um eine äußerlich möglichst naturgetreue Nachahmung, sondern eben um die Essenz des Nachgebildeten.
Die Hardware auf der einen Seite stellt nun die technisch-materiale Grundlage dar. Sie umfasst neben dem Prozessor (also die elementaren Schaltkreise, die das Zentrum der Berechnungen darstellen), die Speichermedien (z.B. Festplatten, Disketten usw.), sowie Ein- und Ausgabegeräte (z.B. Joystick, Maus und Tastatur als Eingabe- und Monitor, Drucker, Lautsprecher als Ausgabegeräte)[53].
Die Hardware selbst ist nur im Binärcode programmierbar, d.h. der Prozessor bzw. die Schaltkreise kennen nur die Zustände „es fließt Strom“ und „es fließt kein Strom“ bzw. „geschlossen“ und „offen“, also „1“ und „0“. Müsste nun jede Hardware direkt mit diesem Binärcode programmiert werden, also mit langen oder sehr langen Zahlenfolgen von Nullen und Einsen, so wäre der Computer bestimmt nicht zu einem bedeutendem Hilfsmittel der Menschen avanciert.
Dies konnte nur mit Hilfe der Software auf der anderen Seite geschehen. Unter Software kann man allgemein Programme bzw. Befehlsabfolgen verstehen, die der Hardware sagen, was sie zu berechnen hat. Die erste notwendige Softwareebene eines Computers ist ein Programm, das die unhandlichen Binärketten in kompakte und verständliche Befehle umwandelt. Hierauf aufbauend folgt, je nach technologischem Entwicklungsstand, ein wahrhafter Turm von Softwareebenen mit Hilfsprogrammen (z.B. grafische Benutzeroberflächen, automatisierte Steuerungs- und Schutzprogramme), Anwendungsprogrammen und natürlich auch Computerspiele. „Wir wären außerstande, auf Hardware auch nur zu referieren, ohne sie immer schon in Software zu verwandeln.“[54] „Die Hardware [ist] eine Struktur eigenen Rechts, die der Software ihre Bedingungen stellt und ihr auch deutliche Grenzen setzt.“[55]
Formalisierbarkeit und Kalkulierbarkeit sind die beiden Grundmerkmale jeder Computersimulation und auch des Computers selbst.[56] So betont Peter Berger, dass die Entwicklung des Computers „[…] aufs engste mit der Rationalisierung in Industrie und Gesellschaft sowie mit der Geschichte des modernen Krieges verbunden ist, er ein genuines Produkt der Moderne darstellt.“[57] Die Hardware, die Software ebenso wie die Handhabung des Computers, unterliegen den Regeln der formalen Logik und dem Grundprinzip der modernen Mathematik.[58] Daher muss sich auch der Nutzer den Bedingungen anpassen und „[…] wird sich nach und nach an die Beschränktheit der Ausdrucksformen gewöhnen, die sein Computer erfordert, und entwöhnt sich womöglich der differenzierten Ausdrucksformen, die in lebendiger Sprache selbstverständlich sind. […] Nun muss ich natürlich einräumen, dass dieser Denkstil nicht erst mit dem Computer Einzug gehalten hat, sondern im Grunde genau jene analytische Rationalität ausmacht, die für die neuzeitliche Wissenschaft überhaupt charakteristisch ist; es ist ja auch kein Zufall, dass Computer auf einer formalisierten Logik beruhen, die schon in den antiken Anfängen der abendländischen Rationalität vorgeprägt worden war.“[59] Ludwig Wittgenstein beschrieb dies treffend: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“[60] und wenn nun auch die Kommunikation zwischen Menschen immer mehr über das Medium Computer abläuft, so ist eine wichtige Frage, inwieweit sie durch dessen formal-logisches Grundprinzip kanalisiert wird. „Die in der realen Welt verankerte EDV-Technologie trägt die Gefahr in sich, ihre virtuelle Form als Muster für die Wahrnehmung der realen Welt auszubilden. Die Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit, die dem Virtuellen zueigen ist, könnte sowohl zu einem Muster im Umgang mit realen Menschen werden als auch zu einem Schema für die Beurteilung des Krieges in der realen Welt.“[61]
Da der Verbund aus Hardware und Software im Prinzip jede andere Maschine simulieren kann, kann man den Computer, im Sinne Achim Bühls, als „universale Maschine“ verstehen. Voraussetzung dafür ist natürlich ein „[…] adäquates Programm, welches das Wesen der zu simulierenden Maschine erfasst.“[62]
Der Computer stellt einerseits ein „multifunktionales Werkzeug“[63], in der Tradition der Wissenswerkzeuge wie Schreibstift, Tafel, Bilder, Speichermedien, Rechen- und Messhilfen dar. „Computer sind technische Systeme der Informationsverarbeitung (Rechnen, Steuern, Planen, Textverarbeiten, Schlussfolgern u.ä.), die gegebene Zeichenfolgen nach ebenfalls gegebenen Regeln in andere Zeichenfolgen verwandeln […]. Gegenüber herkömmlichen informationstechnischen Geräten (z.B. Uhr, Schreibmaschine, Rechenmaschine) zeichnen sich Computer durch Universalität und freie Programmierbarkeit, durch eine immense Steigerung von Leistung und Arbeitsgeschwindigkeit sowie durch die Selbsttätigkeit der Arbeitsabläufe aus […].“[64] Natürlich lassen sich mit dem Computer und entsprechender Hardware (z.B. Greifarme, Laufrollen usw.) auch andere Werkzeuge simulieren bis hin zu menschenähnlichen Robotern. Auch als Medium kann er fungieren: „Der Computer ist in der Lage, wie etwa das World Wide Web belegt, neue Medien zu erzeugen, welche die Medienlandschaft tiefgreifend verändern.“[65]
Andererseits ist er aber auch mehr als ein Werkzeug in dem Sinne, dass wir mit ihm nur das effizienter ausführen, was wir im Prinzip auch ohne Computer könnten, sondern er eröffnet uns auch Möglichkeiten, die wir ohne Computer nicht hätten.[66] Man denke beispielsweise an neuere naturwissenschaftliche Forschungen, die sich in Sphären bewegen, die wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht mehr erfassen können, oder auch an computergenerierte Welten, in denen wir interagieren, sprich die „Virtual Reality“. „Der Rechner als virtuelle Maschine ist dazu in der Lage, begehbare Entwicklungsumgebungen zu schaffen, d.h. Wirklichkeitsstrukturen zu doppeln […], das Sein in Realität und Virtualität zu duplizieren.“[67] Dabei wird die Hardware mit Hilfe der Software so konfiguriert bzw. programmiert, dass sie einen abgegrenzten (virtuellen) Raum mitsamt seinen internen Gesetzmäßigkeiten schafft. Dieser neu geschaffene „Raum“, wo vorher keiner war, ist das entscheidend Neue und hierauf verweisen auch Ausdrücke wie „Cyberspace“ oder „Virtual Reality“. „Während die Trennung von Transport und Kommunikation einen Markstein in der Entwicklung moderner Kommunikations- und Informationstechnologien darstellte – die Erfindung des Telegrafen bedeutete, dass Nachrichten nicht länger persönlich überbracht werden mussten -, scheint der Cyberspace diese Entwicklung noch weiter zu treiben. Manche Umgebungen und Erfahrungen können bereits jenseits von physischer Anwesenheit geteilt werden. Die Telepräsenz, in der Arbeiter sich gegenseitig sehen und ‚zusammenarbeiten’ können, obwohl sie geographisch voneinander getrennt sind, kann hier als simpler Vorbote gelten. Televirtualität ist das Stadium, in dem die Settings selbst ‚virtuell’ werden und die Teilnehmer in computergenerierten Umgebungen interagieren.“[68] Georg Simmel ging zu seiner Zeit noch von einem einzigen allgemeinen Raum aus, „von dem alle einzelnen Räume Stücke sind“[69]. Diese Beschränkung wird nun angesichts virtueller Räume weitgehend aufgehoben. „Solche ‚virtuellen’ Räume überwinden damit zweierlei: die Eigenschaft des Raumes, nicht vermehrbar zu sein und erzeugen einen Ort, an dem soziale Prozesse möglich werden und der hinsichtlich seiner Erreichbarkeit für alle Akteure die gleiche Entfernung besitzt.“[70] Nach Simmel wird der Raum erst durch die Wechselwirkung zwischen den in einer sozialen Beziehung Stehenden belebt und erfüllt. Diese sozialen Prozesse finden auch in analoger Weise in virtuellen Welten statt (insbesondere im Internet). Vielfach wird auch von einer Enträumlichung und Entzeitlichung gesprochen[71], doch kann dies nur eingeschränkt gelten: es werden zwar räumliche Trennungen mithilfe der neuen Kommunikationsmedien in Sekundenbruchteilen überwindbar; so kann man beispielsweise von seinem heimischen Schreibtisch aus per Online-Shopping einkaufen und muss nur noch die Ware an der Haustür entgegennehmen. Dies gilt aber nur für den Kunden, der Vertrieb, der Transport der Ware ist immer noch an reale und konkrete Orte gebunden. Es entwickelt sich vielmehr eine immer engere Verknüpfung zwischen realer und virtueller Welt (und natürlich auch der medialen Welt). „Man denke nur an Formen der Virtualität bei der Kriegsführung, im Zahlungsverkehr oder an der Börse.“[72]
Aus dem Gesagten folgt in den Worten Siegfried J. Schmidts: „Während in einer reinen Schriftkultur die Referenz von Zeichen auf außersprachliche Gegenstände fraglos unterstellt wird, gerät in Kulturen, die über audiovisuelle Simulationsmöglichkeiten verfügen, die ontologische Frage: ‚Was ist wirklich?’ in eine schwer kontrollierbare Bewegung. Längst sind virtuelle Realitäten neben die Erfahrungswirklichkeiten getreten, längst sind ganz unterschiedliche Modi der Realitätsvergewisserung und Wahrheitskontrolle an die Stelle des naiven Vertrauens in Bild und Wort getreten.“[73]
In einem kurzen Essay zeigt Florian Rötzer[74] die Entwicklungsrichtungen der virtuellen Welt auf. So geht das Versprechen der Virtual Reality – Technologie „[…] dahin, nicht nur in eine ganz und gar künstliche Szene oder einen räumlich weit entfernten bzw. unzugänglichen Ort einzutauchen und das Gefühl erhalten zu können, dort ganz gegenwärtig zu sein, sondern in der virtuellen Welt auch in einem beliebigen virtuellen Körper für die anderen, die an das vernetzte System angeschlossen sind, erscheinen und vielleicht auch mit diesen in körperliche Interaktionen bis hin zum Cybersex treten zu können.“[75] Aus diesem kurzen Zitat lassen sich zwei Entwicklungsrichtungen ableiten, die auch für jedes Computerspiel charakteristisch sind: „Einerseits geht es darum, den Menschen mit seinem Körper bzw. mit Teilen seines Körpers in den virtuellen Raum hinein zunehmen, was auch heißt, ihn immer mehr zum integrativen Bestandteil eines Mensch-Computer-Systems zu machen, er mithin zu einer Art Cyborg wird, und andererseits darum, die maschinellen Extensionen aus der direkten Steuerung durch den Menschen zu entlassen. Letzteres, also die Entwicklung von intelligenten, autonomen Robotern oder virtuellen Akteuren, die sensomotorisch mit ihrer Umwelt verbunden sind […]“[76] Dies ist aber bei den heutigen Heim-Computern noch Zukunftsmusik.
Man agiert für gewöhnlich nur mit den Händen, sehr selten auch mit den Füssen in Form von Pedalen und nimmt das Geschehen auf dem Bildschirm audiovisuell wahr, gelegentlich gibt es auch Joysticks, die bei gewissen virtuellen Geschehnissen vibrieren, also den Tastsinn ansprechen. Hinzuzufügen wäre noch das Head-Set[77], das sowohl als Ein- wie als Ausgabegerät dient, mit ihm können sich die Nutzer der virtuellen Welt über eine spezielle Software unterhalten, also telefonieren. Mit Hilfe einer digitalen Kamera können sich die Gesprächspartner zusätzlich visuell wahrnehmen. Alle anderen Technologien, wie Ganzkörperanzüge für die Dateneingabe oder Computer mit akustischer Spracherkennung usw. sind für den standardgemäßen Hausgebrauch im Jahre 2007 noch nicht erschwinglich. Auf der anderen Seite haben wir die virtuellen Akteure[78], diese lassen sich unterscheiden in „Avatare“[79], also dem virtuellen Stellvertreter einer Person in der virtuellen Welt und in „Bots“[80], Akteure die von einem Computerprogramm aus gesteuert werden, also mit vorgegebenen Programmroutinen und daher begrenzten Handlungsmöglichkeiten.[81]
Zusammenfassend kann man sagen, dass die virtuelle Welt bei heutigem technologischem Stand ein Abstraktum ist. Es gibt keine einzige virtuelle Welt, sondern vielmehr abgetrennte und mit eigenen Regeln versehene virtuelle Subwelten bzw. Räume. Die virtuelle Welt selbst besteht derzeit nur unter dem Aspekt, dass die virtuellen Räume in ihrer Gesamtheit den Grundbedingungen des Computers, d.h. der Hardware und Software unterliegen. Jeder virtuelle Raum[82], d.h. jedes Softwareprogramm, das die Rahmenbedingungen schafft, unterliegt den Bedingungen der formalisierten (logischen) Programmiersprache und dem grundlegenden Binärcode der Hardware. Die virtuelle Welt selbst bzw. die Virtual Reality[83] ist eine mit Hilfe von Computern generierte interaktive Simulation verschiedener Aspekte eines Raumes ist, sozusagen eine synthetische Umgebung, in der fiktionale virtuelle Subwelten bzw. Räume sinnlich exploriert werden können.
2.5. Die virtuelle Spielwelt
In Anlehnung an J. Huizingas Definition können virtuelle Räume auch als Spielplätze betrachtet werden: „Jedes Spiel bewegt sich innerhalb seines Spielraums, seines Spielplatzes, der materiell oder nur ideell, absichtlich oder wie selbstverständlich, im voraus abgesteckt worden ist […], d.h. geweihter Boden, abgesondertes, umzäuntes, geheiligtes Gebiet, in dem besondere eigene Regeln gelten […], zeitweilige Welten innerhalb der gewöhnlichen Welt, die zur Ausführung einer in sich abgeschlossenen Handlung dienen. Innerhalb des Spielplatzes herrscht eine eigene und unbedingte Ordnung […], (es) bringt eine zeitweilige begrenzte Vollkommenheit.“[84] Diese Definition gilt im Grunde für jede Software, jedes Anwendungsprogramm und jedes Computerspiel. Zentral für virtuelle Räume bzw. Spielplätze ist der Aspekt der Vollkommenheit, und dass sie im vor aus abgesteckt worden sind. Der oder die Software-Programmierer haben die Aufgabe dies zu gewährleisten, denn ein virtueller Raum, der nicht vollständig abgesteckt und mit Gesetzen durchzogen wurde, gewährt einem Nutzer entweder keinen Einlass, oder das Programm „wirft“ einen an den fehlerhaften Stellen wieder heraus. „Computerabstürze“, „fehlerhafte Programme“ und „Fehlerbereinigende Updates“ sind heute geläufige Begriffe, die die Schwierigkeit der Programmierarbeit zeigen. Joseph Weizenbaum sagt: „Der Programmierer ist der Schöpfer von Universen, deren alleiniger Gesetzgeber er ist.“[85] Auf inhaltlicher Ebene gibt es in den diversen virtuellen Räumen auch die verschiedensten Gesetzmäßigkeiten und Regeln, während auf formaler Ebene alle der Logik der Programmiersprachen folgen müssen.
J. Weizenbaum und F. Rötzer gehen sogar so weit, den Computer selbst als einen Spielplatz zu bezeichnen: „Ein Computer, der nach einem gespeicherten Programm abläuft, ist also auf die gleiche Weise von der realen Welt losgelöst wie jedes abstrakte Spiel. Ebenso wie das Schachbrett, seine zweiunddreißig Figuren und die Regeln eine Welt für sich bilden, so gilt dies auch für ein Computersystem und seiner Betriebsanleitung. […] Der Computer ist also ein Spielplatz, auf dem jedes erdenkliche Spiel möglich ist. […] Dafür braucht man nur zu wissen, was man direkt aus der Betriebsanleitung des Computersystems ableiten oder was man aufgrund der eigenen Phantasie konstruieren kann.“[86] Doch nach meiner Auffassung wirft man ein falsches Licht auf den Computer, wenn man ihn lediglich als Spielplatz begreift – er kann zum Spielen verwendet, kann aber auch zum Nicht-Spielen verwendet werden und reale Auswirkungen auf Andere haben. Wenn ein Computerprogramm eine vollbesetzte Passagiermaschine lenkt oder einen Kernkraftreaktor überwacht, dann ist dies kein Spiel mehr. Das Problem liegt vielmehr darin, dass „die Scheidelinien, welche Erscheinungsformen der Virtualität eine Grenzfläche zur Spielwelt und welche eine zur realen Welt bilden, verschwimmen.“[87] So werden beispielsweise Kampfpiloten an computerspielähnlichen Simulatoren ausgebildet[88], und computerspielähnliche Programme werden zur psychologischen Therapie und Forschung eingesetzt. Florian Rötzer meint, dass sich unser Verständnis zum Spiel verändert hat, da wir nicht mehr nur Schach, Fußball oder Skat als Spiel verstehen, sondern auch komplexe Systemsimulationen auf dem Computer.[89] Auf der anderen Seite „haben auch die militärischen Manöver immer mehr das Aussehen von elektronischen Spielen angenommen, von Kriegsspielen, die riesige Gebiete übergreifen, auf denen alle erdenklichen Prozeduren mittels der verschiedensten Apparaturen des modernen Kampfes durchgespielt werden.“[90] Bei den gesendeten Aufnahmen zum Luftbombardement auf Bagdad im Golfkrieg 1991 (z.B. die Videobilder eines Raketenanflugs auf den Schacht einer Klimaanlage) fühlten sich dann viele Zuschauer auch an ein Computerspiel erinnert.[91]
Hieraus folgt auch, dass man es innerhalb der virtuellen Welt sowohl mit einer virtuellen Spielwelt sowie mit einer virtuellen Nicht-Spielwelt zu tun hat. Die virtuelle Spielwelt vereinigt zwei Welten: die Spielwelt und die virtuelle Welt. Die virtuelle Nicht-Spielwelt zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Wesensmomente des Spiels in irgendeiner Weise missachtet. Doch damit sind noch nicht alle Unklarheiten beseitigt: wenn Computerspiele unter anderem zur Ausbildung eingesetzt werden und Menschen ihren alltäglichen Lebensunterhalt bestreiten, indem sie Computerspiele nutzen bzw. testen, so kommt man nicht umhin, auch den Nutzungskontext der jeweiligen Person zu betrachten.
Da die virtuelle Welt eine enorme Vielfalt an virtuellen Räumen bietet, von denen einige Spielplätze sind, andere wiederum nicht, werden hier als „Computerspiele“ bzw. „virtuelle Spielplätze“ solche Computerprogramme bezeichnet, die von ihrer ursprünglichen Programmierung her als Spiel geplant waren und auch wirtschaftlich als Computerspiel vertrieben werden. Ihre Programmgestaltung darf nicht direkt auf einen spezifischen Ausschnitt der realen Welt verweisen. Eine indirekte Verweisung ist aber nicht zu vermeiden: so zielen im Prinzip die meisten aktuellen Computerspiel auch auf reale Taktiken der Produktion und Vermarktung.
Wenn man jetzt das Computerspiel selbst betrachtet, also seine Struktur so fallen in Anlehnung an Jürgen Fritz vier Kennzeichen bzw. Strukturelemente auf, die sich in einem „Strukturmodell für Computerspiele“ wie folgt präsentieren:
Abbildung 1: „Strukturmodell für Computerspiele“ [92]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
a) Das Erste was man von einem Computerspiel wahrnimmt, ist die „Präsentation“ bzw. die „Oberflächenstruktur“: Hierunter versteht man, neben der Aufmachung der Verpackung und des beigelegten Regelhandbuchs[93], einerseits die Grafik des virtuellen Spiels (Ist es ein 2D- oder ein 3D-Spiel? Welche Qualität haben die unbewegten Bilder und die Animationen? Wie differenziert sind die Farbnuancen? Läuft das Spielgeschehen flüssig ab oder gibt es immer wieder spiel- bzw. technischbedingte Verzögerungen im Ablauf?) und den Sound (Welche Qualität haben die Tonausgaben bei Spieleffekten? Gibt es eine Sprachausgabe und wie gut ist sie nachgeahmt? Wie passend und abwechslungsreich ist die Hintergrundmusik?), andererseits die Spielsteuerung, das „Handling des Spiels“ (Wie präzise werden die Bewegungseingaben des Spielers im Spielgeschehen ausgeführt? Welche Form haben die Einwirkungsmöglichkeiten und wie vielfältig sind sie?).
b) Zu jedem Computerspiel gehört zweitens ein „Inhalt“ bzw. eine „Symbolstruktur“, die den Bedeutungsgehalt des Spiels ausmacht: Dieser umfasst in der Regel eine Spielgeschichte (die Hintergrundstory bzw. Rahmenhandlung) mit ihren Spielfiguren (den Haupt- und Nebendarstellern bzw. Widersachern). Es gibt immer ein Thema, in jedem Spiel geht es um etwas: man muss ein Fußballspiel gewinnen, eine Weltraumschlacht überleben, eine Prinzessin vor einem Drachen beschützen und vieles mehr. Auf die Thematik bzw. die Spielgeschichte wird meist in einer Vorgeschichte hingewiesen, oder man kann sie der beigelegten Anleitung entnehmen. Ebenso haben die virtuellen Figuren im Spiel meist eine Bedeutung, einen Sinn, warum sie da sind. Auch der Spieler selbst übernimmt meist einen virtuellen Akteur: den Hauptdarsteller. In manch anderen Spielen dagegen schlüpft der Spieler gleich in die Rolle eines außerhalb des eigentlichen Spielablaufs stehenden „Halbgottes“, so etwa bei Strategiespielen, wo er mit Hilfe eines „mächtigen“ Mauszeigers hunderte von Untertanen ohne Widerrede umherschicken kann. Damit der Spieler in seine Rolle auch „richtig eintauchen“ kann, sollte zudem der Spielraum entsprechend gestaltet sein, also die Objekte, die man vorfindet, sollten auch in irgendeiner Weise zur Spielgeschichte passen. Ein Spiel beispielsweise, bei dem man in die geschichtliche Rolle von Friedrich dem Großen schlüpft, würde es der Spielgeschichte doch sehr zuwiderlaufen, wenn motorisierte Fahrzeuge und Omnibusse umherfahren würden. Eine weitere Frage kann auch sein, ob es einen Bezug zur medialen Welt gibt, also zu Buch- und Filmvorlagen.
c) Direkt mit dem Inhalt verbunden sind die „Regeln“ bzw. die „Regelstruktur“, aus der sich die Möglichkeiten des Computerspiels ergeben: Zuerst legen die Regeln meistens ein Spielziel fest, d.h. eine Hauptaufgabe muss oder viele Nebenaufgaben müssen erfolgreich gelöst werden. Es gibt aber auch Spiele, die kein Spielziel haben und somit im Prinzip auch kein Spielende. Hier liegt die Faszination nur im Spiel selbst und nicht im Lösen des Spiels. Sodann determinieren die Regeln den gesamten Spielablauf, sie sind die Gesetzmäßigkeiten, nach denen diese „Welt“, dieser virtuelle Spielplatz funktioniert. Grundsätzlich sollten die Regeln logisch, abgerundet und verständlich sein, also nachvollziehbar. Beispielsweise macht bei dem Spiel „Counter-Strike“, einem „Ego-Shooter“, einen Großteil der Faszination die abgestimmten und vielleicht auch teilweise realistisch simulierten Regeln aus. So wird heutzutage in Anlehnung an die reale bzw. an die mediale Welt förmlich erwartet, dass eine einfache Pistole nicht so schnell und oft hintereinander schießt wie etwa ein vollautomatisches Gewehr. Die Regeln des Spiels können also auch nicht (wenigstens nicht ohne vorherige Ankündigung und genaue Einführung) beliebig sein. Die ersten Referenten sind meist die reale Welt oder die mediale Welt, natürlich mit einem Umweg über die mentale Welt des Programmierers bzw. der Programmierer. Bei vielen Spielen gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Teil der Spielregeln nach eigenem Ermessen abzuändern und so seine eigenen Herausforderungen zu schaffen. Aus der Beschaffenheit der Regelstruktur resultieren auch die prinzipiellen Handlungsmöglichkeiten, die dem Spieler zur Verfügung stehen, wann er sie einsetzen kann und welche Auswirkungen sie auf das Spielgeschehen haben.
d) Aus dem Zusammenwirken dieser drei Strukturelemente entsteht in Verbindung mit den Erwartungen und Lebenshintergründen des Spielers das vierte Strukturelement: die Dynamik, also die Struktur der Antriebskräfte des Spiels. Hierunter versteht J. Fritz ein dem „[…] Spiel innewohnender Reiz […], das im Spiel vorhandene Potential zu entfalten.“[94] Das Potential liegt ohne Frage innerhalb des Computerspiels, aber es liegt am Spieler, ob er dieses auch entfaltet bzw. ausschöpfen kann. Die Dynamik selbst lässt sich nochmals in drei Unterdynamiken gliedern: Da wäre als erstes die Regeldynamik, nicht zu verwechseln mit der Regelstruktur. Sie bezieht sich auf Aspekte wie Spielspannung und Abwechslungsreichtum, Komplexität und Schwierigkeitsgrad des Spiels, Witz und Überraschungen sowie die Art des Spieleinstiegs (Wie leicht erlernt man das Spiel, gibt es Einführungslevels?). Zweitens die Psychodynamik des Spiels, worunter J. Fritz einen metaphorischer Bezug versteht, der die Ähnlichkeit einzelner Spielaspekte mit Situationen und Hintergründe der jeweiligen Spieler beschreibt. So würde beispielsweise ein begeisterter Fußballspieler in der realen Welt auch eher von einem virtuellen Fußballspiel angesprochen werden, als Jemand den Fußball in der realen Welt nicht interessiert. Die Soziodynamik ist die dritte Unterdynamik. Mit ihr wird ebenfalls ein metaphorischer Bezug verstanden, diesmal aber die Widerspiegelung der jeweiligen Grundmuster des Computerspiels von Grundmustern unserer Gesellschaft bzw. Kultur. J. Fritz nennt als die drei großen Grundmuster, die in prinzipiell jedem Computerspiel angesprochen werden und die auch in unserer Gesellschaft zentral sind: „Macht, Kontrolle und Herrschaft“[95].
Anhand dieser Strukturelemente kann man differenziert ermitteln, was ein Computerspiel anzubieten hat und nach welchen Kriterien es aufgebaut ist. Aber jedes Angebot benötigt auch eine Nachfrage und dementsprechend müssen die jeweiligen Computerspiele den vielfältigen Erwartungen der Spieler gerecht werden. Damit sich Angebot der Computerspiele und Nachfrage der Spieler treffen, muss gewährleistet sein, dass die Spieler entsprechend in der virtuellen Welt agieren können und der Computer auch in irgendeiner Weise darauf reagiert. Während die Präsentation, der Inhalt und die Regeln, die äußere Gestaltung des jeweiligen Computerspiels betreffen, bezieht sich die Dynamik bereits auf die innere Gestaltung der Mensch-Computer-Interaktion, denn nur in diesem Prozess kann sie sich entfalten bzw. überhaupt erst festgelegt werden.
3. Interaktions- und Kommunikationsformen beim Computerspiel
Im „Lexikon zur Soziologie“ findet man unter Interaktion: „Die wechselseitige Beeinflussung des Verhaltens von Individuen oder Gruppen.“[96] Sodann liest man, dass Karl Dieter Opp von „Interaktion“ spricht: „[…] wenn die Aktivität einer Person die Aktivität einer anderen Person auslöst.“[97] An beiden Kurzdefinitionen erkennt man, dass für eine Interaktion mindestens zwei Personen bzw. Individuen notwendig sind. Betrachtet man weiter die Definition für eine soziale Interaktion, so ist sie, „[…] die durch Kommunikation (Sprache, […] Gesten usw.) vermittelten wechselseitigen Beziehungen zwischen Personen und Gruppen und die daraus resultierende wechselseitige Beeinflussung ihrer Einstellungen, Erwartungen und Handlungen.“[98] Dieser handlungstheoretische Interaktionsbegriff unterscheidet sich von den beiden anderen Interaktionsbegriffen dadurch, dass eine Fokussierung auf die Kommunikationsprozesse stattfindet, über die die „Individuen einander den ‚gemeinten Sinn’ ihrer Handlung vermitteln“[99]. Bei einer Mensch-Computer-Interaktion, beispielsweise bei einem Spiel gegen einen computergesteuerten Spielpartner, kann man schwerlich von einer beiderseitigen Sinnübermittlung sprechen. Das Computerspiel verfügt nur über das Sinnpotential, dass die Programmierer bzw. Entwickler bei seiner Erstellung hineinlegten. Dabei ist es aber ungewiss, ob die Spieler eben diesen Sinn auch für sich herausinterpretieren und von einer direkten Wechselseitigkeit kann auch keine Rede sein. Noch problematischer wird es, wenn man von einer Sinnmitteilung des Spielers an das Computerprogramm sprechen will, da dem Spieler nur vordefinierte Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, deren Sinn im Prinzip auch die Entwickler bzw. Programmierer hineinlegten. Ohne diesen Aspekt weiter philosophisch zu vertiefen, ersieht man an dem Gesagten zweierlei: Einerseits, dass die Mensch-Computer-Interaktion begrenzt ist und nur als Analogie zu verstehen ist und andererseits, dass eine Interaktion im ursprünglichen Sinne, hier verstanden als soziale Interaktion, den Menschen vorbehalten bleibt. Auch der Begriff der Kommunikation soll im folgendem auf zwischenmenschliche Interaktionen beschränkt bleiben.
Aus Sicht eines Computerspielers lassen sich daher zwei Interaktionsformen unterscheiden:
a) Zum einen die „Mensch-Computer-Interaktion“, die sich auf die grundlegende Bedienungsebene des Computers bezieht. Sie beschreibt die Voraussetzungen und Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit sich der Spieler (bzw. der Computernutzer) überhaupt mit dem Computerspiel (bzw. dem Programm) in Beziehung setzen, d.h. mit ihm interagieren kann. Nur wenn dies gelingt, können die anderen, auf die Mensch-Computer-Interaktion aufbauenden Interaktionsformen in Erscheinung treten. Bei einem allein genutzten Computerspiel ist dies vor allem die „simulierte Interaktion“, die die Interaktion mit den virtuellen Akteuren bzw. Bots betrifft.
b) Zum anderen die „computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktion“, die auftritt, sobald ein Computerspiel gemeinsam mit anderen Menschen genutzt wird. Auch hier muss die grundlegende Mensch-Computer-Interaktion funktionieren, damit überhaupt eine computervermittelte Kommunikation stattfinden kann. Die anderen Menschen können dabei entweder als Spielpartner (spielerische Interaktion) oder als Kommunikationspartner (soziale Interaktion) fungieren.
3.1. Mensch-Computer-Interaktionen
Wie kann man sich nun eine Mensch-Computer-Interaktion vorstellen? Welche Elemente sind wichtig, damit es zu einer derartigen Interaktion kommt? Um diese Fragen zu beantworten, lehnt sich diese Arbeit an Jürgen Fritz’ „Modell zur Faszinationskraft von Computerspielen“ an. Anhand dieses Modells erklärt er, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Spieler überhaupt mit einem Computerspiel interagieren kann und wie sich im weiteren Verlauf solch eine Faszination entwickelt, dass das Computerspiel über einen längeren Zeitraum als Spiel- bzw. Interaktionspartner dient:
Abbildung 2: „Modell zur Faszinationskraft von Computerspielen“ [100]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Computerspiel stellt in diesem Modell das Angebot dar, das den Erwartungen des Spielers gerecht werden muss. Aber damit das Geschehen auf dem Bildschirm sein Potential entfalten kann, muss sich der Spieler wie gesagt auf das Spiel „einlassen“ können, indem er seine reale Umgebung „etwas“ ausblendet und die Teilhabe an der virtuellen Welt ins Zentrum rückt. Die Vermittlung zwischen dem virtuellen Computerspiel und dem realen Spielerdasein leisten vier ineinander greifende Funktionskreise, die von J. Fritz in Anlehnung an die vom „Radikalen Konstruktivismus“ geprägte Denkfigur „strukturelle Koppelung“[101] genannt wird. Sie transformiert die reale Aktion des Spielers (z.B. Mausbewegungen und das Drücken von Tasten) in eine virtuelle Aktion (entsprechende Bewegung der Spielfigur) und die virtuelle Reaktion (Ausführen einer Programmroutine für eine entsprechende Gegenbewegung) wieder in eine „reale“ Reaktion (der Spieler nimmt die Gegenbewegung des Computers entsprechend der Ausgabegeräte wahr und dies geschieht sozusagen in der realen bzw. mentalen Welt, jedenfalls nicht in der virtuellen Welt), so dann startet der Spieler wieder eine neue reale Aktion, die jedoch den Reaktionen des Computers angepasst sein sollte, um im Spiel erfolgreich zu sein. Wichtig ist, dass sich der Spieler auf das Computerspiel und seinen wechselnden virtuellen Situationen hin ausrichten muss (jedenfalls, wenn er erfolgreich am Spiel teilnehmen will) und diese Ausrichtung zeigt Ähnlichkeiten zu Interaktionen bei realen Spielen, beispielsweise einem Gesellschaftsspiel wie „Risiko“ oder „Monopoly“. Sogar emotionale Reaktionen sind bei Computerspielen zu beobachten.[102] Da aber nur der Mensch im ursprünglichen Sinne mit Vernunft und Sinn agiert und der Computer eben nur nach programmierten Befehlsabfolgen funktioniert, spreche ich von einer „simulierten Interaktion“ nur dann, wenn der Mensch sich vom Computerprogramm täuschen lassen will, um einen computergesteuerten (simulierten) Spielpartner zu erhalten. Jedoch werden die Möglichkeiten eines simulierten Interaktionspartners, um drei zentrale Motive eines jeden Computerspiels, eingeschränkt: Macht, Kontrolle und Herrschaft. So sind im Grunde fast alle Interaktionen bei einem Computerspiel auf diese drei Motive hin ausgerichtet, wohingegen andere Motive, wie beispielsweise Liebe, die simulierte Interaktion nicht ausdrücken kann.[103]
Wie schon angedeutet, werden sowohl die Computerspiele selbst wie auch die Erwartungen der Spieler von wirtschaftlichen Mechanismen beeinflusst, beispielsweise aufgrund von Werbung und diversen Absatzstrategien.[104]
Betrachten wir die strukturelle Koppelung genauer, so haben wir auf der Angebotsseite die schon beschriebenen vier Strukturelemente des Computerspiels: Präsentation, Inhalt, Regeln und Dynamik. Diese müssen einerseits der jeweiligen Persönlichkeit des Spielers gerecht werden, also was für persönliche Wünsche er an ein gutes Spiel hat, wie seine Fähigkeiten gelagert sind und auch eventuelle Vorerfahrungen, die mit Computerspielen gesammelt wurden. Andererseits sollten die Spiele auch zu dem jeweiligen Lebenskontext des Spielers passen, d.h. Ähnlichkeiten mit alltäglichen Lebensbereichen haben oder Gemeinsamkeiten mit dem sozialen bzw. kulturellen Hintergrund aufweisen. Die Spieler wählen nach J. Fritz „[…] vornehmlich Spiele aus, die zu ihnen ‚passen’, sowohl im Hinblick auf Vorlieben, Interessen und Abneigungen (die sich an Spielinhalten orientieren) als auch in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale, konkrete Lebenssituationen und Strukturmerkmale ihres Lebenskontextes.“[105] Die Erwartungen des Spielers bilden sich bei einem Computerspiel in Bezug auf die ersten drei Strukturelemente (Präsentation, Regeln und Inhalt), ihr Zusammenwirken bildet die Dynamik für die generelle Motivation des Spielers. Diese wird dann mit der Dynamik des Computerspiels (sein generelles Motivierungspotential) über die Prozesse der „strukturellen Koppelung“ fortlaufend abgeglichen. Die Ergebnisse dieser Prozesse entscheiden darüber, ob ein Spiel immer noch fasziniert oder ob es langweilig geworden ist. Erst ein funktionierender, dynamischer Funktionskreis gibt dem Spieler die Möglichkeit, sich vom Computerprogramm so täuschen zu lassen, dass er in den virtuellen Spielplatz „eintaucht“ und mit dem Computer als Spielpartner analog interagiert wie mit einem menschlichen Spielpartner.
3.1.1. Die Mensch-Computer-Interaktion als grundlegende Basis
Eine wichtige Besonderheit bei virtuellen Spielplätzen ist, dass der Spieler nicht direkt handeln kann, sondern indirekt über einen elektronischen Stellvertreter, einer virtuellen Spielfigur oder einer virtuellen Kommandozentrale agieren muss: Denn gewöhnlich sieht die reale Situation beim Computerspielen so aus, dass der Spieler sitzend auf einen Bildschirm schaut und die audio-visuellen Reize, ähnlich wie beim Fernsehen, aufnimmt. Doch anders als beim Fernsehen kann der Spieler aktiv über seine Eingabegeräte das Spielgeschehen beeinflussen. Damit nun überhaupt eine Faszination bzw. eine Interaktion aufkommen kann, ist es wichtig, dass sich der Spieler auf die virtuelle Welt „einlässt“, etwa so wie man sich von einem Spielfilm „mitreißen“ lässt. Eine angemessene Grafik und Tonausgabe, sowie eine verständliche Spiellogik gepaart mit einer bedienerfreundlichen Steuerung sind die ersten Garanten, dass sich der Spieler als Handelnder in einer virtuellen Welt fühlt. Schlecht synchronisierte Geräusche, „ruckelende“ Bewegungsabläufe, unverständliche Spielregeln und eine nervenaufreibende Handhabung sind dagegen die besten Garanten, dass der Spieler immer wieder in die reale Welt „zurückgeholt“ wird, um sich dort über technische Probleme zu ärgern, die mit dem eigentlichen Computerspiel nichts zu tun haben. Geschieht dies häufiger, so haben Spaß, Spannung und Faszination äußerst geringe Chancen, überhaupt aufzukommen. Mit diesen Worten sind die Aufgabenbereiche der ersten drei Funktionskreise der strukturellen Koppelung umrissen: Sie „[…] schaffen die Voraussetzung (dafür), dass sich die Spieler mit dem Bildschirmspiel überhaupt in Beziehung setzen können.“[106]
a) Pragmatischer Funktionskreis: Der erste Funktionskreis stellt den Spieler vor die Aufgabe, „[…] eigene Bewegungsmuster und Wahrnehmungsformen auf die programmgesteuerten Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten der Figur abzustimmen […]“[107], d.h. seine körperlichen Bewegungen mit Joystick, Maus oder Tastatur müssen zu angemessenen Bewegungen des elektronischen Stellvertreters werden. Die wahrgenommenen audio-visuellen Reize zeigen auch sofort die Ergebnisse dieser Bewegungsabläufe. Um erfolgreich zu sein, muss der Spieler lernen, seine Handlungen und Bewegungen so zu optimieren, bis sie sozusagen „automatisierte“ Körperbewegungen werden. Etwas anders ist es bei Computerspielen, in denen man keinen direkten virtuellen Stellvertreter führt, sondern außerhalb des Spielgeschehens in einer Art Schaltzentrale oder Kommandostelle sitzt und meist mit Maus und Tastatur gewisse Einstellungen tätigen muss oder seine virtuellen Spielfiguren, ähnlich einem Schachspiel, umherzieht. Hier geht es darum, die meist sehr vielfältigen Befehle und Einstellungen überhaupt zu kennen und zu wissen, wie man sie ausführt, ohne in ein langes Umhersuchen in Menüs und Untermenüs zu verfallen. Die Faszination entsteht in diesem Funktionskreis durch das Gefühl des Spielers, seine Spielfigur bzw. seine Kommandantur beherrschen, kontrollieren und angemessen steuern zu können. Dieser Funktionskreis bezieht sich unmittelbar auf die „Präsentation“ eines Computerspiels.
b) Semantischer Funktionskreis: Im zweiten Funktionskreis muss der Spieler das Computerspiel deuten, d.h. die wahrgenommenen Bild- und Tonelemente müssen so rekonstruiert werden, dass das Computerspiel eine Bedeutung, einen Sinn erhält. In der Regel ist diese Rekonstruktion sehr ähnlich den Bedeutungsgehalten, die die Spielentwickler in das Spiel hineinlegen wollten. Wenn dies gelingt, findet sich der Spieler, in Anlehnung an seine kulturelle Sozialisation, beispielsweise in einer historischen Schlacht, in einer mittelalterlichen mit Mythen besetzten Welt oder in einem rasanten Formel-Eins-Rennen wieder. Der Bedeutungsgehalt ist meist mit den Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten im Computerspiel verknüpft. So muss ein als „Auto“ rekonstruierbares Objekt mehrere Merkmale eines realen (medialen) Autos bzw. einer realen (medialen) Autofahrt darstellen. Je mehr Eigenschaften dabei realitätsnah präsentiert werden, desto höher ist der Simulationsgrad des Computerspiels. „Mit der Übertragung von Bedeutung verbinden sich kulturelle Erfahrungen, moralische Bewertungen und dadurch bedingte unterschiedliche Gefühle mit dem Spiel. All dies bewirkt, dass Spieler bestimmte Einstellungen zu den unterschiedlichen Spielen finden.“[108] Die Begeisterung entsteht hier durch die Symbolik, genauer durch den Reiz der Verwandlung. Der Spieler steuert kein farbiges, aus Pixel zusammengesetztes, geometrisches Gebilde, sondern einen hochmodernen Kampfjet und befindet sich in einer kriegsentscheidenden Luftschlacht. Er selbst ist nicht mehr der bequem sitzende Spieler vor seinem Computer, sondern nimmt die Rolle eines erfahrenen, hochdekorierten Piloten an, der aus seinem Cockpit auf die angreifenden gegnerischen Staffeln schaut und sich diesen „todesverachtend“ in den Weg stellt. Natürlich wohl wissend, dass er bei einer Niederlage, also seinem Absturz, sich wieder „wohlbehütet“ in seinem realen Sessel vorfindet - also keine realen Konsequenzen zu fürchten braucht. In diesem Funktionskreis findet sich eine direkte Anlehnung an den „Inhalt“ eines Spiels.
c) Syntaktischer Funktionskreis: In dem dritten Funktionskreis geht es darum, die Spielregeln zu erlernen und sie für sich selbst nutzbar zu machen. „Man muss die Welt von ihren Regeln her verstehen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten nutzen und die angemessenen Strategien entwickeln. […] Das Hineinwachsen in die ‚virtuelle Welt’ ist verbunden mit einer zunehmenden Komplexität bei der Strukturierung der spielbezogenen Wahrnehmungen und der daraus hergeleiteten Spielhandlungen.“[109] So erlernt man beispielsweise bei militärischen Strategiespielen, welche Einheiten in gewissen Spielsituationen besonders effektiv sind und wie man seine Forschungs- und Produktionskapazität steigern kann. Der Spieler erlernt nach und nach die verschiedenen Regeln und steigt somit in immer höhere Komplexitätsebenen auf. Das faszinierende an diesem Funktionskreis ist die Herausforderung, das Spiel immer besser kennen zu lernen, um sich dadurch neue Handlungsmöglichkeiten und spielerische Ideen zu erschließen, mit denen er das angestrebte Ziel effizienter bzw. überhaupt erreichen kann. Wie man sofort ersehen kann, herrscht bei diesem Funktionskreis eine Anbindung an die „Regeln“ eines Computerspiels.
Prinzipiell lassen sich die Bedingungen dieser Funktionskreise auf jedes andere Computerprogramm (auch nichtspielerischer Art) übertragen. Sind die Anforderungen erfüllt, so kann man sagen, dass der Nutzer das Programm soweit beherrscht, das er weiß, wofür es da ist und wie man es bedient. Doch für ein Computerspiel ist es zudem wichtig, dass sich der Spieler so fühlt, als würde er wirklich spielen. Wenn nun der Computer neben dem Spielfeld auch noch die Spielpartner stellen soll, ist es wichtig, dass neben den Rahmenbedingungen der Spielwelt, auch fortlaufende die Anforderungen des dynamischen Funktionskreises erfüllt werden. Die Funktionstüchtigkeit der ersten drei Kreise bleibt im Grunde, wenn sie einmal erreicht wurde, auch weiterhin erhalten. Doch bei der simulierten Interaktion und ihren Anforderungen innerhalb des vierten Funktionskreises ist dies keineswegs so: Jederzeit kann es passieren, dass ein Spiel als langweilig empfunden wird und die Täuschung der simulierten Interaktion verschwindet. Der Spieler wird dann wieder auf die grundlegende Bedienungsebene der Mensch-Computer-Interaktion zurückversetzt. Er beherrscht zwar immer noch die Anforderungen des Computerspiels, aber die Scheinhaftigkeit der virtuellen Spielwelt verschwindet.
3.1.2. Die simulierte Interaktion: Der Computer als Spielpartner
Für eine erfolgreiche simulierte Interaktion müssen die zuvor beschriebenen Unterdynamiken eines Computerspiels mit den Erwartungen des Spielers gekoppelt werden. Dies geschieht im dynamischen Funktionskreis, den man wie folgt zusammenfassen kann:
d) Dynamischer Funktionskreis: Aus dem vierten Funktionskreis resultiert die Intensität und die Ausdauer für ein Computerspiel. „Die motivationale Kraft erwächst dadurch, dass Thematiken, Rollenangebote, Skripte, Episoden und einzelne Szenen des Spiels zum eigenen Lebensbereich, seinen kulturellen Hintergründen, Rollen usw. in Beziehung gesetzt wird. Durch den Selbstbezug werden Bildschirmspiele zu einem mehrfädig geflochtenen Band bedeutsamer Metaphern, die in ihren vielfältigen Verweisungen Individuelles mit Gesellschaftlichem verbinden.“[110] Man kann den Selbstbezug unter anderem an den bevorzugten Computerspielen sehen, so bevorzugen beispielsweise geschichtsinteressierte Menschen auch Spiele mit einem geschichtlichen Hintergrund oder von Autos begeisterte Menschen spielen auch wahrscheinlicher Rennspiele. Diese Beispiele fasst J. Fritz[111] unter den Begriff „parallele Koppelung“, das will heißen: Spieler bevorzugen solche Computerspiele, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem haben, was sie auch in der realen Welt bevorzugt machen. Der umgekehrte Fall ist aber ebenfalls zu finden, die so genannte „kompensatorische Koppelung“: Der Spieler sucht sich bevorzugt solche Computerspiele, die einen vollkommen anderen Lebensbereich betreffen, entweder weil er in der realen Welt für derartige Beschäftigungen keine Zeit hat oder aus anderen Gründen verhindert ist, es aber mental schon in irgendeiner Weise gewollt wird. Im dynamischen Funktionskreis findet sich der Spieler mit seinen narzisstischen Wünschen (Macht, Beherrschung, Reichtum, Kraft usw.) ebenso wieder, wie mit seinen erworbenen gesellschaftlich und kulturellen Wertvorstellungen, Normen und Einstellungen. Ob eine simulierte Interaktion als abwechslungsreich und der Schwierigkeitsgrad weder als zu schwer, noch als zu leicht empfunden wird, entscheidet sich ebenfalls innerhalb des dynamischen Funktionskreises.
Der Computer kann jedoch keinen universalen Interaktionspartner in Form eines „künstlichen“ bzw. „virtuellen“ Menschen simulieren, sondern nur einen Interaktionspartner, der auf spezielle Aufgabengebiete festgelegt wurde. Entscheidend ist dabei, dass sich der Spieler für den Moment des Spielens vortäuschen lässt, dass er einen Spielgegner vor sich hat. Man interagiert mit ihm ähnlich wie mit einem menschlichen Spielpartner - natürlich bezogen auf spielbedingte Interaktionen. Interaktionen, die nicht das Spiel betreffen, vermag das Programm nicht zu simulieren. Die Täuschung darf man sich aber nicht so vorstellen, als ob der Spieler nicht wüsste, dass er gegen einen Computer spielt. Es ist vielmehr so: Der Spieler will sich für den Zeitraum des Spiels täuschen lassen, um die Welt des Spiels, eben auch mit einem künstlichen bzw. synthetischen Spielpartner, zu erfahren.[112] Im weiteren Sinn kann man auch eine indirekte Interaktion des Programmnutzers (z.B. Computerspieler) und dem Programmierer (z.B. Computerspielentwickler) erkennen. So spielt im Prinzip ein Computerspieler gegen die Programmierkünste des Entwicklers. Doch hier findet kein Interaktionsprozess im eigentlichen Sinn statt, vielmehr verleiht der Entwickler seinem Programm mehr oder weniger Kompetenzen, einen glaubwürdigen Interaktionspartner zu simulieren.
Bei Computerspielen ist daher auch die Programmierung der „Künstliche Intelligenz“ zentral. Hierbei geht es folglich nicht nur darum, dass die Computergegner bzw. die simulierten Interaktionspartner möglichst effektiv und gewinnorientiert handeln, sondern dass sie dem Computerspieler das Gefühl geben, einen „realen“, einen „menschenähnlichen“ Gegner vor sich zu haben, der eben nicht allwissend ist, gelegentlich Fehler macht und vor allem das Spiel unter den gleichen Bedingungen spielt wie er selbst. Zudem sollte die künstliche Intelligenz aus ihren Fehlern lernen und in ähnlichen Situationen dementsprechend andere Vorgehensweisen versuchen, doch diese Technologie steckt bei Computerspielen noch in den Kinderschuhen. Im Prinzip würde man am Ende gegen sich selbst spielen, wenn nicht auch andere Spieler das gleiche Computerspiel nutzen würden, und so der Computer von verschiedenen Menschen lernen kann. Eine andere Methode ist, den Computer nicht nach strikt festgelegten Programmroutinen agieren zu lassen, sondern ihm mehrere Alternativen zu geben, aus denen er dann mit Hilfe einer gewichteten Zufallsauswahl je eine andere, aber doch mehr oder weniger passende Vorgehensweise aussucht. Bei solchen Versuchen geht es immer darum, den Computer so zu programmieren, dass er sich wie ein Mensch verhält bzw. es dem Computerspieler so vortäuscht.[113] Schon Alan Turing wies auf diesen Aspekt hin, dass man einen Computer als „intelligent“ bezeichnen kann, wenn es ihm hinreichend oft gelingt, dem Menschen vorzutäuschen, dass seine Aktionen von einem Menschen gesteuert wurden und nicht von einer Maschine.[114]
Um über die begrenzten Programmroutinen eines jeden simulierten Spielpartners hinwegzutäuschen, stehen den Programmierern und auch den Spielern diverse Möglichkeiten zur Verfügung: So gibt es einmal die Möglichkeit, einem begrenzt denkenden Computergegner spielbedingte Vorteile zu verschaffen, um ein Kräftegleichgewicht zu erreichen. Hierunter ist im Wesentlichen der einstellbare Schwierigkeitsgrad zu verstehen, der die Spielstärke des Computers bestimmt. Aber ab irgendeiner Schwierigkeitsstufe ist das simulierte Potential des Computers erschöpft und von da an hilft nur noch, dem virtuellen Kontrahenten Möglichkeiten zu geben, die der Spieler nicht hat, um dennoch ein interessantes Spiel zu gewährleisten. Eine andere Möglichkeit sind „Spiel-Updates“, mit ihnen kann man nachträglich ein Computerspiel überarbeiten bzw. erweitern und auch sein simuliertes Interaktionspotential in Form der Computerakteure verbessern. Kleinere Updates können meist kostenlos über das Internet heruntergeladen werden, während große Updates meist kostenpflichtig vom Spieler erworben werden müssen. Bei den neueren Computerrollenspielen, die über das Internet gespielt werden, geschehen diese Veränderungen mitunter permanent durch ein extra eingestelltes und oft über monatliche Gebühren finanziertes Betreuungsteam.[115]
An dem Gesagten erkennt man auch die beiden grundlegenden Entwicklungsrichtung der Virtual Reality nach Florian Rötzer: So geht es darum, den Spieler „in den virtuellen Raum hinein zu nehmen“ und dies geschieht dadurch, dass die Spielwelt, die Spielhandlungen, die Spielsteuerung usw. so simuliert sind, dass wir uns täuschen lassen bzw. lassen wollen und für einige Zeit in die virtuelle Welt „eintauchen“. Andererseits erkennt man, dass die Entwicklung entsprechender Computergegner bzw. Bots zentral ist, um den Spieler für längere Zeit zu faszinieren. Je weniger sie den Eindruck von festen Programmroutinen erwecken, desto eher lassen wir uns täuschen, dass wir einen „echten“ Interaktionspartner vor uns haben.
Als gemeinsames Merkmal aller Computerspiele kann man das grundlegende Ziel sehen, sich im Spiel mit oder gegen den Computer zu behaupten und auch alle simulierten Interaktionen mit einem computergenerierten Spielpartner werden durch die Motive „Macht, Kontrolle und Herrschaft“ kanalisiert. Jürgen Fritz spricht vom „Bleiberecht in der virtuellen Welt“[116]. An den Videospielautomaten in den Spielhallen kann man dieses Prinzip meist noch direkt erkennen. Für einen Münzeinwurf erhält man ein gewisses Kontingent an Versuchen, um die computergesteuerten Hindernisse, Gefahren und Gegner zu meistern. Bei Misserfolg wird einem ein Versuch abgezogen und man darf sich an dem Hindernis noch einmal versuchen; bei manchen Spielen muss man wieder am Spielanfang beginnen. Sind alle Versuche aufgebraucht, so erscheint das bekannte „Game Over“ und der Spieler muss sich entscheiden, ob er für eine weitere Münze ein neues Spiel beginnt oder ob er aufhört zu spielen. Wie schnell der Videospieler seine Versuche aufbraucht bzw. wie oft er an gewissen Hindernissen oder Gegnern scheitert, hängt direkt von den spielerischen Fähigkeiten ab - also im gewissen Sinn von seiner Handlungsmacht, die er über die Prozesse der strukturellen Koppelung erworben hat. Bei den Computerspielen ist dieses Prinzip, manchmal etwas latenter, ebenfalls grundlegend. Ob man nun auf seine eigenen Versuche, im Spiel oft „Leben“ genannt, aufpassen oder ein komplexes System funktionstüchtig halten muss, immer geht es darum sein „Bleiberecht“ zu behaupten. „Dazu muss der Spieler über das Spiel und damit über sich selbst die Kontrolle erlangen. Das Spiel am Bildschirm wird dadurch in seinem Kern zu einem Spiel um Macht, Herrschaft und Kontrolle. Der Macht programmierter Ereignisfolgen muss der Spieler seine Handlungsmacht entgegensetzen. Indem er sich selbst kontrolliert (Wünsche, Gefühle, Kognition, Konzentration usw.) beginnt er, Kontrolle über das Spiel auszuüben und damit die Ereignisfolgen so zu bestimmen, dass sein ‚Bleiberecht’ im Spiel gesichert wird. Aber das Spiel um Kontrolle und Herrschaft muss in einer ‚Welt’ stattfinden, die dem jeweiligen Spieler zusagt und die das Spektrum an Fähigkeiten fordert, die dem Spieler angemessen sind.“[117]
Macht, Kontrolle und Herrschaft finden ihr Pendant in der Lebens- bzw. Alltagswelt der Menschen. „Das Überleben der Menschen hängt davon ab, ob die eigene Macht, die auf die Umwelt wirkenden Fähigkeiten und Kräfte, ausreicht, sich ein Verbleiben auf dieser Welt zu sichern. Im wettbewerbsorientierten Spiel wird dieser Aspekt des ‚Spiel des Lebens’ entfaltet und inszeniert. […] (Computerspiele) bieten vielfältige Spielräume, in denen sich auf unterschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen Thematiken Macht entwickeln und gegenüber gegnerischer Macht behaupten muss.“[118] Bei Max Weber findet man folgende Definition für Macht: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“[119] Bei einem Computerspiel wird die soziale Beziehung durch eine Mensch-Computer-Interaktion ersetzt. Da der Bezugsrahmen und die Einflussmöglichkeiten bei einem Spiel, ebenso wie bei einem Computerspiel, genau festgelegt sind, gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, seine Chance zu nutzen. Folglich muss der Spieler, um seine Chance auf erfolgreiche Machtausübung zu erhöhen, dieses limitierte Repertoire an Möglichkeiten zielgerichtet optimieren. Bei einem Computerspiel geschieht dies wie gesagt über die ersten drei Funktionskreise der strukturellen Koppelung. Dem eigenen Willen wird das „Widerstreben“ des Computers entgegengesetzt, auch dieser ist mit einem gewissen Potential zur Machtausübung ausgestattet, meist in Form von vordefinierten Handlungsroutinen. Im weiteren Sinn kann man daher auch von der Macht der Spielentwickler bzw. Spielprogrammierer sprechen. „Die Macht des Softwareentwicklers rührt daher, dass die formale Logik dazu verhilft, Ordnungsmodelle zu schaffen, die zugleich Instrumente sind, um die Realität modellhaft zu bearbeiten.“[120] Die eingehende Denkarbeit und die erfolgreiche Auseinandersetzung des Programmierers bzw. Entwicklers mit dem Computer, um ein funktionstüchtiges Programm zu kreieren, bestimmen im Wesentlichen das Machtpotential des Computerspiels bzw. genauer des simulierten Interaktionspartners. Mit Hilfe eines einstellbaren Schwierigkeitsgrades kann man bei den meisten Spielen den Computer hindern, sein Machtpotential voll auszuschöpfen. Der Computer hat aber, wenn überhaupt, nur bedingte Möglichkeiten, zu lernen und ist im Grunde auf seine statischen Programmroutinen angewiesen. Folglich ist die heutige Computertechnologie auch noch weit davon entfernt, das erweiterbare oder verringerbare Machtpotential von realen Menschen zu simulieren. Ein Motiv wurde aber noch nicht beschrieben, die „Herrschaft“. Bei Weber heißt es: „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.“[121] Die „angebbaren Personen“ sind bei einem Computerspiel natürlich virtueller Natur und können entweder die eigene Spielfigur bzw. Gruppen von Spielfiguren betreffen, wie auch ein abstraktes System, bei dem man nur über abstrakte Werte seinen Handlungserfolg ablesen kann. Doch grundsätzlich geht es immer darum, über eine erfolgreiche Spielkontrolle und –handhabung, seine erteilten Befehle über die Eingabegeräte auch entsprechend vom virtuellen Geschehen ausgeführt zu sehen, sozusagen „Gehorsam zu finden“.
Auf unsere Gesellschaft bezogen gilt die Beherrschung des Computers als „Kulturtechnik“[122]. Die grundlegenden Normen und Werte, die Computerspiele vertreten, entsprechen denen unserer Gesellschaft: Macht, Kontrolle, rationales bzw. formal-logisches Denken, Leistung- und Wettbewerbsorientierung, hierarchische Funktionen, um nur einige aufzuzählen.
3.2. Computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktionen
Dennoch stößt jedes Computerspiel in der Solo-Variante (ein Mensch gegen den Computer) an seine Grenzen und wird nach einiger Zeit herausforderungslos und langweilig. „Die virtuelle Welt wächst nicht, und der Computer als Spielgegner verändert sich nicht.“[123]
Daher stößt auch gerade die Leistungs- und Wettbewerbsorientierung beim Spiel gegen einen computergesteuerten Gegner an seine Grenzen. Irgendwann ist jeder simulierte Interaktionspartner durchschaut, d.h. seine Programmroutinen wurden grundlegend erkannt und können vom Spieler vorausberechnet werden, so dass der Spieler im Prinzip jedes Spiel, mit einer zuvor errechneten idealen Vorgehensweise, gewinnen kann. Neben den bereits erwähnten „Spiel-Updates“, bleibt nur noch die Möglichkeit den computergenerierten Spielpartner durch einen Menschlichen auszutauschen, um weiterhin seine Herausforderung zu finden.
3.2.1. Der Mensch als virtueller Spielpartner
Nach Untersuchungen von Karla Misek-Schneider und Jürgen Fritz wird das gemeinsame Spiel dem Alleinspiel prinzipiell vorgezogen[124]. Die menschlichen Spielpartner sind dabei meist Freunde, Verwandte und in den letzten Jahren auch vermehrt Unbekannte, mit denen man über das Internet spielt. Grundlegend ist ein menschlicher Spielpartner flexibler, spontaner, unberechenbarer, kommunikativer, lernfähiger, und man kann mit ihm Vereinbarungen treffen, die mit einem simulierten Spielpartner nicht möglich wären, z.B. kann man in Spielen zusätzliche Regeln der Fairness aufstellen oder eigene Spielziele abmachen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich durch das gemeinsame Spiel die Wettbewerbsorientierung und auch die Spielmotivation steigern[125], man motiviert sich sozusagen gegenseitig. Die Wettbewerbsorientierung tritt zumeist in der Variante auf, das man gegen andere Spieler spielt; aber auch die Möglichkeit, mit ganzen Spielergruppen („Teams“) gegen andere Gruppen anzutreten, ist bei einigen Computerspielen vorhanden. Aufgrund dieses verstärkten Wettbewerbs gibt es aber auch Gründe gegen ein gemeinsames Spiel – so vor allem, wenn die Spielpartner ungleich stärker sind und das Spiel für beide langweilig wird. Anzumerken ist, dass nicht jedes Computerspiel tauglich ist, um es gemeinsam zu spielen. Vor allem sehr komplexe und zeitaufwendige Spiele bereiten einer gemeinsamen Spielfreude doch einige Probleme, z.B. zu lange Wartepausen, in denen ein Spielteilnehmer nicht agieren kann, weil der andere noch in umfangreiche Denkprozesse verstrickt ist. Spiele mit „Echtzeit-Charakter“ sind hierfür am idealsten, d.h. solche Spiele, in denen die Aktionen der Spieler sofort virtuell ausgeführt werden und einem folglich keine langen Denkphasen zur Planung bereitstehen. Solche Spiele sind daher meist auch von geringerer Komplexität. Spiele mit einem „rundenbasierten Charakter“ sind dagegen meist komplexer, da die Aktionen des Spielers erst nach einer zusätzlichen Bestätigung virtuell ausgeführt werden und so einem Zeit für Überlegungen gegeben werden. Bis zu einem gewissen Umfang und Zeitaufwand können diese Spiele gemeinsam gespielt werden. Die Spielbarkeit selbst hängt dabei von der Anzahl der Spieler[126] und ihrer Belastbarkeit ab. Allgemein lassen sich zwei Arten des gemeinsamen Computerspiels unterscheiden:
a) Reale Vernetzung: Entscheidend ist hier, dass sich die Spieler real und nicht nur virtuell am gleichen Ort befinden. Man kann sich real sehen und hören, man weiß im Grunde, wer der andere ist. Die direkteste Vernetzung ist die, wenn sich die Spieler um einen Computer mit seinem Bildschirm versammeln.[127] Etwas indirekter vernetzt sind dagegen „Netzwerkspiele“, bei denen jeder Spieler seinen eigenen Computer benötigt. Hier findet meist eine lokale Vernetzung von ein paar wenigen Computern statt, da der Organisationsaufwand und der benötigte Raum für jeden zusätzlichen Spieler immer größer werden. Doch es gibt auch „LAN-Parties“[128], bei denen hunderte von Spielern ihre Computer vernetzen und tagelang Wettbewerbe veranstalten. Dies geschieht meist in großen Hallen, um jedem Spieler genug Platz zu bieten. Differenzieren lassen sich diese Beispiele danach, inwieweit reale Interaktionen zwischen Menschen stattfinden. Bei einem gemeinsamen Spiel an einem Computer nehmen sich die Spieler permanent real wahr und interagieren auch permanent von Angesicht zu Angesicht miteinander. Wenn demgegenüber jeder Spieler seinen eigenen Computer nutzt, werden die realen Entfernungen zwischen den Spielern größer, mitunter halten sich die Spieler in verschiedenen Räumen bzw. Zimmern auf und können sich während des Spiels real nicht mehr wahrnehmen. In solchen Fällen beschränkt sich die reale Interaktion oft nur auf die Spielpausen bzw. vor und nach dem eigentlichen Spiel.
b) Virtuelle Vernetzung: Wenn die realen Interaktionen gänzlich wegfallen und sich die Spieler nur noch über den Computer wahrnehmen, so spreche ich von einer virtuellen Vernetzung. Die Computer der Spieler befinden sich real nicht mehr in unmittelbarer örtlicher Nähe, sondern werden virtuell, beispielsweise über das Internet, vernetzt. Folglich nehmen sich die Spieler real überhaupt nicht mehr wahr, auch nicht mehr in Spielpausen und können nur (virtuell) über die zwischengeschalteten Computer interagieren. Hier haben wir es mit dem Fall einer „computervermittelten Kommunikation“ zu tun. Das Internet stellt dabei die Kommunikationsplattform und zudem auch ein reichhaltiges Angebot an öffentlichen Spielplattformen zur Verfügung, auf denen sich jeder nach Lust und Laune mit anderen, auch völlig unbekannten Menschen messen kann. Aber mit Beendigung des Spiels endet grundsätzlich auch die Interaktion zwischen den Spielern. Im Prinzip kann man auch bei der realen Vernetzung mit Unbekannten spielen, doch ist stets ein realer Eindruck vorhanden bzw. es kann unmittelbar einer aufgebaut werden.
3.2.2. Der Mensch als virtueller Kommunikationspartner
Der hier verwendete Begriff der sozialen Interaktion geht zurück auf George Herbert Mead, der die Interaktionen zwischen Menschen durch Symbole vermittelt sieht, also durch Gesten, sprachliche Ausdrücke, Mimik usw. Folglich nehmen die Symbole im Prozess der Interaktion und Kommunikation eine zentrale Rolle ein.[129] Das wichtigste Symbol bzw. Symbolsystem ist die Sprache, nach einem Zitat von Peter L. Berger und Thomas Luckmann: „Sprache, ein System aus vokalen Zeichen, ist das wichtigste Zeichensystem der menschlichen Gesellschaft. […] Aber Sprache beginnt erst, wo der vokale Ausdruck vom unmittelbaren ‚Hier und Jetzt’ isolierter subjektiver Befindlichkeit ablösbar geworden ist. […] Die Ablösbarkeit der Sprache gründet […] in der Fähigkeit, Sinn, Bedeutung, Meinung zu vermitteln, die nicht direkter Ausdruck des Subjektes ‚hier und jetzt’ sind. Diese Fähigkeit haben auch andere Zeichensysteme.“[130] Gestische und mimische Zeichensysteme wären Beispiele hierfür. Die Kommunikation bzw. besser der kommunikative Prozess leistet die Vermittlungsarbeit zwischen den Individuen. Doch schon Paul Watzlawick stellte heraus, dass sich jede Kommunikation gleichzeitig mit einer Metakommunikation vollzieht: Man kann nicht nicht kommunizieren. So wird über die Kommunikation neben dem eigentlich mitgeteilten inhaltlichen Aspekt immer auch ein Beziehungsaspekt vermittelt.[131] So kann beispielsweise die Aussage „wir sehen uns heute Abend“ je nach Kontext als Verabredung, Drohung, Ironie usw. aufgefasst werden.
Grundlegend lassen sich bei einer Kommunikation daher drei Sinnebenen unterscheiden: „Die Beteiligten haben (1) die ‚objektive’ Gegebenheit einer Situation in Rechnung zu stellen, auch: Normen, Rollen oder institutionalisierte Verhaltenserwartungen genannt […]. Zugleich bringen die Beteiligten aber auch (2) ihre unterschiedlichen Lebensgeschichten, biographische Besonderheiten oder Persönlichkeiten, also ‚subjektive’ Vorgegebenheiten mit in die Kommunikation ein […]. Auf der Grundlage einer wechselseitigen Interpretation der Beteiligten, in der die genannten Anforderungen - also ‚Objektives’ und ‚Subjektives’ - in Rechnung gestellt und aufeinander bezogen werden, kommt es schließlich (3) zu einer gemeinsamen Definition der Situation als der eigentlichen kommunikativen Leistung.“[132]
Diese drei Sinnebenen werden nun für zwischenmenschliche Interaktionen in analoger Weise verwendet. So wird im Rahmen der „objektiven Gegebenheit einer Situation“ untersucht, inwieweit virtuelle Rollen innerhalb eines Computerspiels auftreten. Die „subjektive Vorgegebenheit“ soll mit dem Konzept einer virtuellen Identität analysiert werden, während die „eigentlichen kommunikativen Leistungen“, dahingehend betrachtet werden, inwieweit sie vom computervermittelten Format beeinflusst wird.[133]
3.2.2.1. Computervermittelte Interaktions- und Kommunikationsprozesse
Erläutern möchte ich diese Sinnebenen an der grundlegendsten sozialen Interaktion, der Interaktion von Angesicht zu Angesicht, um dann später an dieser die Unterschiede zu einer computervermittelten Interaktion aufzuzeigen. „Die Vis-à-vis-Situation ist der Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktion. Jede andere Interaktionsform ist von ihr abgeleitet. […] Als Vis-à-vis habe ich den Anderen in lebendiger Gegenwart, an der er und ich teilhaben, vor mir. […] Mein und sein ‚Jetzt und Hier’ fallen zusammen, solange die Situation andauert. Ein ständiger Austausch von Ausdruck findet statt. […] Mein Ausdruck orientiert sich an ihm und umgekehrt, und diese ständige Reziprozität öffnet uns beiden gleichermaßen Zugang zueinander.“[134] In solch einer Face-to-Face-Interaktion spielt die nonverbale Kommunikation (z.B. Gesichtsausdruck, Gesten oder Körperbewegungen) eine nicht zu vernachlässigende Rolle. „Wenn sich Individuen in der Gegenwart von anderen aufhalten, dann sind sie beständig mit nonverbaler Kommunikation befasst, auch mit Personen, mit denen sie nicht direkt sprechen. Durch ihre Bewegungen, ihre Stellung, ihr körperliches Erscheinungsbild und durch mimische und körperliche Gesten übermitteln sie an andere bestimmte Eindrücke.“[135] Das zuletzt Gemeinte betrifft eine „unzentrierte Interaktion“, d.h. „[…] wenn Individuen in einer gegebenen Situation ein wechselseitiges Bewusstsein von der Gegenwart des anderen haben“[136], z.B. bei größeren Menschenansammlungen oder Partys. Zentrierte Interaktion findet dagegen statt, „[…] wenn sich Individuen direkt darauf konzentrieren, was der andere sagt oder tut.“[137] Grundsätzlich ist daher jede Face-to-Face-Interaktion eine zentrierte Interaktion und es sind potentiell alle fünf (Umwelt-)Sinne involviert. Aber schon Alfred Schütz hat versucht zu zeigen, „[…] dass wir keinen direkten Zugang zur ‚andermenschlichen’ Erfahrung haben können, also fremde Erlebnisse schlussfolgernd aus den Zeichen und Ausdrucksformen des fremden Leibes ermitteln müssen.“[138] In diesem Sinne ist auch die Kommunikation „[…] nicht nur ein bloßes Aussenden oder Empfangen von Informationen bzw. Botschaften, sondern ein komplexer Prozess der sozialen Handlung, der die Wirklichkeitskonstruktionen und somit auch die sozialen wie nicht-sozialen Handlungsweisen der Beteiligten beeinflusst. Insbesondere ist zu beachten, dass die soziale Beziehung zwischen den Kommunizierenden den Verlauf des Kommunikationsprozesses prägt – und dieser wieder auf die Beziehungen zurückwirkt.“ Damit wir aber nicht bei jeder Interaktion diesen komplexen Prozess der Wirklichkeits- und Beziehungskonstruktion von Anbeginn an durchlaufen müssen und auch nicht können, sind Typisierungen, formelle oder informelle Regeln der Interaktion bzw. Kommunikation, Alltagsroutinen usw. unumgänglich. Schon Erving Goffman sieht die Zentralität des Ordnungsproblems bei Face-to-Face-Interaktionen: Damit die ursprüngliche Wirklichkeit einer Begegnung erhalten bleibt, „[…] bedarf es gemeinsamer Definitions- und Organisationselemente für den Interaktionsverlauf. So ist jeder zunächst gezwungen, in angemessener Weise teilzunehmen und dies durch Zeichen kundzutun (Nicken, Augenkontakt, Körperhaltung) […]. Umgekehrt wird erwartet, dass fehlendes (eigenes oder fremdes) Engagement durch Anstrengungen zur Rückgewinnung eines gemeinsamen Wirklichkeitsverständnisses ausgeglichen wird […].“[139] Zu einem gemeinsamen Wirklichkeitsverständnis gehört auch eine Verständigungsarbeit, in welch einer Situation bzw. einem Kontext man sich gerade befindet. Befindet man sich gerade uniformiert als Gardist auf einem Karnevalsumzug oder auf einer realen militärischen Invasion. Solch eine Situationsdefinition nennt Erving Goffman „Rahmen“, dieser kann im Prinzip alles umfassen, was einzuordnen erlaubt, „[…] was innerhalb und was außerhalb einer Situation stattfindet.“[140] Das gesamte alltägliche Leben findet als „[…] Serie von Begegnungen mit anderen in verschiedenen Kontexten und an verschiedenen Orten statt. […] Jede dieser Begegnungen wird wahrscheinlich durch Einklammerungen ‚markiert’, wie Goffman es nennt, die die einzelnen Episoden der zentrierten Interaktion von der jeweils vorhergehenden und von der unzentrierten Interaktion, die im Hintergrund abläuft, abgrenzen. […] Bei formalen Anlässen werden häufig anerkannte Techniken verwendet, um den Beginn oder das Ende einer bestimmten Begegnung oder einer Interaktionsphase zu markieren […]“[141], so z.B. vor einem Theaterstück das Läuten der Glocke, Öffnen des Vorhangs usw. „Markierungen sind im allgemeinen dort von besonderer Bedeutung, wo eine Begegnung entweder stark von den gewöhnlichen Konventionen des Alltagslebens abweicht, oder wo Unklarheit darüber entstehen könnte, ‚was vorgeht’.“[142] Solche Markierungen finden sich insbesondere auch in der Abgrenzung der verschiedenen Subwelten der Alltagswirklichkeit. In der Spielwelt sind dies oft der festgelegte Anfang bzw. Ende, die von einem Zeremoniell begleitet werden, z.B. Startschuss, Schlusspfiff, Siegerehrung usw. Während dies in der virtuellen bzw. medialen Welt beispielsweise mit dem Betätigen des Einschaltknopfes bzw. dem Öffnen eines Buches geschieht. Bei der virtuellen Spielwelt haben wir sogar eine doppelte Markierung, da man erst die virtuelle Welt betritt und erst im zweiten Schritt begibt man sich in die Spielwelt des Computers.
Betrachtet man jetzt, den Fall einer computervermittelten Situation, so bietet sich, für die darin stattfindenden Kommunikationen, folgende Definition von Thomas Köhler an: „Unter computervermittelter Kommunikation verstehe ich die Kommunikation, bei der mindestens zwei Individuen in einer nicht-face-to-face Situation durch die Anwendung eines oder mehrerer computerbasierter Hilfsmittel miteinander in Beziehung treten.“[143]
Im Rahmen eines Computerspiels gibt es im Grunde drei Hilfsmittel, um mit anderen menschlichen Spielern zu kommunizieren: Da wäre als erstes die „Chat-Kommunikation“[144], in der man kurze Mitteilungen (etwa in Satzlänge) über die Tastatur eintippt und an den betreffenden Spieler (bzw. auch an alle Spieler) sendet. Die Angeschriebenen erhalten die Mitteilung und auch die Mitteilungen anderer Spieler, mitsamt den jeweiligen Absendernamen, aufgelistet auf ihrem Bildschirm und können dann ebenfalls über eine „Chat-Eingabe“ antworten. Diese Methode stellt die gebräuchlichste Kommunikationsform bei einem Gemeinsamen Computerspiel dar. Die zweite Kommunikationsmethode ähnelt sehr dem telefonieren. Hierfür tragen die Spieler meist Head-Sets, damit sie ihre Hände für Spielaktionen frei haben. Mit Hilfe einer extra installierten Software kann das Computernetzwerk nun als Telefonleitung genutzt werden, und man kann in einer Art Telefonkonferenz mit den beteiligten Spielern kommunizieren. Für gewöhnlich beschränkt sich diese Kommunikationsform auf akustische Mitteilungen, denn prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, mit Hilfe einer digitalen am Computer angeschlossenen Kamera eine Art Bildtelefon einzurichten, mit dessen Hilfe sich die Gesprächsteilnehmer auch visuell wahrnehmen können. Es ist aber fraglich, ob diese Variante mit den zeitbedingten Anforderungen eines Computerspiels vereinbar wäre? Die dritte Kommunikationsmöglichkeit findet sich im Spiel selbst. Je nach Gestaltung des Computerspiels kann man mit seinen menschlichen Spielpartnern auch über Spielhandlungen kommunizieren. So bieten beispielsweise einige Spiele die Möglichkeit, mit seinem virtuellen Stellvertreter einen animierten Gruß zu vollziehen oder einen Tanz aufzuführen. Auffallend ist, dass diese Handlungsmöglichkeiten für den direkten Spielerfolg keinen Sinn haben und ausschließlich der zwischenmenschlichen Kommunikation dienen. Da solche virtuellen Kommunikationshandlungen als Programmroutinen festgelegt sein müssen und heutzutage zumeist mit einer animierten Grafik einhergehen, sind ihrer Anzahl und dementsprechend auch dem Variantenreichtum der Ausdrucksmöglichkeiten deutliche Grenzen gesetzt. Aus diesem Grunde ist auch anzunehmen, dass diese Möglichkeit allenfalls eine Ergänzung zu den beiden ersten Kommunikationsmöglichkeiten darstellt, sie aber keinesfalls ersetzt.
Die zweite Möglichkeit, das Telefonieren über ein Head-Set des Computers, stellt zwar ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um sich kommunikativ auszudrücken, aber die Zahl derer, mit denen man mündlich sprechen kann, ist begrenzt, da ab einer gewissen Teilnehmerzahl die Telefonkonferenz ähnliche Situation in einem chaotischem und nicht mehr anhörbarem Stimmenwirrwarr enden würde. Für kleinere Spielergruppen stellt diese Methode dennoch eine sinnvolle Alternative zur Verfügung, da man wahrscheinlich schneller sprechen als tippen kann und folglich zwischenmenschliche Absprachen direkter und häufiger getroffen werden können. Wenn man vom Bildtelefon absieht, müsste diese Kommunikationsform die gleichen Charakteristika aufweisen wie das herkömmliche Telefonieren[145]: Grundsätzlich ist das Telefonieren ein mündliches Gespräch und demnach wie jede Face-to-Face-Interaktion spurenlos (von der Möglichkeit der Aufnahme und Überwachung einmal abgesehen). So spricht Axel Zerdick „[…] von dem ‚für das Telefongespräch konstitutive(n) Vertrauen in die Flüchtigkeit des Worts’, das mit zu der eigentümlichen Verbindung von Anonymität und Intimität beitrage, die diese Kommunikationsform charakterisierten.“[146] Edeltraud Bülow weist auf den „[…] Wegfall nonverbaler, d.h. außersprachlicher Kommunikationselemente [hin]: die menschliche Sprache wird auf das akustische Signal reduziert, das Sinnlich-Persönliche bis auf die Stimme ausgeschaltet. […] Auch die situative Einbindung des Gesprächspartners, sein räumliches Umfeld, ist nicht ersichtlich, so dass sich […] ein ‚semiotisches Vakuum’ ergebe, das durch gegenseitige Fiktionalisierung von Person und Situation bei Sprecher und Hörer gefüllt werden.“[147] „Aufgrund der Nicht-Sichtbarkeit wird nicht nur die Fantasie angeregt, sondern es ergeben sich mit der geringeren Hemmschwelle auch neue Kommunikationschancen. Unangenehmes lässt sich leichter am Telefon ausdrücken, was Menschen jedoch auch dazu hinreißen kann, ausfallend zu werden […]. Hier schützt den Sprecher die bei Telefonkommunikation leicht gewährleistete Anonymität […]. Auch Lügen lassen sich auf diese Weise viel einfacher vermitteln. […] Die Ortsverschiedenheit und Unsichtbarkeit der Kommunikationspartner sichert insofern breitere Verhaltensspielräume für einen Identitätswechsel als dies bei angesichtiger Kommunikation der Fall ist.“[148]
Betrachtet man jetzt die erste Möglichkeit, die Chat-Kommunikation, so teilt sie auf den ersten Blick einige Charakteristika des Telefonierens über den Computer: die Nicht-Sichtbarkeit, die fehlende situative Einbindung, der Wegfall nonverbaler Kommunikationselemente und damit einhergehend eine größere Anonymität und Chancen für Identitätswechsel scheinen bei der Chat-Kommunikation noch verstärkt, da hier die akustischen Signale durch einen geschriebenen Text ersetzt werden. So weist das „Chatten“ Parallelen zum mündlichen Gespräch und zum geschriebenen Brief auf. Auch Briefe dienen „[…] dazu, mit Menschen in Kontakt zu treten, von denen man räumlich getrennt ist […]. Da körperliche Signale keine Rolle spielen, manifestiert sich die Identität der Kommunikationspartner allein in dem schriftlich geäußerten Wort sowie in der Wahl des Papiers, Schreibwerkzeugs etc., sowie dem Schriftbild.“[149] Die Chat-Kommunikation zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass dem Gegenüber nur der geschriebene Text zur Verfügung steht, doch aufgrund „[…] ihres elektronischen Charakters erfährt die Kommunikation eine zusätzliche Entpersönlichung, weil die durch Handschrift und Papierwahl etc. im bisherigen Schriftwechsel zumindest noch teilweise gegebene ‚physische Authentizität’ nun gänzlich unterlaufen wird.“[150] Zudem ist die Chat-Kommunikation, anders als der Brief, eine synchrone Kommunikation, während der Email, als asynchrone Kommunikation, der Brief näher stehen würde. Beim Chat wird (anders als beim Brief oder der Email) meist eine unmittelbare Antwort erwartet und bei Computerspielen wird diese Erwartung aufgrund des Handlungsdrucks meist noch verstärkt. Aus diesem Grunde steht die Chat-Kommunikation auch dem mündlichen Gespräch sehr nahe[151]. P. Koch und W. Oesterreicher sprechen von einer „konzeptionellen Mündlichkeit“: „Die zeitliche Unmittelbarkeit und Dialogizität der synchronen computervermittelten Kommunikation schlägt sich in einem veränderten Umgang mit der Schriftsprache nieder: Die schriftlichen Äußerungen folgen oft einer konzeptionellen Mündlichkeit […], indem etwa durch eine verstärkte Integration von umgangssprachlichen und sprechsprachlichen Wendungen Informalität und Sprecher-Hörer-Nähe unterstrichen werden.“[152] „Als Hauptschwierigkeit computergestützter Kommunikation erweist sich jedoch, dass sich die Gesprächspartner weder sehen noch hören können. Sie sind nicht physisch, sondern nur virtuell anwesend und […] dieses ‚semiotische Vakuum’ muss irgendwie gefüllt werden.“[153] Trotz dieser Schwierigkeit ist die Chat-Kommunikation die geläufigste Kommunikationsform bei Computerspielen.[154] So ist noch anzumerken, dass die nonverbale Kommunikation beim Chat nicht unmöglich ist, beispielsweise werden „Emoticons und Smileys“[155] verwendet, um Emotionen auszudrücken. Ein weiteres Phänomen ist das Verwenden von Abkürzungen bzw. Akronyme, z.B. ein lautes Lachen wird mit „lol“ („laughing out loud“) signalisiert. Nicola Döring nennt drei Funktionen, die „der netzspezifischen Sprachvariation zugeschrieben werden können“[156]:
a) „Ökonomiefunktion: Eine verstärkte Verwendung von Kurzformen, durchgängige Kleinschreibung, Verzicht auf Satzzeichen – diese Elemente von Internet-Sprachen sind besonders beim synchronen […] Austausch nützlich, um Zeit und Aufwand beim Tippen einzusparen.“
b) „Identitätsfunktion: Mit der Verwendung von Internet-Fachbegriffen, Jargon […] und netzspezifischen expressiven Ausdrucksmitteln usw. unterstreichen Netznutzer sprachlich ihre Identifikation mit der Netzkultur bzw. mit bestimmten Szenen, Subkulturen und Gruppen innerhalb des Netzes.“
c) „Interpretationsfunktion: Rechtschreibfehler, Umgangssprache, Dialektales, Jargon und unvollständige Grammatik geben maschinenschriftlichen Botschaften, die historisch eher formal und bürokratisch konnotiert sind, den Anstrich des Informellen und Ungezwungenen.“
Zusammenfassend kann man die Chat-Kommunikation als „Verschriftlichung der Sprache“[157] bezeichnen: „Die Übergänge zwischen Sprache und Schrift werden fließend. […] Es ist dieses performative Schreiben eines Gesprächs, in dem Sprache interaktiv geschrieben statt gesprochen wird, das ich als Verschriftlichung der Sprache bezeichne.“[158]
Wenn man jetzt allgemeiner die intersubjektive Ebene einer sozialen Interaktion betrachten, also die gemeinsame Situationsdefinition, dann kann man in Anlehnung an die „Kanalreduktionsmodelle“[159] und insbesondere der „Social Presence Theory“[160] davon ausgehen, dass je weniger Sinnesmodalitäten in eine computervermittelte Kommunikation einbezogen werden, „[…] desto weniger ist man sich der Anwesenheit anderer Personen bewusst und desto unpersönlicher werden die Interaktionen. […] Je weniger Kanäle nonverbale Elemente transportieren können und damit als Rückkanal für die Übertragung des Feed-back bereit stehen, desto geringer wird die soziale Präsenz bei einer solchen Interaktion sein."[161] Fraglich an dieser Sichtweise ist aber, „[…] warum getippter Text nicht geeignet sein sollte, Gefühle zu kommunizieren, Intimität herzustellen oder sinnliche Eindrücke zu erzeugen […]“[162] ? In eine etwa andere Richtung zielen „Filter-Modelle“[163], sie gehen zwar auch von einer Verringerung der Kommunikationskanäle und einem damit einhergehenden Informationsverlust aus, aber statt „[…] pauschal von einer Verarmung und Ent-Wirklichung auszugehen, spitzen Filter-Modelle den Informationsverlust darauf zu, dass man bei textbasierter Telekommunikation durch Ent-Kontextualisierung wenig über den sozialen bzw. soziodemografischen Hintergrund (Alter, Aussehen, Bildung, Status, Vermögen etc.) einer anderen Person weiß […]. In einer rein textvermittelten Kommunikationssituation, in der sogar völlige Anonymität bzw. Pseudonymität möglich ist, tritt hinsichtlich solcher sozialen Hintergrundvariablen ein Nivellierungseffekt ein […]. Eine solche Nivellierung baut gemäß dem Filter-Modell soziale Hemmungen, Hürden, Privilegien und Kontrollen ab. Dieser enthemmende Effekt begünstigt sowohl verstärkte Offenheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Partizipation und Egalität, als auch – vor allem im Konfliktfall - verstärkte Feindlichkeit, Anomie, normverletzendes und antisoziales Verhalten.“[164] Gegenüber diesen beiden Modellen geht J. B. Walther im Rahmen seiner „Theorie der sozialen Informationsverarbeitung“[165] vielmehr davon aus, „[…] dass es erst gar nicht zu medienbedingter Kommunikationsverarmung kommen muss. […] Gemäß sozialer Informationsverarbeitung ist beim Fehlen nonverbaler Informationen […] nicht etwa die Beziehungsebene ausgeblendet, Emotionalität reduziert oder der soziale Hintergrund herausgefiltert, sondern werden genau diese Informationen eben einfach auf andere Weise – durch Textzeichen – ausgedrückt. […] Im Unterschied zur zivilisationskritischen und pessimistischen Haltung des Kanalreduktions-Modells ist aus Sicht der Theorie der sozialen Informationsverarbeitung das Internet ein neuer sozialer Handlungsraum, in dem Menschen auf kreative Weise Gefühle ausdrücken, Beziehungen realisieren und soziale Fertigkeiten erlernen, ohne dass dabei automatisch Kommunikationsstörungen und Beziehungsverarmung resultieren müssen.“[166] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle drei Theorien von einer Reduktion der Sinnesmodalitäten ausgehen, aber bezüglich der Frage, ob diese Reduktion mit einer Verarmung der Kommunikation einhergeht oder ob die Mängel aktiv kompensiert werden, uneinig sind.
3.2.2.2. Virtuelle Identitäten als subjektive Vorgegebenheiten
Neben der gemeinsamen Situationsdefinition der Interaktionsteilnehmer ist die zweite Sinnebene der Kommunikation ihre jeweiligen subjektiven Vorgegebenheiten, ihre Persönlichkeit bzw. Identität. „Unter Identität im modernen Sinne versteht man das Bewusstsein einer Person, sich von anderen Menschen zu unterscheiden (Individualität) sowie über die Zeit (Kontinuität) und über verschiedene Situationen (Konsistenz) hinweg im Kern dieselbe, durch bestimmte Merkmale ausgezeichnete Person zu bleiben […]. Identitätsmerkmale in diesem psychologischen Sinne sind also nicht nur Name, Adresse, Geburtstag, Augenfarbe oder Körpergröße, die Identifizierbarkeit sicher stellen […], sondern auch die Persönlichkeitsattribute, Fähigkeiten, Werte, Ziele usw., mit denen eine Person sich definiert und interpretiert. Diese Selbstinterpretation entwickelt sich in Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungen, Einschätzungen und Reaktionen der Umwelt […].“[167] Auf diese Dialektik der Identität weisen auch Berger und Luckmann hin: „Identität ist natürlich ein Schlüssel zur subjektiven Wirklichkeit, und wie alle subjektive Wirklichkeit steht sie in dialektischer Beziehung zur Gesellschaft. Sie wird in gesellschaftlichen Prozessen geformt. […] Die gesellschaftlichen Prozesse, durch die sie geformt und bewahrt wird, sind durch die Gesellschaftsstruktur determiniert. Umgekehrt reagiert Identität, die durch das Zusammenwirken von Organismus, individuellem Bewusstsein und Gesellschaftsstruktur produziert wird, auf die vorhandene Struktur, bewahrt sie, verändert sie oder formt sie sogar neu.“[168] Für den Fall der Face-to-Face-Interaktion zeigt Goffman, dass wir uns auch beständig zwischen zwei Polen bewegen: Einerseits müssen wir uns den gesellschaftlichen Regeln und insbesondere den Regeln der Interaktion fügen, damit wir eine gerade ablaufende Interaktion nicht stören bzw. gefährden – natürlich erwarten wir dies auch von unseren Interaktionspartnern. Andererseits wollen wir uns nicht von einem allzu großen Konformitätsdruck beeinträchtigen lassen, wir wollen auch unsere „[…] Unabhängigkeit zum Ausdruck bringen, und sei es durch sekundäre Anpassung und den Aufbau einer abgeschotteten Eigenwelt.“[169] Für Goffman besitzt daher ein Individuum auch mehrere Identitäten bzw. Teilidentitäten, die an die spezifischen Situationen angepasst sind. Beispielsweise gibt man seiner Geliebten eine andere Teilidentität preis, als dem Gros seiner Berufskollegen. Eine Person verfügt über eine „[…] Vielzahl von gruppen-, rollen-, raum-, körper- oder tätigkeitsbezogenen Teil-Identitäten (z.B. Berufs-Identität, Familien-Identität, Geschlechts-Identität, […] religiöse Identität). Diese Teil-Identitäten bilden zusammen kein stabiles und homogenes Ganzes, sondern eher ein – in lebenslanger Entwicklung befindliches […]“[170] Konstrukt. Grundlegend lassen sich die Teil-Identitäten eines Menschen danach differenzieren, ob sie einer individuellen oder einer kollektiven Identität zuzuordnen sind: „Identifiziert sich die Person gerade über individuelle Besonderheiten wie etwa ihre körperlichen Attribute oder spezifischen Vorlieben und Fähigkeiten, in denen sie sich von anderen Menschen in charakteristischer Weise abhebt, so spricht man von personaler Identität. Identifiziert sie sich dagegen gerade mit den Merkmalen einer sozialen Gruppe oder sozialen Kategorie, deren Mitglied sie ist und mit deren Gruppenmitgliedern sie sich als ähnlich wahrnimmt […], so spricht man von sozialer Identität. […] Während soziale Identitäten auf der Selbstinterpretation als austauschbares Gruppenmitglied beruhen, betonen personale Identitäten die Distinktheit von allen anderen Menschen […].“[171]
Individuen der heutigen Zeit (zumindest in den westlichen Gesellschaften) sind „[…] nicht mehr in einem homogenen sozialen Raum verortet, sondern sie sind sozio-kulturelle Grenzgänger, die höchst unterschiedliche Lebensbereiche koordinieren und integrieren müssen, in denen jeweils andere Anforderungen, Regeln und Normen gelten. Sie sind in verschiedenen Kontexten zu Hause, wobei Rahmungen und Modulationen[172] im Sinne Goffmans bestimmen, was hier zulässig und/oder gefordert ist. Identität ist somit heute partizipative oder multiple Identität, da aufgrund individuell arrangierter räumlicher, zeitlicher, sachlicher und sozialer Rollentrennungen mehrere (Teil-) Identitäten und Selbstdarstellungen neben- und nacheinander existieren. […] Wo die Relevanz von Rollen und Traditionen abnimmt, wächst die Bedeutung von situationalen Selbstdarstellungen. […] Gerade bei der Identitätsentwicklung und –darstellung spielen nun Medien eine zunehmend wichtigere Rolle. Ihre symbolischen und virtuellen Welten repräsentieren Ressourcen und Resonanzräume für unterschiedlichste Subjektivitätsformen und Ich-Entwürfe.“[173] Nach S. Turkle kann man insbesondere die virtuellen Gesprächs- und Spielgemeinschaften im Internet als „Laboratorien für Identitätsarbeit“[174] sehen, die dem Individuum eine Fülle von Möglichkeiten bietet, neue bzw. unterdrückte Identitätsentwürfe auszuleben. Als Hauptgrund sieht sie dafür den Verlust der Körperlichkeit, so kann man beispielsweise in einem Internet-Chat in die Rolle des anderen Geschlechts schlüpfen und wird dann auch so wahrgenommen. S. Turkle sieht folglich in dem Internet ein Potential, Wunschvorstellungen über die eigene Person verwirklichen zu können. Nicola Döring trifft in diesem Zusammenhang noch eine wichtige Unterscheidung: Von einer „virtuellen Identität“ spricht sie nur dann, wenn „[…] eine dienst- oder anwendungsspezifische, mehrfach in konsistenter und für andere Menschen wieder erkennbarer Weise verwendete, subjektiv relevante Repräsentation einer Person im Netz gemeint“[175] ist. Ansonsten spricht sie von einer „virtuellen Selbstdarstellung“, die weder „Dauerhaftigkeit“ noch „subjektive Relevanz“ aufweisen muss: „Beim erst- und einmaligen Anmelden mit einem bestimmten Nickname in einem Chat ist eine Online-Selbstdarstellung[176] erschaffen, die vielleicht nur zwanzig Minuten besteht, weil die betreffende Person dann den Chat wieder verlässt, ihn nie wieder aufsucht und auch den Nickname nie wieder verwendet. […] Nur ein Bruchteil aller Online-Selbstdarstellungen sind also Online-Identitäten.“[177] Zu beachten ist, dass sowohl eine virtuelle Identität wie auch alle virtuellen Selbstdarstellungen immer dienst- oder anwendungsspezifisch sind. Damit ist gemeint, dass die jeweiligen Dienste wie E-Mail, IRC, Online-Computerspiele usw. jeweils unterschiedliche Selbstdarstellungs-Requisiten bieten und auch inhaltlich differente Kommunikationsbereiche ansprechen und somit die Konstruktion der virtuellen Selbstdarstellung bzw. Identität entscheidend beeinflussen. Allgemein ist nach den Kanalreduktions- und Filtermodellen zu erwarten, dass aufgrund der Chat-Kommunikation individuelle Besonderheiten und vor allem auch Gruppenzugehörigkeiten herausgefiltert werden. Vorteilhaft könnte dabei sein, „das mit dem Herausfiltern hierarchisierender und stereotypisierender Merkmale und Identitäten (z.B. Geschlecht, Alter, Sozialstatus, Ethnizität usw.) eine gleichberechtigtere Online-Kommunikation“[178] stattfindet. Gerade die Anonymität bzw. Pseudonymität wird im Zusammenhang mit virtuellen Selbstdarstellungen bzw. Identitäten immer wieder angeführt: „Anonymität in physischen Umgebungen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Menschen zwar körperlich begegnen, aber darüber hinaus wenig oder nichts voneinander wissen. Name, Herkunft und Lebenskreis des Gegenübers sind nicht bekannt bzw. nicht unmittelbar mit dem eigenen Lebenskreis verschränkt. […] Die anonyme Umgebung bringt Distanz zum Geschehen mit sich, weil die Individuen weniger emotional eingebunden sind. Zugleich bereitet der Mangel an Informationen über die anwesenden Mitmenschen aber auch den Boden für Spekulation und Illusion.“[179] In Bezug auf Computerspiele ist mit Anonymität gemeint, dass man eine virtuelle Repräsentation nicht einer Person außerhalb der virtuellen Welt zuordnen kann. In diesem Sinn kann man auch von einer Pseudonymität sprechen: „Man kann die pseudonymen Netztexte oder Online-Transaktionen einer Person, die mit dem selben Pseudonym erzeugt bzw. durchgeführt wurden, aufeinander beziehen, jedoch weiterhin nicht mit der Person außerhalb des Netzes in Verbindung bringen.“[180] Bei Computerspielen ist die Pseudonymität vor allem über den gewählten Spielernamen gegeben, aber teilweise auch über den virtuellen Stellvertreter selbst oder über die individuelle Spielweise. So sagt schon Anselm Strauss: „Jeder Name ist ein Behälter, in den die bewussten oder unbeabsichtigten Bewertungen des Namensgebers hineingegossen werden.“[181]
Zusammenfassend kann man Identitätsbildung als selbstreflexiven Prozess verstehen: Indem eine Person ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Typisierungen über sich selbst und der für sie relevanten Eigen- und Fremdgruppen verarbeitet, stellt sie ihre Identität bzw. ihre Teil-Identitäten her. Doch eng damit verbunden ist die noch nicht beschriebene erste Sinnebene einer Kommunikation, die das Objektive der Situation betrifft, also die Normen und institutionalisierten Erwartungen – sie haben entscheidenden Einfluss auf die Identitätsbildung. Diese Ebene kann man im Rahmen einer Interaktion als „soziale Rolle“ (bzw. Rollenerwartung) bezeichnen. Sie steht in einem wechselseitigen Verhältnis zur Identität und sie bedingen sich auch gegenseitig. Zusammen betrachtet stellen die beiden ersten Ebenen sozusagen die Vorbedingungen einer Interaktion dar. Der eigentliche kommunikative Prozess findet wie gesagt in der dritten, intersubjektiven Ebene statt: der gemeinsamen Definition der Situation.
3.2.2.3. Virtuelle Rollen als objektive Gegebenheiten
George Herbert Mead stellte heraus, dass das Individuum durch zwei entscheidende Merkmale gekennzeichnet ist: Durch die schon angesprochene Selbstwahrnehmung und durch Verhaltensantizipation. Personen können das Verhalten der Anderen vorwegnehmen und damit ihr eigenes Handeln an potentiellen Reaktionen von ihren Interaktionspartnern ausrichten. Hieraus resultiert ein verbindliches Muster wechselseitiger Verhaltenserwartungen[182], wenn diese Verhaltenserwartungen nun objektiviert werden, spricht man von einer „sozialen Rolle“. „Rollen sind sozial definierte Erwartungen, die eine Person, die einen bestimmten Status oder eine bestimmte soziale Position bekleidet, befolgt […].“[183] Die Grundlage der Verhaltenserwartungen sind die eigenen Wissensvorräte, Erfahrungen und Typisierungen. Doch Rollen sind keine Typen, vielmehr können Typisierungen zu Rollenerwartungen werden: „Von Rollen können wir erst dann sprechen, wenn diese Form der Typisierung sich innerhalb der Zusammenhänge eines objektivierten Wissensbestandes ereignet, der einer Mehrheit von Handelnden gemeinsam zu eigen ist. In solchem Kontext sind Typen von Handelnden Rollenträger. […] Man weiß nicht nur allgemein, wer zur Rolle gehört, sondern man weiß auch, dass das allgemein gewusst wird. […] Rollen treten in Erscheinung, sobald ein allgemeiner Wissensvorrat mit reziproken Verhaltenstypisierungen entsteht […].“[184] Die soziale Rolle stellt in diesem Sinne die objektive Seite einer Interaktion dar: „Rollen repräsentieren die Gesellschaftsordnung. Diese Repräsentation hat zwei Ebenen. Erstens repräsentiert die gespielte Rolle sich selbst. Rechtsprechen zum Beispiel heißt, die Rolle des Richters spielen. Die Rechtsprechende Person fungiert nicht ‚aus sich heraus’, sondern als Richter. Zweitens repräsentiert die Rolle des Richters einen ganzen Verhaltenskomplex. Seine Rolle steht in Verbindung mit anderen Rollen, deren Gesamtheit die Institution des Rechts ausmacht. Der Richter richtet als der Repräsentant dieser Institution.“[185]
Bei Computerspielen haben wir es vornehmlich mit „virtuellen Spielrollen“ zu tun, so schlüpft man in die Rolle eines Rennfahrers, eines Königs oder einer Ameise. Kennzeichen ist, dass sie nur für den jeweiligen virtuellen Spielplatz eine objektive Relevanz haben und den programmierten Regeln dieses Spiels unterliegen. „Virtuelle Rollen“ dagegen sind zwar auch an den jeweiligen virtuellen Spielplatz gebunden, aber sie haben auch außerhalb der direkten Spielsituation bestand. Beispiele hierfür wäre die Rolle des „Spieladministrators“, des „Neueinsteigers“[186] oder des „Titelverteidigers“. Auch solche Rollen beeinflussen die virtuelle Identität innerhalb des Computerspiels. Es ist aber noch eine zu klärende Frage, inwieweit virtuelle (Spiel-)Rollen bei den jeweiligen Computerspielen vorhanden sind und wie deren Einfluss zu bestimmen ist. [187]
4. Untersuchungsdesign – methodisches Vorgehen
Die bisherigen Ausführungen dienen der Präzisierung der verwendeten Begrifflichkeiten („Konzeptspezifikation“) und der theoretischen Fundierung der nachfolgenden empirischen Erhebung („Theoriebildung“). Der nächste Schritt ist, eine geeignete Untersuchungsform („Forschungsdesign“) zu bestimmen, um dann an dieser die theoretischen Konzepte entsprechend anzupassen, so dass die empirisch erhobenen Sachverhalte zugeordnet werden können („Operationalisierung“).
Da das Phänomen „Computerspiel“ und insbesondere das Computerspielen via Internet eine relativ neue Erscheinung ist, wird in dieser Arbeit eine qualitative Vorgehensweise verwendet[188]. Qualitative Verfahren besitzen gegenüber quantitativen Vorgehensweisen den Vorteil der Tiefenstruktur (auf Kosten der Repräsentativität und Vergleichbarkeit), da es keine begrenzenden Antwortkategorien gibt und so die Befragten offen und flexibel antworten können.[189] Geht man zudem von der aktiven und unterschiedlichen Verarbeitung des Computerspielkonsums aus, so schützt diese Methode vor dem Fehler, dass der Forscher seine Vorstellungen und Interpretationen auf die möglichen Antwortkategorien überträgt und so den Befragten dementsprechend einengt. Hieraus ergibt sich auch der explorative Charakter dieser Arbeit, die man als eine Explorationsstudie verstehen kann, mit deren Hilfe möglichst viele Aspekte der Interaktion und Kommunikation beim Computerspiel erfasst und beschrieben werden sollen. Anhand dieser Beschreibungen könnten dann Tendenzen bzw. auch neue Tendenzen erkannt werden und folglich Ansatzpunkte für spezifischere, vielleicht auch quantitative Erhebungen gegeben werden. Anzumerken ist, dass ein derartiges Vorgehen ausschließlich deskriptive Aussagen liefert, während Kausalzusammenhänge nicht erkannt werden können. „Qualitative Sozialforschung ruht auf zwei Säulen: Auf einer Vorstellung über den Aufbau von Gesellschaft und auf Regeln wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns über die Gesellschaft, die auf der inhaltlichen Konzeption aufbauen. […] Alle Handlungen und somit auch alle Aussagen im Interview sind durch die Strukturen und Prozesse der Lebenswelt beeinflusst, die eine Person umgeben. […] Auf der Basis dieser Vorstellung liegt es daher nahe, empirische Analysen auf genau diese Wechselwirkung zwischen den Personen und ihrer sozialen Umwelt abzustimmen.“[190]
4.1. Forschungsdesign: Auswahl des Messinstruments
Da das Ziel dieser Arbeit ist, die empirisch erhobenen Aussagen zu den verschiedenen Interaktionsformen während eines Computerspiels in dem zuvor systematisch aufgebauten Theoriekomplex einzuordnen, bietet sich meines Erachtens ein teilstandardisiertes Interviewverfahren an. So können die angesprochenen Themenbereiche des Interviews schon im Rahmen der Fragestellung auf die entsprechenden Theorieaspekte gelenkt werden, und da die Antwort vom Interviewten offen formuliert werden kann, behalten sie einen explorativen Charakter. Uwe Flick spricht in diesem Zusammenhang von einer „Strukturierung durch Subjekt und Forscher“: „Hier soll das Subjekt themenspezifisch zum Sprechen (hier: Antworten) gebracht werden. Die Dynamik der Datensammlung ist hier eng mit der Hauptaufgabe des Forschers verknüpft, die darin besteht, zwischen den Äußerungsinteressen des befragten Subjekts (und damit auch dem Fluss des Gesprächs), der Struktur des Leitfadens sowie der begrenzten Zeit zu vermitteln.“[191] Ein zentrales Charakteristikum dieser Interviewform ist, dass sie mit einem zuvor angefertigten Interviewleitfaden einhergehen, in dem die einzelnen Theoriebereiche auf mehr oder weniger gelungene Fragestellungen operationalisiert werden. Doch der Interviewleitfaden soll nicht als eng gefasste Ablaufvorgabe gefasst werden, sondern vielmehr als Kontrollliste dienen, um nachzuvollziehen, welche Bereiche schon ausreichend erörtert wurden und welche noch weiterer Fragen bedürfen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Fragen im Interviewleitfaden nicht zu eng gefasst werden, damit der Befragte noch genug Freiraum für seine Antwort hat und nicht mit völlig unerwarteten und unbekannten Themen konfrontiert wird. Denn dies kann zur Folge haben, dass er nicht mehr nach seiner Einstellung her antwortet. Zudem ist es wichtig, dass das Interview selbst einen ungezwungenen und freien Charakter hat, damit der Interviewte zu ausgedehnten Antworten animiert wird, sozusagen eher ins Erzählen übergeht. Daher ist auch die Positionierung der jeweiligen Fragen, bis auf die Einstiegsfrage, vorher nicht festzulegen, sondern muss je nach Interviewablauf angepasst werden. Damit aber dennoch alle zu analysierenden Theorieaspekte angesprochen werden, sind während des Interviews Vertiefungsfragen und später auch Fragen, die nicht gerade den Interviewfluss fördern, unerlässlich. „In der Regel werden die Interviewerinnen und Interviewer bei teilstandardisierten […] Interviews zugleich dazu aufgefordert, die im Leitfaden vorgegebenen Fragen nach eigenem Ermessen und nach Einschätzung des theoretischen Anliegens der jeweiligen Studie durch klärende Nachfragen zu ergänzen und Gesichtspunkte aufzugreifen, die von den Befragten unabhängig vom Gesprächsleitfaden in die Interviewsituation eingebracht werden, sofern diese im Fragekontext der Untersuchung als bedeutsam erscheinen.“[192] Als theoretische Grundlage kommen für die empirische Erhebung zwei Interviewformen in Betracht, die aber in dieser Arbeit nur teilweise durchgeführt werden können:
a) „Problemzentrierte Interview“ nach Andreas Witzel: Bei dieser Interviewform „[…] werden anhand eines Leitfadens, der aus Fragen und Erzählanreizen besteht, insbesondere biographische Daten mit Hinblick auf ein bestimmtes Problem thematisiert. Dieses Interview ist durch drei zentrale Kriterien gekennzeichnet: Problemzentrierung, d.h. ‚die Orientierung des Forschers an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung’; Gegenstandsorientierung, das heißt, dass die Methoden am Gegenstand orientiert entwickelt bzw. modifiziert werden sollen; schließlich die Prozessorientierung in Forschungsprozess und Gegenstandsverständnis. […] Witzel benennt als vier ‚Teilelemente’ des von ihm konzipierten Interviews: ‚Qualitative Interviews’, die ‚biographische Methode’, die ‚Fallanalyse’ und die ‚Gruppendiskussion’ […].“[193] Die „Problemzentrierung“ und „Gegenstandsorientierung“ sind auch Kriterien dieser Arbeit, aber die Prozessorientierung kann nur bedingt erfüllt werden, da nur eine Erhebung durchgeführt wird. Auch mit Blick auf A. Witzels „Teilelemente“ kann hier nur das „qualitative Interview“ durchgeführt. Dieses soll „einen vorgeschalteten Kurzfragebogen, den Leitfaden, die Tonbandaufzeichnungen und das Postscriptum (Interviewprotokoll) [umfassen]. Der Leitfaden soll zwar dazu beitragen, den ‚vom Befragten selbst entwickelten Erzählstrang’ […] zum Tragen kommen zu lassen. Jedoch ist er vor allem die Grundlage dafür, ‚etwa bei stockendem Gespräch bzw. bei unergiebiger Thematik’ dem Interview eine neue Wendung zu geben.“[194] Ein Kurzfragebogen mit dem vor allem demographische Daten vorab ermittelt werden können, hat den Vorteil, dass das eigentliche Interview um eben diese Fragen entlastet wird.
b) „Fokussiertes Interview“ nach Robert K. Merton und Patricia L. Kendall: Die Grundlagen dieser Interviewform wurden im Zusammenhang mit Kommunikationsforschung und Propagandaanalyse entwickelt. „Zentral für diese Interviews ist die Fokussierung auf einen vorab bestimmten Gesprächsgegenstand bzw. Gesprächsanreiz – wie etwa einen Film, den die Befragten gesehen haben, einen Artikel, den sie gelesen haben, eine bestimmte soziale Situation, an der sie teilhatten und die auch den Befragenden bekannt ist, […] und der Versuch, Reaktionen und Interpretationen im Interview in relativ offener Form zu erheben.“[195] Für die Durchführung eines fokussierten Interviews nennen R.K. Merton und P.L. Kendall vier Kriterien[196]: 1) Die „Nicht-Beeinflussung: Die Führung und Lenkung des Gesprächs durch den Interviewer sollte auf ein Minimum beschränkt sein.“[197] Dies kann wie schon erwähnt durch die Frageform gewährleistet werden, indem mit unstrukturierten Fragen begonnen wird, dann halbstrukturierte und zum Schluss strukturierte Fragen folgen, bei denen sowohl der konkrete Aspekt wie die Antwortmöglichkeiten („Ja“ oder „Nein“) vorgegeben sind. 2) Die „Spezifität: Die von den Versuchspersonen gegebene Definition der Situation soll vollständig und spezifisch genug zum Ausdruck kommen.“[198] Hiermit ist gemeint, dass die jeweiligen Themengebiete zuvor detailliert genug ausgearbeitet werden. Zu beachten ist allerdings, dass man den Befragten dabei nicht in die zuvor herausgearbeitete Theorierichtung „drängt“ und ihm Antworten suggeriert. 3) „Erfassung eines breiten Spektrums: Im Interview sollte das ganze Spektrum der auslösenden Stimuli sowie der darauf folgenden Reaktionen der Befragten ausgelotet werden.“[199] Damit ist im Grunde gemeint, dass alle ausgearbeiteten Themen und Aspekte auch angesprochen werden. Dennoch soll gewährleistet sein, dass der Interviewablauf fließend bleibt und keinen zu starren Charakter erhält, die Antworten sollen noch einen erzählenden Charakter behalten. 4) „Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen: Das Interview soll die affektiven und wertbezogenen Implikationen der Reaktionen der Befragten ans Licht bringen, um herauszufinden, ob die gemachte Erfahrung für sie eine zentrale oder nur marginale Bedeutung hat.“[200] Ziel soll sein, „ein Höchstmaß an selbstenthüllenden Kommentaren des Informanten darüber, wie er das Stimulusmaterial erfahren hat, zu erhalten.“[201] Allgemein ist festzuhalten, dass diese Kriterien sehr idealtypisch sind und in der Praxis schwer vollkommen zu realisieren sind, dennoch markieren sie die grundlegende Vorgehensweise während des Interviews. Die fokussierte Situation ist dabei das zu Zeit vom Befragten ausgiebig gespielte Computerspiel.
Die verwendete Interviewform stellt eine Mischform aus den beiden (doch sehr ähnlichen) Theorien dar. So gibt es eine Fokussierung auf eine bestimmte Situation: Die Befragten zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Zeitraum der Erhebung ein Computerspiel ausgiebig spielten (durchschnittlich mindestens eine Stunde täglich) und meinerseits eine vorhergehende Analyse der theoretischen Grundlagen des Phänomens „Computerspiel“ erfolgte. Das zentrierte Problem sind die Grundlagen der Interaktion und Kommunikation auf virtuellen Spielplätzen. Von A. Witzel wird die Idee des standardisierten Vorabfragebogens[202] übernommen, indem sowohl soziodemographische Daten, wie das zu Zeit gespielte Computerspiel und die investierte Zeit ermittelt werden. Der Interviewleitfaden und die Durchführung des Interviews sollen im Grunde den Kriterien beider Theorien entsprechen.[203] [204]
4.2. Operationalisierung: Konstruktion des Kategoriensystems und des Interviewleitfadens
Die systematische Aufgliederung der verschiedenen fokussierten Theorieaspekte dient in doppelter Hinsicht als Grundlage: Zum einen werden aus ihr heraus die grundlegenden Fragen für den Interviewleitfaden herausgearbeitet, so dass schon bei einer richtig verstandenen Frage die Antwort zu gewissen Teilen auf diesen Themenbereich zugespitzt ist. Zum anderen dient dieses System als Auswertungsschema, anhand dessen die jeweiligen Textpassagen der Transkripte zugeordnet werden.
Betrachtet man die virtuellen Spielplätze grundlegend, so lassen sich zwei Perspektiven wählen: Zum einen können die Rahmenbedingungen, die Grenzen bzw. Anforderungen ohne jegliche Interaktion betrachtet werden. Damit ist gemeint, man wählt eine Außenschau und betrachtet die strukturellen Bedingungen der virtuellen Spielwelt. Anhand der zuvor dargelegten Theorie sind dies die technischen Möglichkeiten, die der Computer setzt und die Wesensmerkmale, die einem Spiel zugeschrieben werden. Die Strukturmerkmale eines Computerspiels (Präsentation, Inhalt, Regeln und Dynamik) finden ihre direkte Entsprechung in der „strukturellen Koppelung“ einer Mensch-Computer-Interaktion und werden in der folgenden Erhebung und Auswertung im Rahmen der zweiten Perspektive betrachtet. Diese bezieht sich auf die Innenschau, also auf die Betrachtung der Interaktions- und Kommunikationsprozesse innerhalb eines Computerspiels. Doch aufgrund der verschieden gearteten Interaktionsformen zwischen Menschen auf der einen und Mensch und Computer auf der anderen Seite werden sie auch in der Auswertung separat dargestellt.
Anhand dieses Kategoriensystems wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, bei dem für jede Kategorie eine etwa allgemeiner gehaltene Einleitungsfrage formuliert wurde, mit jeweils daran anschließenden spezifischeren Unterfragen. Die Einzelfragen wurden mehreren Personen zum Verständnistest vorgelegt und bei Bedarf modifiziert. Im Anhang befindet sich der endgültige Interviewleitfaden nach erfolgten Probeinterviews. Anzumerken ist, dass die Reihenfolge der einzelnen Fragen, bis auf die erste Einleitungsfrage, nicht verbindlich ist. Je nach bereits erörterten Themen wurden manche Fragen gar nicht gestellt, da die Antworten schon ausreichend waren. In wenigen Fällen ist es auch vorgekommen, dass Vertiefungsfragen gestellt wurden, die nicht im Interviewleitfaden stehen, diese wurden dann im Transkript genau kenntlich gemacht.
4.3. Gütekriterien: Bestimmung der Reliabilität und Validität
Der nächste Schritt ist, den zuvor konstruierten Interviewleitfaden und den geplanten Ablauf der Interviewdurchführung einem Pretest zu unterziehen, d.h. in diesem Fall ein bzw. zwei Probeinterviews durchzuführen. Hierbei soll festgestellt werden, ob das geplante Interviewvorgehen auch in einem angemessenen Zeitraum (in etwa zwei Stunden) durchführbar ist und ob die Gütekriterien (Validität und Reliabilität) ein angemessenes Niveau erreichen. Betrachtet man als erstes die Gütekriterien, so ergeben sich folgende Anforderungen:
a) Reliabilität: „Als ‚Reliabilität’ oder ‚Zuverlässigkeit’ kann das Ausmaß bezeichnet werden, in dem wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Messinstrument die gleichen Werte liefern.“[205] Doch wie kann diese Anforderung bei einem qualitativen Interview eingehalten werden? So weisen J. L. Kirk und M. Miller darauf hin, dass Methoden, die kontinuierlich zu unveränderten Messungen bzw. Ergebnissen führen, irreführend sind, da man in Fällen sich wiederholender Aussagen oder Beobachtungen eher von einer bewusst vermittelten Version des Befragten ausgehen kann. Ein weiteres Problem ist, dass das hier untersuchte Phänomen „Computerspiel“ raschen Veränderungsprozessen unterliegt und folglich einem quantitativen Reliabilitätsverständnis entgegen wirkt.[206] In einer qualitativen Forschung erhält Reliabilität „[…] ihre Bedeutung als Kriterium nur vor dem Hintergrund einer spezifischen Theorie über den Gegenstand und über die Verwendung von Methoden“[207], die dem untersuchten Phänomen angemessen erscheinen. Dabei gilt es zu beachten, dass „[…] das Zustandekommen der Daten dahin gehend expliziert werden, dass überprüfbar wird, was Aussage des jeweiligen Subjekts ist und wo die Interpretation des Forschers schon begonnen hat. […] Andere Verständnisweisen von Reliabilität wie die beliebig häufige Wiederholbarkeit von Erhebungen mit denselben Daten und Resultaten sind dagegen zurückzuweisen.“[208] Reliabilität in qualitativen Verfahren gründet auf Intersubjektivität, d.h. man versucht, eine erhöhte Objektivität zu erreichen, indem verschiedene Interview- und Interpretationsteams herangezogen werden. Mit aus diesem Grund ist daher eine Tonband- bzw. Videoaufnahme des Interviews unerlässlich. „Um der Natürlichkeit der Situation möglichst nahe zu kommen, empfiehlt es sich, den technischen Aufwand der Aufzeichnung auf das durch die Fragestellung und den theoretischen Rahmen tatsächlich Notwendige zu begrenzen […] – sowohl hinsichtlich der Zahl der aufgezeichneten Dokumente (Gespräche) als auch, was die Vollständigkeit des Zugriffs betrifft.“[209]
b) Validität: „Unter ‚Validität’ (Gültigkeit) eines Messinstrumentes versteht man das Ausmaß, in dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen sollte.“[210] Das erste Kriterium für die Validität wurde schon erwähnt, gemeint ist die Auswahl der richtigen Methode für den Untersuchungsgegenstand. Allein diese Tatsache schafft Validität, da eine Methode, die für den Untersuchungsgegenstand nicht geeignet wäre, auch keine verwertbaren Ergebnisse erzeugt. Zudem ist es wichtig, die verwendeten Hauptfragen zu den jeweiligen Themenbereichen im Vorfeld danach zu testen, ob sie entsprechend verstanden werden. Wenn man dabei von der Position eines „subtilen Realismus“[211] nach M. Hammersley ausgeht, „[…] wird die Frage der Validität von qualitativer Forschung zu einer Frage, inwieweit die Konstruktionen des Forschers in den Konstruktionen derjenigen, die er untersucht hat, begründet sind […] und inwieweit für andere diese Begründetheit nachvollziehbar wird […]. Damit wird das Zustandekommen der Daten ein Ansatzpunkt für die Bestimmung der Validität […], ein anderer die Darstellung von Phänomenen und daraus abgeleiteten Schlüssen.“[212]
Um die Gütekriterien annäherungsweise einzuhalten, sollen grundlegend alle durchzuführenden Interviews nach dem gleichen Schema ablaufen: Sie sollen erstens in der heimischen Atmosphäre des Interviewten stattfinden und im Idealfall die Form eines informellen Gesprächs annehmen. Der Umfang soll ca. eineinhalb bis zweieinhalb Stunden betragen. Zweitens sollen die Interviews mit Hilfe eines Tonbandgerätes aufgenommen werden. Um die Situation nicht zu künstlich wirken zu lassen, wird sich in dieser Arbeit für ein handgroßes Diktiergerät entschieden, dass in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb des direkten Blickfeldes positioniert wird. Drittens soll jedes Interview mit der gleichen Einleitungsfrage beginnen, aber je nach Verlauf wird die Ablaufstruktur des Interviewleitfadens angepasst. So werden die weiteren Hauptfragen passend zu den vorherigen Antworten gestellt. Da sich die Fragen aber auf verschiedene Themenbereiche beziehen und sie zudem nicht gänzlich offen strukturiert sind, sondern ein begrenztes Antwortenspektrum bieten, gilt es, einen Mittelweg zwischen einem offenen Gespräch und themenspezifischen Antworten zu finden. Nicht im Interviewleitfaden stehende Vertiefungsfragen werden dann gestellt, wenn der Befragte zu einem Thema nur unzureichende Angaben macht oder wenn sich eine, aus meiner Sicht unerwartete, neue Sichtweise ergibt. In beiden Fällen sollen die jeweiligen Vertiefungsfragen ebenfalls transkribiert werden. Anhand des Interviewleitfadens, der Tonbandaufnahmen und den darauf ausgearbeiteten Transkripte sollte viertens die Nachvollziehbarkeit gewährleistet sein. Nur bedingt eingehalten werden kann fünftens die Forderung, dass die „Konstruktionen des Forschers in den Konstruktionen“ des Befragten begründet ist, da die anschließende Auswertung anhand der aufgebauten Theorie analysiert werden soll und auf nicht berücksichtigte Aspekte nur in Form eines Hinweis eingegangen werden kann. Dennoch sollen gerade derartige Differenzen explizit aufgeführt werden, um Ansatzpunkte für eventuelle spätere Erhebungen zu geben. Überhaupt nicht einzuhalten ist in dieser Arbeit die Forderung nach Intersubjektivität, d.h. nach verschiedenen Interviewern und Transkriptionsinterpreten, da beide von meiner Person gestellt werden.
Die Durchführung und die Ergebnisse der Probeinterviews sind dem „Anhang 4“ zu entnehmen.
4.4. Stichprobe: Auswahl der Untersuchungseinheiten und Kategorisierung der Computerspiele
Um bei der nachfolgenden Erhebung ein entsprechend breites Spektrum an Computerspielern zu erfassen, gilt es ein wichtiges Problem zu klären. Es gibt nicht das eine Computerspiel, sondern eine Vielfalt von Spieltypen, die sich in ihrer Struktur, ihren Anforderungen und ihrem Potential sehr unterscheiden. Für diesen Zweck bietet sich eine von Jürgen Fritz entworfene „Landkarte der Bildschirmspiele“[213] an, in der die Vielzahl der virtuellen Spielplätze idealtypisch einer überschaubaren Anzahl von Spielkategorien zugeordnet wird:
Abbildung 3: „Landkarte der Bildschirmspiele“ [214]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diesem Dreiecks-Modell werden zwei Ausdehnungsrichtungen zugrundegelegt, die sich auf die drei wesentlichen Spielelemente Denken, Action und Geschichten beziehen. Die jeweiligen Computerspiele können innerhalb, je nach ihrer Beziehung zu den Spielelementen, platziert werden. Wenn man vorerst die beiden Ebenen betrachtet, so ersieht man bei der „horizontalen Ebene“ auf der einen Seite, inwieweit Denken und indirektes, zeitverzögertes Handeln gefordert wird oder inwieweit Action und direktes, unmittelbares Handeln zum Spielziel führt. Bei der „vertikalen Ebene“ auf der anderen Seite ersieht man, ob ein eher einförmiges Geschehen mit Einzelabläufen vorliegt oder ob eine komplexe Geschichte entfaltet wird, mit einem geschlossenen Geschehensablauf.
Wenn man nun die drei Spielelemente in ihren Endpunkten betrachtet, also in ihrer reinsten Ausprägungsform und ihnen idealtypisch die verschiedenen Spielkategorien zuordnet, ergibt sich die nachfolgende Unterteilung[215]:
a) „Action“: Der Spieler handelt hier mit Hilfe eines elektronischen Stellvertreters, d.h. einer Spielfigur, mit der er das Spielgeschehen beeinflussen kann. Unmittelbarer Handlungsdruck und Reaktionsschnelligkeit stehen im Mittelpunkt, da die Eingabebefehle des Spielers direkt von der Spielfigur umgesetzt werden („Echtzeit-Modus“). Folglich bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken, man muss schnell auf die unterschiedlichen Spielsituationen reagieren, und dies gelingt am besten mit einer funktionierenden Auge-Hand-Koordination sowie einer guten Konzentrationsfähigkeit und Stressresistenz. Hauptziel des Spielers ist das Entwickeln von „effektiven Verhaltesmustern“, um die Spielhindernisse zu meistern. Und diese einstudierten Bewegungsabläufe müssen immer schneller, präziser und wirkungsvoller werden, da die meisten Computerspiele dieser Kategorie mit zunehmender Spieldauer immer schwerer und anspruchsvoller werden. Diesem Spielelement werden die „Action-Spiele“ bzw. „Geschicklichkeitsspiele“ zugeordnet, weil es hier in der Regel um gezielte Bewegungen und ausdauerndes Reaktionsvermögen geht.
b) „Denken“: Dieses Spielelement liegt förmlich dem Action-Element gegenüber. Wie der Name schon sagt, geht es hier um planvolles, durchdachtes Handeln, um die Spielsituationen zu meistern. Hier gibt es auch keine Spielfigur, die man steuert, sondern man steuert außerhalb in seiner „Schaltzentrale“, von wo aus man Befehle verschickt und mit Hilfe diverser, abstrakter Regulationen das Spielgeschehen beeinflusst. Der Computer reagiert auch nicht direkt und unmittelbar, sondern erst dann, wenn der Spieler bestätigt, dass alle seine Eingaben beendet sind („Turn-Modus“ bzw. rundenbasierte Spiele). Dies ist auch notwendig, da man für die komplexen Überlegungen und strategischen Pläne eine längere Bedenkzeit benötigt, um erfolgreich zu sein. Als reinste Spielkategorie lassen sich hier die „Denk- und Logikspiele“ einordnen, bei denen es vornehmlich um das Lösen von logischen Problemen geht bzw. um das Aufklären von Rätseln.
c) „Geschichten“: Bei diesem Spielelement geht es nicht um die Art der Steuerung (d.h. direkt bzw. indirekt) oder ob man unter Zeitdruck schnell reagieren muss bzw. in ausgedehnten Denkphasen komplexe Pläne zu schmieden hat, da sich der Spieler innerhalb einer umfassenden Spielgeschichte, ähnlich einem Roman, befindet. Der Anfang und das Ende sind vorgegeben, aber nicht festgelegt ist, wie man das Spielziel erreicht. Der Spieler selbst legt diesen Weg fest, indem er mit seinen Handlungen die Geschichte fortschreibt, bis er entweder das Ziel erreicht oder einem vorzeitigen Ende erliegt. Dem Spielelement „Geschichten“ gegenüber liegen einzelne, unzusammenhängende Spielsequenzen, in denen sich der Spieler jeweils bewähren muss. Die Kategorie der „Abenteuerspiele“ spricht dieses Element grundlegend an, da in aller Regel eine interaktive, zusammenhängende Erzählung durchlebt wird.
Um nun die Interviewpartner zu ermitteln, habe ich folgendes Vorgehen gewählt: Der standardisierte Kurzfragebogen, der ursprünglich direkt vor Interviewbeginn ausgeteilt werden sollte, wurde dahingehend umfunktioniert, dass er zur Ermittlung von potentiellen Interviewpartnern dient. Dafür teilte ich an acht mir persönliche bekannte potentielle Interviewpartner jeweils mehrere Fragebögen aus, mit der Bitte, dass sie einen selbst beantworten und die anderen an ihnen bekannte potentielle Interviewpartner aushändigen. Dieses Verfahren hat zwei Vorteile: Zum einen wird die ohnehin schon lange Zeitdauer des Interviews um die Beantwortungszeit für den Kurzfragebogen entlastet und zum anderen erhalte ich ein größeres Spektrum von möglichen Interviewpartnern, aus denen ich die geeigneten aussuchen kann. Bei der Auswahl geht es vor allem darum, eine möglichst gleiche Verteilung der Untersuchungseinheiten auf die drei Computerspielkategorien (Action, Denken, Geschichten) zu erreichen.
Als potentielle Interviewpartner kommen nur solche Personen in Frage, die nach ihrer Einschätzung durchschnittlich täglich mindestens eine Stunde Computer spielen. Zudem sollten sie männlich[216], über 20 Jahre alt sein und mindestens eine mittlere Schulbildung haben. Da ich jedem dieser acht Personen die Bitte stellte, wenn möglich zwei bis vier weitere interviewbereite Personen in ihrem Freundeskreis ausfindig zu machen (als einzige Bedingung erhielten sie, dass die Person gern am Computer spielen soll), erhoffte ich eine absolute Rücklaufzahl von mindestens zwanzig potentiellen Interviewpartnern, inklusive den ursprünglichen acht Personen, die auf jeden Fall zur Verfügung standen.
Insgesamt waren es nur 17 Personen, die für ein Interview bereitstanden, die zudem noch dahingehend überprüft werden mussten, ob sie auch die Bedingungen erfüllten:
Vorab wurde eine Person herausgefiltert, da sie keine Angabe zur investierten Zeit für das Computerspielen machte. Zwei weitere Personen wurden herausgenommen, da sie im Vergleich zu den anderen potentiellen Interviewpartnern nur „ca. 1 Stunde“ spielten. So dann wurde mit den übrigen 14 Personen durch Experimentieren eine Verteilung angestrebt, bei der alle drei Spielkategorien gleichmäßig abgedeckt werden, d.h. jeweils drei Interviewpartner für eine Kategorie. Zudem sollten zwei der drei Personen das jeweilige Computerspiel auch gemeinsam mit anderen Menschen nutzen, d.h. in Form einer realen Vernetzung („Netzwerkspiel“) oder in Form einer virtuellen Vernetzung („Onlinespiel“). Zu beachten ist, dass jede Person zu zwei verschiedenen Computerspielen befragt werden sollte. Ausnahme bildet eine Person, die mein Interesse erweckte, da sie explizit nur ein Spiel angegeben hat und zudem einen sehr hohen Zeitaufwand für das Computerspielen angab („4 bis 5 Stunden“), sie gelangte sofort in die Untersuchungsgruppe.
4.5. Datenerhebung: Durchführung der Interviews und methodenkritische Anmerkungen
Die Datenerhebung wurde prinzipiell nach den gestellten Anforderungen durchgeführt. Die Interviewdauer betrug durchschnittlich zwischen zwei Stunden (bei Spielern, die nur alleine Computerspielen) und drei Stunden (bei Spielern, die auch mit anderen vernetzt spielen). Das Vertrauensverhältnis scheint aber auch in der Hinsicht maßgeblich zu sein, dass bei mir unbekannten Interviewpartnern der Gesprächsfluss schneller ins stocken geriet und auch die Ergebnisse weniger ertragreich waren. Gerade bei Fragen die sich auf die Themen „Kampf“, „Macht und Herrschaft“, „Identität“ (insbesondere „Wunschidentität“) oder „Freizeitverhalten“ bezogen, zeigten sich einerseits ein sehr kurzes und unergiebiges Antwortverhalten oder andererseits eine meines Erachtens abwehrende Haltung in Richtung einer „sozialen Erwünschtheit“ – doch dazu mehr in der Auswertung. Dieses Problem zeigte sich zudem erst bei den letzten Erhebungen, da ich erst zum Schluss die mir unbekannten Personen interviewte. Der Grund war, an mir nicht gänzlich unvertrauten Personen, eine längere Einübungszeit in die Interviewhandhabung zu erhalten. Daher war es mir auch nicht mehr möglich, die entsprechenden Fragen zu revidieren. Wahrscheinlich müssten für solche Themen subtilere Fragen verwendet werden. Doch bei dem Gros der Themenbereiche ergaben sich keinerlei Probleme.
Nachdem alle neun Interviews[217] durchgeführt wurden, ging es darum, die Tonbänder zu transkribieren, dabei versuchte ich grundlegend den Wortlaut der jeweiligen Interviewpartner und auch die meinige Fragestellung wiederzugeben. Dieser Aufwand ist meines Erachtens unerlässlich, um eine nachfolgende Auswertung vollziehen zu können. Auf rhetorisch und psychologisch zu deutende Aspekte nehme ich keinen Bezug – daher werden auch keine Sprechpausen und „Ähms“ und „Hmms“ gedeutet.
4.6. Datenauswertung: Methodische Vorgehensweise
Das hier verwendete Auswertungsverfahren findet sich zu Teilen in den Theorien der „qualitativen Inhaltsanalyse“[218], genauer im Verfahrensschritt der „strukturierenden Inhaltsanalyse“, den man wie folgt beschreiben kann: „Ein wesentliches Kennzeichen ist die Verwendung von Kategorien, die häufig aus theoretischen Modellen abgeleitet sind: Kategorien werden an das Material herangetragen und nicht unbedingt daraus entwickelt, wenngleich sie immer wieder daran überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden.“[219] Die Kodiereinheiten beinhalten Einordnungskriterien („Kodierregeln“), die sich aus den jeweiligen Gliederungspunkten des theoriegeleiteten Kategoriensystems ergeben. Dieses Verfahren lehnt sich an dem Grundgedanken von Philipp Mayring an, „[…] dass durch die genaue Formulierung von Definitionen, typischer Textpassagen („Ankerbeispiele“) und Kodierregeln ein Kodierleitfaden entsteht, der die Strukturierungsarbeit entscheidend präzisiert […].“[220] Das zuvor, in der Operationalisierungsphase, entwickelte Kategoriensystem dient wie schon erwähnt auch als grundlegendes Auswertungsschema – in diesem Sinne als Kodierleitfaden. Die jeweiligen Kodiereinheiten bzw. Kategorien wurden mit kurzen Begriffen versehen, anhand derer nun die Auswertungstranskripte gegliedert und entsprechende Textpassagen herausgefiltert werden. An manchen Stellen kann es vorkommen, dass sich Textpassagen mehreren Kategorien zuordnen lassen. In solchen Fällen wird hervorgehoben, für welche Alternative ich mich entschieden habe und zudem ein Verweis auf die andere Deutungsmöglichkeit gegeben. Lässt sich eine Passage überhaupt nicht einordnen, so erhält sie das Prädikat „[ohne]“, dies steht für „ohne Kategorie“. Unter den jeweiligen Kategorieabschnitten finden sich die verwendeten „Kodierregeln“ in Form von Fragestellungen, die an die Transkript-Texte herangetragen werden und Beschreibungen, welche Aspekte thematisiert werden müssen, damit die betreffende Textstelle Zugang zur Kategorie erhält. So dann sollen die jeweiligen Textpassagen mit den „dazugehörigen“[221] Theorieaspekten in Verbindung gebracht werden. In einem interpretativen Prozess werden dann mögliche Konvergenzen bzw. Divergenzen hervorgehoben.[222] Die Interpretation stellt im Grunde eine „Reduktion“ dar: „Gleiche und ähnliche Aussagen werden zusammengefasst, ein Deutungsmuster, eine Kernvariable wird als wesentlich herausgearbeitet.“ Der vorläufige Abschluss bildet dann die systematische Darstellung der Untersuchungsergebnisse und ein Ausblick, in welche Richtung zukünftige Erhebungen ertragreich sein könnten. Zudem möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich nur einen Analyseschritt mit dem Datenmaterial vollzogen habe, die anderen können hier aus Umfangsgründen nicht durchgeführt werden.
5. Darstellung der Ergebnisse
Das folgende, etwas längere Kapitel enthält die Ergebnispräsentation. Wie schon angedeutet lehnt sich die Gliederung der jeweiligen Unterkapitel an das in der Operationalisierungsphase entworfene Kategoriensystem an. Da das Augenmerk dieser Arbeit auf das Phänomen „Computerspiel“ gerichtet ist und nicht auf die Anforderungsunterschiede der jeweiligen Computerspielgenres[223], werden die entsprechenden Darstellungen den hiesigen Analyse- und Darstellungskategorien untergeordnet. Doch es sei schon einmal an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass prinzipielle Unterschiede aufgrund der Spielgenres vorhanden sind und auch von den Interviewpartnern beschrieben werden.
5.1. Rahmenbedingungen der Interaktion und Kommunikation auf virtuellen Spielplätzen
Die Anforderungen, Grenzen und Bedingungen, die der Computer setzt, sind nicht zu umgehen. Und will man sich noch unbekümmert auf einem virtuellen Spielplatz entspannen, so müssen sowohl vom Platz selbst als auch vom Spieler die Kriterien eines Spiels eingehalten werden, um nicht gewollt oder ungewollt die Spielwelt zu verlassen.
5.1.1. Grenzen, Bedingungen und Anforderungen des Computers
Doch damit es soweit kommt, benötigt der Mensch bzw. hier der Spieler, ein entsprechendes Interface in Form von Ein- und Ausgabegeräten und einen ausreichenden Wissens- und Erfahrungsvorrat, um alle Hardware- und Software-Komponenten zu aktivieren und sich mit ihnen zu koppeln, indem er einerseits sich selbst der virtuellen Welt mit ihren jeweiligen Plätzen anpasst und andererseits die virtuelle Welt entsprechend seiner individuellen Vorgegebenheiten modifiziert:
Zu dem jeweiligen Computer-Interface der neun Interviewten lässt sich grundlegend sagen, dass es sich aus den heutzutage gewöhnlichen Komponenten zusammensetzt, dem Computer, Monitor und Musik-Lautsprecher als Ausgabegeräte und Tastatur, Maus und Joystick als Eingabegeräte. Bei den beiden Interviewten (Hans-Gerd und Werner), die eine Fahrzeugsimulation spielten, sind zusätzlich noch Lenkrad und Pedale vorhanden. Bei vielen, insbesondere bei denen, die internetbasierte Computerspiele betreiben, ist ein Head-Set vorhanden, aber keiner der Interviewten nutzt eine digitale Kamera während des Spielens, der folgende Proband drückte dies am Beispiel eines Online-Actionsspiels gut aus:
Der Alte: Ja das wärs noch, wenn ich bei der ganzen „Counter-Strike“ Hektik auch noch die Gesichter von allen Teamkollegen auf dem Bildschirm hätte, […] da würde man überhaupt nicht mehr durchblicken, […] „teamspeak“ [Benutzung eines Head-Sets] ist da ideal, man kann schnell reagieren und muss auch nicht erst umständlich rumtippen […].
Nur die visuelle und akustische Wahrnehmung werden folglich in das virtuelle Geschehen involviert, dabei geben die Probanden grundlegend (bis auf „Werner“) dem Sehen einen gewichtigeren Stellenwert als dem Hören:
Spire: Das man etwas sieht ist natürlich schon wichtiger, auf den Ton kann ich schon verzichten, ist dann aber nicht mehr so ne schöne Stimmung, man kann aber immer noch zocken […].
So lässt sich festhalten, dass grundlegend alle Interaktions- und Kommunikationsformen nur zwei Sinne ansprechen und zudem vom Computer umgewandelt werden.
Dennoch stellt der Computer für alle Probanden im Grunde ein multifunktionales Werkzeug dar, er wird als Schreibmaschine, Malblock, ebenso wie als Medium genutzt (insbesondere das „Internet“), aber auch als Fernseher, um sich Spielfilme anzuschauen und Stereoanlage, um Musik zu hören. Das Computerspielen selbst nimmt bei bis auf drei Probanden[224] etwa die Hälfte der Computertätigkeiten in Anspruch, man kann sie daher durchaus als wichtige Tätigkeit auf dem Computer bezeichnen. Der entscheidende Aspekt ist nach Ansicht der Interviewten, dass man mit dem Computer viele Tätigkeiten schneller, leichter und bequemer machen kann:
Der Alte: Gerade bei der Mukke stellt der Computer eine Erleichterung dar, wenn ich mir früher die ganzen Platten und CDs angucke, die ich hatte, bestimmt eineinhalb Schrankregale voll und jetzt ist fast viermal soviel auf meiner kleinen externen Festplatte und man kann alles ganz leicht über ein Programm abspielen lassen […].
Auf virtueller Spielebene (bei dem Online-Rollenspiel „World of Warcraft“) zeigt sich der Vorteil der Bequemlichkeit an folgendem Zitat:
Günni: Bei dem Spiel gehe ich gerne angeln aber in echt [also in der realen Welt]. Nein, denn da muss ich ja erst hinfahren, selbst die Angel auswerfen und dann zappelt da irgendwann der Fisch herum. Nein, dass wäre nichts für mich. In dem Spiel ist es ja nur ein Klick. Das ist entspannend, wenn ich nur klicken muss und dann habe ich einen Fisch gefangen. [Ironisch ausdrückend] Leider muss ich aber hier immer noch den Köder anklicken, also den Mauszeiger auf das Rucksacksymbol bewegen, ihn dann durch einen Klick öffnen usw. Das ist schon anstrengend und mit Aufwand verbunden. […] Zudem bin ich hier flexibler, ich kann innerhalb von zwei Minuten meine Angel wieder einpacken und mich in eine ganz andere Action werfen, dann kann ich ja auch direkt anfangen zu kämpfen. […] Jedenfalls beim realen Angeln wäre mir das Drumherum einfach viel zu aufwendig.
Als Erleichterung wird der Computer grundlegend von allen Interviewpartnern angesehen und derart lässt sich auch der Umgang mit dem Computer beschreiben, man möchte die Arbeiten möglichst schnell, leicht und komfortabel verrichten und ebenso bequem und direkt sollen auch die virtuellen Spielplätze erreichbar und zu benutzen sein.
Günni: Ich spiele ja, weil ich mich entspannen will, und wenn ich mich entspannen will, dann will ich mich an den Rechner setzen und sofort loslegen […] nicht erst dies und das machen, hier einen neuen Treiber suchen und am besten noch den Rechner aufschrauben, das sind Sachen, die gehen schon gegen den Strich und sind auch nicht entspannend […].
In dieser Hinsicht nutzen auch bis auf „Der Alte“ alle ein „Microsoft-Windows“ Betriebssystem und nehmen auch gerne die geringeren Einflussmöglichkeiten zugunsten einer bequemen Benutzeroberfläche in Kauf. „Der Alte“ scheint in diesem Sinn eine Ausnahme darzustellen, er zieht es vor, sein Betriebssystem über „Linux“ selbst zu konfigurieren und damit seine Einflussmöglichkeiten zu behalten; auch bei der Spielesoftware dringt er auf die Programmierebene vor und verändert das Spiel je nach Wünschen und Möglichkeiten[225]:
Der Alte: Also Windows ist ja schön und alles kann man schnell anklicken, aber trotzdem weiß doch eigentlich keiner so richtig, was in dem Programm abgeht, […] da blickt doch keiner durch. […] bei Linux brauchst du zwar etwas Programmierkönnen, aber wenn das mal drin hast, dann ist schon alles ganz logisch und du weißt dann auch, wofür die einzelnen Komponenten da sind […] Ja ich will auf jeden Fall mehr Einfluss auf meinen Computer haben.
Abgesehen von dieser Ausnahme überwiegt bei den anderen der Faktor „Komfort“, aber dennoch kann bei allen ein zumindest moderates Computerwissen verzeichnet werden. So kennen sich alle (auch der Linux-User) mit den grundlegenden Windows-Funktionen aus und auch mit diversen Anwendungsprogrammen, jeder beherrscht im Grunde die Logik einer Programmiersprache (das frühere Basic kannten alle mehr oder weniger), aber fundierte Programmierkenntnisse sind nur von „Jonas“, „Der Alte“ und auch mit kleineren Abstrichen von „Horst“ genannt worden. Auch sind bei allen Interviewten Erfahrungen von früher Kindheit an zu verzeichnen, sie erlebten alle noch die Entwicklungen auf dem Computerbereich der 1980er und 1990er Jahre, viele fingen mit dem Basic-gestützten Commodore 64 an und hatten seit dem auch grundlegende Erfahrungen mit dem Computer und insbesondere seinen Spielen:
Horst: Etwa mit zwölf oder dreizehn Jahren, auf einem C-64 beim Nachbarn und seitdem eigentlich immer mehr oder weniger regelmäßig. […] Meine ersten Beschäftigungen mit dem Computer waren, soweit ich mich erinnern kann, kleinere Programme zu schreiben, sprich zu programmieren. […] ich besuchte dann auch Volkshochschulkurse für das Schreiben mit Turbo-Pascal. […] Aber gespielt habe ich auch schon immer parallel […] das Programmieren habe ich dann etwa mit sechzehn Jahren aufgegeben.
Arnold: Ich fing schon in der frühen Kindheit an, mit C-64 Computerspielen und Atari-Konsolenspielen, danach Nintendo, Super-Nintendo, zudem auch Playstation und jetzt Playstation 2. Nach und nach kam der PC hinzu […] aber auch damit habe ich eher gespielt und erst später habe ich begonnen, mit dem Computer zu schreiben und dann im Internet.
Danny: Es fing mit dem C-64 an, den mein Vater mir kaufte. Ja und damit spielte ich dann und zwar „Giana Sisters“ [ein Geschicklichkeitsspiel]. […] Früher gab es nur eine Datasette […] Kassette rein und warten, sehr lange warten und dann Ladefehler, dann wieder laden und nach einer halben Stunde klappt es dann. […] Mit fünfzehn oder sechzehn Jahren spielte ich auch noch nicht so viel, eher weniger, als heute mit 31 Jahren. Die Spiele waren auch noch nicht so, nicht so zeitaufwendig und fesselnd.
Aber keiner (bis auf „Der Alte“) wünscht sich eigentlich, ein Computerspiel zu verändern, beispielsweise:
Jonas: Ja und Nein, also Karten kreiert habe ich schon, aber dafür braucht man auch Zeit und wenn ich Zeit hab, dann spiel ich eher […] ich bin schon zufrieden mit den Spielen, die es so zu kaufen gibt. […] Und was, Umprogrammieren [kurzes Lachen], das mach ich schon genug auf der Arbeit, nein, da reicht mir schon spielen, das andere können schon die Spielentwickler machen.
So werden im Prinzip je nach Vorlieben die entsprechenden Computerspiele (meist aktuelle) aus dem Angebot der Spiel-Industrie ausgesucht und gekauft. Und dank der reichhaltigen Auswahl ist auch keiner der Interviewten unzufrieden, dann ein Spiel langweilig wird oder einem in irgendwelchen Aspekten nicht gefällt wird eben ein neues Computerspiel geholt oder auf ein altbewährtes zurückgegriffen.[226]
Jedenfalls lässt sich sagen, wenn das Spiel einwandfrei funktioniert, dann sind nur noch die Regeln und das Wissen des jeweiligen virtuellen Platzes relevant und es spitzt sich folglich alles auf die Frage zu, inwieweit der Spieler sich den Bedingungen des virtuellen Spielplatzes anpasst (von diversen kleineren Voreinstellungsmöglichkeiten z.B. dem Schwierigkeitsgrad, einmal abgesehen) und hierdurch das Gefühl erhält, eben in diesen „einzutauchen“. Daher führt auch der nächste Schritt dahin, zu betrachten, inwieweit der Computer das Potential hat, eben solch einen virtuellen Spielplatz zur Verfügung zu stellen, und was die Bedingungen für ein erfolgreiches „Eintauchen“ sind:
Betrachtet man als erstes die Frage, ob die virtuelle Welt (mit dem Computer als ihr Generator) für die Spieler real oder besser wirklich ist, so lässt sich anhand der Interviews festhalten, dass sie nicht als Realität gesehen wird, aber im gewissen Sinne doch wirklich ist, weil man mit den Worten von Spire: „ja wirklich Computer spielt“ und ebenso ein Vergleich der Computerwelt mit dem Fernsehen betont wurde. Ohne dieser Frage jetzt wirklich auf den Grund gehen zu wollen und zu können[227], lässt sich aber noch festhalten, dass gerade gemeinsam genutzte Computerspiele den Eindruck verstärken, man spiele hier eben mit wirklichen Menschen. Prinzipiell reicht auch schon, dass der virtuelle Spielplatz potentiell gemeinsam genutzt wird, und bei einem internetbasierten Computerspiel lassen die betreffenden Probanden an dem wirklichen Charakter der virtuellen Welt keinen Zweifel, man kann von einem neuen virtuellen Raum sprechen, in dem man sich real bzw. wirklich mit anderen Menschen trifft:
Günni: Man könnte auch das Bild nehmen, das Onlinespiel ist ein zusätzlicher Raum im Haus. In diesen Raum kann ich einfach hineingehen und schauen, ob gewisse Leute da sind, die ich kenne oder nicht, ja wie ein Wohnzimmer. Wenn man nun von solch einem virtuellen Zimmer, also dem virtuellen Platz ausgeht, dann können prinzipiell zwei Bedingungen für das „Eintauchen“ verantwortlich sein: Zum einen die äußere Gestaltung des virtuellen Platzes und zum anderen die „Interaktionen“, die in seinem Inneren ablaufen. Diese inneren Prozesse werden von den Interviewpartnern auch als primär für ein erfolgreiches „Eintauchen“ betrachtet. Die äußere Gestaltung wird als zweitrangig, aber dennoch insofern als wichtig eingestuft, in den Worten von einem Probanden:
Werner: […] der erste Eindruck ist halt schon wichtig, wenn mir ein Spiel nur vom anschauen nicht gefällt, dann denk ich, würde ich es nicht zocken […]. Natürlich muss das Spiel gut aussehen, aber das tun ja fast alle Spiele heute und vor allem einen guten Sound solls geben. Sound ist mir wichtig […]. Der Soundtrack bei einem Spiel ist daher wichtig, die Hintergrundmusik […] diese Musik läuft halt auch die ganze Zeit im Hintergrund und wenn die dann nervt, dann ist das schon uncool. Wenn die gut ist, dann bleibt die halt auch hängen und dann macht das Fahren mehr Spaß […] wenn ein gutes Rocklied läuft und man gerade von der Polizei wegfährt, dann geht das schon ab, als wenn jetzt dabei halt ein Geigensong läuft […].
Die äußere Gestaltung lässt sich im Einklang mit den Interviewpartnern mit der grafischen Ausgestaltung des virtuellen Spielplatzes und der akustischen Geräuschskulisse gleichsetzen, sie sind entscheidend für eine gute Atmosphäre:
Jonas: Der Sound ist für mich sogar ein bisschen wichtiger als die Grafik […] mir macht es nichts aus, wenn die Figuren und Gesichter etwas kantiger sind, das ist eher nebensächlich, wenn das Spielprinzip gut ist. Dann mag ich schon lieber wenn eine gute Sound-Atmosphäre entsteht, die eine passende Stimmung erzeugt. Ich habe beim Spielen auch Boxen an und die Stimmung verbreitet sich so auch in meinem Zimmer und von daher sollte der Sound schon gut sein.
Doch ohne eine erfolgreiches „Eintauchen“ kann überhaupt keine Atmosphäre entstehen. Wenn ein Spiel auf der inneren Ebene der Mensch-Computer-Interaktion fasziniert, so tritt die äußere Gestaltung merklich in den Hintergrund:
Arnold: Mich fasziniert bei Spielen wie die Grafik und der Sound immer weiter voranschreiten. Bei „Anstoß“ ist die Grafik eher nebensächlich, man sieht da auch nicht das Spiel selbst, sondern nur einen Bericht in Textform, überhaupt ist das Spiel von der Grafik eher unterdurchschnittlich, weil auf dem Bildschirm auch nichts passiert [keine Spielanimationen]. Grafik und Sound können interessant sein, sind aber für mich nicht so wichtig, wenn das Spiel an sich gut ist.
Doch bevor die erstrangigen Bedingungen erläutert werden, gilt es noch den zweiten Rahmen des „Spiels“ zu beachten: Was zeichnet im speziellen einen virtuellen Spielplatz aus?
5.1.2. Wesensmerkmale einer virtuellen Spielwelt
Da im Rahmen dieser Arbeit eine Spielwelt mit Hilfe der sechs Wesensmomente eines Spiels eingegrenzt wird, erfolgt vorerst eine gesonderte Betrachtung, inwieweit die Motivationsgründe der Interviewten übereinstimmen:
Moment der Freiheit: Alle Probanden spielen Computer aus freien Stücken, keiner wird gezwungen und für keinen stellt es eine Arbeit im Sinne einer Verdienstquelle dar. Ein Interviewpartner bekam für das Spiel „Counter-Strike“ schon ein Angebot für einen E-Sport-Verein, das er aber ablehnte. Solche Phänomene stellen im Grunde einen Grenzfall von Spielwelt und Nicht-Spielwelt dar, da hier definitiv reale Konsequenzen vorhanden sind:
Spire: Nein, aber nicht so krass wie die Pro-Teams, die bekommen auch schon Geld. […] Ich hätte auch bei so einem Pro-Clan anfangen können, aber das fand ich zu krass […] die meinten, das gemeinsame Training würde täglich acht Stunden dauern und das dann vier- bis fünfmal die Woche. Nee, das ist mir zuviel, dann ist es mein Job und könnte mir dann schon aus Prinzip keinen Spaß mehr machen [scherzhaftes Lachen].
So wird auch einheitlich die Frage nach der Möglichkeit eines Spielzwangs verneint, es gibt lediglich einen selbst auferlegten Zwang, etwa in Form von Terminvereinbarungen bei gemeinsamen Spielen:
Günni: Eigentlich ist ja kein Spielzwang da. Ausnahme man hat einen festen Termin vereinbart. […] Feste Termine sind aber oft auch die einzige Möglichkeit, um zu einem gegebenen Zeitpunkt beispielsweise zwanzig oder sogar vierzig Mitspieler zusammenzubekommen, um eine der vorhandenen Riesenaufgaben zu erledigen, bei denen man so viele Leute braucht. […] Und wenn man sich bei einer Gilde in einem Anmeldeformular für eine bestimmte Aufgabe eingetragen hat, so können ja bei Nichteinhalten mitunter schon Strafen folgen, wie etwa ein paar Tage nicht mehr mitgenommen zu werden oder beim nächsten Mal weniger Belohnung erhält. […] Rausgeworfen wird einer deswegen nicht, ja nur, wenn er auch sonst sehr unzuverlässig ist.
Oder in Form des eigenen Anspruchs an sich selbst:
Werner: Ich zock generell ein Spiel immer erst auf der leichtesten Stufe durch, ich will ein Spiel halt erst genießen, Grafik anschauen, Story mitkriegen und so […] und wenn ein Spiel dann cool ist, dann zock ich es auch auf schweren Levels […] ich will mir auch selbst zeigen, dass ich es drauf habe und ich muss das jetzt durchspielen, auch wenn ich keine Lust mehr habe […] aber ich hab jetzt nicht unbedingt den Trieb, den Computer auf dem höchsten Level zu schlagen.
Moment der inneren Unendlichkeit: An einem Tag verliert zwar jeder Proband irgendwann die Lust am Computerspiel (dies variiert je nach den gemachten Angaben von einem Kurzaufenthalt mit einer halben oder ganzen Stunde bis zu einer ausgedehnten „Reise“, die mehr als vierzehn Stunden dauern kann), aber grundlegend findet man bei keinem Interviewpartner Äußerungen darüber, dass er die Lust am Computerspielen allgemein verlieren würde, sie ist bei allen mehr oder weniger unverändert geblieben und steht eher in einem Verhältnis von vorhandener und nicht-vorhandener Freizeit; exemplarisch:
Horst: Also, wo ich mehr Freizeit hatte, hab ich auch mehr Computer gespielt, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich dann auch mehr andere Freizeitaktivitäten gemacht habe […].
Jonas: Das hängt natürlich auch direkt damit zusammen wie viel Zeit man fürs Spielen hat, wenn man real viel machen muss, dann ist klar, das andere, die viel spielen können, auch weiter sind als man selbst.
So lassen sich als Hauptspielgründe die Suche nach Entspannung, Spaß und Herausforderung angeben:
Horst: Beim Onlinespiel ist es die Herausforderung, also in die nächste Liga aufzusteigen, obwohl das Spiel fiktiv ist, ist der Aufstieg doch irgendwie real. […] bei Solocomputerspielen ist es hauptsächlich die Entspannung oder einfach nur Spaß oder Zeitvertreib.
Werner: Weil es mir halt Spaß macht, für mich ist Computerspielen mein Hobby, wie ein anderer halt seine Briefmarken sammelt, so zocke ich Spiele […] Aber klar gibt es wichtigere Dinge im Leben, es ist nicht das wichtigste, Familie und so was ist mir schon wichtiger, aber ich brauch halt das Spielen, fast schon wie eine Sucht […] es gibt auch Tage, da zock ich gar nicht.
Hans-Gerd: Also die Herausforderung ist sehr wichtig. Ein Spiel wäre langweilig wenn es viel zu einfach ist, etwa so dass man schon am Anfang alles kann und bestens funktioniert, man sollte schon gefordert sein. […] ich finde dafür ist Spielkontrolle sehr wichtig und die kommt durch viel Übung zustande und je besser ich das Spiel kann, desto anspruchsvollere Aufgaben kann ich auch machen.
Arnold: Ich will da Spaß dran haben und fertig. Die Langeweile soll vergehen, ebenso wie der Tag vorbeigehen soll [kurzes Lachen]. […] also hauptsächlich aus reiner Langeweile.
Den Aspekt der Langeweile kann man aber nur mit Einschränkung als Grund zulassen, da er ein Symptom ist, das man beheben will, ein Proband sagt zur Langeweile folgendes:
Jonas: Ich könnte in derselben Zeit auch Fernsehen schauen oder die Wohnung aufräumen, also eigentlich nur als Zeitvertreib, Langeweile. […] manchmal trifft man sich auch nicht mit Freunden, weil niemand Zeit hat. […] Aber es darf auch keine absolute Langeweile vorherrschen, denn wenn mir sowieso schon zu langweilig ist, spiele ich auch kein Computer. […] Eigentlich spiele ich meist aus Entspannungsgründen.
Die Suche nach Entspannung und Herausforderung ist nicht zu trennen, beide gehen Hand in Hand: Ein Spiel will Spannung halten und dies geht beim Computerspiel vornehmlich in Form der Herausforderung, ist sie nicht mehr gegeben, so wird ein Spiel Langweilig und wird nicht mehr gespielt:
Günni: Ich habe eine sehr hohe Leistungsanforderung an mich und an das Spiel. Denn wenn ich schwierige Sachen machen will, sollen die auch möglich sein. Aber wichtig ist auch, dass ich das je nach Lust und Tagesform variieren kann, so kann ich ja einfach mal nur Unsinniges und nichts Anspruchsvolles machen oder mit fünf Mitspielern etwas sehr herausforderndes und Anspruchsvolles machen. Wo man eine so schwere Aufgabe zu lösen hat, die eigentlich mit nur mehr Mitspielern möglich ist, das ist ja schon ein Reiz. Die Gegner sind sehr stark, man muss perfekt spielen aber dann ist ja auch die Belohnung entsprechend höher. […] Und das kann ich mir selbst aussuchen, das ist mir auch wichtig, wenn ich in eine Entspannungsphase eintrete und wann in eine Leistungsphase.
Grundlegend gilt, dass die Schwierigkeit der geschafften Herausforderung[228] das Ausmaß des Glücksgefühls bzw. der Entspannung ausmacht. Es darf aber auch nicht zu schwer sein, in dem Sinne, dass es für den Spieler unmöglich erscheint, das Spiel zu gewinnen, hier fehlt die (Gewinn-)Chance, und solch ein Spiel wird von den Interviewten in der Regel (frustriert) beendet:
Arnold: Jedes Spiel hat gewöhnlich einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad […] wenn ein Spiel trotzdem noch zu schwer ist, finde ich es auch Mist […].
Jonas: Also er sollte auf der schwersten Stufe nicht leicht zu nehmen sein, bei Medieval bin ich schon zufrieden, jetzt jedenfalls […] ich spiele sowieso keine Spiele, die mich nicht wirklich fordern, aber es darf auch nicht übertrieben schwierig sein, es sollte, auch wenn es fünf Stunden dauert, zu knacken sein.
Danny: […] ich verliere so ungern, aber […] gegen den Computer hat man seine Erfolgserlebnisse […] wenn ich bei einem Spiel nur verliere, dann höre ich auch auf und werfe es in die Ecke.
Die dritte Hauptmotivation für ein Computerspiel ist Spaß, und sie führt direkt zum nächsten Wesensmoment eines Spiels.
Moment der Scheinhaftigkeit: So lässt sich bei den Probanden neben der Suche nach Spaß auch eine gehörige Portion Ernst feststellen, die für jedes Spiel unabdingbar ist, dies sieht man zum einen an den emotionalen Aspekten, die ein Computerspiel hervorrufen kann:
Werner: [Lachen], ja es gibt, wo meine Freundin auch immer sagt, reg dich nicht so auf, ist doch nur ein Spiel, dann sag ich immer, für dich ist es nur ein Spiel, für mich ist es halt mein Hobby. Zocken ist einfach mein Hobby und, und halt Bestandteil für mich geworden. Ich brauch das einfach, um mich abzureagieren oder um mich halt aufzuregen […].
Arnold: Für die Handlung ist kennzeichnend, dass es immer ein Ziel gibt, und so gehe ich ein Spiel auch an, indem ich das Ziel erreichen will, ja erfolgreich bestehen will. […] wenn ich bei „Fifa-Soccer“ drei bis fünf Stunden gespielt habe und dann zwei Spiele hintereinander unglücklich verliere, dann steigere ich mich schon hinein und dann fluch ich auch gut herum, ja und dann kann so was im Stress enden.
Horst: […] aber Frust kann schon entstehen, man kann nicht einfach einen abgespeicherten Spielstand laden, wenn etwas schief geht. Dann ist es passiert und man kann auch nichts mehr rückgängig machen, dann kann schon Frust entstehen, wenn man durch einen Fehler wichtige Punkte verliert.
Und zum anderen an dem Ehrgeiz, den die Spieler entwickeln, um das Spielziel zu erreichen:
Jonas: […] ich will nicht unbedingt irgendetwas erreichen müssen, es ist vielmehr reiner Zeitvertreib. […] Aber natürlich müssen die Aufgaben innerhalb des Spiels erledigt werden, da ich ja sonst aufhören müsste. Also diesen Ehrgeiz habe ich schon, ich will das Spiel schon durchspielen.
Dieser Ehrgeiz zeigt sich unter anderem auch darin, dass die Spieler auch außerhalb der direkten Spielsituation über das Spiel und das weitere Vorgehen nachdenken, als exemplarisches Beispiel, sei folgendes Zitat aufgeführt:
Günni: Ja das Spiel ist schon immer im Kopf. Aber zum Nachdenken nutze ich gewisse Lücken im Tagesablauf […] was könntest du beim nächsten Spieleintritt machen, ja dass ich, wenn ich am Rechner bin auch direkt loslegen kann. Sozusagen volles Genießen ohne Planen, da ich ja dies schon vorher während dem Nachdenken in der realen Welt gemacht habe […] Es ist ja eher ein strukturiertes, planvolles Nachdenken was ich noch ausprobieren könnte.
Das Heraustreten in eine Welt mit eigenen Tendenzen findet bei Computerspielen in doppelter Hinsicht statt: Einerseits das schon angesprochene und noch anzusprechende „Eintauchen“ in die virtuelle Welt und andererseits das Eintreten in die Scheinwelt des Spiels. Allgemein wird das Computerspiel auch als Auszeit in einer anderen Welt betrachtet, beispielsweise Spire: „Ich spiele Computerspiele um eine Auszeit zu nehmen.“ Aber die direkte Frage nach einer „Auszeit in einer kontrollierbareren Welt“ wird von vielen Probanden in Richtung einer „Flucht in virtuelle Welten“ gedeutet, wobei insbesondere den Online-Rollenspielen ein erhöhtes Gefahrenpotential bescheinigt wird:
Jonas: Ultima Online ist schon gefährlich, dass liest man ja auch öfters in den Foren, wo Leute um Hilfe bitten, weil sie von dem Spiel nicht mehr weg kommen und ihre Freundschaften anfangen kaputt zu gehen. […] Ich kam eigentlich von dem Spiel deswegen leichter weg, weil die meinen Charakter kaputt geändert haben, die haben die Wurzeln abgetrennt [gespieltes Heulen]. […] ich war ja auch in der Gefahr und hätten mir meine Freunde dann nicht in den Hintern getreten, wüsste ich nicht, was passiert wäre. […] gefährlich ist vor allem, dass man in einer eigenen Welt ist und so viele Freiheiten hat. Außerdem findet man in der Realität bei einem erlegten Tier auch keine 50 Goldstücke oder besser Euro. In der Realität hat man diese Freiheit nicht, jeder kann nicht alles werden und schon gar nicht reich werden und schon gar nicht in so einer schnellen Zeit und wenn man dann in dieser Welt noch Freunde finden kann, eben wie in der Realität, dann kann man sich schon darin verlieren. […] In der Realität sind natürlich die Chancen auch da, aber man muss hier wesentlich mehr dafür machen, es ist nicht einfach nur durch einen Klick zu lösen, die Computerwelt ist da schon bequemer.
Danny: Guild Wars zockt man nicht eben mal, man muss schon viel Zeit für seinen Charakter investieren. Aber auch hier gibt es einen sportlichen Anteil, man tritt gegen andere Menschen an. […] man kann sich schon von der Realität entfremden, gerade wenn man zwölf bis vierzehn Stunden spielt. […] Aber Guild Wars ist nicht so wie World of Warcraft, den Höchstlevel hat man hier schon in zwei Tagen erreicht und nicht erst in zwei Monaten.
Und auch die Aussage von „Günni“ kann in Richtung einer Auszeit interpretiert werden, da er diese Welt explizit für eine Flucht benutzt, während die anderen beiden sich doch schon eher von einem „Fliehen wollen“ abgrenzen:
Günni: Ich versuche ja auch durch das virtuelle Spiel der Realität zu entkommen, um dort abzuschalten und Energie zu gewinnen. Und was gibt es dafür besseres, als eine Welt, die es eigentlich gar nicht gibt und man hier Sachen machen kann, die man sich in der Realität ja gar nicht vorstellen kann.
Moment der Ambivalenz: Die Offenheit des Spielausgangs resultiert, wie schon kurz zuvor angesprochen, daraus, dass es nicht einseitig werden darf, weder zu schwer noch zu leicht. Aber noch an einem weiteren Aspekt lässt sich diese gewollte Ambivalenz ersehen, genauer an der Fairness und Ehrlichkeit, die die Spieler einander entgegenbringen. Ohne Einschränkungen gilt dies für die Probanden während eines gemeinsamen Spiels, keiner würde irgendwelche falschspielerischen Tricks, z.B. „Cheats“[229] verwenden, zumindest wurde es so angegeben. Aber auch indirekte, außerspielerisch erlangte Vorteile werden abgelehnt, beispielsweise, man kauft sich über „Ebay“ für reales Geld Spielgeld oder fertig trainierte Spielfiguren:
Günni: Das wäre für mich glatter Betrug, wenn ich für fünfzig Euro tausend Gold kriege, um mir dann ganz viele tolle Sachen zu kaufen. Das wäre ja nicht selbst erarbeitet, was für mich aber wichtig ist. […] Für mich ist das jedenfalls eine unehrliche Spielweise.
Jonas: Nein überhaupt nicht. Ich würde mir nie für ein paar Hundert Euro einen Level 60 World of Warcraft Charakter kaufen. Das muss ich schon selbst erreicht haben.
Gegen einen computergesteuerten Spielgegner sind die Interviewten grundlegend etwas flexibler, aber dennoch wird eine ehrliche Spielweise bevorzugt, da man sich nicht selbst betrügen und der Spannung berauben will:
Arnold: Ich halt mich schon für einen relativ ehrlichen Menschen und wenn ich spiele, dann bin ich auch nicht so einer, der, wenn er verloren hat oder nicht weiterkommt, gleich die Maschine ausmacht oder neulädt […] ich nehm die Niederlage hin und versuch es im nächsten Schritt dann besser zu machen. Also ich finde eine ehrliche Spielweise wichtig, wenn man immer neustartet bringt das doch nichts, es ist albern. […] auch ohne Cheats, weil das Beschiss ist, dann brauch ich erst gar nicht anfangen zu spielen.
Jonas: Gegen einen Menschen würde ich nie cheaten, aber gegen einen Computer und gerade wenn ich das Spiel schon durchgespielt habe und er mir keine Herausforderung bietet und ich nur eine Art von Ausflug in das Spiel machen will, dann schon. […] Neuladen gegen einen Computer kommt auch vor, […] gerade wenn ich gegen den Computer einen Kampf verloren habe und ich denke, dass kann ich doch besser machen […] aber wenn auch dann nichts zu machen ist, dann spiele ich meist weiter.
Hans-Gerd: Wenn es halt ein wichtiges Spiel ist, also Finale zum Beispiel, dann kann es schon passieren dass ich mal Neulade, aber sonst versuche ich das eigentlich ohne. Ich denke, ich bin da schon sehr konsequent, andere die ich kenne, laden wesentlich öfters neu […] ich finde es oft spannend, eine schlechte Situation wieder gut zu machen.
Moment der Geschlossenheit: Dieser Moment resultiert zum einen schon aus der Beschaffenheit des Computerspiels als ein Programm mit genau festgelegten Grenzen und Abläufen, und zum anderen lässt sich auf Spielebene diese Geschlossenheit an dem Prinzip der Ordnung erkennen. Für jeden Probanden ist es als erstes wichtig, dass die Spielziele klar ersichtlich sind, es muss aber nicht unbedingt ein in greifbarer Nähe liegendes Ziel sein, insbesondere bei Strategiespielen (im weiteren Sinne auch Denkspiele) kann das Ziel entweder im Spielen selbst liegen oder aber auch selbstgesteckte Ziele sein:
Der Alte: […] ich find Spiele, die ein festes Ziel haben und auch bald zu Ende sind, nicht so schön […] ich glaub, ich hab auch noch kein Spiel durchgespielt, wenn ich gesehen hab, das ist der letzte Level, war auch oft die Motivation plötzlich weg […] ich find da schon Endlosspiele besser, […] aber das heißt jetzt nicht, dass ich nichts erreichen will, oft denk ich, ich mach mir die Spiele eher absichtlich schwerer, sobald ich merk, dass sieht gut aus, das gewinnst du, hör ich auf und versuch, etwas an dem Spiel zu modeln, damits schwerer wird […].
Ähnliches gilt für die Spielregeln[230], auch hier sagen alle einheitlich, dass sie klar, verständlich und nachvollziehbar sein sollen, in den Worten von Jonas: „Also wenn ich ein Spiel nach zehn Minuten Einführung nicht verstehe, wovon ich aber nicht ausgehe, dann lege ich es beiseite.“ So kann man anhand der Aussagen davon ausgehen, dass zumindest jeder den Ansporn hat, die Spielregeln zu beherrschen und auch den Willen sie einzuhalten.
Moment der Gegenwärtigkeit: Ein flüssiger Spielablauf ist, wie schon erwähnt, ein wichtiges Kriterium, um in eine virtuelle Welt „einzutauchen“, von daher müssen auch die virtuellen Spielkonsequenzen diesem Kriterium entsprechen, schnell ersichtlich sein und dennoch Überraschungen bergen können: Auch diese Frage betrifft eine direkte „Interaktion“ mit dem Computer, es sei hier aber schon darauf hingewiesen, dass diese Eigenschaft auch bei rundenbasierten Strategiespielen ihre Gültigkeit haben, da bei ihnen diese Eigenschaft noch am fragwürdigsten erscheint:
Der Alte: […] was ich mach, das will ich schon direkt sehen […] ja auch bei Strategiespielen, wenn ich irgend etwas einstelle oder was verändere, dann sieht man bei den meisten Spielen auch sofort irgendwelche Resultate, auch bevor man die nächste Spielrunde anklickt […] das sind dann Vorausberechnungen und daran kann ich dann ja auch weiter abschätzen, welche Einstellungen sich noch lohnen […] die meisten Strategiegames sind auch so einfach gehalten, dass man das wichtigste auch direkt sieht, vielleicht bei ein paar älteren oder sehr detaillierten, mit Nachschubsversorgung und allem drum und dran, ist es noch umständlicher, hier mach ich mir dann Notizen auf Zettel, damit man für später Bescheid weiß […].
Anhand der exemplarischen Beispiele kann man ersehen, dass alle sechs Wesensmomente bei Computerspielen ihre Gültigkeit haben und dementsprechend die Interaktionen (neben den Bedingungen des Computers) kanalisieren. Aber je nach Computerspiel und Spieler können die Übergänge zur Nichtspielwelt sehr fließend sein. Doch bevor die genauen Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die jeweiligen Interaktionsformen beschrieben werden, soll noch auf die zwei grundlegenden Funktionen eines Spiels nach Huizinga eingegangen werden: Kampf und Darstellung, die ebenfalls einen gewichtigen Einfluss zu haben scheinen.
Bei der Frage nach den vielfach kämpferischen Aspekten innerhalb eines Computerspiels, distanzieren sich die Probanden sofort von Kriegs- bzw. Gewaltbegeisterung und beschreiben diese Aspekte in Richtung eines sportlichen Wettkampfes:
Arnold: Von kriegerischen Schlachten bin ich jetzt nicht so angetan, auch was Filme angeht […] Kämpfe finde ich bei Spielen gut, wo man als Einzelkämpfer agieren kann […] eins gegen eins. […] das Faszinierende ist einmal, jemand anderes zu besiegen, ja wenn man als Sieger hervorgeht.
Günni: Ich würde dass eher unter das Wort Sport fassen, es ist ja ein sportlicher Aspekt, ein sportlicher Wettstreit, wer das Spiel besser beherrscht […]. Dieser sportliche Wettstreit ist für mich das Reizvolle. […] Und ich kämpfe ja auch nicht wirklich, sondern ich klicke nur verschiedene Symbole an und versuche damit auf gegnerische Symbole, also Bewegungen, zu reagieren. Wenn ich sagen würde, ich kämpfe richtig oder ich töte, dann würde ich mich ja auch richtig mit dem Charakter identifizieren […] dafür ist aber meine Distanz zu dem Spiel einfach zu groß.
Jonas: Also wenn auch eher ein Wettkampf. In der Realität mag ich jedenfalls keine Kämpfe, ich prügele mich nicht und auch in dem Spiel spiele ich eher einen friedlichen Charakter. […] Beim Kampf ist es ja auch nicht unbedingt der Kampf, sondern das man sich im rechtzeitigen Moment heilt, wen man als nächstes anklickt und die Aktionen müssen im richtigen Moment und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden […] ein reaktionsschnelles handeln […].
Danny: […] ich finde rein den sportlichen Wettkampf toll. Ich finde auch nichts an dem Blut und den auseinanderspritzenden Körperteilen anziehend […] man trifft einen und macht seine Punkte, nichts mehr. […] Quake ist für mich auch mehr Sport als Kampf […].
Und solch ein sportlicher Wettkampf ist auch grundlegend bei allen Probanden das zentrale Kriterium, auch bei Ego-Shootern und strategische Kriegssimulationen trifft dies zu: keiner ist kriegsbegeistert, allenfalls besteht ein historisches Interesse. Die Annahme der Zentralität von „Macht, Kontrolle und Herrschaft“ in Computerspielen lässt sich unter diesen Wettkampf-Aspekt subsumieren. So wurden vielfach von den Interviewpartnern eben diese Aspekte bei ihren Beschreibungen des Wettkampfes erwähnt:
Werner: Es gab schon immer einen Machtkampf, seit Anbeginn der Menschheit, schon bei den Neandertalern, da war es halt auch immer Mann gegen Mann oder Truppe gegen Truppe und es geht halt darum, wer ist der bessere, sei es bei einem Kampfspiel, einem Ego-Shooter oder nem Autorennen. […] das Duell Mann gegen Mann finde ich interessant, wenn man einen Kumpel neben sich hat und gemeinsam zockt, zu schauen wer ist der bessere […] privat bin ich aber nicht von Waffen begeistert, bin ja auch zum Zivildienst und nicht zum Bund.
Arnold: Kontrolle ist dafür sehr wichtig, wie bei Fußballspielen einen perfekten Doppelpass. Mir geht es darum, sagen zu können, ich beherrsche das Spiel, das will ich erreichen. […] natürlich gehört für mich auch Zufall dabei, weil es in echt ja auch so ist, so was wie wenn man ein dummes Gegentor kassiert, aber wenn man gut genug ist, steckt man das auch weg. Wenn alles nur perfekt ginge, also alles gut verläuft, dann denke ich, dass das Spiel auch langweilig wird […].
Die genauere Nachfrage nach den Aspekten der Macht und Kontrolle ergab jedoch widersprüchliche Ergebnisse, so wurden einerseits den Aspekten Beherrschung und Kontrolle ein wichtigen Stellenwert zugewiesen, andererseits wurde sich von „virtueller Macht“ abgegrenzt, sie galt mehrfach als lächerlich, beispielsweise Der Alte: „Meinst du, es gibt so Freaks, die es toll finden, Macht in einem Computerspiel auszuüben, ich fänd das eher ein Armutszeugnis […]“. Ebenso wie Ablehnungen von virtueller Kontrolle zu verzeichnen waren:
Günni: Ich kann mich frei entscheiden was ich machen will. […] für mich ist das Spiel ja fast hundertprozentig kontrollierbar. […] Das fasziniert mich auch, da ich ja die volle Kontrolle über mein Freizeitangebot haben will […]. Es ja mehr wie ein Überlebenskampf, weil man ja Risiken eingeht in dem Spiel, also mehr der sportliche Aspekt und nicht so sehr der Machtaspekt.
Horst: […] aber grundsätzlich finde ich je kontrollierbarer ein Spiel, desto langweiliger ist es. […] die Herausforderung muss schon da sein, ansonsten verliert das Spiel für mich an Reiz.
Jonas: Mit Kontrollierbarkeit hat das nicht unbedingt etwas zu tun […] ich möchte in ein Spiel auch nicht mein Ego hineinsetzen, sondern ich will eine Herausforderung schaffen […] und wenn das Spiel aus ist, dann ist dies auch gelaufen. Einfach nur Freizeit.
Hier gibt es offensichtlich ein abweichendes Verständnis von Macht und Kontrolle. So wird sich im Grunde von Macht- und Kontrollprozessen, die analog in der realen Welt beobachtet werden, abgegrenzt. In dem Sinne: wirkliche Macht und Kontrolle kann man nur in der Realität ausüben. Aber in dem Sinne einer Macht und Kontrolle, die dem Wettkampf untergeordnet wird, findet sie ihre Gültigkeit: man will das Spiel beherrschen und so kontrollieren, dass man den Spielanforderungen gewachsen ist, aber dennoch eine Ambivalenz wahrt, also den Gegner nicht vollkommen beherrscht und kontrolliert.
Den Aspekt der Darstellung, in dem Sinne, dass man eine Theaterrolle spielt, findet man explizit bei den Online-Rollenspielen, bei den Solo-Rollenspielen dagegen weniger und bei den anderen Spielkategorien im Grunde gar nicht:
Jonas: Ich habe mir eine Elfin ausgewählt, und weil sie jetzt auch die älteste Charakterin in der Rasse ist, stellt sie eine weise Elfin dar. […] ich dachte mir dabei, wenn ich schon ein Online-Rollenspiel spiele, dann kann ich auch gleich eine sehr schwere Rolle übernehmen, also eine weibliche […] aber sie ist jetzt nicht meine Traumfrau. […] es ist eher wie ein Theaterspielen, ich übernehme eine Rolle und denke mir, wie man die wohl am besten spielen könnte und dann tue ich das auch. […] meine eigene Persönlichkeit hat eher weniger mit der Rolle zu tun.
Der Darstellungsaspekt liegt schon in der Natur des Rollenspiels und bei virtuellen Rollenspielen ist es eine Frage, inwieweit andere Menschen involviert werden und wie Vielfältig die Interaktions- und Kommunikationsformen sind, die das jeweilige Computerprogramm zulässt. So sieht man bei dem Spiel „Ultima-Online“ Unterschiede zu den beiden anderen Online-Rollenspielen „World of Warcraft“ und „Guild Wars“. Bei den beiden zuletzt genannten Spielen findet eine stärkere Fokussierung auf kämpferische Aspekte statt, und die Möglichkeiten im Spiel, friedlich voran zu kommen, sind sehr eingeschränkt. Bei „Ultima-Online“ dagegen liegt das Hauptaugenmerk auf ein gelungenes Rollenspiel, man versucht seinen Charakter im Einklang mit der Spielwelt zu steuern und im wahren Wortsinn Theater zu spielen. Bei den anderen Spielkategorien und auch bei Solo-Rollenspielen sind zwar auch Rollenangebote vorhanden, sie erfordern aber weniger darstellerische als spieltechnische Künste (das Thema „virtuelle Rollen“ wird noch innerhalb der „computervermittelten Mensch-Mensch-Interaktion angesprochen).
Diese Rahmenbedingungen ergeben aber noch keine hinreichenden Bedingungen für eine funktionierende Mensch-Computer-„Interaktion“, also für ein erfolgreiches „Eintauchen“. Ihnen können zusammenfassend zwei Funktionen zugeschrieben werden: Zum einen begrenzen und kanalisieren sie die Möglichkeiten der „Interaktionen“ und zum anderen dienen sie als Verstärker von funktionierenden „Interaktionen“, so dass das „Eintauchen“ und die Aufmerksamkeit gegenüber dem virtuellen Geschehen intensiver wird.
5.2. Mensch-Computer-Interaktionen auf virtuellen Spielplätzen
Die Basis jeglicher Interaktion auf einem virtuellen Spielplatz ist die Mensch-Computer-„Interaktion“, die sich innerhalb der ersten drei Funktionskreise entfaltet. Sie stellt die grundlegende Ebene der Computer- bzw. Spielbedienung dar. Erst wenn deren Funktionieren gewährleistet ist, können andere computervermittelte Interaktionsformen stattfinden. Diese Ebene beinhaltet noch kein „Eintauchen“ in die virtuelle Welt. Hierfür ist bezüglich der spezielleren Interaktionsformen mit dem Computer ein permanent funktionstüchtiger, dynamischer Funktionskreis unabdingbar. Er gewährt erst das gewollte Gefühl des Spielers, mit einem oder mehreren computergenerierten Akteuren zu interagieren, mit anderen Worten eine simulierte Interaktion. Erst mit ihr entsteht das Gefühl des wirklichen „Eintauchens“ in die virtuelle Welt: in einem begrenzten Rahmen (hier begrenzt auf Spielaktionen) interagiert man mit den simulierten Spielpartnern, ähnlich wie mit realen menschlichen Spielern.
5.2.1. Kriterien einer funktionierenden Mensch-Computer-Interaktion
Der pragmatische Funktionskreis stellt nach Aussagen der Probanden gerade hinsichtlich der Spielsteuerung das entscheidenste Kriterium für eine funktionierende Mensch-Computer-„Interaktion“ dar:
Spire: Nee, für mich ist schon die Steuerung am wichtigsten, wenn ich die nicht kann, dann kann das Spiel auch so krass sein wie es will, […] aber wie soll ich es dann ohne Frust zocken, wenn die Figuren machen was sie wollen oder wenn man bei „Counter-Strike“ nicht zielen könnte, dann steht man doof rum und schießt in die Weltgeschichte […].
Arnold: Wenn ich mit einem Spiel nicht zu recht kommen würde oder die Steuerung nicht kann, dann würde ich es auch nicht spielen, fertig.
Günni: Die Spielsteuerung sollte einfach sein, damit man sie ja leicht ausreizen und bedienen kann. Sie soll ja auch zur Entspannung dienen, ich will ja auch nicht großartig über die Spielsteuerung nachdenken, sondern das Spiel einfach nur steuern. Dafür brauche ich ja, wissenschaftlich ausgedrückt, einen schnellen Automatisierungsprozess, damit ich meine Tasten so belegen kann, wie ich das brauche, und das verinnerliche ich ja dann. Etwa so wie mit dem Autofahren und der Gangschaltung, da denkt man auch nicht erst darüber nach.
An dem letzten Zitat ersieht man auch, worauf es ankommt: auf einen immer präziser werdenden Automatisierungsprozess der Steuerung. Erst wenn diese mehr oder weniger verinnerlicht ist, können die anderen Spielaspekte ihre Wirkung entfalten:
Werner: Bei Final Fantasy […] muss man auch die verschiedenen Manöver drauf haben, Zauber machen, halt diese richtig einsetzen und zu timen, die Sachen einfach nur zu machen, ist ganz einfach […] Die Steuerung sollte aber schon gut zu steuern sein, halt nicht zu viele Tasten und gerade ganz nervig sind die Games, wo die Hälfte der Befehle noch überflüssig ist […] aber Final Fantasy ist da schon cool, gerade die richtige Mischung, man muss halt nur wenige Tasten drücken, kann aber viele Sachen machen. […] Ich sag auch immer, eine Steuerung drauf zu haben, ist eine andere Sache, als sie auch umzusetzen, so dass es auch was wird. Wenn man bei „Need for Speed“ fahren kann, dann kann man halt fahren, Gas geben, bremsen, aber das auch im richtigen Moment zu tun, das richtige Timing zu haben, das ist die Kunst, das braucht halt etwas.
Doch ist fraglich, ob nicht auch der semantische Funktionskreis, also in dieser Arbeit verstanden als Spielverständnis, ebenso wichtig ist. Doch die direkte Frage hiernach hatte einen tautologischen Beigeschmack: Wie soll jemand ein Spiel spielen, das er nicht versteht, welches er überhaupt nicht zuordnen kann, also nicht einmal als Spiel. Anhand der Interviews konnte bezüglich dieses Aspektes nichts ermittelt werden, da die Frage eher Verwirrung auslöste.
Aber dafür wurde ein anderer Aspekt als sehr zentral eingestuft: das Spielprinzip, das zum einen im Einklang mit den zuvor erläuterten Wesensmomenten des Spiels steht und zum anderen auf den syntaktischen Funktionskreis verweist. Neben der einsichtigen Nachvollziehbarkeit der Regeln, ist für die Spieler gerade der Aspekt wichtig, der aus dem Zusammenwirken der Regeln und der entstehenden Handlungsmöglichkeiten bzw. potentiell zu vollziehenden Spielaktionen, entsteht:
Günni: Ja ganz wichtig ist auch, dass viele Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind, das bringt ja die Abwechslung. Anstatt viele verschiedene Computerspiele zu spielen, wo man wenig machen kann, kann ich ja auch nur ein Computerspiel spielen, indem ich viel machen kann. So kann ich ja bei World of Warcraft zum Beispiel Angeln gehen […].
Danny: Ich stehe drauf, wenn man viel machen kann, ganz klar. Je mehr man machen kann, desto interessanter ist es […].
Jonas: […] es darf aber auch nicht zu viel des Guten sein, wenn sie zu komplex oder kompliziert werden […] sie sollen sich schon in einem verträglichen Rahmen bewegen. Ich mag keine Spiele wo man mehr Zeit für Knöpfe drücken, Regler verschieben und sonstige Einstellungen benötigt, als für das eigentliche Spiel […] es soll schon ein zügiger Spielverlauf sein und eine komfortable Spielsteuerung.
Jonas spricht hier einen entscheidenden Zusammenhang an: Prinzipiell wird eine möglichst reichhaltige Palette an Handlungsmöglichkeiten bevorzugt, aber sie müssen von der Spielsteuerung her auch komfortabel umgesetzt werden. Wenn dies nicht gelingt, wirken zu viele Handlungsmöglichkeiten erdrückend und zu kompliziert und werden von daher eher abgelehnt:
Der Alte: […] also ich find ja schon, dass man möglichst viel machen können sollte, und eigentlich denk ich auch je mehr desto besser, aber ne Grenze gibt’s schon, man sollte schon durchblicken, wie man etwas macht […].
Hans-Gerd: Es darf nicht zu genau und detailliert werden, etwa die ganzen Strategiedinger, die finde ich schon sehr langweilig, man stellt nur ein und muss eigentlich nix machen, aber auch die Flugsimulatoren finde ich schlimm, da blickt ja fast keiner durch, jede Taste ist belegt und macht irgendetwas […] da mag ich doch lieber Spiele, wo man weiß, was man machen muss, ein klares Spielziel und nicht zu viele Tasten.
Sind diese drei Aspekte erfüllt, so kann man von einer funktionierenden Mensch-Computer-Interaktion sprechen: Man weiß, was man kann und worum es geht (Spielverständnis), man weiß, wie man seine Handlungsabsichten auf dem Spiel umsetzt (Spielsteuerung), und man weiß prinzipiell, welche Konsequenzen auf welche Aktionen folgen können (Spielprinzip).
Die anderen folgend beschriebenen grundlegenden Aspekte nehmen in Augen der Spieler vielfach auch einen wichtigen Stellenwert ein, sind aber nach ihren eigenen Abwägungen grundlegend den anderen dreien[231] nachgeordnet.
So wird die grafische bzw. akustische Ausgestaltung (Präsentation) der jeweiligen Handlungen für die Spielmotivation und das Gefühl des „Eingetaucht-seins“ in den jeweiligen virtuellen Spielplatz schon als sehr wichtig erachtet (selbstverständlich ist auch, dass zumindest eine minimale Form von Präsentation vorhanden sein muss, damit überhaupt irgendeine Handlung stattfinden kann). Doch welche Form der Ausgestaltung hier den Vorzug erhält, variiert ebenso wie bei der äußeren Gestaltung des virtuellen Spielplatzes, in Abhängigkeit von den individuellen Vorlieben:
Günni: Sound ist mir weniger wichtig, aber die Grafik muss stimmen, sie muss optisch anspruchsvoll sein, braucht aber nicht zu realistisch und detailliert zu sein.
Werner: Neben der Story ist natürlich auch die Grafik und der Sound wichtig und halt auch die Steuerung, […] die haben richtig was drauf, die Grafik, die Effekte und alles. […] Grafik und Sound ist schon wichtig, man siehts ja und man hörts, aber wenn die Story nicht stimmt, sie mir halt nicht gefällt, dann kann das Spiel so schön aussehen wie es will, dann spiele ich es nicht.
Jonas: Da das Spiel von 1996 ist, ist die Grafik eher nebensächlich. Wenn das Spielprinzip gut ist, dann kann die Grafik oder der Sound auch schlecht sein. Für mich ist es viel wichtiger möglichst viele Freiheiten zu haben, und wenn ich diese habe, dann kann es auch die billigste Grafik sein.
Danny: Für mich ist vor allem eine schöne Grafik wichtig, weil ich eben auch privat Grafiker bin. Privat gestalte ich Web-Seiten. […] Aber auch die Story ist nicht unwichtig, aber wenn die Grafik hundsmiserabel ist, dann spiele ich es auch nicht. […] Der Sound ist nicht so wichtig, er soll aber auch nicht zu schlecht sein.
Horst: Grafik ist mir nur bedingt wichtig, ebenso wie der Sound.
Interessant ist, dass die Präsentation der Handlungen innerhalb eines virtuellen Spielplatzes grundlegend als wichtiger erachtet wird als seine äußere Ausgestaltung:
Horst: […] also ich denke, mir ist es schon wichtig, dass die Animationen eher besser sind und das Spiel ruckelfrei abläuft, als dass der Hintergrund schön gestaltet ist.
Spire: […] bei „Oblivion“ macht mein Computer nicht mehr richtig mit, da muss ich schon Grafik und Sound runterstellen, als erstes ist auf jeden Fall der Sound dran, ich hör da meist eh keinen Unterschied, ach die Hintergrundmusik stell ich eigentlich immer aus, die ist meistens eh immer gleich und ich hab lieber die Soundeffekte […] ja, bei der Grafik ist es schon erst der Hintergrund, der etwas runter gestellt wird, dann die Figuren etwas schlechter detailliert, dann der Hintergrund und so weiter, aber die Sichtweite stell ich nie runter [also das Objekte und auch andere Figuren erst später graphisch dargestellt werden], die beeinträchtigt halt direkt das Spiel, für die würde ich auch ein kleines Ruckeln in Kauf nehmen […]. Ja, nur ein kleines, wenn es zuviel hakt, dann kann ich es auch nicht mehr spielen.
Wichtiger als jede detailgetreue Präsentation der Figuren und auch des Hintergrundes ist folglich (auch bei den anderen Probanden) ein flüssiger und ruckelfreier Spielablauf, also eine gute Gestaltung der Animationen; und auch die Soundeffekte sind für eine gute Atmosphäre wichtiger als die Hintergrundmusik, dies wurde auch grundlegend bestätigt.
Einen weiteren Aspekt, der unmittelbar mit dem semantischen Funktionskreis verbunden ist und auch schon in den vorherigen Zitaten Erwähnung fand, ist die „Story“, also der Spielinhalt, die Thematik bzw. die Hintergrundgeschichte. Ihre Relevanz variiert sehr stark bei den jeweiligen Interviewpartnern. Als exemplarisches Beispiel seien hier die Aussagen der drei Probanden bezüglich der Online-Rollenspiele aufgeführt, alle drei Spiele haben als Hintergrund eine mittelalterliche Fantasy-Welt (die sich an Tolkiens „Herr der Ringe“ anlehnt):
Günni: Für die Spielauswahl ist der mittelalterliche Fantasy-Hintergrund eher nebensächlich, könnte von mir aus auch in einer Science-Fiction-Welt spielen. Es ist ja vielmehr das Spiel entscheidend, das muss ansprechend sein. Jede Thematik erschöpft sich ja irgendwann, da man ja alles nur bedingt lange konsumieren kann.
Danny: Ich finde weder Fantasy noch Mittelalter toll, dass interessante ist, man läuft in einer Welt herum und lernt Leute kennen. In dieser Cyber-Welt lernt man Cyber-Leute kennen, man lernt eigentlich die Leute so kennen, wie sie gerne aussehen würden. […] Das Spiel könnte von mir aus in einer anderen Zeit spielen, eigentlich stehe ich sowieso mehr auf Science-Fiction, also mehr auf „Alien“ als auf „Herr der Ringe“.
Jonas: Mich spricht schon die mittelalterliche Zeit an, also ich will nicht da leben, aber ein grundlegendes Interesse habe ich. Auch Fantasy interessiert mich, da ich ja auch eine große Phantasie habe, so lese ich auch gern Phantasien anderer. […] Auch Dokumentationen übers Mittelalter, also etwa die Tempelritter, schaue ich mir schon gerne an. Aber ich gehe jetzt nicht raus und spiele Life-Rollenspiele, doch Pen-and-Paper-Rollenspiele habe ich frühe gerne gespielt […].
Auch bei den anderen Probanden gibt es keine einheitlichen Aussagen. Ob der Inhalt entscheidend ist, hängt vielmehr von den Intentionen und dem Lebenshintergrund des jeweiligen Spielers ab:
Arnold: Der Inhalt ist schon wichtig, bei mir ist der Inhalt Fußball und ich wollte auch ein Fußballspiel holen und interessiere mich auch sehr dafür. […] man kann hier schon richtig die Bundesliga oder die Champions League nachspielen, ich denke, wenn es nur englische Ligen wären, würde ich es vielleicht auch nicht spielen.
Werner: Also generell die Story von Final Fantasy, die ist supergeil, es gibt kaum ein Spiel, wo die Story so gut durchdacht und mitreißend ist […] und ich kann mich da halt richtig reinversetzen […] viele sagen schon, das ist krankhaft, wenn man die Umwelt um sich herum vergisst, aber das ist doch beim Buch lesen auch nichts anderes.
Horst: Ich habe eigentlich nie Fußball gespielt und bin auch kein Fußballfan von einem bestimmten Verein. […] mich interessiert eigentlich mehr das strategische System, was dahinter steckt, als die Tatsache, dass es Fußball ist […].
Man kann vielmehr davon ausgehen, dass der jeweilige Spielinhalt und die Hintergrundgeschichte für ein grundlegendes Funktionieren einer Mensch-Computer-„Interaktion“ weniger Relevanz haben. Vielmehr scheint ihr, ähnlich der Grafik- und Soundpräsentation, eine wichtige Funktion bei dem Gelingen einer simulierten Interaktion zugeordnet zu sein.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen: wenn die Spielsteuerung, das Spielverständnis und das Spielprinzip (Regelstruktur) erfolgreich mit dem Spieler gekoppelt wurden, sind die Grundbedingungen für die (Spiel-)Interaktionen auf dem virtuellen (Spiel-) Platz gegeben und bleiben grundsätzlich auch weiterhin funktionstüchtig. Bei der simulierten Interaktion, die auf der elementaren, funktionstüchtigen Mensch-Computer-Interaktion aufbaut, ist dies dagegen ein fortwährender Prozess, dessen Kriterien permanent überprüft und erfüllt sein müssen, da ansonsten die Interaktion schlagartig aufhört, weil das Spiel beispielsweise als langweilig empfunden wird.
5.2.2. Kriterien einer erfolgreichen simulierten Interaktion
Ob und wie lange eine simulierte Interaktion (mit anderen Worten, die Begeisterung des Spielers gegenüber einem Computerspiel und sein Wille, es fortzusetzen) bestehen bleibt, bestimmt im Wesentlichen der dynamische Funktionskreis, mit seinen drei Unterdynamiken. Aber auch mit seinem Funktionieren befindet man sich erst auf dem Vorhof einer simulierten Interaktion, da man im Prinzip erst die eine Seite der virtuellen Welt berücksichtigt hat, indem es geschafft wurde, den Spieler in das virtuelle Geschehen „hinein zu nehmen“ und dieser es auch so gewollt hat. Für eine computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktion bedarf es jedoch stets einem Partner und dieser wird entweder von einem virtuellen Akteur („Bot“) übernommen oder einem anderen Menschen. Für eine simulierte Interaktion ist dagegen der virtuelle Akteur kennzeichnend und dieser findet im zweiten Teil dieses Kapitels seine Beachtung. Erst wenn dieser seine im Rahmen des Spiels gesetzten Anforderungen erfüllt und der Spieler es zudem will, kann von einer simulierten Interaktion gesprochen werden bzw. von einem wirklichen „Eintauchen“ in den virtuellen Spielplatz.
5.2.2.1. Das gewollte „Hineinnehmen“ des Spielers in das virtuellen Geschehen
Grundlegend lassen sich den Aussagen bezüglich der Regeldynamik zwei zentrale Aspekte ausmachen: Zum einen die Schwierigkeit eines Computerspiels und zum anderen die Komplexität und den Abwechslungsreichtum. Jedoch lässt sich nicht beurteilen, ob einer dieser Aspekte für die Interviewten einen wichtigeren Stellenwert haben. Der Aspekt der Schwierigkeit und die Wichtigkeit einer grundlegenden Offenheit des Spielausgangs wurden schon angesprochen, sie spielen daher auch für eine funktionierende simulierte Interaktion (bezüglich der Regeldynamik) eine zentrale Rolle:
Günni: […] ich versuche alle Möglichkeiten, ja Fähigkeiten und Taktiken voll auszunutzen. Und das finde ich auch am Schwierigkeitsgrad gerade toll, ich kann ihn mir ja so aussuchen, wie ich ihn haben will, und so variiert ja die Größe der Herausforderung eigentlich, ja wenn ich keine Lust habe, mich anzustrengen, gehe ich dahin, wo nichts oder nicht viel passieren kann und, wenn ich die Herausforderung suche, gehe ich da hin wo man einiges tun kann.
Aber auch der Abwechslungsreichtum einer simulierten Interaktion innerhalb virtueller Spielplätze spielt eine nicht minder wichtige Rolle:
Jonas: Der Storyfaden darf nicht einlinig sein, also wenn man es einmal durchgespielt hat, darf die nächste Partie nicht nach dem gleichen Schema ablaufen. Man muss große Wahlmöglichkeiten haben sowohl im Spiel als auch für die Startbedingungen. […] Schön ist es auch, dass man nicht alles niedermähen muss, sondern man kann auch ohne Kampf weiterkommen.
Dabei ist es zum einen die ebenfalls schon erwähnte (komfortable) Komplexität:
Spire: Auf Jeden ist es auch die Flexibilität der Möglichkeiten und die dann doch recht freie Auswahl an Entwicklungsmöglichkeiten einer Spielfigur. […] das Spiel hat zwar einen grundsätzlichen Leitfaden und klar ein Ziel […] das kann man aber auf verschiedenste, eigen ausgesuchte Weise erledigen. Man kann sich richtig frei in der virtuellen Welt bewegen […] dagegen gibt es ja viele Spiele mit einem sehr engen Handlungsstrang […].
Und zum anderen den Witz und die Überraschungen, die sie bergen:
Günni: […] ja viel Abwechslung, so hängen etwa Halloween überall Kürbisköpfe und auch die Gegner hatten Kürbiskopfbomben oder Weihnachten gab es spezielle Weihnachtsgegenstände, die man nur dann holen konnte […] ja auch eine richtige Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmann wurde gehalten […].
Die Ergebnisse zu der Psycho- und Soziodynamik sind sehr mit Vorsicht zu betrachten, da der Interviewleitfaden den jeweiligen Lebenshintergrund der Probanden nur sehr sporadisch ermittelt. Festzuhalten gilt, dass bei einigen Interviewpartnern durchaus Parallelen von bevorzugten Computerspielen und anderen Freizeitaktivitäten bzw. Interessen zu ermitteln waren, so beispielsweise Werner, der ein begeisterter Spieler von Fahrzeugsimulationen ist:
Werner: bei „Need for Speed“ […], ich find ja auch grad das „tunen“ geil, den Motor tunen, ihn überdrehen, dass er halt immer schneller wird, das ist der „Kick“ bei dem Spiel […] in der realen Welt kann ich halt nicht mit 300 km/h über die Landstraße pesen […] ich selbst hab das auch drauf, mit dem Spiel und dem Tunen […] für mich ist das eher eine Kunst. Wenn ich ein getuntes Auto [in der Realität] sehe, drehe ich mich auch gerne um und wenn ich dann eine Kamera dabei hab, dann mach ich auch halt ein Foto davon, das finde ich einfach schön. Man kann hier immer kreativer werden […] hier kann ich halt selbst bestimmen, wie tief die „Schürzen“ am Auto sein sollen oder wie groß die Felgen […] Auf jeden Fall interessieren mich Autos schon lange […] schon mein älterer Bruder früher mit seinem aufgemotzten Opel Tigra, da fing es halt an […] auch Rennen im Fernsehen schau ich mir gern an, aber „Need for Speed“ sind illegale Straßenrennen, der „Kick“, der Reiz dabei […] man geht halt auch kein Risiko ein, wenn man einen Unfall baut, dann passiert ja nichts.
Auch bei den Probanden, die von sportlich geprägten Spielen fasziniert sind, findet sich ein Bezug zu ihrem realen Lebenshintergrund:
Hans-Gerd: Ich spielte schon immer gerne Sportspiele und gerade Eishockey find ich gut, spielte auch selbst in einem richtigen Verein, […] jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Bei dem Spiel findet ich aber auch die Managervariante gut, man kann selbst spielen und selbst seine Mannschaft managen, Training, Sponsoren suchen und, und, und dann versuchen, den Gegner auszutricksen und zu schlagen.
Arnold: Zum einen bin ich ein großer Fußballfan und zum anderen ist es für mich eine Simulation. Es ist nett, so was nachzuspielen [„Anstoß 3“] und es ist etwas witziger gemacht, […] also wie Schiedsrichter bestechen […] aber weiß es nicht genau, liegt aber wohl im Detail.
Bei den anderen Probanden konnten jedoch keine direkten Gemeinsamkeiten ermittelt werden. Auch im Rahmen einer simulierten Interaktion von einer virtuellen Identität zu sprechen erscheint verfehlt, diese entwickelt sich erst, wenn andere menschliche Spieler potentiell den gleichen virtuellen Spielplatz nutzen. So distanzierte sich auch jeder bezüglich allein genutzter Computerspiele, dass er eine Identität konstruiert oder sich in irgendeiner Form selbst darstellt. Allenfalls in Form einer virtuellen Rolle konnten sich Aussagen ermitteln lassen, deren Auswahl durchaus Parallelen mit der eigenen Persönlichkeit aufweisen kann:
Spire: Es ist zuviel, dass man sich hier seine eigene Identität schafft, aber auf jeden Fall schafft man sich eine Identität nach eigenen persönlichen Vorlieben. […] das Aussehen der Figur, die Werte die ich steigere und klar, die Waffen und Zauber die ich verwende, suche ich alle nach Sympathie aus […] ich selbst spiele etwa einen Gift mischenden Bogenschützen, mag keinen Nahkampf […] so kann ich es viel ruhiger angehen lassen […] wie ich es in echt auch gerne mache […] auch bei „Counter-Strike“ suche ich mir weit reichende Waffen und bin nicht so im Nahkampf […] alles viel zu hektisch. […] Also ich denke schon, dass ich meine Figuren nach meiner Persönlichkeit auswähle, […] aber Wunschidentität, nee das würde zu weit gehen, dafür ist das zu sehr ein Spiel, außerdem spiel ich das nur gegen einen Computer.
Dafür, ob der Spieler sich während der direkten Spielsituation auch in der entsprechenden virtuellen Rolle empfindet, d.h. so wahrnimmt, konnte nur in Ansätzen ermittelt werden:
Jonas: […] als der kleine Eroberer, als Feldherr. Es ist ja nur Taktik gefragt, also spielt man den kleinen Napoleon […] aber ich fühle mich jetzt nicht wirklich als Feldherr.
Werner: Computerspielen ist ja so etwas, man schlüpft in eine Rolle, oft spielt man ja aus Sicht der Person und die anderen schauen einen an […] man stellt sich halt schon vor, dass man gerade der Hauptcharakter ist, halt ein Rennfahrer.
Arnold: […] kann ich nicht genau sagen. Ich bin im Spiel der Manager, der Meister [kurzes Lachen], dann gibt es bei „Anstoß 3“ Bewertungen, wie so was wie Publikumsbeliebtheit, aber ich nehme diese Rolle nicht mit in die reale Welt. Grundlegend, ich weiß es nicht.
Inwieweit die virtuellen Spiel-Rollen nun von der kulturellen Sozialisation und der jeweiligen Gesellschaft abhängen (d.h. Aspekte der Soziodynamik), wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht erfragt.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass seitens des Spielers ein ständiger (unbewusster) Bewertungsprozess der drei Unterdynamiken darüber entscheidet, ob er sich noch grundlegend auf eine simulierte Interaktion einlassen will. Fällt dieses Ergebnis positiv aus, so entscheiden die Kriterien und die Beschaffenheit der computergesteuerten Akteure darüber, inwieweit die Simulation gelingt und der Spieler nicht ungewollt aus dem virtuellen Spielplatz wieder „auftaucht“.
5.2.2.2. Anforderung und Beschaffenheit der virtuellen Akteure
Grundlegend zeichnet sich ein computergesteuerter bzw. simulierter Spielpartner dadurch aus, dass er zum einen die Anforderungen eines Spiels, also die sechs Wesensmomente erfüllt. Dies wird im folgenden auch angenommen, da die simulierten Spielpartner ein Sub-Programm eines Computerspiels sind und daher auch seinen Regeln folgen müssen, um keinen Programmabsturz zu verursachen. Daraus resultiert: wenn das Computerspiel selbst die Anforderungen der Wesensmomente einhält, so tun es auch die computergesteuerten Spielpartner.
Zum anderen zeichnet sich ein simulierter Akteur durch seine formal-logischen Programmroutinen aus:
Werner: Der Computer ist halt berechenbar, der Computer ist an sich dumm, er macht halt nur das, was ich ihm sage, […] so wie die Programmierer programmiert haben, so handelt er auch.
Jonas: Der Computer ist irgendwann berechenbar […] beim Spielgefühl ist es, dass es beim ersten Mal [gewinnen] toll ist, dann versucht man es eine Stufe schwieriger, aber auch das hat man irgendwann raus.
Arnold: Der Computer lässt sich irgendwann ausrechnen, ja voraussehen. Aber in den letzten Jahren ist auch die KI gestiegen und besser geworden […].
Was trotz allem die Täuschung glücken lässt, ist der Aspekt des „Irgendwann“, und bis er eintritt, können mitunter einige Monate, manchmal auch Jahre vergehen, was sich nach den Angaben der Probanden daran ablesen lässt, seit wann sie die betreffenden Computerspiele spielen. Und auch ein formal-logischer Computergegner stellt mitunter eine harte Nuss dar:
Günni: Hier hat sich ja einiges getan. So gibt es Computerspiele, wo sich der Computer deinem eigenen Spielvermögen anpasst, also deinem Level. Es gibt Computerspiele, die berechnen genau deine Vorgehensweise und übernehmen die, dann spielt man ja sozusagen gegen sich selbst.
Horst: […] man merkt beim Computer, dass er auf irgendwelche Parameter beruht oder sich so verhält aufgrund von Berechnungen […]. Aber der Computer kann auch recht gut sein […] eigentlich gerade wenn, man ein Spiel neu hat und diese ersten Spiele macht […] man hat auch noch die Schwierigkeitsstufen und es oft auf die richtige Abstufung ankommt, […] so bin ich eigentlich mit den Computerleistungen recht zufrieden und wenn ich nicht mehr zufrieden bin, dann spiele ich das Spiel auch nicht mehr.
An dem letzten Zitat ersieht man auch, was grundlegend passiert, wenn dieses „Irgendwann“ erreicht wurde, das Spiel wird nicht mehr gespielt. Bei einem Solo-Computerspiel wird auch durchweg erwartet, dass der simulierte Spielpartner möglichst „intelligent“ bzw. „effektiv“ agiert, aber er muss sich im Rahmen der Fairness bewegen:
Der Alte: Wenn man das Spiel beherrscht glaub ich, ist der Computer einem ideentechnisch immer unterlegen, so ist es auch OK, wenn er Produktionsvorteile erhält und mit größeren Massen ankommt […] aber wenn die KI nur noch darauf aufbaut, dann machts keinen Spaß […] auch wenn die [künstliche Intelligenz] alles sieht und jede Idee schon im Ansatz vereitelt, weil sie den Hinterhalt sowieso schon erkannt hat, dann ist so was schon langweilig.
Horst: Ich finde es wichtig, wie sich der Gegner verhält, ich baue eine Stadt auf und der Computer ebenso und es gibt danach einen gegenseitigen Angriff, dann erwarte ich hinter dem gegnerischen Angriff, das da auch eine gewisse Intelligenz steht und eine gewisse strategische Leistung […] eigentlich so, als wäre der Gegner kein Computer.
Folglich stellt der Aspekt der Künstlichen Intelligenz ein zentrales Kriterium der Konstruktion virtueller Spielpartner dar. Doch sobald der virtuelle Spielplatz potentiell gemeinsam mit anderen Menschen genutzt wird, fällt dieses Kriterium in die Zweitrangigkeit. Einerseits soll der Computer überhaupt keinen Spielgegner mehr stellen, da man ausschließlich mit anderen Menschen spielen will. Dies ist vor allem bei den Probanden „Der Alte“ und „Horst“ der Fall, wenn sie ein Echtzeit-Strategiespiel in einem realen Netzwerk mit Freunden spielen. Hier würde der Computer vor allem mit seiner Spielweise stören, da er ein ungestörtes Aufbauen, bevor man in die „Schlacht“ zieht, unmöglich machen würde.
Andererseits (am Beispiel der Online-Rollenspiele) kann und sollen die computergenerierten Akteure in eine Statisten-Rolle zurückfallen:
Günni: Bei World of Warcraft sind die Computergegner im Prinzip genau strukturiert. Jedes Monster kann nur bestimmte Sachen und hat bestimmte Fähigkeiten. […] Sie sind intelligenztechnisch gesehen stroh-dumm, weil sie ja nicht einmal weglaufen, sich verstecken oder Verstärkung holen. Und wenn sie das machen, dann weiß man ja das von diesem Monstertyp. […] Aber trotzdem bin ich zufrieden mit den dummen Computergegnern, es dient mir ja zur Entspannung. Es gibt dann aber auch ganz starke dumme Computergegner, die dann einen Reiz darstellen, weil sie ja stark sind. Stärker als man selbst und man muss dann ja viel tun, um diese zu besiegen. […] So kann ich einmal ja die Schwierigkeit variieren und habe ja noch als Ausgleich die menschlichen Gegner. […] ja und ein paar nette Sachen lassen sich dann auch einsammeln, Erfahrung brauche ich ja mit meinen Leuten auf der höchsten Stufe nicht mehr […].
Jonas: Ja die ist berechenbar. Aber das ist ja auch gut so […] man weiß, man geht in einen Dungeon, da sind die und die Monster und die haben die und die Fähigkeiten. Es muss ja nicht immer ein anderer, großer Reiz sein, etwa im Team zu spielen, manchmal geht es auch nur darum, kleine Goldmünzen aufzusammeln und mit dem Gold dann die Ausrüstung verbessern.
Neben der Entspannung dienen die simulierten Interaktionspartner folglich der Vorbereitung und dem Training der eigenen Spielfigur, um später im Vergleich mit anderen, menschlichen Spielern vielleicht etwas besser dazustehen. Eine weitere Funktion des Computers sei noch abschließend erwähnt, nämlich die, dass er die Rolle eines Schiedsrichters bzw. in folgendem Zitat des Spielleiters einnimmt:
Günni: Als Kind habe ich schon gerne Rollenspiele gespielt, damals in Form von Pen-and-Paper-Rollenspielen, weil die Computertechnologie noch nicht so gut war. Früher musste das Spiel immer von einem anderen gesteuert werden, der Spielmeister. Und das macht heute der Computer, richtig gut und detailliert, ja und sehr umfangreich und man hat deswegen auch mehr Möglichkeiten, etwas zu tun, als in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. All die Sachen, die es in World of Warcraft gibt, können einem früheren Spielmeister gar nicht einfallen.
Eine realitätsnahe Konstruktion der simulierten Interaktionspartner wird von den Probanden in Abhängigkeit vom jeweiligen Computerspiel erwartet, dabei gilt grundlegend, dass die Thematik, die Hintergrundgeschichte nicht zwingend realitätsnah sein muss (z.B. bei Fantasy-Spielen):
Werner: Kommt auf das Spiel an, wenn ich ein Fantasyspiel spiele, verlange ich nicht unbedingt, dass es realistisch ist […] aber die Physik- und Floraengine sollte es schon sein […]oder wenn einer nach nem Kampf tot umfällt, dann soll er nicht auf einem Abhang gerade liegen bleiben, dann soll er schon realistisch runter fallen. Die Story muss aber nicht unbedingt realistisch sein […].
Jonas: Da ich sowieso eher mittelalterliche Spiele bevorzuge, müssen sie nicht unbedingt realitätsnah sein, aber die einzelnen Spielabläufe sollten schon realitätsnäher sein. Also ein Männchen, was beim Gehen seine Beine nicht bewegt, wenn man es irgendwo hinschickt, sieht ja nicht so schön aus. […] ebenso erwarte ich auch, wenn ich einen NPC böse angehe, dass er nicht nett und freundlich zu mir ist […] und auch die Welt sollte entsprechend gestaltet sein, also ein Baum sollte schon wie ein Baum aussehen […] auch kleine Extras können die Spielwelt schön beleben, so finde ich es auch schön, wenn die einzelnen NPC nicht immer fest an einem Platz stehen, sondern auch umherlaufen, ja einen Tagesablauf haben.
Günni: Das Spiel selbst sollte nicht realitätsnah sein […] aber die einzelnen Bewegungen sollten ja schon dem natürlichen angepasst sein. So sind es ja auch keine unnatürlichen Bewegungen, obwohl es unnatürliche Figuren sind, eben wie ein Minotaur, ja ein Mensch mit Stierkopf ist, aber dieser bewegt sich ja trotzdem wie ein normaler Mensch, also schon realitätsnah. […] Oder wenn man ein Monster trifft, dann sollte auch Blut dazugehören. Denn wenn man sich mit einem Messer schneidet, dann blutet es ja normal. […] Es bringt einen einfach noch mehr in die Welt rein.
Wie man an den Zitaten ersieht, gilt dies aber nicht für die Gestaltung der Bewegungsabläufe bzw. der diversen Objekte. Die simulierten Interaktionen sollten in den Augen der Probanden einen Verweis auf reale Interaktionen beinhalten, damit die Täuschung um so stabiler erscheint und man so ein besseres Spielgefühl erhält, mit anderen Worten besser und länger in die virtuelle Welt „eintauchen“ kann:
Hans-Gerd: Die ist mir schon sehr wichtig, die grafische Darstellung sollen gut sein und gerade die Kombinationsmöglichkeiten, Schusstechniken und vor allem das Spielerverhalten auf dem Platz soll realitätsnah sein […] gerade die Spieler die man nicht direkt steuert, müssen mitspielen, wie eben bei einem richtigen Eishockeyspiel […] man selbst steuert ja sowieso meist nur den Spieler, der am Puck ist oder in der Abwehr dem Puck am nächsten.
Auch das Auswechseln des gewöhnlichen Joysticks gegen ein Computer-Lenkrad mitsamt Pedalen zielt ebenfalls auf eine höhere Realitätsnähe:
Werner: […] wenn ich ein Rennspiel spiele, dann will ich halt ein realistisches Rennen fahren, so wie man halt auch wirklich mit einem Auto fährt […] wenn ich fahre, finde ich es schon cooler, auch mit Lenkrad und Pedale zu fahren […] fährt sich halt auch besser und kommt halt noch mehr das Gefühl auf.
Jedoch gilt festzuhalten, dass es auch nicht zu viel des Guten sein darf, da mitunter der empfundene Spielfluss beeinträchtigt wird (beispielsweise wird die Steuerung aufgrund der realitätsnahen Komplexität immer unhandlicher und unübersichtlicher):
Jonas: Bei den Schlachten finde ich es schön, wenn sie gut und realitätsnah aussehen, […] eben wie das so ist, wenn ein Pfeilhagel auf einen Trupp Menschen niedergeht. Aber es sollte auch nicht zu realistisch sein, so dass die Spielbarkeit darunter leidet.
Arnold: Ein Spiel kann zwar realistisch sein, wenn es aber keinen Spaß macht, dann spiel ich es auch nicht. […]. Aber ich denke, dass es auf das Gesamte ankommt, also wenn die Steuerung stimmt, es zudem realistisch ist, dann steigen die Chancen auf Spielspaß, es läppert sich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die simulierten Interaktionen grundlegend einen formal-logischen Charakter haben, und dies auch von den Spielern so gewollt ist. Irgendwelche nicht spielbezogenen Interaktionen (z.B. emotionale oder darstellerische Handlungen) werden von einem Computer nicht verlangt. Die Gestaltung der Abläufe selbst muss einen grundlegenden, aber auch nicht zu detailgetreuen Verweis auf die reale Welt (bzw. zumindest die mentale Welt) haben. Entscheidend ist zudem ein Abwechslungsreichtum in Form eines Ideen- und Variantenreichtums des simulierten Interaktionspartners, der im Idealfall auch die gleichen Spielanforderungen (d.h. den gleichen Bedingungen unterliegt, ohne spieltechnische Vorteile z.B. Produktionsvorteile) erfüllen muss wie die menschlichen Spieler. Dieses Ideal wird mit zunehmender Spieldauer jedoch immer unerreichbarer.
Aus diesem Grund ist auch eines der beliebtesten Spielvarianten bei den Interviewten das gemeinsame Spiel mit anderen Menschen. Auch die Probanden, die derzeit nur Solo-Computerspiele nutzen, zögen grundlegend gemeinsame (zumindest real vernetzte) Computerspiele vor, wenn die Spielpartner bereit stünden.
5.3. Gemeinsam genutzte virtuelle Spielplätze
Hier interessiert vornehmlich die Frage, welche Unterschiede in den spielbezogenen Interaktionen eines Menschen gegenüber den simulierten Interaktionen eines Computers bestehen.
Günni: Ein großer Nachteil ist bei Solospielen für mich im nach hinein betrachtet […] dass man als Spieler dazu neigt, nur noch dem Computer seine Schwächen zu berechnen, weil er ja aus programmierten Routen besteht und die ja eben begrenzt sind. Wenn man nun diese herausgefunden hat, ist man ja auch ganz schnell bei der Lösung und hat das Spiel gewonnen. […] Online habe ich ja die Möglichkeit, gegen menschliche Gegner zu spielen, die zwar auch oft nur ein begrenztes Repertoire haben, aber sie sind ja unberechenbarer als ein Computergegner. Das ist der Reiz, der menschliche Gegner ist variabel.
Danny: Computer bringen immer dieselben Sachen, haben vorgegebene Richtlinien. Das Gefühl gegen einen anderen Menschen zu spielen, rockt auch mehr. Ein menschlicher Spieler besitzt Taktik, er ist nicht so leicht vorhersehbar. Ein Computergegner bei Quake trifft auch immer und das sehr genau [wenn die Schwierigkeit sehr hoch eingestellt wird], sobald er einen sieht, dann trifft er auch, daher muss man so spielen, dass er einen nicht sieht, ich verwende dann Granaten und Raketen, jedenfalls eine ganz andere Taktik. Ein Mensch muss sich erst orientieren, er trifft auch nicht immer sofort und weiß auch nicht immer, wo die Gegner sind.
An den beiden Zitaten ersieht man schon einige wichtige Unterschiede, so vor allem die prinzipielle Unberechenbarkeit und die Variabilität eines Menschen. Aber auch, dass ein menschlicher Gegner den gleichen Spielbedingungen unterliegt wie man selbst ist ein entscheidender Aspekt. Der menschliche Gegner kann sich nicht in Sekundenbruchteilen orientieren wie ein Computer, und er macht auch gelegentlich Fehler und lässt sich überraschender mit taktischen Finessen austricksen als ein Computer. Es sei denn, der menschliche Gegner hat eine noch originellere Antwort, um die Aktion zu parieren, während der Computer immer nach ähnlichem Schema vorgeht:
Arnold: […] trotzdem, beim Menschen weiß man nicht, wie er reagiert, da hat jeder seine Taktik, es ist nicht so schemenhaft wie beim Computergegner. […] beim Menschen spielt auch eine neue Herausforderung mit, man weiß halt nicht wo man steht, den Mensch kann man nicht vorausberechnen wie einen Computer […] und hier kann man auch erst wirklich sehen, ob man das Spiel beherrscht oder nicht und deswegen untergeht. […] Vorteilhaft ist auch, wenn man den Menschen kennt oder ihm beim Spielen zusieht, so kann man schon seine Taktik ersehen und sich drauf einstellen. Es wird auch immer interessanter, wenn man öfters gegen den Selben spielt […] auch der andere hat seine eigene Taktik und lässt sich was neues einfallen […] Menschen bieten mehr Überraschungen, beim Computer weiß man mit der Zeit, wie und wann er ankommt […] während man sich bei Menschen gemeinsam weiterentwickeln kann und besser werden.
Aus diesem Zitat lässt sich noch eine weitere, sehr zentrale Charakteristik des Menschen herauslesen: gemeint ist seine Lernfähigkeit, also dass er nicht wie ein Computergegner immer auf seinem vordefinierten Niveau bleibt:
Werner: Weil beim Onlinespiel sitzt da auch ein Mensch, der genauso denkt und spielt wie ich, der halt ebenso einen Ehrgeiz hat […] der Computer macht nur soviel, wie ihm gesagt wird. Bei einem richtigen Gegner ist es viel interessanter, weil die halt einfach schwieriger sind, nicht immer, es gibt auch Anfänger, wo es halt leicht ist, aber ebenso sind es die Gegner, wo man sich denkt, wie schafft der das denn, das gibt dann einen Ansporn.
Jonas: Ja und dann geht es irgendwann an einen menschlichen Gegner. Der lernt ja ebenso wie ich und so sind auch die Spiele abwechslungsreicher, weil er ja jeden Tag etwas Neues machen kann und damit ist auch die Herausforderung größer. […] und außerdem kann man sich mit einem menschlichen Spieler unterhalten […] man sitzt eben nicht allein vor dem Rechner.
Und genau die zuletzt genannte Möglichkeit macht eine grundlegende Faszination des gemeinsamen Spiels aus. Die Kommunikation mit anderen Menschen, der gemeinsame Spaß und auch das Gefühl von Gemeinschaft sind Elemente, die bereits über die direkte Spielsituation hinausweisen. Für die direkte Spielsituation bleibt festzuhalten, dass es vor allem die Unberechenbarkeit (sowohl im herausfordernden Sinne, da ein menschlicher Gegner vielfach schwieriger empfunden wird als ein computergesteuerter, ebenso wie im entspannenden Sinne, da Menschen öfters „amüsante“ Fehler machen, die einem Computer nie unterlaufen würden) und die Lernfähigkeit eines Menschen ist. Zu erwähnen sei noch, dass man aufgrund der Kommunikationsmöglichkeiten mit einem anderen Menschen besser kooperieren kann, also die Teamfähigkeit wird durchweg als weiterer Vorteil angegeben. Mit einem simulierten Spielpartner ist es nach Aussagen der Probanden entweder überhaupt nicht möglich oder nur sehr bedingt, da die Aktionen eines Computers innerhalb eines Teamspiels oft als selbstmörderisch bezeichnet werden.
Grundlegend gilt auch, dass sich das Spielgefühl wandelt, da ein menschlicher Gegner immer als realer Gegner wahrgenommen wird und folglich wächst auch die Emotionalität während des Spiels:
Horst: Bei Hattrick ist es, dass ja hinter jeder Mannschaft ein menschlicher Gegner steckt, der ebenso seine Einstellungen tätigt […] es gibt auch gewisse Zufallsfaktoren, die das Spiel regelt aber grundsätzlich ist der Gegner gegen den man am Samstag spielt, ein realer Gegner und wird von mir auch so wahrgenommen.
Werner: […] es freut mich auch mehr wenn man einen echten Gegner besiegt, bei einer LAN-Party springt man dann auch auf, wenn man gewonnen hat und lacht halt den anderen aus, halt so ein Konkurrenzding unter Freunden. […] Es ist viel schöner, jemanden zu besiegen, wo man eigentlich keine Chance hat, als ein Spiel durchzuspielen, denn dann sagt der andere, ja toll, ich habe es auch geschafft, das hat halt jeder […] wenn ich aber einen anderen besiege, dann bin ich wenigsten besser als ein paar andere.
Allgemein wurde angegeben, dass eine reale Vernetzung, gerade aufgrund der Möglichkeit, in eine Face-to-Face-Kommunikation einzutreten, gemeinschaftlicher und daher auch unterhaltsamer ist. Sie wird im Prinzip auch einer virtuellen Vernetzung vorgezogen, wenn nicht der organisatorische Aufwand wäre. Gerade die Probanden, die keinen Laptop besitzen, klagen über den Transport von Computer mitsamt Monitor und Zubehör, da die Computer in unmittelbarer Nähe positioniert werden müssen. Auch die entsprechenden Räumlichkeiten sind nicht immer vorhanden. Eine Ausnahme bilden hier die beiden Sportspiele „Fifa-Soccer 2007“ und „NHL 2007“, sie können noch bequem an einem Computer und Bildschirm genutzt werden. Arnold spielt daher auch sehr regelmäßig gemeinsam mit anderen Menschen in einer Face-to-Face-Situation. Bei den anderen wird dagegen durchschnittlich ein Zeitintervall von vier bis zwölf Wochen angegeben (manche spielen sogar noch seltener). Der Alte spielt etwas regelmäßiger, da er in einer WG mit mehreren anderen computerspielfaszinierten Menschen wohnt, und sie ein permanent stehendes lokales Netzwerk aufgebaut haben. Von daher gibt es hier auch keinen nennenswerten organisatorischen Aufwand. Doch grundlegend lässt sich festhalten, dass bei den Interviewten ein verstärkte Trend zur virtuellen Vernetzung auszumachen ist. Nach Aussagen der Probanden, die derzeit Online-Computerspiele nutzen, entwickelte sich ihre Faszination erst vor wenigen Jahren (variiert zwischen zwei und sechs Jahre), vorher war die Computertechnologie noch nicht ausreichend, und rein textbasierte Onlinespiele wurden von keinem genutzt.
So fallen auch die Erzählungen über LAN-Partys durchweg positiv aus. Nur der folgende Proband erwähnt auch die Anstrengung, die eine solche Party beinhaltet:
Spire: Lan-Parties klar, LAN-Sessions haben wir die immer genannt, da haben wir uns mit zwanzig Mann getroffen, alle Computer zusammengeschlossen, einen Raum gemietet. Und privat haben wir das auch gemacht, natürlich mit weniger Rechnern. […] Und dann haben wir schon die ganze Nacht, manchmal auch ein ganzes Wochenende gezockt […] Aber klar, nach sechs bis acht Stunden kann man wirklich nicht mehr, dann knallt es nur noch im Kopf und dann reichts auch […] wenigstens für diesen Tag. […] Aber hat man sich schon die Mühe gemacht und alles herbeigekarrt, dann muss man da auch durch, sonst lohnt es nicht.
Das intensive Computer spielen (manchmal über drei bis vier Tage) schreckte jedoch keinen ab, so eine Party zu wiederholen, es ist vielmehr eine ungetrübte Begeisterung für diese Spielvariante vorhanden. Bei der virtuellen Vernetzung scheiden sich jedoch die Meinungen. Einige Probanden sind große Fürsprecher, andere lehnen sie aus prinzipiellen oder spieltechnischen Gründen ab:
Jonas: Bei „Ultima Online“ ist aber noch faszinierender, dass man online spielt, also mit anderen Menschen. Man hat ja hier seine kleinen Grüppchen und dann werden auch Gilden gegründet, mit denen man sich dann auch außerhalb des Spiels unterhält Werner: Online ist das [„Need for Speed“] erst richtig genial, sich halt mit anderen zu messen. Wenn man das gegen den Computer geschafft hat und man denkt dann halt „ah, ich bin der Beste“ […] aber wenn man dann online geht, dann kriegt man plötzlich eine „Klatsche“ von einem anderen und weiß „halt Stopp“, da gibt es ja noch bessere, der Reiz ist halt größer, man weiß, da ist einer besser und man will ihn halt besiegen.
Hans-Gerd: Onlinespiele sind nicht so mein Ding, ich will schon wissen, mit wem ich spiele, ich finde die sind viel zu unpersönlich, wenn dann mal ein Netzwerk-Spiel, aber das ist jetzt bestimmt auch schon ein halbes Jahr her, also jetzt spiele ich nur allein.
Horst: […] eigentlich würde ich das auch nur mit Menschen spielen, die ich schon vorher kenne, […] so etwas wie ein erweitertes Netzwerk übers Internet […] aber mit anonymen Personen würde mich „Age of Empires“ nicht reizen.
Werner: Onlinerollenspiele sind bestimmt cool und wenn die kostengünstiger wären, könnte ich mir so eine Welt auch gut vorstellen, hier steht dann halt der Punkt der Gemeinschaft im Vordergrund. Aber Rollenspiele wie „Final Fantasy“ [Solo-Rollenspiele], die finde ich halt deswegen toll, weil man in Ruhe die Story genießen kann, wie man halt auch ein Buch alleine liest.
Der Alte: Für Multiplayer ist das nichts, es ist eher ein langwieriges Ding […] so ein Spiel wo ich mich gemütlich hinsetze, Zigarette dabei, etwas trinke und dann spiele. Die Grafik sieht gut aus und es läuft alles schön slow ab […] auch die Echtzeit-Schlachten, man kann ja immer Pause machen und dann in Ruhe die Befehle geben und dann erst die Zeit wieder anschalten […] also eigentlich hat das nix mit Echtzeit zu tun […] wenn man jedenfalls allein spielt, aber der Multiplayer-Modus ist sowieso gammel, man kann nur die Schlacht kämpfen, aber gerade der interessante strategische Aufbau fehlt […].
Die Gründe dagegen sind oft der (vermeintlich) unpersönliche Charakter der virtuellen Vernetzung, die damit einhergehenden Kosten[232] und spielinterne Gründe, entweder dass die Spielmöglichkeiten der Mehrspieler-Variante wesentlich eingeschränkter sind als die der Einspieler-Variante, oder dass die Spiele selbst zu langwierig sind (eine Spielpartie kann sich mitunter über mehrere Monate hinziehen):
Jonas: Also im Netzwerk spiele ich auch eher Echtzeitstrategiespiele als langwierige komplexe Spiele, es soll ja schon etwas passieren.
Aber auch von der umgedrehten Variante wird gesprochen, also dass der gemeinsame Spielmodus wesentlich umfangreicher ist. Und dies ist auch ein sehr gewichtiger Grund für die virtuelle Vernetzung, insbesondere bei Online-Rollenspielen, sie weisen schon Merkmale auf, die vergleichbar sind mit einem realen Spielplatz: sie fungieren als ein Treffpunkt, wo eben nicht nur gespielt wird, sondern auch über reale Gegebenheiten gesprochen wird und sich im Zuge dessen auch eine virtuelle Community[233] bildet:
Danny: […] das [„Guild Wars“] ist eine Cyber-Web-Welt, eine andere Welt die man erkunden kann. […] Am Anfang fande ich gerade das Erkunden toll, die Welt und insbesondere die tausende von anderen Spielern. Ich war auch total überfordert und musste mich mit der Zeit erst hineinarbeiten.
Günni: Ja die Handlungsmöglichkeiten sind so gigantisch und da ist ja noch eine gewisse Community, eine Gemeinschaft, in der man sich bewegt. Man könnte dies vergleichen mit einem Dorf in das man zieht und alle Leute kennen lernt und sich wohl fühlt. Und wieso sollte man nun einen Grund suchen, aus diesem Dorf wieder wegzuziehen, dann bleibe ich doch hier, hier hat man alles, einem ist nie langweilig, weil ich ja immer eine Idee habe, was ich machen kann, ja und die ganzen Menschen, die ich kenne, mit denen ich das machen kann. […] Ja es ist natürlich ein abgetrenntes Dorf, in der Realität habe ich ja mit ihnen keinen Kontakt.
Mit solchen Zitaten befindet man sich, wie gesagt, schon außerhalb der direkten Spielwelt, die anderen Menschen dienen als Kommunikationspartner (ähnlich einem Chat-Room) und natürlich zeitgleich als Spielpartner. Sie unterliegen daher bezogen auf die Merkmale einer spielerischen Interaktion denselben Anforderungen wie ein simulierter Interaktionspartner. Grundsätzlich ist auch, gerade angesichts des gemeinsamen Spiels, ein Bestreben vorhanden, diese einzuhalten, man will kein Falschspieler oder Spielverderber sein. Der formal-logische Charakter bei menschlichen Spielinteraktionen trifft nur bedingt zu: So wird einerseits von allen angegeben, dass man schon bestrebt ist, das Spiel zu gewinnen und dementsprechend auch möglichst utilitaristisch vorgeht. Aber diese Gewinnorientierung hat auch ihre Grenzen, dies wird aus folgenden Aussagen deutlich:
Der Alte: […] ja eigentlich, ne eigentlich nicht. Bei „Empire Earth“ etwa, wenn man mit mehreren Kumpels zockt, dann dauert das in der Regel einen ganzen Abend bis in die Nacht und dann nimmt sich auch keiner was vor. Jetzt kann es aber sein, dass einer einen sehr schlechten Start hat und man ihn schon nach einer Stunde ganz vernichten kann, ich denk fürs Spiel wärs gut, ihn sofort kalt zu machen, man hat halt keinen Stress mehr mit ihm und kann sich auf die anderen konzentrieren, aber das macht man dann doch nicht, weil er dann sofort raus wäre und zugucken könnte. […] ne, man lässt den dann meist etwas in Ruhe und kämpft gegen stärkere Gegner, jedenfalls ich mach das so […].
Spire: […] eher nicht so viel, außer […] wenn ich weiß, das einer ein Anfänger ist, klar so einen würde ich mir jetzt nicht als Opfer aussuchen, aber das würde für mich auch keine Herausforderung darstellen […] ist schon eher unfair.
Aber auch in Richtung einer speziellen Konkurrenz, gibt es nicht-rationale Aktionen, beispielsweise:
Spire: […] richtig herausfordernd sind schon manche Leute, aber die kenne ich auch. Bei manchen hab ich auch so eine Art Blutsfehde, und klar solche Leute suche ich mir extra raus […]. Auch ob ich einen mag und nett finde oder nicht, spielt bestimmt auch einen Grund.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass gerade bei realen Vernetzungen, wo in der Regel (wird auch so bestätigt) einander persönlich bekannte Menschen miteinander spielen, vermehrt Aktionen auftreten, die ein Computer im Prinzip nicht ausführen würde, z.B. Aktionen aufgrund von Sympathie oder Antipathie. Doch anscheinend, je unpersönlicher die Beziehung zwischen den Spielern ist, desto seltener treten nicht-gewinnorientierte Spielinteraktionen auf. So wird sich im Rahmen der Onlinespiele eher an dem persönlichen Wohl oder dem Wohl der eigenen Gruppe, des Teams orientiert.
Damit es überhaupt zu einer Gruppenbildung kommen kann, bedarf es der Kommunikation und nicht direkt spielbezogene Interaktionen der Spieler untereinander, mit dem vordergründigen Ziel, sich kennen zu lernen und eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen, sowohl auf spielerischer, wie auf persönlicher Ebene. Solche Interaktionsformen werden hier als „computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktion“ verstanden und sind grundlegend von den zuvor beschriebenen Interaktionsformen zu unterscheiden. Erwähnt sei noch, dass die bei einer realen Vernetzung gewöhnlich stattfindenden face-to-face-Kommunikationen kein Gegenstand dieser Arbeit sind, sie bezieht sich lediglich auf virtuell vernetzte Kommunikationen. Zum Abschluss noch ein Proband, der den Unterschied zwischen realer und virtueller Vernetzung gut auf den Punkt bringt:
Jonas: […] eigentlich spiele ich Netzwerkspiele auch nur mit Freunden, also mit realen Bekannten. […] Was auch noch ein Unterschied ist, man kann rüber gehen und den anderen fragen, ob er eine Wurst will.
5.4. Zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation auf virtuellen Spielplätzen
Grundlegend baut die computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktion auf eine funktionierende Mensch-Computer-„Interaktion“ auf. Nur wenn man das Spiel so weit beherrscht, dass man mindestens die Aktionen bedienen kann, um mit anderen Spielern in Kontakt zu treten, steht einem diese Interaktionsform offen.
Nach Meinung der Online spielenden Probanden kommen durchaus gelegentlich Personen vor, die das Spiel überhaupt nicht beherrschen und nur chatten wollen, doch meist wird das von ihnen nicht gern gesehen, weil sie den Spielfluss stören, indem sie einen mit nicht-spielbezogenen Themen ablenken und auch gar nicht anders können, da sie keinerlei Spielkenntnisse besitzen. Keiner der Probanden hat so was auch je gemacht, „dafür gibt es halt auch Chat-Foren“ wie Werner exemplarisch anmerkt und ein anderer Proband drückt dies folgendermaßen aus:
Günni: Die Leute gibt es leider und das sind ja auch die Leute, die ich wegklicken muss [damit ist gemeint, dass er einen Spieler so markiert, dass fortan seine Chat-Kommentare nicht mehr angezeigt werden], da die mich irgendwie stören. Reine Spielintention ist der Grund, warum ich überhaupt Online gehe.
Für alle Interviewten ist es wichtig, das jeweilige Spiel zu beherrschen, und natürlich kommt es bei jedem auch mal vor, dass er weniger spielt und mehr mit Spielkollegen chattet. Aber hier findet sich ein grundlegender Unterschied bezüglich der Spielgenres: die Online-Rollenspiele nehmen eine gewisse Sonderstellung ein, da hier die Probanden stets innerhalb der Spielwelt miteinander kommunizieren, also mit Hilfe ihres virtuellen Stellvertreters[234]. Bei den anderen Spielkategorien kann man zwar auch innerhalb des Spiels chatten, ohne direkt daran teilzunehmen (in Form eines Beobachters), aber damit würde man den Gesprächsfluss der aktiv Spielenden stören. Von daher gibt es nach Angaben der Interviewten für jedes dieser Spiele auch angehängte Chat-Rooms, in denen sich die jeweiligen Spieler treffen, und erst dort wird vermehrt auch über reale und persönliche Themen gesprochen:
Günni: […] man lernt ja zu erst das Spiel „Quake“ kennen und danach erst das Quake-Net […] mir wurde während des Spielens gesagt, „komm doch mal ins IRC“ [innerhalb des Internet Relay Chat gibt es eine Rubrik, die sich Quake-Net nennt], und da bin ich dann hingegangen und sah dort tausende von anderen Leuten miteinander sprechen. Jeder sagte etwas in den Raum hinein […]. Zudem gibt es noch ein schönes Programm „The all seeing eye“, mit dem kann man jederzeit sehen, wer wo gerade „Quake“ spielt […] im Spiel selbst rede ich aber weniger und überhaupt nicht über reale Sachen […] es kann auch schon vorkommen, dass man jemanden kennen lernt und sich denkt „hey der ist ja nett“, lass uns mal im IRC kommunizieren, aber im Spiel selbst schließt man eigentlich keine Freundschaften […] während des Spiels wird eher gesagt, du bist ja total schlecht oder es hat Spaß gemacht […].
Während bei Online-Rollenspielen stets beide Gesprächsebenen (Spiel und Realität) vermischt werden:
Jonas: Och eigentlich wird über alles gesprochen, Beziehungsprobleme, Hochzeiten, also durchaus auch persönlichere und intimere Themen […] ich selbst bin auch schon offen und ehrlich, ich bin jetzt nicht Jennifer und achtzehn Jahre alt. […] das Vertrauensverhältnis ist schon OK, aber es sind Spielgefährten und mich interessiert das meiste private auch nicht so sehr.
Nach Angaben ist die Gesprächsebene von der jeweiligen Spielsituation abhängig, kurz: wenn man sich mitten im Kampfgetümmel befindet, wird man sich nicht über den gestrigen Abend unterhalten.
Betrachtet werden soll die computervermittelte Mensch-Mensch-Interaktion an den zuvor dargelegten drei Sinnebenen der Interaktion: In dieser Arbeit verstanden als virtuelle Identität, virtuelle Rolle und computervermittelte Kommunikationsprozesse.
5.4.1. Computervermittelte Kommunikationsprozesse zwischen den Spielern
Betrachtet man vorerst, auf welcher Art miteinander kommuniziert wird, so lässt sich anhand der Aussagen bestätigen, dass der vornehmlich genutzte Kommunikationsmodus die Chat-Kommunikation ist:
Jonas: Ich selbst chatte nur, also Text und Emoticons […] „teamspeak“ habe ich noch nie verwendet […] nur das, was man halt mit einem Text ausdrücken kann.
Während das Computer-Telefonieren über „teamspeak“ vornehmlich in kleinen Gruppen, insbesondere in Teamspielen verwendet wird:
Günni: Hier unterhält man sich ja auch über ganz banale Angelegenheiten, je nachdem, wie gut man sich kennt, dann ja auch nur über das Spiel. […] das meiste an Kontakt mit Gildenmitgliedern hat man über „teamspeak“, ja wenn es nicht zu viele sind, dann gibt es Sprechregeln, meist reden dann nur die Gruppenführer. […] Aber bei einer ruhigen Quest kann man sich ja schon schön unterhalten, eben wie mit dem Telefon.
Danny: Ich selbst bin ja nicht in einem Clan, in einer Mannschaft und benutze deswegen auch kein teamspeak, also ein Telefonieren ohne Kosten, nur jeder kann jeden hören […] Ich selbst unterhalte mich meistens über das Chatten. Beim Quake-Net ist das sowieso die einzige Möglichkeit […] Nur wenn ich Quake im Team-Modus spiele, was ich allerdings sehr selten mache, dann benutze ich teamspeak, weil Zeitverzögerungen aufgrund des Tippens sehr schnell zum Ende führen.
Doch wie aus den Interviews zu erhören war, nimmt das Computer-Telefonieren nur eine untergeordnete Rolle ein (mit Ausnahme des Teamspiels). Es wurde auch darauf hingewiesen, dass man bei erstmaligem Spielbeginn sowieso mit der Chat-Kommunikation anfängt, da man um ein Computer-Telefon einzurichten mindestens die Leute kennen muss, mit denen man dies macht. Grundlegend lässt sich sagen, dass das Computer-Telefonieren ein gewisses Vertrauensverhältnis voraussetzt und auch die Anonymität eines Chats nicht mehr gegeben ist (man hört zumindest die Stimme des Gegenübers).
Betrachtet man bei der Chat-Kommunikation, wie geschrieben wird, so fällt bei einigen Probanden eine Ökonomisierungs-Funktion auf:
Günni: Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist mein Schriftbild. Ja weil man im Spiel gezwungen ist, in kurzer Zeit viel zu schreiben und dabei noch viele Informationen zu transportieren, die dann auch noch verstanden werden sollen. […] Beispiel „ka“ bedeutet „keine Ahnung“ oder „cu“ bedeutet „see you“, also auf Wiedersehen. Man nimmt also die Aussprache der einzelnen Buchstaben, um ganze Wörter zu beschreiben. Oder „np“ steht für „no problem“ oder „vll“ für „vielleicht“ […]. Wenn ich die Texte ausschreiben müsste, dann wäre ich ja vielleicht schon im Kampf gestorben und dann habe ich ja wieder Reparaturkosten und einen höheren Zeitaufwand, da man ja erst wieder als Geist zu der Stelle gelangen muss, wo man gestorben ist. […] Das Spiel erfordert die Abkürzungen, oder man stellt sich in eine Ecke, macht nichts und kann dann ja schön schreiben, aber das kann ich ja auch in einem Chat-Programm […]
Werner: [kurzes Lachen], ja doch schon, gewisse Sachen wie „lol“ oder andere Abkürzungen […] aber nicht unbedingt in der allgemeinen Sprache, aber halt mit Freunden, im Kreis der Zocker, kommt das schon mal vor. […] Bei „Need for Speed“ hab ich auch nicht viel Zeit zum Schreiben und „np“ geht halt viel schneller zu schreiben als „kein Problem“. […] ja die muss man richtig lernen, […] von einem Freund bekam ich dann halt eine Liste mit den wichtigsten Abkürzungen, ohne diese Liste hätte ich auch sehr lange gebraucht, um da durchzublicken. Wie bestätigt wird, liegt dies vielfach an den Spielanforderungen selbst, eben das Reagieren in Echtzeit, und von daher wird auch der Vorzug eines Head-Sets ersichtlich. Aber zwei Probanden äußern auch Bedenken, dass die Sprache „verkommen“ könnte, d.h. eine Angleichung der real gesprochenen Sprache an die ökonomisierte „Cyber-Sprache“:
Danny: Ja auf jeden Fall, definitiv. Die ganze Veramerikanisierung, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Englische ist zwar im Chat ganz hilfreich und auch die Kürzel wie „cu“ für „see you“ sind ganz praktisch, aber ich habe schon ein wenig Angst davor, dass auch im realen Leben so gesprochen wird, […] ich denke unsere Sprache verkommt. Ich selbst habe auch Angst davor, dass ich im realen Leben nicht mehr lache, sondern „lol“ sage. […] Im Chat ist das ja OK., aber im realen Leben […].
Jonas: Ja, das ist es ja, was ich bei World of Warcraft nicht mag. Mir geht es zu weit, wenn man Ausdrücke aus dem Spiel auch bei Unterhaltungen mit Freunden in der Kneipe verwendet. Solchen Leuten kann ich auch nicht zuhören, wenn sie mit einem reden wollen.
Bei den analysierten Computerspielen bildet auch nur „Ultima Online“ hierin eine Ausnahme, weil in diesem Spiel der darstellerische Aspekt einen höheren Stellenwert hat, als in den anderen analysierten Onlinespielen:
Jonas: Bei Ultima Online verwendet man eine mittelalterliche Schreibweise, das heißt, man versucht möglichst wenig moderne Wörter zu verwenden. Die Sätze werden auch richtig ausformuliert und eine gekürzte Chatsprache wird nicht gern gesehen, ebenso sind die Namen auch nicht irgendwelche Buchstaben und Zahlenfolgen.
Grundsätzlich wird auch nur mit dem geschriebenen Text kommuniziert, folglich werden auch keine nonverbalen Elemente vermittelt. Jegliche Kommunikation mitsamt ihren emotionalen Aspekten muss textlich dargestellt werden. „Emoticons“ und „Smileys“ sind auf den jeweiligen virtuellen Spielplätzen eher unüblich und auch keiner der Probanden gab an, derartige Hilfsmittel zu nutzen. Danny gab noch an, dass man „Emoticons“ und „Smileys“ allenfalls in machen Chat-Foren findet, aber dass man bei „Quake“ wahrscheinlich auch ausgelacht wird, wenn man sie verwendet. Und bei „Ultima Online“ werden sie, aufgrund der darstellerischen und mittelalterlich anmutenden Sprache, überhaupt nicht gern gesehen.
Die dritte prinzipiell mögliche Kommunikationsform, also über Spielaktionen, nimmt den Probanden nach einen sehr peripheren Stellenwert ein, sie stellen vielmehr ein witziges Beiwerk dar, um die Kommunikation etwas abwechslungsreicher zu gestalten, aber nur über sie Kommunizieren ließe sich nicht, und es konnten auch keine Hinweise darauf gefunden werden, dass kommunikative Spielaktionen vielleicht eine nonverbale Kommunikation ersetzen:
Günni: Man hat bei „World of Warcraft“ ja eine ganze Palette von Möglichkeiten, so kann man verschiedene Grüsse ausführen, mit einem Teampartner habe wir auch eine spezielle Grußzeremonie, aber das ist ja eher ein Jux […] nein [nur über sie kommunizieren] das geht nicht, also eher ja schnell verständliche Sachen, aber ich denke in Kämpfen würden solche Hinweise ja auch nichts nützen, da man die ja erst sehen muss in der ganzen Aktion […].
So bleibt den Probanden im Wesentlichen (abgesehen vom „teamspeak“) die Chat-Kommunikation, aber inwieweit behalten die Kanalreduktionsmodelle recht, dass mit dem Informationsverlust eine unpersönlichere Kommunikation einhergeht? Betrachtet man hier erst einmal die Online-Rollenspiele, so werden die Kontakte wie folgt beschrieben:
Günni: Diese Community lernt man dann ja auch immer besser kennen und einige kenne ich schon ein dreiviertel Jahr. Ich kann mit denen labbern und lachen, wie mit jemandem, mit dem ich mich schon jahrelang im Wohnzimmer getroffen habe […] obwohl ich eigentlich gar nichts über sie [die anderen Mitspieler] weiß. Es geht eigentlich immer alles ums Spiels, es gibt ja sogar Witze über Spielklassen […] es wird über das, was im Spiel ist gelacht, oder man zeigt einem, was man gefunden hat und erzählt sich Geschichten über Aufgaben […]. Das Reelle geschieht dann eher nebenbei, wie wo kommst du eigentlich her oder was machst du. Das kommt dann nach und nach, wenn die Neugierde da ist, etwa wenn ich mit dem gut spielen kann und ich mich noch gut mit ihm verstehe, dann wird es ja vielleicht auch im reellen Leben so sein. […] Oft fragt man ja auch erst nach dem Ort, ob er in erreichbarer Nähe wohnt oder 800km weit weg entfernt. […] So spiele ich mit einem jetzt etwa ein dreiviertel Jahr, der etwa 100km weit weg wohnt. Hier könnte ich mir ja schon mal vorstellen sich im real life zu treffen, um zu schauen, ob er real auch so ist, wie er sich im Spiel gibt. Bisher ist dies aber noch nicht passiert […].
Jonas: Das ist dasselbe wie in der Realität, wenn man einen neuen trifft und ihm sagt, ja gib mal deine Telefonnummer, ich rufe dich an […] manchmal hält es sich länger, manchmal aber auch gar nicht. Und so gab es auch bei Ultima Online kurze Bekanntschaften, aber man hat auch seine langjährigen Spielpartner […] und mit denen habe ich mich auch schon real getroffen.
Danny: Meistens sind die schon eher oberflächlich, obwohl man manchmal nette Leute trifft. […] Ich bin aber jetzt auch schon älter und komm auch auf die meisten Leute nicht mehr so klar, wenn die gerade mal sechzehn sind und sich auch so verhalten, dann ist das nichts für mich. Auch die Vögel, die sich in die Rolle richtig rein versetzen, die Herr der Ringe Heinis sind auch nichts für mich. […] Und Leute, die meine schöne Nekromanten-Elfin primitiv anbaggern […] ich will eigentlich nur spielen und nicht den Mist anhören, den Leute so von sich geben. […] Wäre da nicht noch ein guter Freund von mir, der auch spielt, hätte ich bestimmt schon wieder aufgehört, aber das Spiel ist toll.
Anhand dieser Aussagen lässt sich keinesfalls von einer prinzipiell unpersönlicheren Kommunikation reden, man kann allenfalls sagen, dass die Vertrautheit von den Intentionen der jeweiligen Spieler abhängt und nicht von der Kommunikationsart. Betrachtet man zudem die zuvor gemachte Aussage von Hans-Gerd[235], dass er Onlinespiele ablehnt, da sie zu unpersönlich sind und man bedenkt, dass er sie aber auch noch nie gespielt hat, so lässt sich auch fragen, ob die Unpersönlichkeitsannahme der Chat-Kommunikation nicht auch auf einem Vorurteil beruhen könnte. Bei den anderen Onlinespielen ergibt sich folgendes Problem: Da die Kommunikation während der direkten Spielsituation ausschließlich spielbezogen ist (bis auf sehr wenige Ausnahmen), könnte man von einer unpersönlichen Kommunikation sprechen, die aber nicht auf die Form des Chats zurückzuführen ist, sondern auf die spielbedingten Anforderungen.[236]
Danny: Der Kontakt ist schon recht freundschaftlich […] näher habe ich zwar nur vier Leute kennen gelernt, aber der Kontakt war doch sehr nett und vertraut. […] Aber richtig man lernt die Leute nicht beim Quakespiel selbst besser kennen, hier wird nur gespielt, aber dafür ist das Quake-Net [dies ist ein Sprechforum von Quake-Spielern innerhalb des IRC] da. […] eigentlich habe ich schon mehr mit Leuten im Internet zu tun, als draußen […] ich hänge ja auch fast nur vor dem Computer. […] Die Leute sind real aber, und ich auch, voreingenommener.
Schon zutreffender könnten, wie sich aus dem letzten Zitat ergibt, die Filtermodelle sein, wenn man den Informationsverlust positiv betrachtet, indem vorurteilsbehaftete Kommunikationen eine viel geringere Chance haben, aufzukommen:
Günni: Ein großer Unterschied [beim Kennen lernen] besteht einmal schon darin, dass man sich nicht sieht. Bei den Online-Rollenspielen verkörpert man zudem noch gewisse Charaktere und den sieht man dann ja auch anstatt der eigentlichen Person. […] Es ist schon komisch, wenn man beispielsweise jemanden neues als Zwerg kennen lernt und ihn auch nur so herumlaufen sieht, dann könnte man ja fast schon denken, da sitzt auch ein Zwerg an dem Computer. Aber ebenso werde ich wohl auch wahrgenommen, bin ja jetzt ein Gnom und ja sogar noch kleiner.
Und wie man ersieht, könnte die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung ebenfalls ihre Berechtigung erhalten, da das wichtigste Kriterium der Online-Probanden grundlegend ist, einen möglichst guten Spielpartner zu haben und keinen guten Freund:
Werner: Nö, die interessiert mich eigentlich auch nicht, im Endeffekt, was hab ich davon, wenn ich jetzt halt weiß, wie er aussieht und was er macht, mich interessiert viel mehr […] hat mein Partner auch etwas drauf, macht es Spaß, mit ihm zu spielen, ist er halt freundlich im Umgang […] ein gewisser gegenseitiger Respekt ist mir halt schon wichtig, auf der anderen Seite sitzt ja auch ein Mensch […] gerade wenn man zusammen zockt sollte, es halt auch zusammen passen.
Von daher ist es auch eine Möglichkeit, fehlende persönliche Informationen des Gegenübers mit Spielinformationen zu kompensieren. Dies zeigt sich auch daran, dass es auch ausreicht, wenn man den Spielnamen des Anderen weiß:
Jonas: Das erste was man von einem kennen lernt, ist ja nur der Charakter, das andere Reale lernt man erst nach und nach kennen. […] obwohl es schon ein wenig unter geht, weil man diese Leute ja solange unter anderem Namen und ihrem Charakter kannte […] auch bei den realen Treffen haben wir uns dann mit Charakternamen angesprochen, die echten Namen kannte ich auch nur selten, es wäre ja auch zuviel, wenn ich mir von jedem auch noch den echten Namen merken müsste, es ist ja ein Spiel. […] Ja ich selbst wurde auch mit meinem Charakternamen angesprochen. […] Eigentlich finde ich es auch gut, dass nicht jeder direkt alles über mich weiß, und ich muss auch nicht jeden kennen lernen.
Man sieht hier, dass dies sogar der Fall ist, wenn sich die ansonsten unbekannten Spieler auch real getroffen haben. Solche realen Treffen wurde auch nur im Rahmen von „Ultima Online“ berichtet, bei den anderen Probanden kam es bis jetzt noch nicht soweit.
Eine Charakteristik der Chat-Kommunikation, die die Funktion übernimmt, potentiell mögliche, virtuelle Kontakte zu filtern, sei noch erwähnt:
Günni: […] Menschen, die das ruhige und angenehme Zusammensein in der virtuellen Welt stören und das ja sogar vorsätzlich und absichtlich machen […] muss es ja auch geben. Das ist sozusagen der reale Anteil in der virtuellen Welt. In der realen Welt hat man diese unliebsamen Menschen noch öfter. Das Schöne hier ist aber, dass ich diese Menschen in der virtuellen Welt einfach wegklicken kann. […] Das ist überhaupt das schöne am Onlineleben, das man die Kontakte weitgehend einschränken kann und einfach wegklicken kann. In der Realität muss man ausweichen oder sonst eine Lösung finden.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Chat-Kommunikation nicht unbedingt nachteilig ist, wenn man von einer vorurteilsfreieren Kommunikation ausgeht. Bezüglich der Onlinespiele lässt sich schon sagen, dass der Grad der Vertrautheit, der von Spielpartnern ist und nicht der von persönlichen Freunden:
Werner: Ja hab schon Leute übers Spielen kennen gelernt, man hat gechattet und sich nach einigen Tagen wieder auf dem gleichen Server getroffen und haben uns auch gleich wieder erkannt, […] und zocken auch öfters gegeneinander. […] real haben wir uns noch nicht getroffen, der wohnt halt weit weg […] und dass sind ja auch nicht solche Freunde, wie in einer gemeinsamen Stadt, da gibt es schon gewaltige Unterschiede zwischen Internet-Freunden und echten Freunden. Ich würde sie halt auch nicht unbedingt als Freunde, eher als Bekannte bezeichnen oder Zockerfreunde.
Günni: […] die Mitspieler sollten ja nicht zu anonym sein. Erst ab einer gewissen Nähe kann man ja gut miteinander spielen, da ja sonst einem der Partner zu egal wäre und man sich nicht so für ihn anstrengt. Folglich stirbt man auch mal eher für ihn, als wenn einem der Partner egal wäre, dann würde ich eher abhauen.
Doch Themen wie Vertrautheit bzw. Anonymität gehören schon zu der zweiten Sinnebene einer computervermittelten Interaktion, eben der Konstruktion virtueller Identität.
5.4.2. Virtuelle Identitäten und virtuelle Rollen
Die zweite und dritte Sinnebene wird im Rahmen der Auswertung in ein Kapitel zusammengefasst, da sie sich wechselseitig bedingen und aus Sicht dieser Arbeit Identität und Rollen nur bezüglich der virtuellen Spielplätze betrachtet werden. Dementsprechend einseitig (da der Lebenshintergrund der Spieler nur am Rande betrachtet wird) sind die folgenden Beschreibungen.
Ausgegangen wird von der Frage, inwieweit direkt spielbezogene Rollen auf virtuellen Spielplätzen zu finden sind:
Günni: Das ist ja schon so, dass wenn ich [er selbst übernimmt die Rolle eines Fernkämpfers, der im Nahkampf schwach ist] irgendwo hingehe, dann brauche ich ja Leute, die zu mir passen, also in erster Linie brauche ich immer einen Kämpfer [für den Nahkampf] und einen Heiler [der die Aufgabe hat, den Kämpfer zu heilen], ich selbst kann dann schön von hinten draufballern […] und da ist ja schon so, dass jeder seine festen Aufgaben hat, und ich denk ja schon, dass man sich auch anders verhält […] auf jeden Fall ist man unterschiedlich gefragt, ein Heiler wird ständig gefragt, ob er mit irgendwelchen Gruppen mitkommen will, während man auf einen Jäger [den er selbst spielt] im Grunde verzichten kann, so macht ja ein Zauberer von hinten noch mehr Schaden […] ich finde das aber schön so, da man ja nicht ständig genervt wird, und ich um so freier spielen kann, […] ich kann ja auch ganz viele Sachen alleine schaffen, wofür ja ein Heiler noch einen anderen braucht […]
Grundlegend wird insbesondere bei den Online-Rollenspielen zugestimmt, dass man die Spieler aufgrund ihrer Rolle etwas unterschiedlich bewertet und dementsprechend mit ihnen kommuniziert. Aber auch auf die eigene Persönlichkeit bzw. Spielweise hat die Rolle gewisse Auswirkungen:
Jonas: Ja das könnte man sagen […] wenn man bei „Ultima“ einen friedlichen Charakter spielt, […] ein Schneider, der nicht kämpfen kann […], dann ist es auch nicht so ratsam allein einen Krieger zu reizen und es auf einen Kampf ankommen zulassen, […] ja den wird er auf jeden Fall verlieren. Oder ein Playerkiller [jemand, der eine Rolle ausgewählt hat, in der man sehr gut andere Spieler töten und ausrauben kann] wird ja vielmehr kämpfen müssen, als jetzt ich, als friedliche Elfe […].
Danny: […] ich spiele eine weibliche Elfe. […] ich dachte mir, hey spiel mal ein nettes Mädel, weil ich zu Zeit auch kein nettes Mädel habe […] so baute ich mir eine schöne Freundin […]. Aber bei anderen, gerade bei den tollen Kriegern, groß, stark, gut aussehend, eben voll der Reißer, aber im echten Leben sind diese Leute bestimmt nicht so wie diese Krieger, also eine Wunschvorstellung, das merkt man allein an den Gesprächen.
Bei den anderen gemeinschaftlichen Spielen, wo man jetzt nicht explizit eine Rolle (in Form einer Charakterklasse z.B. Elfen-Bogenschütze) darstellt, lassen sich aber auch gewisse Spielrollen ausmachen:
Spire: Bei Counter-Strike gibt es zwei Rollen, die Polizisten und Terroristen […] ja, die haben keine Auswirkungen auf die Spielweise, das ist auch von der benutzten Waffe abhängig. Jemand mit einem Scharfschützengewehr hat vorne nichts zu suchen […] klar, solche Leute werden auch eher als Feiglinge bezeichnet oder einfach nur Sackgang [nervend] […].
Arnold: Weniger, ich denke nicht [dass man bei „Fifa-Soccer“ von unterschiedlichen Bewertungen aufgrund der gewählten Mannschaft sprechen kann], vielleicht mal ein Spruch […] vielleicht ist es ein klein wenig lustiger, wenn ich jetzt einen besiege, der Schalke spielt und auch Fan ist [er selbst ist Dortmund-Fan und mag kein Schalke], aber ich denke, dass das doch nicht so wichtig ist […].
Prinzipiell lässt sich anhand der Aussagen annehmen, dass es bei gemeinsamen Computerspielen durchaus Spielrollen geben kann, und dass sie auch einen Einfluss auf die Spielweise und virtuelle Identität haben können. Das folgende Zitat könnte auch als indirekter Beleg gelten, da es buchstäblich das alte Sprichwort „Kleider machen Leute“ auf die virtuelle Spielwelt überträgt:
Günni: […] die Ausrüstung ist ja schon wichtig, ich kann zwar einiges mit spielerischem Können wettmachen, aber mit epischen Gegenständen [dies sind einige der besten und effektivsten Waffen bzw. Rüstungen, die man finden kann] hat man ja um einiges bessere Karten […] ich sage aber ja auch immer, dass mit der Ausrüstung nicht auch gleich gesagt ist, dass er auch spielen kann […] die besten Sachen findet man ja auch in Aufgaben, wo man mit einer 40-Mann Gruppe unterwegs sein muss, aber das ist ja für den einzelnen weniger schwer, es sind ja noch genug andere da. Aufgaben, die man nur mit einer kleinen Gruppe macht [ca. fünf Personen] sind viel anspruchsvoller, hier ist ja jede Aufgabe normal nur einmal vergeben […] und da kommt’s ja auf jeden an. […] Ach ja, auf jeden Fall gibt es viele Leute, die immer auf die Ausrüstung schauen und selbst auch nur nach bunten Sachen hinterher sind, ich ja auch ein bisschen […].
Spieler, die bei Online-Rollenspielen eine minderwertigere Ausrüstung haben und auch von ihren Fähigkeitswerten geringer sind, sind allgemein auch weniger gefragt in der jeweiligen Spiel-Community. So gab auch Günni an, dass das eigentliche Rollenspiel mit dem Höchstlevel anfängt[237], die anderen befinden sich sozusagen noch in der Ausbildungszeit und werden daher noch nicht als vollwertig erachtet. Ausnahmen bilden hier erfahrene Spieler, die noch weitere Spielfiguren trainieren, sie werden über ihren Status als erfahrener Spieler (jedenfalls von den ihnen bekannten Personen) bewertet.
Mit solch einem Status liegt im Prinzip der Fall einer Spielrolle vor, die sich nicht nur auf die direkte Spielsituation bezieht. Das Vorhandensein derartiger Rollen wird von den Probanden auch bestätigt:
Danny: Jedenfalls im Quake-Net […] das ist eher „old school“, die alt Eingessenen, die ehrlicheren, intelligenteren Leute [kleines Lächeln]. […] In anderen Spielen wie Guild Wars trifft man irgendwelche Anfänger, die gerade mal eben das Internet bekommen haben und oft auch viel, viel viel jünger sind. […] Und wenn dann meine gut aussehende Elfe von einem in der Realität gerademal vierzehn jährigen Knirps mit seinem großen, plumpen Krieger angemacht wird, dann nervt das schon.
So gibt es die Rolle des „Anfängers“, die aber natürlich kein Proband innehat. Sie zählen sich grundlegend zu den „erfahrenen Spielern“. Ebenso gibt es „Anführer“ und „Mitläufer“. Allgemein hängen derartige Rollen meist mit spielerischen Erfolgen zusammen; exemplarisch ein Proband, wie er die verschiedenen Spieler bewertet:
Günni: […] das kommt immer auf die Gruppe an. Es gibt ja immer auch, ich nenne sie talentfreie Spieler, die dann ganz gewiss nicht die Gruppenführung übernehmen sollten, die brauchen schon eher eine führende Hand. Dann gibt es Leute, die stürmen sehr schnell los und sind genauso schnell auch tot. Das sind dann die konfusen Spieler, die aber auch dann ständig solche Aktionen machen, die muss man auch an die Hand nehmen. […] Es hängt eigentlich von der Spielfähigkeit und von der Spielkenntnis ab, wer das Kommando übernimmt. Es gibt aber auch Leute, die nichts können, aber alles wissen.
Ebenso gibt es auch selbst ausgewählte Rollen, die das ausdrücken, wie ein Spieler sich empfindet:
Günni: Zu Zeit bin ich das Orakel, ich werde alles Mögliche gefragt und habe ja auch auf alles Mögliche eine Antwort. […] da ich ja alles im Kopf habe und auch alles gesehen habe. Ich habe ja auch schon die verschiedensten Klassen [Berufszweige wie Zauberer, Krieger usw.] gespielt und kenne ja eigentlich alle Klassen in- und auswendig.
Es bleibt jedoch anzumerken, dass die zuvor beschriebenen Befunde sehr mit Vorsicht zu genießen sind, da sie keineswegs klären können, inwieweit die Spielrollen nun wirklich die Persönlichkeit bzw. die Konstruktion virtueller Identitäten beeinflussen. Dass Spielrollen mitunter die Spielweise der Personen verändern, ergibt sich prinzipiell logisch aus der Konstruktion des Spiels, d.h. wenn eine gewählte Rolle schwach im Kampf ist, dafür aber andere Fähigkeiten beherrscht, so ist es nur allzu verständlich, dass man eben auf dieses andere Können zurückgreift, bevor man sich in hoffnungslose Kämpfe stürzt.
Die beschriebenen Probleme treffen im verstärkten Maße auf die Ergebnisse bezüglich einer virtuellen Identität zu. Insbesondere Fragen, die auf eine Wunschidentität abzielen, wurden zu direkt gestellt und ergaben daher sehr abwehrende (wahrscheinlich in Richtung einer sozialen Erwünschtheit) bzw. nicht zu verwertende Aussagen.[238]
Betrachtet man vorerst, ob bei den Probanden eine Identifizierung mit der Spielfigur bzw. mit der gespielten Rolle zu ermitteln ist, so wurde dies grundsätzlich verneint. Nur drei Interviewpartner konnten in abgeschwächtem Maße entsprechende Tendenzen bei sich entdecken:
Werner: Dieser Wunsch wird eher durch das Spiel erweckt […] ich kann aber nicht sagen, dass das bei mir nicht so ist, […] wenn ich „Need for Speed“ zocke und abends pennen gehe, dann träume ich schon manchmal davon, dass ich halt der Typ mit der tollen, coolen Karre bin und die Straße entlang fahre, kommt schon vor, klar.
Arnold: Eigentlich nein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich mir das schon einmal gedacht, denn wenn man in dem Spiel ganz drin ist und auch noch erfolgreich, dann vergisst man auch einiges um sich herum, man vergisst auch die Zeit, man ist in dem Spiel sozusagen gefangen, und man nun da sitzt und sich mitunter wirklich für diesen Manager hält und da den Laden irgendwie am Laufen hält. Aber wenn der Rechner dann aus ist, ist dieses Gefühl auch direkt wieder weg, aber während des Spiels kann es schon vorkommen.
Günni: Die Figuren sollen ja schon schön aussehen und sich nicht zu abartig bewegen. Und das ist ja hier [bei World of Warcraft] auch so. Das ist ja so gemacht, damit man sich gut mit den Figuren identifizieren kann. Und ich denke schon, dass man sich ein wenig mit der Figur identifiziert, die man ja sozusagen mehr als ein Jahr gespielt hat, […] zumindest, wenn man das Spiel anhat. […] Es ist für mich ja nur ein Spiel und ich habe ja auch eine gewisse Distanz zu dem Spiel und meine auch nicht, dass es mich hundertprozentig vereinnahmt, wie etwa dass ich mich hundertprozentig mit meinem Charakter identifiziere. In der echten Welt möchte ich ja auch kein Jäger sei, wie hier im Spiel.
Anhand der Aussagen bezüglich des Einflusses der eigenen Persönlichkeit auf die Gestaltung der Spielfigur bzw. der Spielweise lässt sich ersehen, dass wahrscheinlich eine Verbindung zwischen getragener Spielrolle und konstruierter Spielidentität besteht. Aber welcher Aspekt nun welchen mehr beeinflusst, oder ob es eine ausgeglichene Wechselseitigkeit ist, lässt sich hier nicht bestimmen.
Mit größerer Sicherheit kann man dagegen annehmen, dass es auf den virtuellen Spielplätzen (mit einigen Ausnahmen innerhalb der Online-Rollenspiele, z.B. „Ultima-Online“) in erster Linie um den spielerischen Wettkampf geht, und die darstellerische Komponente eher zweitrangig ist. Dementsprechend ist die Kommunikation ausgerichtet und folglich auch die jeweiligen Selbstdarstellungen. Bezüglich der Frage, inwieweit die wahre Identität des Gegenübers interessiert, kann man auch weiterhin die Annahme vertreten, dass man vornehmlich gute Spielpartner sucht und kein intimes Vertrauensverhältnis:
Günni: Jetzt nicht bezogen auf die Lebenseinstellung, weil das Spiel ja schon recht anonym ist, also vielmehr auf das Spiel selbst bezogen. […] Die reelle Identität der Mitspieler interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Wenn ich Computer spiele, interessiert mich nicht was die Familie des Anderen macht. Natürlich gelegentliche Gespräche über Alltäglichkeiten, aber persönliche Probleme bespreche ich da ja nicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man im Rahmen der Online-Rollenspiele und einer entsprechenden Spieldauer (mehrere Monate) durchaus von virtuellen Identitätskonstruktionen (zumindest einer Spielidentität) innerhalb der direkten Spielsituation sprechen kann, da jeder der drei Probanden zwar mehrere Spielrollen übernimmt, aber immer die gleiche Identität dahinter steht. Jeder spricht offen darüber, dass er auch die anderen Figuren steuert und bei keinem lassen sich Aussagen darüber finden, dass sie ihre reale Persönlichkeit unterschiedlich darstellen. Die spielbedingten Darstellungsaspekte bleiben davon natürlich unberührt.
Bei den anderen internetbasierten Computerspielgenres kann man dagegen kaum von Identitätskonstruktionen innerhalb der direkten Spielsituation sprechen, allenfalls von situativen Selbstdarstellungen, da die einzelnen Spielparteien einen kurzfristigeren Charakter haben und dementsprechend wenig Zeit für persönliche Kommunikationen bleibt. Doch dies bedeutet nicht, dass die Spieler in den angehängten Chat-Räumen, keine Identitäten konstruieren und diese dann mit in das Spiel „hinein nehmen“ - davon ist sogar auszugehen.
6. Fazit und Ausblick
Wie man ersieht, ist das Computerspiel, mitsamt seinen Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, ein äußerst vielschichtiges Phänomen. Es verknüpft die virtuelle Welt mit der Spielwelt. Während die äußere Gestaltung des virtuellen Raums und die grundlegenden Mensch-Computer-Interaktionen nur den Rahmenbedingungen der virtuellen Welt unterliegen, baut die simulierte Interaktion zusätzlich auf die Bedingungen der Spielwelt auf, ebenso wie sie die Grundlage für die Umgestaltung des virtuellen Raums in einen virtuellen Spielplatz bildet. Doch die Grenze zwischen einer virtuellen Spielwelt und einer virtuellen Nicht-Spielwelt sind fließend. Personen, die mit Hilfe eines Computerspiels externe reale Zwecke verfolgen, übertreten diese Grenze. Ebenso wie es auch Computerprogramme gibt, die auf den Grundprinzipien eines Computerspiels aufbauen, aber eine direkte Verbindung zur realen Welt aufweisen. Ein Beispiel wäre das Onlineprogramm „Second Life“, bei dem man für reales Geld virtuelles (Spiel-) Geld eintauscht, mit diesem man dann agieren und es potentiell vermehren kann, und es schließlich wieder in reales Geld eintauschen kann. Doch auch ohne die Spielwelt zu verlassen, zeigt sich, dass vielseitige Handlungsmöglichkeiten einen wichtigen Aspekt für Computerspiele darstellen, man könnte hier den Begriff einer „komfortablen Komplexität“ als Ideal angeben.
Vom Computer als Spielpartner werden abwechslungsreiche, spannende (bzw. entspannende) und herausfordernde Aktionen erwartet, die grundlegend die Merkmale eines interessanten Wettkampfes aufweisen. Eng verbunden mit dieser Funktion des Kampfes sind die zentralen Motive des Spielers, das Computerspiel zu beherrschen und zu kontrollieren. Folglich tragen auch die Spieleraktionen einen utilitaristischen und gewinnorientierten Charakter. Diese Prägung, die direkt aus der Beschaffenheit des Computers als einer formal-logischen Maschine resultiert, wird erst aufgehoben, wenn ein virtueller Spielplatz auch potentiell mit anderen genutzt wird. Zum einen gibt es Anzeichen, dass die darstellerische Komponente und dementsprechend auch das Vorhandensein einer virtuellen Spielrolle gesteigert wird, ebenso wie zum anderen die Wettkampforientierung steigt. Allgemein stellt der Mensch einen besseren Spielpartner dar als der, der vom Computer generiert wird. So wird auch das gemeinsame Spiel mit Freunden und Bekannten in der Regel vorgezogen, d.h. wenn die äußeren Umstände nicht dagegen sprechen. Aber bei einem gemeinsamen Spiel mit unbekannten Personen, sind unterschiedliche Sichtweisen zu verzeichnen. Es gibt Hinweise, dass einige eben von der prinzipiellen Pseudonymität des Internets abgeschreckt werden, andere jedoch gerade in dem sofort abrufbaren Potential von menschlichen Spielpartnern den entscheidenden Vorteil sehen. Eine Sonderstellung innerhalb der Computerspiele scheinen „Online-Rollenspiele“ darzustellen, hier nimmt der soziale Kontakt zwischen den Menschen einen zentraleren Stellenwert ein, so dass man auch von einem integrierten Chat-Room sprechen könnte. Voraussetzung bleibt jedoch, dass das jeweilige Spiel beherrscht und auch gespielt wird, da die generelle Motivation eben das Spielen und nicht das Kennen lernen von unbekannten Personen ist. Dies ist sozusagen ein gewünschter Nebeneffekt.
Anzumerken ist, dass die getroffenen Aussagen einen exemplarischen Charakter aufweisen, da sie nur auf einer kleinen Untersuchungsbasis (n=9) beruhen und zudem Computerspieler repräsentieren, die langjährige und intensive Spielerfahrungen gemacht haben. So würde sich für die spielbezogenen Interaktionen mit einem Computer oder mit einem Menschen eine repräsentative, quantitative Erhebung bezüglich der Relevanz der einzelnen Strukturmerkmale eines Computerspiels anbieten. Im Rahmen der Kommunikationsprozesse zwischen den Menschen könnte eine genauere Betrachtung der jeweiligen Lebensumstände verglichen mit den präferierten Computerspielen Hinweise darauf geben, inwieweit virtuelle Identitäten konstruiert und virtuelle Rollen dargestellt werden. Ferner könnte bezüglich der internetbasierten Onlinespiele (bzw. Onlineprogramme wie „Second Life“) die Frage interessieren, inwieweit Anzeichen für ein virtuelles Zweitleben zu finden sind und inwieweit dieses Onlinedasein das reale Leben beeinflusst?
7. Literaturverzeichnis
Bahl, Anke: „Zwischen On- und Offline. Identität und Selbstdarstellung im Internet“, Kommunikation und Pädagogik Verlag, München, 1997.
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas: „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie“, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1980.
Dahm, Markus: „Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion“, Pearson Studium, München, 2006.
Dietz, Peter: „Menschengleiche Maschinen. Wahn und Wirklichkeit der künstlichen Intelligenz“, Bühler & Heckel Verlag für Kunst und Wissenschaft, Berlin, 2003.
Döring, Nicola: „Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen“, Hogrefe-Verlag, Göttingen, 2003.
Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; von Rosenstiel, Lutz; Wolff, Stephan (Hrsg.): „Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen“, Psychologie Verlags Union, München, 1991.
Flick, Uwe: „Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung“, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2005.
Fritz, Jürgen: „Warum Computerspiele faszinieren: empirische Annäherung an Nutzen und Wirkung von Bildschirmspielen“, Juventa Verlag, Weinheim, München, 1995.
Fritz, Jürgen & Fehr, Wolfgang (Hrsg.): „Computerspiele auf dem Prüfstand“, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1998.
Fritz, Jürgen & Fehr, Wolfgang (Hrsg.): „Computerspiele. Virtuelle Spiel- und Lernwelten“, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2003.
Froschauer, Ulrike & Lueger, Manfred: „Das Qualitative Interview – zur Analyse sozialer Systeme“, WUV Universitäts-Verlag, Wien, 1992.
Fuchs-Heinritz, Werner; Lautmann, Rüdiger; Rammstedt, Otthein; Wienold, Hanns (Hrsg.): „Lexikon zur Soziologie“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994.
Funiok, Rüdiger: „Didaktische Leitideen zur Computerbildung – Zielsetzung und Kriterien einer allgemeinen Computernutzungs-Kompetenz als Anregungen für Medienpädagogik, technische Allgemeinbildung und informationstechnische Grundbildung“, München, Wien, 1993.
Giddens, Athony (herausgegeben von: Christian Fleck & H. G. Zilian): „Soziologie“, Verlag Nausner&Nausner, Graz, Wien, 1995.
Gräf, Lorenz & Krajewski, Markus (Hrsg.): „Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web-Werk“, Campus Verlag, Frankfurt am Main, New York, 1997.
Huizinga, Johan: “Homo Ludens – Versuchs einer Bestimmung des Spielelements der Kultur“, Akademischer Verl.-Anst. Pantheon, Basel, 1949.
Kaesler, Dirk (Hrsg.): „Klassiker der Soziologie. Band I – Von Auguste Comte bis Norbert Elias“, C. H. Beck oHG, München, 2000 (a).
Kaesler, Dirk (Hrsg.): „Klassiker der Soziologie. Band II – Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu“, C. H. Beck oHG, München, 2000 (b).
Kaesler, Dirk & Vogt, Ludgera (Hrsg.): „Hauptwerke der Soziologie“, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 2000.
Köhler, Thomas: „Das Selbst im Netz. Die Konstruktion sozialer Identitäten in der computervermittelten Kommunikation“, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen, Wiesbaden, 2003.
Korte, Hermann & Schäfers, Bernhard (Hrsg.): „Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie“, Leske+Budrich, Opladen, 1998.
Koxholt, Rolf: „Die Simulation ein Hilfsmittel der Unternehmensforschung. Begriff – Methodik und Technik der Durchführung – Möglichkeiten der Anwendung“, R. Oldenbourg, München, 1967.
Krämer, Sybille (Hrsg.): „Medien – Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien“, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2000.
Kretz, Hans Friedhelm: „Das Spielen an Unterhaltungsautomaten. Eine Untersuchung der Spielgewohnheiten und Spielmotive von Berufsschülern, Berufsfachschülern, Berufsaufbau – und Fachoberschülern im Landkreis Cochem“, Schulz-Kirchner Verlag, Idstein, 1987.
Lischka, Konrad: „Spielplatz Computer. Kultur, Geschichte und Ästhetik des Computerspiels“, Verlag Heinz Heise, Hannover 2002.
Luhmann, Niklas: „Die Realität der Massenmedien“, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1996.
Mayer, Werner Paul: „Aufwachsen in simulierten Welten. Computerspiele – die zukünftige Herausforderung für Eltern und Erzieher“, Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1992.
Merton, Robert K. & Kendall, Patricia L.: „Das fokussierte Interview“ in: Christel Hopf und Elmar Weingarten (Hrsg.): „Qualitative Sozialforschung“, 1984.
Postman, Neil: „Wir amüsieren uns zu Tode“, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1985.
Ropohl, Günter: „Technologische Aufklärung. Beiträge zur Technikphilosophie“, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1991.
Scheuerl, Hans: „Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen“, Band 1, Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 1990.
Schiefenhövel, Wulf; Vogel, Christian; Vollmer, Gerhard; Opolka, Uwe (Hrsg.): „Zwischen Natur und Kultur. Der Mensch in seinen Beziehungen“, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1994.
Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.): „Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus“, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1987.
Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke: „Methoden der empirischen Sozialforschung“, R. Oldenbourg Verlag, München, Wien, 1999.
Stegbauer, Christian: „Grenzen virtueller Gemeinschaft – Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen“, Westdeutscher Verlag, Opladen, Wiesbaden, 2001.
Thimm, Caja (Hrsg.): „Soziales im Netz. Sprache, Beziehungen und Kommunikationskulturen im Internet“, Westdeutscher Verlag, Opladen, Wiesbaden, 2000.
Treibel, Annette : „Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart“, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004.
Turkle, Sherry: „Leben im Netz. Identitäten in Zeiten des Internets“, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1999.
Vattimo, Gianni & Welsch, Wolfgang (Hrsg.): „Medien-Welten Wirklichkeiten“, Fink Verlag, München, 1998.
Weber, Max: „Soziologische Grundbegriffe“, J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1984.
Weizenbaum, Joseph: „Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977.
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: „Strukturmodell für Computerspiele“, in: Jürgen Fritz: „Schemata und Computerspiel“, S.8ff, in: Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr (Hrsg.): „Computerspiele auf dem Prüfstand“, Bonn, 1998.
Abbildung 2: „Modell zur Faszinationskraft von Computerspielen“, in: Jürgen Fritz: „Warum Computerspiele faszinieren: empirische Annäherung an Nutzen und Wirkung von Bildschirmspielen“, Weinheim, München, 1995, S.37.
Abbildung 3: „Landkarte der Bildschirmspiele“, in: Jürgen Fritz: „Warum Computerspiele faszinieren: empirische Annäherung an Nutzen und Wirkung von Bildschirmspielen“, Weinheim, München, 1995, S.23.
[...]
[1] Unter „Computerspiel“ versteht man ein Spiel, das auf einem „vollwertigen“ Computer gespielt wird; während ein Videospiel über einer Konsole, d.h. einem auf spielerische Zwecke reduzierten Computer, verwendet wird. Im folgendem wird auch nur noch von Computerspielen gesprochen, da Videospiele kein Gegenstand dieser Untersuchung sind.
[2] Abkürzung für computervermittelte Kommunikation
[3] Thomas Köhler: „Das Selbst im Netz. Die Konstruktion sozialer Identitäten in der computervermittelten Kommunikation“, Wiesbaden, 2003, S.82.
[4] Vgl. Jürgen Fritz: „Wie virtuelle Welten wirken – Über die Struktur von Transfers aus der medialen in die reale Welt“, S.3ff, in: Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr (Hrsg.): „Computerspiele. Virtuelle Spiel- und Lernwelten“, Bonn, 2003.
[5] Husserl konzipierte die Phänomenologie als „Wesenswissenschaft“, ihm geht es dabei um die Erkenntnis des Wesens der Dinge. Hierfür führt er den Begriff der Lebenswelt ein und meint damit die „Gegebenheiten der bloßen Wahrnehmungswelt“ (vgl. hierfür Annette Treibel: „Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart“, Wiesbaden, 2004, S.84f), das selbstverständlich Vorausgesetzte. „Während sich jedoch für Husserl die Sinnstruktur der Lebenswelt in den Akten des Bewusstseins aufbaut, vollzieht sich für Schütz der Aufbau sinnhafter, zu verstehender Realität auch in – sozialen – Handlungen“ (Martin Endreß in: Dirk Kaesler (Hrsg.): „Klassiker der Soziologie. Band I – Von Auguste Comte bis Norbert Elias“, München, 2000 (a), S.338).
[6] Treibel 2004, S.83.
[7] Ebd., S.87. Der Gedanke der Intersubjektivität wurde neben Husserl auch schon von George Herbert Mead, im Rahmen seines Symbolischen Interaktionismus, aufgegriffen. Im dritten Kapitel wird hierauf genauer Bezug genommen.
[8] Endreß in: Kaesler 2000 (a), S.339.
[9] Ebd., S.340.
[10] Ebd., S.338.
[11] Ebd., S.342.
[12] Ebd., S.342f.
[13] So weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die folgenden Areale nur einen Teilbereich unserer Lebenswelt darstellen; viele wichtige Welten, wie z.B. die Welt der Religion oder der Wissenschaft werden hier nicht angeführt. Vergleiche für die folgend beschriebenen Subwelten Jürgen Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit. Über Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung realer und medialer Ereignisse“, S.6ff, in: Fritz & Fehr 2003.
[14] Dieser Begriff wird in Peter L. Bergers und Thomas Luckmanns Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie“ (Frankfurt am Main, 1980) eingeführt.
[15] Berger & Luckmann 1980, S.25.
[16] Ebd., S.28.
[17] Ebd., S.24f.
[18] Ebd., S.24.
[19] Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.4, in: Fritz & Fehr 2003.
[20] Ebd., S.6.
[21] Vgl. ebd., S.6f.
[22] Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.15, in: Fritz & Fehr 2003.
[23] Ebd., S.10.
[24] Gerd. E. Schäfer zitiert in: Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.15, in: Fritz & Fehr 2003. Doch die Spielwelt stellt nicht nur eine Verbindung zwischen realer und mentaler Welt her, sondern bezieht auch die mediale Welt immer stärker ein, d.h. immer mehr Spiele beziehen sich auf Hervorbringungen wie Romane, Comics und Fernsehen. Siehe zur medialen Welt den Exkurs im „Anhang 1“.
[25] Volker Sommer: „Spiel und Humor“ in: Wulf Schiefenhövel, Christian Vogel, Gerhard Vollmer, Uwe Opolka (Hrsg.): „Zwischen Natur und Kultur. Der Mensch in seinen Beziehungen“, Stuttgart, 1994, S.139.
[26] Schmidtchen und Erb zitiert in: Hans Friedhelm Kretz: „Das Spielen an Unterhaltungsautomaten. Eine Untersuchung der Spielgewohnheiten und Spielmotive von Berufsschülern, Berufsfachschülern, Berufsaufbau – und Fachoberschülern im Landkreis Cochem“, Idstein, 1987, S.7.
[27] Johan Huizinga: “Homo Ludens – Versuchs einer Bestimmung des Spielelements der Kultur“, Köln, 1949, S.45f.
[28] Hans Scheuerl zitiert in: Werner Paul Mayer: „Aufwachsen in simulierten Welten. Computerspiele – die zukünftige Herausforderung für Eltern und Erzieher“, Frankfurt am Main, 1992, S.98.
[29] Vgl. zu den jeweiligen Momenten Hans Scheuerl: „Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen“, Band 1, Weinheim, Basel, 1990, S.65ff. Ergänzt werden die Momente durch die meines Erachtens passenden Zitate von Huizinga 1949.
[30] Scheuerl 1990, S.69.
[31] Huizinga 1949, S.12.
[32] Ebd., S.17f.
[33] Ebd., S.13.
[34] Hans Scheuerl 1990, S.77.
[35] Ebd., S.90.
[36] Vgl. Huizinga 1949, S.18f.
[37] Ebd., S.15.
[38] Ebd., S.16.
[39] Ebd., S.16f.
[40] Vgl. hierzu ebd., S.17ff und Scheuerl 1990, S.85ff.
[41] Scheuerl 1990, S.98.
[42] Ebd., S.104.
[43] Huizinga 1949, S.22.
[44] Mayer 1992, S.94ff.
[45] Huizinga 1949, S.16.
[46] Ebd., S.20.
[47] Gregory Bateson zitiert in: Sybille Krämer: „Zentralperspektive, Kalkül, Virtuelle Realität: Sieben Thesen über die Weltbildimplikationen symbolischer Formen“, in: Gianni Vattimo und Wolfgang Welsch (Hrsg.): „Medien-Welten Wirklichkeiten“, München, 1998, S.35.
[48] Achim Bühl: „Die virtuelle Gesellschaft – Ökonomie, Politik und Kultur im Zeichen des Cyberspace“, in: Lorenz Gräf und Markus Krajewski (Hrsg.): „Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web-Werk“, Frankfurt am Main, New York, 1997, S.41.
[49] Der Begriff „Turingmaschine“ geht zurück auf Alan Turing, der 1936 das mathematische Grundprinzip für eine universal programmierbare Rechenmaschine entwickelte. Neben dieser beliebigen Programmierbarkeit waren sie auch in der Lage, ihre Programmroutinen während des Rechenvorgangs zu modifizieren. Mit der Turingmaschine lässt sich alles berechnen, was sich berechnen lässt („Theorie der Berechenbarkeit“; vgl. hierzu Peter Dietz: „Menschengleiche Maschinen. Wahn und Wirklichkeit der künstlichen Intelligenz“, Berlin, 2003, S.46f). Es wurde zwar niemals eine Turingmaschine exakt nachgebaut, aber das Grundprinzip findet sich in allen modernen Computern, z.B. Programmschleifen oder der rekursive Aufruf von Funktionen.
[50] Exakte Prognosen beispielsweise für das morgige Wetter sind auch für dieses Modell unmöglich, da für die Zukunft eine exakte Berechnungsgrundlage fehlt (vgl. zur Turingmaschine Friedrich Kittler: „Hardware, das unbekannte Wesen“, in: Sybille Krämer (Hrsg.): „Medien – Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien“, Frankfurt am Main, 2000, S.119ff).
[51] Werner Fuchs-Heinritz, Rüdiger Lautmann, Otthein Rammstedt, Hanns Wienold (Hrsg.): „Lexikon zur Soziologie“, Opladen, 1994, S.602.
[52] C. J. Thomas und W. L. Deemer zitiert in: Rolf Koxholt: „Die Simulation ein Hilfsmittel der Unternehmensforschung. Begriff – Methodik und Technik der Durchführung – Möglichkeiten der Anwendung“, München, 1967, S.11.
[53] Die Aufzählung der einzelnen Hardware-Komponenten bezieht sich nur auf die zu Zeit gebrauchten Heimcomputer für private bzw. spielerische Zwecke. Denn im Prinzip könnte eine Hardware auch jedes andere erdenkliche, technische Gerät beinhalten, wie beispielsweise Computerpistolen, Tanzmatten, Scheinwerfer usw. Die vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte werden auch als „Interface“ bezeichnet.
[54] Ebd., S.128.
[55] Sybille Krämer: „Was haben die Medien, der Computer und die Realität miteinander zu tun?“, in: Sybille Krämer 2000, S.19. Allgemein ist die Hardware unersetzbar für Rechenleistung, Speicherkapazitäten, Ein- und Ausgabe, aber einzeln betrachtet, ist jedes Hardware-Teil ersetzbar, sowohl auf technischer Ebene (also das ein beschädigtes Teil durch ein Äquivalentes ausgetauscht wird) wie auch auf logischer Ebene. Hiermit ist gemeint, dass man mit einer Hardware A eine beliebige andere Hardware B simulieren könnte. „Die Unterschiede zwischen ihnen lassen sich vollständig durch Software kompensieren, sofern wir die dadurch veränderten Rechenzeiten und mögliche Einschränkungen des Speicherplatzes vernachlässigen“ (Roger Penrose zitiert in: Bühl in: Gräf & Krajewski 1997, S.42). Vergleiche zum Verhältnis Hardware und Software auch Markus Dahm: „Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion“, München, 2006, S.161ff.
[56] Krämer in: Vattimo & Welsch 1998, S.34.
[57] Peter Berger zitiert in: Bühl in: Gräf & Krajewski 1997, S.40.
[58] Bühl in: Gräf & Krajewski 1997, S.40.
[59] Günter Ropohl: „Technologische Aufklärung. Beiträge zur Technikphilosophie“, Frankfurt am Main, 1991, S.157f.
[60] Ludwig Wittgenstein zitiert in: Ropohl 1991, S.159.
[61] Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.19, in: Fritz & Fehr 2003.
[62] Achim Bühl in: L. Gräf und M. Krajewski 1997, S.42.
[63] Vgl. Rüdiger Funiok: „Didaktische Leitideen zur Computerbildung – Zielsetzung und Kriterien einer allgemeinen Computernutzungs-Kompetenz als Anregungen für Medienpädagogik, technische Allgemeinbildung und informationstechnische Grundbildung“, München, Wien, 1993, S.200ff.
[64] Ropohl 1991, S.147.
[65] Bühl in: Gräf & Krajewski 1997, S.43. Für eine Beschreibung des „World Wide Web“ (Internet) siehe „Anhang 1“.
[66] Vgl. Krämer in: Vattimo & Welsch 1998, S.32.
[67] Bühl in: Gräf & Krajewski 1997, S.43.
[68] David Lyon: „Soziale Beziehungen im Cyberspace – Kontroversen über computervermittelte Beziehungen“ in: Vattimo & Welsch 1998, S.93.
[69] Georg Simmel zitiert in: Christian Stegbauer: „Begrenzungen und Strukturen internetbasierter Kommunikationsgruppen“ in: Caja Thimm (Hrsg.): „Soziales im Netz. Sprache, Beziehungen und Kommunikationskulturen im Internet“, Opladen, Wiesbaden, 2000, S.20.
[70] Stegbauer in: Thimm 2000, S.20.
[71] Vgl. beispielsweise Raulet, Simon, Berghaus, Bühl, Hoffmann, Perry zitiert in: Christian Stegbauer: „Grenzen virtueller Gemeinschaft – Strukturen internetbasierter Kommunikationsforen“, Wiesbaden, 2001, S.41ff.
[72] Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.19, in: Fritz & Fehr 2003.
[73] Siegfried J. Schmidt in: Sybille Krämer 2000, S.68. Elena Esposito fragt noch radikaler: „Sind diese virtuellen Möglichkeiten wahr oder falsch? […] Hat es überhaupt Sinn, die Frage zu stellen? Gegenüber der realen Welt kann man testen, was wahr und was nicht wahr ist, was Realität und was Fiktion ist“ (Elena Esposito: „Fiktion und Virtualität“ in: Krämer 2000, S.269). Aber wie soll man dies in der virtuellen Welt testen? Schon der Begriff „Virtual Reality“ („virtuelle Realität“) weist auf ein gewisses Paradoxon hin. Der Begriff „Virtuell“ entstammt dem Bereich der Optik und meint „lichtwellentäuschende Bilder“ (Krämer in: Vattimo & Welsch 1998, S.32). Ein Beispiel für solche virtuelle Objekte sind Spiegelbilder: „Virtuell sind diese Bilder, weil sie vortäuschen, die gespiegelten Objekte befänden sich hinter der Spiegelfläche. Aufgrund dieser illusorischen Platzierung können wir im Spiegel Objekte zugleich von vorne und von hinten betrachten, können uns selbst mit den Augen anderer sehen. Dieser einzigartige Perspektivenzuwachs ermöglicht es den Betrachtern von Spiegelbildern, Wahrnehmungen zu machen, die von dem Ort aus, an dem sich ihre physischen Körper befinden, gerade nicht zu erlangen wären“ (ebd., S.32). „Der Spiegel ‚repräsentiert’ nicht eine alternative Realität für den Beobachter […], sondern ‚präsentiert’ ihm die reale Realität aus einem anderen Blickwinkel und erweitert dadurch sein Beobachtungsfeld. Ebenso ‚repräsentiert’ die virtuelle Wirklichkeit keine fiktionale Realität, sondern sie ‚präsentiert’ dem Beobachter die Realität der Fiktion – also eine alternative Möglichkeitskonstruktion […]“ (Esposito in: Krämer 2000, S.287). „Virtuelle Realitäten sind eine Technik, interaktive Spiegelungen symbolischer Welten möglich zu machen. […] Mit virtuellen Realitäten können mögliche Welten sinnlich exploriert werden. […] Sie imitieren und simulieren nicht ‚Realität’, sondern die Art, wie wir Realität als phänomenales Ereignis erfahren. Dies geschieht, indem phänomenale Attribute in symbolische Funktionen transformiert werden“ (Krämer in: Vattimo & Welsch 1998, S.33).
[74] Florian Rötzer: „Vom zweiten und dritten Körper oder: Wie es wäre, eine Fledermaus zu sein oder einen Fernling zu bewohnen? Ein Essay“ in: Krämer 2000, S.152ff.
[75] Ebd., S.152.
[76] Ebd., S.165f.
[77] Ein Head-Set ist ein Kopfhörer mit einem integrierten Mikrophon, diese Apparatur setzt man sich auf den Kopf und kann so freihändig mit anderen kommunizieren, genauer gesagt telefonieren.
[78] Florian Rötzer bezieht sich zwar auch noch auf Roboter, aber da diese kein Untersuchungsgegenstand der hiesigen Arbeit sind, werden sie aus Umfangsgründen nicht weiter bearbeitet.
[79] „Avatar“ ist ein Begriff des Hinduismus für eine illusorische Erscheinung (vgl. Köhler 2003, S.41).
[80] „Bot“ ist eine Kurzform von Roboter und bezieht sich auf einen künstlichen Akteur, den es nur in der virtuellen Welt gibt; während es Roboter auch in der realen Welt geben kann.
[81] Der Forschungsbereich der „Künstlichen Intelligenz“ versucht die computergesteuerten virtuellen Akteure, die „Bots“, auf der einen Seite immer effizienter und schneller werden zu lassen, auf der anderen Seite versucht sie sie immer mehr der menschlichen Intelligenz anzunähern. Die künstliche Intelligenz wird im Rahmen der Mensch-Computer-Interaktion (Kapitel 3.1.), noch eingehender erläutert.
[82] Auch das Internet ist nur ein Teil der virtuellen Welt, ein virtueller Raum, eben ein sehr großer, weltumspannender Raum.
[83] Die Begriffe „virtuelle Welt“, „Virtual Reality“ und „Cyberspace“ können und werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
[84] Huizinga 1949, S.16f.
[85] Joseph Weizenbaum: „Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft“, Frankfurt am Main, 1977, S.160.
[86] Ebd., S.157 und vgl. auch Florian Rötzer: „Aspekte der Spielkultur in der Informationsgesellschaft“ in: Vattimo & Welsch 1998, S.149ff.
[87] Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.22, in: Fritz & Fehr 2003.
[88] Vgl. ebd., S.22.
[89] Vgl. Rötzer in: Vattimo & Welsch 1998, S.153f.
[90] Paul Virilio zitiert in: Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.22, in: Fritz & Fehr 2003.
[91] Vgl. Benjamin Wolley zitiert in: Fritz: „So wirklich wie die Wirklichkeit“, S.22, in: Fritz & Fehr 2003.
[92] Vgl. Jürgen Fritz: „Computerspiele als Fortsetzung des Alltags – Wie sich Spielwelten und Lebenswelten verschränken“, S.2ff, in: Fritz & Fehr 2003. Siehe auch Fritz: „Schemata und Computerspiel“, S.8ff, in: Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr (Hrsg.): „Computerspiele auf dem Prüfstand“, Bonn, 1998.
[93] Die meisten Computerspiele präsentierten sich noch vor einigen Jahren mit einem beigelegten Handbuch, in dem die Spielregeln und die Vorgeschichte zu entnehmen waren. Manchmal waren auch Spiellandkarten oder Romane zum Spiel zu finden. Doch in den letzten Jahren gibt es auch immer häufiger Spiele, die auf eine real beigelegte Anleitung verzichten bzw. diese sehr klein halten und dafür eine virtuelle Anleitung der Spielesoftware hinzufügen.
[94] Jürgen Fritz: „Computerspiele als Fortsetzung“, S.3, in: Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr (Hrsg.) 2003.
[95] Auf diese Grundmuster wird im Kapitel 3.1.2 noch explizit eingegangen.
[96] Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt, Wienold 1994, S.307.
[97] Karl Dieter Opp zitiert in: Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt, Wienold 1994, S.308.
[98] Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt, Wienold 1994, S.308.
[99] Ebd., S.308.
[100] Vgl. Jürgen Fritz: „Warum Computerspiele faszinieren: empirische Annäherung an Nutzen und Wirkung von Bildschirmspielen“, Weinheim, München, 1995, S.27ff.
[101] Die hier verwendete Denkfigur der „strukturellen Koppelung“ geht zurück auf die Überlegungen von Humberto Maturana. Dieser unterscheidet bei der Interaktion des Organismus mit seiner Umwelt zwei Ebenen: Die erste Ebene betrifft das „angemessene“ Verhalten des Organismus in seiner ökologischen Nische (wenn man diesen Gedanken etwas weiter fasst, dann kann man hierunter auch ein adäquates, zum „Überleben“ taugliches Verhalten in der virtuellen Welt verstehen) und die zweite Ebene bezieht sich auf die Ausrichtung des Organismus während einer Interaktion mit einem anderen Organismus, d.h. wenn sie miteinander kommunizieren. Ein außen stehender Beobachter kann nun die Veränderungen der jeweiligen Organismen und ihre Ausrichtung aufeinander beobachten. Und genau dies versteht man unter einer „strukturellen Koppelung“: „[…] die von einem außen stehenden Beobachter registrierte Veränderung der (neuronalen) Zustände zweier Organismen, die interagieren“ (Dietz 2003, S.200). Vergleiche zu diesen Überlegungen Humberto Maturana: „Kognition“ in: Siegfried J. Schmidt (Hrsg.): „Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus“, Frankfurt, 1987.
[102] Fritz: „Computerspiele als Fortsetzung“, S.6f, in: Fritz & Fehr 2003.
[103] Vgl. Fritz 1995, S.31ff.
[104] Der Bereich „Hersteller, Produktentwicklung, Marktmechanismen und Marketing“ soll in dem Interview aber kein Gegenstand der Befragung sein und kann auch aus Gründen des Umfangs nicht adäquat bearbeitet werden - er wurde vielmehr der Vollständigkeit wegen aufgeführt.
[105] Fritz: „Wie virtuelle Welten wirken“, S.19, in: Fritz & Fehr 2003.
[106] Fritz 1995, S.33.
[107] Ebd., S.33.
[108] Ebd., S.34.
[109] Ebd., S.35.
[110] Ebd., S.35.
[111] Vgl. zur „parallelen“ und „kompensatorischen Koppelung“ Fritz „Wie virtuelle Welten wirken“, S.19ff, in: Fritz & Fehr 2003.
[112] Vgl. Fritz 1995, S.31f.
[113] Ergänzend könnte man hier die Untersuchungen von Sherry Turkle anführen: Im Rahmen einer reinen computergesteuerten, textbasierten Kommunikationsplattform, auf denen sich Menschen treffen um miteinander zu flirten, wurde ein „Flirt-Bot“ eingesetzt, d.h. ein Computerprogramm, das eine junge, flirtende Frau simulieren sollte. Das Ergebnis war, dass nach anfänglichen Erfolgen, irgendwann die Programmroutinen durchschaut wurden und der „Flirt-Bot“ als nicht echt auffiel (vgl. Sherry Turkle: „Leben im Netz. Identitäten in Zeiten des Internets“, Reinbek bei Hamburg, 1999, S.154ff).
[114] Alan Turing gilt auch als einer der Väter der künstlichen Intelligenz. Er entwarf den so genannten „Turing-Test“: hier geht es darum, dass ein Interviewer Fragen stellt, von denen er aber nicht weiß, ob sie ein Computer oder ein Mensch beantwortet. Gelingt es dem Computer hinreichend oft den Interviewten zu täuschen, so hat er den Test bestanden und sein Verhalten kann als „intelligent“ bezeichnet werden. Vergleiche zum „Turing-Test“ Peter Dietz 2003, S.46ff.
[115] Beispiele für solche Spiele wären „World of Warcraft“, „Everquest“, „Guild Wars“ und „Ultima-Online“.
[116] Fritz 1995, S.35.
[117] Ebd., S.36.
[118] Fritz „Wie virtuelle Welten wirken“, S.11, in: Fritz & Fehr 2003.
[119] Max Weber: „Soziologische Grundbegriffe“, Tübingen, 1984, S.89.
[120] Christel Schachtner zitiert in: Fritz „Wie virtuelle Welten wirken“, S.12, in: Fritz & Fehr 2003.
[121] Weber 1984, S.89.
[122] Vgl. K. Haefner zitiert in: Mayer 1992, S.98.
[123] Ebd., S.17.
[124] Vgl. Karla Misek-Schneider und Jürgen Fritz zitiert in: Fritz & Fehr 1998.
[125] Vgl. Jürgen Fritz und Wolfgang Fehr: „Netzwerk – Spiele“ in: Fritz & Fehr 1998.
[126] So kann schon Langeweile bzw. Frust aufkommen, wenn man weiß, dass nachdem man seinen Spielzug ausgeführt hat, noch vier andere Spieler am Zug sind und man daher getrost eine halbe Stunde warten kann, bis man selbst wieder an der Reihe ist.
[127] Hier spielt man entweder nacheinander, in Form von rundenbasierten Spielen oder Spielen, bei denen je ein Spieler einen kurzen Solodurchlauf absolvieren muss und man nachher die Ergebnisse (Punkte) vergleicht. Oder man spielt gleichzeitig (Echtzeitspiele) auf einem Spielfeld, wobei jeder Spieler seine eigene(n) Spielfigur(en) erhält. Doch mit dieser Methode können nur eine begrenzte Auswahl von Spieltypen gemeinsam genutzt werden, da die Handlungsmöglichkeiten und Aktionen aller Spieler auf einer Bildschirmgröße untergebracht werden müssen. Alle Spiele, die ein von anderen Spielern unabhängigeres Agieren und Erkunden beinhalten sowie auf einem weitläufigeren Spielfeld stattfinden, benötigen prinzipiell einen Bildschirm für jeden Spieler, mit dem sie nur ihre eigenen Spielaktionen wahrnehmen können. Beispiele hierfür wären Spiele, die einem eine dreidimensional wirkende Welt präsentieren, in der man mit Hilfe der Maus frei umherschauen kann, so wie man real seinen Kopf dreht und mit den Augen umherblickt, während die Tastatur zur Fortbewegung und für Aktionen benutzt wird, beispielsweise Tasten zum Vorwärtsgehen, zum Springen, um virtuelle Türen zu öffnen oder um Objekte aufzuheben. Für solche Spiele muss jeder Spieler auch noch seine eigene Maus und Tastatur haben und oft auch seinen eigenen Computer.
[128] „LAN“ steht dabei für „Local Area Network“. Vergleiche für eine Beschreibung der LAN-Parties: Daniel Tepe: „Phänomen Netzwerkspiel – Einblicke in eine jugendkulturelle Erlebniswelt“ in: Fritz & Fehr 2003.
[129] Vgl. George Herbert Mead zitiert in: Hans Joas: „George Herbert Mead (1863-1931)“ in: Kaesler 2000 (a), S.174ff.
[130] Peter L. Berger und Thomas Luckmann 1998, S.39.
[131] Vgl. Paul Watzlawick zitiert in: Ralf Bohnsack: „Interaktion und Kommunikation“ in: Hermann Korte und Bernhard Schäfers (Hrsg.): „Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie“, Leske+Budrich, Opladen, 1998, S.42. Anzumerken ist, dass sich diese Bedingung auf face-to-face Kommunikationen bezieht und bei medien- bzw. computervermittelter Kommunikation keine Gültigkeit beansprucht.
[132] Bohnsack in: Korte & Schäfers 1998, S.36.
[133] Einige Autoren verwenden die Begriffe „medienvermittelte“ oder „technisch vermittelte Kommunikation“ (vgl. beispielsweise Neil Postman: „Wir amüsieren uns zu Tode“, Frankfurt, 1985; Mike Sandbothe: „Transversale Medienwelten: Philosophische Überlegungen zum Internet“ in: Vattimo & Welsch 1998; Krämer in: Vattimo & Welsch 1998; Stegbauer in: Thimm 2000). Sie beziehen sich auf einen grundlegenderen Zusammenhang, da jeder Computer ein technisches Gerät ist und man jeden Computer, wenn man ihn für zwischenmenschliche Kommunikation nutzt, auch als Medium nutzt. Neil Postman drückte den Unterschied zwischen „Technik“ und „Medium“ treffend aus: „Die Technik verhält sich zum Medium wie das Gehirn zum Verstand oder zum Denken. So wie das Gehirn ist die Technik ein gegenständlicher Apparat. So wie der Verstand ist das Medium die Art und Weise, in der man einen solchen materiellen Apparat gebraucht. […] Mit anderen Worten, die Technik ist bloß eine Maschine; das Medium ist die soziale und intellektuelle Umwelt, die von einer Maschine hervorgebracht wird“ (Neil Postman 1985, S.106f). Da der Untersuchungsfokus dieser Arbeit auf Computerspiele liegt, wird im folgenden der spezifischere Begriff der „computervermittelten Kommunikation“ verwendet, die im Prinzip den Bedingungen der „technisch“ und „medienvermittelten“ Kommunikation unterliegt.
[134] Berger und Luckmann 1998, S.31.
[135] Athony Giddens (Hrsg. Christian Fleck & H. G. Zilian): „Soziologie“, Graz, Wien, 1995, S.111.
[136] Ebd., S.111.
[137] Ebd., S.111.
[138] Alfred Schütz zitiert in: Robert Hettlage: „Erving Goffman (1922-1982)“ in: Dirk Kaesler (Hrsg.): „Klassiker der Soziologie. Band II – Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu“ 2000 (b), S.192.
[139] Erving Goffman zitiert in: Hettlage in: Kaesler 2000 (b), S.193.
[140] Ebd., S.194.
[141] Giddens 1995, S.112.
[142] Ebd., S.113.
[143] Köhler 2003, S.18.
[144] Die Chat-Kommunikation bei Computerspielen hat als Grundlage das Prinzip des „Internet Relay Chat (IRC)“.
[145] Vorausgesetzt wird bei den folgenden Ausführungen, dass bei einem Computerspiel nur zwei Personen auf diese Weise miteinander kommunizieren. Wenn drei oder mehr Personen beteiligt sind, würden die Charakteristika der Telefonkommunikation von der Gruppengröße verändert, z.B. ist der Grad der Intimität bei zwei Personen ein anderer, als bei drei oder mehr Personen. Das Telefon steht in der Tradition des Telegraphen und dieser war das erste Gerät, das es ermöglichte „[…] aus dem Zusammenhang gerissene Informationen in unvorstellbarer Geschwindigkeit über riesige Entfernungen zu transportieren“ (Neil Postman 1985, S.17). Folglich ist natürlich auch die Überwindung von Zeit und Raum ein zentrales Charakteristikum des Telefons.
[146] Axel Zerdick zitiert in: Anke Bahl: „Zwischen On- und Offline. Identität und Selbstdarstellung im Internet“, München, 1997, S.40.
[147] Edeltraut Bülow zitiert in: Bahl 1997, S.40.
[148] Bahl 1997, S.41f.
[149] Ebd., S.38.
[150] Ebd., S.70.
[151] Für gewöhnlich stellt ein Computerspiel auch diverse Möglichkeiten zur Verfügung, die Chat-Kommunikation übersichtlicher zu halten: Einerseits will man nicht immer seine Botschaft an alle anderen Beteiligten richten, so wäre es beispielsweise nicht sehr vorteilhaft, wenn man die strategische Vorgehensweise des eigenen Teams mit allen, auch mit dem gegnerischen Team bespricht. Daher gibt es diverse Kanäle („Channels“), die nur von einem speziellen Adressatenkreis wahrgenommen werden, z.B. ein Kanal für alle befreundeten Teammitglieder oder eine „Flüster-Funktion“, mit dem man einer speziellen Person etwas mitteilen kann. Andererseits will man nicht alle Botschaften der Spieler wahrnehmen - insbesondere bei sehr umfangreichen und mit vielen Personen bestückten virtuellen Spielplätzen kann dies zu Kommunikationsproblemen führen, da man nicht immer die Zeit hat, sich bei einer Vielzahl von einströmenden Nachrichten die passende herauszusuchen. Auch für solche Fälle gibt es Möglichkeiten, die zugesendeten Nachrichten zu filtern und damit auf eine übersichtliche Anzahl zu reduzieren.
[152] Vgl. P. Koch und W. Oesterreicher zitiert in: Nicola Döring: „Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen“, Göttingen, 2003, S.43.
[153] Bahl 1997, S.71.
[154] Vgl. Fritz: „Ich chatte also bin ich. Virtuelle Spielgemeinschaften zwischen Identitätsarbeit und Internetsucht“, S.2ff, in: Fritz & Fehr 2003.
[155] „Emoticon“ ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern „emotion“ und „icon“ und bedeutet, dass man mit Hilfe der ASCII-Zeichen ein um 90° Grad nach links gedrehtes Gesicht darstellt, z.B. :-) oder :-(. „Smileys“ sind speziell für den Ausdruck von Emotionen bereitgestellte bzw. programmierte Mondgesichter, z.B. J oder L (vgl. Gurly Schmidt: „Chat-Kommunikation im Internet – eine kommunikative Gattung?“ in: Thimm 2000, S.124ff).
[156] Döring 2003, S.183f.
[157] Mike Sandbothe spricht in Bezug auf das Internet auch noch von drei weiteren Tendenzen („Versprachlichung der Schrift, Verbildlichung der Schrift und Verschriftlichung des Bildes“), die aber bis auf die „Verbildlichung der Schrift“ für die hier analysierten Computerspiele keine Relevanz haben und daher auch nicht näher erläutert werden (vgl. Sandbothe in: Vattimo & Welsch 1998, S.70ff). Die „Verbildlichung der Schrift“ scheint für die Chat-Kommunikation während eines Computerspiels unerheblich zu sein, aber wenn man diese Tendenz in Richtung Neil Postmans These versteht, dass „[…] wir heute im Begriff sind, eine wortbestimmte Kultur in eine bildbestimmte Kultur zu verwandeln […]“ (Postman 1994, S.18), dann trifft diese These auf die zeitliche Entwicklung vieler Computerspiele zu: Computerspiele, die sich in ihren ersten Versionen noch durch zahlreiche textbasierte Spielaspekte auszeichneten, präsentieren sich heute vielfach in einer rein grafikanimierten Version.
[158] Sandbothe in: Vattimo & Welsch 1998, S.70.
[159] Dies ist eine allgemeine Bezeichnung für Theorien die im Grunde davon ausgehen, dass bei computervermittelter Kommunikation die meisten Sinnesmodalitäten im interpersonalen Zusammenhang ausgeschlossen sind. „Die im Vergleich zur Face-to-Face-Situation drastische Kanalreduktion auf der physikalischen Reizebene gehe auf psycho-sozialer Ebene mit einer Verarmung der Kommunikation, mit einer Reduktion gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten und verfügbarer Zeichensysteme einher […]: Ent-Sinnlichung, Ent-Emotionalisierung, Ent-Kontextualisierung und sogar Ent-Menschlichung sind Stichworte, die den defizitären Charakter textbasierter bzw. kanalreduzierter Telekommunikation kennzeichnen sollen. […] Demgemäß drohen computergestützte Telekommunikationsmedien durch die in sie eingebaute technische Rationalität das typisch Menschliche – nämlich Emotionalität, Ambiguität, Unkalkulierbarkeit, Stimmung etc. – aus der Kommunikation zu entfernen und zwar zugunsten von Ökonomie, Kommerz, Effizienz, Geschwindigkeit, Kontrollierbarkeit, Manipulierbarkeit, Überschaubarkeit und Logik“ (Döring 2003, S.149f).
[160] Die Social Presence Theory geht zurück auf die Arbeiten von J. Short, E. Williams und B. Christie („The Social Psychology of Telecommunication“, London) aus dem Jahre 1976.
[161] Köhler 2003, S.26.
[162] Döring 2003, S.150.
[163] Vertreter der Filter-Modelle sind insbesondere M. J. Culnan, M. L. Markus, S. Kiesler, J. Siegel, T. W. McGuire und V. Dubrovsky.
[164] Döring 2003, S.154f.
[165] Die „social information processing perspective“ geht zurück auf die Arbeiten J. B. Walther („Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective“, Communication Research) aus dem Jahre 1992.
[166] Ebd., S.163.
[167] Döring 2003, S.325.
[168] Berger & Luckmann 1998, S.185.
[169] Hettlage in: Kaesler 2000 (b), S.196.
[170] Nicola Döring 2003, S.326.
[171] Ebd., S.330f.
[172] Goffmans Rahmen und Modulationen weisen gewisse Ähnlichkeiten mit den hier verwendeten Subwelten auf. Modulationen sind ein „[…] System der Konventionen, das eine bestimmte Tätigkeit aus dem primären Rahmen in etwas transformiert, das dieser Tätigkeit nur nachgebildet ist“ (Erving Goffman zitiert in: Dirk Kaesler und Ludgera Vogt (Hrsg.): „Hauptwerke der Soziologie“, Stuttgart, 2000, S.173). So nennt Goffman insgesamt fünf Modulationen: „So-Tun-als-ob“, „Wettkampf“, „Zeremonie“, „Sonderaufführungen“ und „In-anderen-Zusammenhang-Stellen“.
[173] Waldemar Vogelgesang: „’Ich bin, wen ich spiele.’ Ludische Identitäten im Netz“ in: Thimm 2000, S.246f.
[174] Turkle 1999, S.377.
[175] Döring 2003, S.341.
[176] Online-Selbstdarstellung und virtuelle Selbstdarstellung werden von N. Döring synonym verwendet, ebenso wie virtuelle Identität und Online-Identität.
[177] Döring 2003, S.341.
[178] Ebd., S.349.
[179] Bahl 1997, S.81.
[180] Döring 2003, S.344.
[181] Anselm Strauss zitiert in: Bahl 1997, S.86.
[182] Vgl. George Herbert Mead zitiert in: Hans Joas in: Dirk Kaesler 2000 (a), S.173ff.
[183] Giddens 1995, S.112.
[184] Berger & Luckmann 1998, S.78f.
[185] Ebd., S.79.
[186] So ist gegenüber den Neulingen („Newbies“) eine gewisse Abgrenzung zu beobachten. „Ein Neuling ordnet sich oft unter und findet sich in der Rolle des Fragenden wieder: Fragen über die Befehle, das Programm und die Handhabung […], er muss sich zunächst einen gewissen Status erarbeiten: Man kennt die Neuen nicht und erst langsam entwickelt sich eine virtuelle Vertrautheit“ (Gurly Schmidt in: Thimm 2000, S.116).
[187] Das Untersuchungsdesign folgt grundlegend dem Modell eines „linearen Forschungsprozesses“. Vgl. zu diesem Modell: Andreas Diekmann: „Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen“, Reinbek bei Hamburg, 1999, S.161ff und Rainer Schnell, Paul B. Hill, Elke Esser: „Methoden der empirischen Sozialforschung“, München, Wien, 1999, S.7ff.
[188] Was jedoch nicht als Kritik an die Quantitative Sozialforschung zu verstehen ist; vielmehr wird davon ausgegangen, dass beide Methodenansätze nicht gegensätzlich sind, sondern sich gegenseitig ergänzen.
[189] Vgl. Gerhard Kleining: „Methodologie und Geschichte qualitativer Sozialforschung“ in: Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Stephan Wolff (Hrsg.): „Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen“, München, 1991, S.11ff.
[190] Ulrike Froschauer und Manfred Lueger: „Das Qualitative Interview – zur Analyse sozialer Systeme“, Wien, 1992, S.11f. Die inhaltliche Konzeption über den Aufbau der Gesellschaft im Rahmen qualitativ orientierter Sozialforschung geht zurück auf George Herbert Mead, der das Handeln einer Person immer im gesellschaftlichen Kontext betrachtet.
[191] Uwe Flick: „Stationen des qualitativen Forschungsprozesses“ in: Uwe Flick et al. 1991, S.158.
[192] Christel Hopf „Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick“ in: Uwe Flick et al. 1991, S.177.
[193] Andreas Witzel zitiert in: Uwe Flick: „Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung“, Reinbek bei Hamburg, 2005, S.134f.
[194] Ebd., S.135.
[195] Hopf in: Uwe Flick et al. 1991, S.178. Merton und Kendall nennen vier Merkmale die ein fokussiertes Interview auszeichnen: „1. Man weiß von den interviewten Personen, dass sie eine ganz konkrete Situation erlebt haben […]. 2. Die hypothetisch bedeutsamen Elemente, Muster und die Gesamtstruktur dieser Situation sind vom Forscher vorher analysiert worden. Durch diese Inhaltsanalyse ist er zu einer Reihe von Hypothesen über die Bedeutung und die Wirkungen bestimmter Aspekte dieser Situation gelangt. 3. Auf der Grundlage dieser Analyse hat der Forscher einen Interviewleitfaden entwickelt, der die Hauptgebiete einer Untersuchung umreißt und die Hypothesen enthält, die den Forscher in die Lage versetzen, im Interview die relevanten Daten zu erheben. 4. Eigentliches Ziel des Interviews sind die subjektiven Erfahrungen der Personen, die sich in der vorweg analysierten Situation befinden. Die Vielfalt der von ihnen beschriebenen Reaktionen gibt dem Forscher die Möglichkeit, a) die Validität der aus der Inhaltsanalyse und der sozialpsychologischen Theorie abgeleiteten Hypothesen zu testen und b) nicht antizipierte Reaktionen auf die Situation festzustellen und sie zum Anlaß für die Bildung neuer Hypothesen zu nehmen“ (Robert K. Merton und Patricia L. Kendall: „Das fokussierte Interview“ in: Christel Hopf und Elmar Weingarten (Hrsg.): „Qualitative Sozialforschung“, 1984, S.171f).
[196] Vgl. für die Kriterien zusätzlich Uwe Flick 2005, S.118ff.
[197] Merton & Kendall in: Hopf & Weingarten 1984, S.178.
[198] Ebd., S.178.
[199] Ebd., S.178.
[200] Ebd., S.178.
[201] Ebd., S.197.
[202] Die verwendete Version des Vorabfragebogens findet sich im Anhang 3.
[203] Das Kategoriensystem und die jeweiligen fokussierten Theorieaspekte finden sich im Anhang 2.
[204] Der Interviewleitfaden findet sich zusammen mit dem Vorabfragebogen im Anhang 3.
[205] Schnell, Hill, Esser 1999, S.145.
[206] Vgl. J. L. Kirk und M. Miller zitiert in: Uwe Flick 2005, S.319f.
[207] Ebd., S.320.
[208] Ebd., S.322.
[209] Uwe Flick: „Stationen des qualitativen Forschungsprozesses“ in: Flick et al. 1991, S.161.
[210] Schnell, Hill, Esser 1999, S.148.
[211] M. Hammersley geht dabei von drei Prämissen aus: „(1) Die Gültigkeit von Wissen lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Annahmen lassen sich in ihrer Plausibilität und Glaubwürdigkeit beurteilen. (2) Phänomene existieren auch unabhängig von unseren jeweiligen Annahmen über sie. Unsere Annahmen über sie können den Phänomenen mehr oder weniger angemessen sein. (3) Wirklichkeit wird über die (verschiedenen) Perspektiven auf Phänomene zugänglich. Forschung zielt auf die Darstellung von Wirklichkeit ab, nicht auf ihre Abbildung“ (M. Hammersley zitiert in: Flick 2005, S.323).
[212] Flick 2005, S.323f.
[213] Fritz 1995, S.19ff.
[214] Fritz 1995, S.23.
[215] Anzumerken ist, dass in der Realität solch „reine“ Spiele selten vorkommen. Es sind meist gewisse Anteile von „Action“ und „Denken“ vorhanden, ebenso gibt es auch kaum Spiele, wo nicht zumindest eine kleine Rahmengeschichte vorhanden ist. Dennoch fällt es bei den meisten Spielen nicht schwer, das dominante Spielelement herauszuarbeiten und sie entsprechend einzuordnen. Eine detailliertere Beschreibung der Computerspielkategorien findet sich im Anhang 5. Vergleiche für die nachfolgenden Ausführungen Jürgen Fritz 1995, S.24ff.
[216] Ferner gilt anzumerken, dass aus Gründen der Homogenität der Untersuchungsgruppe alle Interviewpartner von männlichem Geschlecht sind. Ohne näher auf die Geschlechterforschung einzugehen, sei hier nur darauf hingewiesen, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die beiden Geschlechter durchschnittlich unterschiedliche Computerspiel-Präferenzen hegen (vgl. Tanja Witting und Heike Esser: „Nicht nur das Wirkende bestimmt die Wirkung. Über Vielfalt und Zustandekommen von Transferprozessen beim Bildschirmspiel“, S.8ff, in: Fritz & Fehr 2003.
[217] Die Beschreibung der neun untersuchten Probanden findet sich im „Anhang 6“.
[218] Philipp Mayring unterscheidet innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse drei Analyseschritte, von denen aber in dieser Arbeit nur einer durchgeführt werden kann (vgl. Philipp Mayring: „Analyseverfahren erhobener Daten“ in: Uwe Flick et al. 1991, S.209ff): Das erste Verfahren ist die „zusammenfassende Inhaltsanalyse, hier wird das Material so zu reduzieren versucht, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, aber ein überschaubarer Kurztext entsteht“ (ebd., S.211). Im Grunde werden die Kategorien und die Struktur der Analyse aus den erhobenen Daten heraus entwickelt. Das zweite Verfahren, nennt sich „explizierende Inhaltsanalyse, sie zielt das Gegenteil der zusammenfassenden Inhaltsanalyse an: Zu einzelnen unklaren Textbestandteilen (Begriffen, Sätzen, …) soll zusätzliches Material herangetragen werden, um die Textstellen verständlich zu machen“ (ebd., S.212). Die hiesige Arbeit stützt sich aber nicht auf diese beiden Verfahren, sondern auf das dritte, die „strukturierende Inhaltsanalyse, sie hat das Ziel, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material unter bestimmten Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S.213).
[219] Uwe Flick 2005, S.279.
[220] Mayring in: Uwe Flick et al. 1991, S.213.
[221] Die Zugehörigkeit ergibt sich aus dem zugrunde gelegten Kategoriensystem, dass sich wiederum aus dem theoretischen Hintergrund ableitet. Bei zweideutigen Textstellen, wurden entweder zwei Kodiereinheiten vergeben und erst im interpretativen Prozess die eindeutige Auswahl vollzogen, oder sie wurden als „nicht einzuordnen“ markiert.
[222] Anzumerken ist, dass im Idealfall die interpretative Auswertung von einem Team vollzogen wird und dass ich daher als Einzelperson nur „eine“ Interpretationsvariante liefern kann (vgl. zu den formalen Anforderungen an die Interpretation Froschauer & Lueger 1992, S.59ff).
[223] Dieser Begriff bezieht sich auf die in der „Systematisierung der Computerspiele“ eingeführten Spielkategorien (z.B. Geschicklichkeitsspiele, Abenteuerspiele, Fahrzeugsimulationen usw.).
[224] „Jonas“ arbeitet beruflich Vollzeit an einem Computer, „Danny“ gestaltet privat Internetseiten und „Der Alte“ programmiert und modifiziert wie gesagt mehr an den Spielen, als das er sie spielt. Bei diesen dreien nimmt die Zeit für das Computerspielen deutlich weniger als die Hälfte der gesamten Computertätigkeit ein.
[225] Er nimmt dafür Computerspiele (meistens Strategiespiele), die seines Erachtens ein gutes Spielprinzip haben und verändert dann beispielsweise grundlegend das Regelwerk (oft auch in Anlehnung an sein angereichertes Studienwissen über die Historik) oder entwirft eigene Spiellandschaften. Meistens nehmen diese Tätigkeiten nach seinen Einschätzungen mehr Zeit ein, als dass er das jeweilige Spiel dann wirklich spielt. Er stellt dann aber auch die entworfenen Landschaften ins Internet, wo sich andere Spieler diese kostenlos herunterladen können. Wie er sagt, hat er sich dieses Wissen durch herumprobieren angeeignet, er öffnet dabei beispielsweise die verschiedenen Unterdateien mit einem Text- oder Hex-Editor und schaut, was sich finden bzw. verändern lässt.
[226] Auch „Der Alte“ ist zufrieden mit dem Angebot, hier findet er auch immer „ […] neues gutes Basispotential und auch gute Anregungen […]“, eigentlich beschäftigt er sich auch mit keinem Spiel (bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen) länger als ein Jahr.
[227] Die Interviews gaben zu dieser Frage keine näheren Aufschlüsse und auch zu der theoretischen Annahme, dass die virtuelle Welt die „Realität der Fiktion“ ist, gab es keine Hinweise, weder dafür noch dagegen.
[228] Die Frage nach der Beschaffenheit der Herausforderungen führt direkt auch zu den Merkmalen der virtuellen Interaktionspartner und wird daher im Rahmen der Interaktionsprozesse innerhalb eines virtuellen Spielplatzes beschrieben.
[229] „Cheats“ sind vom Programmierer integrierte Spielbefehle, mit denen die grundlegenden Spielregeln, so außer Kraft gesetzt werden, dass man Spielvorteile erhält, z.B. mit Hilfe eines Codewortes erhält man eintausend Spielgeldeinheiten, ohne irgend etwas dafür zu leisten, oder man wird unverwundbar.
[230] Auch dieser Aspekt findet innerhalb der Mensch-Computer-Interaktion eine nähere Betrachtung.
[231] Aufgrund des Unverständnisses und des tautologischen Charakters der Frage nach dem Spielverständnis gehe ich im Weiteren von der Annahme aus, dass das Spielverständnis ebenfalls grundlegend ist, wahrscheinlich sogar so grundlegend, dass ihre Erfüllung als selbstverständlich erscheint.
[232] Die Internetkosten werden als nur zweitrangig angegeben, entscheidender sind die monatlichen Gebühren, damit man weiterhin an dem Spiel teilnehmen kann (z.B. „World of Warcraft“).
[233] Eine Beschreibung virtueller Spielgemeinschaften („Communities“) findet sich im Anhang 7.
[234] Es wird aber auch angemerkt, dass man nicht richtig spielen muss, sondern sich lediglich einloggt, sich an einen friedlichen Ort begibt, wo einem aus spielerischen Gründen (z.B. Gegner) nichts geschehen kann und dort sich nicht mehr bewegt, sondern nur noch kommuniziert, da die adressierten Personen stets erreichbar sind, man muss also nicht unbedingt mit seiner Spielfigur in Sichtweite sein.
[235] Horst machte eine ähnliche Aussage, doch gibt es hier Schwierigkeiten bei der Deutung, da er auf der anderen Seite mit „Hattrick“ ein reines Onlinespiel nutzt. Da sich aber nach seinen Angaben die Kontakte mit Unbekannten auf lediglich kurze Statements beschränken und er auch keine Absichten auf intimere Bekanntschaften hegt, stellt er aber auch keinen direkten Widerspruch zur folgenden Annahme dar. Den Kontakt bei „Hattrick“ beschreibt Horst wie folgt: „Hier habe ich keinen großen Kontakt […] höchstens, dass man seinem Gegner eine kurze Nachricht im Spiel schreibt, wie „schönes Spiel“ oder ein kurzes Statement […] aber von Bekanntschaft ist da nicht zu reden, eher von Kommunikation […] ich habe auch keine festen Spielpartner […] eigentlich bin ich recht anonym, ich spreche da so gut wie gar nicht über private Themen und wenn nur immer in der Rolle des Clubmanagers […] die wahre Identität des Gegenübers interessiert mich auch kein Stück.“
[236] Wie die Kommunikation in den angehängten Chat-Räumen vonstatten geht, können in dieser Auswertung keine Angaben gemacht werden, da sich die Untersuchung ausschließlich auf virtuelle Spielplätze bezieht, die Chat-Räume bzw. Foren nicht mit einschließt.
[237] Den Höchstlevel erreicht man bei „World of Warcraft“ in etwa ein bis zwei Monaten, wenn man zügig und viel spielt (tägliche Spieldauer ca. fünf bis sechs Stunden).
[238] Folglich werden die zugehörigen Aussagen auch nicht in die Ergebnispräsentation aufgenommen
- Arbeit zitieren
- Valentin Bröder (Autor:in), 2007, Virtuelle Spielplätze - Eine explorative Studie zu Interaktion und Kommunikation bei Computerspielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78727
Kostenlos Autor werden








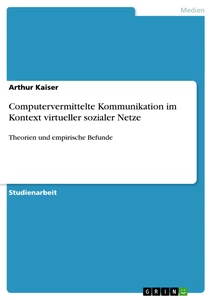






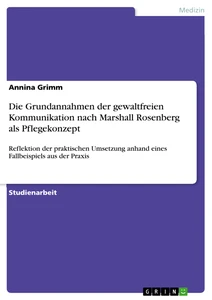
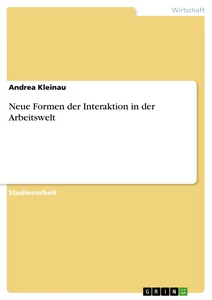



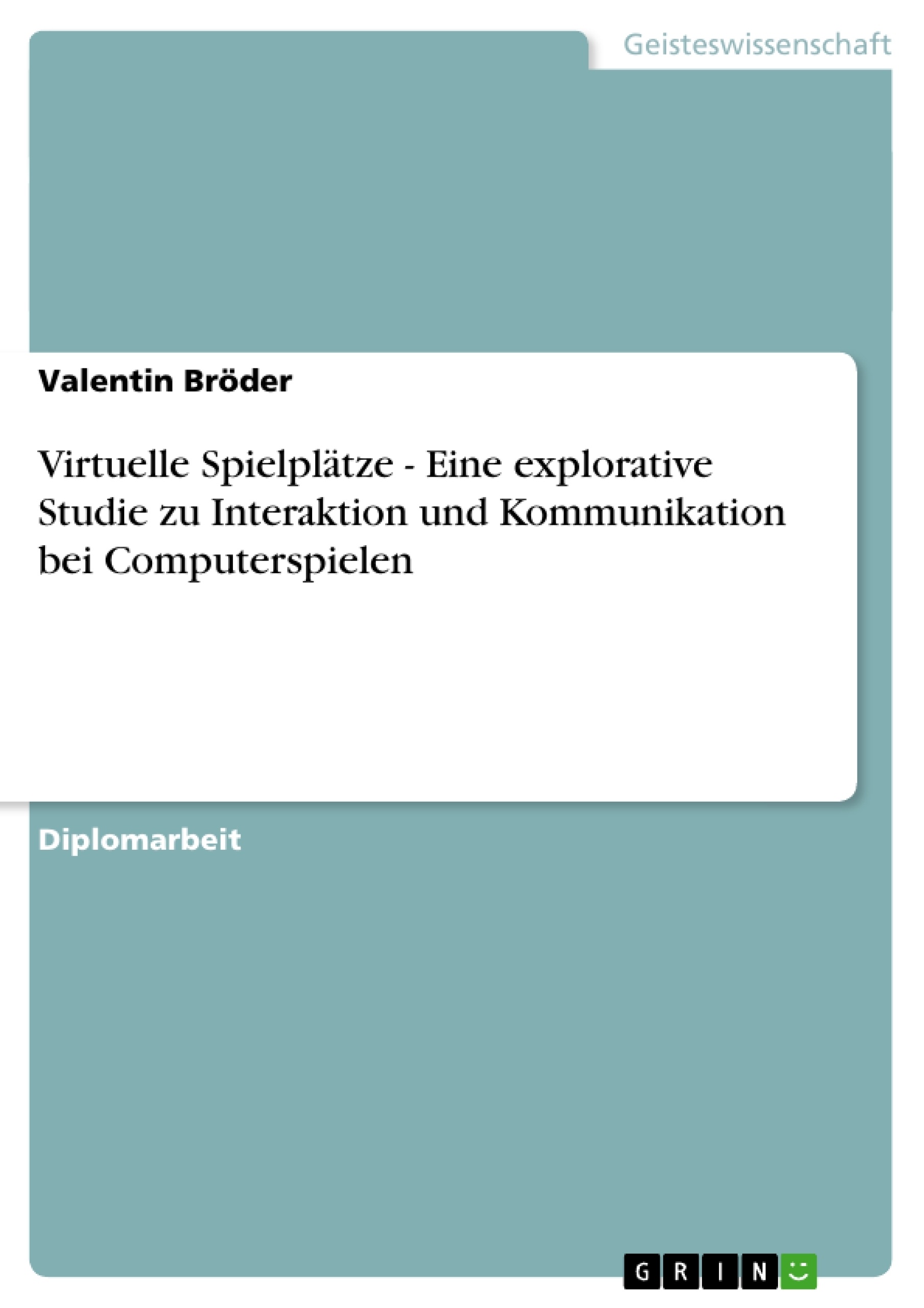

Kommentare