Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1. Nachrichtenwert-Theorie
2.2. Agenda Setting in der Medienwirkungsforschung
2.2.1. Der Agenda-Setting-Ansatz
2.2.2. Intermedia-Agenda-Setting
3. Kommunikationswissenschaftliche Beschäftigung mit Boulevardmedien
3.1. Begrifflichkeit und Definition
3.2. Gründe für die wissenschaftliche Relevanz
3.2.1. Musterbeispiel für Koorientierung
3.2.2. Bedeutung der Boulevardmedien
3.2.3. Ein Stiefkind der Kommunikatorforschung
4. Besonderheiten von Boulevardzeitungen
4.1. Merkmale der Boulevardpresse
4.1.1. Vorkommen
4.1.2. Format
4.1.3. Inhalte
4.1.4. Leser-Blatt-Bindung
4.1.5. Das Erscheinungsbild
4.2. Ökonomie des Boulevardjournalismus
5. Die Entwicklung des Boulevardjournalismus
5.1. Von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert
5.2. „Die Goldenen Jahre der Massenpresse“
5.3. Niedergang im Krieg und Neuanfang
5.4. Die Krise des Boulevardjournalismus
5.5. Welche Zukunft hat der Boulevardmarkt?
6. Der Münchner Zeitungsmarkt
6.1. Die Konkurrenzsituation
6.2. Die Münchner Zeitungen
6.2.1. Die Abendzeitung
6.2.2. Bild und Bild-München
6.2.3. Die tz
6.2.4. Die übrigen Münchner Tageszeitungen
7. Der Fall Moshammer
7.1. Rudolph Moshammer – ein Münchner Unikat
7.2. Medienphänomen Moshammer
8. Forschungsfragen
8.1. Allgemeine Fragen zum Konkurrenzverhalten
8.2. Fragen zum Fall Moshammer
9. Anlage der empirischen Untersuchung
9.1. Die Inhaltsanalyse
9.1.1. Wissenschaftlicher Hintergrund
9.1.2. Stichprobenbildung
9.1.3. Das Codebuch
9.1.4. Testphase
9.1.5. Ablauf der Codierung
9.2. Die Redaktions-Befragung
9.2.1. Wissenschaftlicher Hintergrund
9.2.2. Stichprobenbildung
9.2.3. Aufbau des Fragebogens
9.2.4. Pretest
9.2.5. Ablauf der Untersuchung
9.3. Auswertung der Ergebnisse
10. Darstellung der Ergebnisse
10.1. Ergebnisse zum allgemeinen Konkurrenzverhalten
10.2. Ergebnisse zum Fall Moshammer
10.3. Exkurs: So antworteten die Verantwortlichen
11. Fazit und Ausblick
12. Literaturverzeichnis
13. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Fragebogen zur Redaktionsbefragung
Erstes Anschreiben zum Fragebogen
Erinnerungsschreiben zum Fragebogen
Danksagung
1. Einleitung
Das Jahr 2005 hat viele bewegende Nachrichten geliefert: die Wahl der neuen deutschen Bundesregierung unter Angela Merkel, die Terroranschläge in London, der Amtsantritt des neuen Bundespräsidenten. Doch in den Münchner Medien fanden all diese Ereignisse weniger Beachtung als eines, das – zumindest aus weltpolitischer Sicht – viel unbedeutender war: der Mord am Münchner Prominenten Rudolph Moshammer. „Kaum ein Tod seit dem von Ministerpräsident Franz Josef Strauß 1988 hat die Münchner so aufgewühlt und beschäftigt“, schrieb die AZ einige Tage nach dem Raubmord in Moshammers Villa in Grünwald bei München.[1]
Entsprechend groß war die mediale Resonanz auf das Verbrechen. Neun Tage lang widmeten alle drei Münchner Boulevardzeitungen AZ, Bild-München und tz ihre Schlagzeilen Moshammer, auch in den Wochen danach erschienen noch zahlreiche Berichte. Eine vergleichbar intensive Berichterstattung über ein Ereignis und seine Folgen hatte es in München seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr gegeben. Wie im Folgenden noch ausgeführt wird, bietet es sich daher an, an den Beispielen des Moshammer-Mordes und der Münchner Zeitungen AZ, Bild-München und tz die Arbeitsweise von konkurrierenden Boulevardblättern zu untersuchen.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet demzufolge:
Wie stark beeinflussen sich die Boulevardblätter Abendzeitung, Bild-München und tz in ihrem Konkurrenzkampf auf dem Münchner Zeitungsmarkt gegenseitig?
In Kapitel acht wird die Fragestellung noch präzisiert, hier soll sie daher nur kurz zusammenfassend vorgestellt werden: Einerseits geht es um das Konkurrenzverhalten im Alltag der Boulevardmedien, darum, ob und wenn ja in welcher Form eine Orientierung aneinander (Koorientierung) stattfindet. Andererseits geht es darum, wie sich der Konkurrenzkampf auf die Arbeit der Boulevardjournalisten konkret auswirkt. Wissenschaftliche Basis dafür sind die Agenda-Setting-Hypothese im Allgemeinen und Intermedia-Agenda-Setting im Speziellen.
Diesem Forschungskomplex vorangestellt wird eine Analyse der Berichterstattung über den Fall Moshammer – geleitet von der Teilforschungsfrage, wieso die Boulevardmedien so intensiv über den von ihnen oftmals als „Mosi“ gefeierten Münchner Prominenten berichtet haben. Hier ist die Nachrichtenwert-Theorie die zugrunde liegende wissenschaftliche Basis.
Neben dem grundsätzlichen wissenschaftlichen Interesse für diese Frage gilt es mit ihr auch zu belegen, dass die Person Moshammer und der Mordfall für die Boulevardmedien so relevant waren, dass von diesem Fallbeispiel generalisiert werden kann.
Dass dieses Fallbeispiel zur wissenschaftlichen Betrachtung geeignet ist, lässt sich mit mehreren Relevanzfaktoren begründen: So war der Mordfall Moshammer Anfang 2006 immer noch von latenter Aktualität. Denn in München wurden auch nach der Verurteilung des Mörders im Herbst 2005 noch mehrere Fragen diskutiert: Unter anderem ging es darum, was aus Moshammers Villa in Grünwald werden würde und wie es seinem alternden Hund „Daisy“ ergeht.
Um die Relevanz dieser Arbeit zu begründen, reicht dieses lokaljournalistische Interesse jedoch nicht aus. Zentrales Motiv, diese Untersuchung anzugehen, ist ein immer noch vorhandenes Forschungsdefizit im Bereich des Boulevardjournalismus. Wie später noch gezeigt wird, ist dieser auch im jungen 21. Jahrhundert noch das Stiefkind der Kommunikatorforschung. Sogar die Journalismusstudien der 1990er-Jahre beschäftigten sich mit dem Genre gar nicht oder nur am Rande.
Zudem widmet sich die Arbeit einem weiteren, bisher vernachlässigtem Feld der Kommunikatorforschung: den Auswirkungen von Konkurrenz im Journalismus. Denn wie Reinemann 2003 feststellte, gebe es „bislang kaum befriedigende Antworten“ auf die Frage, wie sich ökonomische oder publizistische Konkurrenz auf die Arbeit einzelner Journalisten und Redaktionen konkret auswirkt, welche Überlegungen eine Rolle dafür spielen, sich an der Konkurrenz zu orientieren oder ob Koorientierung vorwiegend unbewusst abläuft.[2]
Des Weiteren ist eine hohe quantitative Relevanz des Themas zu nennen, schließlich ist der Münchner Zeitungsmarkt der drittgrößte lokale Medienmarkt in Deutschland (nach Hamburg und Berlin). Rund 1,25 Millionen Einwohner in der Stadt und weitere Hunderttausende im Umland können tagtäglich zumindest theoretisch in Kontakt mit der Münchner Boulevardpresse kommen. Zudem werden Abendzeitung und tz auch überregional – etwa an Bahnhofskiosken – vertrieben, und Geschichten von Bild-München erscheinen bei entsprechender Bedeutung auch in der Bundesausgabe, die rund zwölf Millionen Leser am Tag erreicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind auch von praktischer Relevanz, weil sie im Allgemeinen darüber Aufschluss geben können, wie sich Boulevardmedien im Konkurrenzkampf am besten positionieren sollten, und im Speziellen darüber, wie die drei Münchner Boulevardzeitungen aufgestellt sind.
Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über theoretische Grundlagen dieser Arbeit mit den Hauptkomplexen Nachrichtenwert-Theorie und Medienwirkungsforschung gegeben. Beim letzten Teil ist – wegen des zentralen Hauptforschungsziels Konkurrenzverhalten – der Aspekt Intermedia-Agenda-Setting besonders hervorgehoben.
Der Literaturteil dieser Arbeit beginnt im dritten Kapitel, welches die kommunikationswissenschaftliche Beschäftigung mit Boulevardmedien thematisiert. Nach einer Diskussion von Begrifflichkeit und Definitionsmöglichkeiten wird die wissenschaftliche Relevanz des Genres ausführlicher behandelt. Am Schluss des dritten Kapitals wird außerdem der aktuelle Forschungsstand zusammengefasst und dargestellt, wieso ein erhebliches Forschungsdefizit besteht.
Um einen detaillierteren Überblick über die Boulevardpresse zu geben, widmet sich das vierte Kapitel danach ihren Besonderheiten: Unterteilt ist dieses Kapitel in die printmedialen und ökonomischen Merkmale der Gattung. Daran schließt sich im fünften Kapitel ein Überblick über die historische Entwicklung der Branche an, der auch ihre Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahrzehnten thematisiert. Eine Scharnierfunktion zwischen Literaturteil und eigentlicher Empirie bilden das sechste und siebte Kapitel, die erklären, wieso der Münchner Boulevardmarkt und der Fall Moshammer für dieses Forschungsvorhaben besonders geeignet sind. Dort werden die Münchner Medien und die Person Moshammer genauer vorgestellt. Außerdem wird näher auf die für diese Arbeit bedeutende Studie von Marzahn zu Moshammer eingegangen.[3]
Auf die detailliert aufgeschlüsselte Forschungsfrage, die sich in sieben Teil-Fragen untergliedert, folgt anschließend ein Überblick über das methodische Vorgehen. Im Fokus stehen hierbei Textanalyse und Redaktionsbefragung als die beiden in dieser multi-instrumentalen Untersuchung verwendeten Methoden. Den Abschluss der Arbeit bilden Darstellung und Diskussion der Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Koorientierung.
2. Theoretische Grundlagen
Da die Untersuchung der einzelnen Zeitungen der vergleichenden Betrachtung vorangehen muss, wird zunächst die dazu benötigte Nachrichtenwert-Theorie diskutiert. Danach folgen Agenda Setting und das – vor dem Hintergrund der Koorientierung wichtige – Intermedia-Agenda-Setting.
2.1. Nachrichtenwert-Theorie
„Was macht ein Ereignis zur Nachricht?“ – das ist die zentrale Frage der Nachrichtenwert-Theorie. Bevor dieses Konzept zur Auswahl und Gestaltung von Nachrichten diskutiert werden soll, gilt es zunächst den Begriff zu analysieren, der ihm innewohnt: die Nachricht. „News is, what’s different“, lautet die gängige US-Definition.[4] Das, was den Unterschied macht, sei also die Nachricht. Oder ist es eher „die erste Skizze der Geschichte“, wie es eine englische Formulierung besagt: „News ist the first rough draw of history.“[5] Eine ältere Definition aus dem 19. Jahrhundert, die John B. Bogart, 1880 Lokalredakteur der US-Zeitung Sun, erfand, besagt: „When a dog bites a man, that is not news, but when a man bites a dog, that is news.“[6]
Auch kommunikationswissenschaftlich wurde die Nachricht schon analysiert. So definierten Dorsch-Jungsberger et al. den Begriff als „Endprodukt eines Prozesses, in dessen Verlauf sich vielfältige, publizistisch bedeutsame Faktoren auf ein bestimmtes Geschehen auswirken“.[7] Alle diese Definitionen – deren Auflistung sich um ein Vielfaches verlängern ließe – betonen mehrere Faktoren: Nachrichten sind neu, anders als das Bestehende und liefern damit den Aufhänger journalistischer Berichterstattung.
Die Nachrichtenwert-Forschung untersucht darauf aufbauend, welche Aspekte der Nachricht, die etymologisch ihren Ursprung übrigens im 17. Jahrhundert im Wort „Nachrichtung“ hat[8], innewohnen müssen, damit sie wahrgenommen und als berichtenswert angesehen wird. Dieser Frage gingen Gelehrte schon vor über 300 Jahren nach, etwa Christian Weise, der 1676 in seinem Aufsatz „Schediasma Curiosum de Lectione Novellarum“ über Nachrichtenselektion sinnierte.
Vordenker der wissenschaftlichen Moderne wurde der Amerikaner Walter Lippmann mit seinem 1922 publizierten Buch „Public Opinion“.[9] Lippmann geht davon aus, dass, „selbst wenn alle Reporter der Welt Tag und Nacht arbeiteten, sie nicht bei allen Ereignissen der Welt dabei sein (könnten). (...) Zeitungen versuchen gar nicht, die ganze Menschheit unter den Augen zu behalten.“[10] Dementsprechend müsste es also Kriterien geben, nach denen sie Nachrichten selektieren. Der Grundgedanke für eine neue Forschungsrichtung war manifestiert.
Diese splittete sich im Laufe der Jahre in drei wesentliche Richtungen auf: Gatekeeper-, News-Bias- und Nachrichtenwert-Forschung. Während sich die erste mit den Journalisten sowie Einflüssen und Zwängen, denen diese ausgesetzt sind, beschäftigt, widmet sich die zweite Forschungsrichtung den Gründen dafür, dass es in der massenmedialen Berichterstattung zu Einseitigkeiten und politischen Tendenzen kommt.[11]
Die erste empirische Untersuchung zur Nachrichtenwertforschung führte Charles Merz 1925 durch. Beim Vergleich von zehn Titelseiten-Geschichten ausgewählter Zeitungen fand er heraus, dass die Faktoren Personalisierung, Konflikt, Spannung und Prominenz dominieren und über die Intensität der Berichterstattung entscheiden.[12]
In Europa begründete Einar Östgaard 1965 die Forschungstradition.[13] Der Norweger war der erste, der ein komplexes Nachrichtenfaktoren-Konzept entwickelte. In diesem standen die Bereiche Vereinfachung, Identifikation und Sensationalismus im Mittelpunkt. Zwei Hypothesen Östgaards gilt es hervorzuheben: einerseits die Komplementaritäts-Hypothese, die davon ausgeht, dass ein fehlender Nachrichtenfaktor durch einen anderen ersetzt werden kann. Ist zum Beispiel ein Taschendieb nicht prominent und der Fall damit eigentlich Alltag, so können besonders tragische Umstände ihn doch interessant machen, wenn also zum Beispiel der Beraubte in der gestohlenen Geldbörse seinen gerade abgeholten Lottogewinn hatte.
Andererseits ist die Additivitäts-Hypothese zu nennen, in der Östgaard postuliert, dass verschiedene Nachrichtenfaktoren sich in der Summe addieren. Ein Autounfall eines unbekannten Stadtrates also würde demnach Aufmerksamkeit entfachen, wenn dabei wertvolle chinesische Vasen im Kofferraum zu Bruch gingen, der Mann ein volltrunkener Wiederholungstäter wäre, und sich der Unfall außerdem noch an Heilig Abend vor dem Haus des Bürgermeisters abspielte.
Ebenfalls 1965 widmeten sich auch die Wissenschaftler Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge der Frage, welche Faktoren den Nachrichtenfluss bestimmen und bauten dabei auf Östgaards Studie auf.[14] Wie schon Lippmann gingen sie von kognitionspsychologischen Vorgängen bei der Ereignisauswahl aus. Diesen Gedankengang modifizierten sie insofern, als dass sie erstmals die Zweistufigkeit des Selektionsprozesses ins Spiel brachten. Denn nicht nur Journalisten, sondern auch später die Rezipienten selektierten aus dem Nachrichten-Angebot. „Chain of communication“[15] nannten Galtung und Ruge diesen Prozess und ermittelten zwölf Faktoren als selektionsbeeinflussend. Dazu gehört das Erreichen eines gewissen Grundinteresses (Aufmerksamkeitsschwelle), ein Nachrichtentrend, Überraschungseffekte, die grundsätzliche Bedeutsamkeit des Ereignisses, die Beteiligung bekannter Personen, Institutionen oder Nationen. Auch Personalisierung und Negativismus steigern die Chance, dass eine Nachricht berichtenswert wird.
Die herausgearbeiteten Nachrichtenfaktoren wirken dabei zusammen, was die Forscher in mehreren Hypothesen herauszuarbeiten versuchten. Erstens übernahmen sie Östgaards Komplementaritäts-Hypothese. Zweitens formulierten Galtung und Ruge, analog zu Östgaards Additivitäts-Hypothese, denselben Zusammenhang, den sie als Selektions-Hypothese präsentierten. Die Verzerrungs-Hypothese meint drittens, dass die Berichterstattung Ereignisse auf diejenigen Aspekte reduziert, die sie aus Sicht der Nachrichtenfaktorforschung interessant machen. Die Replikations-Hypothese als vierte besagt, dass die Verzerrung im Laufe der Berichterstattung immer stärker zunimmt. Die Theorie von Galtung und Ruge gilt als bis dato bedeutendster Beitrag zur Nachrichtenwertforschung, war jedoch nicht frei von Kritik: So merkte Schulz genauso wie Eilders an, dass sie zu schwach durch empirische Befunde gestützt sei.[16]
Als nächste wichtige Forschungsstufe ist die Studie von Westerstahl und Johansson zu nennen.[17] Die Schweden postulierten, dass es statische und dynamische Nachrichtenfaktoren gebe. Während erstere stets relevant seien, seien zweite von Veränderungen im journalistischen Berufsverständnis abhängig. Beispiel dafür ist der Börsen-Hausse 1999/2000, als manche Zeitungen plötzlich sogar den Kurs der T-Aktie auf ihrer Titelseite veröffentlichten – eine Angewohnheit, die sie wegen des nachlassenden Interesses an Aktien in der 2000 einsetzenden Baisse wieder einstellten.
Doch auch die Nachrichtenfaktor-Forschung ist nicht frei von Kritik. So monierte Rosengreen 1970, dass eine wirklich objektive Untersuchung kaum möglich sei. Denn dafür sei ein Vergleich von In- und Output notwendig, also von objektiver Realität und dem, was Journalisten daraus machen.[18] Auch Schulz postulierte eine wissenschaftliche Unmöglichkeit, Realität wirklich objektiv zu erfassen und mit dem Berichteten zu vergleichen – denn jede Nachricht sei eine Interpretation der Umwelt.[19] Nachrichtenfaktoren seien daher auch keine Ereignismerkmale, sondern „Beitragsmerkmale“, die den massenmedialen Wert einer Nachricht bestimmten.[20] Anders ausgedrückt: Ein Nachrichtenfaktor ist keineswegs eine objektive Eigenschaft eines Ereignisses, sondern eine subjektive Größe, die sich auf das erwartete Leserinteresse bezieht. Dennoch bestätigte Schulz in einer Studie 1976 die Wirksamkeit von Nachrichtenfaktoren: „Die Definition von Realität, wie sie uns von den Nachrichtenmedien dargeboten wird, orientiert sich an einem weitgehend allgemeinverbindlichen Kanon von Selektions- und Interpretationsregeln.“[21] Auch Eilders bestätigte alles in allem die Nachrichtenwerttheorie als Kriterium journalistischer Selektion.
Abschließend sei noch die Untersuchung von Staab zu nennen, in der er sich vom bis dato prägenden Kausalmodell der Selektionsentscheidungen entfernte. Seine These besagt, dass Nachrichtenfaktoren auch Folgen – nicht nur objektive Ursachen – der Nachrichtenauswahl sein können, da Journalisten bestimmte Ziele verfolgen. Sie würden demnach, um die eigene Berichterstattung zu legitimieren, den selektierten Inhalten nachrichtlich relevante Faktoren zuschreiben. Dieses „Finalmodell“ sorgte in gewisser Weise für eine Verschmelzung von Nachrichtenwert- und News-Bias-Forschung.[22] Da Staab empirisch nachweisen konnte, dass verschiedene Zeitungen dasselbe Ereignis völlig unterschiedlich prominent verkauften, sah er sein Modell bestätigt.
Die kontroverse Diskussion der Nachrichtenwert-Theorie hat nichts daran geändert, dass sie kommunikationswissenschaftlich anerkannt ist. Für diese Arbeit ist sie deshalb so wichtig, weil Nachrichtenwerte auf Publikumsinteressen zurück zu führen sind.[23] „Nachrichtenwerte haben also ihre journalistische Funktion darin, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.“[24] Dementsprechend lassen sie Rückschlüsse darauf zu, wie Zeitungen – und gerade Boulevardblätter – arbeiten, um Leser zu gewinnen. Aufgrund der intensiven Berichterstattung über Moshammer ist mit Blick auf diese Arbeit davon auszugehen, dass dem Mordfall zahlreiche Nachrichtenfaktoren zugeschrieben wurden, die – unter anderem gemäß der Additivitäts-Hypothese – die 14-tägige Dominanz des Themas in den Münchner Boulevardmedien erklären.
2.2. Agenda Setting in der Medienwirkungsforschung
Agenda Setting ist ein Teil der Medienwirkungsforschung, einem Forschungsfeld, das seine Ursprünge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert hat. Die wissenschaftliche Einstellung gegenüber der Medienwirkung hat sich seither stark verändert. Den Anfang dieser Forschungstradition markierte die „Invasion der Marsmenschen“ – unter dem Titel wurde eine US-Studie bekannt, laut der hunderttausende New Yorker Bürger angeblich in Panik gerieten, weil ein Hörspiel von Orson Welles über die Invasion Außerirdischer im Radio als wahre Nachricht verkauft wurde.[25] Eine aus dieser Begebenheit abgeleitete grenzenlose Macht der Medien widerlegte bereits 1944 der US-Wissenschaftler Paul Lazarsfeld in seiner Studie „The People’s Choice“.
Als überholt gilt auch das Stimulus-Response-Modell von Shannon und Weaver, das davon ausgeht, dass ein bestimmter Kommunikationsinhalt[26] jedes Individuum auf die gleiche Weise erreicht, weil jeder die Stimuli auf gleiche Art wahrnehme und ähnlich oder gleichartig reagiere. Dieses aus den Naturwissenschaften übernommene Kausalitätskonzept[27] gilt als widerlegt, spätestens seitdem Bauer im Jahr 1969 seinen Aufsatz „Das widerspenstige Publikum“ vorstellte. Sein transaktionales Modell propagiert den aktiven Rezipienten, der aus den Mitteilungen nach seinen Bedürfnissen Inhalte selektiert und das Ausgewählte zudem noch nach eigenen Prädispositionen wie Hintergrundwissen oder Einstellung interpretiert – und nicht zwingend nach der Intention des Verfassers.[28] Solchen komplexen Kommunikationsprozessen widmet sich zum Beispiel der dynamisch-transaktionale Ansatz von Früh und Schönbach.[29]
Die Entwicklung wird hier ausgeführt, weil der Grundgedanke für diese Studie wichtig ist: Wenn der Rezipient so eine wichtige Rolle spielt, dann muss sich das auf die tägliche Arbeit der Kommunikatoren – also zum Beispiel der Journalisten – auswirken. „Das Interesse des Rezipienten (…) müsste also ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Nachrichtenfaktor sein.“[30] Im Besonderen müsste das für Boulevardzeitungen im Konkurrenzkampf gelten, da die ja – ausgehend von einem aktiven Rezipienten – diesen jeden Tag aufs Neue überzeugen müssen. Daher können Nachrichten, auch wenn sie von Journalisten mit Blick auf ihre grundsätzliche Relevanz als unbedeutend eingestuft werden, „aufgrund des unterstellten Leser-Interesses aber sehr hoch bewertet werden“.[31]
2.2.1. Der Agenda-Setting-Ansatz
Mit „Agenda Setting“ wird die Funktion der Massenmedien bezeichnet, öffentlich wahrgenommene und diskutierte Themen zu bestimmen, indem sie selbst Themen setzen und Meinungen verbreiten. Die Hypothese geht zurück auf den US-Forscher Bernard C. Cohen, der 1963 postulierte, dass Medien zwar nicht die öffentliche Einstellung zu einzelnen Themen determinierten, aber doch beeinflussten, über welche Themen sich Menschen überhaupt Gedanken machen.
Mit ihrer empirischen „Chapel Hill Studie“ zum amerikanischen Präsidentenwahlkampf[32] bestätigten die US-Forscher Maxwell McCombs und Donald L. Shaw die Annahme von Cohen: „It is hypothesized that the mass media sets the agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes towards the political issues.”[33] Maletzke erbrachte denselben Nachweis ein Jahrzehnt später, als er herausfand, dass „diejenigen Themen der politischen Diskussion, welche die Medien hervorheben, in der Folge auch von den Rezipienten als wichtig betrachtet” werden.[34] Berühmt ist auch Cohens Erkenntnis: „(The press) may not be successful (…) in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.”[35]
Drei Modelle stehen heute in der Agenda-Setting-Forschung nebeneinander: Das Awareness-Modell (Aufmerksamkeitsmodell) besagt zunächst nur, dass der Rezipient über Medien auf Themen aufmerksam wird. Laut dem Salience-Modell (Hervorhebungsmodell) beeinflusst die Art medialer Berichterstattung die Wichtigkeit, die der Rezipient einem Thema zubilligt. Am weitesten geht das Priority-Modell (Themenselektionsmodell), das postuliert, dass der Rezipient die Themenrangfolge der Medien eins-zu-eins übernehme.
Weitere Ausführungen zum Agenda Setting würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weswegen hier ein Verweis auf einschlägige Übersichtswerke ausreichen[36] und der Blick auf einen für die folgende Untersuchung wichtigen Teilbereich gerichtet werden soll.
2.2.2. Intermedia-Agenda-Setting
Abschreiben gilt schon in der Schule als ein Weg zum Ziel – wenn auch nicht als der ehrenvollste. Für Journalisten finden sich ebenfalls zahlreiche pragmatische Gründe, sich an der Arbeit von Kollegen zu orientieren, denn journalistische Quellen bieten viele Vorteile: Vor allem sind sie leicht verfügbar – leichter vielleicht als ein Gesprächspartner, der erst angerufen werden muss. In Zeiten des Internets und der weltweiten Kommunikation gilt das sogar für ausländische Medien. Die Erschließungskosten – zeitlich und monetär – sind also geringer. Zudem sind sie nach journalistischen Grundsätzen verfasst und anhand von Nachrichtenfaktoren konzipiert worden, sind also für Medienschaffende leichter zu bearbeiten als nichtjournalistische Quellen. Ihr Ursprung verleiht ihnen per se Glaubwürdigkeit. Aus all diesen Gründen überdauert seit Jahrzehnten der Aphorismus: „Journalismus ist und bleibt, wenn einer ab vom ander’n schreibt.“
Dass es Koorientierung im Journalismus gibt, ist eine sehr alte Erkenntnis. Schon Stieler, einem der ersten, die sich dem Thema wissenschaftlich näherten, fiel 1695 auf, wie sehr „heut zu Tage alles in einem bloßem Nachschreiben besteht“.[37] Und er bemerkte – den Begriff „Zeitung“ mit „Nachricht“ gleichsetzend – verärgert: „Wem ekelt nicht dafür, wenn er eine neue Zeitung lieset, die er vor acht Tagen aus einer anderen albereit gelesen hat?“[38]
Kaum zehn Jahre später bestätigte Johann Peter von Ludewig[39] diese Erkenntnis und notierte, „dass die meisten Avisen einander ausschreiben“.[40] „Avisen“ war damals der gängige Begriff für periodisch erscheinende Zeitungen. Die Kritik setzte sich fort: So bemerkte Zedler Mitte des 18. Jahrhunderts verärgert, dass „Dinge von so weniger Erheblichkeit heute in der Franckfurtischen, Hanauischen, und Nürnbergischen Zeitung stehen, und in etlichen Wochen in sechs anderen Zeitungs=Blättern (sic!) nochmals abgeschmiert und den geneigten Lesern vorgelegt werden“.[41]
So amüsant die alten Formulierungen auch klingen mögen, sie leiten auf ein hochaktuelles Thema hin: die journalistische Koorientierung. Zwar negieren manche Autoren, dass diese vermehrt stattfinde[42], doch ist sich die Mehrzahl der Medienwissenschaftler zumindest einig, dass sie von erheblicher Bedeutung ist. Wegweisend war in diesem Bereich Reinemanns Arbeit[43], in der er, unter dem Titel „Medienmacher als Mediennutzer“, Kommunikations- und Einfluss-Strukturen im deutschen Journalismus analysierte.[44] Er zeigte auf, dass „anderen Medien große Bedeutung für die journalistische Arbeit“ zukomme, was für Themensuche, -auswahl und Recherche gelte.[45]
Zuvor hatten schon einige kleinere Studien ein ähnliches Ergebnis geliefert: Bereits 1976 fand Donsbach heraus, dass sich mehr als 50 Prozent der Lokaljournalisten und sogar drei Viertel der überregional Berichtenden manchmal oder häufig „an dem, was andere Medien bringen“, orientierten.[46] Kepplinger ermittelte 1985, dass überregionale Qualitätszeitungen im intermediären Wettbewerb starken Einfluss hätten.[47] Sehr eindeutig war auch das Ergebnis einer Befragung von Jarren und Donges unter Rundfunkjournalisten. 85 Prozent von ihnen bezeichneten die Berichterstattung der Tageszeitungen als Grundlage für eigene Geschichten.[48] Eine Studie von Gallmann unter Politik- und Wirtschaftsredakteuren von Tageszeitungen ergab mit Blick auf die Recherche sogar, dass die Berichterstattung anderer Medien wichtiger sei als „eigene Beobachtungen“.[49]
Jedoch ist hier darauf hinzuweisen dass das journalistische Informationsverhalten und damit auch die Mediennutzung davon abhängt, in welchem Ressort die Befragten arbeiten.[50] Eine sehr spezielle Studie von Schenk und Sonje zeigte zum Beispiel, dass Wissenschaftsjournalisten mit dem Fachgebiet Gentechnik die Berichte anderer Medien nur als sechstwichtigste Quelle ansahen – hinter Experten, Fachliteratur, Pressemitteilungen, Fachveranstaltungen und Nachrichtenagenturen.[51] Nicht nur je nach Ressort unterscheidet sich Koorientierung, auch je nach wahrgenommenem Medium, da einige „die Rolle von Meinungsführern“[52] haben.
Die Wahrscheinlichkeit für die Wiedergabe einer bestimmten Meldung steigt jedenfalls generell, wenn andere Medien ebenfalls darüber berichten. Luhmann betonte dementsprechend, Massenmedien „arbeiten weitgehend selbstinspirativ: durch Lektüre ihrer eigenen Erzeugnisse“.[53]
Allgemein gesehen ist also der hohe Stellenwert der Mediennutzung für Journalisten offenkundig, Reinemann nennt sie sogar „eine zentrale Form routinisierten journalistischen Handelns“.[54] Auch im außerdeutschen Raum wurde das in zahlreichen Untersuchungen bestätigt. Die Feststellung von Shoemaker und Reese soll hier genügen: „Journalists read, watch, and listen to news from their own and from competing organizations, and when a story breaks first in one medium, it may quickly be picked up by other media.”[55] Allerdings wirft Reinemann zu Recht ein, dass Koorientierung nicht zwingend zum direkten Abschreiben führen müsse, sondern auch langfristige Auswirkungen wie veränderte Selektionskriterien im Journalismus bedingen könne.[56] Inwieweit dieses Phänomen auf dem Münchner Zeitungsmarkt zu beobachten ist, gilt es in dieser Arbeit zu klären. Dabei wird untersucht, welche Formen von Koorientierung vorherrschen, an welchen Medien sich die Befragten orientieren und ob es Ressort spezifische Unterschiede gibt.
3. Kommunikationswissenschaftliche
Beschäftigung mit Boulevardmedien
In diesem Kapitel sollen zunächst verschiedene Begriffe und Definitionen für das Genre diskutiert werden. Anschließend werden in detaillierter Form die – in der Einleitung zwangsläufig nur angeschnittenen – Relevanzfaktoren aufgegriffen.
3.1. Begrifflichkeit und Definition
Genauso wenig, wie es eine allgemein verbindliche Definition gibt, herrscht Einigkeit darüber, wie die Mediengattung als Ganzes zu bezeichnen ist. Vielmehr schwirren in Wissenschaft und Alltag zahlreiche Begriffe umher, die teils alles andere als zutreffend sind.
Zunächst bedarf der Begriff „Boulevard“ selbst einer kurzen Erläuterung. Das Wort kommt aus dem Französischen und steht für eine belebte innerstädtische Straße. Hier treffen sich Menschen, sitzen in Straßencafés, tauschen Neuigkeiten und Gerüchte aus. Entsprechend sieht Satinsky den Boulevard als „Brennpunkt von Halbwahrheiten“, als „Schaufenster des täglichen Lebens“.[57]
Im englischen Sprachraum ist alternativ zum Boulevardbegriff häufig von „Yellow Press“ die Rede: Das mit am häufigsten genutzte Synonym ist an und für sich nicht ganz korrekt, da es ursprünglich eher die publikumsorientierte Massenpresse im Allgemeinen meinte. Der Begriff geht zurück auf die Hauptfigur einer Comic-Serie mit dem Namen „The Yellow Kid“, die 1895 in der New York World erschien. Um möglichst viel Aufsehen zu erregen, wurde der Mantel dieses „gelben Kindes“ in knalligem Gelb gedruckt. Damit wurde der Name „Yellow Press“ Synonym für Zeitungen, die mit besonders viel Farbe Leserinteresse wecken wollen.[58] Das deutsche begriffliche Äquivalent ist „Regenbogen-Presse“. Es wird heute allerdings vor allem auf die bunt bebilderten, einfach produzierten Frauenmagazine wie Frau im Spiegel oder Das goldene Blatt angewendet, die mit Geschichten über Adelshäuser, Film- und TV-Stars Auflage machen. Ebenfalls aus dem Angelsächsischen kommt der Begriff „Tabloid“, der dort noch weiter verbreitet ist als „Yellow Press“. Er geht zurück auf das Kleinformat früherer US-„Bilderzeitungen“.
Im deutschen Sprachraum gibt es ebenfalls mehrere synonym gebrauchte Begriffe: Zu nennen sind „Straßenverkaufszeitung“ und „Kaufzeitung“. Beide jedoch sind unscharf, weil erstens nur ein Teil der Boulevardpresse auf der Straße verkauft wird und „Kaufzeitung“ zweitens suggeriert, dass die nicht-boulevardeske Presse nicht zu kaufen sei. Genauso wenig zutreffend ist Paweks Terminus „Überregionales Straßenblatt“, da diese Überregionalität höchstens auf Bild zutrifft, während andere Blätter – wie AZ und tz – sich bewusst regional positionieren. Die Liste der nicht ganz treffenden Bezeichnungen lässt sich fortsetzen: Sex & Crime-Journalismus, über den etwa Grimm veröffentlichte,[59] gehört genauso dazu wie „Sensationspresse“, bei der es sich laut Dulinski um den „Idealtypus des äußersten Randes des populären Journalismus“ handelt.
Vor allem dem wissenschaftlichen Diskurs entnommen sind drei andere Begriffe: So spricht Ritzer von der „McDonaldisierung der Medien“ und vom „McJournalismus“[60]. Noch abschätziger ist der „Kloakenjournalismus“, mit dem Bollinger allerdings nur frühe US-Boulevardblätter meinte.[61] Interessanter ist der Begriff „Populärer Journalismus“. Sparks führte ihn zur Gattungsbezeichnung als „popular journalism“ in die Debatte ein.[62] Renger widmete ihm ein ganzes Buch und definierte ihn als „funktionalen, teilweise auch fiktionalen und formal-inhaltlich geplanten Gebrauchsjournalismus“ an der Schnittfläche zwischen Kulturindustrie und Alltag, der „Schicksale und Gefühle mit dem Suggestionsmittel der journalistischen Glaubwürdigkeit“ vermarkte.[63] Unterschiede sind in der Wertung beider Forscher zu sehen: Sparks betrachtet den Wandel zu boulevardesken Inhalten als Krise für die Demokratie[64], Renger dagegen sieht das Genre positivistisch als „sinnstiftendes Element“.[65]
Abschließend sei noch die „Revolverpresse“ genannt: Der Begriff hat nichts mit Verbrechensberichterstattung zu tun, sondern bezieht sich auf die Androhung diskreditierender Veröffentlichungen, die durch (Schweige-)Geldzahlungen verhindert werden können.[66]
Der Autor dieser Arbeit hält nur die Begriffe Boulevardjournalismus und Populärer Journalismus für gebrauchsfähig. Alle anderen disqualifizieren sich, weil sie entweder falsche Vorstellungen von der Branche vermitteln oder diese aber – wie „Kaufzeitung“ – offenkundig falsch beschreiben. Da „populärer Journalismus“ noch kein allgemein gebräuchlicher und verständlicher Begriff ist, bietet es sich jedoch an, bei der üblichen Terminologie des Boulevardjournalismus zu bleiben.
Auf der Suche nach einer allgemeingültigen Definition
Was diesen Boulevardjournalismus, der im Alltag überall präsent ist, nun qua definitione ausmacht, darüber streitet die Wissenschaft, wie Bruck und Stocker konstatierten: „Die breite Vertrautheit mit dem Phänomen im Alltag ging bislang mit einem Mangel an systematischer Beschreibung und Analyse einher.“[67]
Dieses vor zehn Jahren beschriebene Dilemma gilt immer noch: Eine umfassende und allgemein anerkannte Definition von Boulevardzeitungen gibt es nicht. Es ist nicht eindeutig geklärt, wo Boulevard beginnt und wo er aufhört. Einst lebte das Genre, wie Haller zusammenfasste, „von der Verfälschung der Gefühle, vom Schockieren, von der fortgesetzten Missachtung des Humanen“.[68] Heutzutage reiche das nicht mehr, vielmehr gehe es auch um Ratgeber-Journalismus und Lebenshilfe. „Sex and Crime allein zieht nicht mehr.“[69] Doch das als hinlängliches Definitionskriterium für Boulevardmedien zu sehen, greift zu kurz. Von Koszyk und Pruys stammt eine sehr detaillierte Definition, die das Genre bezeichnet als all
„jene Periodika, die vorwiegend auf der Straße zum Kauf angeboten werden, eine betont populär-sensationelle Aufmachung haben, den Leser durch schockierende Stories ansprechen wollen (…) und sich häufig bewusst einer sehr direkten Ausdrucksweise bedienen, die nicht selten die Vulgärsprache zu übertreffen sucht, um Sensationshunger (…) permanent zu wecken und zu befriedigen“.[70]
Darauf aufbauend haben Bruck und Stocker die materiellen, sprachlichen und organisatorischen Charakteristika des Genres herausgearbeitet. Als typische Stilkomponenten nannten sie erstens Familiarisierung respektive Personalisierung, zweitens Simplifizierung, drittens Melodramatisierung[71] und viertens Visualisierung. Bei der redaktions-organisatorischen Komponente gingen die Autoren auch auf Details wie „einen hohen Anteil an Kolumnen und einen großen Unterhaltungsteil mit Cartoons, Witzen, Kochrezepten (…) etc.“ ein.[72]
Treffen diese Klassifikationen zahlreiche wichtige Aspekte, so sind sie dennoch angreifbar: Die von Bruck und Stocker angesprochene Personalisierung wurde als Stilmittel zum Beispiel längst von seriösen Tageszeitungen adaptiert und ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Dennoch sind die Definitionen von Bruck/Stocker sowie Koszyk/Pruys hervorhebenswert und erscheinen dem Autor dieser Arbeit als die derzeit trefflichsten, da andere Definitionsversuche sich in Allgemeinplätzen erschöpfen oder durch Veränderungen auf dem Pressemarkt obsolet geworden sind: So schrieb etwa Meyn, es handele sich bei Boulevardzeitungen um jene Blätter,
„die ausschließlich am Kiosk zu haben sind und die nicht nur an Stammtischen wegen ihrer populären Themen, sondern auch in der politischen Meinungsbildung wegen ihres Urteils über Politiker eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Kennzeichnend ist die auffällige Aufmachung: Reißerische Überschriften, großformatige Fotos, Sex- und Grusel-, Prominenten- und Skandal-Geschichten.“[73]
Dieser Definition ist jedoch aus zweierlei Gründen zu widersprechen. Erstens wegen des Kiosk-Verkaufs: Es gibt in Deutschland keine Tageszeitung, die nur am Kiosk zu haben ist. Im Fall der Münchner Boulevardblätter gilt: Alle drei – auch die Bild -Zeitung – sind im Abo zu beziehen und außer am Kiosk auch bei Straßenhändlern, im Einzelhandel und an „Stummen Verkäufern“[74] erhältlich. Ausgehend von der Absatz-Strategie hat sich die Definition eingebürgert, dass Boulevardzeitungen jene Erzeugnisse der Tagespresse bezeichnen, die mehr als die Hälfte ihrer Auflage am Kiosk absetzen oder im Straßenverkauf.[75]
Zweitens ist die Layout-Definition von Meyn angreifbar. In der Tat wurden in der Vergangenheit oft plakative Schlagzeilen, zahlreiche und oft freigestellte Fotos, viel Farbe und ein variables Layout als Definitionskriterien genannt. Schneider und Raue etwa notierten als Merkmale des Genres das „reißerische, oft chaotische Layout, vor allem auf der Titelseite; die farbigen, großen, meist roten Buchstaben und Balken; der extreme Schnitt bei Bildern (...); die fetzigen Schlagzeilen“.[76] In Teilen mag diese Beschreibung noch auf boulevardspezifische Charakteristika zutreffen, doch allgemein kann sie als obsolet angesehen werden, da längst auch Teile der Abonnement-Presse solch boulevardesken Merkmale aufweisen.[77] Im immer härteren Konkurrenzkampf ist zudem zu erwarten, dass sich Abo- und Boulevardpresse weiter angleichen werden.
Das gilt auch für sprachliche Eigenarten. Pürer und Raabe analysierten, dass Straßenverkaufszeitungen sich „in aller Regel durch einen einfachen Sprachstil, der stark an die Umgangssprache angelehnt ist“, auszeichneten.[78] Grundsätzlich ist dieser Aussage auch heute – ein Jahrzehnt später – zuzustimmen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich Abo- und Straßenverkaufspresse auch sprachlich angenähert haben.
Daher bleibt festzuhalten, dass die Definitionsversuche von Bruck/Stocker sowie Koszyk/Pruys das Genre am besten beschreiben. Allerdings verpassen auch sie es, Besonderheiten wie die starke Lokalorientierung und den im Vergleich zur Abopresse differierenden Themenkanon in ihre Genre-Beschreibung aufzunehmen, so dass eine wirklich zufrieden stellende Definition nicht existiert.
3.2. Gründe für die wissenschaftliche Relevanz
Drei Relevanzfaktoren werden im folgenden Kapitel noch einmal ausführlich diskutiert: die Eignung der Boulevardmedien zur Erklärung des Phänomens Koorientierung, die Bedeutung des Genres und abschließend das immer noch vorherrschende Forschungsdefizit.
3.2.1. Musterbeispiel für Koorientierung
Boulevardmedien drängen sich geradezu als Grundlage wissenschaftlicher Forschung auf, wenn man sich dem Thema Koorientierung widmet. Denn es ist davon auszugehen, dass sich Koorientierung bei ihnen besonders stark widerspiegelt.
Einerseits gilt dies – zumindest auf dem Münchner Zeitungsmarkt – aus praktischen Gründen: Schon am frühen Abend verkaufen AZ und tz aktuelle Ausgaben des nächsten Tages in der Stadt, gegen 21 Uhr ist auch die Bild -Zeitung erhältlich. Diese Situation ermöglicht es den Konkurrenten, sich zeitnah aneinander zu orientieren. Aus seiner eigenen Erfahrung als Sportredakteur bei der Abendzeitung weiß der Autor, dass keine aktuelle AZ- Seite zum Drucken freigegeben wird, bevor nicht sichergestellt ist, dass tz und Bild keine weiter gehenden Informationen zu den eigenen Geschichten oder gar bessere Themen haben. Überregionale Qualitätszeitungen tun sich viel schwerer, ihre – meist in anderen Städten erscheinenden – Hauptkonkurrenten am Vorabend zu erhalten. Ihren lokalen Rivalen Münchner Merkur kann die Süddeutsche Zeitung sogar definitiv erst am nächsten Morgen auswerten, weil es ihn im Abendverkauf nicht gibt.
Andererseits ist die Notwendigkeit zur Koorientierung bei konkurrierenden Boulevardmedien wie in München wegen des Leserverhaltens viel größer: Ob der Vielzahl an „Stummen Verkäufern“ in der Stadt bekommen Boulevardleser meist mit, was die Konkurrenten machen – und orientieren sich womöglich schnell um, wenn ihnen deren Schlagzeilen besser gefallen. „Eine Folge dieser gewachsenen Konkurrenz ist eine stärkere Publikumsorientierung“, schrieb Reinemann.[79] Dass das zu einer zunehmenden Orientierung an der Konkurrenz führe, stehe außer Frage. Denn da die Zufriedenheit des Boulevardpublikums wichtiger werde, „können es sich Journalisten vermutlich immer weniger leisten, ein Thema zu verpassen“.[80]
Merkur - oder SZ -Leser erfahren dagegen nicht so leicht, was die Konkurrenz macht. Denn erstens erhalten sie ihre Zeitung meist im Abo nach Hause und achten daher wahrscheinlich weniger auf den Straßenverkauf. Zweitens gibt es von beiden Zeitungen viel weniger und von anderen überregionalen Blättern gar keine Zeitungskästen, die zum Konkurrenzkauf anregen könnten.
Allerdings ist wissenschaftliche Relevanz nicht nur mit Blick auf die Koorientierung gegeben. Wie in der Einleitung schon ausgeführt, gilt es, das immer noch vorherrschende Forschungsdefizit abzubauen. Bevor dieses in Kapitel 3.2.3. thematisiert wird, ist auf einen anderen wichtigen Grund einzugehen, wieso sich Boulevardmedien für eine wissenschaftliche Untersuchung eignen und diese quasi sogar verlangen: ihre große Relevanz auf dem Medienmarkt.
3.2.2. Bedeutung der Boulevardmedien
Boulevardzeitungen werden gern als „Unterklassen-Presse“ abgetan – als würden sie nur von Bauarbeitern in der Mittagspause und Arbeitslosen in der Kneipe gelesen. Zwar besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass der Anteil der höher Gebildeten an den Bild -Lesern unterdurchschnittlich ist im Vergleich zum restlichen Printmarkt, doch dabei „wird übersehen, dass ,Bild’ – aufgrund der überaus großen Verbreitung – auch die Zeitung ist, die (…) von absolut gesehen mehr Personen mit höheren Schulabschlüssen gelesen wird als jede andere deutsche Tageszeitung“.[81] Angesichts von rund 15 bis 20 Millionen Lesern, die das Boulevardgenre tagtäglich erreicht, wirkt die despektierliche Einordnung als „Unterklassen-Presse“ in der Tat obsolet.
Die hohe Bedeutung von Bild wird durch wissenschaftliche und gesellschaftliche Kommentare belegt: „Die ,Bild’-Zeitung hat die bundesdeutsche Presse geprägt wie kaum eine andere“, stellten etwa Pürer und Raabe fest.[82] Und der Stern schrieb unlängst: „Als letztes der alten bundesdeutschen Leitmedien hat ,Bild’ die Kraft, nationale Debatten über Tage zu dominieren.“[83] Im Besonderen bekommen das immer wieder Politiker zu spüren. Ex-Außenminister Joschka Fischer wurde dementsprechend öfter mit der Aussage zitiert, gegen die rote Gruppe beim Axel-Springer-Verlag (Bild, Bild am Sonntag) könne man „nur schwer Wahlen gewinnen. Und dauerhaft kannst du gegen die nicht regieren.“ Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder antwortete auf die Frage nach den wichtigen deutschen Medien stets mit dem Trias „Bild, BamS, Glotze“. Und ein anderer Politiker verglich eine negative Bild -Schlagzeile mit einem Blizzard: „Einen kann man überstehen. Aber nicht jeden Tag einen.“[84] Denn auch wenn Politik im Boulevard eine untergeordnete Rolle spielt, so ist das Genre als politischer Meinungsmacher dennoch nicht zu unterschätzen.
Die gewachsene Bedeutung der Boulevardzeitungen zeigt sich auch an Boulevardisierungstendenzen bei anderen Medien (siehe Kapitel 5.4.) und am Anteil am deutschen Pressemarkt. 1950 kamen Boulevardzeitungen mit 400 000 verkauften Exemplaren nur auf 0,4 Prozent Marktanteil.[85] 15 Jahre später waren es bei 5,3 Millionen schon rund 30 Prozent.[86] Im zweiten Quartal 1992 wurde – bedingt vor allem durch die Wiedervereinigung – sogar eine verkaufte Gesamtauflage des Genres von fast 6,5 Millionen gezählt.[87] Danach ging es zwar bergab: 1999 erreichte die verkaufte Auflage erstmals in keinem Quartal die Sechs-Millionen-Marke, im vierten Quartal 2003 fiel sie unter fünf Millionen. Die aktuellsten Zahlen sind die für das Schlussquartal 2005 mit 4,68 Millionen. Aber mit der immerhin noch dreifachen verkauften Auflage der überregionalen Abo-Zeitungen und einem Anteil von knapp 22 Prozent an den insgesamt verkauften Tageszeitungen ist das Genre weiterhin ein relevantes Forschungsobjekt.
Innerhalb der Branche wird es auch hoch angesehen: Der Schweizer Verleger Michael Ringier etwa betonte: „Für mich ist Boulevard die anspruchsvollste Form des Journalismus.“ Anspruchsvoll macht die Arbeit vor allem der Zwang, jeden Tag aufs Neue Leser zu gewinnen, die das Blatt am Kiosk, im Straßenverkauf, im Biergarten oder am „Stummen Verkäufer“ sehen.[88] Während Abo-Zeitungen ihren festen Leserstamm haben, müssen sich die Boulevardkonkurrenten stets der „Abstimmung am Kiosk“[89] stellen.
Daher stellte Weischenberg fest, dass die Boulevardzeitung wie kein anderes Presse-Genre „dem ökonomischen Imperativ“ unterliege,[90] eben weil sie jeden Tag aufs Neue um Käufer buhlen müsse. Renger kommt zum gleichen Schluss, sei doch „eher die Profitabilität und weniger die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe“ von zentraler Bedeutung.
Zwangsläufig hat das Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Zeitung: Das Ziel, Auflagen und Verkaufszahlen zu steigern, begünstigt die Ausrichtung auf den Massengeschmack und auf verkaufsfördernde Nachrichten. Oder, wie es Fricke ausdrückt: „Nicht die Nachrichtenselektion steht im Mittelpunkt, sondern die Präsentation von Sensationen.“[91] Wie sehr das Boulevardmedien zum Agenda-Setter macht, an denen sich andere Medien orientieren, hat Reinemann herausgefunden. Obwohl seine Befragung auf Berliner Politberichterstatter abzielte, auf ein Klientel also, bei dem man zuvorderst eine Orientierung an überregionalen Leitmedien wie SZ, FAZ oder Spiegel vermutet hätte, kam er zum Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Journalisten die Boulevardmedien für einen der besten Agenda-Setter hält. Das gelte nicht nur für Printjournalisten: Bei privaten Fernsehsendern orientierten sich 59 Prozent der Journalisten an den Themen der Boulevardmedien, bei privaten Hörfunksendern gar 82 Prozent – ein deutlicher Beleg für die Bedeutung des Genres beim Intermedia-Agenda-Setting.[92]
Da aufgrund des „Lokalen Prinzips“[93] die Lokalberichterstattung zudem Schwerpunkt des Boulevards ist, eignet sich ein lokales Ereignis wie der Moshammer-Mord besonders gut zur Forschung.
3.2.3. Ein Stiefkind der Kommunikatorforschung
Umso verwunderlicher – nicht nur angesichts dieser Intermedia-Agenda-Setting-Funktion – ist, wie wenig sich die Wissenschaft bisher mit dem Genre beschäftigt hat. Bezüglich des Forschungsdefizits gilt immer noch die Feststellung von Lippert aus dem Jahr 1953: „Die Sensation bewegt die Massen – aber wenig die Wissenschaft.“[94] Saxer et al. vertraten 1971 sogar eine „Defizitthese bezüglich der Erforschung der Boulevardpresse“[95], Haller schloss sich 1984 dieser Kritik an und stellte fest, dass eine präzise und praktisch zutreffende Kennzeichnung dieses Zeitungstyps in der Wissenschaft immer noch fehle.[96] In der Tat gab es bis dahin – abgesehen von Paweks älterem Überblick[97] – nur einige Verweise auf ökonomische Besonderheiten der Kaufzeitungen. Hennig bestätigte Hallers Erkenntnis im Jahr 1999: Die Kommunikationswissenschaft habe den Boulevardjournalismus stiefmütterlich behandelt.[98]
Besonders deutlich wurde das durch die Vernachlässigung in den Überblickswerken der 1990er-Jahre: Bei Schneider und Raue[99] fand das Genre zumindest noch am Rand Erwähnung. In der repräsentativen Münsteraner Studie „Journalismus in Deutschland“[100] sowie einer vergleichbaren Arbeit an der Uni Hannover[101] dagegen, die beide den Journalismus als soziales System in der Gesellschaft untersuchten, wurden die Spezifika des Boulevardgenres gar nicht beleuchtet.
Die Nachfolgestudie „Journalismus in Deutschland II“ von Weischenberg, Scholl und Malik lag bei Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht vor, da sie erst im September 2006 erscheinen sollte. Jedoch wurde in einem vorab veröffentlichten Exposé[102] im Printsektor nur eine Unterteilung zwischen Zeitungs-, Zeitschriften- und Anzeigenblatt-Journalisten vorgenommen und das Boulevardgenre namentlich gar nicht erwähnt. Das gleiche gilt für eine im August 2006 von Weischenberg im Magazin Journalist vorab publizierte Zusammenfassung der Studie.[103] Auch Weischenbergs dreibändiges Standardwerk „Journalistik. Theorie und Praxis aktueller Medienkommunikation“[104] missachtete das Genre fast ganz und widmete ihm nur wenige Seiten.[105]
Allerdings sind zuletzt einige spezifischere Werke erschienen: Lesenswert ist Dulinskis Buch „Sensationsjournalismus“, das einen guten allgemeinen Überblick gibt, sich jedoch vor allem dem äußeren Rand des Boulevards widmet. Außerdem ist Rengers Werk „Populärer Journalismus“ zu nennen, das vor allem beim historischen Rückblick überzeugt und das Genre aus Sicht der Cultural Studies analysiert. Doch auch der Autor stellt fest, wie sehr der Boulevard „bis jetzt nur ein marginal in ein theoretisches Gerüst gefasster Gegenstand“ sei. Dulinski kam zum gleichen Ergebnis und stellte sogar in Abrede, dass es überhaupt eine repräsentative Forschungsbasis gebe.[106]
In der Tat wurde sogar Bild selten kompetent mit Blick auf die Kommunikatoren untersucht. Die Studien, die explizit zu Bild vorliegen, konzentrierten sich vorrangig auf Inhalte. Zu nennen sind etwa Webers Arbeit über Sexualität in der Zeitung[107], Schirmers und Büschers Analysen der Schlagzeilen[108] oder die Abhandlung von Voss über Emotionalisierung.[109]
Abgesehen von der Beschäftigung mit dem bedeutendsten deutschen Boulevardmedium gibt es wenige wissenschaftliche Arbeiten – meist zu einzelnen Boulevardzeitungen oder singulären Merkmalen: Dazu zählt etwa Dorsch-Jungsbergers Aufsatz „Sensationsjournalismus und Lebensweltparadigma“, in dem die Autorin die Pressegattung als „Unterform von Gefühlskommunikation“ bezeichnet.[110] Des Weiteren sei Dovifats Schrift „Auswüchse der Sensationsberichterstattung“ erwähnt, die Extreme des Boulevardjournalismus’ analysierte,[111] wie es auch Molkenthin-Böhme 23 Jahre später tat.[112] Aus den 1970er-Jahren stammt Langenbuchers und Mahles Arbeit, die „Journalismus (…) nicht zuletzt in Unterhaltung, Rekreation, Entspannung“ definiert sah.[113]
Auch mit dem Aufkommen des boulevardorientierten Privatfernsehens änderte sich – trotz breiterer Untersuchungsgrundlage – wenig. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Unterhaltungsmedien hat sich aus Bohrmanns Sicht sogar verschlechtert – „was die Prominenz der Forscher, die öffentlich zugebilligte Bedeutung der Untersuchungen und die Anzahl angeht“.[114]
Auf der Suche nach den Ursachen finden sich verschiedene Positionen: Die allgemeine wissenschaftliche Missachtung des Genres begründete Saxer damit, dass es meist nicht als eigenes publizistisches System angesehen werde.[115] Es ist zu vermuten, dass das – weil abgeschlossene Untersuchungen damit schwerer sind als etwa bei der Analyse einzelner Ressorts – auf einige Forscher abschreckend gewirkt hat. Auch Böckelmann kommt zu einem solchen Ergebnis.[116]
Außerdem ist das Bild des Genres in der Wissenschaft zu nennen: Unterhaltung und Journalismus – diese Kombination passt für viele Kommunikationstheoretiker offenbar nicht. Harte Nachrichten im massenmedialen System, die ja meist politischer Natur sind, seien strukturell an das politische Funktionssystem gekoppelt, und für beide Systeme ergebe sich eine Art „Win-win-Situation“, führte Luhmann von der systemtheoretischen Warte dazu aus. Unterhaltungsjournalismus dagegen ließe sich strukturell nur an das unscharfe Kunstsystem koppeln. Daher beschäftigte sich Wissenschaft lieber mit (politischem) Nachrichtenjournalismus.[117]
Eine Beschäftigung mit der bisherigen Forschung lässt vermuten, dass die Hauptursache offenbar eine elitär-wissenschaftliche Sichtweise ist, die für den Boulevard oft nur Missachtung übrig hat und Abonnementzeitungen, allen voran überregionale Qualitätszeitungen, bevorzugt. Vorliebe zu Themenkonfigurationen der Hochkulturen“, nannten Bruck und Stocker dieses Phänomen.[118] Damit können Boulevardzeitungen nicht dienen, und so kritisierte schon Adorno – ohne das Genre allerdings explizit zu nennen – die „Träume der Massenkultur als psychologische Störungen“.[119] Saxer bemerkte, dass boulevardeske Berichterstattung an den Universitäten oft „als Verstöße gegen die Norm des Zeitungmachens“ und „als abweichendes publizistisches Verhalten“ gedeutet würde. Dehm legte – vor allem mit Blick auf TV-Inhalte – dar, dass „Unterhaltung (…) als primitives Mittel zur Bewältigung von Lebensproblemen für den weniger intelligenten und gebildeten Bevölkerungsteil“[120] gesehen werde, und auch Gebhardt stellte fest, dass politisch-ästhetische Wertungen die Forscher beeinflusst hätten: „Mit dem Ergebnis, dass (…) Zeitungstypen, denen Seriositäts- und Gesinnungsdefizite attestiert wurden (z.B. Boulevardblätter, Generalanzeiger), in der Forschungsgeschichte deutlich unterrepräsentiert sind“.[121]
Der Boulevard galt und gilt offenkundig vielen als forschungsunwürdig. Diese Arroganz spiegelt sich auch in manchen Begrifflichkeiten: So spricht Ritzer mit Bezug auf das Boulevardgenre von der „McDonaldisierung der Medien“, Nutz nennt die Sprache des Genres „Fortsetzungsmärchen“.[122] Enzensberger polemisiert gar gegen Bild als „Monster aus dem Hause Springer“.[123]
Zu dieser geringschätzigen Einstellung kommen pragmatische Gründe, die eine Erforschung erschweren: Viele Zeitungsarchive verzichten darauf, die Boulevardpresse in ihrer Gesamtheit aufzunehmen, so dass Forscher zumindest bei nicht-aktuellen Studien Probleme mit der Datenbeschaffung bekommen können.
Dennoch ist es als großes Manko der Kommunikationswissenschaft anzusehen, dass – trotz ihrer massenmedialen Bedeutung – die Boulevardmedien bislang derart missachtet wurden. Gesetzt den theoretischen Fall, in ferner Zukunft würden Wissenschaftler anhand der heutigen zeitungswissenschaftlichen Publikationen die Struktur des Pressemarktes analysieren: Ihr erster Eindruck wäre, dass die Boulevardzeitungen unbedeutende Nischenprodukte ohne gesellschaftliche Relevanz gewesen wären.
Ein Forschungsdefizit ist – Bezug nehmend auf das Fallbeispiel dieser Arbeit – auch bei der kommunikationswissenschaftlichen Beschäftigung mit der Verbrechensberichterstattung zu sehen: Zwar findet sich ein ausgiebiger Forschungsgrundstock an Untersuchungen zu Einzelfällen und einzelnen Medien. An Vergleichsstudien zwischen seriösem und Boulevardjournalismus mangelt es jedoch genauso wie an solchen, die allgemeine Aussagen über das Boulevardgenre zulassen. Zu erwähnen ist in jedem Fall die allerdings schon recht alte Arbeit von Schwacke, der beim Vergleich von FAZ und Bild heraus fand, dass sich die Boulevardzeitung nur insofern abhob, als dass sie stärker moralisierte und der Anteil von Kriminalitätsberichterstattung am redaktionellen Gesamtumfang ein höherer, die Faktendarstellung jedoch vergleichbar war.[124] Büscher bestätigte zudem den generellen Eindruck, dass die Sprache in den einschlägigen Berichten der Boulevardpresse brachialer sei.[125]
4. Besonderheiten von Boulevardzeitungen
Ein kurzer Vergleich von AZ, Bild und tz per Augenschein zeigt, wie unterschiedlich die Boulevardzeitungen sind. Daher kann es keinen Katalog an Besonderheiten geben, der für alle Genre-Vertreter gleichermaßen zutrifft. Dennoch lassen sich zahlreiche inhaltliche, grafische, sprachliche und ökonomische Merkmale finden, die typisch sind für Boulevardzeitungen.
4.1. Merkmale der Boulevardpresse
In dieser Arbeit ist es nicht möglich, eine allumfassende Gegenstands- und Zustandsbeschreibung des Genres zu leisten. Die Darstellung seiner Merkmale ist daher auf den Konkurrenzgedanken ausgerichtet und darauf, was die Merkmale über Koorientierung aussagen.
4.1.1. Vorkommen
Boulevardmedien gelten als Phänomen urbanisierter Lebenswelten, denn damit sie gedeihen, müssen eine gewisse Kaufkraft und eine ausreichende Käuferzahl vorhanden sein. „Das Rascheln und Knittern von Papier ist der Grundton der Großstadt“, schrieb Mumford schon 1961.[126] Nur in Städten, wo sich viele Menschen aufhalten, lohnt es, Zeitungskästen aufzustellen. Nur auf belebten öffentlichen Plätzen oder in stark frequentierten Lokalen machen Straßenverkäufer Sinn.
Auch die technischen Produktionsmerkmale verlangen nach einem urbanen Standort. Späte Redaktionsschlusszeiten funktionieren nur, wenn die Masse der Zeitungen in einer begrenzten Region abgesetzt wird. Vorabendausgaben lohnen nur, wenn das Verbreitungsgebiet zu später Stunde noch gut bevölkert ist – was bei einer Großstadt wegen der Berufstätigen und der hohen Bevölkerungsdichte der Fall ist. Auch Sonntags-Ausgaben, wie die AZ sie etwa am Sonntag nach Moshammers Beerdigung veröffentlichte, werden eher in Ballungsräumen wahrgenommen, zumal solche Sonderdrucke meist nicht an Abonnenten ausgeliefert werden.
4.1.2. Format
Wer über das Format einer Zeitung redet, denkst zunächst an die Papiergröße. Das ist jedoch zu kurz gegriffen, worauf schon der Terminus „Format“ bei TV-Sendungen einen Hinweis gibt. Folgt man Bruck/Stocker, gibt es mehrere begriffliche Qualitäten des Formats: Zunächst meint es in der Tat die materielle Größe einer Zeitung, die Fläche an Papier, die der Leser vor sich hat. In der frühen Zeitungsgeschichte waren die Blätter oft ausgesprochen groß, weil eine einheitlich pro Papierseite erhobene Bogensteuer eine große Anzahl von Seiten enorm verteuert hätte. Mit dem Wegfall der Zwangsabgabe im 19. Jahrhundert diversifizierten sich die Formate jedoch. Handlichkeit und Auffälligkeit sind die Pole, zwischen denen Boulevardblätter den geeigneten Weg finden müssen. Mit Ausnahme von Bild sind alle deutschen Formate – auch bei AZ und tz – eher handlich, was die Orientierung und das „Überfliegen“ erleichtert.
Jedoch ist das nur eine Dimension des Format-Begriffs: Die thematische Struktur, inhaltliche Präferenzen und der Stil des Blattes – auch „medial-linguistisches Erscheinungsbild“ genannt[127] – charakterisieren genauso ein Format wie das Vertriebsformat und die Zielgruppe. Versteht man Format in diesem Sinne, nähert sich der Begriff schon der Genre-Klassifikation. Bezogen auf diese Arbeit ist es zum Beispiel eine Format-Frage, wo die Moshammer-Berichterstattung in der Zeitung stattfand – ob, wie bei der tz schon ab Seite drei, die dort den Lokalteil einleitet, oder wie bei der AZ erst ab Seite sieben, weil dort das Lokale anfängt.
4.1.3. Inhalte
Bei Boulevardzeitungen – da ist sich die Forschung einig – steht das vermutete Leserinteresse weit höher als die originäre Bedeutung des Ereignisses. Im Besonderen ist das dort der Fall, wo mehrere Boulevardzeitungen, wie in München, miteinander wetteifern. Uwe Zimmer, einst AZ -Chefredakteur, brachte es – mit Fokus auf den Rezipienten – auf den Punkt: „Im Brennpunkt steht der Konsument, nicht der Produzent.“[128] Es geht um das „Aufspüren von Meldungen, die irgendeine Gefühlsreaktion bei ihren Lesern hervorrufen.“[129] Diese Erkenntnis hatten britische Zeitungsmacher schon im 19. Jahrhundert gewonnen, wie ein anonymer Leitspruch zeigt:
„Tickle the public, make ‘em grin/the more you tickle, the more you’ll win/teach the
public, you’ll never get rich/you’ll live like a beggar and die in a ditch.”[130]
Und wenn der Tag nun einmal keine Sensationen liefert? Für das Genre sei das kein Problem, meint Link. Denn „nicht die Welt produziere die Nachrichten, sondern die Zeitung selbst und gebe diese in bester Autopoiesis (sic!) als Realität aus.“[131] Da das Verkaufen im Vordergrund stehe, richteten sich Inhalt und Form nach dem bestmöglichen Absatz. Inwieweit diesem „Primat der Profitmaximierung die klassische Berufsethik“ geopfert wird, wie es Bruck und Stocker fürchten,[132] versucht diese Arbeit zu beantworten, kann allerdings die ökonomische Komponente nicht untersuchen. Hinweise, dass die Berufsethik leidet, gibt es einige: Achtzig Prozent der Bild -Nachrichten seien erlogen, kritisierte einst der deutsche Fußball-Nationaltorwart Sepp Maier, Sontheimer sprach gar pauschal vom „Lügenblatt“.[133] Und mit Blick auf die tz kommentierte Arnu: Das Blatt „unterbietet (…) gerne jedes Niveau.“[134]
Wissenschaftlich bereits ausführlicher thematisiert worden ist die besondere thematische Struktur, die teilweise wegen fehlender Vielfältigkeit kritisiert wird: „Wer auf die Lektüre (der Boulevardpresse) allein angewiesen ist, würde glauben, das Leben sei eine Kette von Verbrechen, Selbstmorden, Schändungen, Ehebrüchen (…) und Sittlichkeitsverbrechen, knapp verbunden mit einigen Sportrekorden und der Anbetung ihrer Helden.“[135] Allerdings gilt es darauf hinzuweisen, dass Boulevardzeitungen ihren seriösen Mitbewerbern thematisch teilweise auch einiges voraus haben – auch wenn das mit Bereichen wie lokaler Unterhaltung, Klatsch & Tratsch oder Leserservice gesellschaftspolitisch eher nachrangige Themenfelder sind.
Das Primat der Unterhaltung
„Die Abo-Zeitung will den Kopf des Lesers erreichen,
die Boulevardzeitung den Bauch.“[136]
Wie dominant der Unterhaltungsaspekt ist, zeigt sich am besten bei der Blattstruktur des Genres: Die Schlagzeile, auf die später noch näher einzugehen ist, wird vor allem mit Unterhaltungsthemen bestritten. Dem Autor ist bekannt, dass er dies nicht empirisch belegt hat, jedoch dürfte diese Aussage jeder Überprüfung Stand halten.
Am Beispiel von tz und Bild-München könnte an dieser Stelle gezeigt werden, dass dem Unterhaltungsteil sowie den Rätsel-/Ratgeber-Seiten mehr Platz eingeräumt wird als Politik und Kultur. In Bild-München nehmen sogar Cartoons und Witze gemeinsam meist mehr Platz ein als das oft zum „Kulturstück“ geschrumpfte Feuilleton. Die Hierarchie der Ereignisse nach Wichtigkeit und Wertigkeit sei abgeschafft, notierte Löffler zu dem Thema: „Alles ist bunter Lärm.“[137]
Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das Unterhaltungsprimat schon in den frühesten Boulevardzeitungen Bestand hatte: Bereits in der ersten Ausgabe der Wiener Kronen Zeitung, die als ein Wegbereiter des modernen Boulevardjournalismus gilt, schrieb der Herausgeber und Chefredakteur Gustav Davis am 2. Januar 1900: „In jeder einzelnen Ausgabe des Blattes muss das Wiener Gemüt, muss österreichischer Frohsinn zum Ausdruck kommen.“[138]
Wie sehr die Politik gegenüber der Unterhaltung in den Hintergrund rückte, beschrieb Müller anhand der Anfangszeit von Bild: „Wäre ein Historiker späterer Jahrhunderte auf die ersten sechs Jahrgänge der ,Bild’-Zeitung als einzige Quelle angewiesen, so könnte er die wichtigsten innen- und weltpolitischen Ereignisse kaum (…) rekonstruieren; sie kamen zum großen Teil gar nicht vor.“[139] Dittrich erklärte das mit dem Ziel der Zeitung: „Die Bild-Zeitung der Gründerjahre (…) war im wesentlichen darauf bedacht, ihre Leser zu unterhalten.“[140] Der Fall Moshammer passt dementsprechend genau ins Kern-Themengebiet des Genres, was ein Hauptargument dafür ist, an ihm Konkurrenzstrategien zu untersuchen – zumal er auch noch eine zweite zentrale Domäne des Boulevards betrifft: die Lokalberichterstattung.
Das „Lokale Prinzip“
Denn wie bereits erwähnt, ist das Lokalressort traditionell das wichtigste Ressort – vor allem für Boulevardzeitungen, allgemein aber auch für Abozeitungen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben das belegt, etwa die Langzeituntersuchung „Massenkommunikation V“ von Berg/Kiefer.[141] Das Allensbach-Meinungsforschungs-Institut kommentierte schon 1998 in einem Jahresbericht zum Informationsverhalten, dass „ein Ergebnis über Jahrzehnte unerschütterlich“ sei: „Das Lokale steht in der Gunst der Leser ganz oben.“[142] Das ist ein zentraler Grund dafür, dass in den Münchner Zeitungen die Moshammer-Berichterstattung so intensiv ausfiel.
In Zukunft, so weit herrscht wissenschaftlicher Konsens, werden Ereignisse, die sich im direkten Umfeld des Lesers abspielen, sogar noch wichtiger, eben wegen des konkreten Bezugs zum Rezipienten. „Heimat stiften in einer atomisierten Welt könnte in Zukunft eine noch ausbaufähige Hauptaufgabe der Tageszeitungen sein.“[143]
Der ehemalige AZ -Chefredakteur Zimmer entließ seinen Stellvertreter Arno Luik 1997 mit der Begründung: „Wir sind eine lokale Zeitung, die keinen Platz hat für Leute, die auf der lokalen Ebene mangelnd (sic!) qualifiziert sind.“tz -Verleger Dirk Ippen begründete die Trennung von Chefredakteur Thomas Dobernigg 1998 damit, dass die „betont münchnerisch-bayerische Linie der tz nicht (…) ausreichend gesichert“ gewesen sei.[144] Und der neue AZ -Chefredakteur Michael Radtke formulierte bei seinem Antritt 2005, dass man auf dem Münchner Zeitungsmarkt am ehesten mit lokaler Kompetenz reüssieren könne. Diese Aussagen erklären, wieso der Konkurrenzkampf im Lokalen – was noch gezeigt werden wird – am stärksten ist.
Bedeutung von Sex & Crime
Wie originär dieses Themen-Duett – aus Sicht der Redaktionen natürlich am liebsten in direkter Verbindung – für das Genre ist, zeigt sich am besten daran, dass Sex & Crime-Journalismus sogar schon ein Synonym für Boulevardberichterstattung ist. „Die menschheitsgeschichtlich alten Zonen der Begierde“ hat Renger in der Sexualitäts- und Kriminalitätsberichterstattung ausgemacht.[145] Die Jagd nach entsprechenden schlagzeilenverdächtigen Nachrichten nimmt zweifelsfrei teils bedenkliche Züge an: „Die Hatz nach den tränenrührenden Zitaten der Mutter eines Mordopfers oder den Kinderfotos des Mörders gerät zum sportiven Abenteuer. Du bist im Blutrausch“, formulierte es die frühere Bild -Volontärin Sabine Rückert, ein Münchner Kollege von ihr gab zu: „Man stumpft ab angesichts des ganzen Elends und verliert auf Dauer jegliche Sensibilität.“[146]
Für die Zeitungen bedeuten solche Themen jedoch Auflage, so dass sie immer wieder viel Platz im Blatt finden und zu den essentiellen Inhalten des Genres zählen. Da der Mordfall Moshammer beides verbindet – die Kriminalität in Form des Mordes, den Sex in Form der Homosexualität des Opfers und des Geschlechtsaktes mit dem späteren Mörder vor der Tat – ist er als urtypische Boulevardgeschichte besonders gut für die Forschung geeignet.
4.1.4. Leser-Blatt-Bindung
„Unser wirklicher Chefredakteur (…) ist der Leser.
Er weiß es nicht, aber seine Wünsche sind für uns bestimmend.“[147]
Dieses Postulat verfasste die österreichische Kronen Zeitung bereits im Jahr 1900 und gilt daher in Europa als eines der ersten Medien, die sich explizit dem Thema Leser-Blatt-Bindung verschrieb. Wer diese insgesamt als erster systematisch praktizierte, ist nicht klar: Schon bei den Illustrated Daily News, einer der ersten Boulevardzeitungen der USA, hieß es im 19. Jahrhundert im Impressum: „This newspaper, we suppose, is an example of what happens when masses which can read find something they like to read.“[148]
Am Grundgedanken hat sich nichts geändert: Bild schwingt sich heute zur „Stimme des Volkes“ auf, indem es ausgesuchte Leser direkt zitiert und aus deren Statements allgemeine Forderungen oder Anklagen konstruiert. Deren Tenor orientiert sich in der Regel an der Mehrheitsmeinung, um bestmöglichen Absatz zu erreichen Es geht eben darum, „emotionale Adäquanz“[149] zu schaffen, also keine Wertkonflikte zwischen Medieninhalten und Rezipient aufkommen zu lassen. Dieser Gedanke ist an die Theorie der Kognitiven Dissonanz[150] angelehnt, wonach Mediennutzer solche Inhalte bevorzugen und eher behalten, die sich mit bestehenden Einstellungen decken.
Wichtiger denn je ist heute – in Zeiten immer stärkerer Konkurrenz – das Schreiben für den Leser. Bei Bild geht es darum, über Inhalt und Wortwahl ein Wir-Gefühl aufzubauen, das zur Verbündung von Leser und Zeitung gegen alles Feindliche und Fremde einlädt. Der gleichsam empörte Leser wähne sich im Besitz der Macht, analysierten Bruck und Stocker, weil er zu den Guten gehöre und die Anderen, besonders gerne die Mächtigen, durch Verachtung strafen könne.[151] Gerade Deutschlands größtes Boulevardblatt versucht, durch dieses Wir-Gefühl die Käufer der Zeitung langfristig zu binden. Die Maxime von Bild -Chefredakteur Kai Diekmanns lautet daher: „Bild liebt den Leser. Bild ist sein bester Freund.“[152] Voss nennt diese Strategie „Pseudo-Dialogizität“.[153] Im Fall Moshammer verfolgten vor allem AZ und Bild-München die Stärkung der Leser-Blatt-Bindung in besonderem Maße, wie noch zu zeigen ist.
4.1.5. Das Erscheinungsbild
„Das“ typische Erscheinungsbild eines Boulevardmediums gibt es genauso wenig, wie es „die“ Boulevardzeitung gibt. Das lässt sich nicht nur anhand der Inhalte dokumentieren, sondern auch daran, wie die Zeitungen aussehen. Hieß es früher oft, Boulevard sei das, wo riesige Überschriften prangten, so ist diese Aussage bei differenzierter Betrachtung zurückzuweisen: Hamburger Morgenpost und Bild sind zweifelsfrei beides Blätter des gleichen Genres, doch verhindert allein das nur etwas halb so große Format der Morgenpost, dass sie gleichermaßen mit überdimensionierten Lettern in der Schlagzeile wuchert wie Bild. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Layout-Kriterien, die boulevardtypisch sind: Waren Zeitungen ursprünglich mal schwarz auf weiß gedruckt, sind heute gerade bei Boulevardzeitungen Farben nicht mehr wegzudenken. Farbige Fotos sind die eine Seite, farbliche Elemente im Layout und Text die andere. Zentral ist dabei die Farbe rot. Denn rot sticht gegenüber anderen Farben deutlich hervor, kann Spannung und Angst darstellen. Es wird gerne bei Katastrophen, Feuer, Gefahr, aber auch bei Liebe eingesetzt.
Weitere Kriterien sind eine Abkehr vom typischen, aus den Abonnementzeitungen bekannten Ordnungsprinzip, die bunte Mischung verschiedenster Themen auf einer Seite, grafische Elemente wie Kästen, Unterstreichungen und Blickfänger in Form eingeklinkter Zitate. „Optische Opulenz“ hat Schirmer diesen Boulevardstil genannt, dessen Ziel – der Profitmaximierungsstrategie folgend – „maximale Verkäuflichkeit“ sei.[154] Die Konsequenz daraus ist eine nahe liegende, nämlich „der vorrangige Einsatz solcher Gestaltungsmittel, die auf die Erregung von Reiz, Spannung und Emotion abzielen“.[155] Inwieweit die Münchner Boulevardzeitungen das Layout gezielt einsetzen, soll in dieser Arbeit geklärt werden.
Bildorientierung
Ein wichtiger Aspekt der optischen Gestaltung ist die Bildorientierung: Bis ins 19. Jahrhundert waren es vor allem Holzschnitte, Drucke oder auch Zeichnungen, die Zeitungen zur Illustration, als Blickfang und zur Steigerung der Authentizität nutzten. Erst die fotomechanische Rastertechnik machte Fotos ab 1880 für Printmedien nutzbar. Spätestens, seitdem in den 1920er-Jahren handlichere Kameras aufkamen, waren Bilder nicht mehr wegzudenken. Das galt vor allem für die Boulevardblätter mit ihrem (tele)visuellen Anspruch. Axel Springer erklärte die Bildorientierung in seiner Zeitung einmal damit, dass „Bild die gedruckte Antwort auf das Fernsehen“ sei.[156]
Der Daily Mirror, eine der ersten Boulevardzeitungen, reüssierte laut Henning sogar vor allem aufgrund von Bildorientierung und insbesondere wegen der aktuellen Bilder.[157] Schirmer verallgemeinerte die These sogar und geht davon aus, dass „der Aufstieg der Boulevardpresse (…) eng mit Innovationen auf dem Gebiet der Illustration verbunden ist“.[158]
Auch die intensive Moshammer-Berichterstattung (vor seinem Tod) sei in gewisser Weise mit boulevardesker Bildorientierung zu erklären, vermutet Marzahn. Sie führt die Vielzahl der Berichte über Moshammer unter anderem darauf zurück, dass er wegen seines auffälligen Äußeren gerne auch ein reines Fotoobjekt darstellte, das ohne aktuelle Relevanz abgebildet wurde.[159] In der Inhaltsanalyse dieser Arbeit wurde daher in besonderem Maße auf den Einsatz von Bildern geachtet und wurden Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitungen herausgearbeitet.
Die Schlagzeile
Der Begriff Schlagzeile stammt ursprünglich vom „Schlagwort“ ab. In der Frühzeit der Pressegeschichte stand ein solches Wort am Anfang jedes gedruckten Zeitungstextes. In der Regel handelte es sich um Datums- oder Ortszeilen ohne inhaltliche Bezüge. Schlagzeilen in Form von Überschriften gab es lange nicht, weil Zeitungsseiten wie Bücherseiten gestaltet waren, einspaltig umgebrochen und kaum mit grafischen Elementen aufgelockert. Erst im 19. Jahrhundert wurde aus dem Wort am Textanfang ein halber Satz, eine Zeile und schlussendlich die Schlagzeile. Die ersten Zeitungen, die sie konsequent einsetzten, waren die US-Blätter von William R. Hearst, zuvorderst das New Yorker Morning Journal. In der Wissenschaft verwendete Wehle den Begriff 1878 erstmals in seinem Buch „Die Zeitung“.[160] In fast allen Fällen ist die Schlagzeile die Überschrift des Aufmachers, also des Artikels, der nach Ansicht der Redaktion am prominentesten auf der Titelseite verkauft werden muss.
Lange war die erste Zeitungsseite politischen Nachrichten vorbehalten. Diese Maxime findet sich heute bei keinem dem Autor bekannten Blatt mehr, selbst überregionale Tageszeitungen wählen ihr Hauptthema manchmal aus den Ressorts Vermischtes oder Sport. Bei Boulevardzeitungen sind politische Themen auf der ersten Seite sogar eine Ausnahme. Ihre Aufschlagseite nimmt mit einem ressortübergreifenden Nachrichten-Mix eine Art Schaufenster-Funktion ein. Daher bedürfe es, „wenn Sie eine blutige Zeile haben, (…) noch etwas Witziges oder Weiches“, zitiert Sontheimer den ehemaligen Stellvertretenden Bild -Chefredakteur Paul C. Martin.[161]
[...]
[1] Kleber/Aschoff (2005): S. 8.
[2] Vgl.: Reinemann (2003): S. 252.
[3] Vgl.: Marzahn (2002).
[4] LaRoche (1984): S. 61.
[5] Die Formulierung stammt von Ben Bradlee, ehemals Chefredakteur der Washington Post. Zitiert nach: Boyd (1988): S. 3.
[6] zitiert nach: LaRoche (1984): S. 61.
[7] Dorsch-Jungsberger/Roegele/Stolte (1985): S. 280.
[8] Vgl.: Fricke (1992): S. 27.
[9] Vgl.: Lippmann (1922).
[10] Lippmann (1990): S. 230.
[11] Vgl.: Staab (1990): S. 27f. Da Gatekeeper- und News-Bias-Forschung in dieser Arbeit keine Rolle spielen, seien sie hier nur am Rande erwähnt.
[12] Vgl.: Merz (1925): S. 156ff.
[13] Vgl.: Östgaard (1965).
[14] Vgl.: Galtung/Ruge (1965): S. 64
[15] Galtung/Ruge (1965): S. 65.
[16] Vgl.: Eilders (1997) und Schulz (1976).
[17] Vgl.: Westerstahl/Johansson (1986).
[18] Vgl.: Rosengreen (1970).
[19] Vgl.: Schulz (1976): S. 28.
[20] Eilders (1997): S. 34.
[21] Schulz (1976): S. 117.
[22] Vgl.: Staab (1990): S. 96.
[23] Darauf wies schon Wilke (1984) hin.
[24] Wilke (1984): S. 234.
[25] Wissenschaftlich ist diese Massenpanik allerdings nicht belegt.
[26] der Stimulus
[27] In der Biologie diente das Modell ursprünglich zur Erklärung von bewussten oder unbewussten Reflexen im Sinne eines Reiz-Reaktions-Schemas. Der Reiz ist der Stimulus, der auf einen Empfänger trifft. Dieser reagiert mit einer Reaktion (Stimulus-Response).
[28] Vgl. auch: Schulz (1990): S. 33.
[29] Vgl.: Früh/Schönbach (1982): S. 74 – 82.
[30] Vgl.: Fricke (1992): S. 44.
[31] Fricke (1992): S. 58.
[32] In Inhaltsanalysen und einer Befragung verglichen beide, welche Themen in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung dominierten. Demnach bestand zwischen Medien- und Publikumsagenda eine Korrelation von mehr als 90Prozent. Allerdings wurden der Studie später methodische Mängel vorgeworfen.
[33] McCombs/Shaw (1972): S. 177.
[34] Maletzke (1983): S. 118.
[35] zitiert nach: Rössler (1997): S. 23.
[36] Vgl.: Bonfadelli (2004), Bonfadelli (2004a), Jäckel (2005), Rössler, (1997) und Schenk (2002).
[37] Stieler (1969/1695): S. 165.
[38] zitiert nach: Dulinski (2003): S. 106.
[39] Es gibt auch Quellen, die den Namen mit Johann Peter von Ludwig angeben.
[40] Ludewig (1795): S. 89.
[41] Zedler (1994/1749): S. 104.
[42] Vgl. Schatz (1995) oder Weber (2000).
[43] Reinemann (2003).
[44] am Beispiel der Berichterstattung über aktuelle Bundespolitik
[45] Vgl.: Reinemann (2003): S. 294.
[46] Donsbach (1981): S. 237.
[47] Vgl.: Kepplinger (1985): S. 19f.
[48] Vgl.: Jarren/Donges (1996): S. 98.
[49] Gallmann (1998): S. 94.
[50] Vgl.: Reinemann (2003): S. 110.
[51] Vgl.: Schenk/Sonje (1998): S. A7.
[52] Schulz/Kindelmann (1993): S. 13
[53] Luhmann (1997): S. 1107.
[54] Reinemann (2003): S. 296.
[55] Shoemaker/Reese (1991): S. 161.
[56] Vgl.: Reinemann (2003): S. 289.
[57] Satinsky (2000): S. 2.
[58] Vgl.: Meyer (1983): S. 10.
[59] Vgl.: Grimm (1992): S. 58 – 61.
[60] zitiert nach: Renger (2000): S. 19.
[61] Vgl.: Bollinger (1996).
[62] Vgl.: Sparks (1996).
[63] Vgl.: Renger (2000): S. 14ff.
[64] Vgl.: Sparks (1998): S. 6f.
[65] Renger (2000): S. 433.
[66] Vgl.: Hummel (1991): S. 192.
[67] Bruck/Stocker (1996): S. 11.
[68] Haller (1995): S. 9.
[69] Adler (2003): S. 6.
[70] Koszyk/Pruys (1973): S. 61.
[71] Melodramatisierung meint die Zuspitzung (meist) menschlicher Tragödien und das Anspielen auf das Schicksal, dem alles unterworfen ist. Sie soll den Leser berühren, indem sie seine Angstlust anspricht.
[72] zitiert nach: Dulinski (2003): S. 92.
[73] Meyn (1999): S. 111.
[74] Als „Stumme Verkäufer“ werden Zeitungskästen bezeichnet. Sie sind unterteilt in so genannte Vollautomaten, bei denen sich erst nach Zahlung des entsprechenden Betrages eine Klappe öffnet und eine Zeitung entnommen werden kann. Bei Halbautomaten hat der Käufer – nach Zahlung des entsprechenden Betrages – Zugriff auf alle Zeitungen im Kasten. Offene Geräte haben zum Geldeinwurf einen Schlitz am Kasten, doch kann die Zeitung de facto auch ohne Bezahlung entnommen werden. Zur Zahlkontrolle werden einzelne Geräte überwacht.
[75] Der Straßenverkauf teilt sich auf in den Absatz an Zeitungskästen („Stumme Verkäufer“) und bei Verkäufern, die bereits am Vorabend die aktuelle Ausgabe in Kneipen, Biergärten und an zentralen Verkehrspunkten anbieten.
[76] Vgl.: Schneider/Raue (1998): S. 260.
[77] Sogar der als besonders konservativ geltende Münchner Merkur stellt inzwischen manche Fotos frei.
[78] Pürer/Raabe (1996): S. 173.
[79] Reinemann (2003): S. 3.
[80] Reinemann (2003): S. 5.
[81] Klingemann/Klingemann (1983): S. 24.
[82] Pürer/Raabe (1996): S. 174.
[83] Streck (2000): S. 44.
[84] Streck (2000): S. 29.
[85] Vgl.: Meyn (1990): S. 70.
[86] Vgl.: Brand/Schulze (1983): S. 32ff.
[87] Diese Zahlen basieren – genauso wie die folgenden in diesem und im nächsten Absatz – auf der Auflistung der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW).
[88] Der Vertrieb von Abo- und Boulevardzeitungen wird detailliert bei Ossorio-Capella (1972) dargelegt.
[89] Straßner (1999): S. 839.
[90] Weischenberg (1995): S. 237.
[91] Fricke (1992): S. 6.
[92] Vgl.: Reinemann (2003): S. 255f.
[93] siehe Kapitel 4.1.5.
[94] zitiert nach: Dulinski (2003): S. 11. Vgl. auch: Lippert (1953).
[95] Saxer/Bonfadelli/Hättenschwiler (1979): S. 1.
[96] Vgl.: Haller (1984): S. 54.
[97] Vgl.: Pawek (1965).
[98] Vgl.: Hennig (1999): S. 955ff.
[99] Vgl.: Schneider/Raue (1998).
[100] Vgl.: Weischenberg/Löffelholz/Scholl (1994a).
[101] Vgl.: Schneider/Schönbach/Stürzebecher (1993) und Schneider/Schönbach/Stürzebecher (1994).
[102] Vgl.: Malik (2005). S.1 – 4.
[103] Vgl.: Weischenberg (2006): S. 10 – 18.
[104] Weischenberg (1992), Weischenberg (1995), Weischenberg/Kriener (1998).
[105] Vgl. vor allem: Weischenberg (1992): S. 169 sowie S. 268f.
[106] Vgl.: Dulinski (2003): S. 171.
[107] Weber (1978).
[108] Schirmer (2000) und Büscher (1996).
[109] Voss (1999).
[110] Dorsch-Jungsberger (1993): S. 391.
[111] Vgl.: Dovifat (1930).
[112] Vgl.: Molkenthin-Böhme (1953).
[113] Langenbucher/Mahle (1975): S. 12.
[114] Bohrmann (1999): S. 148.
[115] Saxer/Bonfadelli/Hättenschwiler (1979): S. 2.
[116] Vgl.: Böckelmann (1993).
[117] Vgl.: Luhmann (1996): S. 117ff.
[118] Bruck/Stocker (1996): S. 10.
[119] zitiert nach: Frith (1981): S. 79.
[120] Dehm (1984): S. 630.
[121] Gebhardt (1999): S. 885.
[122] zitiert nach: Renger (2000): S. 425.
[123] Enzensberger (1991): S. 78.
[124] Vgl.: Schwacke (1983).
[125] Vgl.: Büscher (1996): S. 198ff.
[126] Mumford (1961): S. 639.
[127] Bruck/Stocker (1996): S. 12.
[128] Zimmer (2000): S. 6.
[129] Zimmer (1994): S. 4.
[130] Der Reim gilt als „Fleet-Street-Motto“, bezogen auf die Straße, in der traditionell Londons Tagespresse sitzt.
[131] Link (1986): S. 229.
[132] Bruck/Stocker (1996): S. 18.
[133] Sontheimer (1995): S. 41.
[134] Arnu (1997): S. 16.
[135] Dovifat (1930): S. 24.
[136] Schirmer (2001): S. 23.
[137] Löffler (1997): S. 17.
[138] Dichand (1977): S. 17.
[139] Müller (1968): S. 77f.
[140] Dittrich (1977): S.13.
[141] Berg/Kiefer (1995): S. 213.
[142] Schneider/Raue (1998): S. 257.
[143] Metz (1998): S. 11.
[144] Ippen (1998): S. 29
[145] Renger (2000): S. 403.
[146] Sontheimer (1995): S. 41.
[147] Dichand (1977): S. 17.
[148] Hughes (1981): S. 225.
[149] Vgl.: Büscher (1996): S. 98ff.
[150] Vgl.: Festinger (1973).
[151] Vgl.: Bruck/Stocker (1996): S. 29.
[152] zitiert nach: Adler (2003): S. 21.
[153] Voss (1999): S: 87. Vgl. zum Phänomen der Vereinigung von Zeitung und Leser: Straßner (1999): S. 116f.
[154] Schirmer (2001): S. 11f.
[155] Henning (1999): S. 955f.
[156] zitiert nach: Hennig (1999): S. 959.
[157] Vgl.: Hennig (1999): S. 957.
[158] Schirmer (2001): S. 26.
[159] Vgl.: Marzahn (2002): S. 73.
[160] Vgl.: Wehle (1883).
[161] Sontheimer (1995): S. 38.
- Arbeit zitieren
- Timm Rotter (Autor:in), 2006, Konkurrenzstrategien von Boulevardzeitungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76767
Kostenlos Autor werden




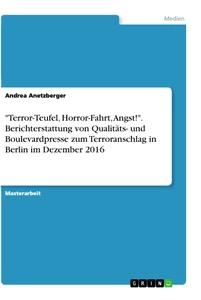






Kommentare