Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Methodik
1.2 Begriffsabgrenzungen
1.2.1 Makroökonomik
1.2.2 Wachstum oder Entwicklung
1.2.3 Subsaharisches Afrika
2. Wachstumspolitik
2.1 Wachstumsprozess
2.1.1 Wachstum und Wohlfahrt
2.1.2 BNE als Messinstrument
2.1.3 Eigenschaften des Wachstumsprozesses
2.2 Wachstumstheorien
2.2.1 Das neoklassische Modell
2.2.2 Fazit
2.3 Instrumente der Wachstumspolitik
2.3.1 Investitionspolitik
2.3.2 Arbeitsmarktpolitik
2.3.3 Bildungs- und Forschungspolitik
2.3.4 Außenhandelspolitik
2.3.5 Wettbewerbspolitik und marktsubsidiäre Instrumente
2.4 Zusammenfassung
3. Ungleichheitsberechnung
3.1 Definition von Ungleichheit und Ungleichheitsberechnung
3.2 Messinstrumente
3.3 Datengrundlagen
3.4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen
4. Analyse des Wirtschaftswachstums
4.1 Botsuana
4.1.1 Wirtschaftsgeschichte
4.1.2 Wachstumspolitik
4.1.2.1 Investitionspolitik
4.1.2.2 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
4.1.2.3 Außenhandelspolitik
4.1.2.4 Wettbewerbspolitik
4.1.3 Zusammenfassung
4.2 Nigeria
4.2.1 Wirtschaftsgeschichte
4.2.2 Wachstumspolitik
4.2.2.1 Investitionspolitik
4.2.2.2 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
4.2.2.3 Außenhandelspolitik
4.2.2.4 Wettbewerbspolitik
4.2.3 Zusammenfassung
4.3 Simbabwe
4.3.1 Wirtschaftsgeschichte
4.3.2 Wachstumspolitik
4.3.2.1 Investitionspolitik
4.3.2.2 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
4.3.2.3 Außenhandelspolitik
4.3.2.4 Wettbewerbspolitik
4.3.3 Zusammenfassung
4.4 Südafrika
4.4.1 Wirtschaftsgeschichte
4.4.2 Wachstumspolitik
4.4.2.1 Investitionspolitik
4.4.2.2 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
4.4.2.3 Außenhandels- und Wettbewerbspolitik
4.4.3 Zusammenfassung
5. Zusammenfassung
5.1 Investitionspolitik
5.2 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
5.3 Außenhandelspolitik
5.4 Wettbewerbspolitik
5.5 Fazit
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Anhang 4
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bruttokapitalbildung und Sparquote Botsuanas von 1966 bis 1990 (Quelle: WDI 2004)
Abbildung 2: Vergleich der Spar- und Konsumquoten zwischen Botsuana und Nigeria im Zeitraum von 1986 – 2000 (Quelle: WDI 2004)
Abbildung 3: Wachstumsprognosen des IWF für Botsuana mit und ohne AIDS
Abbildung 4: Entwicklung von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in Nigeria von 1990-2000 (Quelle: WDI 2004)
Abbildung 5: Wert der Produktion des Agrarsektors Simbabwes von 1994 bis 2005 in konstanten 1990 Z$ 1000
Abbildung 6: Aufteilung der Gesamtausgaben Südafrikas (Quelle: WDI 2004)
Abbildung 7: Vergleich von Sparquote und Bruttokapitalbildung zwischen Südafrika und den Tigerstaaten im Zeitraum 1990 – 2002 (Quelle: WDI 2004)
Abbildung 8: Offizieller Wechselkurs Rand/USD von 1990 bis 2004
Abbildung 9: Entwicklung der Ungleichheit der PKE von 1975-2000
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Disproportionalitätsfunktionen der Ungleichheitsindizes (Quelle: Firebaugh [2003, 77])
Tabelle 2: Ergebnisse der Ungleichheitsberechnung des Untersuchungsraums A
Tabelle 3: Ergebnisse der Ungleichheitsberechnung des Untersuchungsraums B
Tabelle 4: Makroökonomische Indikatoren Nigerias 1980 und 1988 (Quelle WDI 2004)
Tabelle 5: Übersicht der Daten im Untersuchungsraum A für 1975 (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 6: Übersicht der Daten im Untersuchungsraum A für 2000 (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 7: Übersicht der Daten im Untersuchungsraum B für 1975 (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 8: Übersicht der Daten im Untersuchungsraum B für 2000 (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 9: Bestandteile der Formel (9)
Tabelle 10: Übersicht der Daten zum PKE (USD, Atlasmethode) und zur Gesamtbevölkerung im Untersuchungsraum B im Zeitraum von 1975-2000 (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 11: Länder, deren Kriterienausprägung eine Untersuchung als mögliches positives Beispiel zulässt (Quelle: WDI 2004)
Tabelle 12: Länder, deren Kriterienausprägung eine Untersuchung als mögliches negatives Beispiel zulässt (Quelle: WDI 2004)
1. Einleitung
Nach der großen Zeit der meist erfolgreichen Unabhängigkeitsbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent hatten viele Menschen in und außerhalb Afrikas die Hoffnung, dass sich mittelfristig der Lebensstandard der Menschen dem der westlichen Welt annähert. In den 1960er und 1970er Jahren schien es auch so, als ob dieses Ziel binnen weniger Jahre erreicht werden könnte. In den 80er und 90er Jahren zerfielen diese Hoffnungen jedoch wieder. Das Pro-Kopf-Einkommen[1] (PKE) vieler Länder fiel vor allem in der letzten Dekade des 20. Jh. teilweise unter das Niveau der 60er Jahre. Mittlerweile ist Afrika ein Synonym geworden für Kriege, Seuchen, Völkermorde, Armut und Hungersnöte. In Anlehnung an den großen Roman von Joseph Conrad wird es heutzutage vielfach auch als „Herz der Finsternis“ bezeichnet. Dabei übersehen viele, dass in den letzten Jahrzehnten durchaus auch positive Entwicklungen stattgefunden haben. Einen großen Anteil an dieser Tendenz tragen jedoch die internationalen Medien. Eifrig transportieren sie schlechte Nachrichten aus Afrika, während sie gleichzeitig positive Beispiele weitestgehend ignorieren. So entsteht in der Bevölkerung der westlichen Welt das Bild eines hoffnungslosen Kontinents, der ewig in der Armutsfalle gefangen bleiben wird. Diese Arbeit unternimmt den Versuch, einen objektiveren Blick auf das Wirtschaftswachstum der afrikanischen Staaten in den letzten Jahrzehnten zu werfen. Es sollen diejenigen makroökonomischen Faktoren identifiziert werden, die für das Wachstum des subsaharischen Afrika maßgeblich sind. Zwangsläufig wird diese Untersuchung vor dem Hintergrund zweier Ausprägungen stattfinden:
- Einerseits wird der Fokus auf bekannten und allgemein übertragbaren makroökonomische Funktionsweisen liegen, welche das Wachstum beeinflussen und
- Andererseits müssen spezifisch afrikanische Rahmenbedingungen und Verhältnisse und deren Auswirkungen auf das Wachstum der Volkswirtschaften in die Untersuchung mit einbezogen werden.
Mit Blick auf den zweiten Punkt ist es wichtig zu betonen, dass der Fokus der Arbeit nicht allein auf der Identifikation der wachstumsrelevanten, makroökonomischen Faktoren liegt. Um ein möglichst realitätsnahes Modell zu entwickeln, müssen die wachstumspolitischen Entscheidungen und Hintergründe in die Untersuchung mit einbezogen werden, die maßgeblichen Einfluss auf die Ausprägung der Faktoren haben. Aus diesem Grund reicht es beispielsweise nicht, eine niedrige Inflationsrate als wachstumsstimulierend zu identifizieren. Der Wert des Ergebnisses steigt entscheidend, wenn gezeigt werden kann, welche wachstumspolitischen Entscheidungen und welche makroökonomischen Hintergründe die Entwicklung der Inflationsrate zwingend beeinflusst haben. Durch diesen Ansatz kann ein Modell aufgestellt werden, welches annähernd allgemein übertragbar für das subsaharische Afrika ist. Ein vollständig übertragbares Modell aufzustellen, ist auf Grund der regionalen und nationalen Unterschiede unmöglich. Der Fokus sollte demzufolge auf einem möglichst hohen Annäherungsgrad liegen.
1.1 Methodik
Die Vorgehensweise dieser Arbeit basiert auf einem zweistufigen Vorfahren. In einem ersten Schritt wird der Wert der Ungleichheit zwischen den PKE der Länder für 1975 und 2000 berechnet. Durch dieses Verfahren kann ermittelt werden, ob das Wachstum der PKE der afrikanischen Staaten konvergent oder divergent verlaufen ist. Je nach Ergebnis der Berechnung werden anschließend vier Länder ausgewählt, die repräsentativ für die ermittelte Entwicklung der Ungleichheit sind. In einem zweiten Schritt erfolgt darauf aufbauend die Identifikation der wachstumsrelevanten, makroökonomischen Faktoren der jeweiligen Staaten. Um die Entwicklung dieser Faktoren zu verstehen, ist es notwendig, auf die wachstumspolitischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Hintergründe einzugehen, die direkt oder indirekt diese Faktoren und somit das Wachstum beeinflusst haben. Aus diesem Grund erfolgt vor der eigentlichen Wachstumsanalyse eine kurze Vorstellung der Wirtschaftsgeschichte. Aufgrund dieses zweistufigen Vorgehens gliedert sich die vorliegende Arbeit wie folgt. Nachdem im Kapitel 2 die Grundlagen der Wachstumspolitik und das gewählte Modell vorgestellt werden, widmet sich Kapitel 3 der Ungleichheitsberechnung und der Identifizierung der zu untersuchenden Staaten. Die Vorstellung der Wirtschaftsgeschichte und die Analyse des Wachstums erfolgt daraufhin in Kapitel 4. Im abschließenden Kapitel 5 wird in wachstumspolitisches Modell aufgestellt, welches auf andere Staaten des subsaharischen Afrika übertragen werden kann.
1.2 Begriffsabgrenzungen
Bevor mit den Erläuterungen zu den wachstumstheoretischen Grundlagen fortgefahren werden kann, müssen an dieser Stelle erst einige Begriffe geklärt werden, um das Verständnis dieser Arbeit zu erleichtern.
1.2.1 Makroökonomik
Makroökonomik ist die Untersuchung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung einer Volkswirtschaft (Sachs [1995, 1ff.)]. Sie baut auf den Erkenntnissen der Mikroökonomik auf. Letztere befasst sich mit den individuellen Entscheidungen von Unternehmen und Haushalten und ihrer Interaktion auf den Märkten. Diese fällen täglich millionenfach Entscheidungen, welche die gesamte Volkswirtschaft beeinflussen. Die Makroökonomik versucht, mittels repräsentativer Unternehmen oder Haushalte solche Entscheidungen oder Aktivitäten zu verallgemeinern. In einem ersten Schritt wird untersucht, wie sich ein solches typisches Unternehmen oder solch ein typischer Haushalt im Kontext der Gesamtwirtschaft verhält und welche Auswirkungen sein Verhalten hat. In einem zweiten Schritt werden diese Daten zu volkswirtschaftlichen Schlüsselvariablen, wie Inflationsrate, Arbeitslosenquote oder Konsumquote aggregiert. Durch die Untersuchung der Interdependenzen zwischen den Schlüsselvariablen und ihrer Funktionsweisen versucht die Makroökonomik, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen.
Im Fokus dieser Arbeit stehen die aggregierten, volkswirtschaftlichen Schlüsselvariablen und die Auswirkungen ihrer Funktions- und Verhaltensweisen auf das Wirtschaftswachstum. Diese Betrachtung erfolgt sowohl unter Beachtung der allgemeinen makroökonomischen Regeln als auch unter Berücksichtigung der spezifisch afrikanischen Verhältnisse.
1.2.2 Wachstum oder Entwicklung
Die Begriffe „Wachstum“ und „Entwicklung“ werden in der Literatur häufig unterschiedlich verwendet. Wachstumstheorie und Wachstumspolitik wird meist als begrenzt auf Industrieländer und auf die Makroökonomie angesehen (Oppenländer [1988, 2f.]). Der Begriff „Entwicklung“ erscheint in der Literatur dagegen häufig in zwei verschiedenen Interpretationsvarianten. Einerseits bezieht er sich auf Veränderungen im Wachstum der Entwicklungsländer. Andererseits wird er oft auch für die Umschreibung von Strukturveränderungen in Ländern der Dritten Welt gebraucht. Bei letzterer Variante fließen neben ökonomischen auch gesellschaftliche, politische und soziale Aspekte in die Begriffsbildung ein. Sowohl Struktur- als auch Wachstumsveränderungen werden letztendlich aber von wachstumspolitischen Entscheidungen oder Aktivitäten beeinflusst. Des Weiteren haben beide Theorien das gleiche, implizierte Ziel: die Wohlfahrt der Bevölkerung zu steigern.[2] Aus diesen Gründen werden in dieser Arbeit die Begriffe „Wachstum“ und „Entwicklung“ synonym verwendet.
1.2.3 Subsaharisches Afrika
Bei der Abgrenzung des Betrachtungsraums orientiert sich diese Arbeit an der Begriffsbestimmung der World Development Indicators 2004 (WDI 2004), welche jährlich von der Weltbank herausgegeben werden. Demnach gehören zum Gebiet des subsaharischen Afrikas alle Länder des Kontinents inklusive Madagaskar, abgesehen von den nordafrikanischen Staaten Ägypten, Algerien, Dschibuti, Libyen, Marokko und Tunesien. Diese Abgrenzung erfolgt aufgrund der klimatisch, geographisch und gesellschaftlich größeren Nähe letzt genannter Staaten zum arabischen Raum. Aus diesem Grund gehören sie auch in den WDI 2004 derselben Gruppe wie die Länder des Mittleren Ostens an. Um dem Ziel der Arbeit gerecht zu werden, wird dieser Betrachtungsraum noch weiter eingeengt. So werden die Inselstaaten Kap Verde, die Komoren, Mauritius, São Tomé und Príncipe sowie die Seychellen von der Untersuchung ausgenommen. In diesen Staaten tragen Tourismuseinnahmen einen signifikanten Teil zum BNE bei. Da selbige aber an regionale Besonderheiten gebunden und keine makroökonomischen Wachstumsfaktoren sind, die einfach übertragen werden können, würde das dem Ziel dieser Arbeit nicht gerecht.
2. Wachstumspolitik
Dieses Kapitel stellt den theoretischen Hintergrund zur praktischen Untersuchung des Wachstumsprozesses im subsaharischen Afrika bereit. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Triebkräfte des Wachstums identifiziert. Die zentrale Frage dieses Abschnitts lautet: Welche Möglichkeiten bestehen für die politischen Akteure, den Wachstumsprozess einer Volkwirtschaft zu beeinflussen? Um diese Frage zu beantworten, muss zuerst der Begriff des Wachstumsprozesses sowie seine Ziele und Eigenschaften erläutert werden. Den Schwerpunkt des zweiten Teils dieses Kapitels bilden die Wachstumstheorien. Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Abschnitt auf die Tauglichkeit der Theorien für die praktische Wachstumspolitik gelegt werden. Im dritten und letzten Teil erfolgt eine nähere Untersuchung der wirtschaftspolitischen Bereiche, die den Wachstumsprozess beeinflussen. Neben der Darstellung der konkreten Steuerungsinstrumente soll in diesem Abschnitt vor allem ein Schema erarbeitet werden anhand dessen der Wachstumsprozess im subsaharischen Afrika analysiert werden kann.
2.1 Wachstumsprozess
Über kaum ein anderes ökonomisches Thema wird so gestritten wie über den Weg der Ausgestaltung des Wachstumsprozesses. Es existieren unzählige Publikationen zu wachstumstheoretischen bzw. wachstumspolitischen Problemstellungen. Dem entsprechend weit gefächert ist auch die begriffliche Abgrenzung des Wirtschaftswachstums. Eine allgemeine Definition bezeichnet Wirtschaftswachstum als Zunahme der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft (Gabler [2000, 3397]). Nach Majer liegt quantitatives Wirtschaftswachstum vor, wenn die Wachstumsrate des realen Bruttonationaleinkommens (BNE) über einen bestimmten Zeitraum positiv ist. Dies führt zu einer höheren Ausstattung der privaten Haushalte mit Gütern und Dienstleistungen und somit zu einer Wohlfahrtssteigerung (Majer [1998, 15]). Doch bereits diese Definition enthält zwei Kritikpunkte: Wohlfahrt als Ziel des Wachstumsprozesses und das BNE als Messinstrument.
2.1.1 Wachstum und Wohlfahrt
Unzweifelhaft führt die durch das Wirtschaftswachstum bedingte höhere Ausstattung der Haushalte mit Gütern und Dienstleistungen zu einem höheren Wohlfahrtsniveau. Doch das Wohlbefinden eines Individuums wird nicht allein durch materielle Werte bestimmt. Auch immaterielle Werte wie Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen und soziale Kontakte, Umweltbedingungen sowie politische Partizipation spielen eine wesentliche Rolle. Die Kritik an einer rein ökonomischen Bewertung der Wohlfahrt konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Punkte (Dürr [1977, 28ff.]):
- Überflussgesellschaft: Die klassische Wirtschaftstheorie betrachtet den Konsumenten als rationales Individuum. Er entscheidet selbst, welche Güter und Dienstleistungen er konsumiert. Doch diese Theorie ist mittlerweile umstritten. Der Konsument wird durch Werbung, Trends und dem dadurch hervorgerufenen Zwang, all das haben zu wollen, was der Nachbar auch hat, massiv von außen beeinflusst. Es entsteht ein Konsumzwang, der nicht der direkten Bedürfnisbefriedung gilt. Aus diesem Konsumzwang resultiert ein gefühlter Rückgang der persönlichen Freiheit. Des Weiteren bewirkt er ein hohes Ausmaß an Ressourcenverschwendung im Sinne der Nachhaltigkeit.
- Ökologische Folgen: Die mit dem Wirtschaftswachstum und den Produktionssteigerungen einhergehenden ökologischen Belastungen sind nicht zu übersehen. Sie wirken sich einerseits direkt und andererseits indirekt durch die Beeinträchtigung des subjektiven Wohlbefindens auf den Menschen aus.
- Soziale Folgen: Der mit dem Wirtschaftswachstum einhergehende Strukturwandel (Urbanisierung, Landflucht) führt zu einem Auflösen sozialer Bindungen. Viele Menschen fühlen sich einsam und vermissen die familiäre Geborgenheit. Außerdem sinkt durch den rasanten technologischen Fortschritt der Wert von Erfahrungen. Vor allem alte Menschen fühlen sich davon überfordert und sind sich unsicher hinsichtlich ihrer Stellung in der Gesellschaft.
Wenn Wohlfahrt mit Wachstum einhergehen soll müssen die immateriellen Werte mit berücksichtigt werden. Eine nachhaltige Wachstumspolitik sollte sich also nicht nur auf ökonomische Steigerungen konzentrieren, sondern auch die oben erwähnten qualitativen Aspekte mit einbeziehen.
2.1.2 BNE als Messinstrument
Am häufigsten eingesetzt bei der Messung des Wirtschaftswachstums wird das Bruttonationaleinkommen (früher Bruttosozialprodukt). Es entsprich dem Gesamtwert des von Inländern in einer Periode erzielten Einkommens (Sachs [1995, 32]). Allerdings ist das BNE als Messinstrument umstritten. Die Leistungen der privaten Haushalte durch Schatten- oder Subsistenzwirtschaft fließen nicht in das BNE ein. Gerade in Entwicklungsländern tragen diese aber einen großen Teil zur Wertschöpfung bei. Ein weiteres Problem ist die Bewertung der öffentlichen Leistungen zu ihren Kosten. Eine Steigerung der Kosten würde demzufolge eine Erhöhung der Leistungserstellung implizieren. Genauso gut kann dieser Fakt aber auch auf einen zu großen Verwaltungsapparat hinweisen. Ein dritter Kritikpunkt befasst sich mit den defensiven Ausgaben. Diese entstehen, wenn versucht wird, Schäden oder Verschlechterungen der Lebens-, Umwelt- und Arbeitsbedingungen, die durch den Wachstumsprozess entstanden sind, zu beseitigen (Leipert [1987, 3]). Defensive Ausgaben, z.B. in Form der Abfallbeseitigung, erhöhen das BNE. Allerdings geht diesen Kosten eine Wohlfahrtsminderung voraus. Es ist umstritten, ob diese Ausgaben Teil eines Wachstums- und damit Wohlfahrtsindikators sein dürfen. Weitere Kritikpunkte befassen sich mit der fehlenden Berücksichtigung des Wertes der Freizeit oder mit der Abwesenheit von sozialen Indikatoren. An dieser Stelle wurde nur eine kleine Auswahl der Einwendungen gegen das BNE als Wachstumsindikator vorgestellt. Aber trotz aller Kritik wurde bis jetzt kein besseres Instrument der Wachstumsmessung entwickelt. Aus diesem Grund steht das Bruttonationaleinkommen weiterhin im Zentrum der wachstumspolitischen Diskussion und wird auch in dieser Arbeit verwendet.
2.1.3 Eigenschaften des Wachstumsprozesses
Der wirtschaftliche Wachstumsprozess einer Volkswirtschaft wird von zwei zentralen Phänomenen begleitet: dem sektoralen Strukturwandel und der Urbanisierung. Der sektorale Strukturwandel kann anhand der von Clark (1940), Fisher (1939) und Fourastié (1954) aufgestellten Drei-Sektoren-Hypothese erklärt werden (Teichmann [1988, 6]). Diese besagt, dass zu Beginn des Wachstumsprozesses der Anteil des primären Sektors (Land- und Forstwirtschaft) an der gesamten Wertschöpfung zugunsten des sekundären Sektors (industrielle Produktion) stark zurückgeht. Im weiteren Verlauf des Wachstums steigt der relative Anteil des tertiären Sektors (Dienstleistungen) dann auf Kosten des sekundären Sektors. Die Volkswirtschaft entwickelt sich von einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft und, bei weiterem Wachstum, in eine Dienstleistungsgesellschaft. Die Theorie des sektoralen Strukturwandels war seit ihrer Entwicklung häufig Gegenstand kritischer Diskussionen. Trotz vieler Kritikpunkte ist die Grundthese jedoch allgemein anerkannt.[3]
Eine zweite Begleiterscheinung des Wachstumsprozesses ist die Urbanisierung. Diese ist bedingt durch den sektoralen Strukturwandel. Durch den Rückgang des Anteils des primären Sektors entstehen immer mehr industrielle Unternehmen. Diese siedeln sich bevorzugt in Ballungsgebieten an, da dort sowohl Agglomerationsvorteile vorhanden sind als auch die Nähe zum Endverbraucher zu reduzierten Transportkosten führt. Außerdem entstehen durch die nahe Ansiedlung bei anderen Unternehmen Skalenerträge durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur (Sachs [1995, 721]). Nachdem in diesem Kapitel der Wachstumsprozess mit seinen Eigenschaften und Zielen vorgestellt wurde, werden im Folgenden Wachstumstheorien untersucht.
2.2 Wachstumstheorien
Wachstumstheorien versuchen den Wachstumsprozess modellhaft abzubilden. Bereits die Klassiker wie Adam Smith, David Ricardo oder Karl Marx beschäftigten sich mit Erklärungen des wirtschaftlichen Wachstums. Aber erst im 20. Jh. gewann das Interesse an Wachstumstheorien an Bedeutung. Mitte des 20. Jh. konkurrierten drei theoretische Ansätze miteinander: das postkeynesianische Wachstumsmodell von Domar (1946) und Harrod (1939), das Modell des schöpferischen Wettbewerbs von Schumpeter (1926) und das neoklassische Modell, basierend auf Solow (1956). Letztendlich hat sich das neoklassische Modell in der wachstumstheoretischen Diskussion als Referenztheorie durchgesetzt. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur letzteres vorgestellt.
2.2.1 Das neoklassische Modell
Das neoklassische Modell wurde 1956 durch Robert Solow begründet (Solow [1956, 65ff.]). Es basiert auf drei zentralen Annahmen (Teichmann [1987, 79]):
1. der Existenz vollkommener Märkte, d.h. die Preise auf den Märkten bilden sich durch Markträumung ohne äußere Eingriffe,
2. der Entlohnung der Produktionsfaktoren nach ihrem Grenzprodukt und
3. einer substitutionalen, linear-homogenen Produktionsfunktion vom Cobb-Douglas-Typ.
Der Output wird bestimmt durch die beiden substituierbaren Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Das Modell hat zum Ziel, diejenigen Bedingungen darzustellen, die für ein gleichgewichtiges Wirtschaftswachstum notwendig sind. Der Gleichgewichtszustand, der so genannte Steady State, wird bestimmt durch die Sparquote, d.h. desjenigen Anteils des Outputs, der neu investiert wird. Im Gleichgewichtszustand werden die Neuinvestitionen neutralisiert durch die Abschreibungen und das Gesamtwachstum resultiert nur noch aus dem technologischen Fortschritt und dem Bevölkerungswachstum. Zwei Prämissen stehen im neoklassischen System im Vordergrund (Majer [1998, 32ff.]): die zentrale Rolle des privaten Unternehmers und das Maximierungskalkül.
Die erste Prämisse besagt, dass der Unternehmer frei auf dem Markt agiert. Der Staat greift nicht in das Marktgeschehen und wird demzufolge nahezu unberücksichtigt gelassen. Außerdem wird auf den Märkten nur die Angebotsseite betrachtet. Das Modell geht davon aus, dass sich jedes Angebot seine Nachfrage schafft („Saysches Theorem“). Der Konsument wird nicht in die Analyse einbezogen. Der private Unternehmer ist die einzige Institution, die das Wachstum bestimmt.
Die zweite Prämisse, das Maximierungskalkül, setzt sich aus drei Aspekten zusammen:
- Nutzenmaximierung: Da sich jedes Angebot seine Nachfrage schafft liegen unendliche Bedürfnisse vor. Es existieren also keine Sättigungsgrenzen. Durch Gütersubstitution, Innovation und Bevölkerungswachstum sind dem Konsum keine Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund ist das Wachstum nicht durch die Nachfrage limitiert.
- Wissensmaximierung: Technologischer Fortschritt ist der Wachstumsmotor des Angebots da neue Technologien einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das Modell geht dabei von der Annahme aus, dass der Wissensdurst unbegrenzt ist und immer neue Technologien produziert, die unabhängig von ihren eventuellen Nebenwirkungen eingesetzt werden.
- Gewinnmaximierung: Investitionen sind neben dem technischen Fortschritt die entscheidende Determinante wirtschaftlichen Wachstums. Sie erhöhen die Quantität bzw. die Qualität des Produktionspotentials der Wirtschaft und bestimmen somit maßgeblich den Output. Ein gewinnmaximierender Unternehmer wird immer investieren, um den Umsatz zu steigern oder die Kosten zu senken.
Anhand des Maximierungskalküls wird geschlussfolgert, dass dem Wachstum keine Grenzen gesetzt sind, wenn diese Prämissen eingehalten werden. Allerdings sind diese Annahmen äußerst umstritten. Im Folgenden werden die wesentlichen Kritikpunkte des neoklassischen Modells erläutert.
Die allgemeinen Kritikpunkte am Wachstum und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Wohlfahrt wurden schon im Kapitel 2.1.1 behandelt. An dieser Stelle werden konkrete Probleme des neoklassischen Modells vorgestellt. Die Hauptkritik richtet sich gegen das, im Maximierungskalkül begründete, unbegrenzte Wachstum. Meadows hat in seinem bekannten Werk „Die Grenzen des Wachstums“ nachgewiesen, dass dem Wachstum sehr wohl Grenzen gesetzt sind (Meadows [1972, 75ff.]). Obwohl einige seiner Modellspezifikationen umstritten sind, ist die Kernaussage in weiten Teilen der wachstumspolitischen Diskussion mittlerweile akzeptiert. Demnach wird das Wachstum limitiert durch die Nahrungsmittelproduktion, die Umweltverschmutzung und die Rohstoffvorräte. Technologischer Fortschritt als Möglichkeit zur Substitution und Innovation verschiebt die Grenzen zeitlich nur nach hinten. Auch ist dessen Einbindung in das neoklassische Modell als „Mana das vom Himmel fällt“ umstritten. Es werden keinerlei Möglichkeiten aufgezeigt, den technischen Fortschritt zu steuern. Ein weiterer häufiger Kritikpunkt ist die völlige Unterbewertung der Rolle des Staates bzw. der öffentlichen Güter. Bei einem Staatsanteil der heutigen Volkswirtschaften von 50% wird dadurch ein völlig realitätsfremdes Modell erzeugt (Majer [1998, 69]). In der wachstumstheoretischen Literatur werden viele weitere Problembereiche kontrovers diskutiert. Einigen wurde durch die Einbindung von Humankapital, Außenhandel, Steuern u. a. begegnet (Endogene Wachstumstheorie). Die wesentlichen Kritikpunkte des neoklassischen Modells wurden davon aber nicht berührt.
2.2.2 Fazit
Wie im vorherigen Kapitel dargestellt gibt es viele Kritikpunkte an den Modellspezifikationen der Wachstumstheorie. Aber auch ihre Tauglichkeit als Vorgabe für konkrete wachstumspolitische Maßnahmen wird angezweifelt. Gahlen schreibt zu diesem Thema: “Die Ausgangssätze des neoklassischen Systems sind Festsetzungen. Sie sind nicht empirisch gehaltvoll. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, den Gebrauch der in ihnen vorkommenden Begriffe (…) festzulegen. Ein solches konventionalistisches System ist für die Erklärung von Wachstumsprozessen und für die Wirtschaftspolitik belanglos.“ (Gahlen [1972, 326]) Die Modelle sind rein tautologisch, d.h. es kann mit ihnen immer Übereinstimmung mit der Wirklichkeit erzielt werden. Wachstumstheoretische Modelle ermangeln vor allem der realitätsgetreuen Widerspiegelung volkswirtschaftlicher Mechanismen. Sie bedienen sich relativ einfacher Verhaltensannahmen, die die Zusammenhänge der praktischen Wirtschaftspolitik nur unzureichend abbilden. Sind die Wachstumstheorien für die praktische Wirtschaftspolitik also vollkommen bedeutungslos? Nein, die primären Triebkräfte des Wachstums lassen sich mit Hilfe der Modelle identifizieren: Investitionen, technologischer Fortschritt und Humankapital. Im folgenden Kapitel wird dargestellt, in welcher Form die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Bereiche die Triebkräfte des Wachstums beeinflussen können.
2.3 Instrumente der Wachstumspolitik
Welche quantitativen und qualitativen Instrumente beeinflussen Investitionen in Sach- und Humankapital sowie den technologischen Fortschritt? Bei genauerer Überlegung erkennt man, dass nahezu alle wirtschaftspolitischen Bereiche auf den Wachstumsprozess einwirken. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die Auswirkungen der Investitionspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Bildungs- und Forschungspolitik, der Außenhandelspolitik sowie der Wettbewerbspolitik auf das Wachstum einer Volkswirtschaft untersucht.
2.3.1 Investitionspolitik
Investitionen bestimmen den zukünftigen Kapitalstock an Sach- und Humankapital und somit auch den zukünftigen Produktionsoutput. Sie sind demzufolge eine entscheidende Determinante des Wachstums. Investitionen setzen zum einen Ersparnisse voraus, die die Investitionsmittel bereitstellen, und zum anderen Unternehmen, welche die Investition tätigen. Die Ersparnisse werden bestimmt durch die Sparquote, dem Anteil des Produktionsoutputs, der nicht für den Konsum sondern für die Erhöhung des Kapitalstocks verwendet wird. Der Staat kann die verfügbaren Investitionsmittel erhöhen in dem er Geld von den Konsumenten zu den Unternehmen umverteilt, z.B. durch Steuern. Allerdings muss er immer berücksichtigen, dass dadurch die Verteilungsgerechtigkeit und somit die Wohlfahrt der Individuen beeinträchtigt wird. Es gilt also immer das richtige Mittel zwischen Investitionen und Konsum zu gewährleisten.
Die zweite Voraussetzung für Kapitalstockerhöhungen ist der investierende Unternehmer. Seine Investitionsentscheidungen werden nicht nur von den vorhandenen finanziellen Mitteln sondern auch von den Rahmenbedingungen und dem Investitionsrisiko beeinflusst.
Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen beeinflussen das allgemeine Investitionsklima. Bereits vor konkreten Überlegungen hinsichtlich Finanzierungsmöglichkeiten und Investitionsrisiko beurteilt das Unternehmen die generellen Investitionsvoraussetzungen. Neben bildungs-, außenhandels- und wettbewerbspolitischen Aspekten (siehe unten) spielt vor allem die vorhandene Infrastruktur eine wesentliche Rolle. Diese kann sowohl materieller als auch immaterieller Natur sein. Letztere manifestiert sich vor allem in den institutionellen Rahmenbedingungen, welche die Investitionssicherheit beeinflussen. Klare Eigentumsrechte, niedrige Korruptionsraten, innere Sicherheit und demokratische Grundwerte wie Gewaltenteilung wirken sich maßgeblich auf die Investitionsfreudigkeit aus. Zur materiellen Infrastruktur wird die Gesamtheit aller Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel für die Energieversorgung, das Verkehrswesen, die Wasserwirtschaft, die Nachrichtenübermittlung und die Erhaltung sowie Nutzung natürlicher Ressourcen gezählt (Teichmann [1987, 272f.]). Die materielle Infrastruktur beeinflusst das Wachstum auf verschiedene Arten. Erstens siedeln sich Unternehmen bevorzugt dort an, wo eine ausgebaute Infrastruktur vorhanden ist. Zweitens kann durch den Ausbau der Infrastruktur und der Bereitstellung öffentlicher Güter komplementärer Konsum erzeugt werden (vgl. Teichmann [1987, 273]). Als drittes kann der Staat über Investitionen in die Infrastruktur gezielt die konjunkturelle Entwicklung beeinflussen. In Zeiten der Rezession führen derartige Investitionen zu einer höheren Kapazitätsauslastung und steigern somit den Unternehmensgewinn. Mit der Infrastrukturpolitik steht dem Staat ein Instrument zur Verfügung, mit der er gezielt die Investitionspolitik sowohl regional als auch national steuern kann.
Finanzierungsmöglichkeiten
Die Finanzierungsmöglichkeiten werden sowohl durch das vorhandene Eigenkapital als auch durch das verfügbare Fremdkapital bestimmt. Das Eigenkapital hat in diesem Zusammenhang einerseits Finanzierungsfunktion und dient andererseits als Haftungsgrundlage für mögliches Fremdkapital (Teichmann [1987, 216]). Der Staat kann die Eigenkapitalbestände der Unternehmen einerseits direkt durch Investitionsprämien (z.B. Subventionen) unterstützen. Dadurch ist der Staat in der Lage, strukturschwache Regionen zu unterstützen und unerwünschte Wanderungsbewegungen der Arbeitskräfte in die Ballungsgebiete zu unterbinden (siehe Kapitel 2.3.2). Andererseits besteht für den Staat die Möglichkeit, das Eigenkapital indirekt über die Unternehmensgewinne zu beeinflussen. Steuersenkungen oder Steuervergünstigungen können die Gewinne steigern und somit die Eigenkapitalbasis verbreitern (Teichmann [1987, 213f.]). Diese Instrumente haben gegenüber Subventionen den Vorteil, dass nur Unternehmen davon profitieren, die Gewinne erwirtschaften, während unrentable Firmen davon nicht beeinflusst werden (Dürr [1977, 206]). Des Weiteren kann der Staat über eine Erhöhung der Geldmenge die Nachfrage ausweiten. Dadurch erhöhen sich die Gewinne der Unternehmen. Allerdings muss bei dieser Maßnahme die Inflationsgefahr einkalkuliert werden. Die durch die Geldmengenausweitung steigenden Löhne und Preise können die Inflationsraten steigern und somit das Investitionsklima beeinträchtigen.
Das verfügbare Fremdkapital wird hauptsächlich von der Höhe der Kapitalmarktzinsen beeinflusst. Bei niedrigen Zinsen und hoher Kapitalrendite wächst die Bereitschaft der Anleger, ihr Geld zu investieren anstatt es bei einer Bank anzulegen. Zusätzlich steigt aufgrund der niedrigen Fremdkapitalkosten die Investitionsbereitschaft der Unternehmer. Niedrige Zinsen können sowohl über Zinssubvention als auch über eine Geldmengenexpansion erreicht werden. Weitere Möglichkeiten der Kapitalakquisition entstehen beispielsweise durch die Einführung von Investivlöhnen (Teichmann [1987, 215ff.]) oder der Erleichterung des Zuflusses an ausländischem Kapital. Wichtige Rahmenbedingungen sind ein ausgebautes, wettbewerbsfähiges Banken- und Kreditsystem sowie rechtliche Voraussetzungen wie beispielsweise der Gläubigerschutz.
Investitionsrisiko
Vor jeder Investition erfolgt eine Risikoabschätzung durch den Kapitalgeber bzw. dem Investor. Nicht die potentielle Gewinnerwartung sondern die Tragbarkeit des Risikos sind der eigentliche Engpass bei einer Investitionsentscheidung (Teichmann [1987, 201ff.]). Abgesehen von der Schaffung eines stabilen institutionellen Umfelds kann der Staat Investitionen fördern, in dem er das Risiko der Unternehmer abmildert. Dies kann z.B. durch staatliche Garantien (Bürgschaften), erweiterte und schnellere Abschreibungsmöglichkeiten oder Risikobeteiligungen von staatlichen Finanzierungsgesellschaften erreicht werden. Die Instrumente dürfen jedoch nicht dazu führen, dass Investitionen ohne vorherige Wirtschaftlichkeitsplanung durchgeführt werden und somit ineffiziente Investitionsruinen entstehen. Das Haftungsprinzip und das marktwirtschaftliche Auslesesystem müssen gewährleistet bleiben. Für den Staat gilt es hier, den richtigen Mittelweg zwischen Investitionsförderung und freiem Markt zu finden.
2.3.2 Arbeitsmarktpolitik
Die Arbeitskraft ist neben dem Sachkapital die entscheidende Determinante des Produktionsoutputs. Sie beeinflusst den Output sowohl quantitativ als auch qualitativ. Letzteres ergibt sich aus dem in den Arbeitskräften gebundenem Humankapital. Die Arbeitsmarktpolitik hat zwei zentrale Aufgaben:
- möglichen Grenzen des Wachstums aufgrund mangelnder Arbeitskräfte durch einer Steigerung des Arbeitsangebots entgegenwirken,
- die Wohlfahrtsmaximierung durch die Beseitigung von Arbeitslosigkeit und durch Gewährleistung von Arbeitnehmerrechten (Arbeitnehmermacht).
Arbeitsangebotssteigerung
Das Arbeitsangebot wird determiniert durch die Bevölkerungsgröße, die Erwerbsdauer, die Arbeitszeit, die Lohnstruktur und intrinsischen Motiven wie beispielsweise der Wert der Freizeit (Teichmann [1987, 186ff.]). Das Bevölkerungswachstum lässt sich nur sehr begrenzt beeinflussen, da es zum großen Teil gesellschaftlich vorbestimmt ist. Empirische Beobachtungen haben gezeigt, dass das Bevölkerungswachstum mit zunehmendem Wohlstand abnimmt. In dem Maß, in dem die Wohlfahrt steigt, verdrängen die Kosten der Kinder (Freizeit, Erziehung) zunehmend ihre Nutzen (Familiäres Einkommen, Altersvorsorge). Der Staat kann auf diese Tendenz nur sehr begrenzt einwirken. Möglichkeiten, das Arbeitsangebot zu steigern, resultieren aus der Anwerbung neuer Arbeiter in anderen Ländern bzw. der Erschließung ungenutzter, interner Arbeitskraftpotentiale. Das Anwerben ausländischer Arbeitskräfte ist in der Literatur allerdings umstritten. Dürr führt an, dass durch die billigen Arbeitskräfte unproduktive Unternehmen möglicherweise nicht aus dem Markt ausscheiden. Außerdem führt der mangelnde Zwang zu Rationalisierungsmaßnahmen zu einer Einschränkung des technischen Fortschritts und der Wettbewerbsfähigkeit (Dürr [1977, 233ff.]). Andererseits besteht gerade für Entwicklungsländer die Möglichkeit, auf diese Weise ihren Humankapitalpool zu steigern. Eine interne Möglichkeit der Angebotssteigerung wird in der Literatur vor allem in der Einbindung der Frau auf dem Arbeitsmarkt gesehen (vgl. Teichmann [187, 89f.]). Weitere Möglichkeiten der Angebotssteigerung sind die Verlängerung der Arbeitszeit beispielsweise durch die steuerliche Förderung von Überstunden oder die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Eine wichtige Rolle spielt das Gesundheitssystem. Eine gut ausgebaute medizinische Infrastruktur ist in der Lage, die Zahl der Krankentage zu verringern und somit die Arbeitsproduktivität zu steigern. Gleichzeitig erhöht sich durch die Reduzierung der Sterblichkeitsrate das Arbeitskräftepotential.
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Die steigende Arbeitslosigkeit ist das zentrale wirtschaftspolitische Thema in den meisten Ländern. Da sie die Zufriedenheit der Menschen senkt, wird dadurch auch die gesamte Wohlfahrt beeinträchtigt. Eine moderne Arbeitmarktpolitik hat zwei Aufgaben: Arbeitslose zu unterstützen und bestehende Arbeitsstellen zu erhalten bzw. neue zu schaffen (Teichmann [1987, 282ff]). Die Unterstützung von Arbeitslosen kann auf vielfältigen Wegen erfolgen. Wichtigste Aufgabe ist die Schaffung einer Plattform für Anbieter und Nachfrager von Arbeitskraft. Auf diese Weise können Arbeitslose besser vermittelt werden. Aber auch direkte Beihilfen zählen zu den bewährten Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik. Mindestens genauso wichtig wie die Unterstützung der Arbeitslosen ist der Erhalt bestehender Arbeitsplätze. Dies kann durch Zuschüsse sowohl an den Arbeitgeber als auch an den Arbeitnehmer erfolgen. Die Unterstützung von Arbeitgebern erfolgt hauptsächlich in strukturschwachen Gebieten. Der Hintergrund dafür ist die mangelnde Mobilitätsbereitschaft der Menschen. Der Zwang zu regionaler Mobilität wird häufig als Belastung empfunden da dadurch die sozialen Gefüge aufgebrochen werden (Teichmann [1987, 98]). Häufig sind Wanderungsbewegungen auch nicht erwünscht, da sie sowohl in den Ballungsgebieten als auch in den Abwanderungsgebieten zu schwerwiegenden sozialen und ökologischen Folgen führen.
2.3.3 Bildungs- und Forschungspolitik
Forschung ebnet den Weg für technologischen Fortschritt welcher seinerseits eine wesentliche Triebkraft des Wirtschaftswachstums ist. Er gewährleistet einerseits kapital- und arbeitssparende Rationalisierungen und steigert somit die Wettbewerbsfähigkeit. Andererseits können durch neue oder ausgereiftere Produkte neue Märkte erschlossen werden. Der Schwerpunkt der Forschungspolitik liegt auf der schwierigen Ertragsprognose, hervorgerufen durch die teilweise sehr langen Zeithorizonte der Forschungsinvestitionen. Diese Problematik verstärkt sich, je mehr sich die Forschungen weg vom Anwendungsbereich und hin zur Grundlagenforschung bewegen. Das Risiko wird immer schwerer kalkulierbar. Der Staat hat verschiedene Möglichkeiten, die Unternehmen bei diesem Problem zu unterstützen (Teichmann [1987, 223ff.]). Er kann den Wettbewerbsdruck lockern und die langfristigen Risiken abmildern in dem er mittels Patente Erfindungen schützt oder sich finanziell am Risiko beteiligt. Dadurch wird der limitierende Einfluss von mangelndem Eigenkapital abgemildert. Der Staat kann die Grundlagenforschung auch in Eigenregie betreiben und die Ergebnisse den Unternehmen zukommen zu lassen. Oft geäußerte Befürchtungen, der Staat könne dadurch private Forschung verdrängen, sind empirisch widerlegt worden (Switzer [1984, 166]). Bei allen Instrumenten gilt es, ein Optimum zwischen gewinnminderndem Wettbewerbsdruck und Forschungsunterstützung zu finden. Entwicklungsländer müssen die Forschungspolitik noch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten (Glismann [1987, 77ff.]). Sie haben häufig versucht, Technologien der entwickelten Länder zu adaptieren. Deren Technologien sind aber meist arbeitssparend, kapitalintensiv und auf große Losgrößen ausgerichtet. Viele Entwicklungsländer sind jedoch durch Kapitalmangel und eine hohe Zahl freier Arbeitskräfte geprägt. Die Forschungspolitik sollte darauf ausgerichtet sein, die Technologien der Industrieländer an die speziellen klimatischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Entwicklungsländer anzupassen. Auch sollte der Technologietransfer zwischen Entwicklungsländern ausgebaut werden da der Grad der Adaptionsfähigkeit der Technologie zwischen diesen Ländern größer ist.
Die Bildungspolitik beeinflusst direkt das Humankapital einer Nation. Sie unterstützt somit sowohl den technologischen Fortschritt als auch den Diffusionsprozess da die Akzeptanz neuer Technologien mit zunehmendem Bildungsgrad steigt (Dürr [1977, 251]). Bildung hat einerseits konsumtiven Charakter in Form von intellektuellen Genüssen. Andererseits trägt sie durch die quantitative und qualitative Steigerung des Produktionsprozesses auch investive Züge (Teichmann [1988, 221ff.]). Letztere sind an dieser Stelle von Interesse da sie sich auf das Wachstum auswirken. Der Staat finanziert zu einem großen Teil Schulen, Universitäten oder Akademien. Damit sorgt er sowohl für eine grundlegende Bildung der Menschen und beteiligt sich andererseits auch an den Kosten berufsspezifischer Ausbildungen. Im Kontext der Entwicklungsländer muss die Bildungspolitik aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet werden. Primär ist sie erst einmal dafür verantwortlich, dass allen Menschen eine Grundausbildung zu Gute kommt. Eine zu starke Fokussierung auf akademische Ausbildung kann dazu führen, dass diese Menschen aufgrund mangelnder Alternativen nur Stellen im Verwaltungsapparat der Regierung finden (Dürr [1977, 255]). Das führt zu einem aufgeblähten öffentlichen Sektor und steigenden Staatsausgaben. Eine weitere mögliche Folge ist die Verstärkung der Landflucht, da akademische Arbeitsstellen, wenn überhaupt, nur in Ballungsgebieten vorhanden sind. Der Staat muss also neben einer ausgewogenen Bildungspolitik dafür sorgen, dass auch genügend Stellen für Akademiker geschaffen werden. Dies ist z.B. durch die gezielte Unterstützung der Ansiedlung ausländischer Unternehmen möglich. Derartige Maßnahmen haben noch einen weiteren Vorteil: den Import von Wissen und somit eine Steigerung des Humankapitalpools. Auch ein anderes dringendes Problem der Entwicklungsländer kann auf diese Art und Weise bekämpft werden: der so genannte „Brain Drain“, d.h. die Abwanderung ausgebildeter Menschen in andere Länder. Indem der Staat inländische und ausländische Unternehmen unterstützt, Arbeitsstellen für Akademiker oder Facharbeiter zu schaffen, kann er dieser Abwanderung entgegenwirken.
2.3.4 Außenhandelspolitik
Im Zeitalter der Globalisierung nimmt die Außenhandelspolitik einen Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik ein. Der Grad der Offenheit des Marktes und die Wechselkurspolitik bestimmen zu einem großen Teil den Umfang der Güter- und Dienstleistungstransaktionen zwischen zwei Ländern.
Wechselkurspolitik
Der Wechselkurs ist der Preis zu dem der Austausch zwischen zwei Ländern stattfindet (Mankiw [1993, 251f.]). Man unterscheidet zwischen nominalen Wechselkurs, dem relativen Preis zwischen den Währungen zweier Länder, und dem realen Wechselkurs, dem relativen Preis zwischen den Gütern zweier Länder (Glismann [1992, 178ff.]). Man unterscheidet zwei Wechselkursysteme: feste und flexible Wechselkurse.
Bei einem festen Wechselkurssystem ist die Inlandswährung fest an eine ausländische Währung oder an einen Währungskorb gebunden. Die meisten Entwicklungsländer haben ein festes Wechselkurssystem (Sachs [1995, 374]). Die Vorteile eines solchen Systems liegen in den niedrigeren Informations- und Umtauschkosten sowie in den geringeren Konvertibilitäts- und Wechselkursrisiken. Allerdings kann diese Planungssicherheit durch unvorhergesehene Aktionen von Regierungen oder Zentralbanken beeinträchtigt werden. Eine feste Wechselkurspolitik hat einen weiteren entscheidenden Nachteil: die Geldpolitik der Zentralbank ist einzig auf die Aufrechterhaltung des Wechselkurses ausgerichtet. Andere Ziele wie Inflationsbekämpfung oder Nachfrageausweitung treten dagegen in den Hintergrund. Die Zentralbank verliert einen Teil ihrer Unabhängigkeit, da sie sich immer am Verhalten der Referenzwährung bzw. des Währungskorbes orientieren muss.
Bei einem flexiblen Wechselkurssystem kann selbiger frei auf Veränderungen am Markt reagieren (Mankiw [1993, 462]). Der große Vorteil eines solchen Systems liegt in der Unabhängigkeit der Zentralbank. Diese ist nicht nur dem Wechselkurs verpflichtet, sondern kann sich unbeeinflusst davon auch anderen wichtigen geld- und fiskalpolitischen Aufgaben widmen. Eine flexible Wechselkurspolitik hat aber auch gewichtige Nachteile. Die Währungsunsicherheit steigt. Entwickelte Volkswirtschaften wie die Schweiz oder Kanada haben zwar gezeigt, dass dieser Fall nicht unbedingt eintreten muss (Glismann [1992, 216]) aber gerade Entwicklungsländer sind für Währungsspekulationen anfällig, da sie häufig nicht über die nötigen Devisenreserven verfügen. Die Krise in Südostasien 1997 hat gezeigt, welche Gefahren durch unkontrollierte Währungsspekulationen auftreten können (Stiglitz [2002, 109ff.]).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass generell flexible Wechselkurse festen vorzuziehen sind, da die Zentralbanken sich auch auf konjunktur- und wachstumspolitische Ziele konzentrieren können. Jedoch kann die Wirtschaft von Entwicklungsländern durch Währungsspekulationen gefährdet werden. Dieser Gefahr könnte mittels Kapitalverkehrskontrollen begegnet werden. Leider ist hier nicht der Platz, dieses äußerst kontrovers diskutierte Instrument der Währungspolitik vorzustellen.
Grad der Marktöffnung
Der Grad der Marktöffnung wird bestimmt durch das Ausmaß der Abschottung gegenüber anderen Märkten. Das wichtigste Instrument ist der Schutz des einheimischen Marktes durch protektionistische Maßnahmen. Damit ist auch gleich ihre Hauptfunktion angesprochen: die Stärkung und den Schutz der einheimischen Wirtschaft gegenüber ausländischer Konkurrenz durch die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Derartige Maßnahmen können entweder tarifär (z.B. Zölle) oder nicht-tarifär (z.B. Exportsubventionen oder Importquoten) sein, wobei letztere deutlich häufiger zur Anwendung kommen. Protektionismus hat zweifach diskriminierenden Charakter:
- Benachteiligung ausländischer Konkurrenten,
- Diskriminierung inländischer Branchen, welche nicht geschützt werden.
Im Inland wirken sich protektionistische Maßnahmen zwar vordergründig positiv durch einen Anstieg der Staatseinnahmen (bei tarifären Instrumenten) und einer Gewinnsteigerung heimischer Unternehmen aus (Glismann [1992, 23ff.]). Beide Effekte werden aber überlagert durch einen stärkeren Rückgang der Konsumentenrente. Außerdem besteht die Gefahr der „Beggar My Neighbour“ Politik: das Ausland revanchiert sich seinerseits mit protektionistischen Maßnahmen. Dadurch entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess der Wohlfahrtsbeeinträchtigung. Nichtsdestotrotz werden diese Instrumente gerade für Entwicklungsländer immer wieder diskutiert. In diesem Kontext unterscheidet man zwei Spielarten: Exportdiversifizierung und Importsubstitution (Glismann [1987, 131ff.]). Bei der Strategie der Exportdiversifizierung wird eine Ausweitung des Exportsortiments staatlich gefördert. Dies kann beispielsweise durch Exportsubventionen geschehen. Der Vorteil einer solchen Strategie ist die offene Anbindung an den Weltmarkt, die Integration in die internationale Arbeitsteilung und die Förderung von direkten Auslandsinvestitionen. Allerdings gilt es gerade für Entwicklungsländer zu beachten, nicht im komparativen Kostenvorteil des primären Sektors zu verharren sondern den Wandel zur Industriegüterproduktion aktiv voranzutreiben. Verfolgt das Land eine Strategie der Importsubstitution, versucht es, wie der Name schon sagt, Importe durch Eigenproduktion zu substituieren. Importe werden durch Handelshemmnisse wie beispielsweise Zölle verteuert. Gleichzeitig werden inländische Unternehmen subventioniert. Dadurch soll die Abhängigkeit vom Weltmarkt reduziert werden. Eine solche Strategie verspricht vor allem den raschen Aufbau der eigenen Wirtschaft. Allerdings besteht die Gefahr, ineffiziente Produktionsstrukturen zu fördern. Außerdem wird der technologische Fortschritt durch die Senkung des Innovationszwangs vermindert. Eine solche Strategie ist mittelfristig nur dann Erfolg versprechend, wenn das Land über einen großen Binnenmarkt verfügt. Langfristig ist weiteres Wachstum nur durch eine Öffnung zum Weltmarkt möglich. Das zeigt sich auch darin, dass vor allem die Entwicklungsländer, die sehr früh auf eine Exportdiversifizierung gesetzt haben, ihre Entwicklung am erfolgreichsten vorantreiben konnten (Glismann [1987, 140]).
2.3.5 Wettbewerbspolitik und marktsubsidiäre Instrumente
Die Wettbewerbspolitik hat zwei zentrale Funktionen. Einerseits unterstützt sie den Markt, falls dieser freien Wettbewerb und somit freie Preisbildung nicht gewährleisten kann. Andererseits greift sie bei negativen Auswirkungen des freien Wettbewerbs regulierend ein.
Wettbewerbsunterstützung
Der uneingeschränkte Wettbewerb ist per Definition bestimmt, folgende wachstumsrelevanten Funktionen zu erfüllen (Teichmann [1987, 234]). Der Markt bestimmt das Angebot an Gütern und Dienstleistungen entsprechend der gegenwärtigen und erwarteten Nachfrage der Konsumenten. Er lenkt die Produktionsfaktoren an die Stätten der höchsten Produktivität und bewirkt selbsttätig die Anpassung der optimalen Faktorallokationen bei veränderten Rahmenbedingungen. Der technologische Fortschritt führt zu ständig verbesserten Produktionsprozessen und Produkten. Vollkommene Märkte sind allerdings in der Realität nicht zu finden. Vielmehr sind sie geprägt durch staatliche Eingriffe und dem Auftreten von Kartellen und Monopolen. Die letzt genannten beeinträchtigen die Marktfunktionen und führen zu einer Minderung der Konsumentenrente und somit zu einer Reduzierung der Wohlfahrt. Der Staat hat zwei Möglichkeiten, gegen Monopole und Kartelle vorzugehen: das Verbotsprinzip und die Missbrauchsaufsicht (vgl. Teichmann [1987, 235ff.]). Prinzipiell besteht seine Aufgabe darin, das Auftreten von monopolistischen Stellungen weitestgehend zu unterbinden, da sie den Wettbewerb einschränken und somit zu höheren Kosten für Konsumenten und Unternehmen führen.
Marktregulierung
Wenn der Markt seinen Aufgaben durch Markversagen nicht nachkommen kann, muss der Staat regulierend eingreifen. In der Literatur werden drei Möglichkeiten für Marktversagen beschrieben (Teichmann [1987, 240ff.]): natürliche Monopole, ruinöser Wettbewerb und externe Effekte. Ein natürliches Monopol liegt vor, wenn ein einzelner Anbieter die nachgefragte Menge zu geringeren Kosten produzieren kann, als wenn dies durch mehrere Unternehmen geschieht. Der Staat lässt dieses Monopol zu. Es unterliegt aber einer ständigen Kontrolle. Häufig werden die Unternehmen dabei dazu gezwungen, dass sich die Preise nicht an den Grenzkosten sondern an der Kostendeckung des Angebots orientieren müssen. Ruinöser Wettbewerb tritt meist in Bereichen hoher Fixkosten auf. In Zeiten einer niedrigen Kapazitätsauslastung führt das zu hohen Stückkosten. Um die Auslastung zu erhöhen, orientieren sich dann alle Anbieter tendenziell an den variablen Stückkosten. Das führt zu einem immensen Preis- und Kostendruck mit dem Ergebnis, dass ein großer Teil der Anbieter aus dem Wettbewerb ausscheidet. Der sinkende Wettbewerbsdruck kann dann zu monopolähnlichen Stellungen der verbliebenen Unternehmen und somit zu einer Senkung der Wohlfahrt führen. Aus diesem Grund greift der Staat regulierend ein. Ein letzter Aspekt der Marktregulierung betrifft externe Effekte. Diese werden durch Kosten ausgelöst, die Güter mit ungelösten Eigentumsfragen betreffen. Ein Beispiel dafür ist die Umweltverschmutzung. Da Umwelt ein Gemeingut ist, werden die Kosten infolge von Schädigungen nicht in die Produktionskosten einbezogen. Da dadurch aber eine Wohlfahrtsminderung (z.B. Luftverschmutzung) entsteht, muss der Staat dafür sorgen, dass die externen Kosten internalisiert werden.
Marktsubsidiäre Instrumente
Die Wettbewerbspolitik hat weitgehend passiven Charakter, da sie auf marktbelebende Aktivitäten verzichtet. Diese Funktion übernehmen marktsubsidiäre Instrumente. Sie sollen den Wettbewerb durch Marktöffnung steigern. Das geschieht, in dem sie Markteintrittsbarrieren abbauen oder Neulingen durch Subventionen den Zugang erleichtern (Teichmann [1987, 258ff.]). Die meisten Einsatzmöglichkeiten marktsubsidiärere Instrumente wurden im Laufe dieses Kapitels bereits angesprochen. Sie umfassen Technologieförderung (Kap. 1.3.3), Strukturpolitik (Kap. 1.3.2), Förderung der Ansiedlung ausländischer Unternehmen (Kap. 1.3.4) oder die Finanzierungs- und Risikobeteiligung bei Investitionen (Kap. 1.3.1).
2.4 Zusammenfassung
Wie gezeigt, kann die neoklassische Wachstumstheorie keinen entscheidenden Beitrag zur Beurteilung und Analyse von Wachstumsprozessen liefern. Nichtsdestotrotz kann die Wachstumstheorie bei der Identifizierung der wesentlichen Wachstumskräfte helfen: Investitionen in Sach- und Humankapital und technologischer Fortschritt. Die Aufgabe der Wachstumspolitik besteht nun darin, die Wachstumsbeiträge der verschiedenen wirtschaftspolitischen Bereiche zu untersuchen. Eine derartige Analyse wird jedoch erschwert durch die Komplexität moderner Volkswirtschaften und durch die unzähligen Interdependenzen und Zielkonflikten zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren. Des Weiteren darf das Wirtschaftswachstum nicht als Selbstzweck sondern als Mittel zur Wohlfahrtsteigerung betrachtet werden. Aus diesem Grund müssen neben den rein quantitativ-ökonomischen auch qualitative Aspekte wie soziale, gesellschaftliche und ökologische Nebenwirkungen oder Wachstumsursachen in die Betrachtung einbezogen werden. Nach der Identifizierung der zu analysierenden Länder im nächsten Kapitel, soll im Kapitel 4 der konkrete Wachstumsprozess dieser Länder in den letzten Jahrzehnten näher untersucht und zentrale Wachstumsfaktoren ermittelt werden.
3. Ungleichheitsberechnung
In diesem Kapitel wird die wirtschaftliche Entwicklung der Staaten im subsaharischen Afrika näher untersucht. Ziel dieses Abschnitts ist es, für diese Länder im Betrachtungszeitraum von 1975-2000 konvergente oder divergente makroökonomische Tendenzen festzustellen. Als Grundlage dieser Untersuchung dient eine Ungleichheitsberechnung. Zu diesem Zweck werden für die Jahre 1975 und 2000 Ungleichheitskoeffizienten berechnet und miteinander verglichen.
Im Kapitel 3.1 werden in einem ersten Schritt die Begriffe Ungleichheit sowie Ungleichheitsberechnung definiert und auf deren Charakteristika eingegangen. Im Kapitel 3.2 wird zuerst eine kurze Übersicht möglicher Messinstrumente vorgestellt. Im Anschluss daran werden die genutzten Ungleichheitskoeffizienten näher erläutert. Kapitel 3.3 beschäftigt sich mit grundlegenden Problemen von Gewichtungs- und Konvertierungsfaktoren. Daran schließt sich eine Darstellung der Datengrundlagen sowie eine Diskussion beschränkender Rahmenbedingungen an. Im abschließenden Kapitel 3.4 werden die Ergebnisse der Ungleichheitsberechnung und daraus resultierende Schlussfolgerungen vorgestellt.
3.1 Definition von Ungleichheit und Ungleichheitsberechnung
Der Begriff „Ungleichheit“ ist in der Fachliteratur allgemein definiert als die Abwesenheit von Gleichheit (vgl. Firebaugh [2003, 71]). Gleichheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jede Einheit über dieselbe Menge einer Quantität X verfügt. X ist also gleich dem Mittelwert [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Die Variable X steht an dieser Stelle für eine beliebige Quantität wie beispielsweise das PKE. Es ist allgemein anerkannt, dass gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten perfekte Gleichheit nicht existiert. Es geht also nicht darum, ob perfekte Gleichheit vorhanden ist, sondern wie hoch der Grad der Ungleichheit ist (vgl. Firebaugh [2003, 71]). Das Messinstrument muss also die Fähigkeit der Kardinalität aufweisen. Auf diesen Aspekt wird im Verlaufe des Kapitels später noch einmal näher eingegangen. Ungleichheit kann in verschiedenen Aggregationsstufen auftreten, beispielsweise zwischen Individuen, zwischen Haushalten oder zwischen Nationen (vgl. Firebaugh [2003, 71]). Dieses Kapitel basiert auf der Ungleichheit zwischen Nationen, da es um die ökonomische Entwicklung der Volkswirtschaften geht und nicht um den Grad der Ungleichheit innerhalb von Staaten.
Mithilfe einer Ungleichheitsberechnung kann ermittelt werden, wie das Einkommen zwischen verschiedenen Betrachtungsgruppen oder Personen verteilt ist. Der Wert der Berechnung repräsentiert den Wert der Ungleichheit der Einkommensverteilung. Je ungleicher diese verteilt ist, d.h. je stärker die Schere zwischen Arm und Reich auseinander klafft, umso höher ist letztendlich der ermittelte Wert des genutzten Indexes. Cowell definiert die Ungleichheitsberechnung als „a scalar numerical representation of the interpersonal differences in income within a given population” (Cowell [1995, 7]). Diese Definition beinhaltet vier zentrale Eigenschaften, die bei einer Ungleichheitsberechnung berücksichtigt werden müssen.
Das Wort „skalar“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle Merkmale der Ungleichheit in einer Zahl zusammengefasst werden. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn eine klare Aussage bezüglich der Entwicklung der Ungleichheit getroffen werden soll. Bei einer mehrdimensionalen Berechnung kann es zu zweideutigen Ergebnissen in der Form kommen, dass beispielsweise für Merkmal A ein Anstieg und für Merkmal B ein Rückgang der Ungleichheit zu verzeichnen ist (vgl. Cowell [1995, 7]).
Eine weitere Eigenschaft von Ungleichheitsberechnung ist die numerische Repräsentation. Unter diesem Aspekt werden sowohl die Fähigkeit des Messinstruments, die Ergebnisse zu ordnen, als auch die Fähigkeit, die exakte Größe der Ungleichheit zu berechnen, zusammengefasst (vgl. Cowell [1995, 9]). Man unterscheidet zwischen kardinalen und ordinalen Messinstrumenten (vgl. Jenkins [1991, 4]). Während ordinale Instrumente nur die Fähigkeit haben, die Ergebnisse zu ordnen, geben kardinale Berechnungsmethoden die exakte Höhe der Ungleichheit und somit eventuelle Veränderungen an. Im Verlaufe dieser Arbeit werden nur kardinale Messinstrumente genutzt.
Ein dritter Aspekt von Ungleichheitsberechnungen ist die Fragestellung, ob alle Einkommensdifferenzen berücksichtigt werden müssen (vgl. Cowell [1995, 10]). Da in dieser Arbeit nicht Ungleichheiten innerhalb von Staaten betrachtet werden, wird auf nähere Ausführungen zu diesem Thema verzichtet.
Das vierte Merkmal der Definition von Cowell beschäftigt sich mit der gegebenen Bevölkerung. Wie ist mit den Personen oder Gruppen zu verfahren, die während des Betrachtungszeitraums neu hinzukommen bzw. wegfallen. Die allgemeine Annahme ist, dass, solange die Struktur der Einkommensverteilung gleich bleibt, sich die gemessene Ungleichheit nicht verändert (Cowell [1995, 11]). Auf diesen Aspekt wird in Kap. 3.3 noch einmal eingegangen, da die Datenabdeckungsrate für die Jahre 1975 und 2000 unterschiedlich hoch ist.
Ein letzter wichtiger Punkt beschäftigt sich damit, ob die Messung der Ungleichheit anhand des Abstandes zwischen den ärmsten und reichsten Ländern oder mittels des Verhältnisses [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] gemessen werden soll. In dieser Formel steht Xj für die Quantität X eines beliebigen Landes j und [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] für den Mittelwert der betrachteten Quantitäten. Firebaugh plädiert für eine verhältnisbasierte Messung. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass bei einem proportionalen Anstieg aller Xj der Grad der Ungleichheit sich nicht verändert, da auch der Mittelwert [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]um dieselbe Rate steigt (Firebaugh [2003, 72 f.]). Dieses Merkmal wird als Skaleninvarianz bezeichnet und im Kapitel 3.2 noch einmal ausführlich diskutiert.
3.2 Messinstrumente
Man unterscheidet unterschiedliche Gruppen von Ungleichheitsmessinstrumenten. Cowell differenziert zwischen allgemeinen Berechnungsmethoden, Rankings sowie wohlfahrtsbasierten und informationstheoretischen Ansätzen. Zu den allgemeinen Instrumenten zählen unter anderem der Gini Koeffizient, die relative mittlere Abweichung sowie unterschiedliche Ausprägungen der Varianz. Rankings basieren auf prozentualen Anteilen der ärmsten und reichsten Bevölkerungsteile. Zu den wohlfahrtsbasierten Ansätzen gehört u. a. der Atkinson Ungleichheitsindex sowie Dalton´s Ungleichheitsindex. Auf informationstheoretische Grundlagen gründen sich schließlich der Theil Index sowie Herfindahl´s Index (Cowell [1995, 21 ff.]). In diesem Kapitel wird auf die in der Praxis am meisten genutzten Instrumente zurückgegriffen (Firebaugh &Goesling [2004, 290]): der Gini Koeffizient (G), der Theil Index (T) sowie die mittlere logarithmische Abweichung (MLA). Bevor diese Instrumente jedoch näher charakterisiert werden, ist eine Vorstellung der grundlegenden Kriterien von Ungleichheitsindizes notwendig. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird die Quantität Xj das PKE eines Landes j kennzeichnen. Man unterscheidet drei Kriterien: Skaleninvarianz, Transferprinzipien und additive Zerlegbarkeit.
Wie schon im Kapitel 3.1 angesprochen ist die Skaleninvarianz ein zentrales Kriterium für Ungleichheitsindizes. Es bedeutet, dass bei einer Änderung aller Einkommen Xj um eine beliebige Rate die Werte der Indizes gleich bleiben (Firebaugh [2003, 79]; Cowell [1995, 56]; Allison [1978, 866]).
Unter Transferprinzipien versteht man die Reduktion der Ungleichheit bei einem Transfer von $1 von einem reicheren zu einem ärmeren Land. Bei einem entgegen gesetztem Transfer muss die Ungleichheit steigen. Nicht alle Indizes erfüllen dieses Kriterium in gleicher Weise. In diesem Zusammenhang ist es wichtig die Transfersensibilität zu betrachten. Die unterschiedlichen Indizes weisen unterschiedliche Sensibilitäten auf. Einige sind besonders sensibel bei Transfers im oberen Bereich der Einkommensverteilung, andere bei Transfers im unteren Bereich (Firebaugh [2003, 79f.]). Die unterschiedlichen Transfersensibilitäten erweitern die Interpretationsfähigkeit des Endergebnisses dadurch, dass die Indizes bestimmte Ebenen der Einkommensverteilung besonders gewichten.
Additive Zerlegbarkeit bedeutet, dass das Gesamtergebnis der Ungleichheitsberechnung der gewichteten Summe der Ergebnisse der Subgruppen entsprechen muss (Firebaugh [2003 79]). Im Gegensatz zum Theil Index und zur MLA erfüllt der Gini Koeffizient dieses Kriterium nicht (Bourguignon [1979, 909 ff.]). Da in dieser Arbeit eine Zerlegung in Subgruppen jedoch nicht vorgesehen ist, die Erfüllung dieses Kriteriums nicht zwingend notwendig.
Im zweiten Teil dieses Kapitels werden, aufbauend auf der allgemeinen Formel für Ungleichheitsindizes nach Firebaugh, die einzelnen Koeffizienten näher vorgestellt. Bei der Herleitung der allgemeinen Formel ist er davon ausgegangen, dass das Einkommen gleich verteilt ist, wenn gilt: [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Deshalb ist das Einkommensverhältnis [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] für jedes Land j genau dann eins, wenn perfekte Gleichheit herrscht. Ist dies nicht der Fall, repräsentiert rj die Disproportionalität vom Einkommen Xj zum Mittelwert [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. Darauf aufbauend stellt Firebaugh die allgemeine Formel für Ungleichheitsindizes wie folgt auf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mit f(rj) als Funktion des Einkommensverhältnis rj und N der Anzahl der Länder bei gleicher Gewichtung. Da die Bevölkerung der Länder unterschiedlich hoch ist, wird N ersetzt durch [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] mit nj gleich dem Bevölkerungsanteil des Landes j und N gleich der Gesamtbevölkerung des Betrachtungsraumes. Dadurch werden Länder mit einer großen Bevölkerungsanzahl stärker gewichtet. Auf den Punkt „Gewichtung der Bevölkerung“ wird im Kapitel 3.3 noch einmal eingegangen. Die allgemeine Formel für Ungleichheitsindizes nach Firebaugh lautet demzufolge:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Man erkennt, dass sich die Formeln der Indizes nur durch die Funktion ihres Einkommensverhältnisses f(rj), der so genannten Disproportionalitätsfunktion, unterscheiden (siehe Tabelle1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Disproportionalitätsfunktionen der Ungleichheitsindizes (Quelle: Firebaugh [2003, 77])
Mittels der allgemeinen Formel für Ungleichheitsindizes (2) und den Disproportionalitätsfunktionen können die Formeln der einzelnen Indizes aufgestellt werden (Firebaugh [2003, 75 ff.]). An dieser Stelle werden die drei Instrumente Gini Koeffizient, Theil Index und MLA kurz vorgestellt:
Gini Koeffizient:
Dieser Index wurde 1914 von Corrado Gini eingeführt. Er repräsentiert das zweifache der Fläche zwischen der 45° Kurve und der Lorentzkurve (Jenkins [1991, 15]). Obwohl umstritten (erfüllt er das Zerlegbarkeitskriterium nicht), ist er immer noch das bekannteste Maß bei Ungleichheitsmessung. Die allgemein bekannte Formel lautet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sie gibt die durchschnittliche Differenz zwischen allen Einkommenspaaren wider (Cowell [1995, 23]). Allerdings existieren verschieden Möglichkeiten G formell auszudrücken. Aufbauend auf den Studien von Blau (Blau [1977, 31]) und Allison (Allison [1978, 876 f.]) hat Firebaugh eine Formel für gruppierte Daten aufgestellt (Firebaugh [2003, 75 ff.]):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mit qj als dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, die in Ländern leben, die ärmer sind als das Land j und Qj als dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, die in Länder leben, die reicher sind als das Land j (Firebaugh [2003, 83]). Somit gilt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Gini Koeffizient ist null bei perfekter Gleichheit und seine Obergrenze beträgt eins. Er ist besonders sensibel im mittleren Bereich der Einkommensverteilung (Allison [1978, 868]). Das bedeutet, dass die Ungleichheit umso mehr beeinflusst wird, je mehr Veränderungen der Einkommen bei Einheiten im mittleren Bereich der Einkommensverteilung auftreten.
Theil´s Index:
Dieses Instrument wurde 1967 von Henri Theil eingeführt (Theil [1967, 92]). Ausgangspunkt für die Herleitung war der informationstheoretische Ansatz, dass es zu jedem Ereignis I eine Wahrscheinlichkeit pi gibt, mit der dieses Ereignis eintritt. Die Wahrscheinlichkeit bestimmt den Wert einer Information h(pi), die entsteht, sobald das Ereignis eintritt. Um den Grad der Unordnung zu bestimmen, der in einem solchen System herrscht, wird eine Entropie E aufgestellt (Cowell [1995, 47 ff.]):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufbauend auf diesem Ansatz und der allgemeinen Formel (2) lautet die Gleichung des den Theil Index (Firebaugh [2003, 75 ff.]):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mit dem Einkommensverhältnis rj und dem Bevölkerungsanteil des Landes j pj. T ist null bei perfekter Gleichheit und seine Obergrenze beträgt eins (Firebaugh [2003, 82]). Der Theil Index ist besonders sensibel bei Einkommensveränderungen reicher Länder (Firebaugh & Goesling [2004, 290]).
Mittlere logarithmische Abweichung (MLA):
Die MLA wird berechnet aus der Differenz des Logarithmus der Mittelwerte von Xj und dem Mittelwert der Logarithmen von Xj. Aufbauend auf diesem Ansatz und der allgemeinen Formel (2) lautet die Gleichung (Firebaugh [2003, 75 ff.]):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die MLA kann auch ausgedrückt werden als das Verhältnis des arithmetischen Mittels zum geometrischen Mittel (Firebaugh [2003, 82]). Sie ist das bevorzugte Instrument neben dem Theil Index, da sie genau wie er, alle drei Kriterien erfüllt (Berry, Bourguignon & Morrison [1991, 61]). Bei perfekter Gleichheit ist die mittlere logarithmische Abweichung null. Sie weist eine hohe Sensibilität bei Einkommensveränderungen armer, bevölkerungsreicher Länder auf (Firebaugh & Goesling [2004, 289]).
Bei der Berechnung des Wertes der Ungleichheit im vorliegenden Fall kommen trotz der Nachteile des Gini Koeffizienten alle vier Instrumente zur Geltung.
3.3 Datengrundlagen
Bevor an dieser Stelle auf die zugrunde liegenden Daten eingegangen wird, werden erst zwei Aspekte näher erläutert:
- Wie erfolgt die Gewichtung der Länder hinsichtlich der Größe ihrer Bevölkerungszahl?
- Welcher Konvertierungsfaktor der Währung wird angewandt, um eine gleiche Berechnungsbasis der PKE zu gewährleisten?
[...]
[1] Als Pro-Kopf-Einkommen wird das Bruttonationaleinkommen (BNE) je Einwohner bezeichnet (Glismann [1987, 20])
[2] Vergleich dazu auch Kapitel 1.1
[3] Für eine umfassendere Diskussion zu diesem Thema siehe u.a. (Teichmann [1988, 6]) oder (Sachs [1995, 719f.])
- Arbeit zitieren
- Friedemann Jäger (Autor:in), 2006, Analyse makroökonomischer Wachstumsfaktoren im subsaharischen Afrika auf Basis einer Ungleichheitsberechnung des Bruttonationaleinkommens von 1975-2000, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76245
Kostenlos Autor werden
















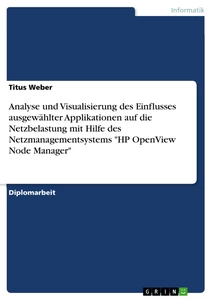

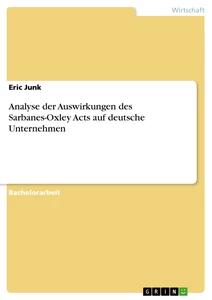

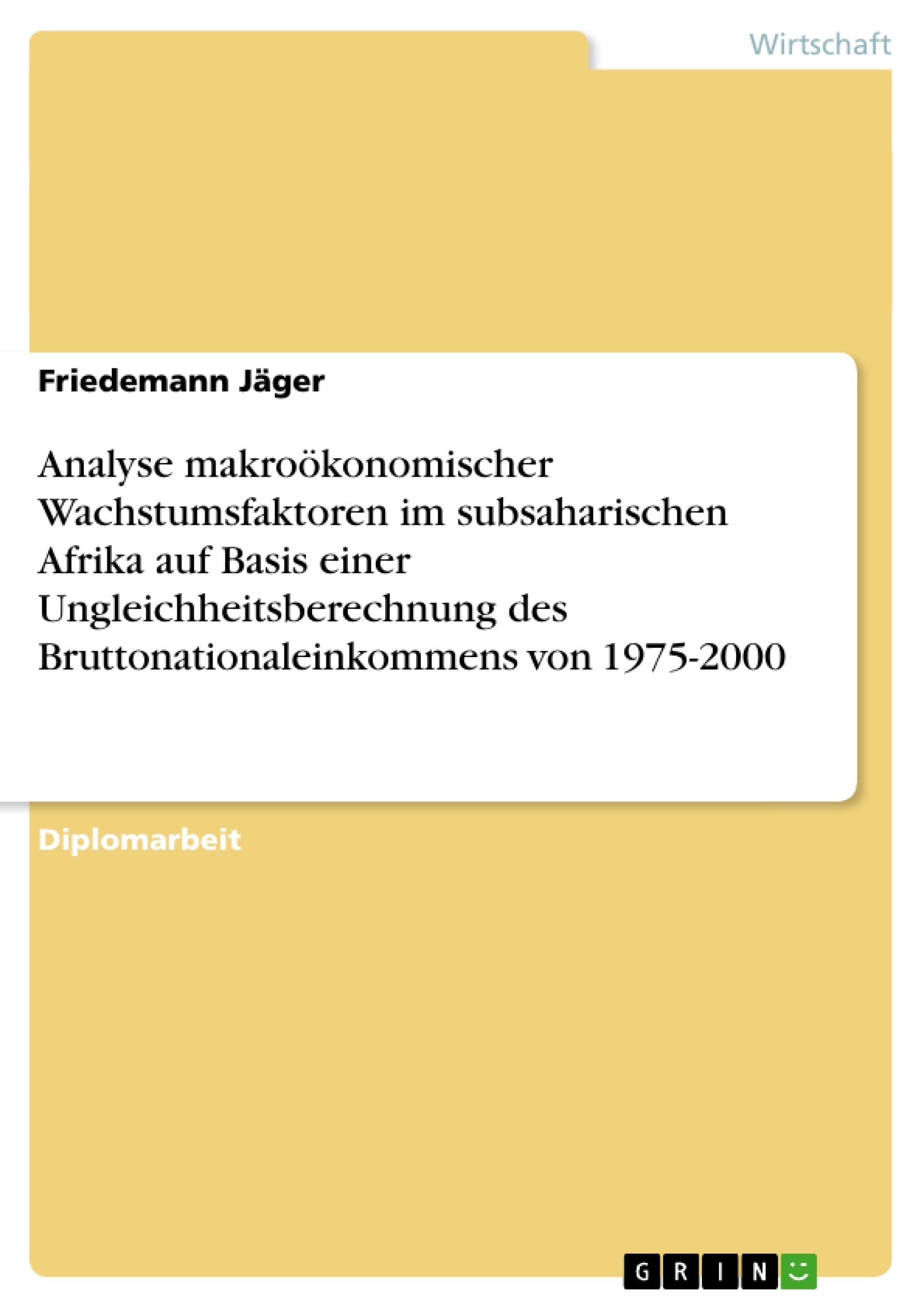

Kommentare