Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. EINLEITUNG
1.1 ANLASS UND PROBLEMSTELLUNG DER ARBEIT
1.2 FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
1.3 ZUR QUELLENLAGE
1.4 ABGRENZUNG ZU ANDEREN THEMEN
2. DIE GESELLSCHAFT IM WANDEL
2.1 Auf dem Weg ZUR INFORMATIONSGESELLSCHAFT
2.2 SCHWINDENDE ERWARTUNGSSICHERHEIT
2.3 Sicherheit des Arbeitsplatzes und Weiterbildung
2.4 soziale Ungleichheit In Schule und Studium
2.5 Auswirkungen auf den Bereich der Weiterbildung
2.6 Zusammenfassung
3. Selbstgesteuertes Lernen: Ein vielschichtiger Begriff
3.1 Definition der „Neuen Lernkultur“
3.2 Der Begriff „Selbstgesteuertes Lernen“- ein kurzer historischer Rückblick
3.3 Die Begriffliche Vielfalt und Unbestimmtheit
3.4 Aspekte von Lernformen und Freiheitsgrade
3.4.1 Selbst- „gesteuert“ – Eine freie Assoziation
3.5 Lernmotivation
3.6 SelbstGesteuertes Lernen: Eine definition
3.7 Zusammenfassung
4. Lernende in selbstgesteuerten Lernprozessen
4.1 Selbstlernkompetenzen der Lernenden
4.1.1 Personale Kompetenz
4.1.2 FachKompetenz
4.1.3 Sozialkompetenz
4.1.4 Methodenkompetenz
4.1.5 Kommunikative kompetenz
4.1.6 Emotionale kompetenz
4.2 von der notwendigkeit, Lernen zu lernen
4.3 Zusammenfassung
5. Lehrende in selbstgesteuerten Lernprozessen
5.1 Kompetenzen der Lehrenden
5.1.1 Deutungskompetenz
5.1.2 LernBeratungskompetenz
5.2 Die Notwendigkeit von Fortbildungen und Investition in Personalressourcen
5.3 Zusammenfassung
6. WeiterbildungsInstitutionen in selbstgesteuerten Lernprozessen
6.1 Aufgaben von Weiterbildungsinstitutionen
6.2 Selbstlernzentren
6.3 Das Problem der Zertifizierung von Lernerfolgen
6.4 Zusammenfassung
7. Bildungspolitik und Wirtschaft
7.1 Auswirkungen von rechtlichen Vorraussetzungen für Weiterbildung
7.2 Finanzierungsproblematik von SelbstGesteuertem Lernen
7.3 Der Faktor Zeit und Nachhaltigkeit
7.4 Zusammenfassung
8. Konsequenzen für die Weiterbildung und offene Fragen
LITERATURVERZEICHNIS
Erklärung Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Sektoren-Modell von 1882-2010
Abbildung 2: Erwerbstätige nach Berufsbereichen
Abbildung 3: Verbreitungsgrad computergestützter Arbeitsmittel nach Berufsbereichen
Abbildung 4: Verteilung der Zahl der Lebensformwechsel bis zum Alter von 35 Jahren
Abbildung 5 : Erwerbstätige nach Produktionssektoren (1950-1993) Ost und West
Abbildung 6 : Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslose in den neuen Bundesländern 1990-1998
Abbildung 7: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten OST/WEST
Abbildung 8: Gesetzliche Grundlagen der Weiterbildung
Abbildung 9: Angaben der Kultusministerkonferenz zu den Ausgaben der Bundesländer für Weiterbildung 1998 je Land in Mio. DM
Abbildung 10: 17- und 18jährige SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe im April 2000 nach beruflicher Stellung der Eltern in% aller gleichaltrigen Kinder bei Ehepaaren der jeweiligen beruflichen Stellung
Abbildung 11: Bildungstrichter: Schematische Darstellung sozialer Selektion 2000
Abbildung 12: Bildungsbeteiligung der 19-24jährigen an Hochschulen nach sozialer Herkunft 2000 und Geschlecht
Abbildung 13: Entwicklung der sozialen Zusammensetzung der Studierenden nach Herkunftsgruppen seit 1982
Abbildung 14: Veröffentlichungen mit „Lernkultur“ im Titel
Abbildung 15 : Karikatur des Nürnberger Trichters: Der passive Lernende wird von außen verlustfrei mit Wissen befüllt.
Abbildung 16 : Die drei Dimensionen des "Selbst"
Abbildung 17: Freiheitsgradeinteilung nach Candy
Abbildung 18: Freiheitsgrade nach Faulstich
Abbildung 19: Konkurrierende Erwartungen Teilnehmer und Kursleitung in SGL
Abbildung 20: Selbstlernkompetenzmodell
Abbildung 21: Die Funktionsweise von Deutungslernen
Abbildung 22: Lernberatungskompetenz
Abbildung 23: Leistungen eines SLZ nach Faulstich
Abbildung 24: Aufgaben eines SLZ 1: selbstgesteuertes Lernen
Abbildung 25: Aufgaben eines SLZ 2 : Supportstrukturen
Abbildung 26: Struktur des Bildungspolitischen Feldes
Abbildung 27: Einflussfaktoren Weiterbildungsnachfrage
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Äußere Aspekte von Lernen
Tabelle 2: Innere Aspekte von Lernen
Tabelle 3: Expansives versus Defensives Lernen
Tabelle 4: Die Kategorisierung der Ursachenzuschreibungen und die Auswirkungen auf den Lernprozess
1. EINLEITUNG
In der Bundesrepublik Deutschland finden seit geraumer Zeit massive Veränderungen statt. Eine berufliche Ausbildung oder ein Studium an sich garantieren schon seit lange keinen Arbeitsplatz mehr. Die öffentlichen Haushalte schreiben rote Zahlen, die demographische Entwicklung zeigt eine wachsende Zahl der Alten und einen Rückgang der Geburten. Der Druck der internationalen Konkurrenz auf den „Wirtschaftsstandort Deutschland“ steigt. Studien wie PISA oder die jüngst vorgestellte OECD-Studie vergeben schlechte Noten für die Bildungspolitik in der BRD.[1]
Die zentrale Bedeutung von regelmäßiger Fort- und Weiterbildung wird in diesem Zusammenhang immer wieder sowohl von Seiten der Wirtschaft, als auch von Seiten von Politik, Gewerkschaften und den Bildungseinrichtungen betont oder wie Univ.-Prof. Dr. Volker Hentschel bei seiner Eröffnungsrede des 1. Mainzer Weiterbildungstages am 07.09.04 treffend formulierte: „Man lernt nicht mehr ein- für allemal, sondern ein ums andere mal“ (Hentschel 2004, o.S.).
Aus diesen Erkenntnissen heraus rückt der Bereich der Weiterbildung in den Mittelpunkt des Interesses.
1.1 ANLASS UND PROBLEMSTELLUNG DER ARBEIT
Beim Verfolgen der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Weiterbildung in Deutschland fallen dem Beobachter unweigerlich gewisse Stichworte auf, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Debatte ziehen. Zu diesen zählt der Begriff des „Selbstgesteuerten Lernens“ als wichtiger Bestandteil „Lebenslangen Lernens“. Daneben finden sich Formulierungen, die synonym für Selbstgesteuertes Lernen gebraucht werden: „Selbstsorgendes Lernen“, „Selbstorganisiertes Lernen“, „Selbstbestimmtes Lernen“ oder „Eigenverantwortliches Lernen“.
Die voranschreitende rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Technologie, die zunehmende Globalisierung, das Wegfallen von Standardbiographien: Die Gesellschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch. Dies erfordert eine Weiterentwicklung der Bildungs- und Weiterbildungsinstitutionen, so dass der Mensch mit dem Tempo der gesellschaftlichen Veränderungen Schritt halten kann. „Selbstgesteuertes Lernen“ (SGL) soll hierfür der Schlüssel sein, gepaart mit dem schon bekannten Begriff des „Lebenslangen Lernens“. Das Individuum muss sich eigenständig und dauerhaft um eine Aktualisierung seines Wissens bemühen. Dieser Vorgang soll möglichst effizient und kostengünstig sein, nachhaltige Ergebnisse liefern sowie möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Senator Willi Lemke beschrieb dies im Jahr 2000 so:
„Im Rahmen der stärkeren Selbstverantwortung der Individuen und der damit verbundenen Abkehr von staatlicher Detailsteuerung wird es notwendig aber auch möglich sein, im Zusammenhang der technologischen Entwicklung im Multimedia-Bereich, Lernprozesse stärker selbst zu steuern und unabhängig von Ort und Zeit zu verwirklichen. (...) Nicht nur wegen der Steigerung der Effektivität und kostensparender Synergieeffekte, (...) wird es vermehrt darauf ankommen, Vernetzungen aufzubauen...“ (Lemke 2000, S.48ff).
Ein zentraler Aspekt des SGL ist also die Selbstverantwortlichkeit des Individuums. Gleichzeitig zieht sich der Staat zunehmend aus der Verantwortung zurück. Dies ist eine willkommene Argumentation, öffentliche Gelder aus dem Bildungssektor abzuziehen und damit die ohnehin leeren Haushaltskassen zu entlasten. „ ... Gefördert wird, was Fortschritt und Arbeit schafft! ...“ (Bulmahn 2004, S.6), nicht unbedingt, was Bildung und Mündigkeit schafft.
Aus diesen Gründen findet sich auch in fast allen aktuellen Projektanträgen aus dem Bereich der Weiterbildung der Begriff des „Lebenslangen Lernens“ oder des „Selbstgesteuerten Lernens“. Abgeschlossene Projekte zu diesem Bereich, z.B. das Projekt
SeGeL (Selbst-Gesteuertes-Lernen) des DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung) oder SeLOG der Bund-Länder-Kommission (BLK) zeigen sowohl die Grenzen des SGL als auch dessen tatsächliche Anwendungsmöglichkeiten auf. Diese unterscheiden sich jedoch von den Erwartungen, die der Begriff des SGL impliziert und mit dem gerade in der Öffentlichkeit dafür geworben wird.
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, was SGL leisten kann und welche Anforderungen dies speziell für Weiterbildungsinstitutionen, Lehrende und Lernende mit sich bringt, soll Thema dieser Arbeit sein. Es soll betrachtet werden, welche Möglichkeiten Formen des Selbstgesteuerten Lernens eröffnen und welche Rahmenbedingungen hierfür geschaffen sein müssen.
1.2 FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
Im Zentrum dieser Arbeit soll die Frage nach den Rahmenbedingungen von Selbstgesteuertem Lernen stehen. Welche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen begründen die Aktualität von SGL? Welche Lösungen zu welchen Problemstellungen bieten sich durch den verstärkten Einsatz von SGL im Bereich der Weiterbildung an? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, wenn SGL erfolgreich sein soll? Welche Probleme stellen sich hierbei?
Hierbei sind die Chancengleichheit im Bildungssystem und die Bedeutung von Lernvor-erfahrungen in den anderen Bildungseinrichtungen wie z.B. der Schule für SGL von zentraler Bedeutung.
Zur Untersuchung dieser Fragestellung soll zunächst kurz der gesellschaftliche Wandel in Deutschland von der Industrie- zur Informationsgesellschaft dargestellt werden. Hierbei sind die zunehmende Individualisierung, der Wegfall von sozialen Sicherheiten, Arbeitslosigkeit, sowie die Chancengleichheit im Bildungssystem genauer zu betrachten. Dabei stehen die Fragen im Vordergrund, welche neuen Anforderungen dieser gesellschaftliche Wandel mit sich bringt und welche Entwicklungen damit verbunden sind. Hierbei soll ebenfalls speziell der Weiterbildungsbereich betrachtet werden. Es wird jedoch unabdinglich gerade im Bezug auf Lernvorerfahrungen sein, auch die Bereiche der Schule und Hochschule zu betrachten.
Anschließend soll das Konzept von SGL vorgestellt werden, sowie der Begriff einer „neuen Lernkultur“, der eng damit verknüpft ist. Hier wird eine Klärung vorzunehmen sein, was unter Selbststeuerung zu verstehen ist und inwiefern von einer Freiheit der Lernenden im Kontext von SGL gesprochen werden kann. Entscheidend wird auch sein, die Bedeutung der Lernmotivation in Bezug auf SGL darzustellen, da diese entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg ausübt.
Nach einer Definition von SGL soll dann erörtert werden, welche Anforderungen SGL an die verschiedenen Akteure im Lehr-/Lernprozess stellt und welche Konsequenzen sich hieraus ergeben. Diese Anforderungen sollen nach den einzelnen Akteuren getrennt vom Lernenden über die Lehrenden und Institutionen bis hin zu Politik und Wirtschaft betrachtet werden.
Hierbei ist vor allem zu beachten, welche Vorraussetzungen Lernende, Lehrende und Institutionen in Bezug auf SGL erfüllen und welche Kompetenzen von wem entwickelt werden müssen. Im Rahmen der Untersuchung von Institutionen sollen dann das Konzept von Selbstlernzentren und die damit verbundenen Aufgabenbereiche und Leistungsspektren dargestellt werden. Bei der Betrachtung von Bildungspolitik und Wirtschaft hingegen steht im Vordergrund, welche Aufgaben sich hier stellen, um passende Rahmenbedingungen für SGL bundesweit zu entwickeln.
Die einzelnen Fäden sollen dann in Bezug auf die Fragestellung zusammenfassend erörtert und diskutiert werden. An dieser Stelle sollen sich auch offene Fragen und Überlegungen wiederfinden, die dem Verfasser während der Fertigstellung dieser Arbeit gekommen sind und die zu weiteren Nachforschungen anregen mögen.
Zum generellen Aufbau:
Die Reihenfolge der Betrachtung der Akteure wurde bewusst von der Ebene des Lernenden zur Ebene des gesellschaftlichen Umfelds (Politik und Wirtschaft) gewählt, um die zunehmende Komplexität des Themas aufzuzeigen, die sich mit jeder höheren Ebene ergibt.
Weiterhin steht am Ende eines jeden Kapitels eine Zusammenfassung, in der die wichtigsten Punkte in einer Kurzdarstellung nochmals klar herausgestellt werden. Dies geschieht zum Zweck einer besseren Übersichtlichkeit.
1.3 ZUR QUELLENLAGE
In dieser Arbeit werden Fachliteratur aus Pädagogik, Soziologie und Psychologie, Artikel aus Fachzeitschriften sowie Quellen aus dem Internet verwendet. Neben den größtenteils soziologischen Publikationen, die den theoretischen Grundbau des ersten Teils dieser Arbeit liefern, soll im zweiten Teil vor allem der Ergebnisbericht des Projekts SeGeL, „Selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildungspraxis“, vom DIE in seiner Erstauflage von 2001 Verwendung finden. Diesem Bericht, der von Stephan Dietrich herausgegeben worden ist, wurde eine CD-ROM mit weiterführenden Informationen beigelegt, auf die sich in der Arbeit jedoch nicht bezogen wird, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese CD-ROM jedem öffentlich zugänglichen Exemplar des Berichts unbeschädigt und frei verfügbar beiliegt.
Weiterhin werden themenrelevante Literatur, z.B. des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), weitere Publikationen des DIE sowie verschieden Artikel oder Dissertationen benutzt.
Generell werden Hervorhebungen (Fettdruck, Kursivstellungen) aus den Quellen nicht übernommen, da diese aus ihrem Zusammenhang herausgerissen eher verwirrend wirken.
Die Quellenangaben der verwendeten Grafiken wurden nicht herausgelöst, sondern in das jeweilige Bild in der originalen Form eingebettet belassen.
1.4 ABGRENZUNG ZU ANDEREN THEMEN
Das Projekt SeGeL an sich wird in seiner Planung und Durchführung in dieser Arbeit nicht näher erläutert werden[2].
Das Konzept von SGL soll vor allem vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund betrachtet werden. Konzeptionen einzelner Lehr-/Lernarrangements sollen nicht gezielt behandelt werden. Ebenso soll die Einordnung von SGL unter den Prämissen eines emanzipatorischen Bildungsbegriffs keine gesonderte Diskussion erfahren, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
E-Learning als ein zentraler Aspekt der Formen von SGL wird zwar in der Betrachtung berücksichtigt, jedoch nicht eigens thematisiert. Es soll an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich auch hier die Freiheitsgrade der Individuen im Lernprozess abhängig von der jeweiligen Form des E-Learnings unterscheiden.
Es wird in dieser Arbeit unabdinglich sein, auch auf die Bereiche Schule und Hochschule einzugehen, dennoch soll nicht betrachtet werden, welche Möglichkeiten von SGL sich in diesen beiden Teilen des Bildungssektors ergeben. Im Bereich der Schule sei hier auf Konrad/Traub verwiesen, die sich diesem Thema widmen (vgl. Konrad/Traub 1999).
Es wird sich im Laufe dieser Arbeit herausstellen, dass Lehrende und Lernende, um den Anforderungen gerecht werden zu können, die SGL an sie stellt, , über gewisse Kompetenzen verfügen müssen. Hierzu zählt auch das Wissen über verschiedene Methoden. Auf die speziellen didaktischen Methoden, die in SGL Anwendbarkeit finden, wird in dieser Arbeit ebenfalls nicht eingegangen. Der Interessierte findet jedoch eine Sammlung kreativer Techniken bei Meueler 2001 in Kapitel Sieben: „Küchenlexikon der Methoden und Sozialformen“ (vgl. Meueler 2001, S.198 ff.). Die Konzeption für Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrende wird ebenfalls nicht näher betrachtet. Hier finden sich Anreize bei Corcilius 2001, S.155ff.; Wegener 2001, S.162ff.; Haussmann 2001, S.177ff. und Behrenberg/Fassnacht 2001, S.191ff.
Eine systematische Unterteilung der Weiterbildung in die Bereiche „allgemeine Weiterbildung“, „politische Weiterbildung“ und „berufliche Weiterbildung“ soll ebenfalls nur am Rande geschehen. Im Zentrum dieser Arbeit steht vor allem der Bereich der beruflichen Weiterbildung, dennoch sind die Betrachtungen dieser Arbeit in Bezug auf alle drei Bereiche der Weiterbildung wichtig. Die spezielle Bedeutsamkeit der beruflichen Weiterbildung ergibt sich aus dem großen gesellschaftlichen Stellenwert von Beruf und Wirtschaft, die auf regelmäßige Weiterbildungen angewiesen sind. Die Bereiche der politischen Bildung sowie der der allgemeinen Weiterbildung werden zunehmend von Politik und Öffentlichkeit stiefmütterlich behandelt. Hier spiegelt sich der große Einfluss der Wirtschaft auf den Bereich der Politik sowie die zunehmend kritischer werdende Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder. Eine Untersuchung der Bedeutsamkeit dieser beiden Bereiche kann im Rahmen der Zielsetzung der Arbeit jedoch nicht geschehen.
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben sog. „erlebnisorientierte Lernumgebungen“, die vor allem auf informelle Lernprozesse in entsprechend arrangierten Erlebnisumgebungen setzen (vgl. Brinkmann 2003, S.163ff.). Im Zentrum dieser Betrachtung stehen formale Formen des selbstgesteuerten Lernens.
2. DIE GESELLSCHAFT IM WANDEL
Die Gesellschaft in der BRD befindet sich zurzeit in einem Wandel. Traditionalistische Strukturen, wie sie vor 100 Jahren deutlich vorzufinden waren, zerbrechen zusehends. Damals waren Biographien und gesellschaftlicher Status zu großen Teilen zum Zeitpunkt der Geburt festgelegt: „Die durch Geburt (…) erworbene Standeszugehörigkeit ist [zu dieser Zeit; F.S.] mit bestimmten Verpflichtungen, Privilegien oder Benachteiligungen verbunden, die die gesamte Lebensführung umgreifen“ (Geißler 1996, S. 30). Der Beruf, die Wahl des Ehepartners, politischer und religiöser Status, Kindererziehung oder Lebensstil waren durch den Stand der Eltern fast immer determiniert (vgl. ebd.). Mit dem Einsetzen der Industrialisierung brachen diese Strukturen bereits langsam auf, doch sind selbst heute noch Reste dieser durch Traditionen und Standesrecht geprägten Gesellschaftsstruktur zu entdecken. Beispiele finden sich in den traditionellen Familienformen, dem unterschiedlichen Zugang zu Bildungsinstitutionen nach sozialem Herkunftsmilieu und in den Strukturen der Handwerkskammern (vgl. ebd.).
Verschiedene Entwicklungen wie das Ende der Monarchie in Deutschland, die Einführung der Sozialversicherungen, die beiden Weltkriege, die Bildungsoffensive in den 70er Jahren u.ä. haben dazu geführt, dass die sozialen Schichten durchlässiger wurden und früh festgelegte Biographien immer seltener werden. Ein Strukturwandel einer Gesellschaft zeichnet sich jedoch am deutlichsten in der Beteiligung „…der drei Sektoren an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung (am Bruttosozialprodukt) und an der Verteilung der Erwerbstätigen auf die drei Sektoren“ (Geißler 2000, S. 19) ab. Der tertiäre Sektor, der Bereich der Dienstleistungen, zeigt ein hohes Wachstum, während der primäre (Landwirtschaft, Urgewinnung) und sekundäre Sektor (verarbeitendes Gewerbe, wie Industrie und Handwerk) eher rückläufig sind (zu den Sektoren vgl. Schäfers 2002, S. 176f.). Geißler beschreibt in aller Kürze die Entwicklung der deutschen Gesellschaftsstruktur anhand der drei Sektoren folgendermaßen:
„Bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts hinein war Deutschland eine Agrargesellschaft, mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen war im primären Sektor beschäftigt. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein durchlief Deutschland dann die Phase einer Industriegesellschaft: Immer mehr Erwerbstätige arbeiteten im sekundären Sektor - in den fünfziger und sechziger Jahren fast die Hälfte. Der Anteil der Erwerbstätigen im primären Bereich schrumpfte kontinuierlich - von gut einem Drittel um die Jahrhundertwende auf sieben Prozent im Jahre 1970. Gleichzeitig stieg der Anteil der Dienstleister kontinuierlich an und überholte in den siebziger Jahren den inzwischen rückläufigen Anteil der Erwerbstätigen in der Produktverarbeitung. Seit den siebziger Jahren ist Deutschland also zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden. Der tertiäre Sektor dominiert in der Beschäftigung und in der Wertschöpfung; er dehnt sich immer weiter aus, während der industriell-handwerkliche kontinuierlich zurückgeht und der Primärsektor auf einen kleinen, weiter schrumpfenden Rest zusammengedrückt wird. 1998 arbeiteten in den alten Ländern 64 Prozent der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor, 34 Prozent im Produktionssektor und nur noch 2,6 Prozent im primären Sektor. Allerdings ist dabei zu beachten, dass ein großer Teil der Dienstleistungen ´produktionsbezogen´ ist - sie dienen der Planung und Durchführung der Güterproduktion sowie der Verteilung der Güter. Daher ist es durchaus angemessen, die moderne Gesellschaft als eine industrielle Dienstleistungsgesellschaft zu bezeichnen" (Geißler 2000, S.19f.).
Das Erreichen der Stufe der Dienstleistungsgesellschaft ist jedoch nicht das Ende der Entwicklung der Gesellschaftsform. Die nächste Stufe, an deren Schwelle sich die BRD augenblicklich befindet, wird Informations- oder auch Wissensgesellschaft genannt. Abb.1 zeigt diesbezüglich eine Prognose für die Entwicklung der Sektoren bis 2010. Auf den vierten Sektor wird weiter unten noch eingegangen.
Abbildung 1: Das Sektoren-Modell von 1882-2010
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2000, S.36)
2.1 Auf dem Weg ZUR INFORMATIONSGESELLSCHAFT
Der Begriff der Informationsgesellschaft geht auf den japanischen Biologen und An-thropologen Tadao Umesao zurück, der in einem linearen Stufenmodell die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft von der Agrargesellschaft zur Informationsgesellschaft schon 1963 beschreibt und letztere als die höchste Entwicklungsstufe kennzeichnet (vgl. Kleinsteuber 1996, S.53). Die Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft steht jedoch nicht erst in ferner Zukunft an. Vielmehr ist „… Dieser Wandel (…) keine Vision, sondern bereits in vollem Gange“ (BMWi 1996, Vorwort).
Diese Entwicklung zeigt sich sowohl in der Entwicklung des Internet als auch des IT-Bereichs (IT: Informationstechnologie). So hat die Anzahl Erwerbstätiger in technischen Berufen sowie in Dienstleistungsberufen seit 1978 kontinuierlich zugenommen, in land- und forstwirtschaftlichen Berufen, sowie in Fertigungsberufen hingegen stetig abgenommen (siehe Abb.2).
Abbildung 2: Erwerbstätige nach Berufsbereichen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus bmbf 2000, S. 168)
Rürup schreibt hierzu:
„Zur Zeit findet eine ökonomische und technische Revolution statt, in der die Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) eine Schlüsselrolle einnehmen. Heute werden bereits mehr als 50 Prozent der Arbeitsplätze durch IuK-Techniken deutlich geprägt, und dieser Einfluss wird auch noch weiter zunehmen. Um die Entwicklung zu veranschaulichen, wird das klassische Drei-Sektoren-Modell um einen vierten Sektor ergänzt, in dem alle Informationstätigkeiten zusammengefasst werden“ (Rürup/Sesselmeier 2001, S. 250f.).
Gerade der vierte Sektor (vgl. auch Abb.1) zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass er von einem enormen Wachstum gekennzeichnet ist. Der technologische Fortschritt überholt Ausbildungs- und Studiengänge, so dass ein Großteil dessen, was das Individuum lernt, schon als veraltet gelten kann, sobald der Abschluss erreicht ist. Diese Tendenz zeichnet sich jedoch nicht nur im Informationssektor an sich, sondern gerade auch im primären, sekundären und tertiären Bereich ab. EDV-Kenntnisse sind im Berufsleben mittlerweile unabdingbar (siehe Abb.3).
Abbildung 3: Verbreitungsgrad computergestützter Arbeitsmittel nach Berufsbereichen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2000, S.35)
Die hohe Bedeutsamkeit von EDV-Kenntnissen zeigt sich auch in den Angeboten der Weiterbildung: Am 17.09.04 fanden sich beispielsweise im „Bildungsatlas“, einer regionalen Weiterbildungsdatenbank in der Region Mainz, Mainz-Bingen 348 Angebote zum Bereich IT von insgesamt 654 Angeboten, das entspricht etwa 53% (vgl. http://www.bildungsatlas-Mainz.de).
Im Kontext des zweiten Individualisierungsschubs[3], der seit den 50er Jahren feststellbar ist, wird die Verantwortung zunehmend auf das Individuum übertragen, mit diesem schnellen Entwicklungsprozess Schritt zu halten.
„Für den Einzelnen ist ständige Weiterbildung zur Entwicklung und Förderung beruflicher Qualifikationen und Kompetenzen, gesellschaftlichen Wissens, sozialer und kultureller Teilhabe, von Orientierungsvermögen, selbständigem Handeln und Eigenverantwortung unverzichtbar geworden“ (bmbf 1998, zit bei Straßner 2001, S.15).
Die Bedeutung dieser Eigenverantwortung ist in einem Rückgang dessen begründet, was Luhmann als „Erwartungssicherheit“ bezeichnet (vgl. Luhmann 1984, S. 412ff.).
Erwartungssicherheit meint hierbei die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von erwarteten kausalen Zusammenhängen, oder wie Luhmann formuliert: „ …die in sie [die Erwartungen; F.S.] eingebaute Erwartung der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des Erwarteten“ (a.a.O., S. 418).
2.2 SCHWINDENDE ERWARTUNGSSICHERHEIT
In traditionalistischen Gesellschaften herrschte ein hohes Maß an Erwartungssicherheit vor. Das lag zum Großteil an der Undurchlässigkeit sozialer Schichten. War man z.B. in einen Stand hinein geboren, gab es nur wenige Aufstiegschancen. Daran geknüpft war eine dementsprechend geringe Aussicht auf Veränderungen. Man wusste, was einen erwartete, sah man dies doch ständig um sich herum. Dennoch kann hier nicht von einer hohen Erwartungssicherheit gesprochen werden, waren doch die Biographie und das Einzelschicksal in weiten Teilen vom Schicksal der Familie, in die man eingebunden war, abhängig. „Das Leben war weniger ein planbarer Lebensweg als ein unvorhersagbares Schicksal, das durch Krankheiten, Tod, Missernten und ökonomische Schuldnerschaft bzw. Abhängigkeit gekennzeichnet war“ (Mayer 1998, S. 441). Eine Erwartungssicherheit war zynisch betrachtet lediglich in dem Fortbestehen des „Überlebenskam-
pfes“ und in der geringen Aussicht auf eine Verbesserung der eigenen Lebensverhältnisse vorhanden.
Von der Mitte des 19. Jh. bis etwa zur Weltwirtschaftskrise war in Deutschland eine neue Form von Lebensläufen erkennbar, deren Erwartungssicherheit Mayer mit dem Begriff „cycle of poverty“ (ebd.) bezeichnet: Für Männer zeichnete sich dies durch eine Lebensarbeitszeit vom 12. oder 14. Lebensjahr bis zur Arbeitsunfähigkeit aus. Entweder der sogenannte „Lebensberuf“, also ein Beruf, den man sein Leben lang ausführte und eine feste Bindung an einen Betrieb oder aber Arbeitslosigkeit waren die Regel. Frauen hingegen waren bis zur Eheschließung erwerbstätig, dann folgten Heirat, Auszug aus dem Elternhaus und Geburt des ersten Kindes in enger zeitlicher Folge (vgl. ebd.).
Von einer Erwartungssicherheit in Bezug auf planbare Lebensläufe kann erst von der Nachkriegszeit bis in die 60er/70er Jahre gesprochen werden:
„Mit den institutionellen Reformen und der Expansion des Bildungswesens setzte sich ein
differenziertes Muster von Bildungsverläufen historisch erstmalig - auch für Frauen - durch:
Kindergarten und Vorschule, Grundschule und für eine Mehrheit weiterführende Schulen bis
zur Mittleren Reife oder zum Abitur, daran anschließend eine qualifizierte Berufsausbildung
oder ein Hochschulstudium. Der Eintritt in den Beruf erfolgt rasch und wird durch das
Ausbildungsniveau und die berufliche Ausbildungsrichtung bestimmt. Die Berufslaufbahn ist - für Männer - geprägt durch Vollbeschäftigung, unbefristete Arbeitsverträge, berufliche Aufstiege und mit dem Alter steigende Realeinkommen“ (ebd.).
In dieser Zeit war eine Institutionalisierung von Lebensphasen kennzeichnend.
Sowohl die Einführung der an das Nettoeinkommen angepassten, flexiblen Rente, als auch eine höhere Durchlässigkeit im Bildungssystem und die Wandlung in den wirtschaftlichen Sektoren eröffnen neue Berufseinstiegs- und -aufstiegschancen.
Der Zeitpunkt der ersten Geburt bei Frauen verschiebt sich aufgrund längerer Ausbildungszeiten nach hinten, Kündigungsschutz und Sozialversicherungssysteme bieten einen hohen Schutz: Die Erwartungssicherheit hat am Ende dieser Phase ihren Höhepunkt erreicht.
Zu dieser Zeit prägten sich „Standardbiographien“ oder „Normalbiographien“ aus. Diese setzten sich hauptsächlich aus drei zeitlichen Abschnitten zusammen: Kindheitsphase (Kleinkindphase und Schulzeit), Erwachsenenstatus (Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit) und abschließend die Seniorenphase (Ruhestand bis zum Tod) (vgl. Hurrelmann 2003, S. 117f.).
Ab den 70ern schließlich sind deutliche Veränderungen feststellbar. Berufswechsel werden häufiger, alternative Familienstrukturen und Formen des Zusammenlebens entstehen, die traditionelle Kernfamilie und die berufliche Karriereorientierung an einzel-
nen Betrieben verlieren an Bedeutung. Erziehungspausen von der Erwerbstätigkeit wird auch bei Männern gesellschaftlich eher toleriert. Die Standardbiographien behalten zwar noch ihre Gültigkeit als System von Erwartungssicherheiten, jedoch wird die Planung des Lebenslaufs zunehmend experimentierfreudiger gestaltet (vgl. Mayer 1995, S. 30).
Ein Grund für diese Entwicklung wird in der zunehmenden Individualisierung gesehen[4]. In der folgenden Grafik (Abb.4) wird beispielhaft der prozentualen Anteil der Häufigkeit des Wechsels von Lebensformen (Ehegemeinschaft u.ä.) nach Geburtsjahrgängen (Kohorten) dargestellt.
Abbildung 4: Verteilung der Zahl der Lebensformwechsel bis zum Alter von 35 Jahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: Brüderl, J. 2004, S.6 )
Dieser Individualisierungsschub ist jedoch nicht getrennt von den institutionellen Rahmenbedingungen zu sehen. Die Freiheiten, die zu einer solchen Individualisierung führten, wurden gestützt durch das Vorhandensein von sozialstaatlichen Versicherungssystemen, die derzeit eine hohe Erwartungssicherheit boten. Ulrich Beck bezeichnet diese Phase auch als „Vollkasko-Individualisierung“ (Beck 1994, S.27). In der Gegenwart hat sich diese Situation grundlegend verändert: Die sozialen Versicherungssysteme haben mit der demographischen Entwicklung, der wirtschaftlichen Konjunktur-
schwäche sowie den finanziellen Folgen der Wiedervereinigung zu kämpfen. Beck spricht davon, dass „…vorgegebene Biographien (…) durch Risikobiographien ersetzt [werden; F.S.]. An die Stelle von Normalbiographien treten "Wahlbiographien", treten "Bastelbiographien", treten "Bruchbiographien" oder auch "Zusammenbruchsbiogra-
phien" oder treten, was wir ja jetzt auch im Westen stärker erleben, "Drahtseilbiographien" …“ (Beck 1994, S.29). Er benennt die Gesellschaftsform, in der wir uns derzeit befinden, dementsprechend als die einer „Risikogesellschaft“. Diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass bei steigender Individualisierung der private Versicherungsschutz hier nicht mehr vorhanden ist (vgl. a.a.O., S.30). Während die Individualisierung in den 70ern/80ern also noch unter dem Schutz einer Beständigkeit der sozialen Sicherungssysteme stattfand, stellt sich heute eine fast umgekehrte Situation dar: Aufgrund der Rentenproblematik, den Defiziten bei den gesetzlichen Krankenversicherungen und der allgemein angespannten öffentlichen Finanzsituation, besteht ein hohes Maß an Unsicherheit. Steigende Arbeitslosigkeit auf der einen und steigende berufliche Anforderungen auf der anderen Seite, gepaart mit einer Deinstitutionalisierung (vgl. Mayer 1998, S. 444) bedingen ein höheres Maß an Bereitschaft zu individuellen Biographien, die der Vielzahl von sozialen Problemen gerecht zu werden versuchen.
Besonders deutlich wird dies an einer besonderen Art der Individualisierung zurzeit der Wiedervereinigung: Beck spricht hier von einer „Zusammenbruchsindividualisierung“ (Beck 1994, S. 28), d.h. es fand eine schlagartige Entkopplung von allen bis dahin gültigen Erwartungssicherheiten in Bezug auf Ausbildung und Beruf, Standardbiographien und Wertesystemen statt (vgl. ebd.). Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten „Individualisierungsschock“ (vgl. Stutz 2004, S.18). Dabei war nach Geißler gerade in der DDR ein hohes Maß an staatlich garantierter sozialer Sicherheit eine verlässliche Größe (vgl. Geißler 1996, S. 246). Dies änderte sich mit der Wende schlagartig: „Ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit hat sich über Nacht in ein Übermaß an Unsicherheit verkehrt“ (ebd.).
2.3 Sicherheit des Arbeitsplatzes und Weiterbildung
Externe Arbeitsmarkteinbrüche, wie zurzeit der Wende, nach der die wirtschaftlichen Sektoren eine enorme Umschichtung durchliefen, zeigen sehr deutlich die Problematik der Sicherheit des Arbeitsplatzes auf.
Dies ist insbesondere anhand der Geschichte der ehemaligen DDR interessant zu betrachten, da eine ähnliche Umschichtung zwar auch in der BRD vor sich gegangen ist, bzw. noch immer vor sich geht, jedoch über einen wesentlich längeren Zeitraum. Die Umschichtung gestaltete sich nach der Wende in den neuen Bundesländern dadurch zwar erheblich dramatischer, doch stellt dies auch die individuellen Anforderungen an den Einzelnen umso deutlicher heraus, die sich auch in den alten Bundesländern ergeben.
Während in der Bundesrepublik der tertiäre Sektor stetig wuchs und primärer sowie sekundärer Sektor schrumpften, blieb eine solche Entwicklung in der DDR größtenteils aus (vgl. Geißler 1996, S.136ff.). Geißler spricht hier von einem „Tertiärisierungsrückstand der DDR“ (Geißler 1996, S.136).
Abbildung 5 : Erwerbstätige nach Produktionssektoren (1950-1993) Ost und West
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: Geißler 1996, S. 137)
Abb. 5 zeigt einen Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland, aus dem besonders die sprunghafte Verschiebung ab 1990 in den einzelnen Sektoren deutlich hervorgeht. Vor 1990 waren der primäre und sekundäre Sektor in der DDR stärker ausgeprägt als in der BRD. Mit dem tertiären verhielt es sich, wie oben bereits erwähnt genau entgegengesetzt. Die Angaben sind prozentual gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen, so geht Arbeitslosigkeit als ein entscheidender Faktor hieraus leider nicht hervor.
Durch das gesetzlich garantierte Recht auf Arbeit in der DDR spielte Arbeitslosigkeit dort bis zur Wende keine große Rolle (vgl. Geißler 1996, S. 203). Nach der Wende stieg mit dem Zusammenbruch der bestehenden Strukturen die Arbeitslosigkeit rasant an (siehe Abb.6). Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Beim Übergang von Planwirtschaft zu sozialer Marktwirtschaft hielten viele Betriebe der wachsenden Konkurrenz nicht Stand. Wenig Erfahrung mit betriebswirtschaftlichen Fragen, eine Abwertung der eigenen Bildungsabschlüsse, der Anstieg der Lebenshaltungskosten, der Wegfall von sozialen Sicherungs- und Betreuungssystemen (z.B. Kinderbetreuung), Veränderungen in der Familienstruktur (vgl. Geißler 1996) sind nur als einige Gründe zu nennen[5].
Abbildung 6 : Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslose in den neuen Bundesländern 1990-1998
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: Geißler 1996, S. 206)
Die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland ist schon vor 1990 kein reines Randgruppenphänomen mehr. Im Zeitraum von 1974 bis 1985 war etwa jeder Dritte der Erwerbstätigen mindestens einmal arbeitslos (vgl. Welzer u.a., 1988, S.18). Die Ursachen hierfür benennt Hradil wie folgt:
„Die (…) Phase der Massenarbeitslosigkeit begann im Jahre 1974. Sie betrifft seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 vor allem auch die Menschen in den neuen Bundesländern. Die Beschäftigungsentwicklung war seit Mitte der 70er Jahre geprägt durch mehrere Rezessionen (1974/75, 1981/82, 1992/93). In deren Folge wurden jedes Mal Arbeitsplätze abgebaut.
Der Abbau von Arbeitsplätzen konnte zwar nach jeder Rezession in den Phasen wirtschaftlicher Erholung wieder vollständig durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze ausgeglichen werden. Aber die jeweiligen Steigerungen der Arbeitslosigkeit konnten infolge des anhaltenden Zustroms von Arbeitssuchenden auf den Arbeitsmarkt niemals wieder vollständig rückgängig gemacht werden. So erhöhten die Wirtschaftskrisen jeweils den ´Sockel’ an Arbeitslosigkeit und aus konjunktureller wurde strukturelle Arbeitslosigkeit. Dies drückt sich in einem treppenförmigen Anstieg der Arbeitslosenquote seit 1973 aus. (…) Berücksichtigt man dieses Beschäftigungswachstum, so ist zu erkennen, dass die seit 1974 steigende Arbeitslosigkeit in Westdeutschland letztlich auf die Vermehrung der Erwerbspersonen zurückzuführen ist. Hauptsächlich ist dies in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung von Frauen begründet, die durch Erwerbstätigkeit und die davon abhängige soziale Sicherung ihr eigenes Leben gestalten wollten oder mussten" (Hradil 2001a, S. 188ff.).
Ulrich Beck kommt zu einem ähnlichen Schluss: Der höhere Anteil von Frauen in den qualifizierten Ausbildungsbereichen fand keinen ausreichenden Niederschlag in den Strukturen des Arbeitsmarktes (vgl. Beck 1986, S.166f.). Kennzeichnend ist hierbei vor allem, dass Frauen neben Niedrigqualifizierten, Älteren und Menschen mit gesundheitlichen Defiziten ein besonders hohes Risiko haben, in die Langzeitarbeitslosigkeit zu gelangen (vgl. Geißler 1996, S. 194). Generell ist, wie in Abb. 6 dargestellt, Arbeitslosigkeit für den größten Teil der Betroffenen jedoch nur von kurzer Dauer und eine „…relativ schnell vorübergehende Erfahrung“ (ebd.).
Unter diesen Gesichtspunkten sticht aus den benannten Risikogruppen eine besonders hervor: Die Gruppe der Niedrigqualifizierten. Unter gleichbleibenden strukturellen Rahmenbedingungen ist hier der zentrale, wenn auch nicht hinreichende Ansatzpunkt für ein Vermeiden der Langzeitarbeitslosigkeit erkennbar: Ein hohes Qualifikationsniveau schützt am besten vor Langzeitarbeitslosigkeit. Alter, Geschlecht und Erkrankungen entziehen sich hingegen meist der direkten und bewussten Einflussnahme. In diese beiden Kategorien untergliedert auch Geißler: „Die strukturellen Ursachen dafür, daß „der Arbeitsgesellschaft teilweise die Arbeit ausgeht“, sind zu zwei Komplexen zu bündeln: demographische Faktoren (…) und technologische Faktoren beeinflussen wesentlich das Angebot an bezahlter Arbeit“ (ebd.).
Unter demographischen Faktoren ist hierbei vor allem die Zahl der Arbeitssuchenden und –fähigen im Verhältnis zu den vorhandenen Arbeitsplätzen zu verstehen, unter technologischen Faktoren der technische Fortschritt, der über die Einführung neuer Techniken eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität bei gleichzeitiger Rationalisierung und Verminderung von Arbeitsplätzen ermöglicht. Geißler berechnet hierzu, „… daß jährlich ca. 2,5-3% Wirtschaftswachstum nötig sind, um die rationalisierungsbedingte „Arbeitsvernichtung“ auszugleichen“ (a.a.O., S. 195)[6].
Demographisch wird sich die Arbeitsmarktlage voraussichtlich in naher Zukunft wieder deutlich verbessern. Dies liegt darin begründet, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und die geburtenschwachen Jahrgänge nachfolgen, was zur Folge hat, dass die freigewordenen Stellen nicht vollständig besetzt werden können. Technologisch werden sich neue Arbeitsbereiche eröffnen, die jedoch andere Arbeitsformen und Qualifikationen erfordern. Die Arbeit wird sich wandeln, aber wohl nicht „ausgehen“. Hradil gibt die Prognose:
„Trotz alledem wird der Arbeitsgesellschaft wohl die Arbeit nicht ausgehen, auch nicht die Erwerbsarbeit. Die o.a. Altersstrukturentwicklung wird in einigen Jahren die Nachfrage nach Erwerbsarbeit sinken und Arbeitskräftemangel entstehen lassen. Da immer höhere Qualifikationen gesucht werden und per saldo Arbeitsplätze vor allem im Bereich der Humandienstleistungen und der neuen Technologien entstehen, werden Arbeitskräfte zuerst und vor allem dort rar werden. Dem wird freilich Arbeitslosigkeit von gering Qualifizierten gegenüberstehen“ (Hradil 2001, S. 398).
Hier findet sich erneut die These, dass eine hohe berufliche Qualifikation vor Arbeitslosigkeit schützt. In Abb.7 wird die qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten in Ost- und Westdeutschland aufgezeigt, die diese These zu untermauern scheint.
Bildungssystem und Arbeitsmarkt stehen in einem Wechselverhältnis (vgl. Thevißen 2002, S.199). Aufgrund der föderalistischen Struktur des öffentlichen Bildungswesens in Deutschland ist dieses Wechselverhältnis jedoch nicht unmittelbar, sondern durch eine eher träge Reaktionsfähigkeit in Bezug auf bundesweite Veränderungen gekennzeichnet. Die Länder Bayern, Sachsen und Thüringen stoppten beispielsweise zuletzt die jüngst eingeführte „Junior-Professur“ (vgl. Hartung 2004, o.S.), da die gesetzliche Kompetenz, solche Neuerungen einzuführen, auf Landesebene und nicht auf Bundesebene liegt. Hier muss für bundesweite Änderungen erst Einigkeit zwischen den Ländern herrschen.
Abbildung 7: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten OST/WEST
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2000, S.12)
Über die rechtlichen Grundlagen der Zuständigkeiten soll durch die folgende Abbildung eine Übersicht ermöglicht werden:
Abbildung 8: Gesetzliche Grundlagen der Weiterbildung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: Faulstich 2004, S.64)
Während der Bund für das Arbeitsrecht (Art. 74 Nr. 12 GG) zuständig ist, liegt die Kulturhoheit bei den Ländern (Länderzuständigkeit für allgemeine Weiterbildung: Art. 30 i.V. Art. 70 GG). Dies führt zu einer „…institutionellen Desintegration von „beruflicher“ und „allgemeiner“ Weiterbildung in Deutschland…“ (Faulstich 2004, S. 63). Eine Rahmenordnung für Weiterbildung existiert auf Bundesebene bislang nicht. Die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche und Geltungsbereiche, also auf Bundesebene vor allem sozial- und arbeitsrechtliche Regelungen, auf Länderebene Regelungen innerhalb des Rechts des Bildungswesens, bedingen verschiedene Entwicklungen in den unterschiedlichen Weiterbildungssektoren, „…weil strukturpolitisch sehr unterschiedliche Ziele mit der Gesetzgebung verfolgt werden“ (a.a.O., S.64). Die Landesgesetze zur Weiterbildung unterscheiden sich zwar von Land zu Land, in Berlin und Hamburg wurden bisher noch gar keine eigenständigen Weiterbildungsgesetze verabschiedet, dennoch lassen sich bei den übrigen Ländern generelle Regelungsbereiche feststellen. Die Landesgesetzgebung regelt vor allem die Aufgabenstellung und Einordnung der Erwachsenenbildung im Bildungswesen, die Stellung, Abgrenzung und Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen und –trägern, deren Förderung und Unterstützung sowie die Abstimmung und Kooperation der Einrichtungen. Speziell bei der Förderung und der Gewährung von öffentlichen Zuwendungen bestehen jedoch Unterschiede bei der Bemessungsgrundlage, Zeitbindung der Zuwendungen nach aktuellen Finanzierungsplänen oder nachträglichen Bezuschussungen, der Trennung von Sachkosten und Personalkosten, der Gewichtung von Themen, Arbeitsformen und ähnlichem in der Einteilung der Sachkosten und der Größenordnung von zusätzlichen öffentlichen Mitteln für Lern- und Lehrmittel, bauliche Maßnahmen, Projekte und Modellvorhaben (vg. a.a.O., S. 65). In allen Ländern ist die Anerkennung der Träger und Einrichtungen eine Vorraussetzung für Förderungsfähigkeit. Die Zuschüsse sind meist auf bestimmte Bereiche beschränkt, etwa die finanzielle Förderung der Kosten des hauptberuflichen Personals, der sogenannten hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter (HPM), Bildungsveranstaltungen (z.B. förderungs-fähige Seminare), Projekte oder Modellvorhaben. Relativ neu ist hierbei der Einbezug von Qualitätsaspekten in die Zuschussgewährung: Diese setzt mittlerweile oft das Vorhandensein einer Qualitätssicherung voraus, etwa nach ISO 9000ff.. Bei allen Ländern ist das Ausmaß der finanziellen Mittel an den Landeshaushalt gekoppelt und damit Schwankungen unterlegen. (vgl. a.a.O., S. 70ff.).
Die steigende Bedeutsamkeit der Weiterbildung hat jedoch in den Finanzierungsrahmen der Länder nur wenig Niederschlag gefunden: „Mittlerweile haben alle Länder die im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel zur Zuschussgewährung eingeschränkt“ ( a.a.O., S.71). Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen heben sich in ihren Ausgaben für Weiterbildung jedoch deutlich von den anderen Bundesländern ab (siehe Abb.9).
Abbildung 9: Angaben der Kultusministerkonferenz zu den Ausgaben der Bundesländer für Weiterbildung 1998 je Land in Mio. DM
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: a.a.O. S. 111)
Ebenso findet sich bei einigen Ländern eine Diskrepanz zwischen der breiten Zustimmung für die Wichtigkeit ständiger Weiterbildung und der Schaffung eines rechtlichen Rahmens. Dies zeigt sich z.B. an dem Vorhandensein oder Fehlen von Bildungsfreistellungsgesetzen, bzw. Bildungsurlaubsgesetzen. So existiert weder in Baden-Württemberg noch in Bayern oder Sachsen eine Bildungsfreistellung, die einen zeitlichen Rahmen für Weiterbildungsmaßnahmen gesetzlich gewährleistet. Einrichtungen wie die Kultusministerkonferenz (KMK) sollen dazu beitragen, einen ständigen Dialog zwischen den Ländern zu gewährleisten. Aufgrund der unterschiedlichen Ansichten gestaltet sich jedoch eine gemeinsame Handlungsabstimmung in der Praxis schwierig, wie an der aktuellen Diskussion um Ganztagsschulen als Konsequenz auf die Ergebnisse der OECD-Studie (vgl. bmbf 2002a) verfolgt werden kann. Hinzu kommt, dass es, wie oben bereits angesprochen, kaum mehr klassische Bildungswege gibt, die direkt und untrennbar mit einem eindeutigen Berufsbild verbunden sind. Beck spricht davon, dass aufgrund von anhaltender Massenarbeitslosigkeit „… die bildungsimmanente Sinngrundlage berufsorientierter Ausbildung gefährdet, bzw. zerstört…“ (Beck 1986, S. 237) wird. Die Institutionen sind nach Beck größtenteils an Standardbiographien orientiert (vgl. a.a.O., S. 214f.), die in dieser Form jedoch nicht oder kaum mehr existieren. Veränderte Bedingungen sind für das Individuum zwar aus der Beobachtung seiner Umwelt heraus deutlich sichtbar, doch findet es kaum angepasste institutionelle Angebote. Aus dieser Diskrepanz resultiert im Zuge der Individualisierung eine Haltungsänderung, was die Wahl des Bildungsweges anbelangt. Ziel ist nicht mehr vordergründig, einen bestimmten Beruf zu erlernen, sondern vielmehr die Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Beck schreibt hierzu:
„In der individualisierten Gesellschaft muß der einzelne entsprechend bei Strafe seiner permanenten Benachteiligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen“ (a.a.O., S.217).
und später
„Junge Menschen bleiben länger in den Schulen, wählen oft eine Zusatzausbildung, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden“ (a.a.O., S. 237).
Es liegt also an dem Einzelnen, sich um eine möglichst breit gefächerte Qualifikation zu bemühen, stets im Bewusstsein, dass es „Lebensberufe“, d.h. Berufe, in denen das Individuum von der Ausbildungsphase bis zum Ruhestand dauerhaft verweilt, nur noch selten zu geben scheint und stattdessen mit beruflichen Neuorientierungen gerechnet werden muss (vgl. Wittwer 2003, S.118f.).
So stellt aufgrund der rasanten technologischen, wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Entwicklungen, die bereits erlernte Inhalte und Instrumentarien für den Berufsalltag rasch veralten lassen, „… eine berufliche Erstausbildung nur noch selten eine Vorbereitung für einen Lebensberuf dar“ (Tippelt 1990, S. 66f..). Der Beruf als „sich zu etwas berufen fühlen“ tritt ebenfalls in seiner Bedeutung eher in den Hintergrund, versteht man ihn als „Fachmenschentum als Lebensstil“ (Weber 1973, S. 379). Er ist weiterhin als Mittel zur Erlangung des Lebensunterhalts von zentraler Bedeutung, eine „Berufung“ im Sinne einer lebenslangen arbeitsteiligen Spezialisierung scheint er jedoch kaum mehr zu sein (vgl. Arnold 1999, S. 248f.). Hierbei tritt sehr stark der Bereich der beruflichen Weiterbildung in den Vordergrund. Die zentrale Bedeutung von Weiterbildung ist weiten Teilen der Bevölkerung durchaus bewusst (vgl. a.a.O., S. 245), dennoch kann man bezweifeln, dass „… Weiterbildung mangelnde Bildungsvoraussetzungen ausgleichen, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes schützen und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen kann. (…) Weiterbildung [wird; F.S.] in dieser Situation nahezu paradox nicht zur hinreichenden, aber in jedem Fall zur notwendigen Bedingung für berufliche und soziale Integration“ (Barz/Tippelt 1999, S.131). Weiterbildung alleine kann dementsprechend aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Komplexität der Arbeitsmarktstrukturen nicht als alleinige Garantie für eine berufliche Sicherheit Geltung erlangen[7], wird jedoch von Seiten der Arbeitgeber bereits vorausgesetzt und ist aufgrund der steigenden Beteiligung und damit durch den Konkurrenzdruck zunehmend unabdinglich.
Hinzu kommt eine inhaltliche Neuerung, die gerade von der Seite der Arbeitgeber eine entscheidende Bedeutung erhält: Die Vermittlung von sogenannten Schlüsselkompetenzen. Unter Schlüsselkompetenzen ist eine Erweiterung der Fachkompetenz um Methoden- und Sozialkompetenzen zu verstehen (vgl. Arnold 1999, S. 246). Arnold bringt dies folgendermaßen auf den Punkt:
„Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (…) werden nicht mehr nur über fachliches Wissen verfügen können müssen; es wird vielmehr entscheidend sein, ob sie auch Probleme selbständig lösen, sich neues Wissen selbst erarbeiten (Methodenkompetenz) und im Team erfolgreich kooperieren und produktiv kommunizieren können (Sozialkompetenz). Mit der zunehmenden Umschlagsgeschwindigkeit des Fachwissens in den technischen Disziplinen und den verbesserten Möglichkeiten, Detailwissen in Datenbänken und Expertensystemen rasch abrufbar bereitzuhalten, verliert das Fachwissen sogar seine dominierende Funktion, während Methodenkompetenz (…) sowie Kommunikations- und Koope-
rationsfähigkeiten immer mehr zum eigentlichen Kern der beruflichen Handlungskompetenz werden“[8] (ebd.).
Gerade diese Schlüsselkompetenzen, sofern man sie auch als reflexive Vorgänge
begreift, d.h. beispielsweise „Lernen zu Lernen“ und währenddessen bisherige Lernerfahrungen selbstreflexiv zu betrachten, bergen die Möglichkeit, benachteiligende Bildungsvoraussetzungen zum Teil zu kompensieren. Die Problematik hierbei besteht neben einem erfolgreichen Prozess der Aneignung vor allem darin, sogenannten bildungsferne Schichten zu motivieren, entsprechende Angebote zu nutzen.
Der Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit zu sozialen Schichten und Mili-
eus und den Chancen im Bildungssystem soll deshalb genauer betrachtet werden.
2.4 soziale Ungleichheit In Schule und Studium
Bildung soll für alle gleichermaßen frei zugänglich sein und damit die Grundlage für eine Chancengleichheit sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bezüglich der Selbstverwirklichung und der sozialen Lage bieten. Entscheidend hierfür wäre im Idealfall eine generelle Offenheit von Bildungsinstitutionen für jeden, eine realistische Finanzierbarkeit für den Einzelnen, eine vergleichbare Qualität der Angebote sowie ein möglichst objektives Messinstrument zur Beurteilung von Lernerfolgen auf Seiten der Institutionen, ein hohes Maß an Motivation, Lerntechniken und Interesse auf Seiten der Lernenden sowie fachliches und methodisches Know-How und Beratungs- und Förderungskompetenz auf Seiten der Lehrenden. Dieses hier skizzierte Idealbild von Rahmenbedingungen findet sich in der Realität jedoch kaum. Das Bildungssystem entspricht auch in Teilen seiner Aufgabenstellung nur bedingt dem Prinzip der Chancengleichheit: Selektion und Statuszuweisungsfunktion sind elementare Bestandteile von Bildungssystemen in modernen Leistungsgesellschaften (vgl. Geißler 1996, S.249f.).
Die Selektion findet jedoch nicht ausschließlich anhand von Leistung statt:
„… -ob gewollt oder ungewollt- (…) Soziale Merkmale der jungen Menschen – ihre soziale Herkunft, ihre Nationalität, ihr Geschlecht, ihre regionale Herkunft – beeinflussen ihre Bildungskarrieren, entweder unabhängig von ihrer Leistung oder auch, weil Leistungen z. T. mit Lebensbedingungen zusammenhängen, die wiederum mit den sozialen Merkmalen verknüpft sind“ (ebd.).
Im Schulsystem ist die Wahl des Bildungsweges, bzw. der erreichte Schulabschluss des Schülers stark von der sozialen Herkunft und Bildungsbiographie der Eltern geprägt:
„Nur 32 Prozent der Kinder von Beamten ohne mittlere Reife besuchen das Gymnasium gegenüber 77 Prozent der Kinder von Beamten, die mindestens das Abitur haben. Fast genauso stark sind die Unterschiede bei den Angestellten. Bei den Selbständigen sieht es ähnlich aus: Rund 85 Prozent der Kinder von Selbständigen außerhalb der Landwirtschaft, die über einen Hochschulabschluß verfügen, besuchen das Gymnasium, gegenüber nur 16 Prozent der Kinder von Selbständigen in der Landwirtschaft“ (Köhler 1992, S.42).
Wie Abb.10 zeigt, setzt sich dieser Trend bis heute fort.
Abbildung 10: 17- und 18jährige SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe im April 2000 nach beruflicher Stellung der Eltern1 in% aller gleichaltrigen Kinder bei Ehepaaren der jeweiligen beruflichen Stellung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2004b, S.102)
Isserstedt u.a. benennen in der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks fünf Schwellen, die auf dem Weg zum Hochschulabschluss zu überwinden sind:
1. Der Übergang von Grundschule zu Haupt-/Realschule/Gymnasium
2. Der Übergang von Sekundarstufe I zu Sekundarstufe II (10.Klasse)
3. Der Erwerb einer Studienberechtigung
4. Realisierung der Studienberechtigung
5. Bestehen der Abschlussprüfungen
(vgl. bmbf 2004b, S.94f.)
Besonders die ersten beiden Schwellen üben eine hohe Selektionswirkung aus (vgl. ebd.) und sind besonders anfällig für eine Beeinflussung durch die Einschätzung des individuellen sozialen Hintergrunds (vgl. bmbf 2004b, S. 98f.). Das Ausmaß dieser Se-
lektion wird an Abbildung 11 deutlich: während von 100 Kindern mit einer hohen sozialen Herkunft 81 ihren Hochschulzugang nutzen, sind es von 100 Kindern mit niedriger sozialer Herkunft gerade noch elf.
Abbildung 11: Bildungstrichter: Schematische Darstellung sozialer Selektion 2000
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2004b, S.119)
Da beide Schwellen entscheidend für den Erwerb der Hochschulreife sind, finden sich bei Hochschulabsolventen ebenfalls deutliche Ungleichheiten in Zusammenhang mit ihrer sozialen Herkunft (siehe Abbildung 12).
Abbildung 12: Bildungsbeteiligung der 19-24jährigen an Hochschulen nach sozialer Herkunft1 2000 und Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus bmbf 2004b, S.118)
Es zeigt sich hieran auch, dass die soziale Herkunft den Bildungsweg sowohl von Männern als auch von Frauen in gleichem Maße beeinflusst. Das Geschlecht spielt in Bezug auf die Hochschulbeteiligung also zunächst keine entscheidende Rolle mehr. Allerdings ist zu beachten, dass in allen neuen Bundesländern die Situation nicht der im Westen entspricht: „Hier liegt der Anteil studienberechtigter Männer seit Jahren deutlich unterhalb der Studienberechtigtenquoten der Frauen“ (a.a.O., S.104). Ebenso ist ein genereller Anstieg der Beteiligung an Bildung zu verzeichnen, d.h. generell nimmt die Anzahl von Personen mit hochqualifizierten Abschlüssen zu. Gleichzeitig scheint jedoch auch die Selektion nach sozialer Herkunft zuzunehmen, wie durch Abbildung 13 verdeutlicht wird.
Abbildung 13: Entwicklung der sozialen Zusammensetzung der Studierenden nach Herkunftsgruppen seit 1982*
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(entnommen aus: bmbf 2004b, S.137)
Diese aufgezeigten sozialen Ungleichheiten in den Bildungsinstitutionen Schule und Hochschule wirken sich entscheidend auf den Bereich der Weiterbildung aus und eröffnen ihm gleichzeitig neue Möglichkeiten, wie im Folgenden betrachtet werden soll.
2.5 Auswirkungen auf den Bereich der Weiterbildung
Schon seit den 70er Jahren zeigen empirische Studien, dass die Teilnahme an Angeboten der Weiterbildung stark vom Niveau der Schul- und Ausbildung abhängig sind (vgl. Barz/Tippelt 1999, S. 128). Je höher der Grad der Schulbildung oder das Ausbildungsniveau und damit verbunden auch der jeweils soziale und berufliche Status sind, desto höher ist die aktive Beteiligung an Weiterbildungsangeboten. Bereits benachteiligte Gruppen, wie die oben beschriebenen, sind im Gegenzug deutlich unterrepräsentiert (vgl. ebd.). Eine aktuelle Studie von Kuwan u.a. ergab, dass die Beteiligung von Personen mit Abitur an Weiterbildung in etwa doppelt so hoch ist wie die von Personen mit Hauptschulabschluss (vgl. Kuwan u.a. 2001, S.10). Es stellte sich weiterhin heraus, dass die Schulbildung der einflussreichste Faktor für die Weiterbildungsbeteiligung ist (ebd.), gefolgt von der Erwerbsbeteiligung, d.h. ob die entsprechende Person zurzeit
erwerbstätig ist oder nicht (ebd.). Kuwan u.a. fassen dies als Weiterbildungsbeteiligung nach dem „…Matthäus-Prinzip: „Wer hat, dem wird gegeben“ “ (a.a.O., S.11) zusammen.
Unter dem Aspekt der Chancengleichheit ist dieses Ergebnis recht ernüchternd. Es lässt vermuten, dass die Chancen schon bei der Überwindung oder Nichtüberwindung der ersten beiden Schwellen im Bildungssystem (s.o.) verteilt werden und kaum eine Möglichkeit für ein „Aufholen“ der Benachteiligten besteht. Unter dem Aspekt des schnellen technischen Fortschritts und der ständig erforderlichen Nachqualifikation sprechen jedoch DIHT (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) und ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) davon, den Abschluss einer Berufsausbildung als Basisqualifikation für Weiterbildungsnutzung anzusehen (vgl. DIHT 2001, S.3). In dieser Sichtweise erhält die Weiterbildung einen neuen Stellenwert: „Wenn Wissen und Kompetenzen stets aktualisiert werden müssen, relativiert sich das, was inhaltlich in Schule und Ausbildung einmal gelernt wurde“ (Brühning o.J., S.2).
Der Weiterbildungsbereich findet im Moment also günstige Rahmenbedingungen vor, um neben der zentralen Aufgabe, Kompetenzen zu vermitteln, eine entscheidende Rolle im Aufbrechen sozialer Ungleichheiten zu spielen. Die Problematik, die sich jedoch zuvorderst stellt, ist weiterhin die der Erreichbarkeit sogenannter Bildungsferner, d.h. Personen, die nicht oder kaum an Weiterbildungsangeboten teilnehmen.
Kuwan nennt hier als entscheidenden Faktor die „Weiterbildungstransparenz“, d.h. das Vorhandensein eines guten Überblicks über die verfügbaren Angebote (vgl. Kuwan u.a., S.10). Dieser Faktor für die Nutzung der Angebote ist vor allem für Personen mit niedriger Schulbildung von großer Bedeutung (vgl. ebd.), also den Großteil der Gruppe der Bildungsfernen. Die große Zahl an Weiterbildungsanbietern mit unterschiedlichsten Schwerpunkten und Angeboten erschwert eine solche Transparenz jedoch zunehmend.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt deshalb zurzeit im bundesweiten Projekt „Lernende Regionen“ den Aufbau von regionalen Netzwerken mit dem Ziel, eine höhere Transparenz und Durchlässigkeit sowie eine enge Kooperation regionaler Weiterbildungsakteure zu erzielen. Als eines der Ziele wird auch ausdrücklich benannt, dass „…die Motivation und Bildungsbeteiligung der Menschen, insbesondere bisher bildungsferner und benachteiligter Personen, gesteigert sowie die Befähigung zum selbständigen Lernen gefördert …“ (bmbf 2001, S.12) werden soll. Im Rahmen dieses Projekts entstand dann beispielsweise die „Lernende Region Mainz/Mainz-Bingen“, verkörpert durch das Projekt „Step on!“ unter Federführung des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Dort wurde beispielsweise eine höhere Transparenz im Weiterbildungsbereich durch die Einrichtung einer Online-Datenbank mit den Angeboten der kooperierenden Weiterbildungsträger erreicht (siehe www.bildungsatlas-mainz.de). Der größte Weiterbildungsträger der Region, die Volkshochschule Mainz, hat sich allerdings bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit nicht an der Initiative beteiligt. Dies zeigt eine der Schwierigkeiten, eine solche Transparenz zu erzielen, nämlich dass die Gesamtheit der Weiterbildungsträger für eine umfassende Übersicht auch die entsprechende Kooperationsbereitschaft zeigen muss. Ebenso ist die reine Einrichtung einer solchen Datenbank noch nicht hinreichend. Ein entscheidender Faktor ist schließlich auch im Bekanntheitsgrad einer solchen Plattform zu suchen. Um Bildungsferne, die teilweise keine oder wenig Eigeninitiative oder auch unzureichende Möglichkeiten gefunden haben, gezielt nach Weiterbildungsangeboten zu suchen, auf ein solches Portal aufmerksam zu machen, muss dann eine breite Werbekampagne betrieben werden (z.B. Flyer, Poster, Veranstaltungen, etc.), um auch diesen Personenkreis zu erreichen.
[...]
[1] In dieser Arbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit entweder eine neutrale Form oder, falls dies nicht möglich ist, die männliche Form der Substantive benutzt. Diese Vorgehensweise ist in keinerlei Hinsicht als Form der Diskriminierung zu verstehen.
[2] nähere Informationen zum Projekt SeGeL siehe: http://www.die-bonn.de/segel/index.html (Stand: 17.09.04)
[3] Der erste Individualisierungsschub ging mit der erweiterten Arbeitsteilung und daraus resultierend einer Schwächung vorhandener sozialer Bindungen einher. (vgl. Durkheim 1988)
[4] Die Individualisierung soll hier im Mittelpunkt stehen, zu weiteren Ursachen vgl. Mayer 1995, S. 30f.
[5]) Hinweise auf die Ursachen von Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern finden sich bei Geißler im gesamten Buch „Sozialstruktur Deutschland“ 1996 (siehe Quellenverzeichnis) nach Kategorien untergliedert, bspw. S. 130 ff., S.203 ff. oder S. 240ff. Da diese Ursachenforschung jedoch nicht Kern dieser Betrachtung ist, soll hier nur darauf verwiesen werden.
[6] Mit dieser Rechnung tritt implizit ein dritter Faktor hervor, den Geißler nicht ausdrücklich benennt: Die wirtschaftlich-konjunkturelle Gesamtsituation sowie die diese beeinflussenden Größen. Zur Vereinfachung soll jedoch an dieser Stelle an der obigen Einteilung festgehalten werden.
[7] Anm. d. Verf.: Die von Barz/Tippelt hier angesprochene Paradoxie scheint in diesem Zusammenhang nur schwer nachvollziehbar.
[8] Diese zunehmende Bedeutung von Schlüsselkompetenzen ist ebenfalls ein Charaktermerkmal der Informationsgesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Päd. Frank Stula (Autor:in), 2004, Selbstgesteuertes Lernen. Aktuelle Konzepte und Entwicklungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75501
Kostenlos Autor werden







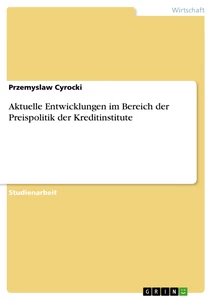

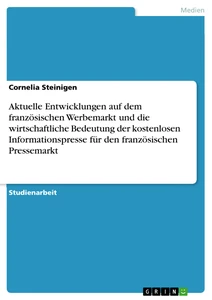











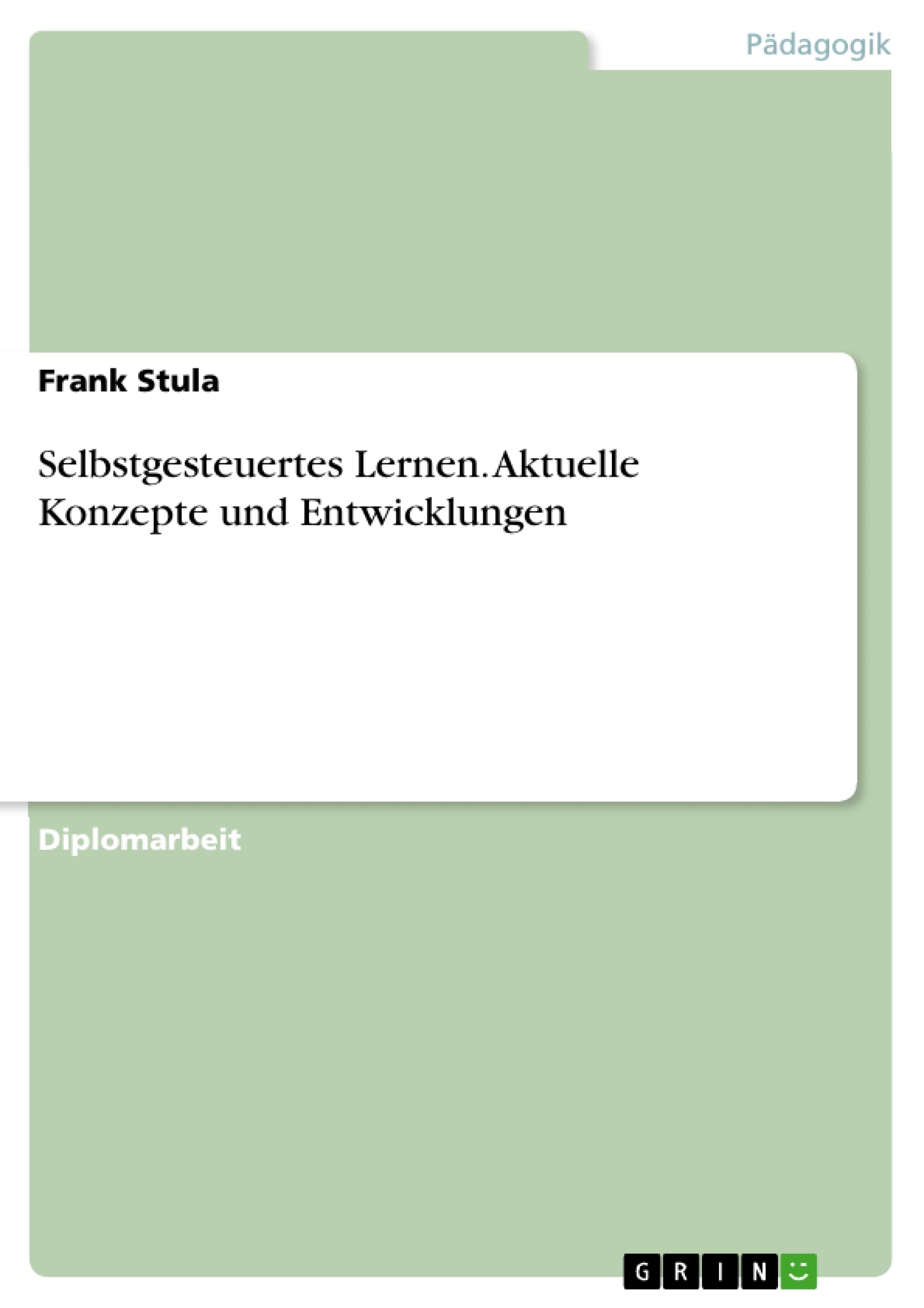

Kommentare