Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Zwischen Fiktion und Faktizität: Kulturelle und sexuelle Gewalt in der Gegenwart
2.1 „Wo Weiße sind, gibt es Essen“ – kulturelle Hierarchisierung
2.2 „Aggressive Abwehrreflexe“ – Reaktion auf indirekt vermitteltes Leiden
2.3 „Gewalt als Aphrodisiakum?“ – Reaktion auf direkt erfahrenes Leiden
2.4 „Was bleibt, ist die unglaubliche Roheit“ – Reaktion auf das Leiden der Mutter
2.5 „Dein Vorrat an einschlägigen Substantiven und Adjektiven ist erschöpft“ – Medien- und Sprachkritik
2.6 „Mehr sagt er nicht“ – Polyphonie?
3. Der Kolonialismus und die Verantwortung der Europäer
3.1 „Von einem muskulösen Träger geschultert“ – Privilegierung des „weißen“ Entdeckers
3.2 „der Erfüllung meiner geheimsten Wünsche nahe“ – Kandt und Mabruk als „koloniales Paar“
3.3 „Und wer sind Sie, junger Mann?“ – Zu Buchs Sicht auf Kandt
3.4 „…daß der Kampf für keine Seite militärisch zu gewinnen war“ – Europa zur Zeit des Ersten Weltkrieges
3.5 „Ich schreibe diese Zeilen in der Zeit nach meiner Zeit“ – Zur Funktion der Multiperspektivität
4. „Die Grundübel der Dritten Welt: Korruption, Brutalität und Ineffizienz“
4.1 Korruption: „Der Name wirkt wie ein Sesam-öffne-dich“
4.2 Brutalität: „Die Männer waren maskiert“
4.3 Ineffizienz: „Am Ende seiner zweistündigen Rede werden der Bierpreis und der Dollarkurs per Akklamation festgelegt“
4.4 Zum Motiv des Brudermords
4.5 Zur Überwindung des „Dritte-Welt“-Diskurses
5. Geschichte als Zyklus?
5.1 Zum Prolog: Kunst und Geschichte – Tilgung des Konkreten
5.2 „Angeblich ist Kabila eine Reinkarnation Mobutus“ – Wiederholung der Geschichte?
5.3 Zur Bedeutung biblischer Stoffe und Motive
5.4 Schreiben als „kollektives Unternehmen“ – Intertextualität
6. Grenzüberschreitung und Utopie
6.1 „Das Paradies ist OFF LIMITS“ – Grenzüberschreitung?
6.2 Grenzüberschreitung und interkulturelle Begegnung
6.3 „Je länger ich hierbleibe, desto weniger begreife ich“ – Grenzüberschreitung und Fremdverstehen
6.4 „Denn hätten sie es gelernt, wären sie nicht zurückgekehrt“ – Grenzüberschreitung und Tod
7. Der Schriftsteller und die Gesellschaft
7.1 „Kulturelles“ und individuelles Gedächtnis – Vermitteln und Verarbeiten
7.2 Schreiben gegen Totalitarismus und Fremdenhass
8. Fazit und Ausblick
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Einhergehend mit einer fundamentalen Neuorientierung der Geisteswissenschaften als Kulturwissenschaften, hat in den letzten zwanzig Jahren innerhalb der Germanistik die interkulturelle Literaturwissenschaft deutlich an Gewicht gewonnen. Da vor diesem Hintergrund zugleich Aspekte der Genderforschung für die Neuere deutsche Literaturwissenschaft zu einem wichtigen Paradigma geworden sind, beschäftigt sich diese mit ihrem Gegenstand verstärkt unter Berücksichtigung der Kategorien Kultur und Geschlecht.
Für die interkulturelle Literaturwissenschaft hat Norbert Mecklenburg festgehalten, dass Texte, Diskurse und Medien „Grundformen intrakultureller und interkultureller Kommunikation“[1] seien, wobei das spezifische interkulturelle Potenzial literarischer Texte darin bestehe, kulturelle Differenzen spielerisch inszenieren und vorführen zu können.[2] Dieser Aspekt ist von zentraler Bedeutung für Texte jener Literaten, die die Perspektive des „postkolonialen Blicks“ einnehmen und sich damit im Feld der mit der Postmoderne verknüpften Diskurse des Feminismus, Multikulturalismus und Postkolonialismus befinden.[3]
Zu diesen Autoren gehört unter anderem Hans Christoph Buch, der sich seit etwa Mitte der sechziger Jahre auf vielfältige Weise literarisch mit Problemen im Umgang der „Ersten“ mit der „Dritten Welt“ beschäftigt. Dabei gehört er einerseits in den Kontext der „68er-Generation“, andererseits steht er dieser jedoch auch mit Skepsis gegenüber, weil – im Gegensatz zu ihm selbst – nicht alle ihrer Vertreter den Gegenstand ihrer Beschäftigung aus eigener Erfahrung kennen.
In seinem Roman „Kain und Abel in Afrika“, den er im Jahre 2000 verfasst hat und der 2001 veröffentlicht wurde, setzt Buch sich mit dem Genozid zwischen Tutsi und Hutus in Ruanda auseinander, der Mitte der neunziger Jahre stattgefunden hat, sowie mit der komplexen politischen Situation im Zaire, der nach einem Putsch der Rebellenarmee im Jahre 1997 wieder die Bezeichnung „Republik Kongo“ trägt. Dabei greift Buch auf eigene Erfahrungen zurück, die er während dreier Aufenthalte in Ruanda, Burundi und der Republik Kongo in den Jahren 1995, 1996 und 1997 gesammelt hat.
Die gegenwartsbezogene Thematik wird in komplexer Weise verknüpft mit der kolonialen Vorgeschichte dieses Konflikts, der mit der Ich-Erzählung Richard Kandts ein eigener Erzählstrang gewidmet ist, für den Kandts tatsächlicher Reisebericht mit dem Titel „Caput Nili. Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils“ eine wichtige Quelle darstellt.
Im Zentrum des Romans stehen somit kulturelle und sexuelle Gewalt, die zugleich den Ausgangspunkt bilden für weiter reichende Reflexionen vor allem jenes Erzählers, der Mitte der neunziger Jahre im Auftrag einer deutschen Wochenzeitung nach Ostafrika gereist ist, um von den dortigen Gewaltexzessen zu berichten. Es zeigt sich im Laufe der Romanhandlung, dass die Erfahrung von Brutalität zugleich den Hintergrund darstellt für eine Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod der eigenen Eltern, so dass es neben einer Überschneidung der Kategorien Kultur und Geschlecht zu einer komplexen Verknüpfung von Öffentlichkeit und Privatsphäre kommt.
Die für die vorliegende Arbeit leitenden Fragestellungen resultieren aus diesen einführenden Bemerkungen. Zunächst wird der Frage nachgegangen, inwiefern die beiden Erzähler mit kultureller und sexueller Gewalt konfrontiert werden und inwiefern sie selbst in bestehende Gewaltstrukturen verstrickt sind. In einem zweiten Schritt wird untersucht, welche Erklärungsansätze für das Auftreten von Gewalt aus Sicht des Romans geliefert werden. Diese Fragen werden im zweiten bis vierten Kapitel behandelt, die somit einen ersten Block im Aufbau der vorliegenden Analyse des Romans bilden.
In einem dritten Schritt wird problematisiert, welche Konsequenzen aus der Textperspektive gezogen werden; dies ist zugleich die übergreifende Fragestellung des zweiten Teils der Analyse, der das fünfte bis siebte Kapitel umfasst. Hier werden Fragen behandelt, die sich auf umfassendere Kontexte literatur- und kulturwissenschaftlicher Betrachtungsweisen beziehen, nämlich die Funktion der spezifischen historisierenden Blickrichtung des Textes, die Art und Weise, wie der Umgang mit „Fremdheit“ thematisiert wird sowie die Sicht auf die Stellung des Schriftstellers in der Gesellschaft. Dieses Konvolut an Fragen zielt letztlich darauf ab, ob die Aussicht auf ein in Zukunft gelingendes (interkulturelles) Miteinander der Menschen angedeutet wird und wie – falls dies der Fall wäre – ein solches zu bewerkstelligen sei.[4]
Vor allem der erste Teil der Analyse ist sehr eng am Text orientiert und versucht dabei zugleich, die literarische Qualität des Romans zu bewerten, und zwar vor dem Hintergrund der Frage, ob der Anspruch postkolonialen Erzählens, nicht in einen latenten oder offenkundigen Exotismus zu verfallen, erfüllt wird. Daher setzen sich die jeweils letzten Unterkapitel des zweiten, dritten und fünften Kapitels mit jeweils einem der drei leitenden Konzepte postkolonialen Schreibens – Polyphonie, Multiperspektivität und Intertextualität – auseinander, so dass grundlegende kultur- und literaturtheoretische Fragestellungen in die Textanalyse integriert werden.
Zum Ende des vierten Kapitels wird – als Abschluss des ersten Teils der Arbeit – der Versuch einer vorläufigen Einordnung des Romans in die deutschsprachige Afrikaliteratur unternommen. Nachdem im sechsten Kapitel zumindest am Rande das Konzept einer interkulturellen Hermeneutik und im siebten Kapitel der kulturtheoretische Ansatz des „kulturellen Gedächtnisses“ behandelt worden sind, wird in einem abschließenden Fazit, das zugleich einen Ausblick darstellt, der Versuch einer Einordnung des Romans in einen größeren Kontext aus einer erweiterten Perspektive heraus modifiziert.
2. Zwischen Fiktion und Faktizität: Kulturelle und sexuelle Gewalt in der Gegenwart
In einem ersten Analyseschritt soll zunächst einmal untersucht werden, in welcher Weise kulturelle und sexuelle Gewalt der Gegenwart in Hans Christoph Buchs Roman thema-tisiert wird. Somit rückt jener Erzählstrang in das Zentrum des Interesses, der sich mit den Gewaltexzessen auseinandersetzt, die in den 1990er Jahren in Ostafrika stattgefunden haben und die im ersten, dritten und fünften Kapitel des Romans behandelt werden.
2.1 „Wo Weiße sind, gibt es Essen“ – kulturelle Hierarchisierung
Schon die Position des überlegenen „weißen“ Europäers, in der sich der deutsche Schriftsteller befindet, als er nach Ostafrika reist und dort im Auftrag einer deutschen Wochenzeitung recherchiert, ist geprägt durch eine kulturelle Hierarchisierung, die ihrerseits selbst eine Form von (kultureller) Gewalt darstellt. Dies soll im Folgenden anhand mehrerer Aspekte weiter analysiert werden.
„In Wirklichkeit hat deine Geschichte viel früher begonnen, im Hotel Lutétia in Paris“ (15).[5] Mit diesen Worten wird jene Passage eingeleitet, die die erste Begegnung des Erzählers mit Ruanda thematisiert. Dabei fällt auf, dass diese Begegnung in Paris – also mitten in Europa – stattfindet, und noch dazu in der Bar eines Hotels, also an einem Ort, der gemeinhin reichen, materiell wohlhabenden Menschen vorbehalten ist. Dort erwartet der Erzähler die ruandische Literaturkritikerin Madeleine Rurasagabiza.
Interessanterweise steht im Mittelpunkt der Retrospektion, die der Erzähler hier vornimmt, die erotische Anziehung, die Madeleine auf ihn selbst ausgeübt hat. Dabei geht ihre Attraktivität zunächst von dem „rauchigen Klang ihrer Stimme“ (16) aus und verbindet sich mit dem Klang ihres Namens, der für europäische Ohren kulturelle Fremdheit evoziert („Ein unaussprechlicher Nachname“, 16). Doch nicht nur der Erzähler selbst, sondern auch weitere Europäer sind den sexuellen Reizen Madeleines buchstäblich zum Opfer gefallen, nämlich ein belgischer Ethnologe, der sich bezeichnenderweise als Wissenschaftler mit dem ruandischen Feudaladel beschäftigt, dabei jedoch die Distanz zum Objekt seiner Untersuchungen verloren und dies mit dem Leben bezahlt hat, sowie dessen Sohn, der sich ebenfalls in Madeleine verliebt hat. Auf die aus psychoanalytischer Perspektive interessante, gleich mehrfach vorhandene ödipale Konstellation sei an dieser Stelle hingewiesen, aber nicht näher eingegangen: Zum einen wird von der Schönheit Madeleines in aus logischer Sicht schwer nachvollziehbarer Weise auf den „unter den Tutsi-Adligen Ruandas weit verbreitet[en]“ (17) dynastischen Inzest geschlossen, und zum anderen fällt auf, dass der Sohn des belgischen Professors „aus Liebeskummer heroinsüchtig geworden“ (17) sei: der junge Mann hat es ganz offensichtlich nicht verkraftet, erfolglos die gleiche Frau wie sein Vater zu lieben. Die Formulierung „Opfer ostafrikanischen Liebeszaubers“ (17) treibt die Klischeehaftigkeit der Textpassage auf die Spitze; die offensichtliche Überlagerung der Kategorien Kultur und Geschlecht spitzt sich schließlich zu in der Feststellung des Erzählers, bekanntlich sei „Ruanda ein feuchtwarmes Hügelland“ (18).
Sowohl Ruanda als auch Madeleine werden somit auf den Reiz kultureller und sexueller Fremdheit reduziert, während beispielsweise die politische Lage Ruandas („seitdem hatte sich die Zahl der Opfer vervielfacht, aber daran dachtest du nicht“, 16) oder die berufliche Situation Madeleines („Hast du schon erwähnt, daß Madeleine eine bekannte Literaturkritikerin ist?“, 17f.) nur sehr am Rande behandelt werden. Immerhin aber ist es gerade jene Madeleine Rurasagabiza, die dem Erzähler eine Namensliste übergibt, die sich auch „zehn Jahre später“ (18) noch im Besitz des Erzählers befindet und an Aktualität kaum verloren hat.
Diese Passage dient somit zum einen dazu, den Erzähler als Schriftsteller vorzustellen und dessen Klischees über Afrika in Form von gängigen Gerüchten und eigenem Wissen über den Kontinent anzudeuten. Zum anderen aber – und dies ist für die vorliegende Arbeit von ebenso großem Interesse – wird hier ein erstes Mal die enge Verknüpfung der Kategorien Geschlecht und Kultur erkennbar; es wird deutlich, inwiefern beide Kategorien mit Gewalt verknüpft sind und dass diese Gewalt ein Ergebnis von Konstruktionen ist, die als Fiktion unterlaufen werden können.
Auch die Art und Weise, wie sich der Erzähler jenen Gebieten, über die er berichtet, nähert, deutet auf seine (zumindest oberflächliche) Überlegenheit hin. Es wird nämlich mehrfach im Roman erwähnt, dass sich der deutsche Schriftsteller den jeweils bereisten Gegenden per Flugzeug oder Helikopter nähert und das Geschehen somit zumindest an-satzweise bereits aus der Vogelperspektive überblicken kann – eben als überlegener, analysierender und deshalb Distanz wahrender Europäer.[6]
Ein erstes Mal deutet sich dies in einer Passage zu Burundis Hauptstadt an, als Ronny den Erzähler „zu einem Hügel oberhalb von Bujumbura [führt], von dem sich ein weiter Ausblick über das Weichbild der Stadt eröffnet“ (23). Ebenfalls nur in einer kurzen Andeutung versteckt tritt dieser Aspekt im Anfangsteil des dritten Kapitels zu Tage („Du bist vor zwölf Stunden in Kigali gelandet und hast Schwierigkeiten gehabt, ein Zimmer zu finden“, 89), sowie zu Beginn des fünften Kapitels („wie der Taxichauffeur dir auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt erklärt“, 150).
Am deutlichsten aber wird die Annäherung aus der Höhe zu Beginn des achten Teils des ersten Kapitels, als der Erzähler – in Begleitung von Ramona Apitz, Kent Page, Nagette Belhadj und dem Fotografen Julian – den für ihn reservierten „Platz im Helikopter“ (34) einnimmt.
Ihr überfliegt nebelverhangene Täler und grüne Hügel, auf denen braune Rinder mit weit ausladenden Hörnern weiden, Nachkommen heiliger Kühe aus dem alten Ägypten, von wo die Vorfahren der Tutsi-Nomaden nach Ostafrika eingewandert sein sollen. Rundhütten mit Bohnen- und Maisfeldern, die durch Erbteilung immer weiter parzelliert werden, Eukalyptushaine, sumpfige Niederungen mit Tümpeln und Bächen, die nach den Regenfällen der letzten Tage zu Flüssen angeschwollen sind. Hinter einem kahlen Hügel tauchen die Spitzen einer Zeltstadt auf, die, wie sich beim Anflug zeigt, erst vor kurzem von der Armee zerstört und von ihren Bewohnern verlassen worden ist. Nur die als Matratzen dienenden Grasmatten sind übriggeblieben und Gerippe von Häusern, an denen Plastikfetzen flattern; ringsum verbrannte Erde, übersät mit zerbeulten Kochtöpfen und Plastikschüsseln, Frauen- und Kinderschuhen, Maiskörnern und Bohnen. Der Hubschrauber landet auf einer windgepeitschten Hochebene. (34f.)
Zunächst einmal gewährt die Vogelperspektive einen freien Blick über Landschaft und Tierwelt Ruandas. Dabei vermischen sich optische Eindrücke mit dem Vorwissen, das sich der Erzähler über die Region, die er bereist, angeeignet hat, wenn er die „braune[n] Rinder“ als „Nachkommen heiliger Kühe aus dem alten Ägypten“ identifiziert und dies parallelisiert mit der wissenschaftlichen Lehrmeinung, die Tutsi-Nomaden seien ebenfalls aus Ägypten – als Viehtreiber nämlich – nach Ostafrika eingewandert. Menschen bleiben diesem Panoramablick verborgen, lediglich die Spuren, die sie hinterlassen haben, lassen auf ihre Existenz rückschließen („Rundhütten“, „Zeltstadt“). Die Erklärung dafür wird denn auch umgehend geliefert: die Armee habe – „wie sich beim Anflug“ zeige – die Zeltstadt zerstört und die Flüchtlinge somit gezwungen, weiter zu ziehen. Je weiter sich der Helikopter dem Boden nähert, desto kleiner werden die Gegenstände, die dem Betrachter ins Auge fallen, von „zerbeulten Kochtöpfen und Plastikschüsseln“ bis hin zu „Maiskörnern und Bohnen“.
Insbesondere diese letzten Gegenstände, die allesamt zum Bereich der Ernährung gehören, deuten auf einen weiteren Aspekt hin, der die Privilegierung der Europäer – bzw. der Blauhelmsoldaten und Rotkreuzhelfer – gegenüber den einheimischen Opfern des Bürgerkrieges veranschaulicht. Wie ein roter Faden ziehen sich nämlich Passagen durch den Roman, in denen beschrieben wird, wie sich auswärtige Helfer und leidende Einheimische ernähren.
„‚Wo Weiße sind, gibt es Essen’“ (100), erklärt eine junge Frau, die sich unter den im dritten Kapitel thematisierten Hutu-Flüchtlingen, die den Rückweg von Goma nach Ruanda angetreten haben, befindet. Das ist einerseits eine richtige Aussage, andererseits blendet sie jedoch aus, dass es auch wichtig ist, was es zu essen und zu trinken gibt.
Als der Erzähler sich Mitte der 1980er Jahre mit der ruandischen Literaturkritikerin Madeleine Rurasagabiza im Pariser Hotel Lutétia trifft, verzehren die beiden „zwei Dutzend Austern und zwei Flaschen Champagner“ (18); beim deutschen Botschafter in Kigali hat der Erzähler die Wahl zwischen „Gin Tonic, Scotch mit Soda oder Campari mit Orangensaft“ (30). Die Hutus hingegen müssen „auf dem Grund eines leergetrunkenen Sees Bohnen und Mais anpflanzen“ (26f.) und werden hinsichtlich der Ernährung mit Tieren verglichen („die Flüchtlinge kampierten unter freiem Himmel und fraßen wie Heuschrecken die Felder kahl“, 25). Besonders in vergleichenden Passagen wird diese Problematik deutlich („auf der einen Seite wohlgenährte kanadische Sanitäter mit Gummihandschuhen, die den Hungernden proteinhaltige Kekse über die Absperrung reichen“, 44). Auf welcher Seite sich der Erzähler befindet, wird an keiner Stelle offen gelassen. Nachdem er für einen kurzen Moment die Grenze zu den Flüchtlingen überquert hat und nur mit Hilfe eines ukrainischen Blauhelmsoldaten wieder zurückgekehrt ist, „gießt dir [jemand] aus einer Plastikflasche Wasser über den Kopf. Israelisches Mineralwasser“ (45f.), das die Flüchtlinge, die „mit Kolibakterien verseuchtes Wasser“ (38) trinken müssen, dringend nötig hätten und das dem Erzähler zur Erfrischung dient.
Für die vermeintliche kulturelle Überlegenheit des Erzählers ist es bezeichnend, dass er – zumindest zunächst – ausschließlich in Hotels residiert. Dies gilt sowohl für die bereits erwähnte Unterkunft im Pariser Hotel Lutétia als auch für jenes Hotel, in dem er bei seinem ersten Aufenthalt in Ruanda ein Zimmer gemietet hat, nämlich das Hotel Mille Collines in der Hauptstadt Kigali, das mit dem Hotel Lutétia schon dadurch indirekt in Verbindung gebracht wird, dass beide Hotels als „Eingang zur Unterwelt“ (12, 15) bezeichnet werden. Dabei ist der Hotelname „Mille Collines“ bereits eine Anspielung zum einen auf die hügelige Landschaft Ruandas und zum anderen auf jene unzähligen Hügel, an denen die meisten Greueltaten ausgeübt werden.
Auch an der Grenze zum Zaire steht zunächst ein Hotel zur Verfügung, nämlich das „Hôtel Méridien am Ostufer des Kiwusees“ (94), doch nach der Ankunft in Goma wird der Erzähler damit konfrontiert, dass das dortige Hôtel du Lac ausgebucht ist (vgl. 110), so dass er sich – gemeinsam mit seiner Begleiterin Evanys – mit einem Zimmer in der unkomfortablen Auberge du Kivu begnügen muss. Auf die entsprechende Passage wird noch einzugehen sein.
Nicht nur die Unterkunft, sondern auch der Umgang mit hochrangigen ostafrikanischen Politikern spiegelt – in zwei Fällen – die privilegierte Position des „weißen, europäischen Subjekts“ wider. Ein erstes Mal wird dies in einer Passage erkennbar, die davon handelt, dass der Erzähler vom Ex-Präsidenten Burundis, Monsieur Bagaza, auf dessen Veranda empfangen wird. Dabei fällt auf, dass der Erzähler den Politiker mit europäischen Diktato-ren bzw. Staatschefs der Vergangenheit vergleicht, nämlich mit Stalin („so ähnlich stellst du dir Stalin vor“, 24), Ulbricht („Ohne es zu wissen, hat er soeben Walter Ulbricht zitiert“, 24) und indirekt auch mit Hitler („und erkundigt sich beiläufig, wie Hitler es geschafft habe, in so kurzer Zeit sechs Millionen Juden zu ermorden“, 24). Darauf wird zu einem späteren Zeitpunkt in der vorliegenden Arbeit noch einzugehen sein; zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass der Erzähler den burundischen Ex-Präsidenten sehr kritisch sieht und ihn als einen (potentiellen) Tyrannen charakterisiert, dass aber andererseits gera-de diese fast private Begegnung („Der Vorsitzende der PARENA-Partei trägt einen Jogginganzug und sieht wie ein biederer Familienvater aus“, 24) nur durch die „europäische“ Identität des Journalisten ermöglicht wird.[7]
Noch offensichtlicher wird die Privilegierung des Erzählers jedoch im fünften Kapitel, als er den Einmarsch der Rebellenarmee in Kisangani beschreibt und dabei schildert, wie nahe er Kabila, dem Rebellenführer und neuen Staatspräsidenten der Republik Kongo, kommt („Eine Stunde später findest du dich auf der Ehrentribüne des Sportstadions wieder, hinter dem Rücken des Präsidenten, auf den du einen Mordanschlag verüben könntest“, 157f.). Dies geht so weit, dass er von Bruno, dem Pressesprecher der Rebellenarmee, geduzt („‚Du kommst zu spät [...,] aber ich habe dir einen Platz freigehalten’“, 159) und von Kabila selbst, „der seinen Redestrom kurz unterbricht“ (159), „durch Kopfnicken begrüßt“ (159) wird.
Auch die materielle Überlegenheit des Europäers wird mehrfach thematisiert („als du ihr [einer Verkäuferin, M.P.] eine Fünfundzwanzig-Cent-Münze gibst, meint Evanys lachend, damit könntest du den halben Markt aufkaufen“, 94), wobei stets der großzügige, aber auch gönnerhafte Charakterzug des Beobachters sichtbar wird. So leistet sich der Erzähler mit Evanys eine Dolmetscherin, obwohl er diese eigentlich gar nicht zu benötigen glaubt, was allerdings ein Irrtum ist, wie sich herausstellen wird.
Dass diese Wohltätigkeit zugleich noch einen anderen Aspekt berührt, wird aus folgender Passage ersichtlich. Zu Beginn der Romanhandlung befindet sich der Erzähler, wie erwähnt, im Hotel Mille Collines in Kigali. Dort trifft er auf Raphaël, den er durch eine „Indiskretion“ (13) dazu gebracht hat, vom Tod seiner Schwester zu berichten. Da der Erzähler dies bereut, lädt er „Raphaël, als hilflose Geste der Wiedergutmachung, in die Cafeteria zum Mittagessen ein“ (13f.). Hier wird offensichtlich, dass der materielle Wohlstand des Europäers dafür verwendet werden kann, dessen eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen. Hinzu kommt, dass Raphaël sich schämt, „Arbeit zu suchen oder um Almosen zu betteln“ (15).
Die soeben herausgearbeitete Privilegierung des europäischen Erzählers gegenüber dessen afrikanischer Umgebung ist gerade nicht Ausdruck einer Affirmation des kolonialen Diskurses durch den Autor, sondern im Gegenteil dessen kritische Auseinandersetzung mit tradierten Denkschemata, die er als problematisch dekonstruiert, indem er zeigt, wie sehr der Erzähler in ihnen befangen ist. Erzähler und Autor dürfen in dieser Hinsicht nicht miteinander identifiziert werden, weil gerade die Du-Perspektive eine Distanz herstellt, die – quasi in zweiter Potenz – eine Distanzierung des Lesers von der Sichtweise des Erzählers bewirken soll.
Wie weitreichend die Privilegierung des europäischen Journalisten gegenüber den einheimischen Opfern der Gewalt ist, zeigt eine Episode aus dem dritten Kapitel, als der Erzähler mit seinen Begleitern Déogratias, Evanys und Hannes unterwegs nach Goma ist und dabei auf einen Flüchtlingsstrom trifft, der in die entgegen gesetzte Richtung strebt:
„Ich bin froh, einen Weißen zu treffen“, sagt eine junge Mutter und hebt ihr zum Skelett abgemagertes Kind in die Höhe, damit ihr es besser sehen könnt: „Wo Weiße sind, gibt es Essen.“ (100)
In dieser Passage verharren Evanys und der Erzähler nicht in einer reinen Beobachterposition, sondern Evanys reicht der jungen Hutu-Frau ein Bündel Bananen, denn „ich kann nicht vergessen, daß sie meine Landsleute sind“ (100).
Zunächst einmal bleibt also festzuhalten, dass der Erzähler als „weißer“, beobachtender, distanzierter Europäer im Auftrag einer deutschen Wochenzeitung[8] immer wieder in die „Krisenregion“ zurückkehrt, um die dortigen Verhältnisse für die westeuropäische Leserschaft realer werden zu lassen und kursierende Gerüchte kritisch zu beleuchten. Diese scheinbare Überlegenheit wird im Roman selbst thematisiert und als eine Form kultureller Hierarchisierung und damit als eine subtile Form von Gewalt kenntlich gemacht. In welcher Weise dies geschieht, soll im Folgenden analysiert werden.
2.2 „Aggressive Abwehrreflexe“ – Reaktion auf indirekt vermitteltes Leiden
Der traditionelle koloniale Diskurs ist geprägt von Dichotomien wie „Europa versus Afrika“, „Zivilisation versus Barbarei“, „Kultur versus Natur“, „Rationalität versus Irrationalität“. Diese polaren Gegensatzpaare werden im Roman ad absurdum geführt; es wird im Folgenden zu zeigen sein, wie insbesondere die Dichotomie „zivilisiertes Europa“ versus „wildes Afrika“ von Hans Christoph Buch als Konstruktion entlarvt wird.
Als der Erzähler in Ruandas Hauptstadt eintrifft, wird er in dem Hotel Mille Collines ein erstes Mal mit der Grausamkeit des Bürgerkriegs konfrontiert. Denn in diesem Hotel trifft der deutsche Schriftsteller auf den 30jährigen Tutsi Raphaël Nzeyimana.
„Ich habe eine Dummheit begangen.“ – „Was für eine Dummheit?“ – „Ich habe meine Schwester vergewaltigt.“ – „Wie bitte?“ – „Ich sagte Ihnen doch: Ich habe meine Schwester vergewaltigt. In Gikorongo, Butare Distrikt, letztes Jahr im April. Sie haben mich gezwungen, es zu tun.“ – „Wer waren sie ?“ – „Interahamwe, die Hutu-Miliz. Wer sonst.“ – „Und wo ist Ihre Schwester jetzt?“ – „Sie ist tot.“ (13)
Was an diesem kurzen Dialog zunächst einmal auffällt, ist die Einseitigkeit der Sprechsituation: der „weiße“ Europäer fragt, der „schwarze“ Afrikaner – zugleich Objekt der Neugierde – antwortet.
Dabei fallen die Antworten Raphaëls äußerst knapp und wortkarg aus, und auch ein gewisser Sarkasmus ist nicht zu übersehen („Ich habe eine Dummheit begangen“). Im Grunde ist – gerade weil die Antworten lakonisch sind – der Dialog für den Leser, aber auch für den Erzähler, weniger informativ als vielmehr erschreckend, weil er beide mit einer Gräueltat konfrontiert, die ebenso unverständlich wie grauenhaft bleibt; Hintergründe jedenfalls werden zunächst nicht bekannt. Erst nachdem sich der Deutsche für seine „Indiskretion“ dergestalt entschuldigt hat, dass er Raphaël ein Mittagessen finanziert – Zeichen nicht nur für schlechtes Gewissen, sondern auch für das Bewusstsein finanzieller Überlegenheit –, erfährt der Leser Genaueres über den Hergang der Vergewaltigung.
Mit einem Pickup-truck wollte er sich und seine Familie nach Burundi in Sicherheit bringen. Alles stand zur Abfahrt bereit, als Kämpfer der Interahamwe-Miliz das Haus umstellten. Die Männer waren maskiert. Sie töteten seine ältere Schwester, nachdem sie Raphaël gezwungen hatten, sie vor den Augen der Eltern zu vergewaltigen, und löschten anschließend die ganze Familie aus […]. (14)
Bezeichnenderweise wird Raphaël auch in dieser Passage nicht durch direkte Rede selbst das Wort erteilt, sondern vielmehr bleibt durch die erlebte Rede eine gewisse Distanz zum Erzählten bestehen. Das Gehörte bleibt für den Schriftsteller Fiktion. Genau diese Distanz wird dann auch noch vom Erzähler sehr direkt bestätigt.
Es gibt einen Grad des Elends, der sprachlos macht. Noch schlimmer: Raphaëls Geschichte löst aggressive Abwehrreflexe bei dir aus. Du möchtest das Gespräch abbrechen und hast plötzlich den Verdacht, Raphaël sei geistesgestört, was er vielleicht auch ist. (15)
Der Erzähler kann und will die „Geschichte“ Raphaëls nicht glauben, weil er nicht selbst mit einer solchen Grausamkeit konfrontiert worden ist. Stattdessen erklärt er ihn für „geistesgestört“. Anders formuliert: für den Erzähler bleibt das Gehörte Fiktion, weil er es sich nicht vorstellen kann. Der Leser hingegen soll sich vom erzählenden Du distanzieren, indem er von dessen „aggressiven Abwehrreflexen“ befremdet wird. Denn diese aggressive Abwehrreaktion ist nichts anderes als die gewaltsame Reaktion des „weißen, zivilisierten Europäers“, der qua Erzählung ein erstes Mal in der Romanhandlung mit Gewalt konfrontiert wird. In dem beobachtenden, europäischen, zivilisierten Subjekt tritt also plötzlich ein Gewaltpotential zu Tage, das eigentlich im traditionellen Diskurs eher dem „wilden, zu kolonisierenden Afrikaner“ zugewiesen wird.
Ähnliches gilt für die Reaktion des Erzählers, als Déogratias, ein junger Tutsi und „Gehilfe des Barmanns“ (90) im Hôtel des Diplomates, erzählt, „wie er, auf einem Dachboden in Kigali versteckt, den Genozid überlebt hat, dem seine Familie zum Opfer gefallen ist: vier Brüder, drei Schwestern, beide Eltern und Großeltern“ (90f.): „Die Reden des jungen Mannes ermüden dich, schlimmer noch: Du ertappst dich bei dem Verdacht, er wolle durch seine Horrorstory ein höheres Trinkgeld erpressen“ (91). In diesem Fall besteht der „aggressive Abwehrreflex“ darin, dass der deutsche Schriftsteller dem Ruander dessen Erzählung nicht nur nicht glaubt, sondern dass er ihm kalte Berechnung unterstellt. Diese Möglichkeit besteht auch durchaus – erweist sich doch gerade Déogratias in der Folge durchaus als schlitzohrig –, doch nicht darum geht es an dieser Stelle, zumal für den gesamten Roman gilt, dass sich der europäische Betrachter jeglichen moralisierenden Urteils über das Verhalten der Bürgerkriegsopfer aus sehr guten Gründen enthält: „Gleichzeitig schämst du dich deiner Ungläubigkeit“ (91).
Diese „Ungläubigkeit“ beschränkt sich jedoch nicht auf den Erzähler, sondern sie wird geteilt vom Menschenrechtsbeauftragten William Clarance:
William Clarance ist ein weißhaariger Jurist aus Kanada, der an das Gute im Menschen glaubt, und ihm ist deutlich Skepsis anzumerken, als Nagette ihm stammelnd berichtet, was ihr im Lager gehört und gesehen habt. Wenn das stimmt, war seine Arbeit hier umsonst, und er muß alles widerrufen, was er dem Generalsekretär nach New York gemeldet hat […]. Ob ihr die Hinrichtungen mit eigenen Augen gesehen habt? [...] Aber er bleibt skeptisch, trotz der endlosen Kolonne schwankender Elendsgestalten, die vorüberzieht. (48)
Allerdings ist die Ungläubigkeit des Kanadiers – zumindest vordergründig – anders zu erklären als die „aggressiven Abwehrreflexe“ des deutschen Schriftstellers. Denn für den Menschenrechtsbeauftragten der UNO kommt das Massaker im Flüchtlingslager Kibeho einem Scheitern der eigenen Politik bzw. der eigenen Mission gleich, nämlich dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte nicht verletzt werden. Deshalb will Clarance die Katastrophe nicht wahrhaben, und deshalb glaubt er der algerischen Entwicklungshelferin nicht. Zugleich jedoch scheint aus Sicht des Erzählers der Reaktion des Kanadiers auch eine gewisse Naivität zugrunde zu liegen, die darin besteht, dass dieser „an das Gute im Menschen“ glaubt und die auf seltsame Weise mit seinem Alter in Verbindung zu stehen scheint („weißhaariger Jurist“) sowie mit seinem Beruf und seiner Herkunft. Seltsam scheint die Anspielung auf das Alter deshalb, weil der Erzähler selbst ebenfalls weißes Haar hat, „das zusammen mit der Schwerhörigkeit deines Vaters auf dich übergesprungen ist“ (178).
Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass der Erzähler – aber eben nicht nur dieser – auf indirekt vermitteltes Leiden mit „aggressiven Abwehrreflexen“ und „Ungläubigkeit“ reagiert, also mit einer zumindest latenten Form von Gegengewalt.
2.3 „Gewalt als Aphrodisiakum?“ – Reaktion auf direkt erfahrenes Leiden
Die Schärfe der Reaktion auf die Konfrontation mit Gewalt nimmt mit dem „Wirklichkeitsgrad“ des Erlebten zu, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Der Erzähler hat sich gemeinsam mit der algerischen Entwicklungshelferin Nagette Belhadj in das Flüchtlingslager Kibeho begeben. Dort tritt das Elend der Flüchtlinge offen zu Tage, wird vor allem der Erzähler selbst sehr direkt mit der grausamen Realität konfrontiert, so dass ein leugnender Eskapismus nicht mehr möglich ist.
Ein französischer Arzt ist über die Sandsackbarriere geklettert und fordert euch auf, ihm zu folgen. Du greifst Nagette unter die Arme und hebst sie über den Stacheldrahtzaun. Ein Schritt, ein Sprung, und ihr landet inmitten der Flüchtlinge, die zur Seite rücken, um euch Platz zu machen. [...] Von allen Seiten greifen Hände nach dir, Verletzte klammern sich an deine Hosenbeine, du trittst auf einen weichen Körper, eine nachgiebige Masse, die sich stöhnend bewegt, stolperst und verlierst das Gleichgewicht. Du hast Angst, im Flüchtlingselend zu versinken, schlägst um dich wie ein Ertrinkender und suchst vergeblich Halt im Menschengewühl, das wie eine Meereswoge über dir zusammenschlägt. (44f.)
Diese Passage macht deutlich, wie körperlich und buchstäblich hautnah der Kontakt zwischen erzählendem, beobachtendem „Subjekt“ und beobachtetem „Objekt“ wird. Die Distanz zwischen beiden Seiten wird aufgehoben – symbolisiert schon durch das Überschreiten der Sandsackbarriere und des Stacheldrahtzaunes –, und dies gilt auch für die Distanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit: Plötzlich erlebt der Erzähler das Elend der Menschen, über das er zuvor nur Berichte gehört hat, ganz direkt. Diese Erfahrung zieht zunächst Angst nach sich, die daraus resultiert, dass er selbst in diesem Elend untergehen und ertrinken könnte, dass er also die Distanz zu diesen Menschen, die bezeichnenderweise als eine anonyme Masse wahrgenommen werden, nicht mehr wird herstellen können. Diese Angst ist es, die sich in brutaler Gewalt entlädt:
In der Mitte des Platzes, wo die Menge auf der Flucht vor Schüssen zusammenströmt, liegen Tote und Sterbende in mehreren Schichten übereinander. Eine Mutter streckt dir ihr schreiendes Baby entgegen, du stößt sie brutal zur Seite und ergreifst die helfende Hand, die dir ein ukrainischer Blauhelmsoldat über den Stacheldraht hinweg entgegenreicht. Ein Ruck, ein stechender Schmerz im Schultergelenk, und du bist in Sicherheit. Der Aufenthalt in der Menge hat keine fünf Minuten gedauert, aber er kommt dir wie eine Ewigkeit vor. (45)
Es wird besonders evident, dass der „zivilisierte“ Europäer zu brutaler, menschenverach-tender Gewalt fähig ist, sobald es um sein eigenes Leben geht. In seiner Angst, dieses furchtbare Elend nicht mehr verlassen zu können und in ihm umzukommen, wird der Erzähler selbst gewalttätig gegenüber einer wehrlosen Frau, die nichts anderes tut, als ihm ihr Kind entgegen zu halten. Gerade dies müsste eigentlich einen „zivilisierten“, „kultivierten“ Menschen von der Ausübung von Gewalt abhalten, doch dieser Reflex funktioniert nicht – eben aus Angst um das eigene Überleben. Jegliche Objektivität ist dem rationalen Beobachter abhanden gekommen, wie auch die Tatsache zeigt, dass dieser für einen Moment das Zeitgefühl verloren hat, so dass ihm fünf Minuten „wie eine Ewigkeit“ vorkommen.
Der Leser ist einmal mehr befremdet ob dieser menschenverachtenden Verhaltensweise des Erzählers, und genau dies soll er sein, wie auch der Erzähler – quasi in selbstreflexiven Momenten – über sich selbst erschrickt.
Dies kann durch die folgende Passage untermauert werden. Auch Nagette hat unter dem, was sie in diesem Flüchtlingslager wahrnimmt, zu leiden; sie muss sich übergeben.
Du redest mit beruhigenden Worten auf sie ein, streichelst ihren Nacken und ihr Haar und kommst dir verlogen und pervers dabei vor, denn hinter der trostspendenden Geste verbirgt sich ein Annäherungs-versuch. Gewalt als Aphrodisiakum? Nein, eher der Wunsch, Halt zu suchen an einem anderen Menschen, dazu das unbestimmte Gefühl, dein erotisches Begehren sei das einzig Normale an diesem Tag. (47)
Der Erzähler schildert an dieser Stelle den Versuch, sich – ganz dem traditionellen patriarchalen Diskurs verpflichtet – in die Rolle des beschützenden Mannes zu begeben, wohl auch, um sich selbst seine eigene Stärke zu suggerieren, über die er in dieser Situation jedoch nicht verfügt. Gerade deshalb wird ihm auch die Verlogenheit dieses Versuchs bewusst. Denn in Wahrheit geht es ihm weniger darum, Nagette zu unterstützen, als vielmehr darum, seinem eigenen „erotischen Begehren“ zu folgen, wobei er dies dadurch rechtfertigt, dass eine solche Reaktion aus den Erfahrungen von Elend und Gewalt resultiere und insofern nur allzu menschlich sei. Dennoch sollte man als Leser die stichwortartig aufgeworfene Frage „Gewalt als Aphrodisiakum?“ nicht einfach mit jenem klaren „Nein“ beantworten, wie es der Erzähler an dieser Stelle tut. Denn in anderen Passagen des Romans wird offensichtlich, dass die Erfahrung von Gewalt sehr wohl eine erotisierende Wirkung auf den Erzähler ausübt.
Du legst tröstend den Arm um sie und kommst dir ungeheuer schäbig vor, denn ihre Erzählung hat dich sexuell erregt. Dabei schämst du dich vor dir selbst und weißt nicht, wie du mit deinen verworrenen Gefühlen umgehen sollst. (112)
Diese Szene spielt sich in der Auberge du Kivu ab, wo der Erzähler und Evanys „wie hungrige Hyänen übereinander“ (113) herfallen – ebenfalls als Reaktion auf ganz direkt erfahrenes Elend. Die Rede ist von einer „Serie konvulsivischer Entladungen, eine gewaltsame Abfuhr aufgestauter Energie, die zwei ineinander verbissene Körper schüttelt“ (113). Die Erfahrung von Gewalt entlädt sich also nicht nur in Form einer Art von „Gegengewalt“, sondern auch in Form sexueller Erregung, was dem tradierten Bild vom „zivilisierten Europäer“ auch nicht eben entspricht.
Zudem wird an dieser Stelle einmal mehr evident, inwiefern sich die Kategorien Kultur und Geschlecht überlagern und inwiefern beides im vorliegenden Roman mit Gewalt gekoppelt ist. Evanys nämlich hat die tröstende Geste des Erzählers als Annäherungs-versuch durchschaut („‚Du kannst mit mir schlafen, wenn du willst’, sagt Evanys, als habe sie deine Gedanken erraten“, 112). Dabei muss zugleich festgehalten werden, dass an dieser Stelle die Frau nicht als reines Opfer männlichen Begehrens gezeichnet wird; die Situation ist komplexer. Dies zeigt nicht nur die sachliche, ja beinahe sarkastische Betrachtungsweise Evanys’ („‚Aber ich sage dir gleich, daß ich nichts dabei empfinde außer Ekel, weil ich zu oft vergewaltigt worden bin’“, 112), sondern auch die Tatsache, dass sie selbst unvermittelt die Initiative ergreift („‚Gehen wir auf dein Zimmer […]. Ich will mit dir schlafen’“, 113). Hier wird besonders deutlich, dass der Geschlechtsverkehr in erster Linie der Versuch ist, irgendwie mit der zuvor unmittelbar erfahrenen Gewalt umzugehen und die eigenen Erfahrungen zu verarbeiten. Möglicherweise wird Evanys’ Begehren zusätzlich hervorgerufen durch die wieder wachgerufenen Erinnerungen an ihre eigenen Erlebnisse als Bürgerkriegsopfer, denn kurz zuvor hat sie dem deutschen Schrift-steller ihre eigene Flucht vor den Hutus geschildert.
Andererseits unterlässt es der Erzähler letztlich nicht, zumindest vage auf bei Evanys wohl doch vorhandene Gefühle einzugehen:
„Schick mir eine Ansichtskarte aus Berlin. Ich weiß nicht, ob ich noch am Leben bin, wenn du das nächste Mal nach Ruanda kommst.“ Und sie dreht das Gesicht zur Wand, während du ihre nackte Schulter küßt. (113)
In dieser Situation erscheint der Erzähler auf subtile Weise doch wieder als überlegener weißer Mann, für den Evanys nur eine Frau unter mehreren darstellt, die ihm zudem kulturell unterlegen ist. Tatsächlich wird ihr in der Folge kein einziges Mal mehr das Wort erteilt. Der Erzähler sieht sich plötzlich mit der Situation konfrontiert, „nach traditionellem Recht“ (117) Evanys heiraten zu müssen, wie deren Cousin – mit materiellen Hintergedan-ken – bemerkt. Allerdings bleibt es bei dieser Bemerkung, was den Eindruck verstärkt, der Erzähler sei bestrebt, eine zu enge Identifikation mit der (oder eine Verwicklung in die) Kultur, die ihn umgibt, zu verhindern.
Ähnliches ließe sich auch für den im fünften Kapitel beschriebenen Kontakt des Erzählers mit der Kongolesin Fatou feststellen. Hier besteht die Verknüpfung von Gewalt und Sexualität in erster Linie darin, dass der Erzähler Fatou als erotische Verführerin und damit zugleich als eine Gefahr wahrnimmt:
„Du wirkst angespannt, Monsieur. Soll ich dir den Nacken massieren? Dein Nacken ist steif.“ – „Nein, danke, ich brauche keine Massage.“ Ein Dieselmotor rumpelt, das Notstromaggregat fällt aus, das Dröhnen der Klimaanlage verstummt. Du stehst im Dunkeln und hörst das feine Sirren, mit dem eine Anopheles-Mücke dein Ohr umkreist. Nur weibliche Moskitos übertragen Malaria; sie saugen ihrem Opfer das Blut aus der Haut; grammatisch korrekt – oder muß es grammatikalisch heißen? – handelt es sich um Moskitas, nicht um Moskitos. Mit diesem konfusen Gedanken schläfst du ein. (162)
Zunächst bleibt unklar, ob der Erzähler tatsächlich mit Fatou schläft, weil in der Folge zunächst ein Traum vom verstorbenen Vater beschrieben wird; auf diese Passage wird zu einem späteren Zeitpunkt unter einer etwas anderen Akzentsetzung noch einzugehen sein. Dann jedoch wird – quasi in Überschreitung der (fließend gewordenen) Grenze von Fiktion und Faktizität – die Antwort auf diese imaginäre Frage gegeben („Jetzt aber liegt weder der Heilige Vater noch die Heilige Jungfrau neben dir, sondern Fatou […]“, 163). Hier wird erneut eine Beziehung hergestellt zwischen der kulturellen Alterität Fatous und deren sexueller Attraktivität. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Corinne Kafka, eine englische (also europäische, „weiße“) Fotografin, auf ihre berufliche Rolle reduziert wird; ja – mehr noch – sie wird in gewisser Weise entsexualisiert bzw. als Verkörperung „europäischer“ Vernunft geschildert („‚Du hast mit Fatou geschlafen, obwohl du mir versprochen hattest, es nie wieder zu tun […] Du solltest einen Aidstest machen lassen’“, 176). Auch darauf wird an späterer Stelle noch einzugehen sein.
Zunächst einmal sei festgehalten, dass die direkte, unmittelbare Konfrontation des Erzählers mit Gewalt eine erhöhte Aggressivität bei diesem nach sich zieht, die sich, wie die Episode mit Evanys gezeigt hat, in sexuellem Begehren entlädt. Je „realer“ die Gewalterfahrung, desto stärker die Gegengewalt des Erzählers. Im Folgenden ist noch einmal auf die bereits angesprochene Episode aus dem Flüchtlingslager Kibeho zurückzukommen, um zum nächsten Aspekt der Analyse überzuleiten.
2.4 „Was bleibt, ist die unglaubliche Roheit“ – Reaktion auf das Leiden der Mutter
Als der Erzähler mit Hilfe eines ukrainischen Blauhelmsoldaten dem Versinken im Flüchtlingselend entgangen ist, sieht er Nagette – wie bereits erwähnt nach nicht mehr als fünf Minuten – wieder: „Nagette erwartet dich am Ausgang des Kessels, wo der französische Arzt notdürftig die Verletzten versorgt“ (46). Dieser Passage entspricht eine parallele Textstelle, die sich auf die Beerdigung der Mutter des Erzählers bezieht:
Du [...] gingst, ohne nach rechts und links zu sehen und die von allen Seiten dir entgegengestreckten Hände zu drücken, zum Parkplatz am Ausgang des Friedhofs, wo deine Geschwister dich mit verweinten Gesichtern erwarteten. (122f.)
Ähnlich wie im Flüchtlingslager ist der Erzähler auch hier ganz auf sich selbst fixiert. Er sieht nicht nach links und rechts und drückt die ihm zur Kondolenz entgegen gestreckten Hände ebenso wenig, wie er jene Hände beachtet, die im Flüchtlingslager Kibeho „von allen Seiten“ (45) nach ihm greifen. Auch jene Menschen, die ihm am Friedhof ihr Beileid aussprechen wollen, bleiben für ihn eine anonyme, gesichtslose Masse ohne Individuen, und erst, als er dieses Spalier, das Assoziationen an einen Spießrutenlauf weckt, durchschritten hat, nimmt er wieder einzelne Personen wahr, nämlich seine Geschwister, die ihn „am Ausgang des Friedhofs“ (123) – parallel zu Nagette „am Ausgang des Kessels“ (46) im Flüchtlingslager – erwarten.
Nicht nur durch diese Passage wird eine Beziehung hergestellt zwischen dem Tod der Mutter des Erzählers und dem Massensterben in Ostafrika. Vielmehr bedeutet die Schilderung des fremden Leids – so zumindest die Perspektive des Erzählers – nichts anderes als die Flucht vor der Erfahrung des Sterbens der Mutter und vor dem damit verbundenen eigenen, privaten Schmerz:
Und du denkst darüber nach, welche unbewußte Motivation dich dazu trieb, vor deiner sterbenden Mutter nach Afrika zu entfliehen und Berichte über Morde und Massaker zu schreiben, deren Lektüre sogar für Gesunde schwer erträglich, für eine Kranke, die selbst dem Tod entgegengeht, aber unzumutbar ist. Vielmehr steckte dahinter der Wunsch, den Schmerz, den du seit dem Tod deines Vaters empfunden hast, einzutauschen gegen einen anderen, größeren Schmerz: der Versuch, dein privates Leiden zu kompensieren durch ein überindividuelles Leiden, das jeden normalen Maßstab übersteigt und dir gerade dadurch Halt und Orientierung gibt. (121)
Dieser Aspekt ist deshalb von Bedeutung, weil auch hier die Spannung von Fiktion und Faktizität thematisiert wird. Denn wenn die Reise nach Afrika eine Flucht darstellt vor dem privaten Leiden, so bedeutet dies letztlich, dass selbst die direkte Erfahrung von Gewalt und Elend beispielsweise im Flüchtlingslager Kibeho in gewisser Weise unwirklich bleibt: der Erzähler sucht quasi nach einer Geschichte, die schlimmer ist als die eigene, und reist deshalb nach Ostafrika. Das Ziel der Reise bestünde dann darin, vor der privaten Wirklichkeit, dem Sterben der eigenen Mutter nämlich, zu entfliehen. Gewalterfahrung als Eskapismus also? – Es stellt sich die Frage, ob man dies dem Erzähler glauben darf. Für die Romananalyse ist an dieser Stelle jedoch zunächst einmal etwas anderes wichtig, nämlich die Tatsache, dass das europäische, zivilisierte Individuum der eigenen sterbenden Mutter mit einer Rohheit entgegentritt, die selbst eine Form der Gewalt darstellt und insofern die Dichotomie „friedlicher Europäer versus wilder Afrikaner“ vollends als Konstruktion ad absurdum führt.
Was bleibt, ist die unglaubliche Roheit, mit der du deiner Mutter zu verstehen gibst, die durch ihre tödliche Krankheit ausgelösten Schmerzen und Ängste seien harmlos im Vergleich zu dem, was du in Ruanda gesehen und erlebt hast. Vielleicht hat sie deshalb leise aufgeschluchzt, als du die Tür zum Schlafzimmer hinter dir zugezogen hast, und lautlos ins Kopfkissen geweint, während du wie ein Einbrecher auf Zehenspitzen davongeschlichen bist. (121)
Was in dieser Passage vorgeführt wird, ist die gewalttätige Reaktion des Erzählers auf jenen Schmerz, den er aufgrund des Sterbens der eigenen Mutter erleidet; diese wird demnach selbst das Opfer eines aggressiven Abwehrreflexes ihres Sohnes, dessen Reaktion zudem als narzisstisch zu bezeichnen ist, da der Schmerz nicht aus Mitleid mit seiner leidenden sterbenden Mutter resultiert, sondern vielmehr aus Selbstmitleid: Es handelt sich um einen Schmerz, der sich nur auf das eigene Selbst des Erzählers bezieht; dieser ist nicht in der Lage, seine Aufmerksamkeit dergestalt nach außen, also auf seine Mitmenschen, zu richten, dass er aufrichtiges Mitleid mit diesen empfinden könnte.
Erst nach dem Tod der Mutter lässt der Erzähler diesen Schmerz überhaupt zu: „Am Tag nach dem Tod deiner Mutter überfällt dich wie ein jäher Schmerz die Gewißheit, daß du von nun an niemandes Sohn mehr bist“ (119). Es folgt konsequenterweise die Einsicht, „daß du umsonst um die halbe Welt gereist warst, weil der Schmerz über den Tod deiner Eltern nicht aufzuwiegen war durch fremdes Leid, sei es noch so furchtbar und noch so groß“ (123f.).
Der Erzähler reagiert also in gewisser Weise durchaus gewalttätig auf das Sterben der eigenen Mutter, ja er tritt dieser sogar selbst mit Gewalt gegenüber, wenn er ihr trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes und trotz ihres bevorstehenden Todes zumutet, seine Reportagen über Ruanda zu lesen. Damit erweist sich der „zivilisierte, weiße Europäer“ keineswegs mehr als der im Vergleich zum „barbarischen, wilden Afrikaner“ Überlegene; vielmehr kommt hier ein Charakterzug zum Vorschein, den Hans Christoph Buch bereits Mitte der siebziger Jahre beschrieben hat,[9] nämlich die „Unfähigkeit […] zur Trauer“,[10] die er als „Zeitkrankheit, die in vielen westlichen Gesellschaften verbreitet ist“,[11] bezeichnet,
in Beziehung setzt zu einer „Unfähigkeit, erwachsen zu werden, dauerhafte Objekt-beziehungen aufzubauen, Versagungen zu ertragen“[12] sowie zu einer „Regression auf infantile Verhaltensmuster, orale Ersatzbefriedigungen, Drogenkonsum, kaputte Sexualität“[13] und mit dem Begriff „Narzißmus“[14] bezeichnet. Hierauf soll später noch näher eingegangen werden.
Es darf allerdings bezweifelt werden, dass man der Darstellung von Gewalt und Elend in ihrer Bedeutung gerecht wird, wenn man sie mit dem Erzähler als reine Kompensation privaten Elends betrachtet. Denn dazu ist die zugrunde liegende Diskurskritik zu weitreichend, wie im Folgenden zu zeigen sein wird.
2.5 „Dein Vorrat an einschlägigen Substantiven und Adjektiven ist erschöpft“ – Medien- und Sprachkritik
Das Verhältnis von Fiktion und Faktizität wird nämlich im Roman noch auf andere Weise thematisiert; Hans Christoph Buch kritisiert gleichsam auf einer Meta-Ebene die „westliche“ Redeweise über das Elend, das sich in Ostafrika abspielt. Dabei richtet sich diese Kritik in besonderem Maße gegen die „westlichen“ Medien.
Der Pulk der Presseleute wendet sich einer Flüchtlingsfamilie zu, die, vom Blitzlichtgewitter geblendet, vor dem Grenzpfahl mit dem Staatswappen von Zaire stehenbleibt: eine schwarze Faust, die eine brennende Fackel reckt. Die junge Mutter, die, einen Ölkanister auf dem Kopf, einen Säugling im Arm und ein kleines Mädchen an der Hand hält, will ihre Last absetzen, um aus dem Pappbecher zu trinken, den Evanys ihr reicht, aber ein Reporter des französischen Senders La Sept schiebt Evanys zur Seite, stellt der Frau den Ölkanister auf den Kopf und weist sie an, dieselbe Pose einzunehmen wie zuvor. (102f.)
Hier wird vorgeführt, wie eine mediale Wirklichkeit konstruiert wird, die eher der Unterhaltung des heimischen Publikums dienen soll als der tiefgehenden Analyse der Sachverhalte. Diese Konstruktion wird sogar ganz offen auf Kosten der Flüchtlinge betrieben. Statt diesen zu helfen, verwenden die Reporter sie als visuelles Material, um den Voyeurismus der westlichen Zuschauerschaft zu befriedigen. Die Würde der betroffenen Menschen wird dabei in keiner Weise berücksichtigt; vielmehr wird ganz unverhüllt und skrupellos eine Mutter zweier Kinder gedemütigt. Diesen Aspekt thematisiert auch Susan Sontag in ihrem Essay „Das Leiden anderer betrachten“: „Je weiter entfernt oder exotischer der Schauplatz, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß wir die Toten und Sterbenden unverhüllt und von vorn zu sehen bekommen.“[15] Eine Konsequenz besteht für Sontag in der Bekräftigung der weit verbreiteten Meinung,
daß solche Dinge in dieser Weltgegend eben geschehen. Die Allgegenwart dieser Fotos und dieser Schrecken nährt wie von selbst die Überzeugung, solche Tragödien seien in den rückständigen – das heißt, armen – Teilen der Welt eben unvermeidlich.[16]
Genau auf diese Problematik hebt auch die zitierte Passage aus Hans Christoph Buchs Roman ab. Denn zweifelsohne kann man den hier beschriebenen Versuch, eine bestimmte Wirklichkeit zu erzeugen, als eine Form kultureller Gewalt ansehen. Diese Konstruktion hat letztlich den Effekt, dass die gezeigte Gewalt als den Fremden – in diesem Falle den Ostafrikanern – naturgegeben dargestellt wird, während ein solches Elend in der eigenen, friedlichen Welt nicht vorkommen könnte. Nicht nur, dass die französischen Fernseh-reporter eine bestimmte Situation konstruieren, wird an dieser Stelle kritisiert, sondern vor allem die Rücksichtslosigkeit und Menschenverachtung, die damit einhergeht.
Mit Bezug auf die soeben zitierte Passage sei zudem noch darauf hingewiesen, dass hier eine afrikanische junge Frau dergestalt mit ihrer Mutterrolle identifiziert wird, dass sich einmal mehr kulturelle und sexuelle Gewalt miteinander überschneiden: Es wird nicht nur die „Realität“ konstruiert, dass in Afrika Gewalt naturgemäß an der Tagesordnung sei (was sich bis in unsere gegenwärtige Medienlandschaft hinein fortsetzt, wenn in Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens als Einleitung zu neuen Katastrophenmeldungen davon gesprochen wird, es habe „wieder mal in einer Gegend der Welt gekracht, wo dies an der Tagesordnung ist und alles oder auch gar nichts bedeuten kann“), sondern zudem wird parallel dazu die Frau auf ihre Rolle als Mutter reduziert. Diese „Realität“ ist – so wohl auch die Textperspektive – ein Konstrukt, das von westli-chen Reportern fingiert wird, die ihrerseits von einer ganz bestimmten Denkweise geprägt sind, nämlich vom kolonialen und patriarchalen Diskurs.
Doch die soeben skizzierte Medienkritik wird ausgeweitet auf eine noch fundamentalere Sprachkritik, die vor Augen führt, dass die zur Verfügung stehenden Wörter nicht ausreichen, um die „Realität“ darzustellen. Diese Sprachkritik setzt wiederum bei den Medien an:
„Können Sie mir sagen, was hier vor sich geht?“ fragt sich der Korrespondent des ZDF, der, aus Kigali kommend, erst vor wenigen Minuten am Grenzkontrollpunkt eingetroffen ist. Aber das kannst du nicht, denn der tiefere Sinn, die politische Bedeutung des Geschehens wird dir erst im nachhinein klar: DAS UNZULÄNGLICHE, HIER WIRD’S EREIGNIS / DAS UNBESCHREIBLICHE, HIER IST’S GETAN – orphische Urworte, die nicht als Soundbite fürs heute -Journal geeignet sind. (102)
Hier wird die Medienkritik ausgeweitet auf eine Kritik an der Sprache der Medien, indem diese der poetischen Sprache Goethes gegenübergestellt wird durch ein Zitat aus dem zweiten Teil des „Faust“ und eine Anspielung auf das Gedicht „Urworte. Orphisch“ aus dem „West-östlichen Divan“.
Doch auch der Erzähler selbst hat Schwierigkeiten, das Gesehene in Worte zu fassen und mit Worten zu erklären. Dies zeigt sich zum einen in eher allgemeinen Aussagen wie „Wörter wie Opfer und Täter, Genozid oder Massaker sagen kaum noch etwas aus“ (52) oder „Dein Vorrat an einschlägigen Substantiven und Adjektiven ist erschöpft“ (52), die sogar in der Feststellung gipfeln, solche Wörter „versperren den Blick auf die Realität, die zu beschreiben sie vorgeben“ (52). Zum anderen deutet sich diese Sprachskepsis aber auch mehrfach bei der Verwendung konkreter einzelner Wörter an („sporadic gunfire“, 36; „Crowd control getting out of control. Stampede“, 41; „Das Wort Massaker fällt dir erst spätabends im Hotel ein“, 46; „Das Wort REGENZEIT fällt dir ein“, 92). Immer wieder fällt anhand solcher Beispiele auf, dass die entscheidenden Begriffe („sporadic gunfire“, „stampede“, „Massaker“, „Regenzeit“) im Grunde Zitate sind, derer sich der Erzähler bedient: es handelt sich um gebräuchliche Wörter, deren Verwendung im Alltag nicht weiter reflektiert wird und deren Aussagekraft bei weitem nicht ausreicht, um die „reale“ Erfahrung, mit der der Erzähler konfrontiert wird, auszudrücken. Wenn aber schon einzelne Begriffe ungeeignet sind, um „die Realität“ abzubilden, wie unzureichend müssen dann erst ganze Diskurse sein, die ja letztlich aus solchen Wörtern bestehen.[17]
2.6 „Mehr sagt er nicht“ – Polyphonie?
Nachdem unter Bezugnahme auf das Spannungsverhältnis zwischen Fiktion und Faktizität auf die Rolle kultureller und sexueller Gewalt eingegangen worden ist, soll im Folgenden noch etwas kritischer untersucht werden, ob nicht im Roman auf einer subtileren Ebene ein
hierarchisches Verhältnis zwischen europäischem Erzähler und den zu Wort kommenden Afrikanern zu konstatieren ist. Die Frage ist nämlich, ob und inwiefern diesen afrikani-schen Individuen – sei es nun Madeleine Rurasagabiza, Raphaël Nzeyimana oder Evanys – eine eigene Stimme verliehen wird, das heißt ob und inwiefern der Roman in seiner Erzählweise einem Kriterium postkolonialen Erzählens, der Polyphonie nämlich, Rech-nung trägt.
[...]
[1] Mecklenburg, Norbert: Interkulturelle Literaturwissenschaft. In: Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea (Hg.): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart; Weimar 2003. S. 433-439. Hier S. 434.
[2] Vgl. ebd., 434f.
[3] Vgl. Lützeler, Paul Michael: Von der Postmoderne zur Globalisierung: Zur Interrelation der Diskurse. In: Ders. (Hg.): Räume der literarischen Postmoderne. Gender, Performativität, Globalisierung. Tübingen 2000. S. 1-21. Hier S. 8-10.
[4] Damit wird zugleich Lützelers These problematisiert, der „postkoloniale Blick“ sei insofern „gleichzeitig nüchtern und reaktionär“, als er „faktische koloniale Verhältnisse erkennen [wolle], um sie im Sinne der Dekolonialisierung zu verändern“ (ebd., 10).
[5] Zitate aus dem Roman „Kain und Abel in Afrika“ stammen aus folgender Textausgabe: Buch, Hans Christoph: Kain und Abel in Afrika. Roman. Berlin 2001. Die dem jeweiligen Zitat in Klammern folgende Zahl gibt die entsprechende Seitenzahl an.
[6] Vgl. zu dieser Blickrichtung bereits Zantop, Susanne: Der (post-)koloniale Blick des „weißen Negers“. Hans Christoph Buch: Karibische Kaltluft. In: Lützeler, Paul Michael (Hg.): Schriftsteller und „Dritte Welt“: Studien zum postkolonialen Blick. Tübingen 1998. S. 129-152. Zantop hebt in ihrer Analyse, die sich kritisch mit Buchs Reisetexten und Reportagen auseinandersetzt und vor allem um die Frage kreist, „wie ‚postkolonial‘ [...] Buchs post-kolonialer Blick“ sei (Zantop 1998, 132), auf den vorherrschenden „Panoramablick“ (133), „die vertikale Distanz zwischen Erzähler und beschriebener Realität“ (134) und die „Erotisierung des Anderen“ (135) ab und kommt letztlich zu dem Ergebnis, Buch bleibe – bei allen „postkolonialen Einsichten“ (152) – in „kolonialen Denktraditionen“ (152) befangen. Ob und inwiefern dieses Fazit auch im Hinblick auf den Roman „Kain und Abel in Afrika“ gezogen werden muss, stellt einen zentralen Aspekt der vorliegenden Arbeit dar.
[7] Dennoch wäre es wohl unangemessen, Bagaza hier als individuell gezeichnete Figur wahrzunehmen. Vielmehr wird er als ein „typischer“ Despot und Tyrann gezeichnet, der im Grunde ebenso unpersönlich dargestellt wird wie „die anwesenden Mitglieder des Zentralkomitees“ (25).
[8] „‚Gräfin D., die Herausgeberin der Zeitung, für die Sie arbeiten‘“ (24); „Eine deutsche Wochenzeitung hat dich nach Ruanda geschickt, um über den Aufstand im Osten von Zaire zu berichten“ (88); „Wegen der Osterfeiertage ist schon am Montag Redaktionsschluß, und wenn du sofort mit der Niederschrift beginnst, kannst du deinen Artikel noch rechtzeitig durchgeben“ (167).
[9] In seiner 1976 gehaltenen Rede „Life is Cheap in Latin-America“. Buch, Hans Christoph: Life is Cheap in Latin-America. Gedanken über Sensibilität und Solidarität. In: Ders.: Das Hervortreten des Ichs aus den Wörtern. Aufsätze zur Literatur. München; Wien 1978. S. 26-36.
[10] Ebd., 32.
[11] Ebd.
[12] Ebd.
[13] Ebd.
[14] Ebd.
[15] Sontag, Susan: Das Leiden anderer betrachten. Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. München; Wien 2003. S. 84.
[16] Ebd., 85.
[17] Nur hingewiesen sei an dieser Stelle auf eine in den achtziger Jahren von Buch vorgenommene Kritik an den gebräuchlichen Bezeichnungen für Hautfarben: „Die Worte weiß und schwarz bezeichnen keine Farben, sondern Fiktionen, die auf der Palette der Natur ebensowenig vorkommen wie in der Pigmentierung der menschlichen Haut.“ Diese Feststellung, die den Zusammenhang von Diskurs- und Sprachkritik ebenso thematisiert wie das Verhältnis zwischen Fiktion und Faktizität, stammt aus einer Reportage aus den Jahren 1986/87 von Buch, Hans Christoph: „Kleine Regenzeit. Westafrikanische Notizen“. In: Ders.: Tropische Früchte. Afro-amerikanische Impressionen. Frankfurt a. M. 1993. S. 19-42. Hier S. 19.
- Arbeit zitieren
- M.A. Mario Paulus (Autor:in), 2004, Sexuelle und kulturelle Codierung von Gewalt in Hans Christoph Buchs Roman 'Kain und Abel in Afrika', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75463
Kostenlos Autor werden













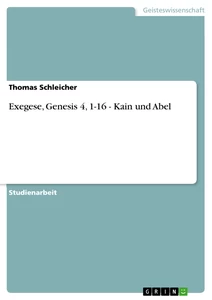








Kommentare