Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Untersuchung der Monologe
1.1 Wallenstein und Macbeth
1.1.1 Wallensteins Monolog Wär’s möglich? Könnt‘ ich...
1.1.2 Macbeths Monologe
1.1.2.1 If it were done when ´tis done...
1.1.2.2 Is this a dagger which I see before me
1.1.3 Zusammenfassung
1.2 Die Räuber und Richard III
1.2.1 Franz‘ Monolog Tröste dich, Alter! Du wirst ihn nimmer...
1.2.2 Richards Monolog Now is the winter of our discontent
1.2.3 Zusammenfassung
1.3 Die Verschwörung des Fiesco zu Genua: Fiescos Monolog
Was ist das? - Der Mond ist unter – der Morgen kommt feurig
1.4 Don Karlos: Posas Monolog Wär’s möglich? Wär es?
1.5 Maria Stuart: Elisabeths Monolog O Sklaverei des Volksdiensts!
1.6 Wilhelm Tell: Tells Monolog Durch diese hohle Gasse muss er kommen
2. Schlussbetrachtung
3. Abkürzungsverzeichnis
4. Bibliographie
5. Anlagen
0. Einleitung
„Monologe sind lauter Atemzüge der Seele.“ (Friedrich Hebbel[1])
Wer hat sich nicht schon einmal selbst dabei ertappt, einen – zumindest gedanklichen – Monolog gehalten zu haben? Einen Monolog in einer Situation, die eine Entscheidung erforderte? Eine Entscheidung, bei der es nicht möglich war, sie einfach aus dem hohlen Bauch heraus zu treffen, sondern sie statt dessen abzuwägen? Einen Monolog, der uns selbst verdeutlicht, in welcher Situation wir uns befinden? Eine Situation, über die wir uns nur dann klar werden können, wenn wir über sie reflektieren? Wahrscheinlich jeder! Denn Monologe sind etwas, was wir tagtäglich tun, teilweise auch ohne uns darüber bewusst zu sein. Monologe sind etwas, das uns in bestimmten Situationen helfen kann. Monologe sind Ausdruck unseres Inneren, die anderen verborgen bleiben; sie sind eben `Atemzüge unserer Seele´.
In der Literatur sind Monologe ein beliebtes Mittel, um eine Situation, ein Vorhaben oder gar Ängste von Figuren hervorzuheben, welchen anderen – abgesehen vom Leser – verborgen sind. Denkt man an die deutsche Literatur der Vergangenheit, fallen einem sofort Autoren, wie Schiller und Goethe ein, deren Werke maßgeblich für die weitere Entwicklung der Literatur waren. Denkt man im Spezielleren an die Werke Schillers, hört man förmlich seine Figuren `sprechen´, denn die Monologe seiner Figuren gehören zu den bekanntesten überhaupt, vor allem Tells „Durch diese hohle Gasse muss er kommen...“ oder Wallensteins „Wär’s möglich? Könnt‘ ich nicht mehr, wie ich wollte?“. Auch in der englischen Literatur finden sich Autoren, die eine vergleichbare Wirkung hatten und noch immer haben: So vor allem Shelley und Shakespeare, bei dessen Nennung nahezu jedem unwillkürlich die Hexen von Macbeth einfallen, die den gleichnamigen Helden des Werks dazu verleiten, zum Königsmörder zu werden, so dass dieser im Anschluss an den begangenen Mord von Wahnvorstellungen heimgesucht wird und mit diesen Erscheinungen sogar spricht; seine Worte „If it were done when `tis done“ und „Is this a dagger which I see before me“ eröffnen ebenfalls einen Monolog.
Dass Schiller ein großer Shakespeare-Liebhaber war, ist unverkennbar und in der Forschung bereits häufig diskutiert worden. Sein großes Interesse an ihm und seinen Charakteren, vor allem aber an der Figur des Macbeth, erklärt sich fast von selbst, denn für ihn waren nur Shakespeares Werke „Brücke zur Antike [und] nur er konnte sich an Größe neben den Alten behaupten und erschuf doch [...] wirkliche Menschen“ (Wikipedia: „Hamlet“).
Die vorliegende Studie beschäftigt sich vor allem mit Monologen Schillers, teilweise jedoch auch mit denen Shakespeares und soll zeigen, ob und wenn ja, inwiefern sich Schiller von Shakespeare in seinen Werken beeinflussen ließ. Im Folgenden werden die Monologe Wallensteins und Macbeths detailliert analysiert und auf ihre Gemeinsamkeiten eingegangen (Kap. 1.1). Im Anschluss daran geschieht dies mit den Monologen von Richard und Franz (Kap. 1.2).
Im weiteren Verlauf der Studie werden dann vier weitere Monologe Schillers näher beleuchtet und ebenfalls auf ihre Parallelen zu Shakespeare untersucht. Diese Monologe sind den Dramen Die Verschwörung des Fiesco zu Genua (Kap. 1.3), Don Karlos (Kap. 1.4), Maria Stuart (Kap. 1.5) und Wilhelm Tell (Kap. 1.6) entnommen. Es handelt sich bei ihnen um die wichtigsten Monologe der Hauptfiguren und vor allem teilweise um typologisch unterschiedliche, wodurch ein exemplarischer Überblick über die Monologe in Schillers Dramen gewährleistet werden soll.
Dieser zweite Teil beschäftigt sich jedoch, nicht mehr so ausführlich mit den Monologen Shakespeares wie dies noch im ersten Teil der Studie der Fall ist, denn es geschieht keine eingehende Interpretation der Shakespeare-Monologe mehr. Vielmehr sollen die Gemeinsamkeiten zwischen den Monologen Schillers und Shakespeares – so weit diese vorhanden sind – durch Querverweise in und am Ende der jeweiligen Monolog-Analyse deutlich gemacht werden.
Im Anschluss an die einzelnen Untersuchungen wird jeweils auf weitere Parallelen und Vergleichsmöglichkeiten zwischen den beiden Autoren eingegangen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht nur, wie oben bereits erwähnt, um Vergleiche zu anderen Monologen, sondern auch um Handlungsparallelen und Parallelen, welche die Charakteren und Motive betreffen.
Ein weiteres Augenmerk wird auf Goethes Schrift Shakespeare und kein Ende gelegt. In diesem geht Goethe nicht nur auf Shakespeare selbst ein, sondern macht deutlich, dass er eine Brücke zwischen Antike und Moderne darstellt. Dies und die weiteren Erkenntnisse Goethes, auf welche ausführlich in Kap. 1.1 eingegangen werden, stellen ebenfalls eine Grundlage für einen Vergleich Schillers mit Shakespeare dar.
1. Untersuchung der Monologe
1.1 Wallenstein und Macbeth
1.1.1 Wallensteins Monolog Wär’s möglich? Könnt‘ ich...
Wallensteins Achsenmonolog (vgl. Borchmeyer 1988: 157) besteht aus vier Abschnitten, die klar durch Regieanweisungen voneinander getrennt sind, deren Funktion die nähere Beschreibung der Gestik und Mimik Wallensteins ist. Der erste Abschnitt des Monologs (V. 139 – 158[2]) besteht überwiegend aus Fragesätzen, die die Bestürzung Wallensteins über seine Situation ausdrücken sollen und endet mit folgender Regieanweisung: „Er bleibt tiefsinnig stehen“ (I, 1). Im zweiten Teil (V. 159 – 179) geht Wallenstein auf seine Gedanken ein und versucht eine Prognose darüber zu geben, wie wohl seine Gegner auf sein Vorhaben reagieren werden; der zweite Teil endet damit, dass Wallenstein „Wiederum stillsteh[t]“ (I, 1). Im dritten Teil, der seinen Schluss darin findet, dass Wallenstein „heftige Schritte durchs Zimmer“ (I, 1) macht und dann „wieder sinnend stehen“ (I, 1) bleibt, macht er deutlich, dass ein Handeln seinerseits notwendig ist. Im weiteren Verlauf folgt der in diesem Monolog umfangreichste Teil (V. 194 – 217); darin beschäftigt sich Wallenstein mit der „Frage nach seiner und nach der Legitimität der bestehenden Ordnung“ (Borchmeyer 1988: 158).
Um Wallensteins Ausgangssituation in seinem Monolog nachvollziehen zu können, bietet sich am besten Goethes Beschreibung an:
„Man sieht ihn rückwärts planvoll, aber frei; vorwärts planerfüllend, aber gebunden. So lange er seiner Pflicht gemäß handelte, reizte ihn der Gedanke, dass er allenfalls mächtig genug sei, sie übertreten zu können, und in dieser Aussicht auf Willkür glaubt er sich auf eine Art von Freiheit vorzubereiten; jetzt aber, in dem Augenblick, da er die Pflicht übertritt, fühlt er, dass er einen Schritt zur Knechtschaft tue“ (zit. nach H. und K. 1977: 8).
Goethe macht ebenfalls deutlich, wie es dazu kam, dass Wallensteins Gedanken gereizt wurden und schließlich dazu führten, dass Wallenstein seine Pflichten übertrat, denn der
„Glaube an eine wunderbare glückliche Konstellation, der Blick auf die großen Mittel, die er in Händen hat, und auf die günstigen Zeitumstände, verbunden mit den Aufforderungen, die von außen an ihn ergehen, wecken allerdings ausschweifende Gedanken in ihm, mit denen seine Phantasie sich nicht ungern trägt; doch spielt er mehr mit diesen Hoffnungen, insofern ihm die Möglichkeit schmeichelt, als dass er seine Schritte fest zu einem Ziele hinlenkte“ (ebd.: 5).
In dieser Aussage Goethes liegt wohl der Grund von Wallensteins Monolog, denn Wallenstein „spielt“ (ebd.) lediglich mit „ausschweifende[n] Gedanken“ (ebd.) über eine Abkehr von seinem Kaiser; es handelt sich daher nur um eine „Möglichkeit“ (ebd.), die der „Phantasie“ (ebd.) entspringt und nicht um Realität. Aus diesem Grund beginnt sein Monolog wohl auch mit einer Frage, nämlich: „Wär’s möglich?“ (V. 139). Auch im weiteren Verlauf dieses Verses finden sich Konjunktivformen: „Könnt‘ ich nicht mehr, wie ich wollte?“ (V. 139). Doch nicht nur hier, sondern auch der nahezu komplette erste Teil seines Monologs ist in dieser Form geschrieben, die nur noch mehr verdeutlicht, dass Wallensteins Gedanken keineswegs für die Realität bestimmt waren. Somit wird bereits zu Beginn seines Monologs eines klar: Wallenstein ist „eigentlich mehr Möglichkeitsmensch als Wirklichkeitsmensch“ (zit. nach Borchmeyer 1988: 130); er hat daher eine stark ausgeprägte ästhetische Haltung, welche von Graham wie folgt beschrieben wird:
„Wallenstein – this is his greatness and his tragedy – is a political figure who wants to be `ganz Mensch´. Hence he plays and continues to play when play is out of season. To remain whole, he remains indeterminate when decisive action is demanded; and this indeterminancy is at once the reward and the price of his unwillingness to act. For to contemplate means to function as a whole. But to function as a whole also means to be restricted to a contemplative response rather than to enter into reality. Action realizes but restricts. Contemplation widens but does not mould and master the real“ (Graham 1974: 77f).
Borchmeyer geht einen Schritt weiter und macht auf den 26. Brief Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen aufmerksam (vgl. ebd.: 131), in welchem es heißt:
„Die Realität der Dinge ist ihr Werk; der Schein der Dinge ist des Menschen Werk, und ein Gemüt, das sich am Scheine weidet, ergötzt sich schon nicht mehr an dem, was es empfängt, sondern an dem, was es tut“ (Schiller 1878: V, 652).
Borchmeyer gibt zu verstehen, dass genau das die Haltung Wallensteins reflektiere, denn der „Schein der Dinge, der allein sein Werk ist, tritt für ihn an die Stelle ihrer Realität“ (Borchmeyer 1988: 131). Ein Beispiel, welches dies verdeutlicht, ist die Astrologie, die sich Wallenstein immer wieder zunutze macht; durch sie wird die Zukunft zu einem „verfügbaren Schein“ (ebd.). Wenn diese Zukunft jedoch nicht eintritt, sondern stattdessen von einer ganz anderen Realität eingenommen wird, hat dies für Wallenstein eine große Verwirrung zur Folge – welche sich unter anderem in seinem Monolog niederschlägt.
Im Gegensatz zu Wallensteins Astrologiegläubigkeit steht jedoch der Zufall, auf welchen an dieser Stelle kurz eingegangen sei; ihn versucht Wallenstein immer wieder zu negieren, unter anderem in den Versen, die seinem Monolog vorausgehen:
„Ich bin es nicht gewohnt, dass mich der Zufall
Blind waltend, finster herrschend mit sich führe“ (V. 135f).
Demnach stehen im Zufall zwei Dinge im Gegensatz zueinander: Die Realität der Dinge und die, wie es Borchmeyer nennt, „scheinhafte Vergegenständlichung“ (ebd.: 131) des ästhetischen Menschen, der über alles verfügen möchte.
Auffallend in diesem Teil seines Monologs ist jedoch auch der Gebrauch der Adjektive „blind“ (V. 136) und „finster“ (V. 136). Diese doch eher negativen Adjektive werden dem „Herrschaftsbereich des Saturn“ (ebd.) zugesprochen und stehen daher im Gegensatz zu Jupiter, dem „Lichtgestirn“ (ebd.), der Wallensteins eigene Sphäre darstellt. Während es noch Zufälle in ersterem geben kann, gibt es diese in letzterem keineswegs. Dies wird deutlich im Gespräch von Illo und Wallenstein, in welchem Illo äußert: „Das war ein Zufall“ (V. 943), woraufhin Wallenstein ihm entgegnet: „Es gibt keinen Zufall“ (V. 944). An dieser Stelle widerspricht sich Wallenstein jedoch selbst, hatte er doch im bisherigen Verlauf des Dramas die Existenz des Zufalls zugegeben („Es ist ein böser Zufall“, V. 92 und „Sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln“, V. 960). Borchmeyer führt an dieser Stelle an, dass Wallenstein immer dann die Existenz eines Zufalls einräumt, wenn „die Realität der astrologischen Spekulation widerspricht“ (ebd.: 132); steht die Realität jedoch mit der `astrologischen Spekulation´ in Einklang, negiert Wallenstein die Existenz. Borchmeyer ist recht zu geben, denn in dem Moment, als der Astrologieglaube als nicht haltbar offenbart wird, nämlich als Octavios Verrat offensichtlich ist, gibt Wallenstein Folgendes zu verstehen:
„Die Sterne lügen nicht, das aber ist
Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal.
Die Kunst ist redlich, doch dies falsche Herz
Bringt Lug und Trug in den wahrhaft’gen Himmel“ (V. 1668 – 1671).
Und das, obwohl er zuvor noch verkündete, dass für den Fall, dass Octavio gelogen habe, „die ganze Sternenkunst Lüge“ (V. 893) sei. Es ist offensichtlich, dass Wallenstein sich immer noch weigert, nicht an Sterne zu glauben; stattdessen befindet er sich nach wie vor in einer Art Scheinwelt und bemerkt nicht, dass „die Sterne eine ganz andere Wahrheit verkündigen“ (Borchmeyer 1988: 132) als die, die er gerne sehen möchte.
Was den weiteren Verlauf seines Monologs angeht, so wird Wallenstein klar, dass er mit den Gedanken, die er sich in Bezug auf die Abkehr vom Kaiser gemacht hatte, wohl eine Grenze überschritten hat, so dass er nun nicht mehr „könnt‘ [...] wie [er] wollte“ (V. 139), sondern stattdessen „[d]ie Tat vollbringen“ (V. 141) müsste, weil er „sie gedacht“ (V. 141) hat. Es erscheint ihm nun so, als müsse er nur auf Grund der Tatsache, dass er Dinge gedacht hat, eine Handlung folgen lassen. Nur durch diese „Grenzverwirrung“ (Borchmeyer 1988: 132) ist Wallensteins „Irritation“ (ebd.) gegeben, die sich durch den Rest seines Monologs hindurchzieht. Doch Wallensteins Gedanken über die Abkehr vom Kaiser waren – so zumindest versucht er sich zu rechtfertigen – lediglich ein „Traum“ (V. 143) und alles andere als ein ausgereifter Plan. Erneut wird in seiner Rechtfertigung klar, dass Wallenstein eine sehr ästhetische Haltung einnimmt, denn er gebraucht Begriffe, wie „Traum“ (V. 143), „Gedanken“ (V. 148) und „Gaukelbild“ (V. 150), um Folgendes klar zu machen:
„Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht
Mein Ernst, beschlossne Sache war es nie.
In dem Gedanken bloß gefiel ich mir“ (V. 146 – 148).
Langsam aber sicher muss sich Wallenstein jedoch eingestehen, dass er den Weg, den er, wenn auch nur in Gedanken, gegangen ist, wohl nicht mehr zurückgehen kann, denn seine Gegner, allen voran Octavio, haben seine Gedanken ernst genommen und ihrerseits Pläne geschmiedet, um die Realisierung von Wallensteins Gedanken zu verhindern. Nur durch diesen Umstand ist Wallenstein nun gezwungen, zu handeln; seine Gedanken sind nun nicht mehr nur Gedanken, sondern stehen auf der gleichen Ebene wie Aktionen – Aktionen, die eben Reaktionen ausgelöst haben. Wallenstein ist sich bewusst, dass er handeln muss, denn er sagt:
„Bahnlos liegt’s hinter mir, und eine Mauer
Aus meinen eignen Werken baut sich auf,
Die mir die Umkehr türmend hemmt!“ (V. 156 – 158).
Im zweiten Teil seines Monologs wird deutlich, was im bisherigen Teil bereits angedeutet wurde: Es handelt sich bei Wallensteins vermeintlichem Verrat lediglich um ein Gedankenexperiment, eine Art Eingebung, die keineswegs ernst gemeint war. Für ihn war es eine kurze „Leidenschaft“ (V. 169), in der er sich – wie zuvor erwähnt – gefiel, aber mehr auch nicht. Ob man seinen Worten Glauben schenken kann oder nicht, sei dahingestellt; eines ist sicherlich gewiss, nämlich, dass er sich selbst nicht für einen Verräter hält, auch wenn er glaubt, dies auf Grund seiner Umstände zu werden, denn er sagt Folgendes: „Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war“ (V. 170).
Es ist eine Art Einsicht, die ihn für den Leser sympathischer macht, die zeigt, dass auch Wallenstein nicht unfehlbar ist, dass er sich auf Grund seiner Gedanken und Worte in eine Situation manövriert hat, der er sich nicht mehr problemlos entziehen kann:
„Jetzt werden sie, was planlos ist geschehen
Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen,
Und was der Zorn und was der frohe Mut
Mich sprechen ließ im Überfluß des Herzens,
Zu künstlichem Gewebe mir vereinen,
Und eine Klage furchtbar draus bereiten,
Dagegen ich verstummen muß. [...]“ (V. 171 – 177).
Ihm ist klar, dass seine Gegner nun zur Annahme gelangen werden, dass sein Verrat lange geplant wurde. Sie werden versuchen, seine „Taten und Worte in eine geschlossene Kausalkette [zu] bringen“ (Borchmeyer 1988: 135), so dass das „unverbindliche Spiel der Phantasie“ (ebd.) aussieht wie das „Werk der planenden Vernunft“ (ebd.). Doch wäre Wallenstein wirklich der Verräter, für den ihn seine Gegner halten, hätte er sich dem Kaiser gegenüber wohl von vornherein anders gegenüber verhalten und keine aggressiven bzw. negativen Äußerungen über ihn gemacht. Vielmehr hätte er sich, um den Schein zu wahren, eine Maske aufgesetzt, um keinen Verdacht zu erregen. Er hätte seinen „Unmut“ (V. 167), seine Meinungsdifferenzen für sich behalten, eben Folgendes getan:
„Ich hätte mir den guten Schein gespart,
Die Hülle hätt‘ ich dicht um mich gezogen,
Dem Unmut Stimme nie geliehn. Der Unschuld,
Des unverführten Willens mir bewusst,
Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft -“ (V. 165 – 169).
Borchmeyer konstatiert, dass Wallenstein allerdings „zu einer solchen Rationalisierung seines Verhaltens [...] außerstande war“ (ebd.: 134f); dieser Beurteilung ist zuzustimmen, denn das zuvor erwähnte „Gaukelbild“ (V. 150) der „königlichen Hoffnung“ (V. 151) war nicht auf einen Zweck ausgelegt, also nicht auf Aktion und Handlung – und demnach Verrat – , sondern lediglich auf Genuss, an dem man sich „ergötzen“ (V. 151) kann.
Dennoch werden nun, da der Verrat unausweichlich erscheint, alle Taten Wallensteins, auch wenn sie noch so uneigennützig, unschuldig und „fromm“ (V. 162) sind, unter diesem Licht erscheinen, denn
„Strafbar erschein ich, und ich kann die Schuld
Wie ich’s versuchen mag! Nicht von mir wälzen;
Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens,
Und – selbst der frommen Quelle reine Tat
Wird der Verdacht, schlimmdeutend, mit vergiftend“ (V. 159 – 163).
Dieser „Doppelsinn des Lebens“ (V. 161), von dem Wallenstein hier spricht, geht nach Borchmeyer auf Schiller selbst zurück, denn beide – Schiller wie Wallenstein – wissen,
„dass vermeintliche Fakten meist nichts als Hypothesen sind, dass die Geschichtsschreibung in der Regel mit `wahrscheinlichen Vermutungen´ operiert, dass die historische Erkenntnis nicht das >An sich< des Gewesenen trifft“ (ebd.: 135),
sondern dass bei einer Veränderung des Standpunkts auch die Dinge und Umstände anders erscheinen als bisher. Dies bedeutet also ganz offensichtlich, dass vom Standpunkt, Wallenstein als Verräter zu sehen, all seine Taten als schlecht und verräterisch abgetan werden; vom Standpunkt, Wallenstein als loyalen Menschen anzusehen, würde man jedoch zu dem Schluss kommen, dass alle seine Taten der Loyalität unterliegen.
Der „Doppelsinn des Lebens“ (V. 161) weist aber auch auf Wallensteins Astrologiegläubigkeit hin, denn in ihr spiegeln sich die „sehr entgegengesetzten Antriebe der Wallenstein-Gestalt“ (Wiese 1952: 231), nämlich einerseits das Bedürfnis, den weiteren Verlauf des Geschehens rational vorherzusagen, zu „rationalisieren und ehrfurchtslos in den Dienst des vorausschauenden Willens zu zwingen“ (ebd.); andererseits ist die Astrologiegläubigkeit im „Irrationalen der Herrschernatur verankert, die aus dem geheimnisvollen Bewusstsein des Selbst heraus lebt, dass das `hellgeborne Joviskind´ vom Schicksal gezeichnet und erwählt ist“ (ebd.). Dieser Gegensatz wird verstärkt durch eine Frömmigkeit, welche wiederum das Abhängigkeitsverhältnis des Einzelnen von der Macht darstellt. Auch in Bezug auf diese will Wallenstein
„das eigene Dasein den Gesetzen des Kosmos ehrfürchtig unterordnen und doch wiederum herrscherlich über diese Gesetze verfügen und mit ihnen als bloßen Rechenfaktoren in seinem Spiel willkürlich schalten [so dass durch] diesen mehrfachen Sinn [...] der Sternenglaube zu einem tragischen Symbol für das Wallensteinsche Scheitern [wird]“ (ebd.),
denn der Wunsch, die Tat mit dem Gewissen zu vereinigen, ist nicht möglich; auch wenn er seine Handlungen an den Sternen festmacht, „vergisst er, dass ihm der Sprung in das Unwägbare von Tat und Verantwortung nicht erspart bleibt“ (ebd.).
Nachdem sich Wallenstein mit dem Verrat am Kaiser auseinandergesetzt hat, gerät er im dritten Teil seines Monologs in eine Art Künstlerdilemma und zwar dadurch, dass er „seine Machtträume in einen rein ästhetischen Bezirk entrückt“ (Borchmeyer 1988: 135). Er weiß nun, dass er seine Träume, bzw. den „Traum“ (V. 143), verwirklichen muss. Dabei stehen seine Gefühle, nämlich die Tatsache, dass er den Verrat eigentlich gar nicht ausführen möchte („In dem Gedanken bloß gefiel ich mir“, V. 148) in Opposition zu den weltlichen Umständen, dass sich seine Gegner bereits auf den Verrat vorbereitet haben und ihm nun nichts mehr anderes übrig bleibt – eben „Die Tat vollbringen [muss], weil [er] sie gedacht“ (V. 141). Allein dadurch, dass er seine Gedanken öffentlich gemacht hat – unter anderem im Gespräch mit Octavio – hat er nun die „Verfügungsgewalt“ (Borchmeyer 1988: 135f) seiner Gedanken verloren und sieht sie „dem Entfremdungsprozess unterworfen“ (ebd: 136), das heißt, dass die Verwirklichung seiner Gedanken für ihn etwas Befremdliches erhalten, was in den folgenden Worten offensichtlich wird:
„In meiner Brust war meine Tat noch mein:
Einmal entlassen aus dem sichern Winkel
Des Herzens, ihrem mütterlichen Boden,
Hinausgegeben in des Lebens Fremde,
Gehört sie jenen tück’schen Mächten an,
Die keines Menschen Kunst vertraulich macht“ (V. 186 – 191).
Phantasie und Realität stehen nun beide unter dem Zeichen der „Fremde“ (V. 189); in ihr befindet sich der Künstler. Allerdings geht Wallenstein der Annahme, dass er sich in einem „moralisch neutralen Raum“ (Borchmeyer 1988:136) bewegt; die Gedanken über die Abkehr vom Kaiser hat er schließlich lediglich `gedacht´ und nicht ausgeführt. Dem Leser erscheint er daher wie ein Darsteller eines Schauspiels, der für eine kurze Dauer in die Rolle des Verräters schlüpft, diese jedoch nach Beendigung des Schauspiels und Hinabsteigen von der Bühne wieder abstreifen kann und so – ohne eine Strafe fürchten zu müssen – sein bisheriges Leben weiterleben kann. Der Unterschied zwischen Wallenstein und einem Darsteller besteht jedoch aus einem ganz entscheidenden Aspekt, nämlich dass Wallenstein keineswegs einen Künstler darstellt, der er vielleicht gern sein würde, sondern ein Politiker ist, der sich mitten in der Realität befindet, nicht aber in einer ästhetischen Scheinwelt. Denn diese Ästhetik ist nur dann möglich, wenn das „vorstellende Subjekt“ (Schiller 1978: V, 658), also der Mensch, „aufrichtig ist (sich von allem Anspruch auf Realität ausdrücklich lossagt), und nur soweit er selbständig ist (allen Beistand der Realität entbehrt)“ (ebd.). Für Wallenstein kann daher der Schein keinesfalls ästhetisch sein, denn er muss realisieren, dass seine Gedanken in der Tat zu Realität wurden. Dies deutet sich nach Borchmeyer bereits zu Beginn seines Monologs an (vgl. ebd.: 137): Denn in dem Moment, als Wallenstein die Worte
„Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse
Erfüllung hin die Mittel mir gespart,
Die Wege bloß mir offen hab gehalten“ (V. 143 – 145)
äußert, befindet er sich nicht mehr in dem oben erwähnten `moralisch neutralen Raum´, also in der des ästhetischen Scheins, sondern bereits in der Realität und kündigt damit den Verrat indirekt an: In der Realität „erweist sich jedes Experiment [bzw. Gedankenexperiment] mit einer Möglichkeit des Handelns als Taktik“ (Borchmeyer 1988: 137); keine Frage daher, warum ihn seine Gegner bereits zu einem Zeitpunkt, als er den Verrat noch gar nicht begangen hat, schon als Verräter bezeichnen können. Goethe ist ebenfalls dieser Meinung; er konstatiert Folgendes über Wallensteins Situation:
„Als ob er gleich nicht direkt, nicht entscheidend zum Zwecke handelt, so sorgt er doch, die Ausführung immer möglich und sich die Freiheit zu erhalten, Gebrauch von den bereiteten Mitteln zu machen. Er sondiert den Feind, hört seine Vorschläge an, sucht ihm Vertrauen einzuflößen, attachiert sich die Armee durch alle Mittel und verschafft sich leidenschaftliche Anhänger bei derselben. Kurz, er vernachlässigt nichts, um einen möglichen Abfall vom Kaiser und eine Verführung des Heers von ferne vorzubereiten [...]. Die natürliche Folge ist, dass seine Gesinnungen immer zweideutiger erscheinen und der Verdacht gegen ihn immer neue Nahrung erhält“ (H. und K. 1977: 5).
Für Wallenstein geht daher vom Verrat eine gewisse Faszination aus; er reizt ihn. Dadurch ist es möglich, dass Schein und Realität oder Moral und Ästhetik verschmelzen und keine klare Grenze mehr zwischen ihnen auszumachen ist.
Diese Faszination aus dem dritten Teil des Monologs steht mit dem „Gemeine[n]“ (V. 208) und der „Gewohnheit“ (V. 196) einer bestehenden Ordnung („Macht“, V. 193) aus dem vierten Teil des Monologs in Opposition. In diesem letzten Teil beginnt Wallenstein seine Reflexion zwar mit deutlichem Respekt für die bestehende Ordnung; dies kehrt sich jedoch um und endet schließlich in einer Abkehr von ihr. Seine Reflexion beendet er, indem er im Anschluss an seinen „letzte[n] Blick auf [seine] moralische Grenzsituation“ (H. und K. 1977: 5) dem Pagen befiehlt, den „schwed’sche[n] Oberst“ (V. 219) kommen zu lassen und sieht wie folgt aus:
„Und was ist dein Beginnen? Hast du dir’s
Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht,
Die ruhig, sicher thronende erschüttern,
Die in verjährt geheiligtem Besitz,
In der Gewohnheit festgegründet ruht,
Die an der Völker frommem Kinderglauben
Mit tausend zähen Wurzeln sich befestigt“ (V. 192 – 198).
Dass dies für Wallenstein eine `moralische Grenzsituation´ ist, lässt sich an den zahlreichen Begriffen klar erkennen, die dieser mit der „Macht“ (Z. 193) assoziiert. Es sind dies vor allem die Verjährung („verjährt“, V. 195), das Heilige („geheiligtem Besitz“, V. 195), die Frömmigkeit („frommem“, V. 197) und der Glaube („Kinderglauben“, V. 197). Auf den ersten Blick könnte man auf Grund des Gebrauchs von „verjährt“ (V. 195) den Eindruck erhalten, dass man hier eine negative Haltung Wallensteins gegenüber des ancien régime herauslesen kann. Dass dem allerdings überhaupt nicht so ist und sein kann, sondern der Begriff früher vielmehr eine positive Konnotation hatte, hebt auch Borchmeyer hervor. Denn zu Schillers Zeit hatte der Begriff keineswegs die „Bedeutung des Verlusts der Gültigkeit nach einer Jahresfrist“ (Borchmeyer 1988: 158), sondern bedeutete vielmehr das Gegenteil dessen, nämlich die „Integrität und Legitimität einer Ordnung aufgrund ihrer geschichtlichen Dauer“ (ebd.). Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass Schiller in seinen eigenen Schriften näher auf Wallensteins Reflexion eingeht, indem er nahezu alle heraustretende Begriffe des Monologs aufgreift und Folgendes konstatiert:
„Nichts Geringes war es, eine rechtmäßig, durch lange Verjährung [Hervorhebung d. Autors] befestigte, durch Religion [Hervorh.d.A.] und Gesetze geheiligte [Hervorh.d.A.] Gewalt in ihren Wurzeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen der Einbildungskraft und der Sinne, die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerstören“ (Schiller 1978: IV, S. 673).
Im weiteren Verlauf des vierten Monologteils geschieht nun ein Wechsel: Die bisher von Wallenstein erwähnten Begriffe, auf die oben bereits eingegangen wurde, erfahren eine Abkehr ins Negative; sie haben nicht mehr eine positive Konnotation, sondern erhalten vielmehr „entgegengesetzte Wertungsvorzeichen“ (Borchmeyer 1988: 159): sie werden nun als das „ewig Furchtbare“ (V. 207), das „ganz Gemeine“ (V. 207f) und „ewig Gestrige“ (V. 208) bezeichnet. Vor allem wird die Veränderung der Werte aber an der Entgegensetzung des „frommem Kinderglauben[s]“ (V. 197) mit der „feige[n] Furcht“ (V. 205) deutlich. Diese „Furcht“ (V. 205), zusammen mit dem Glauben („Kinderglauben“, V. 197), sind das, was Wallenstein als seinen „unsichtbare[n] Feind“ (V. 203) bezeichnet.
Der Grund für eine solche Umkehr liegt laut Borchmeyer darin, dass Wallenstein „den moralischen gegen den ästhetischen Gesichtspunkt vertauscht“ (ebd.: 159): er führt die „Kraft“ (V. 215) ein. Durch sie allein erscheint die „Macht“ (V. 193) „obsolet und trivial“ (Borchmeyer 1988: 159), eben wie folgt:
„Nicht, was lebendig kraftvoll sich verkündigt,
Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz
Gemeine ist‘s, das ewig Gestrige,
Was immer war und immer wiederkehrt
Und morgen gilt, weil’s heute hat gegolten!
Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht,
Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.
Weh dem, der an den würdig alten Hausrat
Ihm rührt, das teure Erbstück seiner Ahnen!
Das Jahr übt eine heiligende Kraft;
Was grau für Alter ist, das ist ihm göttlich.
Sei im Besitze, und du wohnst im Recht,
Und heilig wird’s die Menge dir bewahren“ (V. 206 – 218).
Es ist klar, dass es sich bei diesem Teil in Wallensteins Monolog um einen „ironischen Pessimismus“ (Borchmeyer 1988: 159) handelt, da Wallenstein in dem Moment, als er sich als Verbrecher entlarvt, selbst zum „Gemeine[n]“ (V. 208) wird, allen Glanz verliert und keine Ehrfurcht beziehungsweise Akzeptanz mehr von seinen Untergebenen erwarten kann, denn „Größe für sich allein kann wohl Bewunderung und Schrecken, aber nur die legale Größe Ehrfurcht und Unterwerfung erzwingen“ (Schiller 1878: IV, 673f). Dessen war sich Schiller bewusst, denn er schrieb Folgendes über die `Entwicklung´ Wallensteins:
„Wallenstein sah nichts als eine gegen den Hof teils gleichgültige, teils erbitterte Armee – eine Armee, die gewohnt war, seinem Ansehen mit blinder Unterwerfung zu huldigen [...]. Berauscht von dem Ansehen, das er über so meisterlose Scharen behauptete, schrieb er alles auf Rechnung seiner persönlichen Größe, ohne zu unterscheiden, wieviel er sich selbst, und wieviel er der Würde dankte [...]. Alles zitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Gehorsam gegen ihn Pflicht, weil sein Ansehen an die Majestät des Thrones befestigt war“ (ebd.).
Was seinen Monolog selbst angeht, so dient dieser wohl dazu, die `Entwicklung´ Wallensteins nachvollziehen zu können; er ist nicht nur ein Reflexionsmonolog, sondern zeigt auch, dass er sich in ihm immer wieder in Widersprüche und eine „immer tiefere Fragwürdigkeit“ (Borchmeyer 1988: 139) verstrickt, die schließlich zu der Wahnvorstellung führt, dass man zweierlei Politik betreiben könne: Die des Denkens und die des Handelns (vgl. ebd.), während es bei der des Denkens keine negativen Konsequenzen für die jeweilige Person gibt. Dass dem ganz sicher nicht so sein kann, weil die Grenze zwischen gedanklichem und tatsächlichem Verrat verwischt, wird deutlich, wenn man Schneiders Worte mit in Betracht zieht, der zu folgender Überlegung rät:
„Beflecken schlimme Gedanken das Herz nicht, kommen sie nicht aus dem Herzen, als Vorbereiter der Tat, wirken sie nicht auf die Welt, indem sie ihr Klima verändern und das Klima des Verbrechens schaffen, die Nacht weben, in der die verbrecherische Tat geschieht?“ (H. und K. 1977: 127).
Somit ist das, was Wallensteins `Politik´ ausmacht, bloße „Selbsttäuschung“ (Borchmeyer 1988: 139), denn er versieht sie mit einem ästhetischem Schein und verwischt dadurch die Grenze zwischen Schein und Realität. Dieses Spiel spielt Wallenstein durch die ganzen Trilogie häufiger: Im zweiten Teil versucht zum Beispiel Terzky, ihn zur Rede zu stellen, indem er ihn fragt: „Was sollen alle diese Masken? sprich!“ (Picco. V. 848), woraufhin Wallensteins Antwort „nach einer Pause, indem er ihn scharf ansieht“ folgendermaßen aussieht:
„Und woher weißt du, dass ich ihn nicht wirklich
Zum besten habe? Dass ich nicht euch alle
Zum besten habe? Kennst du mich so gut?
Ich wüsste nicht, dass ich mein Innerstes
Dir aufgetan – Der Kaiser, es ist wahr,
Hat übel mich behandelt! – Wenn ich wollte,
Ich könnt‘ ihm recht viel Böses dafür tun.
Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen;
Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon denk ich,
Weißt du nicht mehr zu sagen als ein andrer“ (Picco. V. 861 - 870).
Nachdem Terzky daraufhin konstatiert, dass Wallenstein wohl schon immer sein Spiel mit ihnen getrieben habe (Picco. V. 871), reagiert Wallenstein erneut so, wie man es bereits von seinem Monolog her kennt: Er legt sich nicht fest und zieht sich stattdessen in die Scheinwelt, die „Als-ob-Welt“ (Borchmeyer 1988: 142) zurück, bis er schließlich später erkennen muss, dass „sein Gedankenspiel ein `Spiel mit dem Teufel´ war, also unausweichlich in `Ernst´ umschlägt“ (ebd.). Demnach ist Wallenstein nichts anderes als eine „charakterlose Seele“ (zit. nach Borchmeyer 1988: 142), der nichts mehr will als
„nur die Fäden in der Hand haben, deren Bewegung alle nötigen Kräfte für ihn ins Spiel setzen könnte, sie rühren will er niemals. Selbst dachte er sich nie deutlich, wohin das alles führen solle und könne; sein Vorhaben sich bestimmt zu denken, wagt er erst da, wo er es verfolgen muss“ (H. und K. 1977: 20).
1.1.2 Macbeths Monologe
Beide Monologe Macbeths werden vor dem Mord an Duncan gesprochen. In dieser Situation befindet sich Macbeth in einem verwirrten emotionalen Zustand: Er ist sich nicht sicher, ob er den Mord am König tatsächlich durchführen soll oder nicht. Er versucht Argumente abzuwägen und es wird deutlich, dass er selbst eigentlich König sein möchte und daher seine Tat ausführen muss. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden nun die beiden Monologe genauer untersucht, und zwar in ihrer chronologischen Abfolge im Drama: Zuerst der Monolog If it were done when ´tis done... und im Anschluss daran der Monolog Is this a dagger which I see before me....
1.1.2.1 If it were done when ´tis done...
Gleich zu Beginn von I, 7 spricht Macbeth einen Monolog; zuvor begrüßten er und seine Frau den König auf ihrem Schloss. Bei seinem Monolog handelt es sich um eine relativ komplizierte Rede, die das emotionale Chaos und die Verwirrung, vor allem in Bezug auf die Prophezeiungen der Hexen, Macbeths deutlich machen. Die „twists and turns“ (Regan 2000: 102) in der Satzstruktur, aber auch „the sudden proliferation of metaphors from fishing, riding and jumping, the dense theological, legal and ethical vocabulary“ (ebd.) verstärken den Eindruck dieser emotionalen Verwirrung. Es wird zwar gleich zu Beginn des Monologs deutlich, dass Macbeth, wie auch seine Frau, die bevorstehende Tat beendet sehen wollen („‘tis done“, I, 7, V. 1[3]). Doch auch wenn die Tat Macbeths, den König zu ermorden, auf eine Art eine Tat der Bewegung darstellt, so ist doch sein Monolog überwiegend von Stillstand geprägt. Zum einen steht er bewegungslos auf der Bühne und spricht seinen Monolog, zum anderen jedoch ist sein Monolog – zumindest die Anfangsworte – von dem Gebrauch des Konjunktivs geradezu überhäuft: „If“ (I, 7, V. 1 und 2), „when“ (I, 7, V. 1) und „then“ (I, 7, V. 1). Außerdem fällt auf, dass er die Tat nicht ausspricht, sondern sie zu Beginn lediglich als „it“ (I, 7, V. 1) bezeichnet, einen Vers später diese jedoch eine überaus starke Betonung erfährt, indem sie nun als „assassination“ (I, 7, V. 2) deklariert wird. Betrachtet man nun die ersten zwölf Verse des Monologs genauer, fällt sofort auf, dass Macbeths eigentliches Hauptanliegen darin besteht, den Mord am König so schnell als möglich hinter sich zu bringen und zwar in der Art, dass er möglichst ohne negative Folgen für ihn und seine Frau `davonkommt´. Hierfür steht die Metapher des Fischens („trammel up the consequence“, I, 7, V. 3); die Folgen der Tat sollen in einem Netz gefangen werden, so dass das Verbreiten der Nachricht über Duncans Tod und damit auch die möglichen Konsequenzen unterbunden sind. Auch die Alliteration des Wortes „surcease-success“ (I, 7, V. 4) verstärken die Metapher des Fischens.
Im Anschluss an diese Metapher folgt ein zweimaliger Gebrauch des Wortes „here“ (I, 7, V. 5 und 6); die erste Verwendung des „here“ (I, 7, V. 5) lässt vermuten, dass Macbeths Satz beendet ist: Er möchte die Auswirkungen des Mordes „here“ (I, 7, V. 5), also auf der Welt beziehungsweise in seinem Land oder Schloss, vertuschen. Der zweite Gebrauch des „here“ (I, 7, V. 6) macht jedoch vor allem auf die Risiken aufmerksam des „life to come“ (I, 7, V. 6). Wenn also Duncans Tod nicht nur ein Ende für Duncan selbst darstellen würde, sondern auch ein Ende an allem, was dem Mord folgen wird, würde Macbeth problemlos in das neue Leben `hinein springen´ und die Tat riskieren.
In diesem Vers wird erneut die Metapher des Fischens aufgegriffen und zwar in der Form des Ausdrucks „this bank and shoal of time“ (I, 7, V. 6). Demnach ist das Leben im Vergleich mit der Unendlichkeit des Meeres nichts anderes als ein „shallow stretch of water“ (Regan 2000: 102). In der Longman Ausgabe von Shakespeares Macbeth befindet sich sogar ein Bild dieser „bank and shoal“ (I, 7, V. 6), von dem es heißt, dass es ein Bild „of life as a narrow bank thrusting into the great seas of eternity“ (Macb. 1999: S. 42 und 44) darstellt. Das Bild der „bank“ (I, 7, V. 6) kann jedoch auch für die Bank in einem Gerichtssaal stehen und somit das Unrecht symbolisieren, welches Macbeth im Begriff ist, zu begehen. Der „poisoned chalice“ (I, 7, V. 11) verstärkt diesen Eindruck, verweist er doch auf die spätere Banquet-Scene, bei welcher sich – ausgenommen von Macbeth – ausschließlich „communal loyalties“ (Regan 2000 : 102) befinden.
Im weiteren Verlauf des Monologs verändert sich Macbeths Wortwahl: Er gebraucht nun überwiegend Worte, die mit Verwandtschaftsbeziehungen zusammenhängen (vgl. Regan 2000: 102). Seine Worte machen deutlich, dass er eine sehr sachliche Herangehensweise an seine Situation besitzt, wenn er sagt: „First, as I am his kinsman and his subject, / [...], then, as his host“ (I, 7, V. 13f). Die Ironie der Situation wird deutlich: Macbeth, der ja eigentlich „as his host“ (I, 7, V. 14) Duncan vor Unheil bewahren sollte („should against his murderer shut the door“, I, 7, V. 15), ist derjenige, der nun den Plan hegt, ihn zu töten. Macbeth geht in diesem Abschnitt sogar noch einen Schritt weiter und bringt das Bild von Engelstrompeten ein, welche die „deep damnation“ (I, 7, V. 20) ankündigen. Man denkt hier unweigerlich an den sogenannten Judgement Day, an welchem sich des Königs „virtues“ (I, 7, V. 18) „like angels, trumpet-tongued“ (I, 7, V. 19) verteidigen müssen. Doch der Ausdruck „plead like angels“ (I, 7, V. 19) kann nicht nur für die Verteidigung vor Gericht stehen, sondern auch mit betteln, dem Betteln nach Mitleid („pity“, I, 7, V. 21), assoziiert werden, Duncan zu verschonen; denn dieser erscheint für Macbeth als ein „naked new-born babe“ (I, 7, V. 21), das verwundbar ist und eigentlich Schutz benötigt. Diesen Umstand wird Macbeth im weiteren Verlauf des Dramas jedoch schamlos ausnutzen, um ihn zu töten.
Das Bild des „naked new-born babe“ (I, 7, V. 21) könnte aber auch einen Verweis auf das Ende des Dramas darstellen und für Macduff stehen, der „was from his mother’s womb / Untimely ripped“ (V, 8, V. 15f). Das Verb „striding“ (I, 7, V. 22) bedeutet zwar `über etwas schreiten´, erinnert jedoch auch an `reiten´ und wird durch den Gebrauch des „horsed“ (I, 7, V. 22) verstärkt. Das Substantiv „blast“ (I, 7, V. 22) kann nach Regan ebenfalls zwei Bedeutungen haben: Es kann „a gust of wind“ (Regan 2000: 103) oder aber auch „a trumpet blast“ (ebd.) darstellen. Ersteres wäre jedoch naheliegender, da es mit dem Verb „blow“ (I, 7, V. 24) korrespondieren würde. Dieses „blow“ (I, 7, V. 24) wird gegen Ende des Monologs zum zweiten Mal erwähnt; hier ist es jedoch ein Verb. In Vers 4 tritt „blow“ (I, 7, V. 4) als Substantiv auf. Durch diese zweimalige Erwähnung wird die Bedeutung verstärkt und reflektiert somit nicht nur das Chaos in Macbeth und seine emotionale Situation, sondern auch das Chaos in der Natur, welche durch den Mord an Duncan außer Kontrolle gerät.
Die „sightless couriers of the air“ (I, 7, V. 23) verweisen wohl auf unsichtbare Pferde, die von Engeln geritten werden oder auf Engel, die auf den Winden reiten und die Nachricht des Mordes durch ihre Trompeten in die Welt hinaus bringen. Das Bild erinnert an die religiöse Vorstellung, nach seinem Tod von einer Kutsche und Engeln abgeholt zu werden, um einen Platz im Himmel zu erhalten. Das Bild der Tränen, die „shall down the wind“ (I, 7, V. 25) reflektiert Augen, die bei einem zu starken Wind – „blow“ (I, 7, V. 24) – zu tränen beginnen. Der „spur“ (I, 7, V. 25) ist erneut eine Wiederholung dessen, was vorangegangen ist; Macbeth bezieht sich auf die Aussage Duncans, als er auf seinem Schloss ankam und Lady Macbeth zu verstehen gab, dass Macbeths „great love, sharp as his spur“ (I, 6, V. 23) sei. Macbeths Liebe zu Duncan erscheint demnach als eine Art Instrument des Todes. Nur der Leser, die Lady und Macbeth sind sich wohl über diese Zweideutigkeit in Duncans Aussage im Klaren.
Macbeths Monolog endet mit einem weiteren Bild, in dem er sich offenbar als einen Reiter auf einem Pferd sieht, der beim Sprung auf das Pferd den Sattel verfehlt, also „o’erleaps itself“ (I, 7, V. 27) und auf der anderen Seite wieder herunterfällt. Das Substantiv `side´ ist wohl das, das am Ende seines Monologs fehlt, als er von Lady Macbeth unterbrochen wird. Regan konstatiert jedoch, dass die „vaulting ambition“ (I, 7, V. 27) nicht nur dem Bild eines Reiters entsprechen muss, sondern auch eine religiöse Komponente besitzt, nämlich den „fall“ (I, 7, V. 28) von Luzifer (vgl. Regan 2000: 103). Demnach würde sich Macbeths Scheitern bereits in seinen ersten Worten im ersten Akt abzeichnen. Dies wird wohl auch Macbeth selbst klar, denn als seine Frau ihn während seines Monologs unterbricht, beschließt er plötzlich, dass er die Tat doch nicht begehen wird („We will proceed no further in this business“, I, 7, V. 31). Der Grund, den er Lady Macbeth gibt, nämlich die „golden opinions“ (I, 7, V. 33) und die Tatsache, dass Duncan ihn erst kürzlich geehrt hatte, sind jedoch nicht die wahren Gründe für das Ablehnen des Mordes an Duncan. Vielmehr ist es doch wohl Macbeths Angst vor der Verstoßung aus dem Himmel, der durch den „fall“ (I, 7, V. 28) symbolisiert wird und die Verpflichtungen, die er Duncan gegenüber hat, als sein „host“ (I, 7, V. 14) und Kämpfer im Krieg. Diese Gründe kann er seiner Frau gegenüber allerdings nicht äußern, da sie sie nicht verstehen würde.
Die Frage ist jedoch, was Macbeth schließlich doch dazu bringt, den Mord an Duncan zu begehen. Eine Antwort darauf wird gegeben, wenn man die dem Monolog folgenden Verse genauer betrachtet. In diesen kommt es zu einer Diskussion zwischen Lady Macbeth und ihrem Mann, in welcher sie ihm das „desire“ (I, 7, V. 41) als Argument für die Tat anführt:
„Such I account thy love. Art thou afeard
To be the same in thine own act and valour,
As thou art in desire? [...]“ (I, 7, V. 39-41).
Im nächsten Moment beschimpft sie ihn als „coward in thine own esteem“ (I, 7, V. 42) und „poor cat“ (I, 7, V. 44), die Fisch fangen möchte, sich jedoch nicht traut, die Pfoten nass zu machen. Macbeths Argument „I dare do all that may become a man; / Who dares do more is none“ (I, 7, V. 46f) lässt sie nicht gelten, sondern macht sich vielmehr noch über ihn und seine Männlichkeit lustig, indem sie sagt „When you durst do it, then you were a man“ (I, 7, V. 49). Es ist offensichtlich, dass das, was Lady Macbeth hier tut,
„an idea of manliness [ist] that excludes compassion and nurturing. In this she is following the dictates of a society that offers praise and rewards for violence. Her negation of her own mothering instincts defies conventional gender boundaries and suggests that women desirous of social advancement must become as men“ (Regan 2000: 104).
Sie hat Erfolg damit, denn am Ende des ersten Aktes ist Macbeth entschlossen, die Tat auszuführen.
1.1.2.2 Is this a dagger which I see before me
Macbeths zweiter Monolog geht ebenfalls dem Mord an Duncan voraus, steht jedoch im Gegensatz zu dem vorherigen – nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch in Bezug auf die emotionale Situation, in welcher sich Macbeth befindet:
„In the first soliloquy Macbeth was overpowered by a vision which culminated in great clarity of perception, but in this soliloquy vision is replaced by hallucination“ (Clemen 1987: 158).
Clemen hat Recht, denn der Dolch, der in den folgenden Versen nun vor Macbeth auftaucht, ist in der Tat nichts anderes als eine Halluzination. Bevor Macbeth jedoch zu reden beginnt, gibt er seinem Diener den Auftrag, seiner Frau zu sagen, sie möge die Glocke läuten, sobald sein Trank fertig ist. Diese Glocke ist wiederum das Zeichen dafür, dass Macbeth nun den Mord an Duncan ausführen kann. Demnach vollzieht sich Macbeths Monolog zwischen dem Weggehen des Dieners bis zum Läuten der Glocke und ist damit „framed within a more specific time-span than the earlier soliloquies“ (ebd.: 159). In diesem Monolog befindet sich auch das, was im vorherigen Monolog nicht vorhanden war: „movement and gesture“ (ebd.).
Sein Monolog beginnt mit einer rhetorischen Frage: „Is this a dagger which I see before me / The handle toward my hand?“ (II, 1, V. 33f). Diese Frage ist natürlich an ihn selbst und nicht an das Publikum gerichtet, denn er erwartet von ihnen keine Antwort beziehungsweise Zustimmung über das Vorhandensein eines Dolches vor seinen Augen. Vielmehr beginnt er, unbeirrt mit ihm zu sprechen. Ihm ist offensichtlich nicht klar, dass es sich bei dem Dolch tatsächlich um eine Halluzination handelt. Schließlich versucht er ihn zu fassen („Come, / let me clutch thee“, II, 1, V. 34f), was ihm jedoch nicht gelingt, denn „I have thee not, and yet I see thee still“ (II, 1, V. 35). Es wird deutlich, dass er hin- und hergerissen ist, was die Existenz des Dolches angeht. Mehr noch, vier Mal taucht in seinem Monolog das Trugbild des Dolches auf, während er jedoch immer unentschlossen ist „between acknowledging the `reality´ of the dagger and dismissing it as a phantom“ (Clemen 1987: 159). Diese Unentschlossenheit Macbeths wurde bereits in seinem vorherigen Monolog deutlich, als es darum ging, den Mord an Duncan abzuwägen. Während er sich jedoch am Ende des ersten Monologs dafür entschloss, den Mord nicht zu begehen, wird er sich am Ende dieses Monologs auf Duncans Zimmer begeben, um ihn zu töten.
Der Dolch steht aber nicht nur für Macbeths Unentschlossenheit, sondern auch für Scheinwelt und Wirklichkeit – eine Welt, die das ganze Drama umgibt, denkt man doch an die Aussagen der Hexen zu Beginn des Dramas: „Fair is foul, and foul is fair“ (I, 1, V. 10). Macbeth scheint jedoch zu spüren, dass es sich bei dem Dolch um ein Trugbild handelt, denn als er ihn das zweite Mal anspricht, bezeichnet er ihn als „fatal vision“ (II, 1, V. 36). Zwei Verse später wird aus diesem bereits „A dagger of the mind“ (II, 1, V. 38) und schließlich „a false creation“ (II, 1, V. 38), die lediglich ein Hirngespinst ist. Um aber sicher gehen zu können, dass es sich tatsächlich um ein solches handelt, zieht er seinen eigenen Dolch, der sich vom Aussehen her kaum von der Halluzination unterscheidet. Dieses Herausziehen seines Dolches hat für Clemen eine symbolische Bedeutung, denn mit diesem wird Macbeth später den Mord an Duncan ausführen (vgl. Clemen 1987: 160). Macbeth ist sich dessen ebenfalls bewusst und stellt sogar fest, dass ihm der Dolch, den er vor sich sieht, den Weg zu Duncans Zimmer weist:
„Thou marshall’st me the way that I was going;
And such an instrument I was to use“ (II, 1, V. 42f).
In dieser Aussage befindet sich jedoch auch ein Hinweis darauf, dass er sich schon lange Zeit mit dem Mord an Duncan auseinandergesetzt und auf dem „way“ (II, 1, V. 42) dorthin befunden hat. Das Blut, welches er nun auf dem Dolch wahrnimmt, reflektiert ebenfalls seine bevorstehende Tat; es ist klar, dass am Ende dieses Monologs nun ganz sicher kein Rückzug mehr folgen wird. Indem er sagt, dass sich „on thy blade and dudgeon gouts of blood“ (II, 1, V. 46) befinden, hat er praktisch den Mord an Duncan bereits symbolisch begangen. Auch wenn Macbeth das Blut auf dem Dolch wieder als Trugbild entlarvt („There’s no such thing“, II, 1, V. 47), tut dies dem Symbolgehalt keineswegs einen Abbruch, vielmehr verstärkt es noch die Vorstellung von Macbeths „bloody business“ (II, 1, V. 48). Denn um dessentwillen erschien doch erst der Dolch vor seinen Augen, nämlich um ihn über sein `blutiges Geschäft´ zu `informieren´ („It is the bloody business which informs / This to mine eyes“, II, 1, V. 48f). Clemen stellt dies ebenfalls fest, denn er konstatiert Folgendes: „He knows that it [der Dolch] is a foreshadowing or an embodiment of the intended murder“ (ebd.: 160). Der Gebrauch des Wortes „business“ (II, 1, V. 48) fällt an dieser Stelle auf; denn wie im vorherigen Monolog ist es Macbeth nicht möglich, die Tat als solche beim Namen zu nennen; vielmehr gebraucht er erneut ein Wort, welches diese lediglich umschreibt.
Aber mit dem Entschwinden des Dolches endet Macbeths Monolog noch nicht – die Glocke ist noch nicht ertönt – denn sein Blick „turns towards the nocturnal world outside“ (Clemen 1987: 161) und eine neue Vision tut sich vor seinen Augen auf. Es ist die Vision, dass die Hälfte der Welt von Nacht und Dunkelheit bedeckt ist, in welcher die dunklen Mächte nun ihr Unwesen treiben:
„[...] - Now o’er the one half world
Nature seems dead, and wicked dreams abuse
The curtained sleep: witchcraft celebrates
Pale Hecate’s offerings; and withered Murder,
Alarumed by his sentinel, the wolf,
Whose howl’s his watch, thus with his stealthy pace,
With Tarquin’s ravishing strides, towards his design
Moves like a ghost. [...]“ (II, 1, V. 49 – 56).
Auf eine Art zählt sich Macbeth zu diesen dunklen Mächten dazu, schließlich nutzt auch er die Gunst der Dunkelheit; bei Tag könnte er seine Tat nicht begehen. Clemen vertritt diese Ansicht ebenfalls und macht Folgendes deutlich: „Macbeth has a secret understanding with the demonic forces of witchcraft. It is of these that he now speaks, and it is with them that he is in league“ (ebd. 161). Verwiesen sei an dieser Stelle auf den Gebrauch des Wortes `league´, das Clemen erwähnt. Es handelt sich demnach um eine Art Bund, in dem sich Macbeth mit den dunklen Mächten befindet. Dies wird unter anderem durch die „wicked dreams“ (II, 1, V. 50) deutlich, die den „sleep“ (II, 1, V. 51) ausnutzen („abuse“, II, 1, V. 50). Auch Hecate taucht auf und erinnert an die Begegnung mit den Hexen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Macbeth Banquo bei ihrem Gespräch über die Hexen angelogen hat. Ihm gegenüber stritt er die Gedanken an die Hexen ab („I think not of them“, II, 1, V. 22). In seinem Monolog sind sie jedoch nun Gegenstand seiner Gedanken.
Genau in diesem Vers findet sich auch der Höhepunkt des Monologs: Der „withered Murder“ (II, 1, V. 52) wird personifiziert und erscheint vor Macbeth „to evoke the image of murder alarmed by his sentinel the wolf, in anticipation of Macbeth’s muderous deed“ (Clemen 1987: 161). Der Mord bewegt sich mit „stealthy pace“ (II, 1, V. 54), „like a ghost“ (II, 1, V. 56) auf sein Opfer zu; erneut wird Macbeths Handlung vorweggenommen, die durch den „stealthy pace“ (II, 1, V. 54) reflektiert wird. Drei Verse später stellt Macbeth den direkten Bezug her, indem er zu verstehen gibt, dass auch er hofft, wie ein Geist zu seinem Opfer zu gelangen („Hear not my steps, which way they walk“, II, 1, V. 57). Für Clemen ist die Abfolge der von Shakespeare entworfenen Bildern, von denen Macbeth spricht, „dead nature, Hecate and the witches‘ coven, Tarquin, the howling wolf“ (ebd.: 162) und „the ease and assurance“ (ebd.) dieser ein Zeichen für „the intense and fast-moving sweep of Macbeth’s imagination“ (ebd.).
In den letzten Versen seines Monologs verändert sich nun wieder Macbeths wahrgenommener Raum zu einem „renewed narrowing of scope“ (ebd.): Es ist nun nicht mehr das Ungewisse und Ungreifbare, sondern die Realität, die „sure and firm-set earth“ (II, 1, V. 56). Diese bittet er darum, seine Schritte nicht hörbar zu machen. Ausgehend von dieser Bitte gibt Macbeth nun sein Inneres preis: „And take the present horror from the time“ (II, 1, V. 59). Es ist offensichtlich, dass Macbeth an dieser Stelle selbst vor seiner eigenen Tat erschauert und sie am liebsten beendet haben möchte, bevor sie überhaupt begangen wurde. Für Clemen erscheint Macbeth an dieser Stelle
„like a man observing himself in a dream, talking about his steps as if they were separate from him. This splitting of himself, the capacity to confront himself like a stranger, was already noticeable in his speeches in the first act. It is in monologue that such self-duplication can be shown most convincingly“ (ebd.: 162).
Als die Glocke ertönt und Macbeths Monolog von Lady Macbeth unterbrochen wird – wie es in dem bisherigen Monolog ebenfalls der Fall ist – fasst er seine bevorstehende Tat in drei Versen kurz zusammen, durch welche man geradezu den Eindruck erhält, als sei die Tat bereits geschehen. Dennoch sind diese Worte nicht mehr ein Zu-sich-selbst-Sprechen Macbeths, sondern an Duncan gerichtet:
„I go, and it is done: the bell invites me.
Hear it not, Duncan; for it is a knell.
That summons thee to heaven or to hell“ (II, 1, V. 62 – 64).
Dieses Reimpaar, das doch überaus zynisch klingt (vgl. Clemen 1987: 163), für das Shakespeare und auch Schiller bekannt sind – beide gebrauchen es häufig am Ende von Szenen oder Monologabschnitten – soll Macbeth wohl dazu dienen, etwas von seiner Anspannung auf Grund seines bevorstehenden „bloody business“ (II, 1, V. 48) zu verlieren. Dadurch macht er aber auch klar, was wirklich in ihm vorgeht und was er tatsächlich von Duncan hält: Die Tatsache, dass er überhaupt in Betracht zieht, dass Duncan nach seinem Tod in die Hölle kommt, lässt alles, was Macbeth bisher – und auch in seinem ersten Monolog – über ihn gesagt hat, in einem anderen Licht erscheinen, denn alle positive Eigenschaften, welche Duncan zugeschrieben wurden, sind nun nichts Anderes mehr als `foul´.
Dennoch bleibt in Macbeths Monolog, der an dieser Stelle sein Ende findet, eines nach wie vor unklar, nämlich das moralische Problem, in welchem sich Macbeth befindet:
„On the contrary, the soliloquy is entirely removed from the sphere of abstract moral conflict, which has been transmuted into inner drama, which in turn finds not only its own form of interlocution, but also its own deep layer of Macbeth’s personality while at the same time directing our eyes far into the distance“ (Clemen 1987: 163),
denn wie im ersten Monolog die Vision der Engel, erscheint in diesem Monolog eine Vision des allumfassenden Bösen.
1.1.3 Zusammenfassung
Vergleicht man die drei Monologe der beiden Hauptcharaktere in Schillers und Shakespeares Werken, so fallen – rein formal gesehen – kaum Gemeinsamkeiten auf. Alle Monologe haben eine unterschiedliche Länge: Der Wallenstein-Monolog umfasst insgesamt 83 Verse während die beiden Macbeth-Monologe jeweils 28 bzw. 33 Verse haben. Dennoch gebraucht Schiller dasselbe Versmaß wie es damals zu Shakespeares Zeiten üblich war – den Blankvers (vgl. Rettelbach: 1997: 226). Dieser ist ein reimloser fünfhebiger Jambus, der auf Grund seines alternierenden Betonungsmusters – eine betonte Silbe folgt auf eine unbetonte – dem natürlichen Sprechen sehr nahe kommt.
Was den Gebrauch von Metaphern angeht, so findet man überraschend viele Gemeinsamkeiten, wenn auch nicht sofort auf den ersten Blick. Ein Beispiel hierfür wäre die Verwendung der Metapher des Netzes: Macbeth gebraucht diese, um seine Tat zu verbergen – in einem Netz gefangen, würde sie nicht an die Öffentlichkeit treten können. Wallenstein verwendet das Bild des Netzes für sich selbst; er fühlt sich gefangen in einem Netz, welches er sich selbst gestrickt hat („So hab ich / Mit eignem Netz verderblich mich umstrickt“, Tod V. 177f). Auch ist in beiden Monologen von einer Macht die Rede: Diese wird einerseits durch den Kaiser bzw. durch den König dargestellt. In den beiden Dramen wird auf unterschiedliche Weise auf sie eingegangen, nämlich in Form einer „ruhig, sicher thronenden“ (Tod V. 194) Macht und in Form folgender Aussage Macbeths: „We still have judgement here“ (Macb. I, 7, V. 8). Es sind diese beiden Mächte, die von den beiden Charakteren im weiteren Verlauf des jeweiligen Dramas übergangen werden und denen sie sich widersetzen. Auch die „bloody instructions“ (Macb. I, 7, V. 9), von welchen in Macbeth die Rede ist, tauchen in Wallensteins Monolog auf, und zwar in seiner Aussage über die Tat, die er vollbringen muss: „Ich müsste / Die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht?“ (Tod, V. 140f). Hierin besteht gleichzeitig eine starke psychologische Gemeinsamkeit der beiden Hauptcharaktere, denn Wallensteins Aussage könnte so gesehen genau in der Art von Macbeth gesprochen sein: Beide hatten dieselben Gedanken und beide befinden sich in der Situation, dass sie ihre Gedanken jemand anderem mitgeteilt haben – Wallenstein teilte sie Octavio mit und Macbeth seiner Frau – und schließlich nicht mehr zurück können, weil hinter ihnen jemand steht, der sie dazu bringt, die Tat dennoch auszuführen. Auf diese Entscheidung wird im weiteren Verlauf dieser Zusammenfassung jedoch noch näher eingegangen.
Auch als Macbeth versucht, Gründe gegen den Mord an Duncan zu finden, finden sich Parallelen zu Wallenstein: Macbeth sagt Folgendes über Duncan, seine `Macht´:
„First, as I am his kinsman and his subject,
[...]; then, as his host“ (Macb. I, 7, V. 13f).
Später, beim Gespräch mit Lady Macbeth gibt er Folgendes an:
„He hath honoured me of late; and I have bought
Golden opinions from all sorts of people“ (Macb. I, 7, V. 32f).
Diese eigentlich positive Meinung Macbeths über seinen Gegner Duncan findet sich ebenfalls bei Wallenstein in Bezug auf die regierende Macht, denn er sagt:
„[...] Du willst die Macht,
Die ruhig, sicher thronende erschüttern,
Die in verjährt geheiligtem Besitz,
In der Gewohnheit festgegründet ruht,
[...]“ (Tod V. 193 – 196).
Bei beiden ist die positive Meinung über die höhere Ordnung jedoch nur von kurzer Dauer. Die Veränderung ihrer Haltung findet sich bei Wallenstein jedoch noch in seinem Monolog, bei Macbeth befindet sie sich etwas später, denn erst nach dem Gespräch mit seiner Frau ist er sich sicher, den König zu ermorden.
Macbeths Bild des „naked new-born babe“ (Macb. I, 7, V. 21), mit dem er Duncan bezeichnet, der sich schutzlos und damit Macbeth ausgeliefert auf seinem Zimmer befindet, scheint der Aussage Wallensteins über den „frommen Kinderglauben“ (Tod V. 197) zu ähneln. Allerdings wird das Bild in beiden Dramen auf umgekehrte Weise gebraucht: In Macbeth steht das Bild, wie bereits erwähnt, für Duncan, also für die höhere Macht, welcher Macbeth ausgeliefert ist; im Wallenstein steht das Bild für das Volk, welches der Macht ausgeliefert ist.
Was die Tat der beiden Charaktere angeht, so wird sie von beiden nicht direkt ausgesprochen: Macbeth bezeichnet sie immer nur als „horrid deed“ (Macb. I, 7, V. 24) und in seinem zweiten Monolog als „bloody business“ (Macb. II, 1, V. 48); Wallenstein nennt sein Vorhaben einfach nur „Tat“ (Tod V. 141, 170, 186) beziehungsweise „kühne Tat“ (Tod V. 181).
Den Eindruck, nicht mehr von ihrer Tat umkehren zu können, zeigt sich bei Macbeth am Bild des Dolches, der in die Richtung deutet, in welche er gehen muss („Thou marshall’st me the way“, Macb. II, 1, V. 42); bei Wallenstein wird dies durch die Mauer ausgedrückt, wenn er sagt:
„[...] und eine Mauer
Aus meinen eignen Werken baut sich auf,
Die mir die Umkehr türmend hemmt“ (Tod V. 156 – 158).
Grund für diese „Mauer“ (Tod V. 156) ist die Tatsache, dass er davon ausgeht, dass ihm nun seine Gegner seine „reine[n] Tat[en]“ (Tod V. 162) ebenfalls negativ auslegen werden, auch wenn diese einer „frommen Quelle“ (Tod V. 162) entspringen. Außerdem erwähnt Wallenstein in seinem Monolog einen „unsichtbare[n] Feind“ (Tod V. 203), den er fürchtet. Dieser findet sich ebenfalls in Macbeths Monolog – in Form des Geistes: „ghost“ (Macb. II, 1, V. 56). Über die Existenz von Geistern lässt sich an dieser Stelle zwar streiten, dennoch sei gesagt, dass sie für gewöhnlich nicht nur unsichtbar sind, sondern sich auch so bewegen, dass man sie nicht hören kann. Diese Entsprechung findet sich in Wallensteins `unsichtbarem Feind´. Während Wallenstein diesen jedoch fürchtet, tut dies Macbeth nicht. Vielmehr möchte Macbeth selbst eine Art Geist sein, der lautlos in das Zimmer von Duncan treten kann („Hear not my steps, which way they walk“, Macb. II, 1, V. 57). Nach den Worten Macbeths sollte es demnach eher Duncan sein, der den Geist fürchtet und nicht Macbeth selbst – wie es doch bei Wallenstein der Fall ist („den ich fürchte“, Tod V. 203). Dennoch liegt in Macbeths Aussage hier auch eine Doppeldeutigkeit zugrunde; er sollte den Geist – wie Wallenstein auch – ebenfalls fürchten. Der Geist könnte sich nämlich nicht nur auf Macbeth selbst beziehen, sondern auch auf die bösen Geister, die Einfluss auf ihn genommen haben oder auf einen guten Geist, Gott, der im weiteren Verlauf den Mord an Duncan rächen und Macbeths Fall herbeiführen wird.
Doch nicht nur in den Monologen der beiden Charaktere lassen sich Parallelen finden, sondern auch in ihren Handlungen und Charakterzügen im jeweiligen Drama über die Monologe hinaus. Für einen weiteren Vergleich der beiden Werke bietet sich Goethes Essay Shakespeare und keine Ende an. Goethe gibt darin zu verstehen, dass „in den alten Dichtungen“ (Goethe 1953: XII, 292) ein „Unverhältnis zwischen Sollen und Vollbringen“ (ebd.) besteht, während in neueren Dichtungen dieses zwischen „Wollen und Vollbringen“ (ebd.) vorhanden ist. Das `Sollen´ ist das, was dem „Menschen auferlegt“ (ebd.) wird, das `Wollen´ legt er sich selbst auf. Vergleichbar ist dieser Umstand mit einem Kartenspiel: Die Art des Spiels und die Karten, die der Spieler bekommt, hängen vom Zufall ab. Sie reflektieren das, was man in der Antike unter dem Schicksal versteht und vertreten „die Stelle des Sollens“ (ebd.). Die Fähigkeit des Spielers und sein Wille, das Spiel zu gewinnen, wirkt im Gegensatz zu diesem und steht für das `Wollen´. Durch sein Kartenspiel versucht der Spieler nun seine Mitspieler zu beeinflussen, indem er seine Karten „verleugne[t], in verschiedenem Sinne gelten [lässt], halb oder ganz ver[wirft] [...] aus den schlechtesten Blättern den größten Vorteil zieh[t]“ (ebd.). Das Drama ist vergleichbar mit einem Kartenspiel, denn „die alte Tragödie beruht auf einem unausweichlichen Sollen, das durch ein entgegenwirkendes Wollen nur geschärft und beschleunigt wird. Hier ist der Sitz alles Furchtbaren der Orakel, die Region, in welcher Ödipus über alle thront“ (Goethe 1953: XII, 293). Dieses `entgegenwirkende Wollen´ macht die Tragödie „schwach und klein“ (ebd.); das `Sollen´ bewirkt dabei das Gegenteil – es macht sie „groß und stark“ (ebd.). Durch diese beiden Umstände entsteht im Menschen ein „innerer Konflikt“ (ebd.), zu welchem ein `äußerer´ Konflikt hinzukommt, der schließlich dazu führt, dass „ein unzulängliches Wollen durch Veranlassungen zum unerlässlichen Sollen erhöht wird“ (Goethe 1953: XII, 294).
[...]
[1] Zitiert nach: Zitat.tv
[2] Die Zitate in diesem Abschnitt (1.1.1), die mit „V. ...“ bezeichnet sind, beziehen sich - sofern nicht anders vermerkt - auf Schillers Wallensteins Tod (siehe Bibliographie). Sofern es sich bei den Zitaten um einen anderen Teil der Wallenstein - Trilogie handelt, werden diese entweder mit ´ Lager´ oder ´ Picco´ gekennzeichnet.
[3] Die Zitate in diesem Abschnitt (1.1.2), die mit `Act, Scene, V. ...´ bezeichnet sind, beziehen sich - sofern nicht anders vermerkt - auf Shakespeares Macbeth (siehe Bibliographie).
- Arbeit zitieren
- Manuela Kistner (Autor:in), 2006, Monologe bei Schiller und Shakespeare, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75386
Kostenlos Autor werden


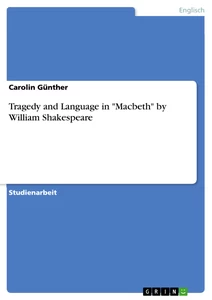
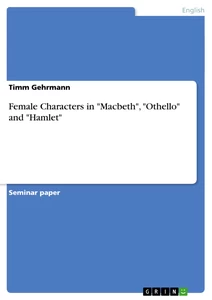
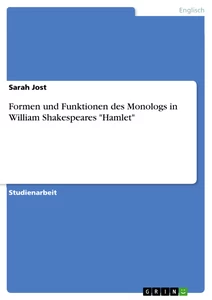





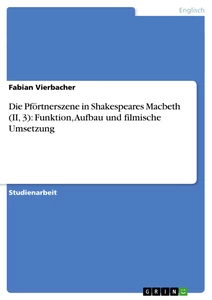
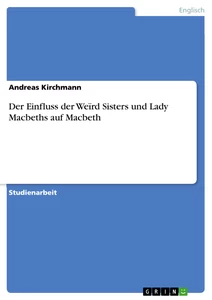








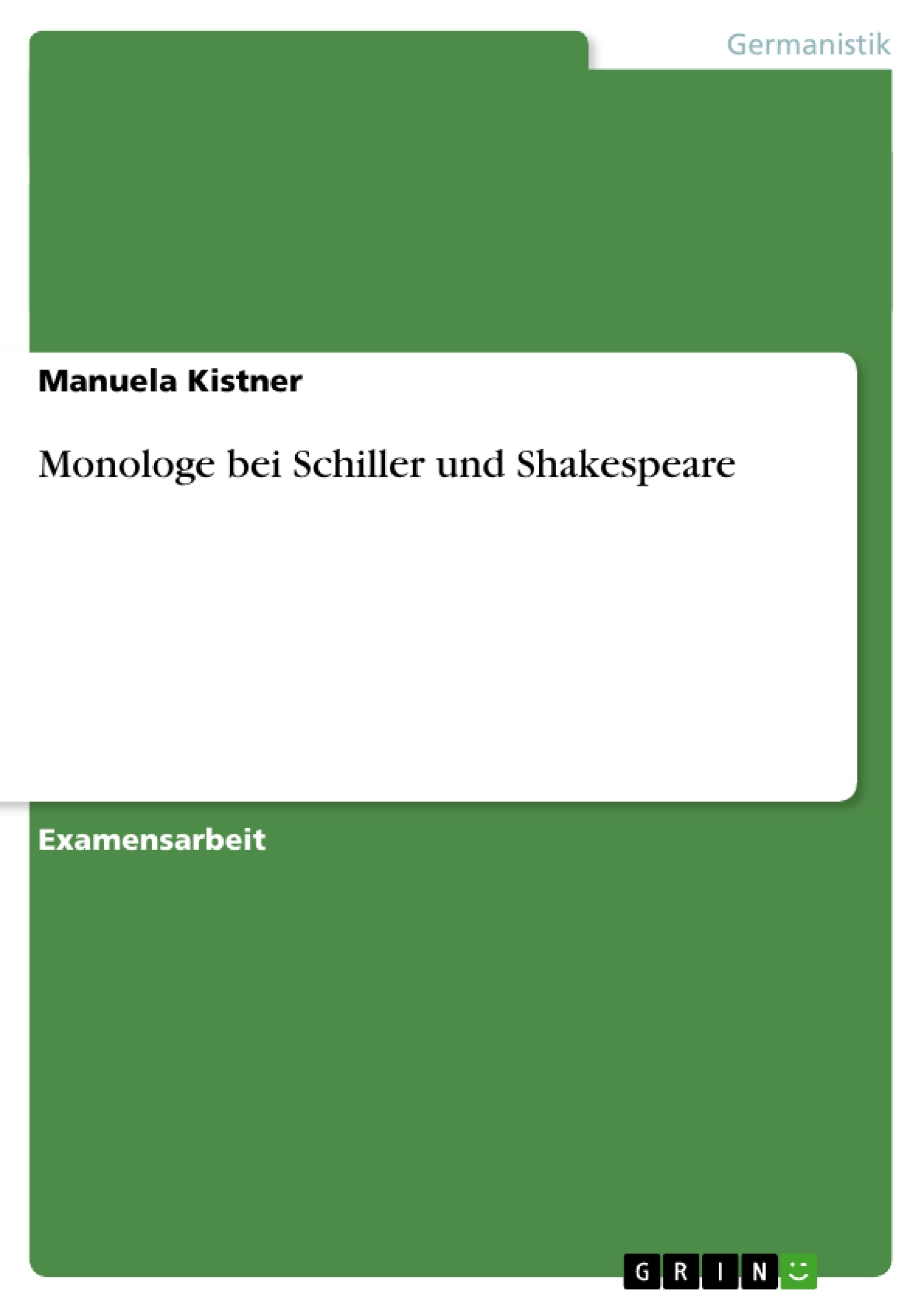

Kommentare