Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Museum
2.1 Historische Entwicklung
2.2 Das Kunstmuseum
3 Museen im Internet
3.1 Entstehungsgeschichte
3.2 Definitionen
3.3 Kategorien
3.4 Möglichkeiten/Perspektiven
4 Virtualität und Virtualisierung
4.1 Definitionen
4.2 Auswirkungen
4.3 Verlust der Aura?
4.4 Virtuelle Welt versus Reale Welt?
4.5 Fazit
5 User-Centered Design (UCD)
5.1 Was ist UCD?
5.2 Der Besucher eines realen Museums
5.3 Der User
5.3.1 Der User im Allgemeinen
5.3.2 Der User von Museumsinternetseiten
5.4 Wie lernt der User?
5.4.1 Das Internet als Lernort
5.4.2 Anforderungen an den User
5.4.3 Möglichkeiten und praktische Beispiele
5.5 Konsequenzen für die Gestaltung
6 Evaluation
6.1 Evaluationsmethoden
6.1.1 Evaluationstypen für den Bildungsbereich
6.1.2 Systematic Usability Evaluation (SUE)
6.1.3 Heuristics for Web Communication
6.1.4 Usability Engineering
6.1.5 Checklisten
6.1.6 Best of the Web Contest
6.2 Kriterienkatalog
6.3 Auswahl der Museen
6.3.1 Broschüremuseen
6.3.2 Inhaltsmuseen
6.3.2.1 ZKM - Museum für neue Kunst
6.3.2.2 Ars Electronica - Museum of the Future
6.3.2.3 Eremitage Museum
6.3.3 Lernmuseen
6.3.3.1 Quadrat Bottrop
6.3.3.2 The Getty
6.3.3.3 The Minneapolis Institute of Arts
6.3.3.4 Museum of Modern Art (MoMA)
6.3.3.5 Metropolitan Museum of Art
6.3.3.6 The National Museum of Wildlife Art
6.3.4 Reine Virtuelle Museen
6.3.4.1 Russische und Sowjetische Plakatkunst
6.3.4.2 Mus é e Imaginaire
6.3.4.3 WebMuseum Paris
6.4 Auswertung der Untersuchung
6.4.1 Auswertung der Broschüremuseen
6.4.2 Auswertung der Inhaltsmuseen
6.4.3 Auswertung der Lernmuseen
6.4.4 Auswertung der Rein Virtuellen Museen
7. Schlusswort
8. Bildverzeichnis
9. Literaturverzeichnis
10. Online Artikel - Verzeichnis
11. Internetseiten - Verzeichnis
12. Glossar
13. Anmerkungen
1 Einleitung
Kunstmuseen haben sich mittlerweile im Internet etabliert. Kaum ein Museum ver- zichtet noch auf einen Internetauftritt. Mit ihren kunstpädagogischen Inhalten berei- chern sie das Internet und schaffen neue Lernräume mit faszinierenden Möglichkei- ten, die durch kreative Ideen und interaktive Angebote das entdeckende Lernen er- möglichen.
Ziel dieser Arbeit zum Thema: „Kunstmuseen im Internet - eine Untersuchung aus kunstpädagogischer Sicht“ ist es, die verschiedenen Erscheinungsformen der Kunst- museen im Internet, ihre Angebote und deren Eignung für die Kunstvermittlung her- auszustellen. Das Thema dieser Arbeit wurde im deutschsprachigen Raum noch nicht unter dem kunstpädagogischen Aspekt behandelt, daher ist der überwiegende Teil der verwendeten Literatur englischsprachig und zu einem großen Teil dem Internet entnommen. Dies macht eine umfangreiche Recherchearbeit nötig um geeignete Materialien zusammenzutragen und ist nicht unproblematisch, da ein schnelllebiges Medium wie das Internet ständig aktualisiert wird und die Quellen zeitlich nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen.
Als besonders hilfreich für die Recherche haben sich die Seiten des Internetforums „Museums And The Web1 “ herausgestellt, die mit jährlichen Konferenzen die Möglichkeiten und Potentiale des Internet für Museen thematisieren. Dort werden internationale Beiträge seit 1997 als online Artikel archiviert. Einen interessanten Beitrag leistet das Forum auch durch den Wettbewerb „Best of the Web2 “, der jedes Jahr die besten Internetseiten von Museen nach verschiedenen Kategorien auszeich- net und für die vorliegende Arbeit einige gute Beispiele geliefert hat.
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, doch zunächst wird eine erste Annäherung an das Thema in einem Mind Map (s. Seite 6) festgehalten. Der erste Teil der Arbeit setzt das virtuelle Kunstmuseum zu seinem Umfeld, dem Internet, in Beziehung. Verschiedene Definitionen und Ansätze werden vorgestellt, die unterschiedlichen Ausprägungen der Kunstmuseen im Internet zu kategorisieren.
Das Kapitel Virtualität und Virtualisierung thematisiert den Einfluss des Internets auf Kunst und Gesellschaft und die daraus resultierenden Veränderungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die userzentrierte Gestaltung von Internetseiten. Sie stellt den User in den Mittelpunkt und berücksichtigt die veränderten Lernbedingungen im In- ternet und die damit verbundenen neuen Kompetenzen und Anforderungen an den User.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der praktischen Untersuchung von Kunstmu- seen im Internet. Zunächst werden verschieden Evaluationsmethoden und ein modi- fizierter Kriterienkatalog vorgestellt. Dieser dient für die Untersuchung als Leitpfaden und wird auf Kunstmuseen verschiedener Kategorien angewendet. Besonders die kunstpädagogischen Angebote der amerikanischen Lernmuseen werden durch zahl- reiche Screenshots beispielhaft illustriert. Zur besseren Veranschaulichung wird emp- fohlen, insbesondere die interaktiven Beispiele im Internet aufzurufen und dort aus- zuprobieren.
Am Ende der Arbeit befindet sich ein Glossar, welches die vielen englischen Fachbegriffe erklärt. Die beiliegende CD-ROM beinhaltet alle verwendeten online Artikel, vergrößerte Ansichten der Screenshots und eine Liste von nützlichen Links.
2 Das Museum
Der Begriff Museum geht auf die griechische Bezeichnung „museion“ zurück, ein Raum, der den Schutzgöttinnen der Künste, den Musen, geweiht war. Er wurde zum Ort der gelehrten Beschäftigung, später Studierzimmer genannt und schließlich als Kunstsammlung bezeichnet.3 Der Deutsche Museumsbund erklärte 1978, dass es noch keine zeitgemäße Definition für das Museum gäbe und unternahm den Versuch, einige Gesichtspunkte zu formulieren:
1. Ein Museum ist eine von öffentlichen Einrichtungen oder von privater Seite getragene, aus erhaltenswerten kultur- und naturhistorischen Objekten bestehende Sammlung, die zumin- dest teilweise regelmäßig als Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich ist, gemeinnützigen Zwecken dient und keine kommerzielle Struktur oder Funktion hat.
2. Ein Museum muß eine fachbezogene (etwa kulturhistorische, historische, naturkundliche, geographische) Konzeption aufweisen.
3. Ein Museum muß fachlich geleitet, seine Objektsammlung muß fachmännisch betreut wer- den und wissenschaftlich ausgewertet werden können.
4. Die Schausammlung des Museums muß eine eindeutige Bildungsfunktion besitzen.4
Das International Council of Museums (ICOM) formuliert 1995 folgende Definition:
Article 2 - Definitions
1. A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its de- velopment, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment.
(a) The above definition of a museum shall be applied without any limitation arising from the nature of the governing body, the territorial character, the functional structure or the orientation of the collections of the institution concerned.
(b) In addition to institutions designated as “museums” the following qualify as museums for the purposes of this definition:
(i) natural, archeological and ethnographic monuments and sites and historical monuments and sites of a museum nature that acquire, conserve and communicate material evidence of people and their environment;
(ii) institutions holding collections of and displaying live specimens of plants and animals, such as botanical and zoological gardens, acquaria and vivaria;
(iii) science centres and planetaria;
(iv) non profit art exhibition galleries
(v) nature reserves;
(vi) international or national or regional or local museum organizations, ministries or departments or public agencies responsible for museums as per the definition given under this article; (vii) non-profit institutions or organizations undertaking conservation, research, education, training, documentation and other activities relating to museums and museology;
(viii) cultural centres and other entities that facilitate the preservation, continuation and man- agement of tangible or intangible heritage resources (living heritage and digital creative activity)
(ix) such other institutions as the Executive Council, after seeking the advice of the Advisory Committee, considers as having some or all of the characteristics of a museum, or as supporting museums and professional museum personnel through museological research, education or train- ing.5
2.1 Historische Entwicklung
Im Mittelalter gab es in Kirchen und Klöstern Sammlungen von Kirchenschätzen, die aus Reliquien, Weihegaben und anderen liturgischen Geräten bestanden. Diese wur- den aus ideellen Gründen gesammelt und dienten in erster Linie zur Stärkung des christlichen Glaubens. Um 1400 fingen geistliche und weltliche Fürsten an, eigene Schatz- und Wunderkammern für ihre Sammelleidenschaft einzurichten.6 Die Samm- lung war eine Art Miniaturausgabe des Kosmos und sollte zur Veranschaulichung der Schöpfung Gottes beitragen. Sie wurde später um naturwissenschaftliche Objekte erweitert. Ein weiterer Zweck war die Speicherung von Wertsachen, die sich bald auch reiche Bürger leisten konnten. Kuriositäten aus aller Welt wurden in den Kunst- kammern zusammengetragen und dienten der Repräsentation und Selbstdarstellung der Fürsten.7 Nur wenige Auserwählte durften zunächst die Objekte besichtigen.
Erst nach der Französischen Revolution, im Zuge der Aufklärung, wurden Museen für breite Kreise der Bevölkerung geöffnet. Der Gedanke von Freiheit und Gleichheit aller Menschen, und dass die Welt rational verstehbar sei, fasste Fuß. Die Bildung der Bevölkerung rückte in den Vordergrund und wirkte sich auf die Museen aus, die nun eine Bildungsfunktion übernahmen. Die Museen wurden im enzyklopädischen Sinn aufgebaut und nach wissenschaftlichen Prinzipien neu gestaltet.8 Erkenntnisse der Pädagogik führten dazu, dass die Museen im 19. Jh. nach didaktischen Ge- sichtspunkten ausgebaut wurden. Mit der Herausbildung und Profilierung neuer Wis- senschaftszweige erfolgte eine weitgehende Spezialisierung,9 so dass am Ende des 19. Jh. auch Museen auftauchten, die einem einzelnen Künstler gewidmet waren. Nach dem 1. Weltkrieg fielen einige Museen der Gegenwartskunst der faschistischen Kulturpolitik zum Opfer. Andere beugten sich dem kulturpolitischen Druck nicht, dennoch erlitt die deutsche Museumslandschaft schweren Schaden. Nach 1945 rückte die Bildungsarbeit der deutschen Museen immer mehr in den Vordergrund. Dauer- und Sonderausstellungen, die Konservierung und Restaurierung der Objekte, wissenschaftliche Aufarbeitung und die interpretierende Darstellung galten als weitere kennzeichnende Elemente der Museumsarbeit. In den 1960-70er Jahren wurde über die Funktionen des Museums debattiert. Dabei fielen Schlagworte wie „Musentempel“, „Schauraum“ und „Lernort“.10 Gegen Ende des 20. Jh. spielten die Einflüsse neuer Medien eine zunehmende Rolle. Neue Präsentationsmöglichkeiten wie Dia-, Film- und Videoprojektionen brachten den Museen radikale Veränderungen ins Haus. In der gegenwärtigen Situation, um die Jahrtausendwende, stellen sich die Museen weltweit einer weiteren Herausforderung: dem Internet.
2.2 Das Kunstmuseum
Im Zuge der Französischen Revolution bildete sich das Kunstmuseum heraus, da die Bedeutung des Kunstwerks als Kulturprodukt und die damit verbundene Verantwor- tung in der Öffentlichkeit erkannt wurde. Kunstvereine entstanden und veranstalte- ten Ausstellungen. Seit etwa 1820 erwarben sogenannte Bürgervereine alte und zeitgenössische Kunst für öffentliche Kunstsammlungen11 von den Kunstvereinen. In der Mitte des 19. Jh. wandte sich das Museum als „Kunsthalle“ entschiedener allen Schichten der Bevölkerung zu und verstärkte die pädagogischen Aktivitäten. Die Sammlungen wurden nach verschiedenen Gattungen aufgeteilt. So entstanden Ge- mäldegalerien alter und neuer Meister, Skulpturensammlungen, Kupferstichkabi- nette, Kunstgewerbemuseen und Museen außereuropäischer Kunst.12 An manchen Orten spezialisierten sich die Museen, während an anderen Orten die alte Idee der Schatz- und Wunderkammern wieder hervortrat und in Wechselausstellungen die verschiedenen Gattungen zusammengefasst wurden. Als spezielle Gruppe unter den Kunstmuseen entstanden solche, die sich ausschließlich einem Künstler oder einer Künstlergruppe zuwandten.
Heute reichen die Arbeitsfelder der Kunstmuseen vom Sammeln der Kunstwerke, ihrer Bewahrung der Kunstwerke, ihrer wissenschaftlichen Erforschung bis zur Ver- mittlung kunstpädagogischer Inhalte. Kunstmuseen gehen dabei von bestehenden Sammlungen aus. Erweitert werden sie durch einzelne Ankäufe oder durch die Zu- wendungen von Stiftungen. Die meisten Sammlungen deutscher Museen reichen bis in die Gegenwart und ergänzen ihre Bestände durch die Kunstwerke lebender Künst- ler.13 Dazu gehört die digitale Kunst und als neueste Entwicklung die Netzkunst. Seit der Entstehung des Internets stellen sich auch die Kunstmuseen dieser neuen Heraus- forderung.
3 Museen im Internet
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Entstehung des Internets an sich und über den Einzug von Museen im Internet. Dann folgen verschiedene Be- zeichnungen und Merkmale dieser Museen, welche die Schwierigkeit einer allgemein gültigen Definition erkennen lassen. Ansätze verschiedener Autoren werden vorgestellt, sowie Versuche die Museen im Internet in Kategorien einzuordnen. Im Anschluss werden Möglichkeiten und Perspektiven für Museen aufgezeigt, das Potential des Internets zu nutzen.
3.1 Entstehungsgeschichte
„Bereits 1968, als das Internet noch gar nicht geboren war, träumte der Museums- wissenschaftler Allon Schoener vom ’Electronic Museum’.“14 Die ersten Computer wurden 1969 in den USA für militärische Zwecke miteinander vernetzt. Im Jahr 1974 schrieb der koreanische Künstler Nam June Paik einen Aufsatz mit der Vision einer „Elektronischen Super Autobahn“ (electronic superhighway), die verschiedene Orte über Netzwerke verbinden könne.15 In den 80er Jahren folgte ein weiteres Netzwerk mit dem Ziel, die Wissenschaft und Bildung voranzubringen. Dieses Netz- werk wurde als Internet bezeichnet. Im Jahre 1989 gewann das Internet an Populari- tät, als ein neuer Internetdienst, das World Wide Web (WWW), hinzukam.16 Nur zwei Jahre später „[...] formulierte [...] Tim Berners-Lee zu einer Zeit, als es vielleicht fünfzig Web Sites auf der Welt gab, erneut die Idee, durch Computervernetzung ein virtuelles Archiv des Wissens aufzubauen.“17 Daraufhin entstanden die ersten virtuel- len Bibliotheken. Nach und nach präsentierten sich immer mehr Museen auf unter- schiedlichste Weise im Internet. 1994 erstellte Jonathan Bowen die „Virtual Library of museums page18 “, eine Adressensammlung von Museen im Internet.19
Inzwischen gleicht das allgemeine Angebot im Internet einer schwer überschaubaren Informationsflut. Auf unterschiedliche Art und Weise wird deshalb versucht, die rie- sigen Datenmengen zu bewältigen. Verschiedene Suchmaschinen, Themenkataloge, Indexe und Übersichtsseiten sollen dabei helfen die Präsenz von Museen im Internet zu erschließen.
3.2 Definitionen
Die vielfältigen Bezeichnungen von Museen im Internet, wie z. B. Webmuseum, In- ternetmuseum, digitales Museum, virtuelles Museum, elektronisches Museum, Cy- berspace Museum, online Museum oder Hypermedia-Museum werfen folgende Frage auf: Was ist unter einem Museum im Internet zu verstehen? Eine allgemein- gültige Definition gibt es dazu nicht.20 Im Folgenden werden einige Definitionen vorgestellt, die unterschiedliche Aspekte berühren und einen Eindruck verschaffen sollen, was in der aktuellen Diskussion unter dem Museum im Internet zu verstehen ist.
Der Webdesigner DiNicola bezeichnet alle vorhandenen Museen im Internet ihrer Natur nach als virtuelle Museen: “By it´s very nature, a digital-art-museum that exists online is a “virtual museum” - sometimes with ties to an existing physical museum, sometimes not.”21
McKenzie (1997) geht davon aus, dass der Inhalt aus allem bestehen kann was sich digitalisieren lässt: Virtual Museums live on the World Wide Web…the Internet. […] A virtual museum is an or- ganized collection of electronic artifacts and information resources - virtually anything which can be digitized. The collection may include paintings, drawings, photographs, diagrams, graphs, recordings, video segments, newspaper articles, transcripts of interviews, numerical databases and a host of other items which may be saved on the virtual museum´s file server. It may also offer pointers to great resources around the world relevant to the museum´s main focus.22
Im Hinblick auf die kulturelle Dimension sagt Ben Davis, ein Berater der Medien- und Entertainment-Branche, (1994) dazu:
The main issues of digital museums are storage, retrieval, and interaction. […] Building digital museums is to reveal the essential nature of museums. The digital museum is an interesting hybrid of the culture that needs no museum and the culture that relies on them. The collec- tive memory that digital museums represent is much like the culture that keeps its cultural identity in its head. Dematerializing objects and creating virtual buildings that anyone with a computer and a modem can visit makes the traditional museum into a transactional space.23
Die Informationswissenschaftler Andrews und Schweibenz (1996) formulieren folgende Definition:
[…] the virtual museum is a logically related collection of elements composed in a variety of media, and, because of its capacity to provide connectedness and the various points of ac- cess available, lends itself to transcending traditional methods of communicating with the user; it has no real place or space, and dissemination of its contents are theoretically un- bounded.24
Fieberg (2001) orientiert seine Definition an der virtuellen bzw. realen Existenz des Museums:
Bei virtuellen Museen kann es sich um die Internet-Präsentation von real existierenden Museen handeln. [...] Neben den virtuellen Museen, denen ein reales Museum als Grundlage dient, gibt es allerdings auch „echte“ virtuelle Museen, die in der jeweiligen Form ausschließlich im Internet „existieren“,25 Laut Hünnekens (2000) sind Medien wie Video-Disc, CD-ROM und computerge- stützte Stationen, die in den 80er Jahren Einzug in die europäischen Museen fanden, schon als „virtuelle“ Museen zu bezeichnen. Sie dienen zur Veranschaulichung der Exponate.26
Doch mit der Möglichkeit der Vernetzung einzelner digitalisierter Museumsbestände in Europa [...] scheint erstmals tatsächlich das Potential3 virtueller Museen eingelöst [...]. Deshalb hat sich heute eingebürgert, von dem virtuellen Museum im Netz zu sprechen.27
Karabin (2000) definiert Museen, die ausschließlich im Internet existieren, folgendermaßen:
Electronic art museums must exist only on the Web. In other words, they should display artwork that, in its on-line exhibited form, cannot be viewed in its entirety at a given institution. Therefore, it may have its “own” collection, but may also represent a conglomeration of artworks from museums around the world. Unlike “real” museums, electronic museums do not have their own building, place or location to visit outside the Web. As a result, a visitor may experience new and exciting connections with the electronically based exhibitions. Frequently, electronic art museums take advantage of specific media or on-line technologies in order to display or encourage users to interact with artwork.28
3.3 Kategorien
Es gibt verschiedene Überlegungen die Museen im Internet einzuordnen. Der Informationswissenschaftler Schweibenz hat 1998 einige davon zusammengetragen und die Unterscheidung in Broschüremuseum, Inhaltsmuseum und Lernmuseum vorgeschlagen. Er greift auf Ansätze von McKenzie, Wersig/Schuck-Wersig und Dolgos zurück, die vorab vorgestellt werden:
McKenzie29 unterscheidet in seinen Ausführungen zwei Hauptgruppen von Internetmuseen:
Lernmuseen (Learning Museums), die grundlegende Bildungsressourcen online zur Verfügung stellen, laden den User zu wiederholten Besuchen ein. Sie ermög- lichen ausführliche Untersuchungen und Entdeckungen. Weitere Merkmale sind umfangreiche Sammlungen, die online zugänglich sind, reiche inhaltliche Ange- bote und eine einladende und benutzerfreundliche Startseite. Außerdem sind vielfältige lernfördernde Aktivitäten vorhanden, die verschiedenen Alters- und Lerngruppen angepasst sind. Dutzende Besuche sind nötig, um den faszinieren- den Inhalt zu erkunden. Die User werden motiviert das reale Museum zu besu- chen.
Marketingmuseen (Marketing Museums) werden für Werbezwecke genutzt und als Kommunikationsmedium eingesetzt, um die Besucherzahlen des realen Mu- seums zu erhöhen. Mehr Menschen sollen auf Sammlungen und spezielle Ereig- nisse aufmerksam gemacht werden. Die Erträge aus den Museumsshops spielen eine große Rolle.
Die Kommunikationswissenschaftler Wersig und Schuck-Wersig unterteilen deutsche Museen im Internet in vier verschiedene Kategorien:
Minimalinformatives Angebot, das lediglich aus Namen, Anschrift und Öffnungszeiten besteht Grundangebot: es ergänzt die Grunddaten um eine kurze Beschreibung des Hauses und der Sammlung Grundangebot mit Zusatzinformation: zu den Grunddaten kommen Informationen zu Sonderausstellungen und weitere Informationen zum Haus und zur Sammlung. Bis zu dieser Ka- tegorie ist keine eigene Homepage erforderlich, diese Informationen können von einem Fremd- anbieter erfolgen.
Erweitertes Informationsangebot mit eigener Homepage: dieses Informationsangebot gibt Aufbau und Organisation des Museums und seiner Sammlung wieder und ist relativ umfangreich. Es dient als Marketinginstrument, bietet aber auch Interaktionsmöglichkeiten.30
Dolgos unterteilt amerikanische Museen:
[...] zwischen Broschüremuseum und Informationsmuseum, wobei es auch Mischformen zwischen beiden geben kann. Das Broschüremuseum kommt generell häufiger vor, da es in Erstellung und Pflege relativ wenig Aufwand erfordert, während das Informationsmuseum sich auf die Ausstellung im physischen Museum bezieht und Informationen liefert. Deshalb ist eine Erstellung mit relativ hohem Aufwand verbunden.31
Aus den genannten Vorschlägen entwickelt der Informationswissenschaftler Schwei- benz eine eigene Kategorisierung von Museen im Internet. Diese liegt der vorliegen- den Untersuchung von Kunstmuseen im Internet (s. 6.3) zugrunde. Er unterscheidet drei Typen:
Das Broschüremuseum: Grunddaten des Museums wie Adresse, Öffnungszeiten und Anreisewege sind angegeben. Zusatzinformationen umfassen Hinweise zu Sammlungen und Ausstellungen. Alle Informationen haben den Zweck, den User zu einem realen Besuch ins Museum zu locken. Laut Schweibenz kann diese Form nicht als virtuelles Museum bezeichnet werden, „denn es fehlen alle Kennzeichen des virtuellen Museums wie umfangreiches Angebot an digitalen Objekten und Informationen, um nur die wichtigsten zu nennen.“32
Das Inhaltsmuseum ist umfangreicher als das Broschüremuseum. Der User wird dazu aufgefordert die ausführlichen Sammlungen online zu erkunden. Das Angebot ist objektorientiert und nicht didaktisch aufbereitet. Bilder unterschiedlicher Größe sind mit knappen Informationen versehen. Diese sind über Suchfunktionen nach verschiedenen Kriterien zugänglich.
Das Inhaltsmuseum stellt die Grundstufe des virtuellen Museums dar, in der digitale Objekte und Informationen sozusagen im Rohzustand angeboten werden und eine Aufbereitung durch Verknüpfung der Objekte und Informationen noch fehlt.33
Das Lernmuseum entspricht inhaltlich den Ausführungen von McKenzie:
Das Lernmuseum erfüllt die Anforderungen des virtuellen Museums, wobei zu unterscheiden ist zwischen dem Lernmuseum, das sich auf die eigene Sammlung beschränkt und dem, das an Angebote anderer virtueller Museen anknüpft. Letzteres würde der Idee des virtuellen Museums noch mehr entsprechen.34
Die Kategorien von Schweibenz müssen noch durch eine weitere Kategorie ergänzt werden. Die sind die reinen virtuellen Museen, die ausschließlich im Internet vorhanden sind. Ihnen liegt kein reales Museum zugrunde. Sie entstehen meist durch Privatpersonen oder Projektgruppen.
3.4 Möglichkeiten/Perspektiven
Die vielfachen Befürchtungen, dass virtuelle Museen die User vom Besuch im realen Museum abhalten, sind unbegründet:35 „Keinesfalls ist im Internet eine Konkurrenz zur Institution Museum zu sehen.“36 Das Internet eröffnet für Museen neue Perspektiven und Möglichkeiten. Der Direktor des „Exploratorium“, ein Zentrum für Medien und Kommunikation, beschreibt einige Potentiale des Internets:
Despite its lack of 3-D reality presence, the Web has some particular capabilities which make it of great interest to the museum world. It is both a temporal and a spatial medium. It pro- vides the opportunity to meld imagery, text and interactivity. And it provides for both indi- vidual as well as group […] experience. These attributes are similar to those offered by the museum experience and this is what makes the marriage between museums and the Web such an intriguing opportunity.37
Damit die Museen ihrem Bildungsauftrag gerecht werden, muss die Kunstvermittlung so effektiv wie möglich gestaltet sein. Die Orientierung an den individuellen Wün- schen und Bedürfnissen der User trägt dazu bei. Die Eigenschaften des Internets er- möglichen günstige Vorraussetzungen für benutzerfreundliche, d.h. userzentrierte Ansätze (s. 5). Friedlander38, Literaturprofessor und stellvertretender Direktor des „Standford Learning Lab“ (s. 5.4.3), weist darauf hin, wie neue Lernräume geschaf- fen werden können, um virtuelle und reale Aktivitäten miteinander zu verbinden. Das Internet bietet eine flexible Umgebung für kunstpädagogische Aktivitäten (s. 5.4.1).
Das Konzept „Museum without walls“ beruht darauf, für jedermann zugänglich zu sein. Dazu sagt Schlesinger:
The flexibility of digital technology permits the presentation of materials at different levels of complexity or in a variety of languages, the provision of Braille interfaces or the placement of printed text in place of voice for persons with impaired hearing, even specialized interfaces to enable severely handicapped persons to interact with the system. Digital software can be transported outside the museum, or into schools in order to reach larger groups with specific interests.39
Die Bereitstellung und Verbreitung von Informationen, Wissen und digitalen Samm- lungsbeständen rund um den Globus erreicht ein breites Publikum und schafft Ver- bundenheit. Dies stärkt nicht nur die Außenrepräsentanz der Museen, sondern er- laubt auch den internationalen Austausch von Ideen, Meinungen, Vorschlägen u.a. über Netzwerke.40 Durch die Möglichkeit immaterielle Kulturgüter mit einzubezie- hen, wird das kulturelle Erbe auf neue Weise lebendig. In Form eines virtuellen Spei- chers wird das Gedächtnis erweitert. Informationen kommen hinzu und bilden ein „kommunikatives Gedächtnis“.41 Darüber hinaus können Museen im Internet die Objekte zeigen, die im realen Museum nicht ausgestellt sind, sei es aus Platzgründen oder Empfindlichkeit.
Die Internetseiten von Museen können dazu benutzt werden, die Kommunikation und Diskussion zwischen Mitgliedern der Öffentlichkeit, und auch zwischen profes- sionellen Museumsexperten und einzelnen Besuchern zu fördern. Auf diese Weise kann auf spezielle Bedürfnisse und Fragen der User eingegangen werden. Insgesamt liegt im Internet das Potential die herkömmlichen Museen mit innovativen und interaktiven Angeboten zu ergänzen, und sie dadurch mit Leben zu füllen.42
4 Virtualität und Virtualisierung
Viele Bereiche unserer Gesellschaft sind in unterschiedlichsten Kontexten mit Virtualität und Virtualisierung durchdrungen. Im Cyberspace Café kann der Besucher virtuelle Identitäten annehmen und sich zum Austausch in virtuellen Foren oder Chatrooms treffen. Der User kann sich virtuellen Lerngemeinschaften anschließen, sich dort weiterbilden oder im endlosen Cyberspace seinen imaginären Einkaufswagen füllen und online einkaufen.
Kunstwerke werden digitalisiert und in Internetmuseen ausgestellt, die der User durch virtuelle Touren erkunden kann. Global gedacht kann das Internet selbst als imaginäres Museum43 aufgefasst werden. Neben den digitalen Reproduktionen von Kunstwerken aller Gattungen und Epochen gibt es die Netzkunst, die u. a. das Ver- hältnis zwischen Realität und Virtualität thematisiert. Die Begegnung von Kunst und Virtualität ist jedoch nicht neu. Der Soziologe und Künstler Thiedeke sagt dazu:
Kunst ist als Teilbereich menschlichen Handelns und der Gesellschaft anzusehen, der sich per definitionem mit dem Verfertigen von Künstlichem beschäftigt. Kunst hat die Funktion, imaginäre Ordnungen zu entwerfen und damit die Grenze zwischen verwirklichter Wirklichkeit und möglicher Wirklichkeit aufzuzeigen [...].44
Virtualität und Virtualisierung haben nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft, sondern auch auf die Darstellungsweise und Vermittlung von Kunst. Es gehört mit zu den Aufgagen der Kunstpädagogik, sich mit diesen Wechselwirkungen auseinander zu setzen. Die virtuelle Welt ist mittlerweile so komplex und facettenreich, dass in dieser Arbeit lediglich ein Eindruck von ihr vermittelt werden kann.
4.1 Definitionen
Laut dem etymologischen Wörterbuch45 ist „virtuell“ auf das lateinische Wort virtus ’Kraft, Tüchtigkeit und Mannhaftigkeit’ zurückzuführen. Weitere Bedeutungen sind: nur scheinbar, der Möglichkeit nach vorhanden, bzw. nicht in Wirklichkeit existie- rend.46 Das Gegenteil von virtuell ist „real“. Es bedeutet ’wirklich’, ist dem lateini- schen Wort realis ’wesentlich’ entlehnt und geht auf res ’Sache, Wesen’ zurück.47 Ergänzend dazu wird unter „virtual reality“ die virtuelle Wirklichkeit verstanden. Es ist die dreidimensionale Simulation eines Geschehens oder eines Existierens. Der ab- wertende Gegenbegriff dazu heißt „real reality“ und meint die wirkliche Wirklich- keit.48
Der Diskurs um Realität und Virtualität ist sehr komplex. Der Medienwissenschaftler Sandbothe gibt dazu eine philosophisch geprägte Definition, die erkennen lässt, dass er Virtualisierung als einen grundsätzlichen Aspekt menschlicher Gestaltungsfähigkeit sieht:
Die reale Welt ist eben nicht im eigentlichen Sinne „nicht virtuell“, sondern wenn man die philosophische Tradition im Blick hat, dann ist seit Aristoteles klar, dass das Wirkliche selbst immer Potentiale seiner Weiterentfaltung in sich enthält. Das Wirkliche im aristotelischen Sinne ist also ein Prozess der Aktualisierung von Potentialen, der nie an ein Ende kommt. Wirklichkeit hat man eigentlich erst verstanden, wenn man ihre prinzipiell virtuelle, entwicklungshafte Dimension, ihre prozessuale Struktur verstanden hat.49
Unter Berücksichtigung pädagogischer und didaktischer Entwicklungen versteht der Medien- und Erziehungswissenschaftler Dichanz vorläufig unter „Virtualität“ und „Virtualisierung“ die Erweiterung didaktisch-methodischer Möglichkeiten mit den Mitteln der elektronisch-digi- talen Informations- und Kommunikationstechnik [...], die Lehrpersonen und Lehrinstituten zahlreiche neue Hilfsmittel an die Hand geben, mit denen die unterschiedlichsten Lernprozesse individueller Lerner an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten sowohl durch den Lerner selbst wie durch eine Bildungsinstitution vororganisiert, motiviert, geordnet, geführt und evaluiert werden können.50
4.2 Auswirkungen
Die Virtualität ist ein Zustand der Möglichkeiten eröffnet und Alternativen zur Reali- tät aufzeigt. Das Medium Internet verschafft den Zugang in diese virtuelle Welt und verändert die Gesellschaft.51 Die Auswirkungen können als Vor- oder Nachteile angesehen werden.
Die technische Entwicklung schreitet voran. Texte, Bilder, Musikstücke, Filme und Kunstwerke werden in einen digitalen Zahlencode zerlegt. Der Soziologe und Künst- ler Thiedeke warnt vor einer Digitalisierung der Wirklichkeit, die den Weg für Mani- pulation frei macht und eine willkürliche Rekombination von Wirklichkeitsentwürfen ermöglicht.52 Diese werden immer komplexer und sind erst durch Maschinen zugänglich. Informationen werden zusehends abstrakter, entstehende Weltkonstruk- tionen sind nicht mehr nachvollziehbar. Kritische Stimmen sprechen vom Wirklich- keitsverlust.53 Der User hat fortan die Möglichkeit, „potenzielle Weltbeschreibungen nicht nur zu lesen, sondern zu betreten, zu verändern und in ihnen - zumindest zeitweilig - zu leben.“54 Er kann an der Gestaltung der virtuellen Realität teilneh- men, indem er sich spielerisch ausprobiert und entfaltet. Dabei ist er von sozialen und physischen Einschränkungen befreit, die mit seiner realen Körperlichkeit zu tun haben. Zusätzlich hat er die Möglichkeit andere Identitäten anzunehmen. Die Infor- mations- und Publikationswissenschaftlerin Möller sieht folgende Gefahr:
Darin kann die Gefahr stecken, sich als Individuum in den konstruierten Wirklichkeiten im Cyberspace zu verlieren, oder aber die Chance, die erweiterten Möglichkeiten der Netz- kommunikation zu nutzen und die Erfahrungen in die nicht-virtuelle Welt mitzunehmen.55
Die Vorstellungskraft verhilft dem User, sich in die Virtualität hineinzuversetzen. Er kann unterschiedliche Perspektiven einnehmen und mehr oder weniger intensive Erfahrungen sammeln.
Our full bodies are still not completely wired however. […] In the same way the people wear wetsuits to spend hours really “in” the water, “wetware” suits (hardware and software com- bined for the body) are being created to allow people to get completely inside the internet.56
Der Webdesigner DiNicola spricht vom scheinbar unbewussten Bedürfnis des Men- schen, seinen menschlichen Körper durch eine virtuelle Reproduktion zu ersetzen. Auf diese Weise könne man in einem digitalen Museum alles anfassen, was man wolle, einschließlich der Kunstwerke, vorrausgesetzt man hat einen digitalen Körper.57 Der australische Performance und Netzkünstler Stelarc thematisiert diese Gedankenspiele, indem er sich mit realen und digitalen Körpern durch Aktionen wie „Ping Body“58 und „Movatar“59 auseinander setzt:
During one 1998 performance, Stelarc wired himself up directly to the Internet. His body was dotted with electrodes […] that deliverd gentle electric shocks, just enough to nudge the muscles into involuntary contractions. The electrodes were connected to a computer, which was in turn linked via the Internet to computers in Paris, Helsinki and Amsterdam. By press- ing various parts of a rendering of a human body on a touch screen, participants could make Stelarc do whatever they wished.60
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
01| Stelarc: “Ping Body”
Die Virtualisierung beeinflusst das Denken und schlägt sich sowohl im Ethikbegriff als auch im Weltbild nieder. In einem Interview sagt der Soziologe und Künstler Sandbothe:
Ein ganz grundsätzliches Phänomen der Bedeutung von Virtualität lässt sich dadurch verdeutlichen, das wir uns als Menschen in gewisser Weise je schon als Möglichkeitswesen entworfen haben. [...] Meine eigene Identität konstituiert sich von einem Virtuellen, von einem Zukünftigen, von einem noch nicht Realen her.61
Weitere Auswirkungen von Virtualität betreffen das Lernen in einer veränderten Umgebung. Diese werden unter dem Abschnitt „Das Internet als Lernort“ behandelt (s. 5.4.1).
4.3 Verlust der Aura?
Walter Benjamin, ein deutscher Philosoph (1892 - 1940), setzt sich kritisch mit dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit auseinander. Viele seiner Denkanstöße haben heute noch Gültigkeit und lassen sich auf das Internet übertragen. Eine seiner Hauptaussagen ist: Kunstwerke verlieren durch die technische Reproduzierbarkeit ihre Aura.
Unter Aura versteht er die Ausstrahlung eines Kunstwerks. Sie ist sein empfindlichs- ter Kern, der seine Echtheit, Einmaligkeit und seinen Kultwert bestimmt. Im Original ist die Aura des Kunstwerks noch unangetastet, doch „was im Zeitalter der techni- schen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura.“62 Diese Aussage greift auch Gawert auf: Es „wird ein weiterer Schritt zur Auflösung des Kultwertes, der Zerstörung der Aura und zur Absolutsetzung einer unauratischen Ausstellbarkeit getan. Das Werk kann nun zu jeder Zeit und an jedem Ort rezipiert werden.“63 Dieser Gedankengang findet gerade im Internet seine aktuellste Entspre- chung. Unabhängig von Raum und Zeit sind Kunstwerke dort für jedermann zugäng- lich. Der Webdesigner DiNicola beschreibt dies auf amüsante Art und Weise (frei aus dem Engl. übersetzt):
Stell dir vor du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Museum besuchen, ohne Wächter und anderen Menschen, mit denen du den Raum teilen musst. Solange du da bist, kannst du auf deinem Lieblingsstuhl sitzen, deine Lieblingskleidung anziehen, deiner Lieblingsmusik zuhören, essen, trinken und rauchen, wann immer du willst. Du stellst deinen eigenen Rundgang zusammen. Möglicherweise springst du schnell zwischen mehreren Museen hin und her. Du hast die Wahl, die ausführlichen Infor- mationen über die Kunstwerke zu lesen oder sie zu ignorieren. Und das allerbeste ist: Siehst du ein Kunstwerk, was dir gefällt, dann „nimm“ es, beschreibe es, bemale es, mach dir Kopien davon, was immer du willst! Wie kann dies geschehen ohne den Alarm auszulösen? Alles was du brauchst ist ein digitales Kunstwerk, ein digitales Museum und einen digitalen Körper. Mit anderen Worten: ein Computer mit einem Modem verhilft dir zu dem Kunstwerke, mit dem (meistens) nur Kunstdiebe davon- kommen.64
Immer dort wo technische Neuerungen entstehen hat dies auch Auswirkungen auf die Kunst. Benjamin sagt: der Einzug der Fotografie hat den Kultwert der Kunst- werke zurückgedrängt.65 „Im flüchtigen Ausdruck eines Menschengesichts wirkt aus den frühen Photographien die Aura zum letzten Mal.“66 Er weist darauf hin, dass die Einmaligkeit eines Kunstwerks und damit auch seine Aura durch die Reproduktion verloren geht.
Nämlich: die Dinge räumlich und menschlich näher zu bringen, ist ein genau so leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen, wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion ist.67
Der Webdesigner DiNicola greift den direkten Zusammenhang auf, zwischen dem Versuch dem Betrachter das Kunstwerk näher zu bringen und der zunehmenden Schwierigkeit das Original von dessen Reproduktion zu unterscheiden. Er wirft die Frage auf, welche Bedeutung dieser Zusammenhang für Kunstwerke im Internet hat und stellt fest, dass es heutzutage in vielerlei Hinsicht keine Distanz und kein Origi- nal mehr gibt.68 Kunstwerke, die am und mit dem Computer hergestellt wurden, bestehen genau genommen nur noch aus einer Zahlensequenz: „Art made on a computer theoretically exists nowhere as an original, other than as a sequence of digits.”69
DiNicola denkt noch einen radikalen Schritt weiter. Er sieht im Verlust räumlicher Entfernung vom Original folgende Konsequenz: Für die Menschen, die die Mona Lisa nie real anschauen werden, wird ihre „digitale Cousine“ zu mehr als nur einer Reproduktion. Ist ein Werk nur als Reproduktion bekannt, dann wird die Reproduktion zum realen Kunstwerk.70
Gawert beschäftigt sich mit dem Gedanken, ob sich die Kunstwerke in unserer heutigen Zeit zu Kunst ohne Aura entwickeln bzw., ob die Begriffe Aura und Original in der virtuellen Welt überhaupt noch vertretbar und sinnvoll sind.71
4.4 Virtuelle Welt versus Reale Welt?
Sind die virtuelle und die reale Welt zwei gegensätzliche Welten? Die aktuelle Diskussion zeigt, diese Annahme ist nicht haltbar „da es einen Rückbezug von der Virtualität zur Realität gibt und vice versa. Die Interdependenz beider Begriffe steht dieser Dichotomisierung diametral entgegen.“72
Der Medienwissenschaftler Sandbothe stellt ebenso deutlich heraus, dass es sich nicht um eine „Zwei-Welten-Story“ handelt, sondern darauf ankommt, diesem „dua- listischen Verständnis von Realität und Virtualität als zwei beziehungslosen Reichen, die nichts miteinander zu tun haben, [...] entgegenzuwirken.“73 Das „Mixed Reality- Konzept“74 widmet sich dieser Aufgabe. Prozesse der Kommunikation und der Interaktivität zwischen der realen und der virtuellen Welt werden erprobt und wahrgenommen. Wissenschaftler und Künstler entwickeln Möglichkeiten, die das menschliche Handeln im Kontext beider Welten miteinander verschränken. Die Installation „Murmering Fields“75 untersucht z. B. Fragen der körperlichen Wahrnehmung. Hier wird eine Mixed Reality-Umgebung erstellt, die gleichzeitig die reale und die virtuelle Präsenz des Körpers thematisiert.
4.5 Fazit
Der technische Fortschritt und damit auch die Virtualisierung ist ein Teil unserer Ge- sellschaft. Der zunehmenden Undurchsichtigkeit technischer Entwicklungen sollte mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegnet werden. Ein kritisch- reflexiver Umgang ist daher die notwendige Konsequenz. Dies erfordert besondere Kompetenzen (s. 5.4.2). Für den Bildungssektor stellt es eine große Herausforderung dar, diese zu vermitteln. Dies bestätigt auch der Medienwissenschaftler Sandbothe: „Die zentrale Aufgabe von Bildung und Weiterbildung besteht darin, Zusammenhänge zwischen virtuellen und realen Formen des Lehrens und Lernens herzustellen.“76 Zum Umgang mit neuen Medien gehört nach wie vor die Face-to-face-Kommunika- tion.77 Dadurch lassen sich virtuelle und reale Erfahrungen miteinander in Beziehung setzen. Das Stichwort heißt „Transmedialität“.78 Die virtuelle Kommunikation und die Face-to-face-Kommunikation werden als zwei Medien betrachtet, die in transme- dialem Bezug zueinander stehen. In jedem Medium kann der sinnvolle Bezug zum anderen Medium gelernt werden. Der Medien- und Erziehungswissenschaftler Di- chanz beschreibt dies als „gemischt didaktisches Design“,79 und sieht darin die Zu- kunft des Weiterbildungssektors.
Virtualität beinhaltet Möglichkeiten sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Es besteht die Chance, virtuelle Räume als Experimentierfelder80 zu betrach- ten und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Dies gilt auch für den Umgang mit Mu- seen im Internet. Erfahrungswerte zeigen, dass Internetmuseen keineswegs den Gang zum realen Museum gefährden. Im Gegenteil, sie verstärken das Verlangen dem realen Museum einen Besuch abzustatten. Virtuelle und reale Angebote sollten sich gegenseitig ergänzen und nicht als konkurrierend betrachtet werden.
5 User-Centered Design (UCD)
5.1 Was ist UCD?
Computersysteme wie das Internet sind interaktiv. Darunter ist eine reversible Kom- munikation zwischen Sender und Empfänger zu verstehen. Ein funktionierendes Zu- sammenspiel zwischen dem User und dem Computersystem ist die Grundvorausset- zung für diesen Kommunikationsprozess und ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg von Internetseiten.81 Deshalb ist User-Centered Design notwendig. Unter User-Centered Design versteht man eine Vorgehensweise, die den User in den Mittelpunkt rückt. Seine Verhaltensweisen, Wünsche und Bedürfnisse werden genau untersucht und in den Gestaltungsprozess integriert.82 Das Forschungsfeld Human- Computer Interface (HCI) oder auch User Interface genannt, untersucht die Kom- munikation zwischen dem User und dem Interface. Daraus resultieren u. a. Evalua- tionsmethoden, die sich mit der Nutzbarkeit von Internetseiten auseinandersetzen und unter dem Stichwort Usability bekannt sind (s. 6.1.).
Bei der Entwicklung von Internetseiten ist User-Centered Design zum Schlagwort geworden.83 Viele Webdesigner haben dazu Kriterien (s. 5.5.1) aufgestellt, die auf folgender Grundlage beruhen: Es ist wichtig, den individuellen User genau zu kennen und ihn von Anfang an in alle Überlegungen mit einzubeziehen. Der Gestaltungsprozess sollte durch eine ständige Userevaluation begleitet werden und die Ergebnisse zu einem transparenten Design führen.
Dr. Lynn Dierking,84 Direktorin des „Institute for Learning Innovation“, und Falk (1998) bemängeln, dass es bislang wenig Forschungsergebnisse darüber gäbe, wer sich zum Internet hingezogen fühlt, und welche Rolle das Internet und die Seiten von Museen dabei spielen, ihre Ideen mitzuteilen. Sie warfen u. a. die Frage auf, ob es Profile „typischer“ Internet User gibt. Überlegungen sollen helfen den User besser einzuordnen.
Vorweg sei aber noch auf den Besucher eines realen Museums hingewiesen, dessen Merkmale für diese Untersuchung eine entscheidende Rolle spielen. Museen gab es schon vor dem Internet, und daher ist es sinnvoll, den Besucher als potentiellen User mit einzubeziehen.
5.2 Der Besucher eines realen Museums
Den realen Museumsbesucher in die Überlegungen mit einzubeziehen, deckt sich mit dem schon vorgestellten userzentrierten Ansatz. Dierking und Falk (1998)85 haben u. a. versucht, den amerikanischen Museumsbesucher genauer zu charakterisieren und ihn als potentiellen User von Museumsinternetseiten zu sehen. Sie sind sich unschlüssig, in wie weit sich die Profile von Museumsbesuchern mit denen von potentiellen Usern von Museumsinternetseiten decken. Sie geben jedoch zu erkennen, dass die Konzeption einer Internetseite für Museen auch die Besucher der realen Museen berücksichtigen muss, um erfolgreich zu sein.
[...] what probably is an important take-away message is how important it is to understand the profiles of your potential users in order to create a web experience that is meaningful to them and to recognize that most likely web use is as complex as museumgoing.86
Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Profil von amerikanischen Museumsbesuchern laut Dierking und Falk vorgestellt:
Die Motivation ins Museum zu gehen hängt damit zusammen welchen persönlichen Stellenwert der Besuch erhält. Die amerikanischen Museumsbesucher glauben, dass es kaum interessantere oder wichtigere Dinge in ihrer Freizeitgestaltung gibt. Sie schätzen das Lernen, suchen die aktive Herausforderung und räumen dieser Freizeit- beschäftigung einen hohen Stellenwert ein. Sie sehen das Museum als Möglichkeit den eigenen Horizont und den ihrer Kinder zu erweitern. Eine unproportionale An- zahl von Museumsbesuchern geht hauptsächlich zum Nutzen ihrer Kinder ins Mu- seum.
Die Besucher gehen nicht aus theoretischem Lerninteresse, sondern aus konkretem Interesse für ein spezielles Thema ins Museum, wobei persönliche Geschichte und Werte eine Hauptrolle spielen. Individuen besuchen Museen ihrer jeweiligen Interessenlage (Kunstinteressierte Individuen besuchen Kunstmuseen). Die meisten Besucher geben einerseits großes bis mittleres Interesse an ausgestellten Objekten an, verfügen andererseits aber nur über wenig bis mittelmäßiges Wissen. Sie wollen ihre Kenntnisse eher im Allgemeinen als im Speziellen verbessern und nicht zu „Experten“ werden. Durchschnittlich geht jede amerikanische Person fast zweimal im Jahr ins Museum. Bei Besuchern, die schon als Kinder im Museum waren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch als Erwachsene ins Museum gehen.
Die meisten Besucher kommen mit konkreten Vorstellungen ins Museum. Sie erwar- ten eine Vielfalt von interessantem Material, welches verschiedenen Altersgruppen, Kenntnissen, persönlichen Interessen und technischen Kenntnissen zu gute kommt. Ob alleine oder als Gruppe, rechnen sie damit in irgendeiner Weise persönlichen Bezug zu Objekten, Ideen und Erfahrungen zu bekommen und diese untereinander auszutauschen. Sie möchten die Dinge nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und berühren können. Vorrangig wird erkannt, dass es sich um reale Gegenstände handelt, und dadurch entsteht ein echter Bezug zu Objekten, Ideen und Erfahrun- gen.
Die Reaktion auf multimediale Elemente ist verschieden. Sie werden meist von den jüngeren Besuchern genutzt. Manche wünschen sich menschliche Ansprechpartner, die ihnen Auskunft geben. Andere verweisen auf die Rolle, die Medien spielen kön- nen, um Interaktivität zu fördern (insb. CD-Rom und Computer). Alle Besucher wün- schen sich wechselseitige Erfahrungen, in denen sie aktiv mit eingebunden werden. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Museumsbesucher sich lieber mit der Darstellung durch neue Medien befassen, als sich die Objekte anzuschauen und de- ren Beschriftungen zu lesen.
5.3 Der User
Was will nun der User, und wie ist er? An dieser Stelle soll dargestellt werden wie der User im allgemeinen, und wie er im speziellen als User von Museumsinternetsei- ten zu verstehen ist. Anschließend wird das Lernverhalten des Users analysiert. Als Konsequenz schließt sich die Frage an, was daraus für die Gestaltung einer Internet- seite für Museen zu berücksichtigen ist. Die Kriterien, die den User im allgemeinen betreffen, sollten grundsätzlich in der Gestaltung von jeder Internetseite berücksich- tigt werden.
5.3.1 Der User im Allgemeinen
Die Firma IBM verfolgt einen userzentrierten Designansatz, der in ihren Web Design Guidelines87 zum Ausdruck kommt. Diese lassen Rückschlüsse auf den User zu. Dar- aus soll ein allgemeines Userprofil entwickelt werden, welches sich auf Überlegun- gen der Bereiche Design, Struktur, Navigation, Typografie, Layout, Visuelle Elemente und Medien bezieht:
Design
User möchten das finden was sie suchen und sich dabei leicht und unbehindert bewegen können. Sie brauchen visuelle Gestaltungsstile, die ihnen zusagen, sowie konsequente optische Reize.
Struktur
Die User erwarten logische Strukturen, die Informationen sinnvoll organisieren. Sie verlieren sich in Strukturen, die über mehr als drei Ebenen in die Tiefe gehen.
Navigation
User möchten wissen, wo sie sich befinden und wie sie zu bereits besuchten Seiten zurückkehren können. Konsequente und gleichbleibende Navigationselemente hin- sichtlich Design, Platzierung und Funktion sind dafür die Vorraussetzung. Bedeut- same Bezeichnungen von Links, und nicht so etwas wie „Go“ oder „Click Here“ ge- hören dazu. Durch unnötige Verknüpfungen werden sie durcheinandergebracht. User erwarten, dass sie von jeder Seite aus auf die Startseite zurückkehren können und sind es gewohnt die Navigationselemente und die Identität (z. B. das Logo) oben und links zu finden. Sie brauchen Feedback und möchten wissen, wie sie an Informationen kommen. Diese erwarten sie in einer logischen Abfolge. User mit Sehbehinderungen erwarten, dass Graphiken oder Image Maps mit Text ergänzt werden.
Typografie
User erwarten aussagekräftige Überschriften, gut lesbare Textblöcke und wichtige Informationen zuerst. Für die User ist linksbündiger Text einfacher zu lesen. Zu viele Links innerhalb eines Textblocks verwirren sie. Außerdem erwarten User, dass längere Texte in druckbarem Format zugänglich sind.
Layout und visuelle Elemente
User verbinden das Gesamtbild mit einer bestimmten Aussage und erwarten wirksame Botschaften, die nicht überladen sind. Der erste Eindruck entscheidet über ihre Verweildauer auf der Seite. Sie wünschen, dass das Design ihrem Geschmack entspricht und assoziieren gestalterische Elemente (z. B. Symbole) mit bestimmten Funktionen. Dabei verstärken Elemente, die sich konsequent wiederholen ein Gefühl von Geschlossenheit und Zugehörigkeit beim User.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anja Schurig (Autor:in), 2002, Kunstmuseen im Internet - eine Untersuchung aus kunstpädagogischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7300
Kostenlos Autor werden

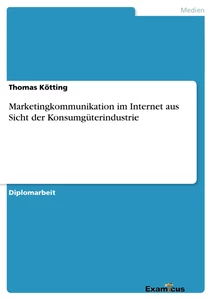













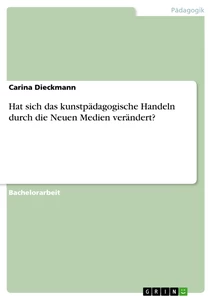

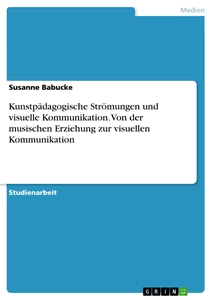

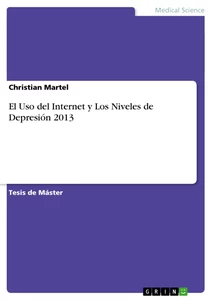
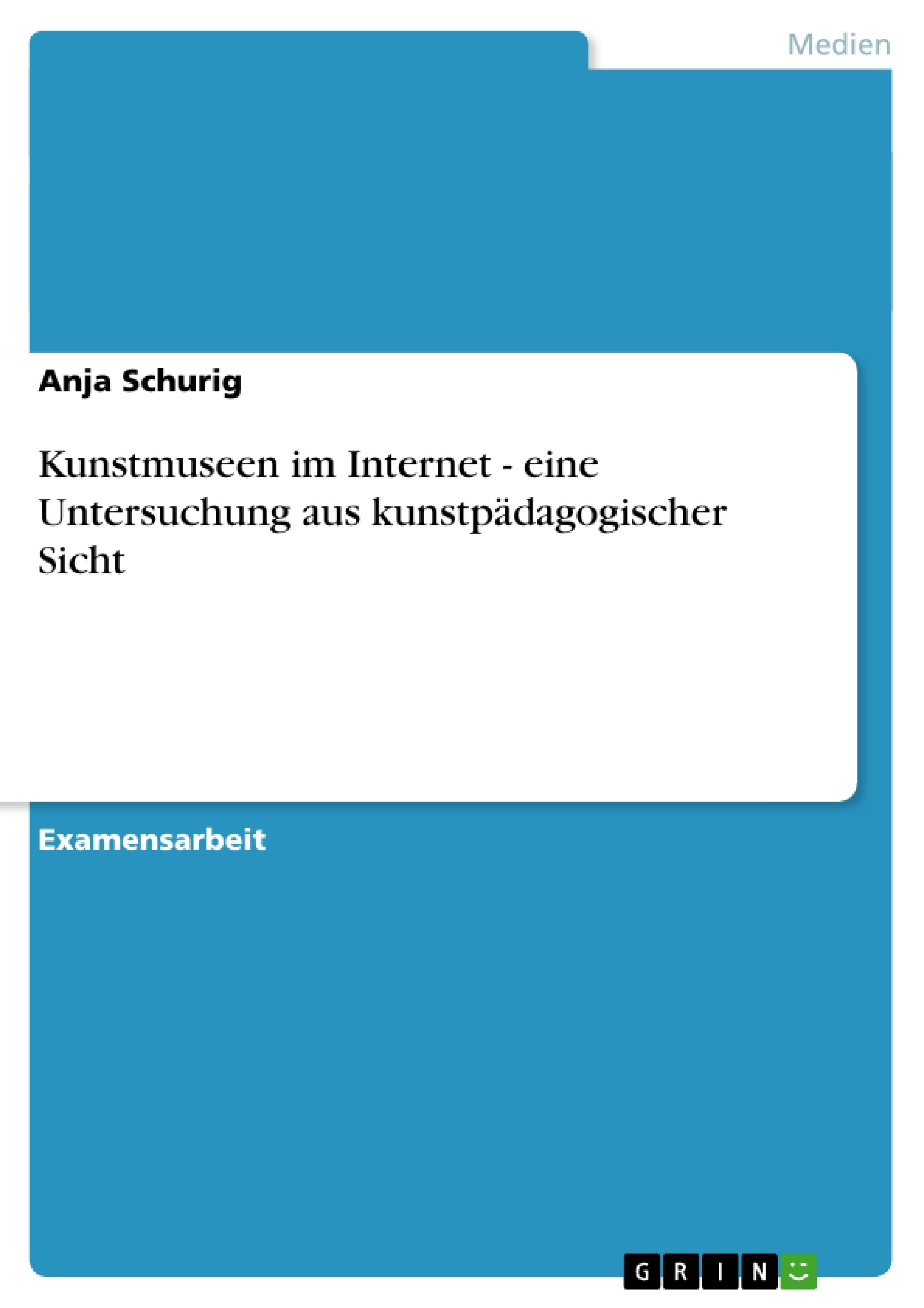

Kommentare