Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Im historischen Rückblick
2.1 Hängung nach Schulen
2.2 Hängung nach Bewegungen
2.3 Die weisse Zelle
3. Rémy Zaugg und der ideale Kunstraum
3.1 Zauggs Ort des Werkes und Menschen
4. Das Werkerlebnis
5. Museen zwischen Bildung und Unterhaltung
6. Ein Beispiel: Die Tate Modern
6.1 Die Ausstellungssituation in der Tate Modern
6.2 Das Museum, das Zaugg sich erträumte?
7. Schlusswort
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es gibt heute mehr Bilder auf der Welt als jemals zuvor. Die westlichen Industrienationen werden von ihnen geradezu überflutet. Ob zuhause in den eigenen vier Wänden oder auf offener Strasse: Bilder – ob virtuell oder real – gehören heutzutage ganz selbstverständlich zum Alltag. Die meisten dieser Bilder sind dabei medial inszenierte Massenware: Träger von Botschaften und Informationen, die um die begrenzten Aufmerksamkeitsfähigkeiten der Rezipienten buhlen. Viele davon werden kaum wahrgenommen, und falls doch, so höchstens oberflächlich. Der Umgang mit Bildern hat sich verändert.
Als traditionelle Orte der Bilder können die Museen davon nicht unberührt bleiben. Sie sind vom Phänomen dieser Bilderflut direkt betroffen. Zwar gibt es heute auf unserem Planeten auch mehr Museen als jemals zuvor, doch die Herausforderung, die sich ihnen im Zusammenhang mit der Bilderflut stellt, ist qualitativer, und nicht quantitativer Natur.[1]
Die Menschen gehen heutzutage mit Bildern ganz anders um, als noch vor 100 Jahren. Schlagwörter wie Reizüberflutung oder Reizübersättigung deuten auf eine eigentliche Überforderung des urbanen Menschen angesichts des inszenierten Spektakels hin. In Anbetracht der Tatsache, dass oftmals selbst grausamste Darstellungen – etwa in der Kriegsberichterstattung – bei vielen Rezipienten kaum mehr Emotionen auslösen, ist sogar davon die Rede, dass die Menschen ihre eigentliche Sehfähigkeit verloren haben.[2]
Es stellt sich also die Frage, wie die Museen mit dieser Herausforderung umgehen. In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass die modernen Strategien der Bildpräsentation, deren sich Museen bedienen, als eine Reaktion auf das Phänomen der Bilderflut verstanden werden können. Die aufzuzeigende Tendenz von traditionellen Strategien der Bildvermittlung hin zu einer mehr auf eine direkte Bilderfahrung abzielende Strategie der Werkpräsentation wird dabei als ein Indiz für diese These angesehen. Die Arbeit beginnt deshalb mit einem Blick in die Vergangenheit: Im ersten Kapitel wird die historische Entwicklung der musealen Bildpräsentation skizziert. Bevor im dritten Kapitel dann das Werkerlebnis als aktuellste Form musealer Inszenierung näher vorgestellt wird, soll zuvor die Ausführungen eines Künstlers vorgestellt werden, der sich intensiv mit der Frage der Kunstwahrnehmung und ihrer räumlichen Umgebung auseinander gesetzt hat.
Dieser Abschnitt über Rémy Zaugg und sein erträumtes Museum bildet die Überleitung zum Werkerlebnis. Anschliessend wird der Aspekt der Selbstdefinition der Museen ins Spiel gebracht. Hier wird es um ihre Verordnung auf der Achse zwischen den beiden Polen Bildung und Unterhaltung gehen. Im letzten Kapitel werden die verschiedenen Fäden dann wieder zusammengebracht. Anhand eines konkreten Beispiels wird aufgezeigt, wie eine umfassende Strategie im Umgang mit den Herausforderungen des Phänomens der Bilderflut aussehen kann.
2. Im historischen Rückblick
Wann genau die ersten Menschen begonnen haben Kunstwerke zu produzieren und diese – in welcher Form auch immer – als solche zu präsentieren, lässt sich nicht genau eruieren. Anzunehmen ist aber, dass der Akt des Ausstellens von Kunst sehr viel älter ist als das öffentliche Interesse daran. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts etablierte sich in Europa die Vorstellung einer öffentlichen Teilhabe am kulturellen Besitz.[3] Periodisch stattfindende Salons boten die Möglichkeit, einen Blick auf das Schaffen der Künstler zu werfen. Die Art und Weise wie die Kunstwerke dort präsentiert wurden, ist durch zahlreiche Gemälde aus dieser Zeit dokumentiert: Die Wände sind fast vollständig mit Bildern bedeckt. Gemälde unterschiedlicher Stilgruppen aus unterschiedlichen Epochen sind wild neben- und übereinander angeordnet, vom Fussboden bis zur Decke. Es scheint, dass das Ideal darin bestand, ein kunstvolles Mosaik aus Bildern zu schaffen, das keine vergeudeten Wandstücke dazwischen ausliess.[4]
2.1 Hängung nach Schulen
Das 19. Jahrhundert wurde dann zur eigentlichen Gründungsepoche der öffentlichen Museen in Europa. Fürstliche Sammlungen gingen in staatliches Eigentum über, private Sammlungen wurden zu öffentlichen, und bürgerliche Kunstvereine initiierten oder gründeten Museen.[5] Die meisten dieser Museen schickten sich an, eine Art kunstgeschichtliche Systematik einzuführen: Das Spektrum der Sammlungen wurde durch den Ankauf von Malerei aus der Frührenaissance gezielt erweitert und die Werke wurden nach Zugehörigkeit zu den einzelnen Schulen aufgehängt.[6] Durch die Widmung einzelner Räume für die Werke einer bestimmten Zeit und Herkunft wandelten sich die Museen immer mehr von reichen Schatzkammern zu veritablen Geschichtsbüchern.[7] Die vollständige Bedeckung der Wände mit Gemälden wurde nun durch die Reihenhängung verdrängt. Es wurde vermehrt darauf geachtet, dass die Bilder in unmittelbarer Nachbarschaft, eine innere Verbindung aufwiesen. Die Gemälde wurden in den vorhandenen Räumlichkeiten nach Schulen geordnet. Die Ausstellungsstrategie, die sich in der Folge aus dieser neuen Präsentationsweise heraus entwickelt hat, kann mit dem Ausdruck Interpretation bezeichnet werden.[8] Ein anschauliches, modernes Beispiel dieser Präsentationsweise liefert die Fotografie „National Gallery I“ von Thomas Struth (Abb. 1). Es zeigt ein nach ästhetischen und historischen Massstäben zusammengestelltes Ensemble dreier Gemälde von italienischen Künstlern aus der Renaissance: Ein Marienbild, ein Altarbild und ein Porträt. Die Gruppierung der Gemälde zeichnet sich durch eine fast gleichmässige Symmetrie aus. Der Kurator schafft hier durch die Auswahl und die Anordnung der Bilder Beziehungen, welche von den Künstlern bei der Ausführung der Werke kaum beabsichtigt worden sind. Er interpretiert die Gemälde. Dadurch besitzt diese Form der Bildpräsentation starke didaktische Züge. Sie blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die vorherrschende Ausstellungsweise in den meisten Kunstmuseen.
2.2 Hängung nach Bewegungen
Als 1929 das Museum of Modern Art in New York (MoMA) seine Türen öffnete, ersetzte sein Gründungsdirektor Alfred Barr das traditionelle Prinzip der Hängung nach Schulen durch das Prinzip der Hängung nach Bewegungen.[9] Das Beispiel machte schnell Schule. Zahlreiche moderne Kunstmuseen folgten dem Beispiel des MoMA und bemühten sich in der Folge, Sammlungen aufzubauen, die eine möglichst komplette Überschau der grossen Bewegungen der Kunstgeschichte boten.[10] In den nach diesem Präsentationsschema gegliederten Ausstellungen unternehmen die Museumsbesucher einen chronologischen Gang durch die Kunstgeschichte. Durch das Aufzeigen von Entwicklungslinien innerhalb der Kunstgattungen trägt auch dieses Präsentationsschema ausgeprägte didaktische Züge. Es handelt sich um eine Strategie der Kunstvermittlung: Durch Auswahl und Platzierung der Werke versucht der Kurator etwa Entwicklungslinien innerhalb der Kunstgeschichte zu veranschaulichen.
Ungefähr zeitgleich mit der Einführung und Verbreitung des neuen Hängungsprinzips nach Bewegungen, fand in der Kunstwelt ein weiterer bedeutsamer Wandel statt. Dieser betraf die räumliche Umgebung der Bildpräsentation: Es handelt sich um das Aufkommen des modernistischen, schlichten und weissen Ausstellungsraums.
2.3 Die weisse Zelle
Noch vor knapp hundert Jahren war es in Europa und in den Vereinigten Staaten die Norm, dass öffentliche Räume, in denen zeitgenössische Kunst gezeigt wurde, reich bestückt waren. Es gab dort nicht selten Kamine, Zimmerpflanzen und dekorative Möbelstücke. Der Fussboden war mit Teppichen ausgelegt und Decke sowie Wände waren reich gegliedert mit farbig gefasstem Stuck.[11] Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich dies allmählich zu ändern.[12] Die dekorativen Elemente wurden nach und nach entfernt und die Ausstellungsräume wurden zu schlichten weissen Zimmern. Diese Entwicklung verlief jedoch nicht linear und sie darf auch nicht streng zielgerichtet vorgestellt werden. Vielmehr experimentierten Ausstellungsmacher und Künstler an verschiedenen Orten und über einen längeren Zeitraum hinweg mit neuen und innovativen Präsentationskonzepten. Als vorherrschende Raumkonvention endgültig durchgesetzt hatte sich laut Walter Grasskamp der modernistische weisse Ausstellungsraum erst nach dem Zweiten Weltkrieg.[13]
Der amerikanische Kunstkritiker Brian O’Doherty beschreibt in seiner dreiteiligen Essay-Serie Inside the White Cube: The Ideology of Gallery Space anschaulich, wie die Entwicklungen in der Kunst um die Jahrhundertwende neue Präsentationsbedingungen erfordert haben.[14] Die Essay-Serie wurde 1976 in der amerikanischen Kunstzeitschrift Artforum veröffentlich und löste eine grosse Debatte aus. O’Doherty deckt darin die zentrale Bedeutung des weissen, neutralen Ausstellungsraums für die ästhetische wie auch kulturelle und ökonomische Bestimmung der modernen Kunst auf.[15] Er kritisiert, dass durch den White Cube die Alltagswahrnehmung zu einer Wahrnehmung rein formaler Werte verkommt.[16] Unter dem Vorwand ein neutraler Raum zu sein, dient er laut O’Doherty in Wirklichkeit der Stabilisierung eines geschlossenen Wertesystems und schafft eine künstliche Trennung von Kunst und Aussenwelt.[17]
[...]
[1] Laut Victoria Newhouse waren 1998 bereits über 5000 Museen im Internet präsent. Heute dürften es weitaus mehr sein. Siehe dazu Newhouse 1998, S. 12.
[2] Diese Aussage stammt von Alfredo Jaar, einem Künstler der sich in seinem Werk um eine Wiederherstellung dieser Sehfähigkeit bemüht. Siehe dazu Anderson 1997, S. 44ff.
[3] Bätschmann 1997, S. 16.
[4] O’Doherty 1996, S. 13.
[5] Schneede 2000, S. 10.
[6] Serota 2000, S. 81.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Serota 2000, S. 84.
[10] Ebd.
[11] Jouhar 2005, S. 16.
[12] Jouhar 2005, S. 19.
[13] Grasskamp 2003, S. 58.
[14] Siehe dazu den ersten Essay „Die Weisse Zelle und ihre Vorgänger“ in: O’Doherty 1996, S. 7–33.
[15] Brüderlin 1996, S. 140.
[16] O’Doherty 1996, S. 10
[17] O’Doherty 1996, S. 9, siehe dazu auch Jouhar 2005, S. 32.
- Arbeit zitieren
- Mike Bucher (Autor:in), 2007, Museale Ausstellungsstrategien in Zeiten der Bilderflut - Werkerlebnis und Kontemplation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72491
Kostenlos Autor werden




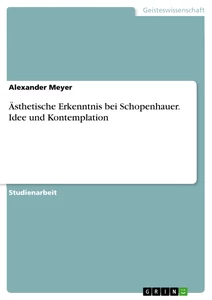
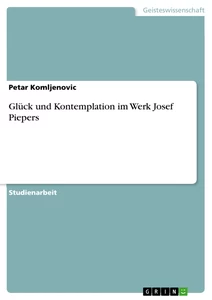





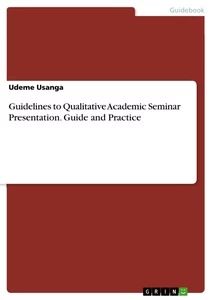



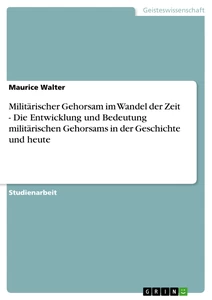




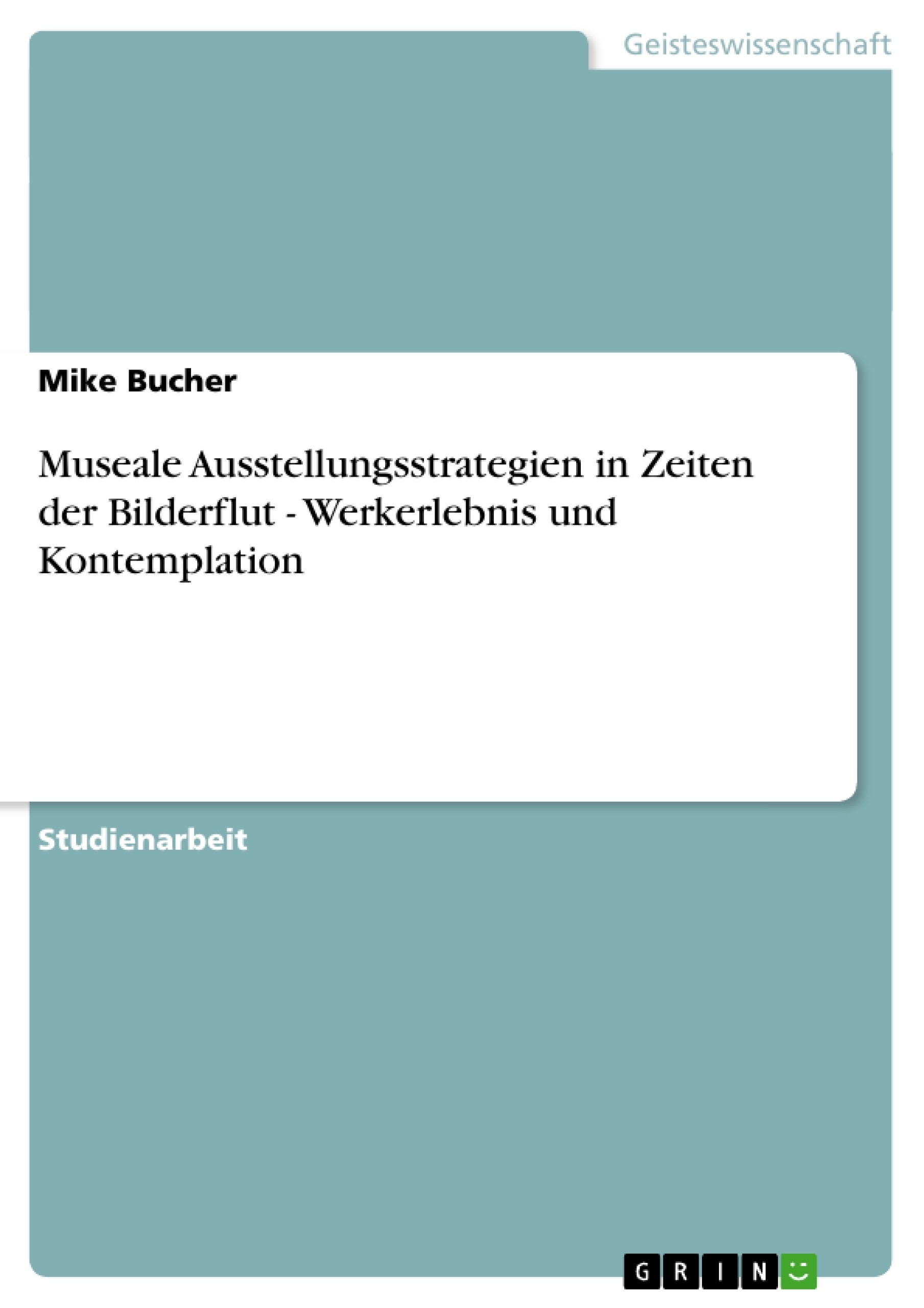

Kommentare