Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung
2.1 Definitionsproblematik des Begriffs »geistige Behinderung«
2.2 Behindertenpolitische und -rechtliche Rahmenbedingungen
2.3 Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung und Möglichkeiten zu ihrer Veränderung
2.4 Historische Entwicklungen der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Westdeutschland seit 1945
2.5 Zusammenfassung
3. Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion: Leitideen und Konzepte zu ihrer praktischen Umsetzung
3.1 Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion
3.2 Wurzeln des inklusiven Gedankens
3.2.1 Normalisierungsprinzip
3.2.2 Selbstbestimmung
3.3 Konzepte zur Umsetzung der Leitideen
3.3.1 Empowerment
3.3.2 Assistenz
3.3.3 Community Care
3.4 Zusammenfassung
4. Freizeit
4.1. Freizeit - Die Schwierigkeiten einer Begriffbestimmung
4.2 Der positive Freizeitbegriff
4.3 Freizeitbedürfnisse
4.4 Voraussetzungen an den Lebensbereich Freizeit
4.5 Freizeit in Deutschland
4.5.1 Beliebte Freizeittätigkeiten
4.5.2 Trends in der Freizeit
4.5.3 Einkommen und Bildung = Determinanten des Freizeitverhaltens?
4.6 Zusammenfassung
5. Freizeit im Leben von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
5.1 Sonderpädagogische Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld Freizeit im Wandel der Zeit
5.1.1 Freizeit ohne besondere Hilfen
5.1.2 Freizeit als Aufgabengebiet der Rehabilitation
5.1.3 Freizeit und soziale Integration
5.1.4 Selbstbestimmte Freizeit
5.2 Freizeit als soziales und gesellschaftliches Integrationsfeld
5.3 Aktuelle Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
5.3.1 Empirische Studien zur Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
5.3.1.1 Freizeitsituation in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
5.3.1.2 Freizeitsituation in Familien
5.3.1.3 Freizeitsituation in Einrichtungen der Lebenshilfe
5.3.2 Freizeitbedürfnisse
5.3.3.1 Erschwernisse aufgrund der Lebenssituation in der Familie
5.3.3.2 Erschwernisse aufgrund der Lebenssituation in Wohneinrichtungen
5.4 Ausblick und Forderungen
5.5 Zusammenfassung
6. Praxisbeispiele: Sozialintegrative Freizeitangebote
6.1 PFiFF
6.2 Orientalische Bauchtanzgruppe
6.3 Inklusionsbeauftragte für den Bereich Sport
7. Interpretation und Reflektion der Ergebnisse
8. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Gegenstand dieser Arbeit ist die Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Fragestellungen, inwieweit der Freizeitbereich zur sozialen Integration dieser Menschen beitragen kann, wie die pädagogische Leitidee der Normalisierung umgesetzt wird und ob die Forderung nach Selbstbestimmung im Freizeitbereich erfüllt wird.
Mein besonderes Interesse an der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung entwickelte sich zum einen durch meine praktische Tätigkeit beim Familienunterstützenden Dienst (FuD) der Lebenshilfe Gießen, zum anderen durch die vielfältigen Anregungen die ich in dem Seminar „Freizeitförderung bei Menschen mit geistiger Behinderung“ von Herrn Ulrich Niehoff-Dittmann am Institut für Heil- und Sonderpädagogik der Justus-Liebig-Universität Gießen im Wintersemester 2004/05 erhalten habe. Schon während meiner praktischen Tätigkeit für den FuD fiel mir immer wieder auf, dass die Freizeit von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung von anderen Personen verplant wird und ihre Sozialkontakte, abgesehen von denen zu ihrer Familie und zu professionellen Begleitern, fast ausschließlich aus Kontakten zu anderen Menschen mit geistiger Behinderung bestehen. In dem erwähnten Seminar wurden dann die theoretischen Bezüge zu Leitgedanken der Behindertenpädagogik hergestellt. Augenfällig wurde dabei, dass die Freizeit, im Gegensatz zu den Bereichen Wohnen und Arbeit, ein bislang stark vernachlässigter Lebensbereich in der Behindertenpädagogik ist.
Vor diesem Hintergrund werde ich untersuchen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung bestehen und wie dabei die bereits oben genannten Ziele der Integration, Normalisierung und Selbstbestimmmung erreicht werden können.
Da der Bereich Selbstbestimmung ein zentraler Aspekt dieser Arbeit ist, werde ich mich thematisch auf die Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung beschränken. Ich gehe davon aus, dass das Konzept der Selbstbestimmung auch bei Menschen ohne Behinderung erst im Erwachsenenalter voll zur Anwendung kommt. Ferner unterscheiden sich die Freizeitsituationen von Kindern und Erwachsenen grundlegend. Eine Darstellung beider Situationen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Zur besseren Lesbarkeit der Arbeit verwende ich bei der Beschreibung von gemischtgeschlechtlichen Gruppen lediglich die männliche Schreibweise.
Zur Struktur der Arbeit: Ausgangspunkt ist im folgenden Kapitel die Schilderung der Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Nach einer Beschreibung der Definitionsproblematik der Bezeichnung »geistige Behinderung« folgt ein Überblick über die rechtliche Situation dieses Personenkreises, um zu überprüfen, inwiefern das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen in der Gesellschaft im gesetzlichen Rahmen verankert ist. Unter Punkt 2.3 folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob es geeignete Möglichkeiten gibt, die vorhandenen Einstellungen in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung zu verbessern. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Überblick über die historische Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung.
Das dritte Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Erklärung der Begriffe Teilhabe, soziale Integration und Inklusion. Die Forderungen nach einer selbstverständlichen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung am Leben in der Gesellschaft enthalten implizit die Forderungen nach einer normalisierten und selbstbestimmten Lebenssituation. Daher wird dann unter Punkt 3.2 die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Normalisierungsprinzips und des Selbst-bestimmungsgedankens in der Behindertenpädagogik aufgezeigt. Inwiefern das Empowerment-Konzept, das Assistenzprinzip und der Community-Care-Gedanke mögliche Wege sein können, um diese Forderungen nach einer Normalisierung der Lebensverhältnisse, verbunden mit einem selbstbestimmten Leben in der Mitte der Gesellschaft, auch in die Realität umsetzen zu können, wird zum Abschluss des dritten Kapitels untersucht.
Im vierten Kapitel wird verdeutlicht, was Freizeit im Allgemeinen ist und welche Bedeutung Freizeit im Leben eines jeden Menschen spielt. Nach einer Begriffsbestimmung erfolgt die Beschreibung von Freizeit und ihrer Funktion. Anschließend werden grundlegende Freizeitbedürfnisse aufgeführt und die wesentlichen Bedingungen für ihre Verwirklichung beschrieben. Abschließend wird unter dem Punkt 4.5 die Freizeitsituation in Deutschland anhand von Freizeitaktivitäten, Freizeittrends und Determinanten des Freizeitverhaltens dargestellt.
Die in den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse werden im fünften Kapitel zusammengeführt und auf die Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung übertragen. Ausgangspunkt hierfür ist die Darstellung der sonderpädagogischen Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld Freizeit. Dann wird (der Fragestellung dieser Arbeit folgend) untersucht, inwiefern der Freizeitbereich als mögliches soziales und gesellschaftliches Integrationsfeld für Menschen mit geistiger Behinderung geeignet ist. Anschließend folgt die Darstellung der Freizeitsituation von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Vor diesem Hintergrund werden die Möglichkeiten der Realisierung der Freizeitbedürfnisse für Menschen mit geistiger Behinderung untersucht und die hierbei bestehenden Erschwernisse aufgezeigt. Abgeschlossen wird das Kapitel 5 mit einer Auflistung des vordringlichen Handlungsbedarfs für die Verbesserung der Freizeitsituation von Menschen mit geistiger Behinderung und für die Verwirklichung des Ziels, der Freizeit von Menschen mit geistiger Behinderung generell - aber auch als mögliches soziales Integrationsfeld - mehr Respekt und Aufmerksamkeit entgegenzubringen.
Welche Möglichkeiten der Freizeitbereich zur sozialen Integration bietet und welche Schwierigkeiten bei der Verwirklichung bestehen, wird dann im Kapitel 6 anhand drei exemplarisch ausgesuchter Fallbeispiele aufgeführt.
Das Kapitel 7 dient der persönlichen Interpretation und Reflektion der Ergebnisse dieser Arbeit, die in Kapitel 8 abschließend zusammengefasst dargestellt werden.
2. Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung
Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Bedeutung des Begriffs »geistige Behinderung« analysiert. Die Ausführungen hierzu stellen jedoch lediglich unterschiedliche Annäherungen an eine Definition von »geistiger Behinderung« dar, denn dieser Begriff kann wohl niemals einheitlich geklärt werden. Unter dem Punkt 2.2 werden dann die wesentlichen rechtlichen gesetzgeberischen Veränderungen, die Benachteiligungen aufgrund einer Behinderung verbieten und den Menschen mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung und eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zusichern sollen, aufgeführt. Im darauf folgenden Punkt werden mögliche Strategien, die zu einer positiven Veränderung in den Einstellungen und Reaktionen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung führen können, vorgestellt. Abschließend folgt ein kurzer Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung.
2.1 Definitionsproblematik des Begriffs »geistige Behinderung«
Der Begriff der »geistigen Behinderung« wurde 1958 von den Gründungsmitgliedern des Eltern-Selbsthilfevereins »Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind« geprägt und löste die zuvor gebräulichen Termini wie, z.B. ‚Idiotie‘ und ‚Schwachsinn‘ ab. Sie legten den Fokus ihrer Betrachtung auf die intellektuellen Beeinträchtigungen und wollten mit dieser Bezeichnung das Anderssein ihrer Kinder so beschreiben, dass es nicht wieder zu einer Abwertung des gesamten Menschen führt. Diese Fokussierung auf die intellektuellen Beeinträchtigungen dieses Personenkreises steht seit einigen Jahren in der Kritik.[1]
Was nun aber eigentlich unter einer »geistigen Behinderung« zu verstehen ist, wird in den letzten Jahren, auch aufgrund der Diskussionen um Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozesse, zunehmend unklarer.[2] Es stellt sich zudem die Frage, ob dieser Begriff in einem sonderpädagogischen Sinne jemals einheitlich und eindeutig geklärt werden kann, denn eigentlich kann „begriffliche Klarheit [...] mit einer solchen Bezeichnung für keinen Sachverhalt gewonnen werden, denn ‘der Geist’ lässt sich eben nicht behindern.“[3]
In der Fachliteratur findet man viele unterschiedliche Definitionen von »geistiger Behinderung« aus verschiedenen Perspektiven. So wird bspw. aus einer eher medizinischen Perspektive eine geistige Behinderung aus einer defizitären Sicht heraus als Zustand betrachtet, der bedingt ist durch hirnorganische Defekte, Intelligenzmangel und evtl. noch weiteren Schädigungen. Nach diesem medizin-ischen Verständnis leidet der behinderte Mensch „als kranke Person an einem gestörten Prozess, was äußerlich zu sichtbaren Symptomen und Syndromen führt, die als wesensbedingte Anteile der Person diagnostiziert und kategorisiert werden.“[4]
Diese Auffassung ist wissenschaftlich nicht haltbar und eine Gleichsetzung von Behinderung und Krankheit sollte bereits seit über zwanzig Jahren (auch nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation) ausgeschlossen sein.[5]
So schreibt auch Barbara Fornefeld dazu:
„Der oft vorgenommene Kausalschluss, dass die organische Schädigung die geistige Behinderung ist bzw. ausmacht, ist falsch. Diese entsteht erst aus dem Zusammenwirken verschiedener individuums- und umweltbezogener Faktoren. Am Anfang steht meist eine prä-, peri- oder postnatale Schädigung des Menschen, die die Entwicklung und das Lernen beeinflusst, ggf. beeinträchtigt. Diese individuellen Faktoren stehen immer in Wechselwirkung mit Umwelteinflüssen familiärer, institutionsbedingter, kultureller oder gesellschaftlicher Art. Die Umweltfaktoren prägen das Leben eines jeden Menschen und machen erst gemeinsam mit den individuellen Schädigungen und Beeinträchtigungen die geistige Behinderung aus. Sie ist keine statische Größe, sondern ein Prozess, der der Dynamik des Lebens folgt, d.h. in jeder Lebensphase wird sich die geistige Behinderung anders zeigen, bedarf sie anderer Hinwendungen.“[6]
Die Orientierung an den Defiziten des Menschen verschiebt sich heute dem-entsprechend mehr und mehr zugunsten einer individuellen Orientierung an dem gesamten Menschen und auf seinen Lebensbereich. „Zur Definition von Behinderung ist also stets mindestens ein personaler, ein sozialer und ein ökologischer Aspekt heranzuziehen.“[7] So wird eine geistige Behinderung nun u.a. auch als Folge sozialer und gesellschaftlicher Benachteiligungen gesehen. Hiermit rücken die Hindernisse ins Blickfeld, die dem Menschen mit geistiger Behinderung von seiner Umwelt in den Weg gelegt werden, ihn behindern[8] und die Hilfen, die dazu beitragen können, diese Behinderungen zu verkleinern.[9]
Andreas Hinz beschreibt diese Umorientierung als Wandel von einer defektologischen Haltung hin zu einer dialogischen Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung.[10]
So stellt auch Hedwig Frank fest, dass das defektologische Menschenbild auf unserer unvollständigen Wahrnehmung des anderen beruht. Die Einzigartigkeit und Individualität des einzelnen Menschen sowie die Vielfalt der menschlichen Seinsweise können wir nicht wahrnehmen, solange wir den gesellschaftlich fest-gelegten Normalitäts-Abnormalitätskriterien folgen.[11]
Weiterhin fordert sie, dass wir
„unser Menschenbild befreien [müssen, M.L.] von engen Klassifikationsschematas und Bewertungsnormen. Die Abwertung von Behinderung als ‚Anders-artigkeit‘ muss aufhören. Solange sie als normale Entwicklungsmöglichkeit ausgeklammert wird, bleiben behinderte Menschen auch von gesellschaftlicher Normalität ausgeschlossen. Sie können ihre eigene Normalität nicht erfahren, bleiben in einer abnormen Identität gefangen. Behinderung als Normalität anzuerkennen ist Voraussetzung für Integration.“[12]
Der Begriff »geistige Behinderung« gerät in den vergangenen Jahren zunehmend stärker in die Kritik. Besonders das Netzwerk People First fordert eine Begriffsänderung, da sich viele Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, dadurch diskriminiert fühlen. So gab es mehrere Vorschläge für eine Begriffsänderung, wie z.B. die Bezeichnungen »Menschen mit so genannter geistiger Behinderung«, »Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf/Hilfebedarf« oder auch »Mental Beeinträchtigte«[13]. Was aber bringt eine Begriffsänderung, vor allem wenn die Gefahr besteht, dass auch dieser neue Begriff in wenigen Jahren auf diskriminierende Art verwendet oder als diskriminierend empfunden wird oder wenn der neue Begriff nicht mehr deutlich macht, dass diese Menschen häufig besondere Hilfen brauchen und sich dann evtl. die Sozialpolitik bezüglich ihrer Gewährung von Unterstützung und finanziellen Hilfen aus ihrer Verantwortung stehlen könnte?[14]
Wesentlich wichtiger sollte es sein, dass sich die Einstellungen und Haltungen in der gesamten Gesellschaft gegenüber Menschen mit geistigen Behinderungen verändern und dass sich ein positives, nicht ausgrenzendes Menschenbild mit den folgenden Grundüberzeugungen entfaltet:[15]
- Geistige Behinderung ist keine Krankheit. Es ist normal, verschieden zu sein, denn jeder Mensch ist einzigartig und unverwechselbar.
- Menschen mit geistigen Behinderungen haben die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere Mensch auch.
- Menschen mit geistiger Behinderung haben die dieselben (Grund)rechte wie jeder andere Bürger unserer Gesellschaft. Sie haben ein Anrecht auf Wertschätzung und Achtung der Persönlichkeitswürde und das Recht auf Leben darf ihnen von niemandem und mit keiner Begründung abgesprochen werden.
- Menschen mit geistiger Behinderung sind bildungs-, entwicklungs- und lernfähig.
- Menschen mit geistiger Behinderung dürfen nicht primär unter dem Aspekt des Behindertseins gesehen werden. Sie sind zuallererst Mensch![16]
In dieser Arbeit wird überwiegend die Bezeichnung »Menschen mit geistiger Behinderung« verwendet, in einigen Fällen jedoch auch der Ausdruck »geistig behinderte Menschen«, dieser gilt zwar als diskriminierender, ist jedoch manchmal grammatikalisch besser einsetzbar.
2.2 Behindertenpolitische und -rechtliche Rahmenbedingungen
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde 1994 in seinem Artikel 3, Absatz 3 um den Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ ergänzt.[17]
„Obwohl das Grundgesetz– und somit auch das Benachteiligungsverbot – für alle staatlichen Ebenen gemäß Artikel 20 Abs. 3 2. Halbsatz GG bindendes Recht ist [...] wurde bald offenkundig, dass das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen aus den ‚Höhen‘ des verfassungsrechtlichen Grundrechtskatalogs in die ‚Niederungen‘ der alltäglichen Gesetzesanwendung überführt werden musste.“[18]
Es wurde also deutlich, dass zusätzliche Regelungen bzw. Gesetze geschaffen werden müssen, um die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern und um ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ermöglichen zu können.[19]
Der erste Schritt auf dem Weg zu dem Ziel, „durch ein Gesetz zur Gleichbehandlung Behinderter das Benachteiligungsverbot des Art 3 GG im gesamten Rechtsgefüge der Bundesrepublik zu verwirklichen“[20], war die Verabschiedung des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) im Juli 2001. Das Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) formuliert unter §1 „Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ als grundlegende Zielsetzung.[21]
Das Inkrafttreten dieses Gesetzes wurde zunächst von vielen Behindertenverbänden als großer Erfolg gefeiert. Es wurden aber schnell auch kritische Stimmen laut. Matthias Schnath bspw. beurteilt die eingetretenen Verbesserungen als gering: „Insgesamt stellte und stellt sich das SGB IX im Wesentlichen dar als ein Gesetz zur
Beschwörung des guten Willens aller Träger, der aber nichts kosten darf.“[22]
Am 1. Mai 2002 ist das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen in Kraft getreten. Die Regelungen dieses Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) „sollen das Benachteiligungsverbot auch über das Sozialrecht hinaus umsetzen“[23].
Im §1 wird als Gesetzesziel genannt,
„die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.“[24]
Menschen mit Behinderungen haben das Recht, in gleicher Weise wie Menschen ohne Behinderungen am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Durch das BGG rückt dieser bürgerrechtliche Anspruch auf eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stärker in den Vordergrund.[25] Das Kernstück dieses Gleichstellungsgesetzes ist die Herstellung einer möglichst umfassenden Barrierefreiheit, so dass alle gestalteten Lebensbereiche, wie z.B. bauliche Anlagen, Verkehrsmittel und Kommunikationseinrichtungen, von Menschen mit Behinderungen „in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“[26]
Dieses Ziel des Bundesgleichstellungsgesetzes kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch die einzelnen Bundesländer gleichartige Landesgleichstellungsgesetze verabschieden.
In den meisten Bundesländern liegen mittlerweile derartige Behinderten-gleichstellungsgesetze vor.[27]
Weiterhin dringend erforderlich zur praktischen Umsetzung der Ziele des BGG ist ein „Zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz, da es erst mit Hilfe dieses Gesetzes gelingen wird, privatrechtlicher Diskriminierung auch als Einzelperson Herr zu werden.“[28]
So werden auch heute immer noch Vorfälle bekannt, die deutlich zeigen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung bspw. bei Urlaubsreisen benachteiligt werden, ihnen der Abschluss von Unfall-, Haftpflicht- und Lebensversicherungs-verträgen verweigert oder ihnen der Aufenthalt in Restaurants, Hotels u.ä. verwehrt wird. Viele Behindertenverbände fordern daher auch schon seit einigen Jahren ein Antidiskriminierungsgesetz, welches diese und andere Benachteiligungen endlich verhindert.[29]
Die Bundesregierung ist zudem nach europäischem Recht dazu verpflichtet, ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz zu verabschieden. Vermutlich vor allem aufgrund dieser Verpflichtung haben die Bundestagsfraktionen der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Dezember 2004 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung dieser europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien eingebracht. Dieser vorgelegte Entwurf eines so genannten Antidiskriminierungsgesetzes (ADG)[30], welches verhindern soll, dass Menschen aufgrund der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ungerechtfertigt benachteiligt werden führte zu heftigen kontroversen Diskussionen. Es wurden auch Bedenken darüber laut, ob Menschen mit Behinderungen überhaupt in dieses Gesetz miteinbezogen werden sollen. Innerhalb dieser Diskussionen konnten die Verbände behinderter Menschen, ebenso wie auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung den Ausschluss von behinderten Menschen aus dem Regelungsbereich des Gesetzes verhindern. Damit wurde der Entwurf in Bezug auf Menschen mit Behinderungen nicht geändert.
Am 17. Juni 2005 hat die rot-grüne Koalition mit ihrer Stimmenmehrheit, gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU, im Bundestagsausschuss das Antidiskriminierungsgesetz durchgesetzt. Der Gesetzentwurf wird wohl dennoch nicht in der verabschiedeten Form in Kraft treten, da der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen hat und es somit auf Grund der von Bundespräsident Köhler angesetzten Neuwahl des Bundestages in der laufenden Legislaturperiode nicht endgültig verabschiedet werden kann.
Da der wesentliche Inhalt des Gesetzes jedoch durch die EU-Antidiskriminierungs-Richtlinien vorgegeben ist, steht außer Frage, dass ein Antidiskriminierungsgesetz zu verabschieden ist; nur das »Wie« ist offen. Denn je nach Zusammensetzung der neu zu wählenden Bundesregierung wird das Gesetz im Detail eine andere Prägung erhalten. In Anbetracht der Diskussionen über die Einbeziehung von Menschen mit geistiger Behinderung ist jedoch zu erwarten, dass der Schutz für diese Personengruppe im Gegensatz zu dem vorliegenden Entwurf zumindest nicht erweitert wird.
2.3 Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung und Möglichkeiten zu ihrer Veränderung
Jeder auch noch so kleine Fortschritt in Richtung mehr Rechtssicherheit für Menschen mit Behinderungen ist gewiss ein Schritt in die richtige Richtung. Für eine gleichberechtigte, selbstbestimmte und vollakzeptierende Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben steht den Menschen mit geistiger Behinderung jedoch vor allem die häufig ablehnende Haltung der restlichen Gesellschaft ihnen gegenüber im Weg. Ablehnende Haltungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung sind weitgehend geprägt durch Unsicherheit, latente Ängste und Vermeidungstendenzen und können sich in den unterschiedlichsten sozialen Reaktionen auf Menschen mit geistiger Behinderung zeigen: Anstarren, diskriminierende Äußerungen und Witze, aggressive Handlungen bis hin zu Vernichtungswünschen (Originäre Reaktionen). Auf den ersten Blick harmloser und positiver wirken dagegen Mitleidsäußerungen und aufgedrängte, unpersönliche Hilfen. Aber auch diese Reaktionen dienen letztlich der Abwertung und Ausgrenzung und resultieren oftmals aus dem Widerspruch zwischen den originären Reaktionen und den offiziell erwünschten Reaktionen. Die originären Reaktionen werden daher oft im Sinne der sozialen Erwünschtheit unterdrückt. Dies kann zu Verhaltensunsicherheiten und Schuldgefühlen gegenüber den betroffenen Menschen und zu einer Scheinakzeptanz führen.[31]
Wie jedoch lässt sich die Akzeptanz behinderter Menschen in der Gesellschaft verbessern? Eine strategische Möglichkeit zur Veränderung der sozialen Reaktionen wird in der Wissens- und Informationsvermittlung über Behinderungen und behinderte Menschen gesehen. Sicherlich besteht in weiten Teilen der Bevölkerung diesbezüglich ein Informationsmangel und daher sind solche Informationsstrategien in Form von Aufklärungskampagnen wichtig. Ihre Wirkung auf die Einstellungsänderung wird jedoch oft überschätzt. Reaktionen und Vorurteile gegenüber behinderten Menschen sind weitgehend irrational und affektiv. Von daher werden die Einstellungen und Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderungen durch sachgerechte Informationen die primär die kognitive Ebene ansprechen, wohl kaum verändert werden können. Zudem kann ein größeres Wissen über Behinderungen auch nicht automatisch gleichgesetzt werden mit positiveren Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen, sondern kann stattdessen auch die Angst und die Abwehr gegenüber diesen Menschen erhöhen. Informationsstrategien können aber als ergänzende Maßnahmen durchaus ihre Berechtigung erhalten.[32]
Als eine Erfolg versprechende Strategie gilt der Kontakt zu behinderten Menschen. Hierzu sollten jedoch die folgenden Kontaktbedingungen möglichst erfüllt sein:
- „Der Kontakt muß intensiv [diese und die weiteren Hervorhebungen im Original] genug sein; oberflächliche und zufällige Kontakte sind nutzlos oder verstärken sogar Ablehnungstendenzen.
- Die Intensität des Kontakts allein reicht nicht aus, er sollte daneben
- emotional fundiert sein und
- freiwillig erfolgen, mit der Möglichkeit des Ausweichens in andere Sozialbeziehungen
- Weitere günstige Bedingungen sind
- relative Statusgleichheit
- die Erwartung einer gewissen ‚ Belohnung‘ aus der sozialen Beziehung und
- die Verfolgung gemeinsamer wichtiger Aufgaben und Ziele in einem möglichst leistungsneutralen Klima.“[33]
Bei einer strikten Beachtung dieser Bedingungen kann der »Kontaktstrategie« eine erhebliche Bedeutung für die Veränderung der sozialen Reaktionen auf Menschen mit Behinderungen zukommen[34], vor allem wenn sie mit weiteren Strategien kombiniert wird. Besonders geeignet als ergänzende Strategie ist bspw. der Erhalt von persönlichen Informationen über die spezielle Behinderung der Kontaktperson. Die Kombination von »Information« und »Kontakt« kann also die gesamte Effektivität vergrößern.[35] Als wichtige Rahmenbedingung für den Abbau negativer Reaktionen gegenüber Menschen mit Behinderungen betrachtet Günther Cloerkes auch die Stärkung der Handlungskompetenz der Menschen mit Behinderungen.[36]
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei unzureichender Berücksichtigung der notwendigen Bedingungen und der Wirkungsmechanismen dieser Änderungsstrategien die vorhandenen ablehnenden Haltungen noch verstärkt werden können. Weiterhin gibt es keine gezielt einsetzbare und erfolgssichere Strategie. Langfristig verspricht man sich von „einer konsequenten und sorgfältig geförderten sozialen Integration behinderter Menschen“[37] die besten Chancen die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv zu verändern.
2.4 Historische Entwicklungen der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Westdeutschland seit 1945
Eine wahre intensive Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, seiner planmäßigen, massenhaften Vernichtung »unwerten Lebens« und mit der eigenen Schuld gegenüber den Opfern hat in beiden Teilen Deutschlands nach 1945 nicht auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene stattgefunden.
So wurden auch beim Wiederbeginn der Behindertenarbeit in Westdeutschland eine Trauerarbeit und die an sich notwendige Aufarbeitung nicht geleistet.
„Statt dessen konnte auch ein Teil von »Hitlers willigen Vollstreckern« nach 1945 zur Tagesordnung übergehen: Personal und Ärzte, die in den Jahren zuvor in dieses [Vernichtungs-] Programm eingebunden waren, wurden auch weiter mit der Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderungen betraut, und diese fand in den gleichen psychiatrischen Krankenhäusern und Anstalten statt.“[38]
Bis in die 60er Jahre hinein wurde eine geistige Behinderung als Krankheit betrachtet. Es wurde davon ausgegangen, dass Menschen mit geistiger Behinderung bildungsunfähig sind und daher letztendlich nur zu verwahren und zu versorgen seien.
In den 60er Jahren veränderte sich, u.a. aufgrund der Bemühungen und der Beweisführung der Lebenshilfe, diese Sichtweise. Menschen mit geistiger Behinderung wurden nun als bildungsfähig betrachtet und man gestand ihnen das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung zu. Zum vorrangigen Ziel in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung wurde die Förderung erklärt. Es entstanden viele Sondereinrichtungen (z.B. Sonderschulen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung) durch die die Erfolge der Förderung nach außen demonstriert werden konnten und dem bislang vorherrschenden biologistisch-nihilistischen Menschenbild: »Du kannst nichts. Du bist nichts!« wurde ein pädagogisch-optimistisches Menschenbild entgegengesetzt: »Aus Dir kann mit unserer Hilfe etwas werden«.[39]
Etwa seit Mitte der 90er Jahre wird diese Förderorientiertheit in der Behindertenhilfe zunehmend kritisiert. Vor allem die Durchsetzung des neuen Leitbildes Selbstbestimmung macht die weitere Orientierung klar erkennbar. Das Prinzip der Selbstbestimmung hat Auswirkungen auf das gesamte System der Behindertenhilfe auf vielen unterschiedlichen Ebenen.[40] So setzt es neue veränderte Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung voraus und fordert neue Konzepte und Hilfen im Umgang mit ihnen: Sie sollen vermehrt begleitet, unterstützt und gestärkt werden.[41]
Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen kurz skizzierten Wandel von der Verwahrung über die Förderung zur Begleitung und die jeweils dazugehörenden Menschenbilder, Ziele und Hilfen sehr anschaulich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Niehoff-Dittmann, 2001, S. 55.
2.5 Zusammenfassung
Um die zuvor gängigen diskriminierenden Bezeichnungen ‚Idiotie‘ und ‚Schwachsinn‘ abzuschaffen, wurde 1958 der Begriff »geistige Behinderung« geprägt. Bis hinein in die 60er Jahre wurde eine geistige Behinderung als Krankheit gesehen und die betroffenen Menschen lediglich verwahrt und versorgt. Diese Sichtweise veränderte sich über die Jahrzehnte hinweg folgendermaßen: Etwa seit Ende der 60er Jahre bis zu den 90er Jahren wurde die Förderung als wichtigstes Ziel der Behindertenhilfe betrachtet. Diese Förderorientiertheit wird etwa seit Mitte der 90er Jahre immer stärker kritisiert. Von nun an wird immer häufiger von einer Begleitung des Menschen mit geistiger Behinderung gesprochen und das neue Leitbild der Selbstbestimmung gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Auch der Begriff »geistige Behinderung« gerät seitdem zunehmend stärker in die Kritik. Vor allem aufgrund der oft diskriminierenden Verwendungsweise des Begriffs und der Gefahr einer Stigmatisierung wird ein neuer Begriff gefordert. Dieser soll sich nicht mehr an den Defiziten des Menschen orientieren, sondern seinen Betrachtungsschwerpunkt stärker auf die individuellen Lebensumstände des Menschen und auf die sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligungen, die ihn behindern, richten. Eine Begriffsänderung kann aber auch neue Probleme mit sich bringen und darf nicht als Ideallösung gesehen werden. Wesentlich wichtiger ist eine Änderung der dahinter stehenden Haltung: Es gilt eine dialogische Haltung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung einzunehmen.
Um soziale Ausgrenzungen und Einschränkungen der gesellschaftlichen Teilhabe zu verhindern bzw. rückgängig zu machen und die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken, wurden in dem vergangenen Jahrzehnt in der Bundes-republik Deutschland unterschiedliche Gesetze verabschiedet. Diese Gesetze geben Menschen mit geistiger Behinderung sicherlich ein Mehr an Rechtssicherheit. Um ihnen jedoch eine wirklich gleichberechtigte und selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe gewährleisten zu können muss ihre Akzeptanz in der Gesellschaft ver-bessert werden. Als Grundvoraussetzung hierfür gilt es intensive, positiv emotionale Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung herbeizuführen. Die beste Möglichkeit die sozialen Reaktionen und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen, die häufig auf Unsicherheiten und Ängsten zurückzuführen sind, zu verändern wird in einer sorgfältigen, aber konsequenten sozialen Integration gesehen.
3. Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion: Leitideen und Konzepte zu ihrer praktischen Umsetzung
In den letzten Jahren tauchen immer wieder neue Leitbegriffe in der Behindertenhilfe auf, die zu einem Überdenken der vertrauten Handlungs- und Deutungsmuster führen sollen. Mit einer inhaltlichen Präzisierung dieser Begriffe sollen nun in diesem Kapitel sowohl die bestehenden Überschneidungen als auch die jeweils spezifischen Ausprägungen dieser neuen Leitideen verdeutlicht werden.
Zunächst wird im Punkt 3.1 dargestellt, was sich hinter dem bereits vertrauten Leitbegriff »soziale Integration« und hinter den aktuellen Leitbegriffen »Teilhabe« und »Inklusion« verbirgt. Im Folgenden werden dann die Leitbegriffe bzw. Grundprinzipien der Normalisierung und der Selbstbestimmung vorgestellt (3.2). Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Beschreibung dreier Konzepte: Empowerment, Assistenz und Community Care.
3.1 Soziale Integration, Teilhabe und Inklusion
Der Begriff Integration wird heute sowohl in vielen unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen als auch in der Alltagssprache geradezu auf eine inflationäre Weise benutzt. So werden völlig unterschiedliche Inhalte und Situationen als integrativ bezeichnet, so dass kaum noch jemand weiß, was tatsächlich unter »Integration« zu verstehen ist.[42]
Ursprünglich leitet sich dieser Begriff von den lateinischen Worten »integrare« und »Integratio« ab. „Integratio bedeutet Wiederherstellung, integrare bedeutet wiederherstellen oder erneuern.“[43]
In der Pädagogik werden heute unter dem Begriff der »Integration« Fragen des gemeinsamen Lebens und Lernens von Menschen mit und ohne Behinderungen über alle Lebensbereiche hinweg diskutiert. Ursprünglich beschreibt der Begriff in den deutschsprachigen Ländern den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern. In Deutschland begann die Integrationsdiskussion in den 70er Jahren und sie bezieht sich bis heute vorrangig auf den vorschulischen und schulischen Bereich.[44] Die soziale Integration, die „als Prozess im Zusammenwirken zwischen Individuen und verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen verstanden werden [kann und die, M.L.] auf die Umsetzung der gesellschaftlichen Teilhaberechte für alle Menschen“[45] abzielt, ist dagegen noch weit von einer Realisierung entfernt. Dabei sollte gerade die soziale und die gesellschaftliche Integration die generelle Zielsetzung aller Integrationsbemühungen sein.
Wie bereits angedeutet ist der Begriff Integration heute zu einem sehr abgenutzten Modewort geworden. So gibt es seit einigen Jahren auch eine massive Kritik daran, welche Verwendung dieser Begriff teilweise in Deutschland findet und was alles als Integration wahrgenommen oder dargestellt wird. So herrschen unter dem Deckmantel der Integration oftmals weiterhin Segregation und Diskriminierung.[46] Es wird der Vorwurf erhoben, die Integrationsidee sei hierdurch in eine Sackgasse geraten.[47]
Auf dem Hintergrund dieser Kritik an der praktischen Umsetzung der Integration und an den mangelnden Bemühungen um eine soziale Integration, suchte man nach einer zutreffenderen Beschreibung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderungen. Im englischen Sprachraum hat sich seit etwa 1990 der Begriff »Inclusion« hierfür durchgesetzt und dieser wird seit einigen Jahren zunehmend auch in der deutschsprachigen Fachliteratur, hier übersetzt als »Inklusion«, verwendet.[48] Seitdem entwickelt sich der Begriff der Inklusion, trotz einer fehlenden genauen Definition zu einem neuen Leitbild einer zukünftigen Integrationsentwicklung und „soll über die teils kritisierte Praxis der Integration hinausführen und als neues umfassendes Konzept etabliert werden.“[49]
Hierzu schreibt Alfred Sander: „Inklusion ist in der deutschen Fachsprache ein sinn-voller Begriff, wenn man darunter optimierte und erweiterte Integration versteht.“[50]
Inklusion bedeutet übersetzt Einschluss oder Einbeziehung. Wie schon erwähnt bedeutet der Integrationsbegriff dem Wort nach eine Wiederherstellung. Integration strebt demnach eine (Wieder-) Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in die bestehende Gesellschaft an. Inklusion dagegen zielt auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen und Auffassungen ab. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen soll als selbstverständliche Tatsache und Normalität erkannt werden, damit jedem Menschen die Unterstützung zukommt, die er für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt.[51]
„Der Inclusionsbegriff thematisiert die Teilhabe an der komplexen und differenzierten Gesellschaft. [...] Während im Wort Integration eher ein ‚Die Mehrheit integriert unter bestimmten Umständen eine besondere Minderheit‘ steckt, läßt Inclusion die Verschiedenheit im Gemeinsamen bestehen [...].“[52]
So beschreibt auch Georg Theunissen, unter Bezugnahme auf Andreas Hinz[53], Inklusion der Idee nach als einen
„Ansatz, der von Lebenswelten [...] ausgeht, in denen alle Menschen, mit oder ohne Behinderung, willkommen sind und die so ausgestattet sein sollten, dass jeder darin, mit oder ohne Unterstützung, sich zurechtfinden, kommunizieren und interagieren, kurzum sich wohlfühlen kann. [...] Inclusion bedeutet in diesem Sinne uneingeschränkte Zugehörigkeit und ist quasi das Fundament für Partizipation.“[54]
Statt allein eine Reintegration von Menschen mit geistigen Behinderungen zurück in die vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen anzustreben setzt sich das Leitbild der Inklusion also zum Ziel, eine Ausgrenzung von Menschen mit geistigen Behinderungen aus ihren Regelstrukturen von vornherein zu verhindern, Ausgrenzungen also gar nicht erst zuzulassen.[55]
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen allerdings neue Konzepte und Strategien entwickelt werden. Von zentraler Bedeutung ist hier vor allem das Community Care Konzept[56] und der mit diesem Konzept verbundene »Kompetenztransfer«: Professionelle Helfer aus der Behindertenhilfe müssen allgemeine gesellschaftliche Institutionen so beraten, also ihre Kompetenz so transferieren, dass diese Institutionen auch Menschen mit geistiger Behinderung entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrer Anliegen angemessen bedienen und beraten können. Dies bedeutet für die Institutionen der Behindertenhilfe, dass sie nicht mehr nur fast ausschließlich die Menschen mit Behinderungen als ihre Kunden betrachten, sondern zunehmend auch die regulären gesellschaftlichen Einrichtungen.[57]
In diesem Sinne definiert auch Ulrich Heimlich Inklusion als
„ Interaktionen [...] , die zur Bildung von Gemeinschaften im Sinne von Netzwerken zur Unterstützung der selbstbestimmten sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen. “[58]
Der Begriff Inklusion wird als Synonym für die Bezeichnung »volle gesellschaftliche Teilhabe« verwendet. Unter einer vollen gesellschaftlichen Teilhabe wird ein uneingeschränktes, gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und selbstverständliches Einbezogensein in die Gemeinschaft aller Menschen verbunden mit dem Erleben von Anerkennung und Unterstützung verstanden. Teilhabe ist also erst dann realisiert, wenn eine Gesellschaft nicht mehr ausgrenzt.[59]
Die Realität sieht jedoch bislang ganz anders aus. „Natürlich ist volle gesellschaftliche Teilhabe bzw. Inclusion ‚nur‘ eine Utopie. [...] Aber es ist eine lohnende Utopie, für die zu streiten sich lohnt.“[60]
Hierbei gilt es, das Menschenbild in unseren Köpfen zu verändern und zu erkennen, dass jede Person bereits integraler Bestandteil der gesamten Menschheit ist. Diese Einheit muss durch vielfältige soziale Beziehungen intensiviert und ausgestaltet werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Inklusion verwirklicht werden kann. Es muss also all das, was der Begriff impliziert, in der Realität eingefordert werden, so dass tatsächlich eine inklusive Gesellschaft entsteht.[61]
Ohne Zweifel weist der Begriff »Inklusion« deutlicher in die richtige Richtung als der Begriff »Integration«. Jedoch taucht auch in der für diese Arbeit verwendeten relativ aktuellen Literatur meist noch der Begriff Integration auf. Dahinter steht aber in den meisten Fällen ein inklusives Denken. Daher wird hier weiterhin in den meisten Fällen der Begriff Integration verwendet und nur wenn explizit auf den erweiterten Gedanken der Inklusion aufmerksam gemacht werden soll auch dieser Begriff benutzt. Dies geschieht aus zweierlei Gründen: Zum einen, da der Begriff Inklusion noch nicht eindeutig geklärt ist, die Vorrausetzungen dafür noch nicht vorhanden sind und man daher quasi in einigen Fällen nicht darum herum kommt, zunächst eine Integration zu betreiben[62] und zum anderen, um den Lesern Verwirrungen zu ersparen, wenn durchgängig von Inklusion geschrieben wird und in den Zitaten verschiedener Autoren dann wiederum der Begriff Integration verwendet wird.
Allerdings soll an dieser Stelle klargestellt werden, dass hinter den Ausführungen der inklusive Gedanke steckt und die folgenden von Cloerkes (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) genannten Grundprinzipien bzw. Merkmale eines integrativen Menschenbildes dieser Arbeit zugrunde gelegt werden:
- „Achtung der Würde und Gleichheit aller Menschen
- Anerkennung einer egalitären Gleichwertigkeit, auch bei extremer individueller Verschiedenheit
- Unverletzbarkeit der Würde eines jeden Menschen, unabhängig von Art und Schweregrad einer Behinderung
- Beachtung des Grundrechts auf eine umfassende Teilhabe am Leben der Gesellschaft
- Beachtung des Grundrechts auf lebenslange Bildung, Erziehung, Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit; Beachtung und Förderung von Kompetenzen
- Anerkennung von Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Subjekte; Überwindung der objektivierenden, defektorientierten Sicht-weise
- Abkehr von einer Mitleidsethik zu einer Ethik des solidarischen Handelns in einer gemeinsamen Lebenswelt
- Leitbegriffe: Selbstbestimmung, Autonomie, Emanzipation, Normalisierung, Antidiskriminierung, Gleichstellung, Demokratie, Humanität.“[63]
3.2 Wurzeln des inklusiven Gedankens
Das Leitbild der Teilhabe und der Inklusion enthält implizit die Prinzipien der Normalisierung und der Selbstbestimmung. Der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung und nach einer Normalisierung der Lebensverhältnisse von Menschen mit geistiger Behinderung ebnete sozusagen den Weg für die Entstehung dieses neuen Leitbildes. Daher lassen sich die beiden Leitideen »Normalisierung« und »Selbstbestimmung« als Wurzeln des inklusiven Gedankens betrachten.
3.2.1 Normalisierungsprinzip
Die Entstehung und Entwicklung des Normalisierungsprinzips wurde vorrangig von drei Personen geprägt: dem Dänen Niels Erik Bank-Mikkelsen, dem Schweden Bengt Nirje und dem Amerikaner Wolf Wolfensberger.[64]
Der Jurist Bank-Mikkelsen hatte als Sekretär des Sozialministeriums, dass 1959 in Dänemark in Kraft tretende »Gesetz über die Fürsorge für geistig Behinderte und andere besonders Schwachbegabte« vorbereitet und die Ziele dieses Gesetzes in folgendem Satz zusammengefasst: „Letting the mentally retarded obtain an existance as close to normal as possible“.[65]
Diesen schon bald nach 1959 als Normalisierungsprinzip bezeichneten Gedanken der Normalisierung erläuterte Bank-Mikkelsen in Vorträgen und Aufsätzen und wehrte sich von Anfang an gegen das Missverständnis, Normalisierung bedeute eine Normierung des Menschen mit geistiger Behinderung:
„Das Grundprinzip der Normalisierungstheorie ist es, daß alle Menschen, seien sie behindert oder nicht, die gleichen Rechte haben; es ist also ein Gleichheitsprinzip. Trotzdem darf man nicht vergessen, daß alle Menschen verschiedenartig sind, daß sie verschiedene Bedürfnisse haben, so daß Gleichheit lediglich bedeutet, jedem einzelnen Menschen Hilfe und Unterstützung anzubieten, die seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen sind."[66]
Weiterhin betonte Bank-Mikkelsen immer wieder, dass die Normalisierung das eigentliche Ziel sein soll und die Integration lediglich ein Mittel auf dem Weg zu diesen Ziel darstellt.[67]
Dieser dänische Gedanke der Normalisierung wurde 1969 in Schweden aufgegriffen. Hier war es vor allem der Psychologe und Direktor des schwedischen »Reichsverbandes für entwicklungsgehemmte Kinder« Bengt Nirje, der diesen Gedanken konkretisierte. Nirje betrachtet das Normalisierungsprinzip als ein Mittel, „das dem geistig Behinderten gestattet, Errungenschaften und Bedingungen des täglichen Lebens, so wie sie der Masse der übrigen Bevölkerung zur Verfügung stehen, weitgehend zu nutzen.“[68]
Um den Ansatz von Bank-Mikkelsen zu präzisieren, benennt Nirje acht Bereiche, über die sich die Normalisierung erstrecken soll:
- „Normaler Tagesrhythmus
- Normaler Wochenrhythmus (Trennung von Wohnen-Arbeit-Freizeit)
- Normaler Jahresrhythmus
- Normaler Lebenslauf
- Respektierung von Bedürfnissen
- Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern
- Normaler wirtschaftlicher Standard
- Normale Standards von Einrichtungen“[69]
Diese Prinzipien sollen nach Nirje grundsätzlich für alle Menschen mit geistiger Behinderung, unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung gültig sein.
Im Gegensatz zu Bank-Mikkelsen sieht Nirje das Normalisierungsprinzip als Mittel, welches die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft ermöglichen könnte und dies als Ziel anstrebt.[70]
Eine zentrale Erweiterung und Systematisierung des Normalisierungsprinzips erfolgte 1972 in den USA durch den Psychologen Wolf Wolfensberger. Neu an den Überlegungen von Wolfensberger ist zum einen die Anwendung des Normalisierungsprinzips auf alle stigmatisierten Menschen und Gruppen, die durch Diskriminierungsprozesse aus der Gesellschaft verdrängt werden und zum anderen die Erweiterung des Konzepts auf die Ebene der gesellschaftlichen Dimensionen. Ebenso wie seinen Vorgängern geht es auch Wolfensberger um die Reformierung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen, doch während Bank-Mikkelsen dafür die physische und soziale Integration mit dem Ziel der Normalisierung und Nirje praktische Veränderungen fordert, versucht Wolfensberger herauszufinden, warum Menschen mit Behinderungen unter anderen bzw. schlechteren Bedingungen am Rande der Gesellschaft leben müssen.[71]
Als entscheidenden Punkt für diese Tatsache sieht er das soziale Ansehen an, welches durch die Vorstellungen, die sich andere Menschen von einer Person machen, entsteht. Er geht davon aus, dass diese Vorstellungen, auch wenn sie nur wenig mit dem Wesen der Person zu tun haben, entscheidend für deren soziale Bewertung sind und daher Ablehnung viel stärker auf die Vorstellungen der Umwelt zurückzuführen ist, als auf das tatsächliche Wesen der abgelehnten Person.[72]
„Man muß sich klar ins Bewußtsein rufen, dass Abweichung (deviancy) durch uns gemacht wird, sie ist in den Augen des Beobachters“[73], schrieb Wolfensberger 1972 und richtete sein Augenmerk verstärkt auf die Möglichkeiten der Aufwertung der sozialen Rolle (Social Role Valorization). Mit der Einführung dieses Begriffs als Ersatzterminus für den Normalisierungsbegriff will Wolfensberger noch einmal betonen, dass es nicht um eine Normalisierung im Sinne einer Anpassung des Menschen mit Behinderung an die Gesellschaft geht, sondern dass eine Rollenaufwertung angestrebt wird, bei der die Einstellung und die Sichtweise der Gesellschaft entscheidend ist.
Die Aufwertung der sozialen Rolle ist nach Wolfensberger nur möglich, wenn sie auf den folgenden drei Handlungsebenen erfolgt:
- Personale Ebene (Individuum)
- Ebene der primären und intermediären sozialen Systeme (z.B. Familie, Nachbarschaft, Heim)
- Gesellschaftliche Ebene (z.B. Gesetze)[74]
Auf jeder dieser drei Handlungsebenen sind zwei Handlungsdimensionen von entscheidender Bedeutung: Die direkte Interaktion und die Interpretation, denn
„Normalisierung darf sich nicht nur auf Interaktionen mit Menschen mit geistiger Behinderung beziehen; vielmehr müssen für eine dauerhafte Normalisierung Einstellungen und Wertvorstellungen der Gesellschaft und der in ihr lebenden Menschen (Interpretation) berücksichtigt und beeinflußt werden.“[75]
In Deutschland wird der Normalisierungsgedanke in den 70er Jahren bekannt. So berichtet bspw. Heidemarie Adam 1977 über die Entstehung und Entwicklung des Normalisierungsprinzips in Dänemark, Schweden und den USA und macht deutlich, dass diese Normalisierungsgedanken in Deutschland noch weit von einer Realisierung entfernt sind:
„Insbesondere geistigbehinderten Personen werden nicht die gleichen Rechte zugebilligt wie nichtbehinderten. [...] Vorurteile sind weit verbreitet. Im besten Fall werden Geistigbehinderte als ewige Kinder betrachtet.“[76]
Durch das Bekanntwerden des Normalisierungsprinzips in Deutschland wurden die tradierten Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung überdacht und das Prinzip bildete die Grundlage für sozialpolitische Veränderungen. Etwa zu Beginn der 80er Jahre wurde das Normalisierungsprinzip zum neuen Leitgedanken, zum neuen Paradigma der Heil- und Sonderpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland.[77]
Das Normalisierungsprinzip wurde jedoch, auch in Deutschland, häufig als »Normalisierung des Behinderten«, als einseitige Anpassung des Menschen mit geistiger Behinderung an die bestehende Normalität fehlinterpretiert. Des Weiteren wurde dem Normalisierungsprinzip auch eine Vernachlässigung der spezifischen Bedürfnisse des Menschen mit geistiger Behinderung vorgeworfen. Schon Bank-Mikkelsen, Nirje und Wolfensberger mussten sich gegen solche Vorwürfe wehren und sie entkräftigen. Wolfensberger forderte zwar das Erlernen von gesellschaftlich üblichen Verhaltensweisen, es ging ihm hierbei aber nicht um eine einseitige, unkritische Anpassung an gesellschaftliche Standards, sondern um entsprechende Formen der Hilfen, durch die der Mensch bessere Möglichkeiten der Integration erhalten kann. Normalisierung zielt damit vielmehr auf gleichberechtigte Lebenschancen und auf eine Veränderung von sozialen Strukturen, die diese Lebenschancen verwehren.[78] Normalisierung in diesem Sinne bedeutet also nicht Normalität und Zwang zum normalen Leben, sondern stellt eine Chance auf einen gleichwertigen Lebensstil, verbunden mit gleichen Rechten dar. Normalisierung heißt auch nicht, dass dem Menschen mit geistiger Behinderung spezielle Hilfen, Dienste und Unterstützung entzogen werden. Jedoch sollten diese Hilfen immer wieder unter dem Aspekt kontrolliert werden, dass sie nicht die lebenslange Abhängigkeit des Empfängers von vornherein unterstellen und somit verfestigen, sondern die Verselbstständigkeit fördern.[79]
Das Normalisierungsprinzip kann demnach als eine der Wurzeln bzw. eine der Leitideen des gleichberechtigten Zusammen-Lebens von Menschen mit und ohne geistiger Behinderung und als Forderung nach einem selbstbestimmten Leben von Menschen mit geistiger Behinderung in der Mitte der Gesellschaft betrachtet werden, oder wie Ilja Seifert, der Vorsitzende des Berliner Behindertenverbandes »Für Selbstbestimmung und Würde« e.V. sagt:
„Es kann/ darf also zukünftig nicht mehr darum gehen, behinderte Menschen der Umwelt ‚anzupassen‘, sondern uns so zu nehmen, wie wir sind. Und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir so, wie wir sind, unsere Persönlichkeit frei entfalten und unsere gesellschaftliche Teilhabe selbstbestimmt gestalten können.“[80]
3.2.2 Selbstbestimmung
Wenn Menschen mit geistiger Behinderung normale Lebensbedingungen und gesellschaftliche Teilhabe fordern, gehört dazu auch der Anspruch „Entscheidungen zu treffen, die den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Interessen oder Wertvorstellungen entsprechen.“[81]
Dieser Anspruch auf Selbstbestimmung impliziert die Forderung, Menschen mit geistiger Behinderung ernst zu nehmen und die Beziehungen zu ihnen zu befreien von Bevormundungen und traditionellen Machthierarchien. So stellt das Prinzip der Selbstbestimmung eine Präzisierung des Normalisierungsprinzips dar: „Es geht um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Begleitern.“[82]
Die Forderung nach Selbstbestimmung ist maßgeblich von der Independent-Living-Bewegung geprägt, die sich in den 70er Jahren in den USA entwickelt hat. In dieser sozial-politischen Bewegung organisierten sich vorwiegend Menschen mit körperlichen Behinderungen, die sich mit den folgenden Anliegen an die Öffentlichkeit wandten:
- „Einfordern des ihnen selbstverständlich zustehenden Rechts, über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen und entscheiden zu können
- Abbau der gesellschaftlichen Diskriminierung behinderter Menschen
- Betroffene - und nicht Fachleute - unterstützen Betroffene“[83]
Die Independent-Living-Bewegung betrachtet Behinderung und Einschränkung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten nicht als individuelles, sondern als soziales Phänomen. Sie protestierten energisch gegen diskriminierende Verhältnisse, forderten entsprechende gesetzliche Veränderungen als auch die dafür notwendigen gesellschaftlichen Bedingungen und einen Einstellungswandel in der Gesellschaft.
Für die Menschen mit Behinderungen bedeutet Independent Living nicht unabhängiges Leben, sondern selbstbestimmtes Leben. Diese Übersetzung soll verdeutlichen, dass es ihnen nicht um physische Selbstständigkeit geht, sondern um Entscheidungsprozesse.[84]
Horst Frehe definiert den Selbstbestimmungsbegriff der Independent-Living-Bewegung folgendermaßen:
„Selbstbestimmt leben bedeutet, das eigene Leben kontrollieren und gestalten zu können und dabei die Wahl zwischen akzeptablen Alternativen zu haben, ohne in die Abhängigkeit von Anderen zu geraten. Das schließt das Recht ein, die eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, am öffentlichen Leben der Gemeinde teilzunehmen, verschiedene soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen selbst treffen zu können. Selbstbestimmung ist daher ein relatives Konzept, das jeder für sich bestimmen muß."[85]
Parallel zu der Independent-Living-Bewegung sind in den 70er Jahren in den USA und Kanada auch eigenständige Interessenvertretungen von Menschen mit geistiger Behinderung entstanden.[86] Diese haben sich unter dem Namen »People First« (»Zuerst sind wir Menschen«) zu einer Bewegung zusammengeschlossen. Aus diesen People-First-Gruppen heraus entstand die internationale Self-Advocacy-Konferenz, die zum ersten Mal 1988 in London tagte. Self-Advocacy wurde zu einer schnell wachsenden Bewegung, die vor allem in den USA, in Schweden, Dänemark, den Niederlanden und in Großbritannien einen großen Stellenwert erlangt hat.[87]
„Advocacy heißt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt: Anwaltschaft, das Sprechen für oder Vertreten von jemandem. Self-Advocacy kann mit „für sich selbst sprechen“, sowohl als Einzelpersonen als auch in Gruppen, übersetzt werden. Self-Advocacy bedeutet, mehr Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen. Jede Aktivität, die Selbstbestimmung/Selbstvertretung einschließt, kann Self-Advocay genannt werden.“[88]
Zu Beginn der 90er Jahre gelangten die ersten Informationen über die Self-Advocacy-Bewegung nach Deutschland. Vor allem angestoßen durch den Kongress der Bundesvereinigung Lebenshilfe »Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung«[89] im Herbst 1994 wurden diese Informationen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und die Idee der Selbstbestimmung wurde so auch dank dieses Kongresses bald zum neuen Leitgedanken in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Im Anschluss an diesen Kongress entwickelten sich, insbesondere von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und dem Dachverband der Selbstbestimmt Leben-Bewegung (ISL), Initiativen zum Aufbau von Selbstbestimmungs- und Selbstvertretungsgruppen in Deutschland.[90]
Die inhaltliche Arbeit dieser, in Deutschland meist »People First« genannten Gruppen, basiert auf dem grundsätzlichen Recht auf Mit- und Selbstbestimmung.
Aber was genau bedeutet Selbstbestimmung und ist denn Selbstbestimmung keine Selbstverständlichkeit? Tatsächlich entscheiden Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Leben sehr viel weniger über sich und ihre Lebensumstände als andere Bürger.
Selbstbestimmung ist in erster Linie als Grundrecht zu verstehen, welches für Bürger einer demokratischen Gesellschaft eine prinzipielle Selbstverständlichkeit darstellt. Sie gehört wesenhaft zum Menschsein dazu, führt zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und stellt die Grundlage menschlichen Wohlbefindens dar.[91]
Selbstbestimmung ist ein relativer Begriff. Es gibt kein absolutes Maß an Selbstbestimmung. Alle Menschen sind in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt durch persönliche, institutionelle oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen als auch durch die Rechte und Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, die es zu berücksichtigen gilt. Die Handlungsspielräume eines jeden Menschen sind unterschiedlich groß und abhängig von den Freiräumen, die ihnen zur Verfügung stehen.[92]
Diese Freiräume für eigene Entscheidungen und Handlungen sind bei Menschen mit geistiger Behinderung vor allem durch ihr „lebenslanges Mehr an sozialer Abhängigkeit“[93] häufig stark eingegrenzt. Daher ist es umso wichtiger und unerlässlich, ihnen auf allen möglichen Ebenen Mitbestimmung und Selbst-bestimmung zu ermöglichen. Diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten werden ihnen jedoch oft nicht zugestanden. Dies geschieht in den meisten Fällen nicht aus Absicht oder gar Böswilligkeit, sondern vielmehr aus Gedankenlosigkeit, mangelndem Einfühlungsvermögen oder auch aus einer Überbesorgtheit heraus.[94]
Überfürsorge schließt fast immer eine Unterforderung ein: Dem Menschen mit geistiger Behinderung wird nicht zugetraut, selbst zu entscheiden und zu bestimmen. Seine Wünsche und Bedürfnisse werden nicht erkannt, ignoriert oder nicht ernst genommen. Entscheidungen werden ihm abgenommen und nicht selten wird auch der erwachsene Mensch mit geistiger Behinderung als „ewiges Kind“ betrachtet und behandelt. Diese Überfürsorge und Bevormundung führt bei den Betroffenen oftmals zu einer verstärkten Abhängigkeit von ihren Mitmenschen und sie kann zudem auch eine »erlernte Hilflosigkeit« herbeiführen.[95]
Ebenso sehr wie diese Unterforderungen sind auch Überforderungen zu vermeiden, da auch diese zu Resignation und Passivität führen können. Mitbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung muss immer echte, konkrete Entscheidungs-möglichkeiten voraussetzen, deren Auswirkungen direkt erfahrbar und verständlich sind. Es muss ihnen klar sein, worüber sie bestimmen und was sie damit bewirken. Genauso wie alle anderen Menschen haben sie Anspruch auf Wahlmöglichkeiten. Auch wenn es sich in den Augen ihrer Bezugspersonen um kleine, belanglose Dinge handelt, trägt das Angebot von Wahlmöglichkeiten entscheidend zu ihrer Lebensqualität bei und stärkt ihr Selbstwertgefühl.[96]
Weiterhin muss sowohl für die Menschen mit geistiger Behinderung als auch für ihre Bezugspersonen klar sein: „Selbst bestimmen bedeutet Verantwortung übernehmen. Selbstbestimmung ermöglichen bedeutet Verantwortung abgeben.“[97]
Verantwortung abgeben setzt bei den Bezugspersonen voraus, dass sie dem Menschen mit geistiger Behinderung etwas zutrauen und dass sie selbst erkennen und einsehen, dass ihre Einflussnahme Grenzen hat und haben muss. Wenn ihnen das gelingt, sie also ihrem Gegenüber ein ehrliches Vertrauen entgegenbringen, ihn ermutigen und ihm so weit und so viel wie möglich Verantwortung für sein eigenes Leben übergeben, tragen sie dazu bei, das Selbstvertrauen dieses Menschen zu fördern und zu festigen. Bevor Menschen sich aber dazu entschließen, die Verantwortung für etwas zu übernehmen, müssen sie sich zunächst selbst darüber klar werden, ob sie das auch wirklich können und wollen. Selbstbestimmung kann auch bedeuten, die Verantwortung in einer bestimmten Angelegenheit bewusst einem anderen Menschen zu überlassen.[98]
Selbstbestimmung setzt also keine Selbstständigkeit voraus. Selbstständigkeit bedeutet, ohne fremde Hilfe leben zu können. Eben dies können Menschen mit geistiger Behinderung in der Regel nicht. Sie sind abhängig von Hilfestellungen durch andere Menschen. Um selbstbestimmt zu leben ist es jedoch nicht nötig, auf Unterstützung zu verzichten, denn auch ein hohes Maß an Abhängigkeit von der Hilfe durch andere Menschen ist nicht mit Fremdbestimmung gleichzusetzen. Wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung die Form und das Maß der Unterstützung selbst festlegen kann und seine Assistenten diese Hilfen ausführen, ohne damit Eigenziele oder Manipulationen zu verfolgen, ermöglicht ihm dies eine selbst-bestimmte Lebensführung auch ohne Selbstständigkeit.[99]
In der Praxis ist bei vielen Eltern und auch bei den professionellen Helfern häufig noch die Einstellung zu finden, dass Menschen mit geistiger Behinderung aufgrund ihrer intellektuellen Beeinträchtigung und ihrer fehlenden Unabhängigkeit unfähig sind, selbst zu bestimmen. Ein Überdenken dieser Sichtweise und eine damit verbundene kritische Selbstreflexion haben bislang nur teilweise stattgefunden. Ein wesentliches Hindernis hierfür sieht Mattke im „Paternalismus als vorherrschendes professionelles Selbstverständnis“[100]. Paternalismus liegt vor, wenn Personen aus ihrer Annahme, dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, für sich das Recht beanspruchen, stellvertretend für diese Menschen Entscheidungen auch gegen deren erklärten Wunsch zu fällen. Während also in der Theorie nahezu einvernehmlich Selbstbestimmung, Begleitung und Assistenz gefordert wird, herrschen in der Praxis häufig noch paternalistischen Haltungen, nach dem Motto »Wir wissen doch besser, was gut für dich ist«, gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung vor.[101]
Die Umsetzung der Leitidee Selbstbestimmung betrifft dementsprechend Menschen mit geistiger Behinderung ebenso wie ihre Angehörigen und ihre Helfer, als auch die Interessenverbände, die Institutionen der Behindertenhilfe und die Politik.
Zusammenfassend bedeutet selbstbestimmt zu leben,
„Entscheidungsautonomie und Umweltkontrolle zu gewinnen und gesellschaftliche Diskriminierungen zu überwinden. Damit verbunden ist der Gedanke, dass Menschen mit Behinderungen dieselben Rechte und Pflichten haben wie andere Menschen auch. Die Wege und Konkretisierungsformen einer selbstbestimmten Lebensführung sind dabei so unterschiedlich, wie es normal ist, verschieden zu sein: Für die einen heißt Selbstbestimmung, selber zu entscheiden, welche Kleider sie tragen oder welche Mahlzeit sie zubereiten möchten; für eine andere Person bedeutet es, in einer eigenen Wohnung zu leben oder ihre Freizeit nach eigenem Gutdünken zu verbringen.“[102]
Christel Rittmeyer betrachtet den Gedanken der Selbstbestimmung nicht als ein neues Paradigma in der Pädagogik bei geistiger Behinderung, sondern eher als neue »Leitvorstellung«, welche die Gedanken der Normalisierung und der Integration ergänzt.[103]
Diese Ansicht vertritt auch Theo Klauß und begründet sie folgendermaßen:
„Die Leitideen der Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung lassen sich als Umformulierungen der Forderung nach Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit verstehen. Wie diese haben sie nur gemeinsam Gültigkeit und stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander: die Forderung nach Gleichheit (ohne Solidarität) beinhaltet die Gefahr der Gleichmacherei, der Nichtberücksichtigung individueller Bedürfnisse. Brüderlichkeit für sich genommen (ohne Freiheit) kann missverstanden werden als Zwang zur Integration und Freiheit ohne Brüderlichkeit bedeutet Überforderung und Isolation des einzelnen Menschen. Gemeinsam formulieren sie jedoch für alle gültige Menschenrechte.“[104]
3.3 Konzepte zur Umsetzung der Leitideen
Die Umsetzung der Leitideen Integration, Teilhabe, Normalisierung und Selbstbestimmung erfordert neue Formen des Umgangs mit Menschen mit geistiger Behinderung als auch Veränderungen in den Einstellungen und Haltungen gegenüber diesem Personenkreis auf Seiten der professionellen Helfer und der gesamten Gesellschaft. Die gesellschaftliche Anerkennung und das Ansehen von Menschen mit geistiger Behinderung soll gesteigert werden. Im Idealfall wird eine vollständige Entstigmatisierung dieser Personen und eine inklusive Gesellschaft angestrebt, die eine hohe Lebensqualität[105] aller gewährleistet.
Es geht darum, neue Konzepte /Strategien zu entwickeln, die der Realisierung dieser Leitideen dienen. Im Folgenden werden daher drei solcher Konzepte, Empowerment, Assistenz und Community Care, vorgestellt.
3.3.1 Empowerment
Der Begriff Empowerment stammt ursprünglich aus den US-amerikanischen Bürgerrechts- und Emanzipationsbewegungen der 70er Jahre. Er bedeutet soviel wie Selbst-Bemächtigung, Selbst-Ermächtigung und Selbst-Befähigung von gesellschaftlichen Randgruppen.
„Empowerment steht für einen Prozeß, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewußt werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen [...]. Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens."[106]
In Deutschland wird dieser Empowerment-Gedanke seit Mitte der 80er Jahre innerhalb der sozialen Arbeit thematisiert und diskutiert und wurde von der Behindertenhilfe dann erst in den 90er Jahren aufgegriffen.[107]
Der Grundgedanke des Empowerment-Konzepts, die Stärkung und Bemächtigung von Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen in einer eher machtlosen Situation befinden, bezieht sich auf die Annahme, „dass Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen eigene Kräfte, Fähigkeiten und Ressourcen zur Verfügung haben oder verfügbar machen können, die durch erlebte Hilflosigkeit oft zugedeckt sind.“[108] So vertraut das Empowerment-Konzept, im Rahmen der Behindertenhilfe also „in die oft verschütteten Ressourcen behinderter Menschen [und, M.L.] setzt an ihren Kompetenzen an und nicht bei den Defiziten.”[109]
Im Empowerment-Prozess verändert sich zunächst einmal die Rolle des Menschen mit Behinderung: Er wird zur Hauptperson, zum Experten in eigener Sache.[110] Das Vertrauen in seine individuellen Ressourcen ist eine der wichtigsten Vorraus-setzungen für gelingende Empowermentprozesse und fordert von den professionellen Helfern eine neue veränderte Haltung gegenüber ihren Klienten. Diese Haltung muss durch die generelle Auffassung geprägt sein,
„daß auch der (erwachsene) Mensch mit einer geistigen Behinderung Experte seiner selbst ist. Er kennt seine Bedürfnisse und Wünsche, er weiß um seine Grenzen und spürt seine Abhängigkeiten, er ist in der Lage, Art und Umfang notwendiger Hilfen zur eigenen Lebensgestaltung selbst zu bestimmen.“[111]
Dies bedeutet, dass sich die professionellen Helfer von ihrer defizitorientierten Sichtweise, in der sie sich selbst als Experten und die Menschen mit einer geistigen Behinderung als Patienten gesehen haben, verabschieden müssen und dass sie stattdessen die Rolle des Begleiters annehmen und ihre Klienten als kompetente Experten und Akteure ihrer eigenen Entwicklung bedingungslos unterstützen.
Ihr Blick soll sich auf „soziale Unterstützungsformen und -systeme, die für eine lebensweltorientierte Behindertenarbeit konstitutive Bedeutung haben”[112] konzentrieren. Diese lebensweltorientierte Behindertenarbeit verfolgt nicht das Ziel der reibungslosen Anpassung an gesellschaftliche Normen, sondern die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, verbunden mit gesellschaft-licher Integration, die schließlich den Weg bereiten soll für eine sinnerfüllte Lebensverwirklichung.[113]
Hier wird deutlich, dass sich Empowerment-Prozesse nicht nur auf der individuellen Ebene abspielen, sondern auch auf der Gruppenebene (z.B. durch die Mitarbeit in einer Selbsthilfe-Organisation) und auf der strukturellen Ebene (z.B. durch die Veränderung struktureller Rahmenbedingungen).[114] Diese drei Ebenen stehen in wechselseitiger Abhängigkeit.
Das Empowerment-Konzept impliziert somit auch sozialpolitische Inhalte und ist daher „keine ausschließlich private Angelegenheit sozial benachteiligter Personen, sondern immer auch ein kollektives und gesellschaftlich konfliktträchtiges Unternehmen, das auf Veränderung ‚des Ganzen‘ zielt.“[115]
In Bezug auf den Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung müssen sich die professionellen Helfer in ihrer neuen Rolle als Unterstützer und Begleiter aber auch darüber im Klaren sein, dass Empowerment ein sehr langandauernder Prozess sein kann. Diese Menschen, die teilweise lebenslang fürsorgliche und fremdbestimmte Betreuung erlebt haben und es nicht gewöhnt sind, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken, werden sich nicht von einen Tag auf den anderen zu emanzipierten, selbstbewussten Experten entwickeln.[116] Empowerment bedeutet demnach für die professionellen Helfer, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und die notwendigen Hilfen zur Verfügung zu stellen, so dass „alle Menschen mit geistiger Behinderung zu wesentlich mehr Entscheidungs- und Handlungsautonomie gelangen”[117] können und zielt darauf ab,
„assistierende Hilfe in einer Qualität und Quantität zu organisieren, daß sowohl Möglichkeiten der Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit als auch mehr individuelle Autonomie realisiert werden können. [...] Es sollte eine enthierarchisierte Beziehung angestrebt und nach Möglichkeit auch verwirklicht werden.”[118]
Ebenso sieht auch Norbert Herriger in dem Empowerment-Konzept eine Entwicklung zu einer neuen Kultur des Helfens:
„Grundlage allen pädagogischen Handelns ist hier die Anerkennung der Gleichberechtigung von beruflichem Helfer und Klient, die Konstruktion einer symmetrischen Arbeitsbeziehung also, die auf die Attribute einer bevormundenden Fürsorglichkeit verzichtet, die Verantwortung für den Arbeitskontrakt gleichverteilt und sich auf einen Beziehungsmodus des partnerschaftlichen Aushandelns einläßt."[119]
3.3.2 Assistenz
Menschen mit Behinderungen als »Experten in eigener Sache« zu akzeptieren bedeutet also von einer (teilweise bevormundenden) fürsorglichen Betreuung Abschied zu nehmen und individuelle Unterstützung in Form von persönlicher Assistenz anzubieten.
Das Konzept der persönlichen Assistenz stammt ursprünglich von körperbehinderten Menschen, die bereits in den 70er Jahren im Rahmen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ihre eigenen Vorstellungen über die Formen und über den Umfang von Hilfeleistungen formuliert haben.[120]
Sie forderten, dass ihnen jederzeit ein persönlicher Assistent zur Verfügung steht, durch dessen Dienste es ihnen ermöglicht wird, an allen Bereichen des täglichen Lebens aktiv teilnehmen zu können.
„Wesentlich für das Konzept ‚persönliche Assistenz‘ ist es, dass mit ihr behinderte Menschen ihre gleichberechtigte Teilhabe selbstbestimmt realisieren können, d.h., sie können mindestens über die folgenden fünf Kompetenzen verfügen:
- Personalkompetenz: Sie können sich die Helfer selbst aussuchen.
- Organisationskompetenz: Sie bestimmen über Zeitpunkt und Ablauf der Hilfen.
- Anleitungskompetenz: Als Experten in eigener Sache leiten sie die Helfer an.
- Raumkompetenz: Sie bestimmen über den Ort der Hilfeerbringung.
- Kontrollkompetenz: Sie kontrollieren selbst die korrekte Leistungs-erbringung.“[121]
Grundsätzlich sollen also die persönlichen Assistenten von den Assistenznehmern angeleitet werden. Der behinderte Mensch wird so im Assistenzkonzept zum Arbeitgeber seiner Assistenten, was für die professionellen Helfer, im Gegensatz zum Empowerment-Konzept, „eine eindeutig individuelle Ausrichtung der Arbeit auf einen behinderten Menschen hin“[122] bedeutet.
Menschen mit geistiger Behinderung fällt es oft schwer für sich selbst allein einzuschätzen, wie viel und welche Hilfe sie in den unterschiedlichsten Lebens-situationen benötigen und dementsprechend haben sie dann auch Schwierigkeiten, Anleitungsfunktionen zu übernehmen. Das Konzept der persönlichen Assistenz kann und muss aber grundsätzlich auch in den Beziehungen zu Menschen mit geistiger Behinderung an Bedeutung gewinnen. Allerdings ist das Assistenzkonzept für diesen Personenkreis um Inhalte einer dialogischen Begleitung zu erweitern.[123]
Dies bedeutet, dass sich die Aufgabe der Fachpersonen nicht allein darauf be-schränkt, aufgabenbezogene Assistenzdienste zu erbringen, sondern dass sie „dar-über hinaus als begleitende, verlässliche BeziehungspartnerInnen zur Verfügung“[124] stehen und mit dem Menschen mit geistiger Behinderung in einen Dialog treten. Mit jemanden in einen Dialog treten bedeutet nicht, ihn zu belehren oder gar ihn zu be-vormunden, sondern ihn ernst zu nehmen, seine Positionen und Wünsche zu respek-tieren, ihm zu zuhören („im Sinne eines verstehenden Zuhörens, auch auf nonverbale Signale“[125]), offen zu sein und ihm so viel wie möglich Freiraum zu lassen („im Sinne eines Zulassens von Fehlern, von Experimentieren und Lernen“[126]).
Eine dialogische Begleitung ist demnach also herrschaftsfrei. Im Gegensatz zum geschilderten Verständnis des Assistenzprinzips, nach dem der Begleiter lediglich die Leistungen entsprechend der Anordnungen seiner Arbeitgeber auszuführen hat, verschieben sich diese Machtstrukturen in der dialogischen Begleitung „wieder in Richtung eines dynamischen, beziehungsoffenen `Mittelbereiches΄“[127].
Diese Verschiebung der Machtverhältnisse hat Ulrich Niehoff in dem folgenden Bild der „Waage der Macht“ veranschaulicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Niehoff, 2005, S. 5.
„Das Verhältnis zwischen behinderten Menschen und Alltagsbegleitern ist annähernd egalitär, wobei letztendlich Menschen mit Behinderung mehr Gewicht in die Waagschale bringen, da es um ihr Leben geht.“[128]
In der dialogischen Begleitung ist der Begleiter gefordert, aufmerksam zu sein und zu erforschen, was sein Gegenüber, der Mensch mit geistiger Behinderung will, was er sich wünscht, um dann herauszufinden, welche Dienstleistungen zur Erfüllung dieser Wünsche erforderlich sind. Dies kann sich als fortlaufender, überdauernder Prozess erweisen, der jedoch immer auf Mitsprache basiert und sich nach den Leit-linien der Normalisierung und der Selbstbestimmung ausrichtet. Zu Beginn dieses Prozesses ist es vor allem wichtig, Angebote zu machen und Wahlmöglichkeiten her-zustellen. Wahlmöglichkeiten auch in dem Sinne, sich gegen die Annahme der neuen Angebote zu entscheiden. Dies gilt in besonderem Maße auch im Freizeitbereich: Wer die unterschiedlichen Angebote nicht kennt, kann sie auch nicht erleben und Interesse und Freude daran entwickeln oder eben sich darüber klar werden, dass bspw. ein Theaterbesuch nicht seinen Vorstellungen einer angenehmen Freizeitgestaltung entspricht.[129]
3.3.3 Community Care
Wie schon unter Punkt 3.1 beschrieben, umfasst gesellschaftliche Teilhabe auch den Anspruch ein normales Leben in Regelstrukturen führen zu können und Hilfe dort zu erhalten, wo auch alle anderen Menschen sind. Seit etwa fünf Jahren wird in der Behindertenhilfe das Community Care Modell diskutiert, welches Strukturen schaffen soll, die die Gemeinwesenanbindung und die sozialen Netzwerke[130] von Menschen mit geistiger Behinderung stärken soll. Hinter diesem Modell „steht der Wunsch, dass alle Menschen als Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten in ihrer Gemeinde so autonom bzw. so integriert leben können wie sie es sich wünschen.“[131] Zudem beinhaltet es die Forderung, dass die soziale Gemeinde/Kommune (Community) sich um alle ihre Bürger, also auch um die Bürger mit geistiger Behinderung kümmern (Care) und sich auch für sie verantwortlich fühlen soll. Die Gemeinde darf sich dieser Verantwortung nicht entziehen, indem sie diese Menschen bspw. in Institutionen abschiebt oder die Verantwortung allein dem überörtlichen Sozialhilfeträger zuschreibt.[132]
[...]
[1] Vgl. Fornefeld, 2003, S. 268.
[2] Georg Feuser vertritt den Standpunkt: »Geistigbehinderte gibt es nicht!« und schreibt als Erklärung für diese Formulierung: Sie „ist keine rhetorische Aussage, sondern sehr ernst gemeint. [...] Es gibt Menschen, die WIR (Hervorhebungen im Original) aufgrund UNSERER Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem WIR sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den WIR als ‚geistigbehindert‘ bezeichnen. Geistige Behinderung kennzeichnet für mich [...] einen phänomenologisch-klassifikatorischen Prozeß, also einen Vorgang der Registrierung von an anderen Menschen beobachteten ‚Merkmalen‘, die wir, in Merkmalsklassen zusammengefaßt, zu ‚Eigenschaften‘ des anderen machen.“ Feuser, 1996, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://info.uibk.ac.at/c/c6/bidok/texte/menschenbild.html
[3] Osbahr, 2000, S. 99.
[4] Fischer, 2003, S. 14.
[5]. Vgl. Heimlich, 2003, S. 133. Ulrich Heimlich schreibt weiter dazu: „Nach wie vor wird der Behinderungsbegriff im öffentlichen Raum als personales Merkmal verwendet und bisweilen sogar mit einer Krankheit gleich gesetzt. Menschen ohne Behinderung werden häufig im Gegen-satz dazu gerade von medizinischer Seite als »Gesunde« bezeichnet.“
[6] Fornefeld, 2003, S. 268.
[7] Heimlich, 2003, S. 132.
[8] Eine Behinderung lässt sich so auch als „Ergebnis einer sozialen Ausgrenzung, einer Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe und damit [als, M.L.] Produkt einer sozialen Inter-aktion [betrachten, M.L.].“ Heimlich, 2003, S. 132.
[9] Siehe hierzu auch Fischer, 2003, S. 11-24.
[10] Vgl. Hinz, 1996, S. 144. Die defektologische Haltung entspricht der medizinisch-defizitären Sicht, aus der eine »Geistige Behinderung« als unveränderbarer Zustand betrachtet wird. Die dialogische Haltung dagegen sieht eine »Geistige Behinderung« als einen Prozess, dessen Entwicklung sich „ökologisch in wechselseitigem dynamischen Austausch zwischen inneren und äußeren Be-dingungsfaktoren [vollzieht, M.L.].“ Hinz, 1996, S. 144.
[11] Frank, 2003, S. 22f.
[12] Frank, 2003, S. 23. Vgl. hierzu vor allem auch Feuser: „Ein Menschenbild, das einen beeinträchtigten Menschen biologisch-medizinisch-psychiatrisch für defekt, psychologisch für deviant und pädagogisch für behindert hält, kann in der gesellschaftlichen Praxis nur Aussonderung und Segregierung hervorbringen“. Feuser, 1996, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://info.uibk.ac.at/c/c6/bidok/texte/menschenbild.html.
[13] Vgl. Wüllenweber, 2004, S. 49f.
[14] Vgl. Göthling/Reuter, 2003, S. 5. Zu den weiteren Schwierigkeiten eines Begriffswandels siehe auch Wüllenweber, 2004, S. 50. Auch Ernst Wüllenweber betrachtet die drohende erneute stigmatisierende Auslegung bzw. Verwendung des neuen Begriffs als Hauptargument gegen eine Begriffsänderung. Er führt jedoch noch weitere Probleme an, die ein solche Umbenennung mit sich bringen könnte, wie z.B. „Die interdisziplinäre Kommunikation zwischen Pädagogik, Medizin, Psychologie und Soziologie würde über einen langen Zeitraum erschwert werden, da sich die nichtpädagogischen Fachdisziplinen vermutlich einer Umbezeichnung solange verschließen würden, bis ein einheitlicher Konsens gefunden wird.“
[15] So schreibt bspw. auch Marlis Pörtner: „Notwendig ist, daß sich die Haltung ändert gegenüber Begriffen wie »behindert« - und damit gegenüber den Menschen, die damit bezeichnet werden. Das wirkt der Diskriminierung mehr entgegen als eine Sprache, die zusehends verarmt durch ängstliches Vermeiden von immer mehr Wörtern, die an sich nicht diskriminierend sind, sondern es erst durch die dahinterstehende Haltung werden.“ Pörtner, 2004, S. 15. [Hervorhebungen im Original].
[16] Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 1991, S. 5ff.
[17] Olaf Stahr schreibt hierzu, dass die damalige CDU-FDP Regierung „erst durch zahlreiche Übergriffe von Neo-Nazis gegenüber den Menschen mit Behinderung“ zu dieser Ergänzung bereit war. Stahr, 2005, S. 9.
[18] Dietrich/Lachwitz, 2003, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://www.aktion-grundgesetz.de/archiv/seite__66496.html.
[19] So hat auch der Bundestag im Mai 2000 beschlossen, „dass die Integration von Menschen mit Behinderungen eine dringliche politische und gesellschaftliche Aufgabe ist.“ Bundestagsdrucksache 14/2913; zitiert nach Bericht der Bundesregierung über die Lage behin-derter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe, 2004, S. 16.
[20] Fuchs, 2004, S. 4.
[21] Vgl. SGB IX, 2001, §1: Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft: „Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu ver-meiden oder ihnen entgegenzuwirken.“
[22] Schnath, 2005, S. 41.
[23] Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung, ohne Jahresangabe, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://www.bmgs.bund.de/deu/gra/themen/sicherheit/ teilhabe/index.php.
[24] BGG, 2002, §1.
[25] So beurteilt auch Theo Klauß die Verabschiedung des BGG bezüglich des Lebens von Menschen mit geistiger Behinderung folgendermaßen: „Auch wenn die Auswirkungen am ehesten für Menschen mit körperlichen und Sinnes-Behinderungen spürbar werden dürften, spiegelt sich hier ein gesellschaftlicher Prozess wider, der auch für Menschen mit geistiger Behinderung bedeutsam ist. Sie sind damit sozusagen offiziell in der modernen Bürgergesellschaft angekommen.“ Klauß, 2003, S. 93.
[26] BGG, 2002, §4. Siehe hierzu auch den Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe, 2004, S. 117 und Haack, 2002, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://www.netzwerk-artikel-3.de/news/anliegen.htm.
[27] Ausnahmen sind hier Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen: In diesen drei Bundesländern liegen bislang nur Entwürfe vor, die jedoch teilweise sehr umstritten sind und daher noch nicht in Kraft treten konnten. In Hessen wurde bspw. Ende des vergangenen Jahres ein Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG) verabschiedet, welches seit dem 1. Januar 2005 gültig ist. Zu näheren Informationen über die einzelnen Landesgleichstellungsgesetze siehe: http://wob11.de/gesetze/landesgleichstellungsgesetz.html.
[28] Drewes, 2002, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://www.netzwerk-artikel-3.de/news/einschtzng.htm.
[29] Vgl. Antretter, 2005, S. 1.
[30] Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Umsetzung euro-päischer Antidiskriminierungsrichtlinien ist abrufbar unter der folgenden Internetseite: http://www.spdfraktion.de/rs_datei/0,,4395,00.pdf.
[31] Ausführlicher zu den Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderungen und den verschiedenen soziologischen und psychologischen Erklärungsansätzen für diese Verhaltensweisen siehe Cloerkes, 2001, S. 76ff. und Kreuz, 2002, vor allem S. 43-70. Die Forschungsschwerpunkte der Dissertation von Alexandra Kreuz sind „die Entwicklung und Adaption verschiedener Methoden der Einstellungsmessung, die Analyse von Determinanten der Einstellung gegenüber Menschen mit einer geistigen Behinderung, sowie der Vergleich der Ein-stellung bei verschiedenen Personengruppen.“ Kreuz, 2002, S. 12.
[32] Vgl. Cloerkes, 1999, S. 253f. Ausführlich hierzu siehe Cloerkes, 2001, S. 106-124.
[33] Cloerkes, 1999, S. 256.
[34] Bei der Bewertung dieser so genannten Kontakthypothese muss immer mitberücksichtigt werden, dass sie für alle zwischenmenschlichen Kontakte Gültigkeit besitzt und sich nicht allein auf gezielte Kontakte zu Menschen mit Behinderungen bezieht: „Niemand käme auf die Idee zu glauben, daß jeglicher Kontakt mit anderen auf positiver Grundlage erfolgt oder so angenehm ist, daß man eine distanzierte Grundhaltung spontan aufgibt. Menschen mit Behinderungen sind so unterschiedlich wie andere auch, und sie haben neben ihrer Behinderung Attribute, die wie bei Menschen ohne Behinderungen soziale Beziehungen erschweren können. Bedingungslose soziale Akzeptanz kann nicht das Ziel sein, sondern lediglich eine Akzeptanz, die der Variabilität unter nichtbehinderten Menschen vergleichbar ist! “ Cloerkes, 1999, S. 257. [Hervorhebung im Original].
[35] Vgl. hierzu auch Kreuz, 2002, S. 61.
[36] Vgl. Cloerkes, 1999, S. 258f.
[37] Cloerkes, 2001, S. 124.
[38] Hähner, 2003a, S. 26.
[39] Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2001, S. 12.
[40] Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.2.
[41] Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2001, S. 13. Soweit dieser kurze historische Abriss, siehe ausführlich hierzu Hähner, 2003a, S. 25-51.
[42] Vgl. hierzu Markowetz, 2000a, S. 39: Der Begriff Integration wurde zuerst in der Philosophie verwendet und später dann vor allem auch in der Soziologie und der Psychologie. Siehe hierzu auch Heimlich, 2003, S. 137: „Neben mathematischen (z.B. Integral), politischen (z.B. euro-päische Integration) und sprachwissenschaftlichen Begriffsverwendungen interessieren im päda-gogischen Zusammenhang insbesondere soziologische und psychologische Bedeutungen. Im soziologischen Sinne bezieht sich Integration auf die Entstehung gesellschaftlicher Einheiten aus einer Vielzahl von Personen und Gruppen und bezeichnet vor allem den Zustand, nach dem jemand oder etwas integriert wurde. Damit sind Prozesse der Integration von Menschen aus anderen Kulturen in eine Gesellschaft ebenfalls gemeint. Im psychologischen Sinne bezeichnet Integration in der Regel die Einheit innerhalb einer Person und innerhalb ihrer Beziehungen zur Umwelt.“
[43] Reiser, 2003, S. 305.
[44] Vgl. Feuser, 1996, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://info.uibk.ac.at/c/c6/bidok/ texte/menschenbild.html
[45] Ebert, 2000, S. 11.
[46] Siehe hierzu auch Boban/Hinz, 2003, S. 40ff.; Feuser, 1995, S. 186-200; Hinz, 2003, S. 330ff. und Reiser, 2003, S. 307ff. Der Vorwurf der Segregation und Diskriminierung unter dem Deckmantel der Integration bezieht sich bei diesen vier genannten Autoren vor allem auf die gängige schulische Integrationspraxis. So schreibt bspw. Helmut Reiser: „Sonderpädagogen arbeiten z.B. in Grundschulen mit etikettierten Kindern in besonderen Gruppen, das heißt äußere Differenzierung als versteckte Selektion unter der Firmierung Integration.“ Reiser, 2003, S. 307. Ines Boban und Andreas Hinz äußern sich ähnlich: „Integration hält in der Praxis an einer Zwei-Gruppen-Theorie fest, nach der es die Kinder ohne und mit sonderpädagogischen Förderbedarf und damit letztlich die Kinder und die anderen Kinder [Hervorhebungen im Original] gibt. [...] Mit solcher integrativer Praxis ist zwar die institutionelle Trennung zwischen den Verschiedenen aufgehoben, aber die personenbezogene Trennung in Kopf und Bauch besteht bei den Beteiligten weiterhin. [...] Der Zwei-Gruppen-Theorie folgend werden in der Praxis der Integration bestimmte Kinder administrativ etikettiert und damit als anders stigmatisiert.“ Boban/Hinz, 2003, S. 41.
[47] Vgl. Schulze, 2004, S. 229.
[48] Vgl. Frank, 2003, S. 27.
[49] Heimlich, 2003, S. 142.
[50] Sander, 2003, S. 321.
[51] Vgl. Niehoff, 2002, S. 4.
[52] Schablon, 2001, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung:http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/inst05/abs/Arbeitspapiere/CC/
[53] Andreas Hinz ist einer der deutschen Fachleute, der sich besonders intensiv für das neue Konzept der Inklusion einsetzt. Siehe daher auch seinen im Jahre 2002 veröffentlichten Text „Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?“. In diesem Artikel versucht Hinz, die beiden viel benutzten und doch wenig geklärten Begriffe Integration und Inklusion zu konkretisieren und sie für die deutschsprachige Diskussion fruchtbar zu machen, indem er die konzeptionellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht und die verschiedenen inklusionistischen Kritikpunkte an der Praxisentwicklung der Integration zusammenfasst.
[54] Theunissen, ohne Jahresangabe, S. 6. Internetveröffentlichung: http://www.assista.org/files/ georg_theunissen.pdf.
[55] Vgl. Niehoff, 2004, S. 1f. und Niehoff-Dittmann, 2001, ohne Seitenangabe. Internetver-öffentlichung: http://www.diakoniewerk.at/download/Brosch%FCre01.pdf.
[56] Siehe hierzu Kapitel 3.3.3.
[57] Vgl. Niehoff, 2004, S. 1f. und Niehoff-Dittmann, 2001, ohne Seitenangabe. Internetver-öffentlichung: http://www.diakoniewerk.at/download/Brosch%FCre01.pdf.
[58] Heimlich, 2003, S. 146. [Hervorhebung im Original].
[59] Zu dem Begriff Teilhabe siehe auch Metzler/Rauscher, 2003.
[60] Vgl. Niehoff, 2004, S. 4.
[61] Vgl. Frank, 2003, S. 28ff.
[62] An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass die Einführung des neuen Begriffs Inklusion vor allem aufgrund der Kritik an der teilweise falsch ausgelegten Umsetzung des Integrations-konzeptes in die Praxis erfolgt ist und nicht aufgrund einer generellen Kritik an den Integrations-gedanken.
[63] Cloerkes, 2001, S. 311f.
[64] Entgegen der weit verbreiteten Darstellung, der Normalisierungsgedanke sei erstmalig Ende der 50er Jahre in Dänemark aufgetaucht, führen die Wurzeln des Normalisierungsprinzips allerdings nach Schweden in das Jahr 1943. Dort sollte ein Regierungsausschuss anhand einer Untersuchung herausfinden, „auf welche Art und Weise behinderten Menschen Arbeitsmöglichkeiten erschlossen werden könnten. Normalisierungsprinzip nannte man den sozialpolitischen Gedanken, der für die Arbeit des Ausschusses richtungsweisend war. Es sollte ein Sozial- und Gesundheitswesen geschaffen werden, das behinderten Menschen ein annähernd normales Leben ermöglicht.“ Ommerle, 1999, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://bidok.uibk.ac.at/ library/ommerle-normalisierung. html?hls =Ommerle{NORmalisierung}#ftn.id2964404
[65] Thimm u.a., 1985, S. 5.
[66] Bank-Mikkelsen, 1982; zitiert nach: Ommerle, 1999, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://bidok.uibk.ac.at/library/ommerle-normalisierung.html?hls=Ommerle{NORmalisierung} #ftn.id2964404.
[67] Vgl. Thimm u.a., 1985, S. 6.
[68] Nirje, 1969; zitiert nach: Thimm u.a., 1985, S. 7.
[69] Nirje, 1974; zitiert nach: Seifert, 1997, S. 27. Eine ausführliche Erklärung der Bedeutung dieser acht Bereiche bzw. Bestandteile des Normalisierungsprinzips findet sich bei Nirje/Perrin, 1999, S. 9-21.
[70] Vgl. Seifert, 1997, S. 27.
[71] Vgl. Prösch, 1997, S. 29f.
[72] Vgl. Prösch, 1997, S. 30.
[73] Wolfensberger, 1972; zitiert nach: Thimm u.a., 1985, S. 11.
[74] Vgl. Seifert, 1997, S. 30.
[75] Stöppler, 1999, S. 29.
[76] Adam, 1977; zitiert nach: Seifert, 1997, S. 33.
[77] Vgl. Fornefeld, S. 137.
[78] Dementsprechend schreibt auch Marlis Pörtner, dass Normalisierung nicht dahingehend missverstanden werden darf, „daß über tatsächlich bestehende Behinderungen hinweggesehen wird. Mit nicht wahrhaben wollen ist den betroffenen Menschen nicht geholfen. Vielmehr muß sorgfältig beachtet werden, worin genau bei jeder Person die Einschränkung besteht und wann sie welche Unterstützung braucht, damit ihr ein angemessener Rahmen und größtmöglicher Freiraum geboten werden kann.“ Pörtner, 2003, S. 28f.
[79] Vgl. Thimm u.a., 1985, S. 22 und Stöppler, 1997, S. 30. Siehe zu den Missverständnissen des Normalisierungsprinzips auch Nirje/Perrin, 1999, S. 29-33: „Normalisierung heißt, Leute normal zu machen“; „Spezielle Hilfen sind mit dem Normalisierungsprinzip unvereinbar“, „Nor-malisierung heißt, Leute in ihrer Gemeinde ohne Unterstützung auszusetzen“, „Normalisierung ist ein Alles-oder-nichts-Konzept“, „Normalisierung eignet sich nur für leichter Behinderte“, „Geistig Behinderte sind am besten mit ihresgleichen dran, geschützt vor den Härten der Gesell-schaft“ „Normalisierung ist eine skandinavische Erfindung, die bei uns nicht angewendet werden kann“, „Normalisierung ist zwar ein humanistisches Konzept, aber idealisiert und unpraktisch“.
[80] Seifert, 2003, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung:
http://www.berliner-behindertenzeitung.de/bbz/03-10/031005.htm.
[81] Mühl, 1996, S. 312.
[82] Sack, 2003, S. 105.
[83] Osbahr, 2000, S. 121.
[84] Vgl. Osbahr, 2000, S. 122.
[85] Frehe, 1999; zitiert nach: Bartuschat, 2002, ohne Seitenangabe. Internetveröffentlichung: http://bidok.uibk.ac.at/library/bartuschat-perspektiven.html.
[86] Nach Einschätzung verschiedener Autoren liegen die Ursprünge der Self-Advocacy Bewegung dagegen in Schweden. Dort haben sich in den 60er Jahren Freizeitclubs für Menschen mit geistiger Behinderung, in denen sie größtenteils selbst die Organisation übernommen haben, gegründet. Damit sie die dafür erforderlichen Fähigkeiten erlangen, wurden Kurse angeboten, aus denen heraus die Idee zur Durchführung einer nationalen Konferenz für Menschen mit geistiger Behinderung entstand. Vgl. Rock, 2001, S. 25.
[87] Vgl. Hähner, 2003a, S. 35.
[88] Knust-Potter, 1996, S. 519.
[89] Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe, 1996. Wichtigstes Kongressergebnis, so Johannes Schädler, war die »Duisburger Erklärung«, in der für geistig behinderte Menschen u.a. die Einhaltung der Menschenrechte, Schutz vor Diskriminierung und Ausgrenzung sowie Mitbestimmungs- und Ent-scheidungsrechte bezüglich der Ausgestaltung von Hilfen im Bereich der Schule, des Wohnens, der Arbeit und der Freizeit gefordert wurde.“ Schädler, 2003, S. 120.
[90] Vgl. Rock, 2001, S. 39.
[91] Vgl. Hahn, 1994, S. 81ff.
[92] Vgl. Niehoff-Dittmann, 1996, S. 58 und Pörtner, 2003, S. 131.
[93] Hahn, 1994, S. 87.
[94] Vgl. Pörtner, 2003, S. 131.
[95] Vgl. Theunissen/Plaute, 1995, S. 57ff.
[96] Vgl. Pörtner, 2003, S. 129ff.
[97] Pörtner, 2003, S. 138.
[98] Vgl. Pörtner, 2003, S. 138f.
[99] Vgl. Niehoff-Dittmann, 1996, S. 58f.
[100] Mattke, 2004, S. 305.
[101] Vgl. Mattke, 2004, S. 305f.
[102] Osbahr, 2000, S. 128.
[103] Vgl. Rittmeyer, 2001, S. 144.
[104] Klauß, 2003, S. 93f.
[105] Jeder Mensch hat sicherlich verschiedene Vorstellungen von dem, was eine hohe Lebensqualität ausmacht. Daher lässt sich dieser Begriff nicht genau definieren. Die meisten Definitionen bzw. Definitionsversuche stellen die persönliche Zufriedenheit ins Zentrum. Generell kann man fest-halten, dass die Lebensqualität eng zusammenhängt mit dem eigenen Einfluss, den jeder für sich auf sein eigenes Leben ausüben kann. Siehe hierzu auch Kapitel 3.3.3.
[106] Theunissen/Plaute, 1995, S. 12.
[107] Vgl. Mattner, 2000, S. 93.
[108] Osbahr, 2000, S. 136.
[109] Niehoff, 2003a, S. 180.
[110] Vgl. Osbahr, 2000, S. 136
[111] Hähner, 2003b, S. 130.
[112] Theunissen/Plaute, 1995, S. 18.
[113] Vgl. Theunissen/Plaute, 1995, S. 18f.
[114] Vgl. Theunissen/Plaute, 1995, S. 12.
[115] Theunissen/Plaute, 1995, S. 12.
[116] Siehe hierzu auch Osbahr, 2000, S 136f.;Hähner, 2003b, S. 130f. und Theunissen/Plaute, 1995, S. 19ff.
[117] Theunissen/Plaute, 1995, S. 21.
[118] Theunissen/Plaute, 1995, S. 23.
[119] Herriger, 2002, S. 263.
[120] Vgl. Weber, 2003, S. 5.
[121] Frehe, 2003, S. 2.
[122] Niehoff, 2003b, S. 53. [Hervorhebung im Original].
[123] Vgl. Niehoff, 2003b, S. 54. Ebenso betont auch Erik Weber die hohe Bedeutung des Assistenzkonzeptes im Umgang mit geistig behinderten Menschen und verweist auf die ansonsten drohende Gefahr einer Ausgrenzung: „In solche, die Assistenz einfordern, die die dazu notwendigen Kompetenzen mitbringen, und jene, die dazu scheinbar nicht fähig sind, die dann `assistenzunfähig´ sein würden – eine Abspaltung, die mit dem Auftauchen wichtiger Entwicklungen für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen, die wir behindert nennen, immer wieder aufgetaucht ist: bildungsunfähig, integrationsunfähig, therapieresistent etc.“ Weiter schreibt Weber, dass „auch Menschen, die wir schwer oder schwerst geistig behindert nen-nen, der Assistenz bedürfen, dazu Signale der Anleitung senden können und dass dies in dialogisch-kooperativer Beziehung mit der betreffenden Person entschlüsselt, übersetzt und umgesetzt werden kann.“ Weber, 2003, S. 6f.
[124] Osbahr, 2000, S. 145.
[125] Weber, 2003, S. 19.
[126] Weber, 2003, S. 20.
[127] Osbahr, 2000, S. 146.
[128] Niehoff, 2005, S. 5.
[129] Vgl. Hähner, 2003b, S. 133.
[130] Zu Strategien zur Erstellung und Stärkung von Netzwerken und ihrer Bedeutung für gemeinde-orientierte Integration siehe auch Kardorff, 1999.
[131] Schablon, 2001, ohne Seitenzahl. Internetveröffentlichung: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/inst05/abs/Arbeitspapiere/CC/.
[132] Vgl. Niehoff, 2005, S. 3.
- Arbeit zitieren
- Martina Lübbers (Autor:in), 2005, Freizeit bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Bedeutung und Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71286
Kostenlos Autor werden
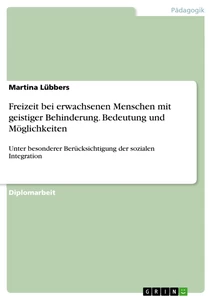

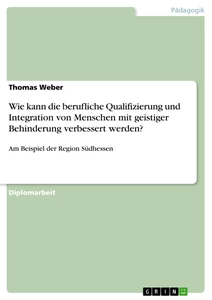

















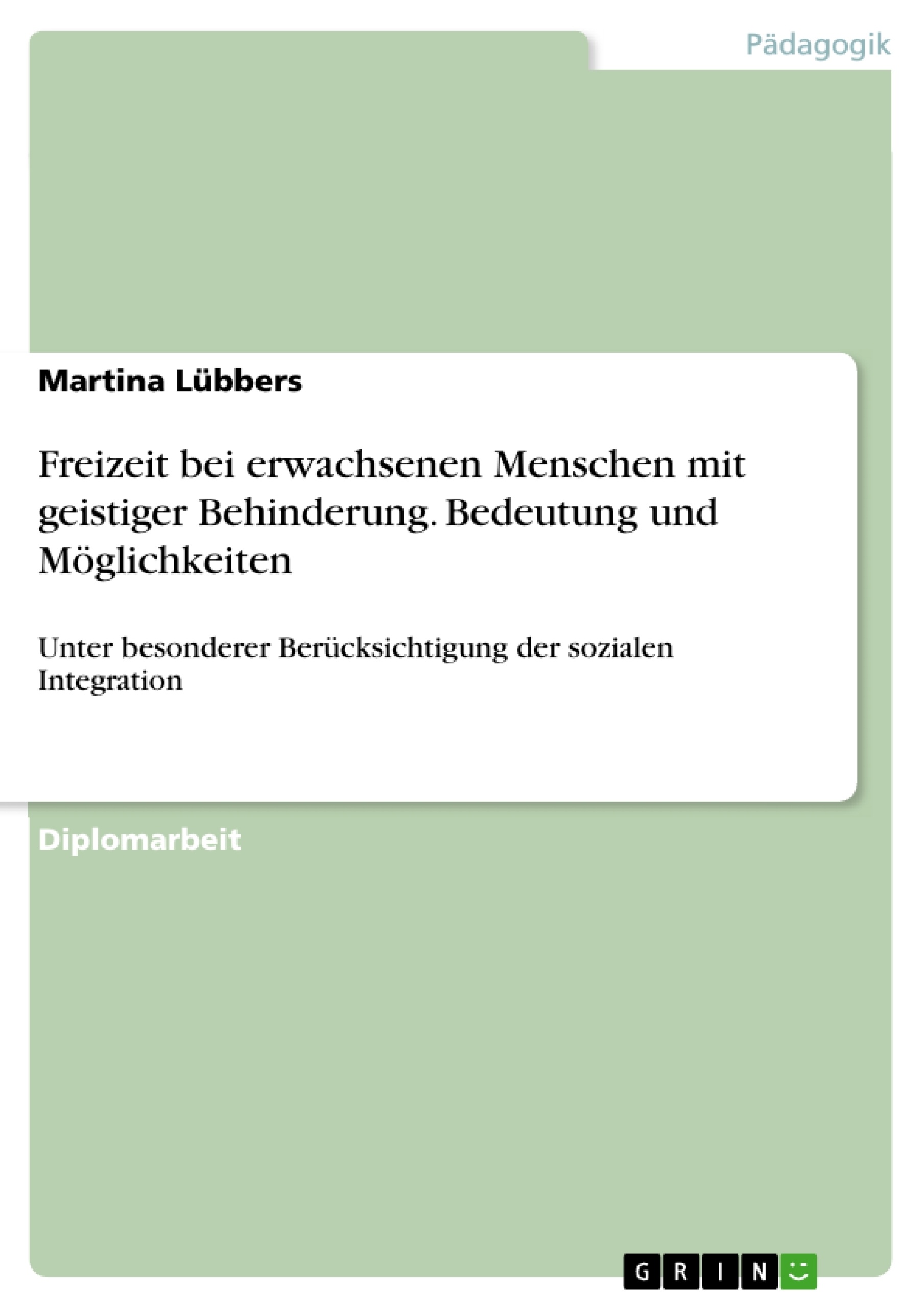

Kommentare