Leseprobe
Gliederung
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Was ist der Standard?
2.2 Die Geschichte
2.2.1 Theodor Siebs
2.2.2 Wilhelm Viëtor
2.2.3 Das Wörterbuch der deutschen Aussprache
2.2.4 Der Aussprache-Duden
2.3 Varianten des Standards
2.3.1 Stilistische Formstufen der Aussprache
2.3.2 Lento- und Prestoformen
2.3.3 Standard versus Dialekt
2.4 Unterschiede in der Aussprache: die Lautschwächungen
2.4.1 Reduktionen und Elisionen
2.4.2 Assimilationen
2.4.3 R-Variationen
2.4.4 Konsonantenschwächungen
2.4.5 Fehlender Glottisschlag
2.4.6 Raffungen und Schwächungen
2.5 Probleme für DaF
2.5.1 Eine Mischung verschiedener Regiolekte
2.5.2 „Ein Deutsch“ versus „mehrere Deutsch“
3 Schlusswort
4 Bibliographie
1 Einleitung
Tag für Tag bedienen wir uns unserer deutschen Muttersprache, ohne uns groß darüber Gedanken zu machen; manchmal suchen wir nach Worten, aber über die Aussprache machen wir uns kaum Sorgen, die „kommt automatisch“. Für einen Ausländer sieht das natürlich ganz anders aus, und schon wer aus einem anderen Dialektgebiet kommt, stockt bisweilen, bevor er ein Wort ausspricht, in der Sorge, vielleicht nicht verstanden oder ausgelacht zu werden. Ich selbst bin in Österreich aufgewachsen, was vom Sprachlichen her in Bayern kein Problem darstellt, doch schon in München muss ich bisweilen innehalten und überlegen, ob ich z.B. Matura oder Abitur sagen muss, rutscht mir für ist mal is‘ und mal isch heraus, und werde ich trotz Bemühung, den Dialekt in Schach zu halten, immer wieder auf meinen österreichischen Akzent angesprochen.
Wäre dieser nun sehr hinderlich dabei, einem Ausländer die deutsche Sprache zu vermitteln? Muss man zu diesem Zweck in allen Situationen wie ein norddeutscher Nachrichtensprecher im Fernsehen sprechen (dessen Akzent in Österreich stark „piefke“-mäßig markiert wäre)? Oder darf man den eigenen Standard lehren und beispielsweise für König die Aussprache ['kø:nIk] statt ['kø:nIç] lehren? Was ist überhaupt der Aussprachestandard des Deutschen, und inwieweit wird er entsprechend realisiert? Gibt es nur einen Standard, der für DaF-Lerner geeignet wäre, oder mehrere?
Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir zunächst den Standard und seine Gültigkeit betrachten, ferner seine Varianten in Stil, Situation und Region, um dann zu sehen, welche Konsequenzen sich für die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache daraus ergeben.
2 Hauptteil
2.1 Was ist der Standard?
Um zu untersuchen, inwieweit die tatsächlich gesprochene Gebrauchsnorm vom gesetzten Standard abweicht, müssen wir zuerst einmal klären, was unter diesem Standard überhaupt zu verstehen ist. Das ist für das Deutsche nicht ganz einfach, da teilweise beispielsweise für Österreich und die Schweiz ein anderer Standard gilt als für Deutschland, doch finden wir in Lehr- und Nachschlagewerken (Aussprache-Duden) eine fixierte Aussprachenorm, die uns als Grundlage unserer Betrachtungen dienen mag.
An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass „Standardaussprache“ keinesfalls das ist, was allgemein gesprochen wird, sondern das Ideal, das für eine mustergültige Ausspracheform erreicht werden sollte. Sie sollte also folgende Eigenschaften aufweisen:
a) Überregionalität und Einheitlichkeit:
- Sie wird im gesamten Sprachraum als Standard akzeptiert und von vielen Sprachbenutzern emotional positiv bewertet, so dass sie als sprachidentitätsgebendes Merkmal für eine Nation oder Kulturgemeinschaft dienen kann;
- die Herkunft des Sprechers, der sich ihrer bedient, ist nicht aus der Aussprache erkennbar;
- sie wird bei Anwendung der Standardsprache in öffentlichen Bereichen verwendet;
- dialektale oder umgangssprachliche Varianten werden ausgeblendet oder auf ein Mindestmaß beschränkt;
b) Deutlichkeit:
- Die Laute werden stärker unterschieden als in der Norm (d.h. wechselseitige Erwartungen zwischen Sprecher und Hörer) der Umgangssprache;
- Sie ist schriftnah, wird also weitgehend durch das Schriftbild bestimmt; kontextbedingte Assimilationen werden minimiert.
c) Bei alledem sollte sie sich nicht allzusehr von der Sprechwirklichkeit entfernen und auch in nicht überformellem Kontext gebrauchbar sein.
2.2 Die Geschichte
Die Standardisierung der deutschen Sprache zog sich über Jahrhunderte hin, doch ging es stets in erster Linie um eine Normierung des Schriftstandards. Erst spät im internationalen Vergleich (etwa zu England oder Frankreich), nämlich im 19. Jhdt., tauchte die Frage auf, wie denn das Schriftdeutsche, dessen Orthographie mit dem Erscheinen des ersten Duden 1880 geregelt worden war, nun im Zweifelsfalle mündlich zu realisieren sei. Hier machten sich vor allem die Germanisten Theodor Siebs und Wilhelm Viëtor verdient, denen wir die ersten Ausspracheregelwerke für das Deutsche verdanken. Dabei hatten beide einen grundlegend verschiedenen Zugang zu ihrem Vorhaben, einen gemeindeutschen Aussprachestandard zu schaffen.
2.2.1 Theodor Siebs
Siebs arbeitete mit einer Kommission zusammen, die sich aus Sprachforschern und Bühnenleitern zusammensetzte, und die erarbeitete Norm verstand sich in erster Linie als Beschreibung des Bühnenstandards, jedoch auch bereits als Vorgabe für die Aussprache des Deutschen in Zweifelsfällen und in Situationen, in denen die Realisierung einer neutral hochdeutschen Aussprache unabdingbar ist, wie etwa bei öffentlichen Reden. Man muss sich dazu vor Augen halten, dass an Schauspieler und Redner damals ganz andere Anforderungen gestellt wurden als heute, vor allem aufgrund der Tatsache, dass es noch keine Mikrofone gab: Um bis in die letzten Reihen verstanden zu werden, war nicht nur eine laute Stimme, sondern auch eine möglichst klare Aussprache vonnöten, so dass die als Vorbild dienende Theaternorm übertriebene und künstlich wirkende Deutlichkeit aufwies, die sogenannte Überartikulation.
Siebs‘ 1898 erscheinendes Werk trug den Titel Deutsche Bühnenaussprache, und bis zum heutigen Tag sind davon 18 Neuauflagen erschienen, die letzte (19. überarbeitete Wiederauflage) im Jahre 2000 – trotz der offensichtlichen Tatsache, dass die dargestellte Norm in vielen Aspekten realitätsfern ist und selbst zur Zeit ihrer Entstehung nicht einmal von Berufssprechern zu 100% so realisiert wurde.
Als Vorbild dienten die Theaterbühnen Berlins, denn zu jener Zeit lag der kulturpolitische Mittelpunkt Deutschlands in Preußen, woraus sich erklärt, dass der heute geltende Standard eine „hochdeutsche Sprachform in niederdeutscher Aussprache“ (W. Viëtor) ist.[1] Gefordert wurden größtmögliche Deutlichkeit (die sich am Schriftbild orientierte[2] ) und Unveränderlichkeit der Einzellaute, unabhängig von Redesituation oder Kontext. So durfte zum Beispiel Anklage nicht als ['aNkla:g´] ausgesprochen werden, sondern nur als ['ankla:g´], und für das R gar forderte Siebs in jeder Position die Realisierung als gerolltes Zungenspitzen-R [r], während ihm das uvulare Rachen-R [{] bzw. [“] oder gar die Vokalisation [å] in der Endsilbe -er oder nach langem Vokal ein Dorn im Auge waren.
Trotz kritischer Stimmen setzte sich der Siebs als Standard durch und bildete jahrzehntelang die Grundlage für die Sprachausbildung für Bühne und Schule.
In den folgenden Neuauflagen wich das Werk nicht von seinen Vorschriften ab, führte jedoch mit der 19. Auflage von 1969 neben der Bühnenaussprache, der sogenannten „reinen Hochlautung“, eine „gemäßigte Hochlautung“ ein, die einige umgangssprachlich allgemein auftretende Erscheinungen wie etwa die Endsilbenreduktion unter Ausfall des Schwa oder die Realisation des /r/ als Zäpfchen-R erlaubte. Ein „Österreichisches Beiblatt“ erkannte für die Endsilbe -ig die Aussprache [Ik] statt [Iç] an, und auch andere regional bedingte Varianten wurden beschrieben, um eine größere überlandschaftliche Varianz abzubilden.
An einigen Stellen gingen die Vorschriften für die gemäßigte Hochlautung sogar schon zu weit: So wurde für die Lenes /b d g/, anders als in der reinen Hochlautung, die generell stimmhafte Realisierung vorschreibt, generelle Stimmlosigkeit postuliert – was phonetischen Untersuchungsergebnissen widerspricht, die Stimmlosigkeit nach Sprechpause und stimmlosen Konsonanten, für alle anderen Fälle jedoch Stimmhaftigkeit konstatiert hatten. Wie die vorhergehenden Auflagen stieß daher auch die Neuauflage auf massive Kritik, bemängelt wurden Realitätsferne und z.T. willkürliche Ausspracheregelungen. Dennoch war der Siebs lange Zeit die Autorität in Fragen der Aussprache, und selbst heute noch ist er nicht ganz vergessen – wie man an der Neuausgabe der 19. Auflage im Jahre 2000 erkennt!
[...]
[1] Wenn Viëtor von niederdeutschen Lauten spricht, so bezieht er sich v.a. auf die Frikative und Plosive, die nicht nur durch unterschiedliche Spannung, sondern auch durch Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit unterschieden werden, eine Differenzierung, die wir im oberdeutschen Sprachraum weitaus seltener vorfinden. Der Siebs (1957) führt die „sprachgeschichtliche Tatsache“ an, „dass die hochdeutsche Schriftsprache im wesentlichen auf ostmitteldeutscher Grundlage beruht, also einen hochdeutschen Lautstand hat, dass sie aber in der Aussprache in der Regel die niederdeutschen Lautwerte bevorzugt, jedoch die Einmischung reiner Dialektformen nicht duldet.“ (S. 17) Gründe dafür sind einerseits die oben erwähnte Vorrangstellung Preußens, andererseits die im Norden immer noch vorherrschenden niederdeutschen Dialekte, aufgrund derer das Hochdeutsche lange wie eine Fremdsprache artikuliert wurde, d.h. mit genau den Lautdistinktionen, die das Schriftbild vorgibt.
[2] Der Siebs (1957) selber macht dazu zwar die Anmerkung: „Besonders wichtig war der Grundsatz, dass die Schreibung kein Maßstab für die Aussprache sein könne. Denn überall ist der Laut das Ursprüngliche, die Schrift das Spätere,“ und „Unsere Rechtschreibung ist ein Gemisch von Tradition und willkürlicher Regelung, das niemals als Wegleiter für unsere heutige Aussprache dienen kann,“ (S. 18f) doch bezieht er das in erster Linie auf Konventionen wie die Aussprache von st- und sp- als [∫t] und [∫p], von ch- als [ç] oder [x] oder von ie als einfaches langes [i:]; im Gegensatz dazu gibt er selber zu, dass „in einzelnen Fällen das Schriftbild die Aussprache tatsächlich beeinflusst hat“ (S. 19), verweisend vor allem auf die Aussprache des langen /e/ als [e:] oder [e:], die in vielen Fällen auf dem Schriftbild beruht, welches wiederum weniger nach aussprachegeschichtlichen Kriterien als nach Kriterien der Wortverwandtschaft (die oft nicht einmal korrekt erkannt wurde) festgelegt wurde: So schreibt man Mann, Männer, aber Hand, behende (was nun freilich die Rechtschreibreform in behände umgewandelt hat) und alt, Eltern, und „es ist Tatsache, dass die Aussprache der Gebildeten in Deutschland vielfach von diesen Regeln bestimmt worden ist.“ (S. 40) Die oben erwähnte sich am Schriftbild orientierende Deutlichkeit bezieht sich hingegen mehr auf den niedrigen Grad der zugelassenen Assimilationen, d.h. stets volle Artikulation sämtlicher geschriebener Buchstaben.
- Arbeit zitieren
- M.A. Friederike Kleinknecht (Autor:in), 2003, Gesprochenes Deutsch und deutsche Standardaussprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70673
Kostenlos Autor werden












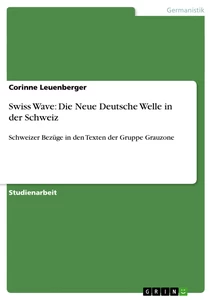










Kommentare