Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffsklärung
2.1 Kultur
2.2 Kulturelle Identität
2.3 Multikulturelle Gesellschaft
3. Interkulturelles Lernen
3.1 Interkulturelles Lernen als Teil sozialen Lernens
3.2 Die Entstehung der Konzeptionen
3.3 Zwei Grundrichtungen: Begegnungspädagogik und Konfliktpädagogik
3.3.1 Universalismus vs. Relativismus
3.3.2 Zur Annäherung an eine Lösung der Universalisum-Relativismus-Debatte
3.4 Die Ziele interkulturellen Lernens
3.4.1 Entdecken des Fremden im Eigenen und des Eigenen im Fremden
3.4.1.1 Das Fremde
3.4.1.2 Selbstbild und Fremdbild
3.4.1.3 Umgang mit dem Fremden
3.4.2 Aufgeklärter Ethnozentrismus
3.4.3 Erkennen von Vorurteilen und Stereotypen
3.4.3.1 Was sind Vorurteile?
3.4.3.2 Erklärungsansätze für die Entstehung von Vorurteilen
3.4.4 (Interkulturelle) Kommunikationsfähigkeit
3.4.4.1 Kommunikation als soziale Situation
3.4.4.2 Nonverbale Kommunikation
3.4.4.3 Verständnisprobleme
3.4.4.4 Metakommunikation
3.4.5 Konfliktfähigkeit
3.5 Die Grenzen interkulturellen Lernens
4. Theater als interkultureller Lernort
4.1 Theater
4.1.1 Spiel und Realität
4.1.2 Der Symbolcharakter des Theaters
4.2 Theaterpädagogik im Spannungsfeld von Pädagogik und Kunst
4.2.1 Theater und Pädagogik: Eine positive Dialektik?
4.2.2 Theaterpädagogik als Teil der Kulturarbeit
4.3 Erfahrungsmöglichkeiten in der (interkulturellen)
Theaterarbeit
4.3.1 Theater als ästhetisches Erfahrungsfeld
4.3.1.1 Zur Bestimmung einer „Ästhetischen Bildung“
4.3.1.2 Theaterspiel als ästhetische Praxis
4.3.2 Theater als (psycho-)soziales Erfahrungsfeld
4.3.2.1 Erfahrung des Subjekts mit sich selbst
4.3.2.2 Erfahrungen des Subjekts mit der Gruppe
4.3.2.3 Erfahrungen des Subjekts mit seiner Lebenswelt
4.3.3 Zusammenspiel der Dimensionen
4.4 Zusammenfassendes: ästhetische Erfahrungen, (psycho-)soziale Erfahrungen und interkulturelle Lernprozesse durch Theaterarbeit
5. Schlußbemerkungen: Überlegung zu einer Übertragbarkeit der Ergebnisse in die theaterpädagogische Praxis
Literatur
1. Einleitung
In einer pluralen Gesellschaft, die durch das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Norm- und Wertvorstellungen geprägt ist,[1] stellt sich die Frage: Wie ist dieses Zusammenleben zu optimieren, d.h. wie können Wege der Verständigung und des Vorurteilsabbaus gefunden werden, um ein friedliches Miteinander zu garantieren? Mit diesen Aufgaben befaßt sich die Pädagogik intensiv seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts, angefangen bei der „Ausländerpädagogik“ bis hin zu aktuellen Konzepten interkultureller Erziehung. Letztere lassen sich zwei Grundrichtungen zuordnen: der Konfliktpädagogik und der Begegnungspädagogik. In der Auseinandersetzung mit diesen beiden Positionen stößt man schnell auf die immer wieder aktuelle Relativismus-Universalismus-Debatte, in der Kulturen entweder als einzigartig und somit unvergleichbar angesehen werden, oder allen Kulturen universalistische Gemeinsamkeiten unterstellt werden, die es hervorzubringen gilt. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ich werde in Anlehnung an Wimmer (1997) und Schaller (1978) bzw. Ostertag (2001) einen Vorschlag wagen und auf die Wichtigkeit interkultureller Kommunikation bzw. des interkulturellen Dialogs aufmerksam machen.
Da ich mich berufsbedingt seit längerem mit theaterpädagogischen Methoden und Projekten befasse, möchte ich in der vorliegenden Arbeit untersuchen, ob das Theater als Kommunikations- und Erfahrungsmedium einen Beitrag zum interkulturellen Lernen bzw. zum interkulturellen Dialog zu leisten vermag und wo seine Grenzen diesbezüglich liegen. Mit „Dialog“ ist in diesem Zusammenhang nicht allein der verbale Austausch von Zeichen zwischen zwei Kommunikationspartnern gemeint, sondern auch – bzw. besonders – der Austausch über (gemeinsame) emotionale, sinnliche und ästhetische Erfahrungen auf einer nonverbalen Ebene.
Es geht mir in dieser Arbeit weniger um die Auseinandersetzung mit verschiedenen kulturellen Theaterformen und deren Rezeption durch ein Publikum, dem diese Formen fremd sind und welches auf diese Art auch in einen Prozeß des interkulturellen Lernens eintaucht. Mir geht es vielmehr um die pädagogische Arbeit mit LaienschauspielerInnen, welche durch ihr Zusammenkommen in einer Gruppe den Kontext als interkulturell definieren: Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen entwickeln ein gemeinsames Theaterstück, welches nicht gezwungenermaßen auch Interkulturalität zum Thema haben muß. Natürlich ist es möglich, sich im Theaterspiel mit Vorurteilen, Unterschieden und Gemeinsamkeiten direkt auseinanderzusetzen, doch auch das gemeinsame Arbeiten an einem Stück und das Verkörpern einer fremden Rolle im mimetischen Prozeß halten schon vielfältige ästhetische und soziale Erfahrungsmöglichkeiten bereit. Unterschiede und Gemeinsamkeiten erscheinen von ganz allein.
Die zu untersuchende These lautet demnach:
In interkulturellen Theaterprojekten mit LaiendarstellerInnen werden über die ästhetische Beschäftigung mit theatralem Material (psycho-)soziale Erfahrungen in Gang gesetzt, die Lernprozesse i.S.d. interkulturellen Erziehung ermöglichen können.
Um zu untersuchen, ob diese These zutrifft, ist es notwendig, die Ziele interkulturellen Lernens mit den möglichen Erfahrungsprozessen im theaterpädagogischen Prozeß zu vergleichen. Hierfür habe ich fünf Ziele interkulturellen Lernens exemplarisch ausgewählt, welche ich am ehesten durch theaterpädagogische Arbeit verwirklicht sehe (siehe Kapitel 3). Ich stütze mich hier u.a. auf die Ausführungen Niekes (2000). Für die Auseinandersetzung mit theatralen Erfahrungsprozessen bietet Weintz (2003) mit seinem Buch Theaterpädagogik und Schauspielkunst die Grundlage meiner Argumentation (siehe Kapitel 4). Dieser postuliert, daß alle ästhetischen Erfahrungen sowohl einen Kunst-, als auch einen Subjekt- und einen Sozialbezug haben. Diese drei Dimensionen finden sich in jedem Theaterprojekt wieder, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung in den jeweiligen Phasen. Ebenso wie Weintz teile ich die Erfahrungsmöglichkeiten in der Theaterarbeit in eine ästhetische und eine (psycho-)soziale Ebene ein. Letztere differenziere ich in die Ebene der Erfahrungen des Subjekts mit sich selbst, in die der Erfahrungen des Subjekts mit der Gruppe und in die der Erfahrungen des Subjekts mit seiner Lebenswelt.
Theater ist in der Lage, emotionale, ästhetische und soziale Erfahrungen auf der (intra-)subjektiven, wie auch der gruppendynamischen Ebene zuzulassen und das in dem sicheren, sanktionsfreien Raum des Spiels. Sting (1994) sieht die Chance zu künstlerischen wie auch soziokulturellen Lernprozessen in Theaterprojekten gegeben:
„Im theaterpädagogischen Prozeß entstehen aus der ästhetischen Suche und unmittelbaren Spielfreude der Beteiligten neben hoffentlich ausdrucksstarken Theaterbildern auch intensive Gruppenprozesse; beides verbindet sich im Idealfall im gemeinsamen Theatererlebnis“ (S. 94).
Dies gilt meiner Meinung nach auch für den interkulturellen Kontext, da mit Symbolen der unterschiedlichen Kulturen experimentiert und spielerisch umgegangen wird und durch die intensive Auseinandersetzung mit einer fremden Rolle das eigene und fremde Rollenbild hinterfragt werden kann.
Obwohl ich soziale Lernmöglichkeiten im Theaterprozeß sehe, wende ich mich doch gegen eine völlige Pädagogisierung des Theaters und eine Vernachlässigung des künstlerischen Anspruchs. Ich möchte zeigen, daß gerade die Verbindung beider Seiten die Theaterarbeit so fruchtbar für den einzelnen und die Gruppe macht. „In diesem Sinne geht es also um [...] Theater in pädagogischen Zusammenhängen, bei dem sich die pädagogischen Ziele aus anderen, insbesondere ästhetischen Orientierungen ergeben und entwickeln“ (Vaßen 1997, S. 62). Mir geht es darum, deutlich zu machen, daß heutige Theaterpädagogik sowohl der Kunstform „Theater“ als auch pädagogischen Zielsetzungen Rechnung tragen muß.
Da ich die Möglichkeiten des Theaters, einen Beitrag zu interkulturellen Lern- und Erfahrungsprozessen zu liefern, hauptsächlich auf einer theoretischen Ebene reflektiere, müssen natürlich auch die Bedingungen für eine Übertragung in die theaterpädagogische Praxis beachtet werden. Wo stößt das Theater hier an seine Grenzen? Die hierfür herangezogenen Argumente stammen teilweise aus meiner eigenen praktischen theaterpädagogischen Arbeit.
2. Begriffsklärung
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Theater und interkulturelles Lernen erfordert zunächst die Klärung verschiedener Begriffe und Hintergründe, die zum Verständnis dieser Arbeit von Bedeutung sind. Zum einen ist zu untersuchen, was überhaupt mit „Kultur“ gemeint ist und welche Konsequenzen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur für ein Individuum hat, d.h. wie sie sich in der Identität einer Person manifestiert. Diesen Fragen werde ich mich in Kapitel 2.1 und 2.2 widmen. Des weiteren soll untersucht werden, welche Bedeutung der Begriff „multikulturelle Gesellschaft“ für den Kontext des interkulturellen Lernens besitzt. Dieser Ausdruck bleibt in vielen Arbeiten zu interkultureller Erziehung oder interkulturellem Lernen uneindeutig: Eine multikulturelle Gesellschaft – ob als Wunschvorstellung oder Zustandsbeschreibung – erfordert immer die Notwendigkeit, Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft ein gerechtes Zusammenleben zu ermöglichen, den produktiven Diskurs über Befremdung und interkulturelle Konflikte anzuregen, aber auch die Chancen und Bereicherungen kultureller Vielfalt aufzuzeigen. Demnach möchte ich folgendes untersuchen:
- Ist eine „multikulturelle Gesellschaft“ die Zustandsbeschreibung einer pluralen Gesellschaft und die Notwendigkeit zur interkulturellen Verständigung somit die Konsequenz daraus?
- Oder ist sie Zielperspektive einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft, die durch Einwanderung und plurale Lebensformen geprägt ist und bedarf ihre Verwirklichung noch der Unterstützung von Pädagogik und Politik?
Diese Diskussion werde ich in Kapitel 2.3 vorstellen.[2]
2.1 Kultur
Von unzähligen Vorschlägen, die sich einer Definition von „Kultur“ annähern, finde ich die Interpretation von v. Bernstorff und Plate (1997) überzeugend. Sie bezeichnen Kultur als „die symbolische Dimension des sozialen Lebens“ (dies., S. 52). Dies meint, daß sich Kultur in Handlungsmustern und Orientierungsweisen einer Gesellschaft offenbart und daß diese sich im sozialen Miteinander, in Kommunikations- und Interaktionsprozessen manifestieren. Den beiden Autorinnen ist es wichtig, daß Kultur nicht an der Zugehörigkeit zu einer Nation festgemacht werden kann, sondern daß sich Kultur im Handeln und Verstehen im Alltag äußert. „Unser Kulturbegriff geht von der Existenz mannigfaltiger Kulturen aus, unabhängig von nationalstaatlichen Grenzen“ (dies., S.47). Demzufolge eignet sich der Mensch die Welt innerhalb eines bestimmten sozialen Umfeldes an, welches durch die Symbole, Deutungs- und Orientierungsmuster der gesellschaftlichen Systeme und Institutionen geprägt ist. Sicherlich spielt die Nation in diesem Kontext gleichfalls eine große Rolle, nämlich insofern deren Institutionen und Systeme zu einem Großteil in einem nationalstaatlichen Rahmen organisiert sind.
„Es geht also nicht darum, die Zusammenhänge von Nation und Kultur zu leugnen, sondern darum, sie differenziert zu betrachten. Eine eindimensionale Gleichsetzung von Herkunft und kultureller Identität würde der Komplexität des Zusammenhanges von Nation und Identität nicht gerecht“ (dies., S. 53).
Eine weitere wichtige Dimension von Kultur ist ihre Prozeßhaftigkeit. Deutungen und Handlungsmuster einer Gesellschaft sind immer abhängig von gesellschaftlichem und geschichtlichem Wandel. Allein die Tradierung von Normen und Werten ist immer Veränderungen unterworfen, d.h. sie ist keine Eins-zu-eins-Reproduktion. Nieke (2000) begründet kleine Veränderungen in der Internalisierung von Orientierungs- und Handlungsmustern durch die nachfolgenden Generationen mit der „Bewältigung neuer Anforderungen“ (ders., S. 44), die eine Gesellschaft im Laufe der Entwicklung an ihre Mitglieder stellt.
Nieke integriert in seinen Kulturbegriff sowohl die Symbolhaftigkeit von Kultur als auch die Schöpfungen, die der Mensch innerhalb eines kulturellen Systems hervorbringt: „Kultur ist die Gesamtheit der kollektiven Deutungsmuster einer Lebenswelt (einschließlich materieller Manifestationen)“ (ders., S. 50). Durch den Begriff Lebenswelt betont Nieke, daß für einen Menschen die gegenwärtige Lebenssituation als Identitätsstifter ausschlaggebender ist als seine Herkunftskultur (vgl. Ostertag 2001, S.75).
Auch Heringer (2004) betont, daß das Wichtigste einer Kultur gemeinsames Wissen und Handeln ist:
„Kultur ist entstanden, sie ist geworden in gemeinsamen menschlichen Handeln. Nicht, dass sie gewollt wurde. Sie ist vielmehr ein Produkt der Unsichtbaren Hand. Sie ist ein Potenzial für gemeinsames sinnträchtiges Handeln. Aber das Potenzial zeigt sich nur in der Performanz, im Vollzug. Und es ist entstanden über Performanz“ (ders., S. 107).
Kimmerles (1997) Verständnis von Kultur beinhaltet sowohl ihre innere Struktur, als auch ihre Stellung zu anderen Kulturen: „Ich möchte Kultur als die Organisation einer menschlichen Gemeinschaft definieren, durch die sich diese zusammen mit anderen Gemeinschaften und inmitten der Natur dauerhaft im Sein erhalten kann“ (ders., S. 98, Hervorheb. im Original).
2.2 Kulturelle Identität
„Identität in ihrem ursprünglichen, psychologischen und soziologischen Sinne war [...] immer schon nur ein Konstrukt zur Beschreibung der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt“ (Losche 2003, S. 19). Auch Weintz (2003) betont die Verbindung zwischen sozialen und subjektiven Faktoren bei der Identitätsbildung. „[...] Bei der Ich-Werdung [sind] Individuum und Sozietät, subjektives Handeln und objektive gesellschaftliche Strukturen als zwei nicht aufhebbare Dimensionen dynamisch aufeinander bezogen“ (ders., S. 68f.). Da die Gesellschaft (Umwelt) jedoch einer ständigen Veränderung unterworfen ist, muß man nun auch von einem dynamischen Identitätsbegriff ausgehen, wenn Identität der Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft sein soll (vgl. Losche 2003, S. 19). In einer pluralen Gesellschaft gibt es durch den Wegfall ehemals selbstverständlicher Normierungen, Traditionen und religiöser Vorschriften zwar oftmals eine große Entscheidungsfreiheit für das einzelne Individuum, doch kann dies auch den Verlust an Sicherheit und Eindeutigkeit bedeuten (vgl. Cloer 1999, S. 27). Die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten ist somit einerseits eine Chance für individuelles Handeln und Selbstverwirklichung, andererseits auch eine große Herausforderung für autonome Ich-Leistungen (vgl. ders., S. 30), da man sich ständig fragen muß: Was ist in dieser Situation richtig? Welche Alternativen gibt es? Wie muß ich mich verhalten, um mein Ziel zu erreichen? So muß das Subjekt aus den zahlreichen Identifikationsangeboten für sich passende Elemente (Teil-Identitäten) auswählen, um daraus eine stimmige Collage zu formen.
„Die tägliche Bricolage-Arbeit an der eigenen, multiplen Identität ist somit hinsichtlich der vorgegebenen ,Materialien’ und ,Werkzeuge’ immer durch die Gesellschaft mit geprägt, auch wenn sie den sozialen Oktrois in begrenzter Form Paroli bieten kann“ (Weintz 2003, S. 75).
Gleichzeitig wird das Subjekt dadurch aber auch flexibler und kreativer im Umgang mit neuen Einflüssen (vgl. Sting 1999, S. 6). Identität kann somit als Selbstkonzept (Bild der eigenen Persönlichkeit) beschrieben werden, welches durch Stabilität und Wandelbarkeit gekennzeichnet ist (vgl. Weintz 2003, S. 69).[3]
Was macht aber nun die kulturelle Identität eines Menschen aus? In der heutigen Gesellschaft, die von Migrationsbewegungen und globaler Vernetzung[4] gekennzeichnet ist, erweist sich auch die kulturelle Identität als „Bastel-Identität“ (vgl. Sting 1999, S. 6).
„Der Bastler geht von dem aus, was er findet, er strukturiert, gruppiert, wertet Reste und Fundsachen um, sein ,Werk’ ist fragmentarisch, weist Brüche und Unzulänglichkeiten auf, die weniger stören, denn neue Einfälle provozieren. Identität als Bricolage - anders ist sie in einer multikulturellen Gesellschaft nicht vorstellbar“ (Krings 1990, S. 19).
Es wird z.B. auch heute noch „die türkische Kultur“ verallgemeinert, obwohl sich in Deutschland längst Immigrationskulturen gebildet haben, die sich stark von „der Herkunftskultur“[5] unterscheiden. Und auch diese Immigrationskulturen sind nicht in sich homogen. Geschlecht, Alter, Bildung - dies alles spielt, neben der ethnischen Herkunft, eine Rolle für die Identitätsbildung der Menschen. Kulturzugehörigkeit läßt sich kaum an äußeren Merkmalen festmachen. Hautfarbe, Sprache oder Kleidungsstil sind Kategorien, die nicht eindeutig bestimmten Kulturen zugeordnet werden können. Hohmann (1983) konstatiert, daß „[...] das eigentlich Gemeinte nicht in der nach außen hin unmittelbaren Darstellung von Kultur [liegt], sondern in der Bedeutung, die sie für den Menschen, für sein Verhältnis zur Welt und zum Mitmenschen hat“ (ders., S. 15, zitiert in: Nieke 2000, S. 46).
V. Bernstorff und Plate (1997) schlagen vor, die kulturelle Identität mit der von Goffman benannten sozialen Identität gleichzusetzen, d.h. sie nicht an die nationalstaatliche Herkunft einer Person zu binden, sondern als Bestandteil der Ich-Identität anzunehmen (vgl. dies., S. 53). Nach Goffman besteht eben diese Ich-Identität aus zwei Polen: der personalen Identität (dem Bewußtsein über die Einzigartigkeit der eigenen Person) und der sozialen Identität (dem Bewußtsein darüber, daß viele andere Menschen genauso sind wie man selbst) (vgl. dies., S. 52). Führt man diesen Gedanken nun zu Ende, bedeutet kulturelle Identität, daß man sich darüber bewußt ist, mit einer bestimmten Anzahl anderer Personen eine Schnittmenge an Symbolen, Vorstellungen, Deutungen und Handlungsmustern zu teilen, die jedoch wandelbar und prozeßhaft sein können. Diese Schnittmenge basiert auf einer gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft, auf kollektiven Erfahrungen einer Gesellschaft.
„Im Gegensatz [...] [zur kulturellen Identität, C.R.] steht eine nationale Identität, die durch oft willkürliche (kriegerisch erzwungene) Staatsgrenzen gekennzeichnet ist und ihre Inhalte u.a. aus (politischen) Systemen, Institutionen, Symbolen und Rechtsansprüchen zieht“ (Losche 2003, S. 20).
2.3 Multikulturelle Gesellschaft
„Die einen beschwören sie als eine Bedrohung für die Ordnung [...]. Die anderen sehen in ihr eine erstrebenswerte [...] Gesellschaftsform. Wieder andere lehnen die Vorstellung einer multikulturellen Gesellschaft ab, da sie ein halbherziges pädagogisches Konfliktlösungsmodell für gesellschaftliche Probleme sei, die [...] auf kulturelle Probleme reduziert werden würden“ (v. Berstorff / Plate 1997, S. 59).
In den Medien, in der Politik, in den Sozial- und Erziehungswissenschaften: Überall taucht das Schlagwort multikulturelle Gesellschaft auf und man macht sich oft keine Gedanken darüber, was eigentlich hinter diesem Begriff steckt bzw. stecken kann. Er wird oftmals als deskriptiver Ausdruck für die gesellschaftliche Situation, die durch Immigration und Globalisierung geprägt ist, benutzt: das Zusammenleben – besser gesagt das Nebeneinanderleben – von Menschen aus verschiedenen Kulturen. Was jedoch sozialpolitisch dahintersteht, wird selten gesehen. „Multi-Kulti“-Feste sind beliebte Gelegenheiten, Weltoffenheit und Toleranz zu zeigen; man schwärmt von der Abwechslung, die die multikulturelle Gesellschaft in den „grauen deutschen Alltag“ bringt. Diese Bereicherung des eigenen Lebens wird jedoch meistens von jenen betont, die nicht in Konkurrenz zu den „Fremden“ auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt stehen. Bei diesen Menschen nämlich ruft der Begriff auch Ängste und Ablehnung hervor (vgl. Krings 1990, S. 17).
In vielen Schriften zur interkulturellen Erziehung wird der Begriff multikulturelle Gesellschaft ohne nähere Erläuterung in den Kontext des Themas gestellt. Ob man unter ihm nun die Entwicklungstendenz der Gesellschaft versteht, eine Utopie oder eine neutrale Zustandsbeschreibung menschlichen Zusammenlebens, bleibt oftmals uneindeutig. Viele Menschen leben aufgrund von Einwanderungssituationen und globaler Vernetzung zwar in einer Gesellschaft, in der unterschiedliche kulturelle Symbole und Orientierungen nebeneinander stehen, die sich auch im Handeln der Gesellschaftsmitglieder zeigen. Doch bedeutet dieses nicht, daß alle kulturellen und ethnischen Gruppen politisch und gesellschaftlich gleichberechtigt sind. Deshalb möchte ich den Begriff multikulturelle Gesellschaft als eine Zielperspektive annehmen, „[...] die in ihrer Idealform noch nirgends auf der Welt zu finden ist“ (v. Bernstorff / Plate 1997, S. 62), zu deren Verwirklichung interkulturelles Lernen jedoch einen Beitrag leisten kann.[6] Ich lehne mich mit dieser Definition an die Ausführungen Frank-Olaf Radtkes (2000) an, der verschiedene Gesellschaftstypen skizziert, die er jeweils zum einen in eine politisch-öffentliche, zum anderen in eine private Sphäre einteilt. Ihm zufolge entspricht die multikulturelle Gesellschaft einem Modell, in deren öffentlicher Sphäre eine Gleichberechtigung aller Gruppen herrscht, in deren privater Sphäre jedoch eine Vielfältigkeit der Orientierungen zugelassen ist (vgl. ders., S. 105).
Zusammenfassendes:
Im Kapitel 2 sind folgende Kriterien für Kultur, kulturelle Identität und multikulturelle Gesellschaft herausgearbeitet worden:
1. Kultur impliziert vor allem Handlungs- und Orientierungsmuster, ist somit symbolisch.
2. Kultur manifestiert sich in Interaktion und Kommunikation, zeigt sich somit im Handeln ihrer Mitglieder.
3. Kultur ist prozeßhaft und sinnstiftend.
4. Kulturelle Identität ist nicht an nationalstaatliche Grenzen gebunden.
5. „Die multikulturelle Gesellschaft“ wird oftmals als undefinierter Begriff benutzt. Im Kontext meiner Arbeit sei sie als Programmatik zu verstehen.
3. Interkulturelles Lernen
Die Auseinandersetzung mit Migration, Einwanderung und somit einer pluralen Gesellschaft (s.o.) verlangt/e stets nach einem angemessenen pädagogischen Konzept für den Umgang zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. In diesem Kapitel werde ich mich deshalb mit verschiedenen Aspekten Interkulturellen Lernens auseinandersetzen, um die Voraussetzung für die Diskussion darüber zu schaffen, ob Theater als Lernarrangement einen Beitrag zu interkulturellen Lern- und Erfahrungsprozessen leisten kann (Kapitel 4). Dafür ist zu klären, was unter interkulturellem Lernen zu verstehen ist (Kapitel 3.1), wie und warum dieser pädagogische Bereich (in der BRD) entstand (Kapitel 3.2) und was dessen Ziele und Grenzen sind (Kapitel 3.3 und 3.4). Die beiden letzteren möchte ich im Kontext der Theaterpädagogik wieder aufgreifen, d.h. ich möchte untersuchen, mit welchen dieser Lernziele in interkulturellen Theaterprojekten zu rechnen sein kann (siehe Kapitel 4).
3.1 Interkulturelles Lernen als Teil sozialen Lernens
Lernen ist zu verstehen als dauerhafte Veränderung des Verhaltens bzw. des Verhaltenspotentials aufgrund von Erfahrungen und deren Verarbeitung (vgl. Hoppe 1984, S. 325). Der Ausdruck interkulturell beschreibt eine Bezugnahme der Kulturen aufeinander (vgl. Sting 1994, S. 87), d.h. interkulturelles Lernen behandelt somit die Optimierung der Wechselbeziehungen zwischen Angehörigen verschiedener ethnischer oder kultureller Gruppen (vgl. Wiemeyer 2001, S. 215).
In den 70er Jahren war Soziales Lernen die Schlüsselkategorie für eine kritische Auseinandersetzung mit sozialer Ungerechtigkeit und politischen Verhältnissen, aber auch für die Ausbildung bestimmter intrasubjektiver und intersubjektiver Fähigkeiten. Der Mensch sollte sowohl in seiner Selbstbestimmung, Selbstfindung und Mündigkeit Unterstützung erfahren (Emanzipation), als auch sich selbst als gesellschaftliches Wesen begreifen, welches eine Verantwortung im Zusammenleben mit anderen Subjekten der Allgemeinheit hat (Solidarität) (vgl. Weintz 2003, S. 76 ff.).
Im Prozeß des sozialen Lernens wurden zwei Lerntendenzen verfolgt: die gesellschaftskritische, die auf die Auseinandersetzung und Überprüfung der Normen und Werte des Makrokosmos zusteuerte und die gruppendynamisch-interaktionistische, die die Ausbildung von Sozialkompetenz im Mikrokosmos (unmittelbare soziale Umgebung) im Auge hatte (vgl. ders., S. 78).
„Soziales Lernen will demnach Einsichten in die Mechanismen von Interaktion und die möglichen Verhaltensspielräume des Subjekts bieten. Es will die Erfahrung der Durchschaubarkeit, Erklärbarkeit und Veränderbarkeit der sozialen Umwelt ermöglichen und ein Instrumentarium bereitstellen zur aktiven Mitgestaltung am eigenen Selbst und zur adäquaten Ausbalancierung von Autonomiebedürfnis und sozialem Anpassungsdruck“ (ders., S. 77).
Wesentliche Lerninhalte waren beispielsweise die Fähigkeit zur Rollendistanz, Empathie, Ambiguitätstoleranz (die Toleranz von auftauchenden Widersprüchlichkeiten), Kooperations-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, sowie Frustrationstoleranz (d.h. unerwartete und ggf. unangenehme Situationen und unbefriedigende Interaktionen auszuhalten) und die Darstellung der eigenen Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen (Selbstpräsentation) (vgl. ders., S. 79). Soziales Lernen ist auch heute noch Gegenstand vieler Bildungsbemühungen und dessen Absichten finden sich auch in besonderer Form in Konzepten interkulturellen Lernens wieder. Interkulturelles Lernen als Spezifikation sozialen Lernens verfolgt Ziele wie Toleranz gegenüber Anderen, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit im Hinblick auf eigene Sichtweisen und eigenes Verhalten, Kooperationsfähigkeit und Solidarität (vgl. Auernheimer 1990, S.171).[7]
Aufgrund meiner vorangegangenen Definition von multikultureller Gesellschaft als Programmatik (vgl. Kapitel 2.3), definiert sich nun interkulturelles Lernen als Weg hin zu diesem Ideal. Zwar entstanden die verschiedenen Konzepte interkulturellen Lernens bzw. interkultureller Erziehung – angefangen von der „Ausländerpäda-gogik“ bis hin zu aktuelleren Theorien – aufgrund der Tatsache von Zuwanderung, Globalisierung und somit einer dauerhaften pluralen Gesellschaft, die ihre Anforderungen auch an die Pädagogik stellte (s.u.). Doch nochmals möchte ich betonen, daß die Verwirklichung einer multikulturellen Gesellschaft noch ansteht und interkulturelle Erziehung somit nicht ihre Folge sein kann, sondern ihre Voraussetzung sein muß.
„Diese Teildisziplin der Erziehungswissenschaften versucht, im umfassenden Feld von Bildung und Erziehung angemessene Antworten auf die Herausforderung zu entwickeln und zu bündeln, die sich aus der Tatsache einer sich durch Migration, Globalisierung und europäischer Integration verändernden Gesellschaft ergeben“ (Leiprecht 2001, S. 20).
3.2 Die Entstehung der Konzeptionen
In den 50er / 60er Jahren erfolgte in der BRD aufgrund von wirtschaftlichen Interessen des Landes nach den Kriegsjahren eine Arbeitsimmigration von ausländischen „Gastarbeitern“. Der Aufenthalt dieser Menschen sollte durch die Erteilung einer Arbeitserlaubnis zeitlich begrenzt werden, doch schnell wurde klar, daß es aufgrund von Familienzusammenführungen weitere Generationen von ausländischen Familien geben würde und auf diese neue Situation auch pädagogisch reagiert werden müsse. Als zentrales Problem erwiesen sich damals die schlechten Deutschkenntnisse der ausländischen Kinder, die jedoch ebenfalls unter der deutschen Schulpflicht standen. Da ihr Leben in der BRD weiterhin als vorübergehend angesehen wurde, versuchte man nicht nur, ihnen die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern auch die Verkehrssprache ihres Herkunftslandes zu bewahren. Man setzte somit einerseits auf eine Integration in das deutsche Schulsystem, andererseits auf den Erhalt der „Rückkehrfähigkeit“ und somit der kulturellen Identität. „Kulturelle Identität bezog sich dabei in aller Regel auf die Vorstellung einer als homogen und statisch wahrgenommenen Herkunftskultur“ (Leiprecht 2001, S. 21). So wurden Lerngruppen gebildet, in denen die ausländischen Kinder unterrichtet wurden. Die sogenannte „Ausländerpädagogik“ wurde neben den schon bestehenden Konzepten der Jugend- und Arbeiterbildung zu einer neuen Zielgruppenpädagogik. Die KlientInnen waren ausschließlich die Kinder und Jugendlichen der Minoritäten (vgl. hierzu Haußmann 1993, S.130 ff. / Nieke 2000, S.14 ff.).
Viele der ursprünglichen „Gastarbeiter“ waren jedoch weit länger in der BRD beschäftigt, als ursprünglich geplant. So gestand man ihnen schließlich den Status der Einwanderer zu und sie wurden somit zum festen Bestandteil einer „multikulturellen Einwanderungsgesellschaft“[8], was zur Folge hatte, daß man am ursprünglichen Konzept der Ausländerpädagogik Kritik übte. Zum einen nahm man Anstoß an der Defizitorientierung dieses Ansatzes, in dem die ausländischen Kinder als „Mangelwesen“ gesehen wurden und die Majoritätskultur die Minoritätskulturen dominierte. Es folgte ein Paradigmenwechsel hin zu einer Differenzhypothese, d.h. zu der Beachtung und Akzeptanz von Unterschieden (vgl. v. Bernstorff / Plate 1997, S. 69). Es wurden immer mehr Forderungen auch nach gesellschaftlicher Gleichstellung und der Beseitigung von Benachteiligungen laut. Man betonte die Wichtigkeit von politischen Reformen in dieser Hinsicht und gleichzeitig die Grenzen der Pädagogik, Diskriminierungen entgegenzuwirken.
„Danach wurde gegenüber allen sozialpädagogischen Hilfsangeboten die Sorge geäußert, durch solche Hilfe könnte die Aufmerksamkeit von den soziostrukturellen Ursachen der sozialen Mißstände abgelenkt werden, während die Hilfen lediglich die Auswirkungen dieser Mißstände zu lindern in der Lage seien“ (Nieke 2000, S. 16).
Eine Assimilation an „die deutsche Kultur“ wurde kritisiert und den Minoritäten die Gleichberechtigung ihrer Kulturen zugesprochen. Im gleichen Atemzug rückten somit auch die Kinder und Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft in den Blick der Pädagogik, da auch sie natürlich mit den neuen Anforderungen und Problemen einer pluralen Gesellschaft umzugehen lernen mußten. Allerdings setzte man auch weiterhin auf die Förderung ausländischer Kinder.
So entstanden Ende der 70er Jahre die ersten Konzepte zur interkulturellen Erziehung. In den 90er Jahren wurde der Blick erweitert auf die Probleme von Minderheiten generell: Flüchtlinge, sprachliche Minderheiten und strukturell benachteiligte Gruppen (Frauen, Alte, Homo-, Bi- und Transsexuelle etc.). Von diesen Perspektiven aus wurde gemeinsame Kritik an herrschenden Normalitätsvorstellungen in der Gesellschaft geübt und die Beseitigung von Benachteiligungen überhaupt gefordert (vgl. Leiprecht 2001, S. 24 / Nieke 2000, S. 18).
3.3 Zwei Grundrichtungen: Begegnungspädagogik und Konfliktpädagogik
Interkulturelle Bildungsbemühungen lassen sich oftmals zwei unterschiedlichen Richtungen zuordnen: Der Begegnungspädagogik oder der Konfliktpädagogik. Im folgenden möchte ich diese kurz skizzieren:
In konfliktpädagogischen Maßnahmen geht es in erster Linie um den Abbau von (institutionellen) Benachteiligungen, also um die Herstellung von Chancengleichheit und die Bekämpfung von Vorurteilen und Rassismen. Oftmals sind Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit durch politische Bildung Gegenstand konfliktpädagogischen Vorgehens. Alle Kulturen sollen in ihrer Verschiedenheit verstanden und akzeptiert werden, Kulturalität tritt jedoch in den Hintergrund; es geht um eine Gleichwertigkeit aller kulturellen Lebensweisen (vgl. Ostertag 2001, S. 10). Die Psychologie sieht Fremdenfeindlichkeit als eine mögliche Folge von subjektiv wahrgenommener Konkurrenz bzw. Bedrohung der eigenen Gruppe durch eine fremde (vgl. Kapitel 3.4.3.2). Diesem Konkurrenzgefühl entgegenzuwirken machen sich konfliktpädagogische Konzepte zur Aufgabe (vgl. Hohmann 1987, S. 103).
Begegnungspädagogik „[...] ist in ihrer simpelsten Form zu beschreiben als die schlichte Repräsentation einer fremden Kultur in einem mono- oder multikulturellen Zusammenhang“ (ebda.).
In begegnungspädagogischen Maßnahmen steht das Kennenlernen fremdkultureller Gesellschaften und der Umgang mit Befremdung im Mittelpunkt des Interesses. Durch solche interkulturellen Kontakte (z.B. interkulturelle Feste) soll den Menschen die eigene Kulturalität bewußt und der kulturelle Horizont erweitert werden. Kulturelle Vielfalt gilt hier als Bildungschance und Bereicherung des eigenen Weltbildes (vgl. Ostertag 2001, S. 9f.). Dieser Ansatz läuft jedoch Gefahr – solange er nicht mehr bewirkt als die „kulturelle Bereicherung in einer harmonischen Atmosphäre“ (Hohmann 1987, S. 103) – keinen wirklich kulturellen Austausch zu ermöglichen. In der Tat werden oftmals kulturelle Traditionen und Rituale (vom Essen über Musik, Tänze und Kleidung) dargeboten, die nur noch im entferntesten Sinne etwas mit der Lebenswelt der Menschen zu tun haben. Es handelt sich hierbei oftmals um konservierte Kulturmerkmale, die durch ihre Exotik auf andere Menschen anziehend und spannend wirken können (siehe Kapitel 3.4.1.3), eine wirkliche Verständigung jedoch kaum ermöglichen. Nehmen wir das Beispiel Tourismus. Auch wenn es ein sehr extremes und simples ist, kann der Sachverhalt daran sehr gut verdeutlicht werden:
In vielen Reiseangeboten steht der Besuch von „Ureinwohnern“ auf dem Programm, welche die TouristInnen an ihrem „ursprünglichen Leben“ mit seinen Festen, Ritualen und Zeremonien teilhaben lassen. Daß diese Veranstaltungen meist nur allein wegen der TouristInnen und „deren Geldbeutel“ inszeniert werden, ist vielen nicht bewußt. Doch auch wenn es sich um „echte“ kulturelle Akte handelt, findet auf Seiten der BesucherInnen keine wirkliche Veränderung der eigenen Handlungsorientierung im Sinne der interkulturellen Erziehung statt. Es ist Konsum, eine Alltagsunterbrechung, das Dargebotene ist – wenn überhaupt – selektiert und für die meisten Menschen sinnentstellt, nicht nachvollziehbar (vgl. Ostertag 2001, S. 118f.). Das Fremde dient hierbei allein der Selbstverwirklichung der eigenen Person durch dessen Vereinnahmung, Fremdenfeindlichkeit und -angst sind damit kaum zu bekämpfen (vgl. dies., S. 114).
3.3.1 Universalismus vs. Relativismus
In den beiden Grundrichtungen interkultureller Erziehungskonzepte, Konfliktpädagogik und Begegnungspädagogik, lassen sich unterschiedliche pädagogische Paradigmen erkennen, mit der Vielfalt einer pluralen Gesellschaft und deren divergierenden Handlungsorientierungen umzugehen: Kulturrelativismus und Kulturuniversalismus. Zwar ist keines dieser Konzepte eindeutig einer universalistischen oder einer relativistischen Theorie zuzuordnen, dennoch lassen sich Tendenzen ausmachen:
Bei begegnungspädagogischen Maßnahmen des interkulturellen Lernens werden Gemeinsamkeiten der Kulturen ins Zentrum des Interesses gestellt. Vertreter eines universalistischen Verständnisses von Kultur unterstellen allgemein-menschliche Grundwerte, die in allen Kulturen zu finden sein müssen (vgl. Ostertag 2001, S. 13), Verschiedenheit ist somit nichts anderes als die „Modifikation des Einen“ (Mersch 1997, S. 32). Deshalb sehen sie es als pädagogische Aufgabe an, eben diese Gemeinsamkeiten hervorzubringen und als allgemeingültige Normen und Werte zu stärken, also Einheit zwischen den Kulturen zu stiften.
Ein Beispiel hierfür sind die europäischen Menschenrechte. Ohne diese Errungenschaft „unserer Kultur“ in Frage stellen zu wollen, möchte ich auf eine Problematik aufmerksam machen, die sie nach relativistischer Perspektive (s.u.) mit sich bringt: Was für „uns“, d.h. für die abendländische Kultur, als selbstverständliche Wertvorstellung gilt, daß der Mensch z.B. in seinen Rechten auf Leben, Unversehrtheit, Meinungsfreiheit etc. geschützt wird, ist kein naturgegebenes, universelles Kulturmerkmal, sondern Ergebnis einer langen Geschichte des Kampfes und der Aufklärung. Trotzdem halten viele Menschen diese für das einzig richtige Fundament einer funktionierenden (demokratischen) Gesellschaft. Gleichzeitig wird oftmals unterstellt, daß alle vernunftbegabten Menschen den Willen zum politischen Handeln im Sinne dieser Menschenrechte hätten und demzufolge werden alle gesellschaftlichen Ordnungen, die diese „verletzen“, verurteilt (vgl. Wimmer 1997, S. 122).
Solche Versuche, europäische Werte und Normen als Maßstab für die ganze Welt gelten zu lassen (Eurozentrismus), werden – oftmals nicht umsonst – als westlicher Kulturimperialismus kritisiert (vgl. Ostertag, S. 13). „Die neue Menschenrechtspolitik erscheint westlichen Intellektuellen so attraktiv, weil sie sich ins Projekt der Aufklärung einschreiben läßt, als dessen Träger sich die Intelligenz seit jeher begriff“ (Wimmer 1997, S. 122).
Tatsächlich wird auf diese Weise die Möglichkeit ignoriert, daß gleiche Werte unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden und daß in anderen Kulturen uns fremde Werte als ebenso selbstverständlich gelten können.
„Diese Position übergeht die Tatsache, daß dort, wo sie von universellen Normen redet, die Praxis zeigt, daß diese immer wieder in Frage gestellt werden, sie also keineswegs selbstverständlich für alle Menschen gleichermaßen gültig zu sein scheinen“ (v. Berstorff / Plate 1997, S. 49).
Wimmer (1997) nennt einige Beispiele dafür, daß der Menschenrechtsgedanke keineswegs in jedem gesellschaftlichen System wiederzufinden ist,[9] daß viele Menschen auf dieser Welt ein anderes Rechtsempfinden haben und sie deshalb nicht als universell angesehen werden können. „Menschenrechte sind also historisch gesehen zunächst einmal ein westliches Projekt“ (ders., S. 123f.).
So zentriert sich der Maßstab für Entwicklung und Zivilisation um einen westeuropäischen Kern, d.h. Europa wird zum normgebenden Teil des Universums.[10]
Diesem Eurozentrismus entgegenzuwirken, dafür plädieren Erika Schmidt und Milena Vogt (2000) in ihrer Projektbeschreibung einer deutsch-zimbabwischen Theaterarbeit:
„Im Zeitalter der Globalisierung von vielen verschiedenen kulturellen Zentren auf der ganzen Welt auszugehen, und damit die bislang an die Peripherie gedrängten Länder der sogenannten ,3. Welt’ [...] mehr kulturellen Einfluß nehmen zu lassen, halten wir für eine zukunftweisende wichtige Veränderung unseres Blickwinkels“ (dies., S. 316).
Bei konfliktpädagogischen Konzepten geht es eher um die Akzeptanz von Unterschieden und die Beseitigung von Benachteiligungen (s.o.). Der Kulturrelativismus legt gerade Wert auf die Verschiedenheit von Kulturen und die Beibehaltung der Vielfalt (vgl. Ostertag 2001, S. 81). Er betont die Einzigartigkeit jeder Kultur und ebenso deren Norm- und Wertesysteme (vgl. Nau 1997, S. 113). „Diese Systeme [sind] nur systemimmanent verständlich“ (ebda.). Da also nicht bestimmt werden kann, ob eine Kultur als wertvoller anzusehen ist als eine andere, müssen beide – nach dieser Theorie – als gleichwertig akzeptiert werden (vgl. Ostertag, S. 13), da allen Werten der gleiche Anspruch auf Geltung zugesprochen wird. Kulturimperialistische Tendenzen, beispielsweise der Universalitätsanspruch der westlichen Wissenschaft, Philosophie und Rechtsauffassung (s.o.), werden kritisiert und jeder Kultur wird das Recht zugesprochen, nach ihren eigenen Werten und Normen zu leben (vgl. Wimmer 1997, S. 121).
Das Problem dieser Theorie ist jedoch, daß sie eine gewisse Beliebigkeit zur Folge hat, welche in der Praxis zu Handlungsunfähigkeit führt (vgl. Ostertag 2001, S.82). Bei Konflikten, die aufgrund divergierender kultureller Normen auftreten, bliebe eine Lösung dieses Konflikts aus, da beide Sichtweisen als gleichberechtigt akzeptiert werden müßten. Der deskriptive Relativismus hat so notwendigerweise einen ethischen Relativismus zur Folge (vgl. Wimmer 1997, S. 124). „Jede Kultur kann also nur über die ihr immanenten Werte erschlossen werden und nur in diesem ethischen Horizont machen moralische Aussagen einen Sinn“ (ders., S. 126). Außerdem weist Ostertag (2001) darauf hin, daß diese Position einen Nährboden für fundamentalistische Strömungen jeglicher Art bietet, „insofern [diese, C.R.] für sich relativistische Schützenhilfe in Anspruch nehmen, obwohl es doch gerade ihre ideologische Selbstherrlichkeit und Intoleranz ist, die den Kulturrelativismus außer Kraft setzt und ad absurdum führt“ (dies., S.91).
3.3.2 Zur Annäherung an eine Lösung der Universalisum-Relativismus-Debatte
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, daß beide radikalen Positionen kritisierbar sind:
„Radikaler Relativismus ist jeglicher Urteilskraft enthoben und vermag kulturelle Vielfalt und Verschiedenheit lediglich kritiklos hinzunehmen; unkritischer Universalismus hingegen droht, fremde Kulturen in kulturimperialistischer Manier zu unterwerfen“ (Ostertag 2001, S. 84).
Wie ist nun mit dieser Problematik umzugehen?
„Die Vereinbarkeit universaler Normen mit kultureller Vielfalt kann zwar diskutiert, jedoch nur schwer eingelöst werden“ (v. Bernstorff / Plate 1997, S. 51).
Im Rahmen vieler kulturpädagogischer und kulturpolitischer Maßnahmen wird oftmals versucht, die Ziele beider Richtungen zu vereinen, d.h. die (scheinbaren) Gemeinsamkeiten der Menschen mit kulturspezifischer Folklore zu verbinden, „[...] so daß im Alltag jeweils die eine oder die andere Einstellung Anwendung finden kann, je nach dem, welche dem Vertreter gerade den größten Nutzen oder Lustgewinn zu bringen vermag“ (Krings 1990, S. 18). Dies ist offensichtlich nur eine halbherzige Konfliktlösungsstrategie.
Ich möchte im folgenden kurz die Argumentation Wimmers (1997) vorstellen, der die o.g. Problematik durch einen „pragmatischen Universalismus“ (vgl. Nau 1997, S. 115) zu lösen versucht. Dieser sieht das Aushandeln von Bedeutungen als Grundlage interkultureller Verständigung und legt diesem Konzept einen modifizierten Kulturbegriff zu Grunde (vgl. ebda.).
Wimmers (1997) Kritik am Kulturkonzept des Relativismus[11] umfaßt folgende Punkte:
1. Es basiert auf einer Homogenitätsvorstellung (s.o.) von Kulturen und übersieht intrakulturelle Variationen (vgl. ders., S. 126). „Die Ethnozentrismusproblematik wäre also auch für Verständigungsprozesse innerhalb einzelner Kulturen zu diskutieren und löst sich somit in der wissenssoziologischen Problematik der Standortgebundenheit des Denkens [...] auf“ (ders., S. 127, Hervorheb. im Original).
2. Individuen wird das Vermögen abgesprochen, kulturelle Normen und Regeln in Frage zu stellen, d.h. ihnen wird unterstellt, nur nach diesen zu handeln, zu fühlen und zu denken. Wimmer hingegen gesteht ihnen diese kognitive Kompetenz zu (vgl. ebda.).
Wimmers Fazit aus diesen Kritikpunkten ist folgendes:
Zwar sind alle Menschen zum größten Teil durch kulturspezifische Bedingungen geprägt, dennoch verfügen sie alle über kognitive Fähigkeiten, diese nach Kosten und Nutzen zu hinterfragen und zu modifizieren (Pragmatik der kulturellen Produktion) (vgl. ders., S. 133). Dieses ist ein universales Vermögen der Menschen, Kultur muß daher als „Aushandeln von Bedeutungen“ gesehen werden (vgl. ders., S. 128). Solch ein „kultureller Kompromiß“ (ders., S. 130) beinhaltet aber auch stets die Ausschließung von denjenigen Menschen, die nicht an der Aushandlung partizipieren konnten. Er konstituiert somit soziale Schließung und Grenzen sozialer Gruppen, die andere als nicht zugehörig definieren und Distanz und Ausgrenzung erzeugen (vgl. Kapitel 3.4.1.1).
„Wollen wir das bisher Gesagte auf eine Kurzformel bringen, so wäre Kultur als ein offener und instabiler Prozeß des Aushandelns von Bedeutungen zu definieren, der kulturell geprägte, aber kognitiv kompetente Akteure in unterschiedlichen Interessenlagen zueinander in Beziehung setzt und bei einer Kompromißbildung zur sozialen Abschließung und entsprechenden kulturellen Grenzmarkierungen führt“ (Wimmer 1997, S. 132).
Somit sieht Wimmer die kulturelle Landschaft weniger als Flickenteppich (so wie es die Ethnologie tut), sondern als „Patchwork-Decke“ mit fließenden Übergängen (vgl. ebda.). Da nun alle Menschen ihre Perspektive als gültig etablieren wollen, müssen sie dieses durch verständigungsorientiertes Aushandeln erreichen.
Betrachten wir rückblickend noch einmal die Menschenrechtsproblematik, würde dies folgendes bedeuten:
Die Menschenrechte sind im Aufklärungsprozeß entstanden, somit bei uns akzeptiert, aber keinesfalls universell gültig. Wir können nur hoffen, daß sie irgendwann eine weitere Verbreitung erleben und von vielen Menschen angenommen werden. Dazu benötigen wir Argumente, um das für uns Sinnhafte darin zu beschreiben und einen Aushandlungsprozeß zu führen (vgl. Wimmer 1997, S. 134). Dies gelingt jedoch nur durch gemeinsame Interessen, einen globalen Kompromiß, und nicht durch neokoloniale Überstülpung (vgl. ders., S. 135).
„Für eine legitime und wirksame Menschenrechtspolitik wird deshalb die Frage entscheidend, ob ,unser’ universalistisches Projekt auch anderswo verankert ist, ob sich in einem Land des Südens Bevölkerungsgruppen finden lassen, die sich in irgendeiner Form als zum ,wir’ zugehörig betrachten, so daß es gerechtfertigt erscheinen könnte, in ihrem Namen einen Einfluß auf den Gang der Entwicklungen zu nehmen. Das Recht auf eine ,andere Entwicklung’, auf ein Ausklinken aus einer neuen Weltordnung muß allen offenstehen [...]. Gar als weltmissionarisches Universalsubjekt aufzutreten und über solche Erwägungen einfach hinwegzugehen, verbieten die Erfahrungen der ehemaligen Kolonien allemal“ (ebda.).
Zusammenfassend ist nun festzuhalten, daß das Problem des ethischen Relativismus nur dadurch zu beseitigen ist, daß die Wertevielfalt unserer Welt (deskriptiver Relativismus) nicht notwendigerweise die absolute Toleranz jeglicher Einstellungen (normativer Relativismus) zur Folge haben muß, sondern daß es ein Aushandeln über kulturelle Bedeutungen geben kann (vgl. ders., S. 134).
Ostertag (2001) kommt auf ähnliche Ergebnisse in der Auseinandersetzung mit Schallers Kommunikativer Pädagogik: Schaller versteht „[unter] Erziehung [...] die Produktion und die Vermittlung von ,humaner’ Handlungsorientierung in symmetrischen Prozessen gesellschaftlicher Interaktion unter dem Horizont von Rationalität[12] “ (Schaller 1978, S. 80). Wer definiert aber nun, was eine menschliche Lebensführung ist?
„Pauschal ließe sich festhalten, der Sinn von Erziehung und Bildung erfülle sich darin, dass wir Menschen in unsere Menschlichkeit hineinfinden. Die Frage jedoch, wie denn diese Menschlichkeit aussehe bzw. auszusehen habe, erfordert unabschließbare Kommunikationsprozesse, in denen der Sinn von Menschlichkeit immer wieder aufs Neue gemeinsam hervorgebracht wird“ (Ostertag 2001, S. 36).
Schallers Verständnis von einem idealen Kommunikationsprozeß ist das gemeinsame, gleichzeitige Agieren aller Interaktionspartner, die eben durch dieses gemeinsame Handeln auch den Verlauf, die Richtung der Interaktion bestimmen
(vgl. Schaller 1978, S. 45)[13] und ist somit vergleichbar mit Wimmers Verständnis des Aushandelns von Bedeutungen (s.o.).
Wichtig im Sinne der Kommunikativen Pädagogik ist das Offenlegen aller Interessen, die Anführung der Argumente aller Sichtweisen und nicht der Versuch, beschwichtigend zwischen divergierenden Meinungen zu vermitteln. „Maßgeblich ist hier nicht, was der oder jener will, weil er der oder jener ist [...], sondern allein die Frage: Was steckt dahinter, was ist los damit?“ (Schaller 1978, S. 53, Hervorheb. im Original). Somit ist das Ziel des rationalen Diskurses weder das Durchsetzen der eigenen Interessen, noch das einlenkende Respektieren der anderen Meinung aus dem Wunsch heraus, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es geht vielmehr um „[die] Überprüfung und Revision der je eigenen Positi-
[...]
[1] Und die meist undefiniert als „multikulturelle Gesellschaft“ bezeichnet wird (vgl. Diskussion in Kapitel 2.3).
[2] Ich möchte hierzu anmerken, daß die Auseinandersetzung mit dieser Diskussion nur in Ansätzen zu leisten ist. Es geht mir bei meinen Ausführungen vor allem um die Verdeutlichung der Tatsache, daß der Begriff „multikulturelle Gesellschaft“ oftmals als undefiniertes Schlagwort benutzt wird und ich es für notwendig halte, diesen in der Beschäftigung mit interkulturellen Lernzielen vorab zu definieren. Eine intensive Auseinandersetzung bietet u.a. die Aufsatzsammlung von Robertson-Wensauer, Caroline Y. (Hrsg.) (2000) Multikulturalität - Interkulturalität? Probleme und Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft. 2. überarb. Auflage. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
[3] Identität beinhaltet meiner Meinung nach jedoch neben dem bewußten Bild der eigenen Person auch unbewußte Persönlichkeitsmerkmale.
[4] Hiermit meine ich vor allem die Vernetzung von Informations- und Kommunikationsstrukturen.
[5] Dieser Begriff ist eigentlich auch unzulänglich, da Herkunftskulturen ebenfalls nicht in sich homogen sind.
[6] Hier sei anzumerken, daß pädagogische Bemühungen ohne Unterstützung politischer Entscheidungen wohl eher unzulängliche Fortschritte bieten. Obwohl ich mich in meiner Arbeit in erster Linie mit pädagogischen Versuchen zur Verwirklichung einer multikulturellen Gesellschaft auseinandersetze (Kapitel 3), ist mir sehr wohl bewußt, daß die Politik einen Großteil dieser Arbeit zu leisten hat.
[7] Detailliertere Ziele beschreibe ich in Kapitel 3.4.
[8] Den Begriff „multikulturelle Einwanderungsgesellschaft“ verwende ich hier entgegen meiner eigenen Definition. Ich möchte dadurch die damalige Argumentation nachzeichnen.
[9] Z.B. das Kastensystem in Indien, welches unserer Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen widerspricht, oder Bestrafungsrituale bei den Aborigines, die die bei uns akzeptierte Freiheitsstrafe für manche Verbrechen als nicht angemessen erachten (vgl. Wimmer 1997, S. 123).
[10] Kimmerle (1997) diskutiert dieses Phänomen am Beispiel der Philosophie: Er kritisiert die Definition von Philosophie als Ergebnis der europäischen Aufklärung und somit als höchste Entwicklungsstufe der Geschichte, an der sich alle anderen Kulturen zu messen haben. Der Kolonialismus wurde somit vor allem als „Entwicklungshilfe“ verstanden, um diesem Ideal näher zu kommen (vgl. ders., S. 91).
Er stellt die These auf, daß alle Kulturen Philosophie haben, und daß man diese nicht an einem Standort (z.B. Europa, Asien), einer Zeitpunktbestimmung (griechische Antike) und einer Schriftkultur festmachen kann. Trotzdem, so Kimmerle, habe die weit verbreitete Meinung, Philosophie an sich entstamme der abendländischen Kultur, einen starken Einfluß auf unser eurozentrisches Weltbild: „Es ist immer noch sehr schwierig, anders zu denken, den Rassismus wirklich zu überwinden und in der Kulturphilosophie die Zweiteilung in westliche und nicht-westliche Kulturen hinter sich zu lassen“ (ders., S. 91f.).
[11] Dieses Kulturkonzept geht, wie oben erwähnt, davon aus, daß jede Kultur eine homogene Einheit aus Religion, Technik, sozialer Organisation etc. ist, welche durch Normen und Werte integriert werden. Somit sind Kulturen nicht vergleichbar und die soziale Welt zeigt sich eher als Flickenteppich aus diesen (vgl. Wimmer 1997, S. 125).
[12] Rationalität in Schallers Sinne beschreibt eine menschliche Lebensführung, eine „historisch-gesellschaftlich vermittelte Lebensbedingung des modernen Menschen“ (ders., S. 49, Hervorheb. im Original).
[13] Rationale Kommunikation ist demzufolge eine „Ko-Operation“ zwischen den Individuen und der Welt, eine „Ver-Handlung“, die nur ohne Autorität möglich ist, welche auf ein vorgefertigtes Ergebnis hinzusteuern versucht. Alle Verhandlungspartner sind in diesem Interaktionsprozeß trotz individueller Beiträge zu diesem (abhängig von Vorwissen, Erfahrung, Standpunkt, Interesse) gleichberechtigt (vgl. Schaller 1978, passim). Im Gegensatz zur autoritären Erziehung, die ein vorgefertigtes Normensystem ohne dessen Überprüfung mit Hilfe von Sanktionen in einem linearen Kommunikationsakt vermittelt (vgl. ders., S. 115), nennt Schaller die Kommunikative Pädagogik „nicht autoritär“ (ders., S. 116). Nicht autoritär soll jedoch weder mit laissez-faire verwechselt werden, noch ist es die Umkehrung des autoritären Verhältnisses der Beteiligten (vgl. ebda.). Diese Reaktion auf Unterdrückung lehnt beispielsweise auch Freire (1971) in seiner Pädagogik der Unterdrückten vehement ab. Er betont, daß „die Unterdrückten [...] [in ihrem Kampf um Befreiung] nicht ihrerseits Unterdrücker der [ehemaligen] Unterdrücker werden [dürfen]“ (ders., S. 38), da sie sonst jenes Verhalten imitierten, unter dem sie zuvor selbst gelitten haben.
Die Tatsache, daß Erziehung nicht in die Hand fremder Autoritäten gelegt werden soll, bedeutet jedoch nicht, daß deren Argumente nicht gelten. Sie sind ebenso Teil des rationalen Diskurses. Auch muß es etwas Autoritatives, etwas Leitendes, geben: den Kommunikationsprozeß (vgl. Schaller 1978, S. 114ff.). „Erziehung ohne Verbindlichkeiten, ohne Autoritatives (im Gegensatz zum Autoritären) gibt es nicht“ (ders., S. 116).
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Päd. Cornelia Rössler (Autor:in), 2005, Theater als interkultureller Lernort: Ästhetische, (psycho-) soziale und interkulturelle Erfahrungsmöglichkeiten in theaterpädagogischen Prozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70155
Kostenlos Autor werden
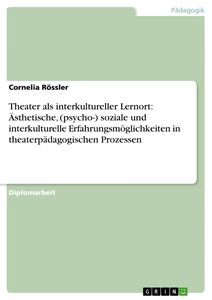


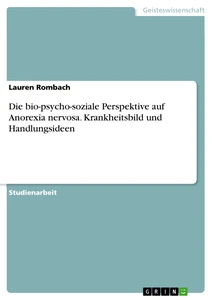

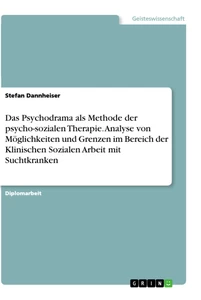



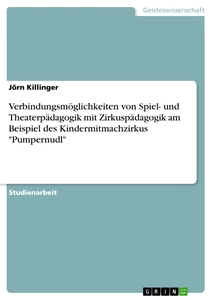










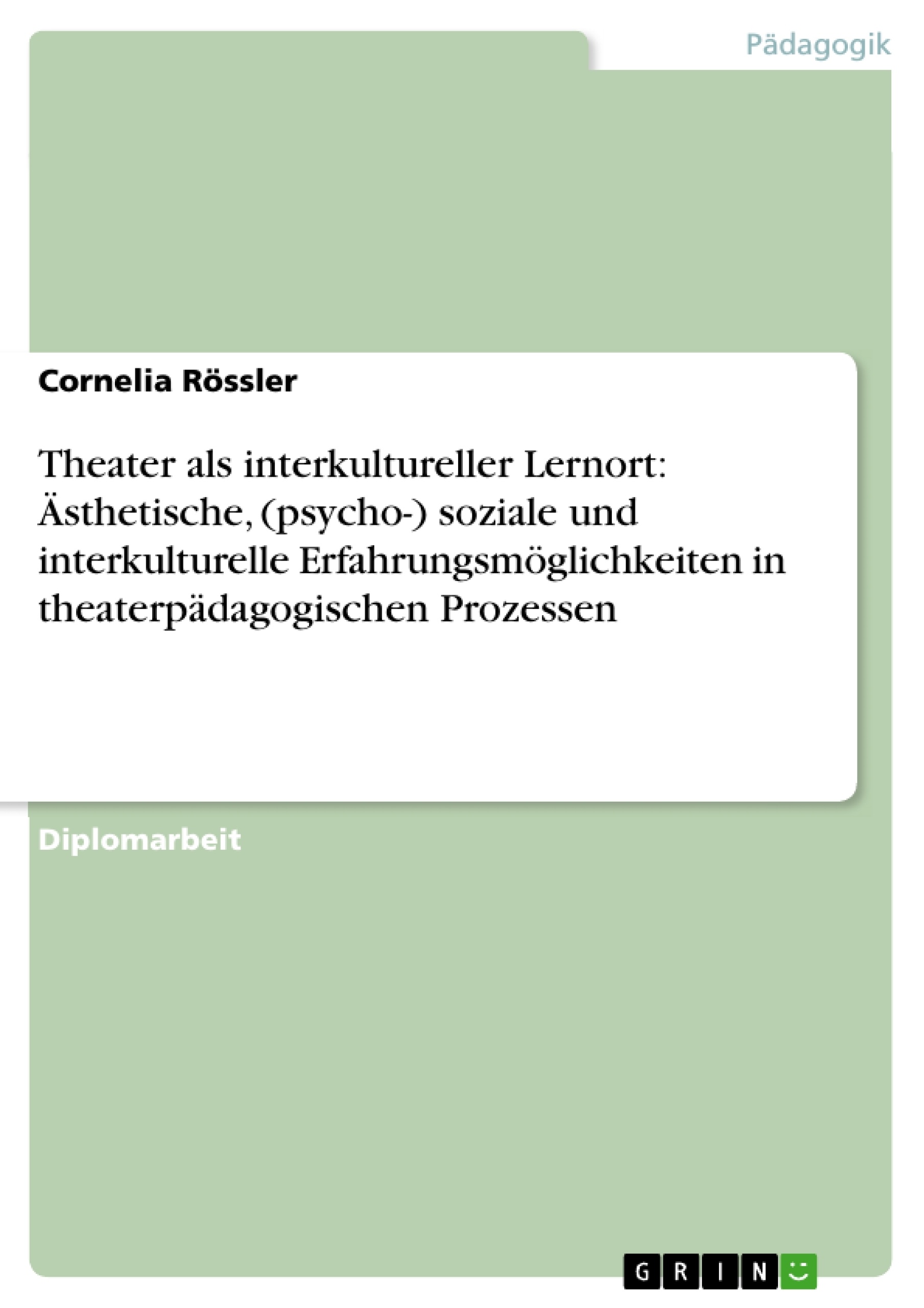

Kommentare